Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Rahmenbedingungen und Herkunft des dekonstruktivistischen Diskurses 4
II. Die Dekonstruktion unter Bezugnahme auf Nietzsche
III. Derridas Sporen und Nietzsches Zarathustra – Gedankenspiele in der Differenz
IV. Schlußbetrachtung - Kritik
Einleitung
Als Thomas Mann am 29.Mai 1934 zum ersten Mal amerikanischen Boden betritt, liegt eine zehntägige Schifffahrt hinter ihm, auf der er sich die Zeit mit dem Lesen des „Don Quijote“ verkürzte. Jene Überfahrt zu einem Kontinent, auf dem er bald seine zweite Heimat finden und einen neuen Lebensabschnitt beginnen sollte, markierte für ihn eine Phase des Hinübers und des Wandels im geographischen, politischen und werkgeschichtlichen Sinne. Und gerade in dem Augenblick, in dem er die Freiheitsstatue erblickt und sich aus dem Morgennebel langsam die Hochhäuser von Manhattan lösen, erinnert er sich seines Traumes der vergangenen Nacht: Er träumte von Don Quijote und sprach mit ihm; doch welche Züge trug dieser? Er hatte einen dicken, buschigen Schnurrbart, eine hohe, fliehende Stirn und unter ebenfalls buschigen Brauen graue, fast blinde Augen. Er nannte sich nicht den Ritter von den Löwen, sondern Zarathustra. An der Stelle des für Thomas Mann entscheidenden Übergangs, zeigt sich ihm Friedrich Nietzsche in der Gestalt des tragischen Ritters. Was sich in diesem Traum Thomas Manns symbolisch widerspiegelt, ist heute geschichtliche Realität. Der Name Friedrich Nietzsche steht für einen „ Übergang und Untergang“, für einen Umschwung in der Geschichte des abendländischen Denkens. Für Habermas präsentiert Nietzsche die Drehscheibe in die sich ihrer selbst noch ungewissen Postmoderne. Nach Heidegger denkt jeder Heutige notwendig "im Licht und Schatten Nietzsches – mag er sich dessen bewußt werden oder nicht“ (Heidegger, „Zur Seinsfrage“, in: „Wegmarken“, 252); und auch bei Jaspers wird Nietzsche zu dem Philosophen, ohne den die Philosophie des 20. (Und wohl auch 21.) Jahrhunderts ihr Problem nicht findet:“niemand kann ohne Nietzsche eigentlich vom Dasein wissen und im Philosophieren eigentlich wahrhaftig sein.“ (Jaspers, „Nietzsche“ Vorwort)
So vielfältig die Stellungnahmen zu Nietzsche auch in gegenläufiger Weise im ausgegangenen Jahrhundert waren, so kann sich doch heute niemand mehr der durch ihn ausgelösten Erschütterung im Selbstvertrauen des über sich selbst reflektierenden Denkens entziehen. Die Anzahl der Veröffentlichungen zum Thema Nietzsche ist mittlerweile nur schwerlich noch zu überblicken; und dies nicht nur in Deutschland, sondern ganz besonders auch in Frankreich. Unter den vielen seit etwa Anfang der 70er Jahre publizierten französischen Studien über Nietzsche, erschienen auch einige Bücher, die einen radikal neuen Ansatz in der Nietzscheforschung fordern. Diese Autoren, die sich mehr oder weniger zu den intellektuellen Gruppen um die Zeitschriften Tel Quel und Poetique zählen oder gezählt haben, konzentrieren sich auf die Schreibweise Nietzsches und sein Spiel mit der Sprache, worin sie den wichtigsten Inhalt seiner Werke sehen. Im Rampenlicht der französischen Philosophie und Literaturwissenschaft stehen zur Zeit die Werke Derridas, die sich ebenfalls fast ausschließlich mit der Problematik der Sprache befassen. Seine Arbeiten werden ähnlich kontrovers diskutiert und teils heftig kritisiert, wie seiner Zeit die Arbeiten Nietzsches. Von Derrida ausgehend sollen seine auf Nietzsche verweisenden Spuren nun re-konstruiert werden, um die Voraussetzungen und Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten einer de-konstruktiven Nietzsche – Lektüre anzudeuten.
I. Rahmenbedingungen und Herkunft des dekonstruktivistischen Diskurses
Derridas Denken, so wie das fast aller französischen Geisteswissenschaftler, ist sehr eng mit dem Strukturalismus verbunden, der als grundlegend für den Gedankenhorizont im Frankreich des 20.Jahrhunderts angesehen werden kann. Traditionell, aber fehlerhaft, nennt man strukturalistisch die freilich sehr verschiedenen Arbeiten Foucaults, Althussers, Lacans, Derridas und, in Bezug auf das vorliegende Thema, einige Interpretationen Nietzsches von deren Anhängern.[1] Als struktural könnte man im weiteren Sinne jede Analyse eines Werkes (oder sonst irgend eines anderen Gegenstandes) bezeichnen, die eine Struktur, d.h. ein Netz innerer Verhältnisse in ihm erscheinen läßt, welche bestimmte Elemente miteinander verbinden.[2] Seine gedanklichen Grundlagen und seine terminologische Bestimmtheit zieht der Strukturalismus aus dem Werk „Cours de linguistique generale“ von de Saussure. De Saussure betrachtet die Sprache als ein System von völlig arbiträren Zeichen. Das linguistische Zeichen vereint nicht ein Ding und einen Namen, sondern ein Konzept (Signifikat) und ein akkustisches Bild (Signifikant). Bezeichnend, und auch für Derrida von größter Bedeutsamkeit, ist de Saussures Feststellung, daß das Verhältnis zwischen Ton (Bild) und Konzept arbiträr ist. Der Ton selbst hat keine Bedeutung, denn nur durch den Unterschied zwischen Worten entstehen Bedeutungen. Die Sprache sieht er als ein System von verschiedenen Zeichen, die in einer geregelten Beziehung zueinander stehen. Die Regeln der Sprache sind für de Saussure ähnlich denen eines Spiels. Das Problem der Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit wird von de Saussure nicht spezifisch behandelt, aber implizit kann das Zeichensystem als autonom betrachtet werden. Aufgrund seiner Überlegungen über die Sprache entwarf er eine generelle Wissenschaft der Zeichensysteme, die er Semiologie nannte.[3] Die Sprache ist dabei nur ein Zeichensystem unter vielen. Sie kann jedoch aufgrund ihrer herausragenden Stellung in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und ihrer Kultur einen besonderen Status für sich beanspruchen.
Die strukturale linguistische Analyse zeigt demnach an dem Körper (Sprache), den sie untersucht, Systeme von Beziehungen zwischen Elementen auf, die an sich keine natürliche bzw. immanente Bedeutung besitzen, sondern in differentiellen Oppositionen stehen und nur Sinn tragen, insofern sie sich von einem Gegenelement absetzen. Die Struktur ist somit das System der Regeln der Opposition der Elemente, das das Funktionieren der Sprache willkürlich bestimmt. Die einzelnen Elemente, an sich ganz inhaltslos, entnehmen ihren Wert lediglich dem System, an das sie gebunden und in dem sie entgegengesetzt sind, gemäß einer sozusagen willkürlichen Ordnung, d.h. einer Ordnung, die von keiner Natur oder keinem Sinn außerhalb des Systems bestimmt wird. Den Elementen wird ihr Sinn notwendig aus purer Konvention und nicht von irgendeiner Essenz der Dinge, sondern von dem besonderen Zusammenhang des Systems verliehen. Jedes Element wird in jedem anderen Zusammenhang einen anderen Sinn bekommen.[4] Saussures Bestimmung des sprachlichen Zeichens als Verbindung zwischen einem akkustischen Bild (Signifikant) und einem Konzept (Signifikat) korrespondiert mit sämtlichen klassischen Zeichentheorien. Sein revolutionärer Schritt war nun, den Bezeichnungseffekt der Sprache entgegen der Tradition nicht mehr als Repräsentation und die Sprache selbst damit als identitätslos und sekundär gegenüber den von ihr bezeichneten Objekten zu bestimmen, sondern, indem er die Differenz zwischen den sprachlichen Zeichen als Ursache ihrer Identität (und nicht umgekehrt) bestimmte, diesen Bezeichnungseffekt als immanentes und konstituives Prinzip anzusehen. Die Differenz ist somit das Prinzip, das Signifikant und Signifikat überhaupt erst erzeugt.[5] Die Einsicht in die Arbitrarität der Zeichen sowie eben jene erläuterte, daß Signifikat und Signifikant „letzten Endes nichts anderes sind als die zwei Seiten ein und des selben Blattes“, während für die klassische Zeichenlehre „immer schon die Unterscheidung zwischen Signifikat und Signifikant“ (Grammatologie, 25), und zwar in einem strikt hierarchischen Sinne gegolten hat, stellt für das Denken Derridas einen bedeutsamen Anstoß dar. Im Gegensatz zu Derrida bleibt de Saussure jedoch mit seiner Bestimmung der Schrift als sekundär gegenüber der gesprochenen Sprache der klassischen (metaphysischen) Tradition verbunden. Hierauf soll im folgenden noch näher eingegangen werden.
II. Die Dekonstruktion unter Bezugnahme auf Nietzsche
Der Denkansatz Derridas wird im weiteren – aus Gründen der terminologischen Erleichterung – unter dem Begriff des „Dekonstruktivismus“ subsumiert. Eigentlich wurde der Begriff des Dekonstruktivismus in den USA in einigen Departments of Literary Criticism entwickelt und stellt eine eigene Weiterbildung Derridascher Denkmotive dar.[6] Die Dekonstruktion Derridas ist weder eine Theorie noch eine Methode; ebensowenig ist es möglich, sie im allgemeinen zu beschreiben.
Als Zugang zur Dekonstruktion bietet sich nur eine schrittweise Annäherung an, ein Verfolgen und Mit – gehen der Denkspuren Derridas und dessen, auf was sie verweisen. Derrida erhält entscheidende Impulse durch seine Auseinandersetzung mit dem Werk Heideggers. Er betont wiederholt, daß keine seiner Untersuchungen ohne den Ansatz der Heideggerschen Fragestellung möglich gewesen wäre. Derrida nimmt wie Heidegger das Ganze des Okzidents in den Blick und konfrontiert es mit seinem Anderen, das sich durch „radikale Erschütterungen“ anmeldet – ökonomisch und politisch, d.h. vordergründig durch die neue Konstellation zwischen Europa und der Dritten Welt, metaphysisch durch das Ende des anthropozentrischen Denkens.[7] Ebenso wie Heidegger beschäftigt auch Derrida die Frage der Möglichkeit einer Selbstüberwindung der Metaphysik; die De-struktion wird zur De-kon-struktion: „Mit versteckten, stets gefährlichen Bewegungen, die immer wieder dem zu verfallen drohen, was sie dekonstruieren möchten, müssen, im Rahmen der Vollendung, die kritischen Begriffe in einen vorsichtigen und minuziösen Diskurs eingebettet werden, muß mit äußerster Sorgfalt ihre Zugehörigkeit zu jener Maschine bezeichnet werden, die mit ihrer Hilfe zerlegt werden kann. Zugleich gilt es, die Spalte ausfindig zu machen - , durch die, noch unerkennbar, durchschimmert, was nach der Vollendung (unserer Epoche) kommt.“[8] Derrida konstituiert seine Metaphysikkritik nun dahingehend, daß er versucht aufzuzeigen, inwieweit Heidegger bei seinem Versuch einer Destruktion der Metaphysik eben dieser immer noch verbunden bleibt. Hierbei kommt für Derrida immer wieder Nietzsche ins Spiel, den er in Bezug auf die metaphysikkritische Fragestellung entschieden vom Heideggerschen Nietzsche abgrenzt.
Ein durch den Strukturalismus Saussures bestimmtes Wissenschaftsklima ermutigt Derrida, die Linguistik für die Zwecke der Metaphysikkritik in Dienst zu nehmen.
Entscheidend ist für Derridas Theorie der Schrift das Verhältnis von Stimme (gesprochenem Wort) und Schrift (geschriebenem Text). In der gesamten westlichen Tradition erkennt Derrida einen Vorrang der Stimme vor der Schrift. Die Hochschätzung des gesprochenen Wortes ist, nach Derrida, dem metaphysischen Denken zuzuordnen, d.h. der vorherrschenden Tendenz des philosophischen Denkens von Platon bis Hegel. Als maßgebend für diese Tendenz kann man Platons Siebenten Brief benennen, in dem es heißt, daß die philosophische Wahrheit sich nicht aufschreiben läßt. Sie ist nur im Dialog, mit seinen verschiedenen Standpunkten und Lösungsvorschlägen, die auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden, gegenwärtig.[9] Die Priorität des gesprochenen Wortes vor der Schrift im Denken des Okzidents zeigt sich deutlich in der vorherrschenden Konzeption der Schrift als bloße Wiedergabe des gesprochenen Wortes, als „phonetische Schrift“, die das „Zentrum des Großen metaphysischen, wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Abenteuer des Abendlandes“ wurde (G, 23). Vermittels des gesprochenen Wortes stand die ihrem Wesen nach derivative Schrift in Verbindung mit der „Instanz eines Logos oder einer von ihm abstammend gedachten Vernunft, wie immer man diesen Logos auch verstehen mag: im vorsokratischen oder philosophischen Sinne, als unendlicher Verstand Gottes oder im anthropologischen Sinne, im vorhegelschen oder nachhegelschen Sinne“ (G,24).[10] Unsere Epoche des Logos erniedrigt somit die Schrift, indem sie diese als „Vermittlung der Vermittlung und als Herausfallen aus der Innerlichkeit des Sinns“ konzipiert.[11] Derrida versucht nun aufzuzeigen, daß das dergestalt logozentrische, metaphysische Denken immer zugleich auch phonozentrisch (zentral auf die Stimme gerichtet) ist. (Im folgenden wird der Begriff des Phonozentrismus implizit unter denjenigen des Logozentrismus subsumiert). Der Logos wohnt demnach stets dem gesprochenen Wort inne, während die vom Wort abgeleitete Schrift sich immer nur referentiell zu dem ihr übergeordneten Logos verhalten kann. Die Konzeption des Sich-im-Sprechen-Vernehmens durch die Lautsubstanz hindurch prägte, nach Derrida, im Westen die gesamte Idee der Welt mit all ihren Unterscheidungen „zwischen dem Weltlichen und dem Nicht-Weltlichen, dem Draußen und dem Drinnen, der Idealität und der Nicht-Idealität, dem Universalen und dem Nicht-Universalen“ , vorallem aber die grundlegende „Thematik der Präsenz“ als Basis aller Metaphysik.[12] Aus der Bestimmung der absoluten Nähe „der Stimme zum Sein, der Stimme zum Sinn des Seins, der Stimme zur Idealität des Seins“, ergibt sich das Merkmal der okzidentalen Metaphysik als „Sinn-Bestimmung des Seins überhaupt als Präsenz“ (G,25f).[13] Das Zusammenfallen des Logozentrismus mit der Bestimmung des Seins des Seienden als Präsenz ist einer der für Derrida wichtigsten Gedanken in diesem Zusammenhang. Derrida sieht seine Aufgabe nun in der Dekonstruktion des Logozentrismus, der für ihn eine der prinzipiellen Illusionen der westlichen Welt darstellt. Es ist notwendig an dieser Stelle entschieden darauf hinzuweisen, daß Derrida mit seiner neuen Beurteilung der Schrift dieser keineswegs den Vorrang geben will in Bezug auf die gesprochene Sprache. Dies würde ja lediglich eine Umkehrung des klassischen und traditionellen Verhältnisses von Stimme und Schrift insinuieren. Die Bewegung des Umkehrens kennzeichnet aber nicht den Denkgestus, der hier vorliegt. Der Vorrang der gesprochenen Sprache wird zwar mit aller Entschiedenheit bestritten und abgebaut. Was darin aufgebaut wird ist aber nicht der umgekehrte Vorgang, sondern ein Zugleich. An die Stelle des einen einfachen Ursprungs tritt nicht ein anderer, sondern ein Ursprungsgeschehen, das in sich diffus bleibt. Daß an die Stelle des Vorrangs das Zugleich tritt, kann man auch so ausdrücken, daß das hierarchische Denken umgewandelt wird zum Denken eines Nebeneinander.[14] Die Verschiebung des Verhältnisses von Wort und Schrift führt notwendig auch zu einer Neubestimmung der Beziehung zwischen Signifikat und Signifikant. Die hierarchische Teleologie dieses Begriffspaares führte dazu, daß die bisherige Schrift, in Form von Werk oder Buch, immer auf der Voraussetzung beruhte, daß vor ihrem eigenen Zustandekommen eine „konstituierte Totalität des Signifikats“ (Wahrheit, Sinn, Logos) besteht, „die deren Einschreibung und deren Zeichen überwacht und als ideale von ihr unabhängig ist. Die Idee des Buches, die immer auf eine natürliche Totalität verweist, ist dem Sinn der Schrift (der Derridaschen Konzeption von Schrift) zutiefst fremd. Sie schirmt die Theologie und den Logozentrismus enzyklopädisch gegen den sprengenden Einbruch der Schrift ab, gegen ihre aphoristische Energie und, wie wir später sehen werden, gegen die Differenz.“ (G,35)[15] Die Signifikanten werden somit sekundär gegenüber einer Wahrheit und einem Sinn, „die bereits durch das Element und im Element des Logos konstituiert sind“ (G,30). Dieser irgendwie außerhalb stehende, unabhängige Logos, man könnte auch sagen, dieses ursprüngliche oder erste Signifikat des oder im Logos, ist das, was Derrida als das transzendentale Signifikat bezeichnet, das von seinem Wesen her nicht auf einen Signifikanten verweist, sondern über die Signifikantenkette hinausgeht und das von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr die Funktion eines Signifikanten hat. Derrida kann die Auffassung eines solchen transzendentalen Signifikats natürlich nicht akzeptieren, da jedes Signifikat auch in die Rolle des Signifikanten schlüpfen kann. Der Rückgriff auf ein transzendentales Signifikat und die Versicherung unseres Denkens in ihm wird nach Derrida auch nicht „von außen durch so etwas wie „die Philosophie“ vorgeschrieben“, sondern ergibt sich notwendig aus „all dem, was unsere Sprache, unsere Kultur und unser „Denksystem“ mit der Geschichte und dem System der Metaphysik verbindet“ (Positionen, 57).[16] Derrida hingegen, der versucht die Signifikanten von der Tyrannei des transzendentalen Signifikats zu befreien und Bedeutung nur im wechselvollen, unendlichen Spiel der Signifikanten untereinander manifestiert sehen will, sieht hier seine Verwandtschaft zu Nietzsche. Schon der junge Nietzsche hat in seiner Studie „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne“ von 1873 sein Mißtrauen gegenüber der Sprache, besonders gegenüber der Sprache als Trägerin der Wahrheit, zum Ausdruck gebracht. Er verweist auf die Willkürlichkeit der Beziehung zwischen Bezeichnung und Ding und bezeichnet Wahrheit (repräsentierbar nur in Form der Sprache) als „ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken.“ (KSA, 279f) In diesem Punkt zeigt sich der grundlegende Unterschied zwischen Derridas und Heideggers Nietzsche-Auffassung und allgemein ein wichtiger Zugang zum dekonstruktiven Anliegen Derridas. Heidegger versucht aus Nietzsches im Willen zur Macht zusammengefaßten Nachlaßfragmenten die beiden darin nur unvollständig angelegten Gedanken des Willens zur Macht und der Ewigen Wiederkehr des Gleichen im Namen der abendländischen Metaphysik zu Nietzsches „eigentlichen“ Gedanken über die Wahrheit des Seins des Seienden zusammenzudenken. Damit wurde, nach Derrida, das klassische Verfahren der Hermeneutik auf seinen Höhepunkt gebracht und gleichzeitig die „Radikalisierung der Begriffe der Interpretation, der Perspektive, der Wertung, der Differenz“ verschüttet, die Nietzsche in seinem Text hervorgebracht hatte. Anstelle einfach innerhalb der Metaphysik zu bleiben, wie Heidegger es sah, trug Nietzsche vielmehr „entscheidend zur Befreiung des Signifikanten aus seiner Abhängigkeit, seiner Derivation gegenüber dem Logos, dem konnexen Begriff der Wahrheit oder eines wie immer verstandenen erstens Signifikats“ bei (G, 36). Nietzsche transkribierte keinen Sinn und schrieb keine unter der Präsenz des Logos stehende Wahrheit ein. „Die Virulenz des Denkens Nietzsches könnte nicht schlimmer verkannt werden“ , so Derrida[17]. Aus diesem Grund muß sich eine dekonstruktive Lesart Nietzsches nur auf dessen Spiel mit der Sprache und die Pluralität seiner Stile beziehen, da eine thematische Interpretation den bezeichnenden Prozeß in Nietzsches Schriften nicht erfassen und sich auf das Bezeichnete stützen würde, das in Nietzsches Werken nie eindeutig, sondern polyvalent Bezeichnendes ist[18]. Es sind hier Nietzsches Begriffe des Spiels, der Perspektive, der Interpretation, des Stils auf die Derrida wiederholt verweist und die er untersucht. Nietzsche ist dabei für Derrida nicht nur Objekt dekonstruktiver Untersuchung, sondern vielmehr Vorläufer seiner eigenen Gedanken. So bezeichnet unter anderem S. Kofmann, eine Schülerin Derridas ihren Lehrer als „un philosophe, unheimlich“ der Nietzsches Dekonstruktion fortführt.[19] Nietzsches Denken hat uns in einen Interpretationsprozeß verwickelt, der ständig über sich selbst reflektiert. Seine Aussage über die Wahrheit, die zur Nicht-Wahrheit, zur Nicht-Existenz der Wahrheit wird, da sie durch einen beständigen Interpretationsprozeß aufgehoben wird („Es gibt keine Wahrheit nur Interpretationen“), fordert für Derrida einen vollkommenen neuen Typus der Interpretation heraus. Da Nietzsches Zeichen „jeglicher präsenter Wahrheit bar“ sind und sich nicht mehr auf einen transzendentales Signifikat oder ein sonst wie versichernden Grund zurück beziehen lassen, kann die Arbeit mit Nietzsche nur im unaufhörlichen Dechiffrieren in einem unendlichen Interpretationsprozeß bestehen. Der Grund, weshalb sich die Interpretation dieser neuen, nach-nietzscheanischen Situation nicht mehr beenden läßt, besteht darin, daß die klassische Beziehung zwischen dem Signifikanten und dem Signifikat nicht mehr intakt uns zu einer veränderlichen, sich verschiebenden Beziehung geworden ist.
[...]
[1] Blondel „Vom Nutzen und Nachteil der Sprache für das Verständnis Nietzsches“ S.521
[2] Blondel S.519
[3] Künzli „Nietzsche und die Semiologie: Neue Ansätze in der französischen Nietzsche-Interpretation“ S.265
[4] Blondel S.521
[5] Metzlers Philosophen Lexikon S.782
[6] Kümmerle „Derrida zur Einführung“ S.17
[7] Habermas „Der philosophische Diskurs der Moderne“ S.191
[8] Derrida (1974), 28f, in: Habermas „Der philosophische Diskurs der Moderne“ S.192
[9] in: Kümmerle S.20
[10] Behler „Derrida – Nietzsche/Nietzsche – Derrida“ S.66
[11] Derrida „Grammatologie“ S.27
[12] Behler S.65
[13] Behler S.66
[14] Kümmerle S.45
[15] in: Behler S.70
[16] in: Behler S.76
[17]: Behler S.71
[18] Künzli S. 282
[19] Künzli S. 275
- Arbeit zitieren
- Steffen Heil (Autor:in), 2003, Nietzsche und Derrida, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69990
Kostenlos Autor werden

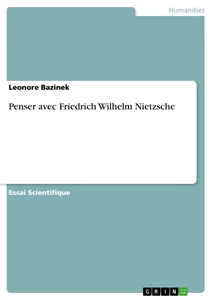


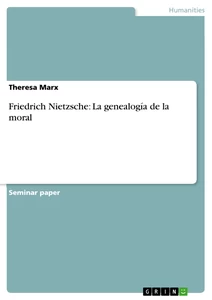



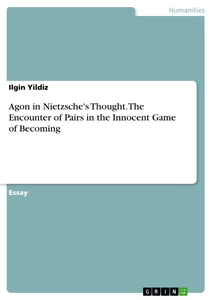








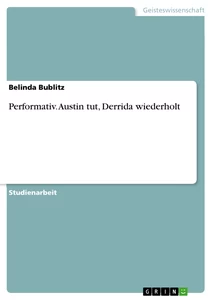


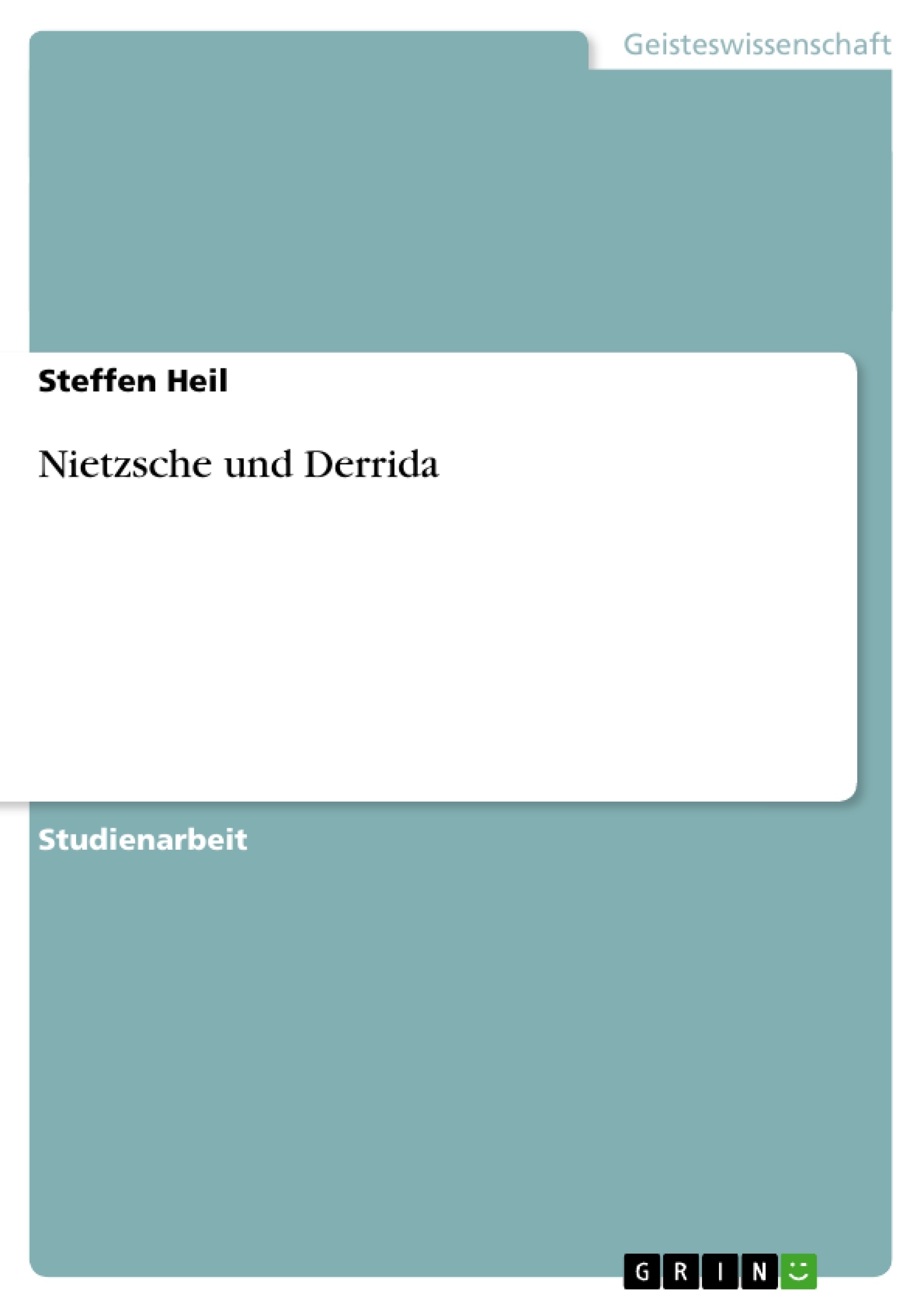

Kommentare