Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die ousia und ihre Bestimmungen
2.1. Die ousia
2.2. Die ousia als Zugrundeliegendes
2.3. Das ti ên einai des Seienden
2.3.1. Das ti ên einai und das Einzelne
2.4. Das Entstehen des Seienden
2.5. Die Teile der Definition
2.6. Das katholou und die ousia
2.7. Die ousia als Prinzip
2.8. Die ousia als Bewegung
2.9. Die Einheit der Definition
3. Bewegung, Vermögen und Verwirklichung
4. Der Wahrheitsbegriff der aristotelischen Metaphysik
4.1. Logische und ontologische Wahrheit
4.2. Die Wahrheit des Zusammengesetzten
4.3. Die Wahrheit des Unzusammengesetzten
5. Kritische Betrachtung der aristotelischen Ideenlehre
5.1. Die Ideenlehre Platons
5.2. Die Wirklichkeit der Ideen
5.3. Kritische Betrachtung des tode ti
5.3.1. Das tode ti und der Begriff
5.3.2. Das aristotelische Ideenmodell
5.3.2.1. Das Problem der Vollkommenheit
5.3.2.2. Der Gegensatz von Einheit und Vielheit
5.3.2.3. Die Identität und deren Widersprüchlichkeit
5.3.2.4. Die Individualität eines Seienden
Literatur
1. Einleitung
Um sich eingehend mit der Frage "Was ist das Seiende?" auseinanderzusetzen, die in den Büchern Ζ, Η und Θ der Metaphysik des Aristoteles eine besondere Gewichtung erfährt, in denen die Wissenschaft vom Seienden, deren Untersuchung bereits im Buch Γ ihren Anfang nimmt, nun konkretisiert wird und mit der Suche nach einem Seienden, das zugleich Seins- und Erklärungsgrund alles Seienden ist, mit der Definition der ousia ihren Höhepunkt findet, ist es notwendig, den von Aristoteles geprägten Begriff der Metaphysik genauer zu beleuchten.
Aristoteles versteht unter Metaphysik eine Wissenschaft, die davon absieht, lediglich Teilbezirke des Seins zu untersuchen, wie zum Beispiel die Mathematik oder die Medizin es tun würden, sondern sich vielmehr dem allgemeinen Sein zuwendet, das in allem zu finden ist, also dem Sein als solchem und dem, was damit zusammenhängt: "Es gibt eine Wissenschaft, die das Seiende, insofern es seiend ist, betrachtet und das, was ihm an sich zukommt" (Met. Γ,1; 1003a 21). Die Metaphysik ist somit für Aristoteles Seinswissenschaft, Ontologie. Alle Wissenschaften würden zwar in gewisser Weise etwas über das Sein aussagen, setzten jedoch hierbei eine Reihe von Begriffen voraus, die unmittelbar mit dem Sein zusammenhingen, die unmittelbar mit dem Sein gegeben seien. Begriffe wie Identität, Art, Einheit oder auch Gattung würden ohne genauer untersucht zu werden von den Einzelwissenschaften benutzt und somit unbesehen vorausgesetzt. Aus diesem Grund bedürfe es einer Wissenschaft, die das Sein und seine spezifischen Eigenheiten wissenschaftlich untersuche, es bedürfe einer ersten Philosophie. Aufgrund der Tatsache, dass das allgemeine Sein allen Seinsbezirken und allem Seienden zugrunde liegt, definiert Aristoteles die Metaphysik auch als die Wissenschaft vom Ersten und Ursächlichen: "Denn wer das Verstehen um seiner selbst willen wählt, wird am meisten die höchste Wissenschaft wählen | - das ist aber die Wissenschaft des im höchsten Grade Wißbaren; und im höchsten Grade wißbar sind das Erste und die Ursachen" (Met. A,2; 982a 31).
Innerhalb der Metaphysik des Aristoteles, die aus insgesamt 14, zum größten Teil eigenständigen Büchern zusammengesetzt ist, bilden die Bücher Ζ, Η und Θ eine geschlossene Gruppe. Die Bücher Z und H enthalten die in Buch Z eingeführte Abhandlung über die ousia, die Substanz, das Wesen: "Und die Frage, die bereits von alters her erhoben wurde, die auch heute erhoben wird und immer erhoben werden und Gegenstand der Ratlosigkeit sein wird, was nämlich das Seiende sei, bedeutet nichts weiter als, was das Wesen sei" (Met. Z,1; 1028b 2–4).
Das Buch Θ hingegen widmet sich der dynamis (Vermögen) sowie der energeia (Verwirklichung). Während sich die ersten neun Kapitel des Buches Θ ausschließlich mit dynamis und energeia beschäftigen, thematisiert das zehnte Kapitel darüber hinaus das Seiende als das "wahr" beziehungsweise "falsch" Seiende, dessen Erforschung Aristoteles bereits in den Kapitel V,7 und VI,2 angedeutet hat: "Weiter bezeichnet "sein" und "ist", daß etwas wahr sei, aber das Nichtsein, daß etwas nicht wahr sei, sondern falsch bei Bejahungen ebenso wie bei Verneinungen" (Met. V,7; 1017a 31), und: "Da aber das Seiende, das man schlechthin das Seiende nennt, in vielfachen Bedeutungen ausgesagt wird, von denen die eine das Akzidentelle bezeichnete, die andere das Seiende im Sinne des Wahren und das Nichtseiende im Sinne des Falschen, […] so muß man zuerst von dem im akzidentellen Sinn Seienden sagen, daß es davon keine wissenschaftliche Betrachtung gibt." (Met. VI,2; 1026a 33 – 1026b 4).
2. Das Seiende und seine Bestimmungen
2.1. Die ousia
Im ersten Kapitel des Buches Z unterscheidet Aristoteles die seiner Meinung nach immer wieder auftretenden, verschiedenen Aussageweisen des Seins. Diese sind für ihn das Was (ti esti) und das Das (tode ti), auf der anderen Seite die Quale und das Quantum, sowie die anderen Kategorien die durch das Sein bezeichnet werden, die er aber an dieser Stelle nicht näher bestimmt. Wenn man diesem Gedankengang von hier aus Folge leisten würde, so ergäbe sich, dass so viele Bedeutungen des Seienden existierten, wie in gleicher Zahl Kategorien, also zehn, vorhanden sind. Doch Aristoteles beharrt nicht auf diesem Standpunkt, sondern erreicht mit diesen einleitenden Gedanken eine "Gegenüberstellung von Substanz und nicht-substantialen Kategorien"1, indem er die ousia als das eigentlich Seiende heraushebt, streng genommen als das einzig Seiende bezeichnet. All das, was in den Kategorien sei, sei nur Seiendes, sofern die ousia in der Weise des genannten Seienden vorliege:
"Das andere aber wird als "seiend" ausgesagt, weil es an dem Seienden in der ersten Bedeutung eine Quantität, eine Qualität, eine Affektion oder etwas anderes derartiges ist" (Met. Z,1; 1028a 18ff). Das Sein der anderen Kategorien erhalte den Titel "seiend" folglich nur, da es ein Sein oder einen Seinsgehalt des im eigentlichen Sinne Seienden, der ousia, bezeichne. Daher stellt Aristoteles in seinem gewählten Beispiel neben anderem das Weiß-Sein in Frage, das seiner Meinung nach nicht als Seiendes vorliegen könne, da es nur durch die Verbindung mit der ousia als Seiendes bezeichnet werden könne. Jedes Seiende - also im Sinne der Kategorien -, das heisst, jedes Sein, ist durch die ousia, oder, wie es von Aristoteles noch bezeichnet wird, durch das "einzelne Ding" (Met, Z,1; 1028a 27) seiend. Die ousia ist somit das vorrangig Seiende, das schlechthin vorliegt. Aristoteles belässt es also nicht bei der Bestimmung des Seienden als "das einzelne Ding", sondern stellt die Frage nach dem bestimmten Was (ti esti), dem Wassein desselben, denn für ihn bezeichnet erst die Verbindung des Was und des Das das Seiende in seiner eigentlichen Struktur. Das Seiende liegt folglich in einer Verbindung des Einzelnen, dem tode ti, und einer allgemeinen Bestimmtheit des Seienden, dem ti esti, vor, wobei darauf geachtet werden muss, bei der Benennung des ti esti nicht die individuelle Beschaffenheit des Seienden zur Sprache zu bringen.
2.2. Die ousia als Zugrundeliegendes
Aristoteles widmet sich weiterhin der Frage, inwieweit die ousia in ihrer Funktion des Seienden, an die das Seiende der Kategorien gebunden ist, als Substrat (hypokeimenon) vorliegt und argumentiert vorerst positiv hinsichtlich dieser Fragestellung: "Substrat aber ist dasjenige, von dem das übrige ausgesagt wird, während es von keinem anderen ausgesagt wird" (Met. Z,3; 1028b 36). Nimmt Aristoteles in seinem Beispiel zuerst Erz als Wesen einer Statue an, das mit den in den Kategorien enthaltenen Eigenschaften der Form oder Größe als ein Seiendes zusammengefügt wird, so distanziert er sich doch kurz darauf von seiner Annahme. Denn wenn von hier aus die ousia bestimmt werden würde, dann sei diese Definition "noch unklar, und es würde demnach auch der Stoff selbst zum Wesen werden" (Met. Z,3; 1029a 10). Alle Bestimmungen also, die man dem Seienden zusprechen will, werden, so Aristoteles, von dem Seienden selbst ausgesagt, der letzte Grund der Definitionen aber, bleibt das völlig Unbestimmte. Entziehe man dem Substrat seine charakteristischen Eigenschaften, löse sich dieses auf und existiere nicht mehr, könne demnach also nicht die ousia sein: "Denn nimmt man alles übrige weg, so bleibt nichts übrig" (Met. Z,3; 1029a 12). Demnach existieren für Aristoteles Bestimmungen, die der ousia unveränderlich und unverlierbar zukommen: "Daher ist das Letzte an sich weder ein Was noch ein Quantum, noch sonst irgend etwas. Aber auch die Verneinungen davon sind es nicht, denn diese können nur im akzidentellen Sinne bestehen" (Met. Z,3; 1029a 24ff.). In dieser Unbestimmtheit jedoch ist für Aristoteles die ousia nicht zu definieren. Um diese zu erkennen, müsse zuerst von der Überlegung Abstand genommen werden, die ousia sei das durch ihre Unbestimmtheit geartete Substrat, da jedes Wesen eine spezifische Individualität aufweise: "Denn es kommt dem Wesen am meisten zu, abgetrennt und ein Dies zu sein" (Met, Z,3; 1029a 28).
2.3. Das ti ên einai des Seienden
Doch weist, wie eben erörtert, jedes Wesen diese Individualität auf, so erhebt sich zwangsläufig die Frage, was das Wesen hinsichtlich dieser Einzigartigkeit bestimmt. Der Weg, das Seiende zu suchen, das alles übrige Sein trägt, führt für Aristoteles zu dem Wassein, genauer, dem "Was-es-ist-dies-zu-sein" (ti ên einai), das heisst dem Sein, das für das einzeln Seiende das erste ist, in dem es konstant erhalten bleibt, solange dieses Seiende ist, das sogar das Seiende in seiner Ausprägung bestimmt, da das Seiende erst durch das ti ên einai das wird, was es ist. Den Begriff des ti ên einai führt Aristoteles bereits am Anfang des dritten Kapitels des Buches Z ein, wenn er davon schreibt, dass man, wenn man von der ousia eines Seienden spricht, diese vier verschiedenen Dinge bezeichnen kann: das ti ên einai, das Allgemeine, die Gattung und das hypokeimenon (vgl. Met. Z,3; 1028b 33-36). Das ti ên einai bestimmt Aristoteles als dasjenige, welches für jedes Seiende "das ist, als was es an sich ausgesagt wird" (Met. Z,4; 1029b 14). Das "was es an sich aussagt" erläutert er mit Hilfe des Beispiels der Bestimmung einer Fläche. Indem man die Fläche als eine weiße Fläche bezeichne, sei dies keine Bezeichnung des ti ên einai der Fläche, also keine Bezeichnung der Fläche in ihrem Fläche-Sein, sondern eine Bezeichnung der Fläche als etwas von der Fläche Unterschiedenes, "da das Fläche-Sein ja nicht das Weiß-Sein ist" (Met. Z,4; 1029b 17). Aber auch die Bezeichnung der Fläche als ein von beiden Verbundenes, also von Fläche-Sein und Weiß-Sein, sei nicht das ti ên einai, da "das zu Bestimmende darin enthalten ist" (Met. Z,4; 1029b 19). Aristoteles bedient sich zur Klärung des Sachverhalts des Ausdrucks "Kleid", um das einzeln vorliegend Seiende so zu bezeichnen, dass es weder als das ihm vorbestimmte Sein, also das Fläche-Sein, noch als das von ihm weiterbestimmte Sein, also das Weiß-Sein, definiert würde. Dieses "nicht an sich" (Met. Z,4; 1029b 29) des Kleid-Seins liege jedoch einerseits in der Weise des Hinzufügens, andererseits in der Weise des Weglassens vor. Der erste Fall treffe dann zu, wenn das Seiende in der Bezeichnung mit einem anderen verbunden und diesem beigefügt werde, zum Beispiel wenn man das Weiß-Sein mit dem Begriff des "weißen Menschen" bezeichne. Im zweiten Fall ist das zu Bezeichnende "nicht als solches Gegenstand der Aussage, in der die Definition der Eigenschaft, die es besitzt, von ihm ausgesagt wird, als bei dem Versuch, es zu definieren, das Hinzugefügtsein dieser Eigenschaft zu ihm irrtümlich nicht mit berücksichtigt worden ist."1 Das bedeutet also, dass, wenn man ein Seiendes als Kleid bezeichnet, diesem Kleid eine Form des Seins, aus dem es zusammengesetzt ist, zuspricht, eine andere dabei jedoch weglässt.
Nun ergibt sich der berechtigte Einwand, ob dieses Kleid-Sein überhaupt das ti ên einai bezeichnet, da letzteres ja als ein Sein vorliegen müsste und nicht, wie es beim Kleid-Sein der Fall ist, als ein Zusammengefügtes von zweierlei Sein. Das ti ên einai definiert folglich die regelnde Einheit aller Seinsweisen eines Seienden, die nach Aristoteles aber "nur dem Wesen zukommt" (Met. Z,4; 1030a 5). Die Wesensbestimmung eines Seienden sollte also die ousia in seinem einen ti ên einai ansprechen. Die Lösung dieses Problems sieht Aristoteles darin, dass ein Seiendes bestimmt werden könne in seiner Gattung und weiterhin in der für das Seiende individuellen Art, die sich von anderen Arten derselben Gattung unterscheidet: "Es gibt also das Was-es-ist-dies-zu-sein für nichts, das nicht Art einer Gattung ist, sondern nur für diese Arten allein [...]" (Met. Z,4; 1030a 12). Doch lediglich für das in der Einfachheit vorliegend Seiende ist eine solche Bestimmung für Aristoteles möglich, also weder für das Seiende, das in Verbindung mit dem Sein der Kategorien steht, noch für das Seiende, das in Kopplung zweier Seinsformen vorliegt, wie das Weiß-Sein und das Mensch-Sein.
2.3.1. Das ti ên einai und das Einzelne
Bevor sich Aristoteles einer genaueren Bestimmung des Gattungs- und Artbegriffs ergibt, stellt sich für ihn die Frage, "ob das Was-es-ist-dies-zu-sein und jedes Einzelne dasselbe sind oder verschieden" (Met. Z,6; 1031a 15). Wie im Verlauf des Textes ersichtlich, versteht Aristoteles unter dem ti ên einai die ousia eines Seienden (vgl. Met. Z,7; 1032b 1f.). Um nun nachzuvollziehen, dass das ti ên einai und das Einzelne identisch sind, muss das Einzelne in zweierlei Bedeutungen verstanden werden. Zum einen wird es durch das Sein bestimmt, das ihm anhaftet, "das akzidentell ausgesagt wird" (Met. Z,6; 1031a 19), zum Beispiel Weiß-Sein, das dem Mensch-Sein in seiner Bestimmung zusätzlich zukommt, zum anderen ist das Einzelne definiert durch das ti ên einai, das das Seiende in seiner Individualität definiert. Aristoteles begründet die Unmöglichkeit einer Trennung zwischen Einzelnem und dem ti ên einai anhand der platonischen Ideenlehre, die er in seiner Argumentation verneint. Wenn, wie Platon es annimmt, die Idee des Seienden getrennt von dem Seienden vorliegen würde, dann müsste ein entsprechend zweites Seiendes existieren, das von dem zu bestimmenden Seienden getrennt ist: " ..., so würde es andere Wesen, Naturen und Ideen außer den genannten geben, und diese wären frühere Wesen, sofern das Was-es-ist-dies-zu-sein Wesen ist" (Met. Z,6; 1031b 1f.). Eine Bestimmung des Seienden wäre somit unmöglich, da ja das zu Bestimmende ohne das ti ên einai existieren würde. Wenn von "Ideen" die Rede sein könne, dann nur in der Form der Verbundenheit mit dem Wesen, "...; denn es wäre notwendig, daß diese Ideen Wesen seien, ..." ( Met. Z,6; 1031b 16). Die Ideen existierten folglich dann durch die Teilhabe am Einzelnen und nicht, wie Platon es annimmt, das Einzelne durch Teilhabe an den Ideen.
2.4. Das Entstehen des Seienden
Die Tatsache dass, wie bereits in Kapitel 2.2. festgestellt wurde, das ti ên einai die regelnde Einheit aller Seinsweisen eines Seienden bildet, zieht eine nähere Untersuchung des Begriffs des Werdens nach sich, der in den Kapiteln 7 – 9 von Aristoteles behandelt wird und bei dem vor allem das Entstehen der ousia in den Vordergrund gerückt wird. Zuerst erhebt sich die Frage nach dem der ousia vorausliegenden Grund, aus dem das Entstehen folgen kann. Aristoteles bedient sich bei seiner Interpretation des Entstehens von Kunst durch den Menschen, der sie schafft. Nun steht für Aristoteles fest, dass es einen Stoff vor dem Entstehen geben muss, der dem zu Entstehenden zugrundeliegt, wie es für ihn bei der Materie der Fall ist: "Es ist also, wie man zu sagen pflegt, nicht möglich, daß etwas entsteht, wenn es nicht schon vorher vorhanden ist. Es ist demnach klar, daß notwendig ein Teil vorhanden sein wird; denn der Stoff ist Teil (er ist ja im Entstehen vorhanden und entsteht selbst)" (Met. Z,7; 1032b 30 ff.). Weiterhin bilde der Ursprung der Veränderung einen unabdingbaren Pfeiler im Entstehungsprozess, da ansonsten der Stoff allein für das Entstehen verantwortlich wäre: "... denn das Entstehende muß aus etwas entstehen, was sich verändert, aber nicht aus etwas, das bestehenbleibt." (Met. Z,7; 1033a 22f.). Jedoch verbindet Aristoteles diese Grundbedingungen zugleich mit einem einschränkenden Zusatz. Bei dem Entstehen dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass aus dem vorausliegenden Stoff die Gestalt des Seienden entstünde, denn auch diese liege vor dem Entstehen: "Ich meine aber, daß das Erz rund zu bewirken nicht das Runde oder die Kugel bewirken heißt, sondern etwas davon Verschiedenes, nämlich diese Form in einem anderen zu bewirken" (Met. Z,8; 1033a 32ff.). Denn wenn man selbst die Gestalt entstehen liesse, so würde das für Aristoteles nach sich ziehen, dass man auch die Materie in einer neuen Gestalt prägen müsste, "... und die Entstehungen würden ins Unbegrenzte fortschreiten" (Met. Z,8; 1033b 4). Was das Ergebnis des Entstehens bilde, sei das tode ti, das einzelne Das. Die Gestalt, die dem Substrat im Entstehen auferlegt werde, sei jedoch kein tode ti, sondern ein "Derartiges" und das Entstehen-Lassen bringe aus dem Derartigen ein "Derartiges Das" hervor (vgl. Met. Z,8; 1033b 20ff.). Folglich ist die Gestalt nicht als ein Seiendes, sondern lediglich als Seinsgehalt zu definieren.
Die Gestalt wiederum, die, wie eben festgestellt, nicht in dem Entstehen mit erschaffen werde, finde ihren Ursprung in der Seele: "Durch die Kunst entsteht das, dessen Form in der Seele ist ..." (Met. Z,7; 1032a 32f.). Daraus folgt, dass bereits vor dem Entstehen die Vorstellung des zu Entstehenden vorliege, ohne mit dem Substrat des zu Entstehenden eine Verbindung einzugehen - jedoch nicht zu verstehen als ein konkretes Bild des zu Entstehenden, sondern in der Art und Weise des Wissens der Charakteristik des zu Entstehenden. Diese Vorstellung sei also nicht mit der Gestalt gleichzusetzen, die ja lediglich als Seins gehalt verstanden werden müsse.
Es stellt sich nun die Frage, inwieweit sich die von Aristoteles beschriebene Entstehung in der Natur vollzieht, im Unterschied zu dem oben angeführten Vergleich des menschlichen Herstellens von Dingen, denn Aristoteles hält diese beiden Entstehungsprozesse nicht für gleichwertig. Zuvor eröffnet sich jedoch aus dem bisher Erörterten eine Erläuterung der von Aristoteles angeführten These, das ti ên einai liege bereits vor dem Entstehen des Seienden bereit. Die Gestalt, die dem Seienden am Ende seiner Entstehung entspricht, erklärt Aristoteles anhand der Entstehung des Menschen, bei der der Mensch als Erzeuger bereits über die Gestalt des zu Entstehenden verfügt, da er in gleicher Gestalt existiert: "..., nämlich die "Natur der Form nach", die mit dem Entstehenden gleichartig ist, wenn sie sich auch in einem anderen befindet. Denn ein Mensch zeugt einen Menschen" (Met. Z,7 1032a 23ff.)
Kehrt man zu der oben genannten Differenz der Entstehungsprozesse der Natur hinsichtlich der des Menschen zurück, ergibt sich eine von Aristoteles angeführte Einschränkung, die die ousia betrifft. Diese existiere lediglich in dem von Natur aus Seienden und nicht in den von Menschen erzeugten Dingen (vgl. Met. 1041b 8ff. / 1043a 4f. / 1043b 21ff.). Für das aus der Natur Entstandene liege das ti ên einai immer und ungebrochen von der Generationenfolge vor. Anders verhalte es sich bei dem Entstehen von Seiendem durch den Menschen, deren ti ên einai nicht aus der Natur und dadurch unveränderlich und ewig existiere, sondern erst in einem zweiten Schritt aus dem ti ên einai des Menschen entspringe. Es sei also der Natur gegeben, Seiendes entstehen zu lassen, das ihr entspreche, was dem im zweiten Schritt durch den Menschen nicht erreicht werden könne.
[...]
1 Christof Rapp, Substanz als vorrangig Seiendes – in: Christof Rapp, Aristoteles - Metaphysik / Substanzbücher, S.29
1 Hermann Weidemann, Zum Begriff Des ´ti ên einai´ - in: Christof Rapp, Aristoteles – Metaphysik / Substanzbücher, S.87
- Arbeit zitieren
- Martin Endres (Autor:in), 2001, Zu: Aristoteles - Die Substanzbücher, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/668
Kostenlos Autor werden
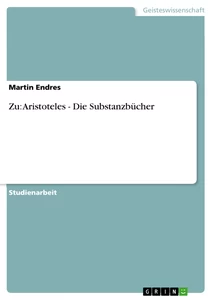


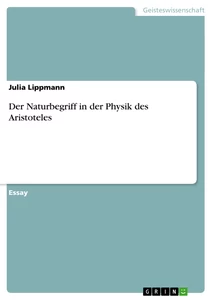

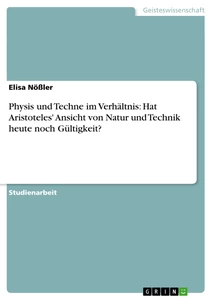
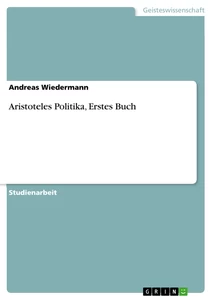









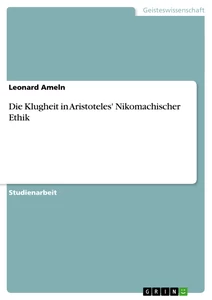

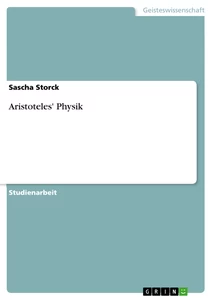

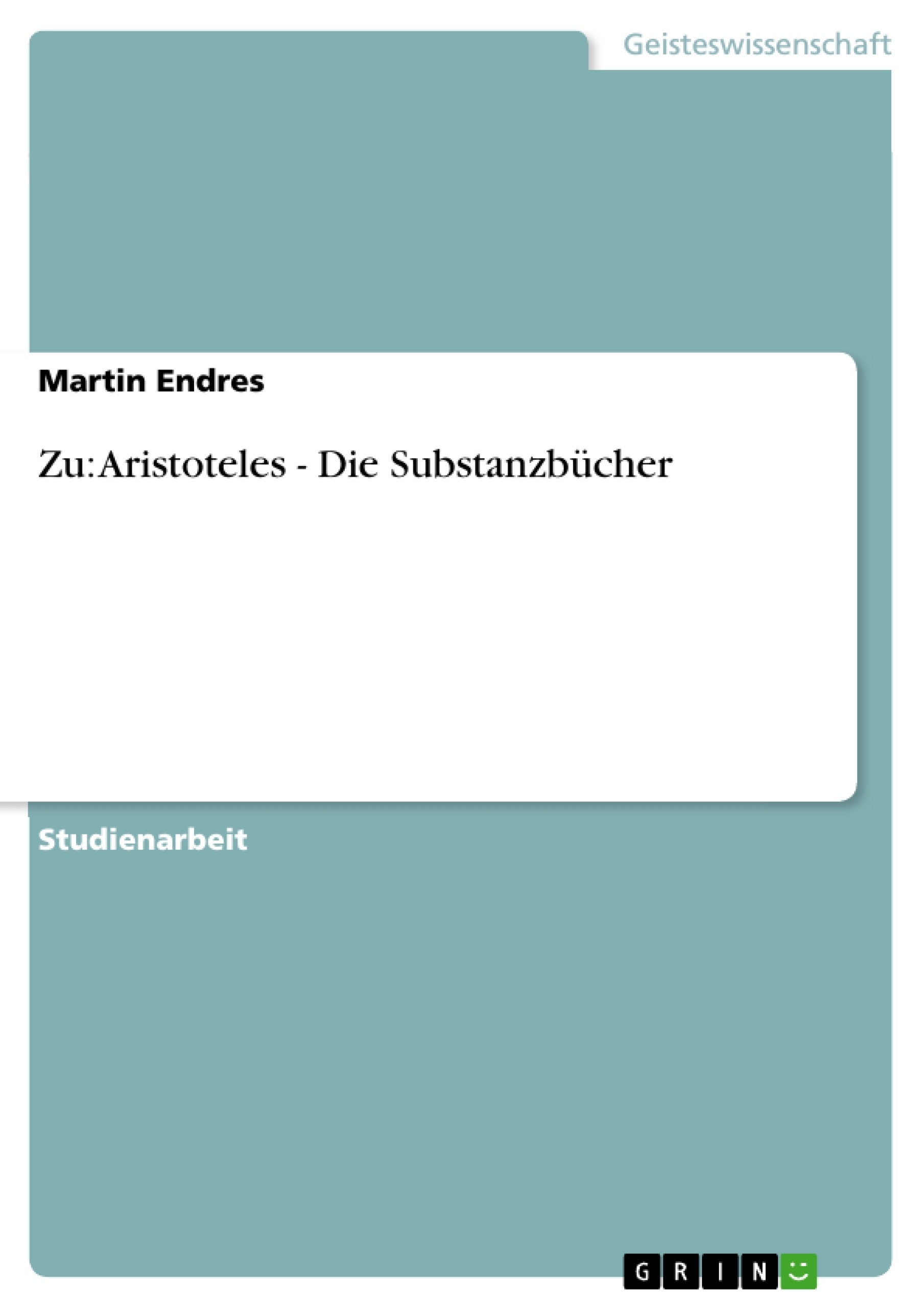
Kommentare