Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Der Begriff „geistige Behinderung“
2 Soziale Integration
2.1 Begriffsklärung
2.2 Geschichte der Sozialen Integration
2.3 Soziale Integration heute
3 Das Kind im Grundschulalter
3.1 entwicklungspsychologische Sichtweisen
3.2 sozialpsychologische Sichtweisen
3.3 soziologische Sichtweisen
3.4 institutionelle Sichtweisen
3.5 pädagogische Sichtweisen
4 konzeptionelle Aspekte des Unterrichts an der Förderschule für Kinder mit einer „geistigen Behinderung“
4.1 Curriculum
4.1.1 Ziele
4.1.2 Inhalte
4.1.3 Methoden
4.2 Schlussfolgerung und Bilanz
5 konzeptionelle Aspekte des Unterrichts an Grundschulen
5.1 Curriculum
5.1.1 Ziele
5.1.2 Inhalte
5.1.3 Methoden
5.2 Schlussfolgerung und Bilanz
6 konzeptionelle Aspekte des integrativen Unterrichts an Grundschulen
6.1 Curriculum
6.1.1 Ziele
6.1.2 Inhalte
6.1.3 Methoden
6.2 Schlussfolgerung und Bilanz
7 Pro und Contra des integrativen Unterrichts
7.1 Vergleiche
7.1.1 Pro
7.1.2 Contra
7.2 Folgen, Möglichkeiten und Grenzen
8 Fazit und Resümee
Literaturverzeichnis
Einleitung
„Der Begriff ‚Integrationspädagogik’, d.h. die Theorie und Praxis des gemeinsamen Lernens, steht für eine neue Sichtweise zur Erziehung und Unterrichtung von Kindern mit Beeinträchtigung sowie für einen veränderten Auftrag in Vorschule und Schule.“ (Eberwein & Knauer 2002, S. 17) Die aktuelle Debatte um das gemeinsame Lernen, also den integrativen Unterricht von Kindern mit und ohne eine „Behinderung“, greife ich in meiner Arbeit anhand der folgenden leitenden Fragestellung auf. Diese lautet: Integrativer Unterricht an der Grundschule oder Unterricht an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ für Kinder mit einer „geistigen Behinderung“? Weiterhin stellt sich für mich die Frage, wie integrativer Unterricht für alle Kinder mit einer „Behinderung“ egal welcher Art mit den heutigen Möglichkeiten realisiert werden kann, ohne das gegebenenfalls Benachteiligungen entstehen. Gerade die Gruppe der Kinder mit einer „geistigen Behinderung“ ist bislang sehr dürftig in die integrativen Grundschulklassen aufgenommen worden. Im Jahre 2003 besuchten in der Bundesrepublik Deutschland lediglich gut drei Prozent der gesamten Schülerinnen und Schüler mit einer „geistigen Behinderung“ den integrativen Unterricht. (weiteres dazu in Kapitel 7, Abschnitt 7.1) Hinzu kommt, dass Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“, „soziale und emotionale Entwicklung“ (ehemalige Schule für Erziehungshilfe) und „Sprache“ das Fernziel haben, ihre Schülerinnen und Schüler (wieder) in die Regelschule zu führen. Dagegen arbeitet die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ hauptsächlich mit dem Fernziel, seine Schülerinnen und Schüler auf das spätere Leben vorzubereiten.
Zurzeit fordern zahlreiche Integrations-Experten vehement, hier sind beispielhaft Eberwein und Feuser zu nennen, eine Integration von allen Kindern und Jugendlichen mit einer „Behinderung“. Da stellt sich für mich ebenfalls die Frage, wie eine Umsetzung bzw. was für Probleme bei der Umsetzung entstehen können. Weiterhin bleibt es fragwürdig, ob eine Integration für alle überhaupt in der jetzigen Gesellschaft realisierbar ist oder ob die finanziellen Mittel in den einzelnen Bundesländern ausreichen? Inwieweit bezieht sich das Studium der Sonderpädagogik auf den Bereich Integration und wird den Kindern mit einer „geistigen Behinderung“ genug Selbstbestimmung entgegengebracht? Was meinen die zahlreichen Elterninitiativen zum Thema Integration und was ist mit den Kindern mit einer „schwerst-mehrfach Behinderung“?
Die Ideen und Erkenntnisse der Integrationspädagogik sind zwar notwendig und hilfreich, dennoch bleibt die Frage offen, ob sie zum jetzigen Zeitpunkt einen integrativen Unterricht für alle leisten kann oder ob Integration heutzutage nicht doch noch unbewusst zwischen integrationsfähig und integrationsunfähig selektiert?
Wie bereits erwähnt beschäftigt sich diese Arbeit speziell mit der Gruppe der Kinder mit einer „geistigen Behinderung“, die bisher bezüglich des integrativen Unterrichts enorm benachteiligt wurde. Ich vergleiche die Curricula der Grund- und Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“. Hinzu kommen einige Aspekte zum integrativen Unterricht mit einer abschließenden Einschätzung der Vor- und Nachteile. Interessant ist besonders die Frage, ob der integrative Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt auch den Kindern mit einer „geistigen Behinderung“ gerecht werden kann und ihnen die größtmöglichsten Förder- und Entwicklungschancen geben kann. Oder ob er zurzeit lediglich eine gute Alternative zum Unterricht an der Förderschule ist. Weiterhin beziehe ich mich ausdrücklich auf die Gruppe der Kinder mit einer „geistigen Behinderung“, da derzeit hauptsächlich für Kinder mit einer „Behinderung“ im Bereich „Lernen“, „soziale und emotionale Entwicklung“ oder „Sprache“ der integrative Unterricht frei zugänglich ist. Demnach ist es interessant, was in den nächsten Jahren vor allem für die Gruppe der Kinder mit einer „geistigen Behinderung“ im Bereich der Grundschule getan werden soll bzw. was die einzelnen Bundesländer zum jetzigen Zeitpunkt bereits bieten.
Die Arbeit beschäftigt sich nacheinander mit den folgenden Themengebieten: Begriffsbestimmung „geistige Behinderung“, soziale Integration sowie die spezifischen Curricula der beiden Schulformen und dem anschließenden Vergleich zwischen pro und contra des integrativen Unterrichts. So wird, beginnend mit den Definitionen und der allgemeinen Theorie anschließend auf die konkrete Situation und die zukünftigen Entwicklungen in den Schulen eingegangen. Die Theorien sind die notwendige und zwingende Grundlage, um die Idee und den Hintergrund der Integrationspädagogik überhaupt nachvollziehen zu können. Meine Argumente, Belege und Zitate beziehe ich ausschließlich aus der aktuellen Literatur; beispielsweise zum Thema Integrationspädagogik oder zum Thema Menschen mit einer „geistigen Behinderung“. Die aktuellen Daten, zum Beispiel zum Thema integrativer Unterricht, stehen auf der Homepage der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Download bereit.
Mein Ziel, das ich mit dieser Arbeit erreichen möchte, ist zum einen mehr Aufmerksamkeit für die bis jetzt benachteiligte Gruppe der Kinder mit einer „geistigen Behinderung“ bezüglich des integrativen Unterrichts. Zum anderen möchte ich den Anreiz geben, die Umsetzung von Integration in den Schulen zum jetzigen Zeitpunkt noch einmal zu überdenken und überarbeiten. Ferner liegt es mir nahe, dass Integration in der aktuellen Verfassung nicht als das absolut Richtige gesehen wird und die Förderschule als ein großes Übel.
Dennoch ist Integration in Zukunft eindeutig der richtige Weg, wenn sie weiterhin überall ausgebaut und gefördert wird. Dann kann eines Tages tatsächlich von einer Integration bzw. einer Inklusion für alle gesprochen werden.
1 Der Begriff „geistige Behinderung“
Im folgenden Abschnitt setze ich mich zuerst mit der Begriffdefinition „geistige Behinderung“ auseinander, um danach auf die möglichen Ursachen von „geistiger Behinderung“ einzugehen. Bislang gibt es keine eindeutige und klare Definition für den Begriff „Behinderung“. Die Gründe für diese Unklarheiten sind vielfältig.
„Der Grund für die Schwierigkeiten in der endgültigen Begriffsbestimmung liegt zunächst in der Individualität des Phänomens der Behinderung. Das heißt, es gibt nicht den Menschen mit Behinderung. Die organische Schädigung und ihre geistig-seelischen oder sozialen Folgen sind bei jedem betroffenen Menschen individuell andere.“ (Fornefeld 2004, S. 45f.)
Fornefeld gibt klar zu verstehen, dass eine eindeutige Definition nicht möglich ist, da sonst jegliche Individualität des einzelnen Menschen verloren geht und sich hauptsächlich auf die Behinderung konzentriert wird.
Speck spricht von „einer grundlegenden Schwierigkeit“ bezüglich der Begriffsbestimmung „geistige Behinderung“, weil „die Gemeinten können zu einer terminologischen Klärung wenig beitragen. Wir als Nicht-geistig-Behinderte können sie nicht so ohne weiteres definieren. Die Verantwortung für diese Menschen verlangt es, dass wir die eigene Sicht nicht verabsolutieren und Definitionsversuche nur auf der Basis der Achtung vor Ihnen vornehmen.“ (Speck 2005, S. 43)
Bleidick schlägt eine mögliche Definition vor, die etwas weiter gefasst ist, nämlich: „Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Funktionen so weit beeinträchtig sind, daß[!] ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilnahme am Leben der Gesellschaft erschwert werden.” (Bleidick 1999, S. 15)
Eine wirklich eindeutige und präzise Definition des Begriffs „Behinderung“ ist selbst in der Fachliteratur nur schwer zu realisieren, da der Mensch mit einer „(geistigen) Behinderung“ in den Definitionsversuchen prinzipiell auf seine „Behinderung“ beschränkt und nicht als Individuum gesehen wird.
„Behinderung“ kann nur als ein Sammelbegriff gesehen werden, weil bei einer eindeutigen, klaren Definition grundsätzlich die betroffene Person benachteiligt wird.
Das neunte Sozialgesetzbuch „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ (vom 23.04.2004) definiert „Behinderung“ nach § 2 Abs.1 wie folgt:
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“
Diese Definition nach dem Sozialgesetzbuch ist nicht vorteilhaft, dennoch muss sich ein Gesetz genau festlegen, um einem möglichen Anspruch auf Unterstützung gerecht zu werden.
Wenn man sich weiter durch die Literatur arbeitet, finden sich Definitionen wie: „Behinderung ist ein Sammelbegriff, der trotz vielfältiger Versuche nur schwer präzisierbar ist, da Behinderung sich nur im Vergleich und Abgrenzung zu Nichtbehinderung darstellen läßt[!].“ (Stimmer 2000, S. 74)
Zusammenfassend kann man sagen, dass es nicht die eine richtige Definition gibt. Grundsätzlich lässt sich an allen drei Definitionen etwas bemängeln, sei es die Nichtberücksichtigung der Individualität eines Menschen oder die Annahme eine Behinderung als „Bedrohung“ zu sehen.
Das Wort „Behinderung“ oder spezifisch „geistige Behinderung“ drückt etwas Negatives aus. Speck formuliert treffend dazu: „Es kann dadurch der Eindruck entstehen, alles, was einen Menschen mit geistiger Behinderung betrifft, sei defizitär.“ (Speck 2005, S. 47)
Positiv anzumerken ist, dass sich in den letzten Jahren der Begriff Mensch mit geistiger Behinderung gegenüber dem Begriff Geistigbehinderte durchgesetzt hat, dennoch kann es nur eine Übergangslösung sein.
Insgesamt hat sich in den letzten Jahren bezüglich des Verstehens von „Behinderung“ ein Perspektivwechsel vollzogen, sowohl innerhalb Deutschlands als auch international gesehen, so dass zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) ihr Klassifikationsschema ICIDH (zu Deutsch: Internationale Klassifikation der Schäden, Aktivitäten und Partizipation: Ein Handbuch der Dimensionen von gesundheitlicher Integrität und Behinderung) von 1980 verbesserte. Das 1999 geänderte ICIDH-2 stellt die Partizipation und die soziale Integration von Menschen mit einer „Behinderung“ in den Mittelpunkt und nicht mehr die Schädigung oder das Defizit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert die „geistige Behinderung“ durch eine unterdurchschnittliche allgemeine Intelligenz, die während der Entwicklungsperiode (Kindheit und Jugend) entsteht.
„International hat sich die ebenfalls von der WHO vorgenommene Klassifikation der geistigen Behinderung in vier Schweregradstufen durchgesetzt, die sich am Intelligenzquotienten orientiert (…).“ (Steinhausen 2005, S. 9f.) Nach internationalen Studien liegt die Häufigkeit der „geistigen Behinderung“ bei zwei bis drei Prozent, wobei der Anteil der leichten „geistigen Behinderung“ stärker in niedrigeren Sozialschichten auftritt. Dagegen ist die schwere „geistige Behinderung“ sehr viel weniger sozialschichtabhängig. Das männliche Geschlecht ist häufiger von einer „geistigen Behinderung betroffen, als das weibliche Geschlecht. (vgl. ebd., S. 10)
„Speziell in der Geistigbehindertenpädagogik wird zunehmend hinterfragt, was eigentlich ‚geistige Behinderung’ meint und ob es sich dabei eher um ein Faktum oder aber um eine soziale Zuschreibung bzw. ein Konstrukt handelt.“ (http://www.athena-verlag.de/1400.htm)
Wichtig ist es, den Menschen mit einer „Behinderung“ als eine ganzheitliche Person mit seinen individuellen Zügen wahrzunehmen. Ein weiteres Plädoyer für eine Definition gibt es auf einer Homepage zum Thema „geistige Behinderung“ (http://www.socioweb. de/lexikon/lex_geb/begriffe/geistig1.htm) und zwar: „Der Begriff ist eigentlich falsch, da die Personen, die er zu beschreiben meint, nicht in ihrem Geist behindert sind. Es handelt sich um Menschen, die wegen einer prä-, peri- oder postnatalen Schädigung primär in ihrer kognitiven Entwicklung beeinträchtigt sind, wodurch sie in modernen Industriegesellschaften auf mannigfache Weise in ihrer Entfaltung behindert werden und benachteiligt sind.“
Abschließend ist zu bemerken, dass die oben genannten Definitionsversuche gezeigt haben, dass es keine eindeutige Begriffsbestimmung für das Wort „Behinderung“ gibt bzw. es schwierig ist, eine geeignete Begriffbestimmung zu finden.
Die möglichen Ursachen für eine „geistige Behinderung“ werden unter fünf verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Es wird zwischen medizinischen, psychologischen, soziologischen, epidemiologischen und pädagogischen Gesichtpunkten unterschieden.
„Hauptaufgabe der Medizin ist (...) die Klärung der Ursachen und der Entstehungsgeschichte von geistiger Behinderung sowie die Entwicklung therapeutischer Maßnahmen.“ (Fornefeld 2004, S. 51) Prinzipiell geht der „geistigen Behinderung“ immer eine organische Schädigung zuvor, die das Gehirn direkt oder indirekt trifft. (vgl. ebd., S. 51)
Neuhäuser und Steinhausen haben 1999 ein überarbeitetes Klassifikationsschema mit Schädigungsbildern erstellt, die Klinischen Syndrome. Dort wird zwischen prä-, peri- und postnatalen Schädigungsformen unterschieden. Pränatal entstandene Formen „geistiger Behinderung“ sind zum Beispiel Genmutationen, das Fehlbildungs-Retardierungs-Syndrom, eine Fehlbildung des Nervensystems, Chromosomen- anomalien, exogen verursachte pränatale Entwicklungsstörungen und Idiopathische „geistige Behinderung“. Perinatale Komplikationen sind Geburtstrauma, Sauerstoffmangelversorgung des Gehirns, Frühgeburt und Erkrankungen des Neugeborenen. Postnatale Ursachen sind entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems (Hirnhaut- oder Gehirnentzündung), Schädel-Hirn-Traumen, Hirntumoren und Hirnschädigungen durch Vergiftungen, Sauerstoffmangel oder Stoffwechselkrisen. Trotz aller medizinischen Klassifikationstabellen ist es wichtig zu wissen, dass „geistige Behinderung“ kein statischer Zustand ist, das heißt sie kann in jeder Lebensphase entstehen. (vgl. Fornefeld 2004, S. 54)
Ebenso können zusätzliche Störungen wie Epilepsie, zerebrale Bewegungsstörungen oder Wahrnehmungsstörungen auftreten. Weitere Folgebeeinträchtigungen, die zu den psychiatrischen Krankheitsbildern gehören und ihre Ursache in der Hirnschädigung haben können, sind beispielsweise Autismus, Psychosen, Hyperaktivität, Stereotypien, Enuresis und Enkopresis oder Essstörungen. (vgl. ebd., S. 54f.)
„Die Ergebnisse jüngster Studien zeigen, dass biologische und genetische Faktoren bei der Entstehung von ‚geistiger Behinderung’ eine wichtige Rolle spielen.“ (ebd., S. 55)
Die psychologischen Gesichtspunkte befassen sich mit den Folgeerscheinungen der Hirnschädigung bezogen auf die emotionale und soziale Entwicklung des Menschen sowie das Lernen des Menschen. Lange Zeit stand lediglich die Lernfähigkeit im Vordergrund, so dass „geistige Behinderung“ nur als Intelligenzminderung aufgefasst wurde.
Damit das Intelligenzniveau festgestellt werden konnte, wurden einige Tests durchgeführt. Danach wurde entschieden, welche Sonderschulform das Kind mit einer „Behinderung“ besuchen sollte. (vgl. ebd., S. 56) Jedoch unterscheiden sich die „Richtwerte” für „geistige Behinderung“ je nach Untersuchungsverfahren, so dass nach Gontard eine leichte Intelligenzminderung bei IQ 50 bis 69 vorliegt, wobei nach Wendeler ein mäßiger Behinderungsgrad im IQ-Bereich 36 bis 52 liegt.
„Heute ist die Klassifikation nach Intelligenz-Werten in die Kritik geraten, weil sie sich als zu einseitig erwiesen hat.“ (ebd., S. 58)
Erstens ist es problematisch, dass das Kind nur nach seinen kognitiven Leistungen beurteilt wird und zweitens gibt ein Intelligenztest keine eindeutige Aussage, da seine Werte immer relativ sind.
Inzwischen hat man von der Selektionsdiagnostik auf die Förderdiagnostik umgestellt. Es wird versucht den Menschen mit einer „Behinderung“ ganzheitlich zu betrachten und zwar werden nicht nur die kognitiven Fähigkeiten beobachtet, sondern auch die sozialen, emotionalen und physischen.
„Geistige Behinderung ist bei aller neurophysischen oder genischen Bedingtheit stets auch Ausprägungsform der Sozialisation.“ (Speck 2005, S. 60)
Die soziologischen Aspekte sind von Bedeutung bezüglich des Verhältnisses „geistiger Behinderung“ und Sozialschicht. Schon in den siebziger Jahren wurde in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, dass „geistige Behinderung“ in allen Sozialschichten vorkommt, jedoch kam eine „Lernbehinderung“ auffällig oft in den unteren sozialen Schichten vor. Heutzutage ist nachgewiesen, dass eine „Lernbehinderung“ häufig keine genetische, sondern auch eine soziale Ursache haben kann. Gründe hierfür können zum Beispiel die mangelnde Bildung in den unteren Sozialschichten sein.
Die Epidemiologie befasst sich mit der Häufigkeit und Verbreitung von Erkrankungen. Im Zusammenhang mit „Behinderung“ wird im zweijährigen Abstand vom Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland eine Schwerbehindertenstatistik erstellt. Allerdings gibt diese Statistik keine klare Aussage her, da nicht eindeutig nach „Behinderungsarten“ unterschieden wird. (vgl. Fornefeld 2004, S. 63)
Weiterhin gibt es in den einzelnen Bundesländern gravierende Unterschiede bezüglich der Schulform, die die Menschen mit „geistiger Behinderung“ besuchen. Eine eindeutige Aussage lässt lediglich die geschlechtsspezifische Verteilung zu. Auf drei männliche Personen mit „geistiger Behinderung“ kommen zwei weibliche.
Die Epidemiologie ist im Kontext von „geistiger Behinderung“ heute noch Stückwerk. Sicherlich kann sie in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass „geistige Behinderung“ weiterhin empirisch erforscht wird.
Die pädagogische Aufgabe ist es, aus der Perspektive von Erziehung und Bildung auf den Menschen mit einer „Behinderung“ und seine Lebenssituation zu schauen, um dann verändernd einwirken zu können. (vgl. ebd., S. 67)
„Der pädagogische Aspekt bezieht sich im Falle einer geistigen Behinderung vor allem darauf, die Lernmöglichkeiten des Kindes auszuloten und durch eine entsprechende Gestaltung seiner Lernumwelt sein Lernen zu fördern.“ (Speck 2005, S. 67)
Das heißt, dass Erziehung immer möglich ist, wobei eine individuelle und spezifische Erziehung notwendig ist, um dem Menschen mit einer „Behinderung“ gerecht zu werden. Es ist wichtig, dass „geistige Behinderung“ nicht statisch, sondern als Prozess gesehen wird. Zur Veranschaulichung hat Speck ein Interaktionales Modell der Genese und des Prozesses geistiger Behinderung (vgl. Speck 2005, S. 70) entworfen. Dieses Modell fasst die vier Bestimmungsgrößen Psycho-physische Schädigung, Person, Umwelt und Geistige Behinderung zusammen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten (Abb. 1, Speck 2005, S. 70)
Das Modell von Speck verdeutlicht einmal mehr den wechselseitigen Prozess von „geistiger Behinderung“.
Zusammenfassend wird durch die oben exemplarisch genannten Definitionsversuche von „geistiger Behinderung“ die Unmöglichkeit einer klaren Begriffsbestimmung deutlich gemacht. Weiterhin wird durch die fünf Aspekte (medizinisch, psychologisch, soziologisch, epidemiologisch und pädagogisch) bezüglich der Ursachen von „geistiger Behinderung“ bestätigt, dass die Entstehung einer „geistigen Behinderung“ nicht nur einseitig bedingt ist, sondern dass mehrere Faktoren zusammenspielen. Durch das Hintergrundwissen auf der anthropologischen Ebene stellt sich nun die Frage, welche weiteren Aufgaben sich für die Pädagogik durch die Definitionen von „geistiger Behinderung“ ergeben.
Dieser Begriff ist nur ein Konstrukt der Gesellschaft, deshalb plädieren viele Fachleute dafür ihn abzuschaffen. Es soll eine neue Ordnung hergestellt werden, so dass der Begriff überflüssig wird. (vgl. http://www.socioweb.de/lexikon/lex_geb/begriffe/ geistig2.htm) Es ist für die pädagogische Arbeit erforderlich sich kontinuierlich bewusst zu machen, dass „geistige Behinderung“ nur ein Konstrukt ist. Dann könnte die Allgemeine Pädagogik und speziell die Geistigbehindertenpädagogik (als ein Teil der Allgemeinen Pädagogik) sich auf die Praxis und Theorie von Erziehung konzentrieren. Die Geistigbehindertenpädagogik bezeichnet sich als „Wissenschaft vom Menschen aus.“ (Fornefeld 2004, S. 17) Sie vermittelt Bildung und Erziehung entsprechend dem Lebensalter und den Fähigkeiten des zu Erziehenden. Außerdem verbindet sie medizinische, psychotherapeutische und sozial-rehabilitative Erkenntnisse für ihre Konzepte. Es wird ein Lebens-, Erziehungs- und Arbeitsraum für Menschen mit einer „Behinderung“ geschaffen, so dass keine Isolation entsteht, sondern eine optimale Förderung geschieht. (vgl. ebd., S. 17)
Aufgaben der Allgemeinen Pädagogik und speziell der Geistigbehindertenpädagogik sind vor allem eine ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen mit einer „Behinderung“ zu haben, um „Behinderung“ nicht als eine Krankheit anzusehen, sondern als ein gesellschaftliches Konstrukt. Hinzu kommt, dass jeder Mensch mit einer „Behinderung“ als Individuum angesehen werden sollte und entsprechend seiner Bedürfnisse behandelt wird und zwar nur soviel wie nötig, damit zum Beispiel keine Überbehütung entsteht.
Grundsätzlich gibt es etliche Definitionen und Klassifikationen für den Begriff „geistige Behinderung“. Jede Wissenschaft hat eigene Abgrenzungen gesetzt, wie zum Beispiel die Psychologie. Dort werden alle Menschen unter einem Intelligenzquotienten von 65 (+/-5) als „geistig behindert“ bezeichnet. Dagegen hat die Schulverwaltung den Intelligenzquotienten für den Besuch der Schule für Geistigbehinderte bei 60 (+/-5) und weniger festgelegt. „Seit 1995 liegt jedoch eine Empfehlung der Kultusminister-Konferenz vor, den für einen Schüler jeweils notwendigen Förderungsbedarf festzustellen und dann den dafür optimalen Lernort auszusuchen.“
(http://www.socioweb.de/lexikon/lex_geb/begriffe/geistig3.htm)
Aus der (sozial)medizinischen Sicht liegt die Grenze zur „geistigen Behinderung“ bei IQ 70. Die kinderpsychiatrische Sicht betont, dass mit einer „geistigen Behinderung eine unterdurchschnittliche allgemeine Intelligenz, die während der Entwicklungsperiode entsteht, und eine Beeinträchtigung des adaptiven Verhaltens (Anpassung) verbunden ist.“ (http://www.socioweb.de/lexikon/lex_geb/begriffe/ geistig3.htm) Wichtig ist anzumerken, dass mit dem Bezug auf die Intelligenz vor allem eine Beeinträchtigung von „Problemlösefertigkeiten“ vorliegt und nicht von „Lebensbewältigungstechniken“ und „sozialen Fertigkeiten“. Die pädagogische Sicht bezieht sich auf die Empfehlungen der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates, die im Kapitel 2.2 noch erläutert werden.
Demnach gilt „als geistig behindert, wer infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf.“ (http://www.socioweb.de/lexikon/lex_geb/ begriffe/geistig3.htm)
Letztendlich kommt es insbesondere darauf an, dass jeder Mensch mit einer „Behinderung“ als ein individueller Mensch angesehen wird, der ebenso alle Rechte und Möglichkeiten hat wie jeder andere Mensch. Zusätzlich muss der Mensch mit einer „Behinderung“ die Chance haben, ein Leben so normal wir möglich führen zu können, in dem ihm die notwendigen Hilfen angeboten werden und zwar nur die, die für ihn unerlässlich sind. (Prinzip der Selbstbestimmung)
à Angaben zu socioweb ändern, Lexikon Pflüger!!!
2 Soziale Integration
Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf die Soziale Integration von Menschen mit einer „geistigen Behinderung.“ Zuerst wird dieser Begriff in Abgrenzung zur Sensorischen Integration definiert, dann beziehe ich mich auf die Geschichte der Sozialen Integration und schließlich beschreibe ich die Soziale Integration von heute.
2.1 Begriffsklärung
Der Integrationsbegriff bezeichnet im Allgemeinen alle Zusammenhänge, die an einer „Herstellung einer Einheit“ (DTV - Lexikon 1999, Bd. 8, S. 306) beteiligt sind. Integration gibt es demnach nicht nur im sozialen Bereich, sondern sie kann zum Beispiel auch in naturwissenschaftlichen, technischen oder medizinischen Bereichen erfolgen.
In diesem Abschnitt wird, wie oben bereits erwähnt, die Soziale Integration von Menschen mit einer „geistigen Behinderung“ behandelt.
Zuerst ist es wichtig, die Soziale Integration von der Sensorischen Integration abzugrenzen. Man versteht unter der Sensorischen Integration die Koordination und das Zusammenspiel unterschiedlicher Sinnesqualitäten und -systeme. „Die Integration der Sinne ist das Ordnen der Empfindungen, um sie gebrauchen zu können. Unsere Sinne geben uns Informationen über den physikalischen Zustand unseres Körpers und über die Umwelt um uns herum.“ (Ayres 2002, S. 7)
Sensorische Integration ist im Zusammenhang mit Menschen mit „geistiger Behinderung“ vor allem im Bereich der Förderung wichtig. Falls eine Dysfunktion der Sensorischen Integration vorliegt, kann dieses evtl. zu Störungen im motorischen Bereich, zu Teilleistungsstörungen oder zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Eine Therapie zur Förderung der Sensorischen Integration beinhaltet hauptsächlich, dass der „Patient“ neue Sinneserfahrungen machen kann und lernt, alle Sinne anzuregen.
Zurück zur Begriffsbestimmung von Sozialer Integration, die Otto Speck folgendermaßen definiert: „Soziale Integration ist die wechselwirkende Ergänzung zur personalen Integration. Gemeint ist das Finden und Aufbauen sinnvoller Koppelungen des Individuums mit der sozialen Umwelt, (...)“ (Speck 2005, S. 185) Der Mensch mit einer „geistigen Behinderung“ muss versuchen innerhalb der Gesellschaft seine Rolle und seinen Status zu finden. Seine Kompetenzen müssen, bezüglich des Abbaus von sozialen Blockierungen und des Aufbaus sozialer Zugehörigkeit, erweitert werden. Soziale Integration ist demnach ein wechselseitiger Prozess zwischen Menschen mit und ohne einer „Behinderung“. Wobei es häufig so scheint, dass die Bereitschaft von Menschen mit einer „Behinderung“ größer ist, sich in die Welt der „Nichtbehinderten“ einzugliedern, als umgekehrt.
Günther Cloerkes schreibt dazu: „Wenn wir (…) von Integration sprechen, dann ist damit gemeint, daß[!] behinderte Menschen (…) in allen Lebensbereichen grundsätzlich die gleichen Zutritts- und Teilhabechancen haben sollen wie nichtbehinderte Menschen.“ (Cloerkes 2001, S. 175)
Soziale Integration heißt, dass sich die Menschen mit einer „Behinderung“ in die Gesellschaft eingliedern können beziehungsweise das gegenseitige Annähern von beiden Seiten ermöglicht. Der Mensch mit der „(geistigen) Behinderung“ soll sich idealtypisch nicht in die Welt der „Nichtbehinderten“ anpassen, sondern beide „Welten“ sollen miteinander „verschmelzen“ zu einer neuen, integrativen Welt.
Die praktische Umsetzung von Integration zum Beispiel im Schulsystem hat einige Hürden zu nehmen. Häufig haben Eltern von Kindern mit „geistiger Behinderung“ gar nicht die Wahl, ob ihr Kind den integrativen Unterricht oder eine Förderschule besucht. Zumeist ist es so, dass das Kind die Schule besucht, die am nächsten zum Wohnort gelegen ist. Außerdem fördert die „Schwere der Behinderung“ - im negativen Sinne - oft die Entscheidung, dass das Kind die Förderschule besucht. Dies ist problematisch, da schon zu Beginn der Integrationsbewegung in den siebziger Jahren unmissverständlich klar gemacht wurde, dass „Integration nicht teilbar ist!“ (vgl. Mand 2003, S. 143)
2.2 Geschichte der sozialen Integration
„Das bildungspolitische Programm ‚Integration’, ausgelöst durch das Gutachten der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates vom Oktober 1973, stellte die Sonderpädagogik nach dem Auf- und Ausbau des Sonderschulwesens, (…) vor die zweite große Herausforderung nach 1945.“ (Cloerkes 2001, S. 172)
Nachdem man im 19. Jahrhundert und auch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Menschen mit einer „Behinderung“ in speziellen Einrichtungen aussonderte (Der kustodiale Ansatz), begann nach 1945 eine neue Zeit. Der rehabilitativ-sonderpädagogische Ansatz setzte sich vor allem in den sechziger Jahren in Deutschland durch. Der Mensch mit einer „Behinderung“ wird professionell gefördert und therapiert durch medizinische, pädagogische und psychologische Maßnahmen.
Es gibt Sondereinrichtungen wie Kindergärten, Sonderschulen und Werkstätten beziehungsweise Wohnheime für Menschen mit einer „Behinderung“. Integration ist lediglich ein „Fernziel“ des rehabilitativen-sonderpädagogischen Ansatzes. Dennoch ist dieser Ansatz immer noch das vorherrschende Leitbild in Deutschland. (vgl. Der Paritätische Wohlfahrtverband 1990, S. 1f.)
Der Deutsche Bildungsrat beschloss schließlich, nach einer dreijährigen Beratungsphase, am 12./13. Oktober 1973 in Bonn die Empfehlungen „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“. (vgl. http://www.gew-nds.de/sos/html/body_memorandum.html)
Bevor in Deutschland durch den Deutschen Bildungsrat 1973 die ersten integrativen Ansätze im Hinblick auf die Zusammenführung von Menschen mit und ohne einer „Behinderung“ beschlossen wurden, entstand das Normalisierungsprinzip.
„Der Geist des Normalisierungsprinzips wirkte sich dann in Deutschland zunächst so aus, dass zu Beginn der zweiten Hälfte der siebziger Jahre (...) zunächst erst zaghaft vereinzelte, in den folgenden Jahren jedoch immer mehr integrative Kindertagesstätten als Modellversuche entstanden.“ (http://www.bpb.de/publikationen/8Q7ACX,0,0,Zur_ schulischen_und_beruflichen_Integration_von_Menschen_mit_geistiger_Behinderung.
html)
Das Normalisierungsprinzip stammt aus Skandinavien von Bank-Mikkelsen (1972) und Nirje (1974) und wurde in den Vereinigten Staaten von Wolfensberger (1972) weitergeführt. Prinzipiell geht es darum, den Menschen mit einer „geistiger Behinderung“ ein Leben zu ermöglichen, dass so „normal“ wie möglich ist. Konkret heißt das unter anderem, ein Abbau der großen Anstalten mit Massenunterbringung, die gleichen Rechte für Menschen mit einer „geistigen Behinderung“ oder die Verfügbarkeit von allen Diensten. Problematisch waren und sind die zahlreichen Missverständnisse, die bezüglich des Inhalts des Normalisierungsprinzips aufkamen und aufkommen. Es sollte unbedingt beachtet werden, dass es beim Normalisierungsprinzip nicht darum geht Menschen mit einer „geistigen Behinderung“„normal“ zu machen. (vgl. Speck 2005, S. 175) Die vier wichtigsten Punkte des Normalisierungsprinzips noch einmal zusammengefasst, sind die Alltagsorientierung, die Partizipation (=Teilhabe) sowie die Regionalisierung und die Dezentralisierung. Speck verdeutlicht die Wichtigkeit dieses Prinzips: „Ein komplexes normatives Orientierungsprinzip für eine sinnvolle Gestaltung von Erziehung und Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung stellt das Normalisierungsprinzip dar.“ (ebd., S. 175)
Nach der Reform in der Sonderpädagogik kam es im (Sonder-)Schulwesen zaghaft zu einigen Veränderungen. Im Zusammenhang mit Sozialer Integration von Menschen mit einer „Behinderung“ im Schulwesen, hier ein kurzer Ausschnitt zu den Entwicklungen in Deutschland. Nachdem in den siebziger Jahren die ersten integrativen Kindergärten und Kindertagesstätten eingerichtet wurden, begann man in einigen Grundschulen die ersten Modellversuche zum integrativen Unterricht einzuführen.
Zu Beginn der achtziger Jahre erkannte man die Notwendigkeit, dass sich die Sonderpädagogik und die Regelschulen besser abstimmen mussten. Ende der achtziger Jahre kamen die ersten Versuche, den integrativen Unterricht in die Sekundarstufe Eins einzuführen. In den neunziger Jahren versuchten sich auch die neuen Bundesländer, zum Beispiel Brandenburg mit der Umsetzung des integrativen Unterrichts.
Zu den heutigen Aufgaben gehört es vor allem, dass das Interesse der Öffentlichkeit weiterhin geweckt wird und die Politik in die Verantwortung genommen wird, damit sich der integrative Unterricht künftig durchsetzen kann. (vgl. Schnell 2003, S. 81-87) Cloerkes bezeichnet es als problematisch, dass der Integrationsbegriff häufig nur auf den Schulbereich übertragen wird. „Allgemein wird in der Pädagogik unter Integration die gemeinsame Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder verstanden.“ (Cloerkes 2001, S. 173)
Jakob Muth (Leiter der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates von 1973) forderte deshalb, dass „Integration als Grundrecht in allen Lebensbereichen“ (ebd., S. 173) gilt. „Integration ist ein ‚Grundrecht im Zusammenleben der Menschen’ (…).“ (ebd., S. 174)
Die bereits oben genannte Vorstellung, dass die schulische Integration automatisch für die Soziale Integration sorgt, hat bei vielen zu der logischen Konsequenz geführt, dass das Wort Integration sich lediglich auf den schulischen Bereich bezieht. (vgl. ebd., S. 222) Im außer- und nachschulischen Bereich begannen die ersten integrativen Prozesse Mitte der siebziger Jahre. Initiatoren waren einige Eltern, die sich gegen die Institution Sonderkindergarten zur Wehr setzten. Sie befürchteten, dass ihre Kinder dadurch schon sehr früh zu einer Sonderstellung in der Gesellschaft kamen.
Zwischen 1979 und 1992 erprobten fast alle Bundesländer die geförderten Modellversuche zur integrativen Erziehung im Elementarbereich.
1998 lag die vorschulische Integrationsquote bereits bei 43 Prozent. Heutzutage ist die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne einer „Behinderung“ in integrativen Kindergärten zur Normalität geworden.
Zum Teil nehmen Sonderkindergärten auch nichtbehinderte Kinder auf. (vgl. Cloerkes 2001, S. 222f.) Die Integration im Freizeitbereich weißt immer noch große Mängel auf, weil es in der Gesellschaft häufig die verbreitete Meinung gibt: „behinderter Mensch = behinderte Freizeit“ (ebd., S. 223). Viele Menschen mit einer „(geistigen) Behinderung“ stehen im späteren Berufsleben vor dem Problem, dass sie nur die Möglichkeit der Arbeit in der WfB (= Werkstätten für Behinderte) haben. Sie stehen vor dem Dilemma, dass sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu wenig Schutz und Hilfe erfahren. Jedoch haben sie auf dem Sonderarbeitsmarkt der WfB zu wenig Normalität und Existenzabsicherung. (vgl. ebd., S. 224f.) Das integrative Wohnen ist auch weiterhin ausbaufähig, zumal es bisher kaum Projekte in diesem Bereich gegeben hat. Inzwischen fordern viele Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen ein gemeindenahes und stadtteilintegriertes Wohnen.
Rückwirkend kann man sagen, dass das Gutachten der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates von 1973 viele positive Entwicklungen für die Integration von Menschen mit einer „Behinderung“ ausgelöst hat. Beispielsweise wurde in den einzelnen Bundesländern eine Vielfalt von Integrationsformen entwickelt. Außerdem wurde 1994 die Forderung des Deutschen Bildungsrates angenommen, in der es hieß, dass die Förderbedürftigkeit eines Kindes mit einer „Behinderung“ nicht mit Sonderschulbedürftigkeit gleichzusetzen ist, sondern in jedem Einzelfall individuell entschieden werden muss, wo der beste Ort zum Lernen ist. (vgl. http://www.gew-nds.de/sos/html/body_memorandum.html)
Dennoch muss man die Entwicklung der Integration von Menschen mit einer „Behinderung“ in allen Lebenslagen als einen langwierigen Prozess betrachten, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Es kann zum Beispiel durch die enormen Sparmaßnahmen des Staates im Bildungsbereich zu Kürzungen kommen, die sich negativ auf die bereits existierenden Integrationsmaßnahmen auswirken beziehungsweise neue Maßnahmen gar nicht erst zur Geltung kommen.
Ferner gibt es in vielen Schulverwaltungen, aufgrund von Personalmangel, große Widerstände gegen eine Förderung der Integration. (vgl. http://www.gew-nds.de/ sos/html/body_memorandum.html)
Letztendlich wird das Engagement aus der Gesellschaft für die Integration ausschlaggebend sein, wie ausbaufähig und erfolgreich Integration in der Zukunft ist.
2.3 Soziale Integration heute
Kapitel 2.2. hat bereits einen kurzen Überblick gegeben, inwieweit Soziale Integration in den letzten Jahren und Jahrzehnten umgesetzt worden ist. Kapitel 2.3 gibt einen Überblick über die Situation beziehungsweise die Umsetzung von heute.
Nachdem 1973 die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates ihr Gutachten zur Integration veröffentlichte, entstand in Deutschland langsam eine Reform des Sonder- schulwesens. Krawitz (1999) und Markowetz (2001) haben für die praktische Umsetzung von Integration einige theoretische Grundsätze und Prinzipien bestimmt. Diese sind unter anderem:
1. „Prinzip des Rekurs auf den ethischen Imperativ unserer Verfassung“
2. „Prinzip der Normalisierung“
3. „Prinzip der Unteilbarkeit“
4. „Prinzip der Ganzheitlichkeit“
5. „Prinzip der Abkehr vom Primat der Förderung und Therapie“
6. „Prinzip der Individualisierung“
7. „Prinzip des Elternwahlrechts und der Selbstbestimmung“
8. „Prinzip der Freiwilligkeit“
9. „Prinzip der Regionalisierung und Dezentralisierung“
10. „Prinzip der Vielförmigkeit“
11. „Prinzip des Dialogischen“
12. „Prinzip der ‚Kooperation am gemeinsamen Lerngegenstand’ “
(Cloerkes 2001, S. 180ff.)
Die oben genannten zwölf Prinzipien versuchen das ganze theoretische Spektrum von Integration abzudecken. Beginnend mit dem allgemeinen Teil und zwar dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in dem es heißt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG)
Demzufolge gibt es nur die eine Schule beziehungsweise den einen Kindergarten und keine Sondereinrichtungen mehr. Normalisierung gehört zu den Grundlagen von Integration. Alle Menschen mit einer „Behinderung“ sollen so „normal“ wie möglich leben.
Unteilbarkeit, Ganzheitlichkeit, die Abkehr von Förderung und Therapie sowie die Individualisierung beziehen sich größtenteils auf den Kindergarten- und Schulbereich.
Integration darf nicht teilbar sein zwischen Integrationsfähig und Integrationsunfähig.
Der Mensch mit einer „Behinderung“ muss als ganzheitliche Person akzeptiert werden, die nur soviel Hilfe braucht, wie notwendig. Förderung und Therapie sind nach wie vor vertretbar und notwendig, jedoch müssen sie sich mehr auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Klientel spezialisieren.
Im besten Fall werden neue Projekte zur integrativen Förderung und Therapie entwickelt und anschließend durchgeführt. Individualisierung ist sehr weit gefasst, da damit sowohl die Lebensqualität des Menschen mit einer „Behinderung“ verstanden wird und ferner die Handlungskompetenzen zur Lebensbewältigung gemeint sind. Wichtig ist es, dass die Wünsche, Bedürfnisse und Besonderheiten des individuellen Menschen miteinbezogen werden. Das Prinzip des Elternwahlrechts und das Prinzip der Freiwilligkeit sind notwendig, damit integrative Prozesse freiwillig passieren unter anderem durch Mitwirkung und Mitbestimmung der Eltern. Regionalisierung und Dezentralisierung, Vielförmigkeit, das Dialogische und „Kooperation am gemeinsamen Lerngegenstand“ beziehen sich sowohl auf die institutionelle Ebene als auch auf die Kommunikation. Erstens muss es für Menschen mit einer „Behinderung“ möglich sein, dass integrative Institutionen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld vorhanden sind und diese verschiedene Formen von Integration anbieten.
Zweitens ist das Dialogische Prinzip (Martin Buber) in der Integrativen Pädagogik wichtig, da sich in der Integration Menschen mit und ohne einer „Behinderung“ immer wieder annähern und entfernen. Jedoch reicht der bloße Kontakt nicht aus, es müssen weitere Kontakte über einen Lerngegenstand vermittelt werden, so dass ein „kleinstes gemeinsames Vielfaches“ entstehen kann. (vgl. Cloerkes 2001, S. 180ff.)
Durch die Praxis haben sich in der Integrationspädagogik mehrere Theorieansätze herausgebildet. Heutzutage spielen vier Theorieansätze eine bedeutsame Rolle:
- Die Theorie des gemeinsamen Lerngegenstandes - Materialistisches Modell (Georg Feuser)
- Die Theorie integrativer Prozesse - Integration als Prozess (Helmut Reiser)
- Der Ökosystemische Theorieansatz - Ökosystemisches Modell (Alfred Sander)
- Anthropologisch-ethisches Modell (Urs Haeberlein)
Diese vier Theorieansätze beschreibt Ulrich Heimlich in „Integrative Pädagogik“ sowie Günther Cloerkes im Buch „Soziologie der Behinderten“ als die entscheidenden Theorieansätze in der Integrativen Pädagogik.
Die Theorie des gemeinsamen Lerngegenstandes - Materialistisches Modell von Georg Feuser zählt zu den einflussreichsten Theorien in der Integrativen Pädagogik.
Sie bezieht sich auf ein Verständnis von Integration „als Kooperation aller auf Basis ihrer Fähigkeiten am gemeinsamen Gegenstand (...).“ (Heimlich 2003, S. 152) Die Theorie von Feuser „hält die ‚kooperative Tätigkeit der Subjekte im Kollektiv’ für unverzichtbar (...).“ (Cloerkes 2001, S. 184) Für Feuser ist es bedeutend, dass die „Entfaltung von Lerngegenständen“ so früh wie möglich beginnt, so dass eine „konsequente Integration“ (ebd., S. 185) von Geburt an möglich ist. Dann kann der „gemeinsame Lerngegenstand“ möglichst früh beginnen, sich weiterentwickeln und lange überdauern.
Die Theorie integrativer Prozesse - Integration als Prozess von Helmut Reiser untersucht Integration unter psychoanalytischen Gesichtpunkten als einen Prozess, der auf mehreren Ebenen stattfindet. Diese Ebenen sind die innerpsychische, die interaktionelle, die institutionelle und die gesellschaftliche Ebene. „Erst wenn diese vier Ebenen integrativer Prozesse sich in Wechselwirkung befinden, kann von einer dynamischen Integrationsentwicklung gesprochen werden.“ (Heimlich 2003, S. 155) Durch das Denken auf den vier Ebenen ist es möglich, Integration aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Wenn beispielsweise auf der institutionellen Ebene ein Prozess ausgelöst wird, kann dieser unwirksam bleiben, wenn er sich nicht auf die innerpsychische und interaktionelle Ebene bezieht. Das Modell von Reiser macht deutlich, dass Integration mehr ist als ein „Beisammensein von behinderten und nichtbehinderten Menschen.“ (Cloerkes 2001, S. 187) Integration ist ein Prozess, der sich auf mehrere Ebenen bezieht und alle etwas angeht, da Integration ansonsten schwer umzusetzen ist.
Der Ökosystemische Theorieansatz - Ökosystemisches Modell von Alfred Sander hat seine Basis in dem sozialökologischen Modell von Urie Bronfenbrenner. Er teilt die Menschen in ein Person-Umwelt-System, bestehend aus vier verschiedenen Unterteilungen und zwar das Mikro-, das Meso-, das Exo- und das Makrosystem. Das Mikrosystem bezieht sich zum Beispiel auf die Familie oder die Schule, das Mesosystem ist das System zwischen zwei verschiedenen Mikrosystemen. Das Exosystem ist das „kommunale soziale Netz- und Stützsystem“ (ebd., S. 188), da der Mensch dort in Wechselwirkung mit formellen (zum Beispiel: Ämter, Behörden) und informellen Gruppen (zum Beispiel: Nachbarn, Verein) steht. Das Makrosystem bestimmt zum Beispiel das Wirtschafts-, Sozial- und Bildungssystem.
Sander versucht in seiner Beschreibung von „Behinderung“, dass der Blick vom Individuum Mensch mit einer „Behinderung“ abweicht und auf das System beziehungsweise das konkrete Umfeld gelenkt wird. (vgl. Cloerkes 2001, S. 189f.) Inzwischen ist das ökologische Modell integrativer Pädagogik von Alfred Sander ein „tragfähiges (...) anerkanntes erziehungswissenschaftliches Modell.“ (Heimlich 2003, S. 164)
Das Anthropologisch-ethische Modell von Urs Haeberlein beschreibt Integration als eine „uneingeschränkte Solidarität für Menschen mit Behinderung.“ (ebd., S. 169)
Haeberlein zeigt durch seine langjährige Forschungstätigkeit und seine Beiträge zur Theoriebildung, dass eine wertgeleitete Heilpädagogik mit den Modellen der Integrativen Pädagogik vereinbar ist. (vgl. ebd., S. 169) Demnach ist Heilpädagogik als eine Teildisziplin der Pädagogik keine Konkurrenz für die Integration, sondern eine zusätzliche Erkenntniserweiterung in der Integrativen Pädagogik. Heilpädagogik heute steht nicht mehr für eine Sonderbehandlung von Menschen mit einer „Behinderung“.
Sie steht für die Integration in die Gesellschaft, damit für Menschen mit einer „Behinderung“ ein „Leben so normal wie möglich“ realisierbar wird. (vgl. ebd., S. 169)
Zusammenfassend ist Integration heute ein Thema, das in der Sonder- und Heilpädagogik kontrovers diskutiert wird. (vgl. Cloerkes 2001, S. 190)
Viele Experten streiten inzwischen, ob es zu einem Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik gekommen ist bzw. kommen wird. Das sonderpädagogische Paradigma bezieht sich auf die traditionelle Sonder- und Heilpädagogik in dem die Menschen mit einer „Behinderung“ in Sondereinrichtungen unterrichtet werden, leben und arbeiten. Fragwürdig ist, ob das integrative das sonderpädagogische Paradigma ersetzt hat oder es zwei konkurrierende Paradigmen sind. Feuser vertritt die Idee, dass beide Paradigmen nebeneinander existieren können. Jedoch sieht Eberwein das Ende der Sonderpädagogik nahen, in dem das integrative Paradigma in Zukunft das einzige relevante ist. Er vertritt die These, dass „soziale Integration (…) nicht durch schulische Separation hergestellt werden“ (ebd., S. 192) kann.
Letztendlich erreichten die Diskussionen Mitte der neunziger Jahre ihren Höhepunkt, so dass inzwischen wieder Ruhe eingekehrt ist. Es wurde sich auf das Wesentliche konzentriert, um die praktische Umsetzung von Integrativer Pädagogik weiterzuentwickeln. Cloerkes fasst zusammen, dass „ein Paradigmenwechsel von der Sonderpädagogik hin zur Integrationspädagogik (…) insbesondere aus behindertensoziologischer Sicht nicht festgestellt werden“ (ebd., S. 194) kann.
Die Frage, ob Soziale Integration nur dann stattfinden kann, wenn Integrative Pädagogik vertreten wird, bleibt weiterhin offen. Meiner Meinung nach, sollte man sich darauf konzentrieren, dass es Menschen mit einer „Behinderung“ möglich ist, sich sozial zu integrieren. Es ist letztendlich egal, ob Integration nun durch die traditionelle Sonderpädagogik oder durch die Integrative Pädagogik realisiert wird. Es ist weitaus bedeutsamer, dass der Mensch mit einer „Behinderung“ überhaupt die Möglichkeit bekommt sich sozial zu integrieren.
[...]
- Arbeit zitieren
- Diplom Janina Komm (Autor:in), 2006, Integrativer Unterricht für Grundschulkinder mit einer geistigen Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65693
Kostenlos Autor werden









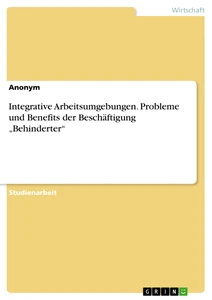










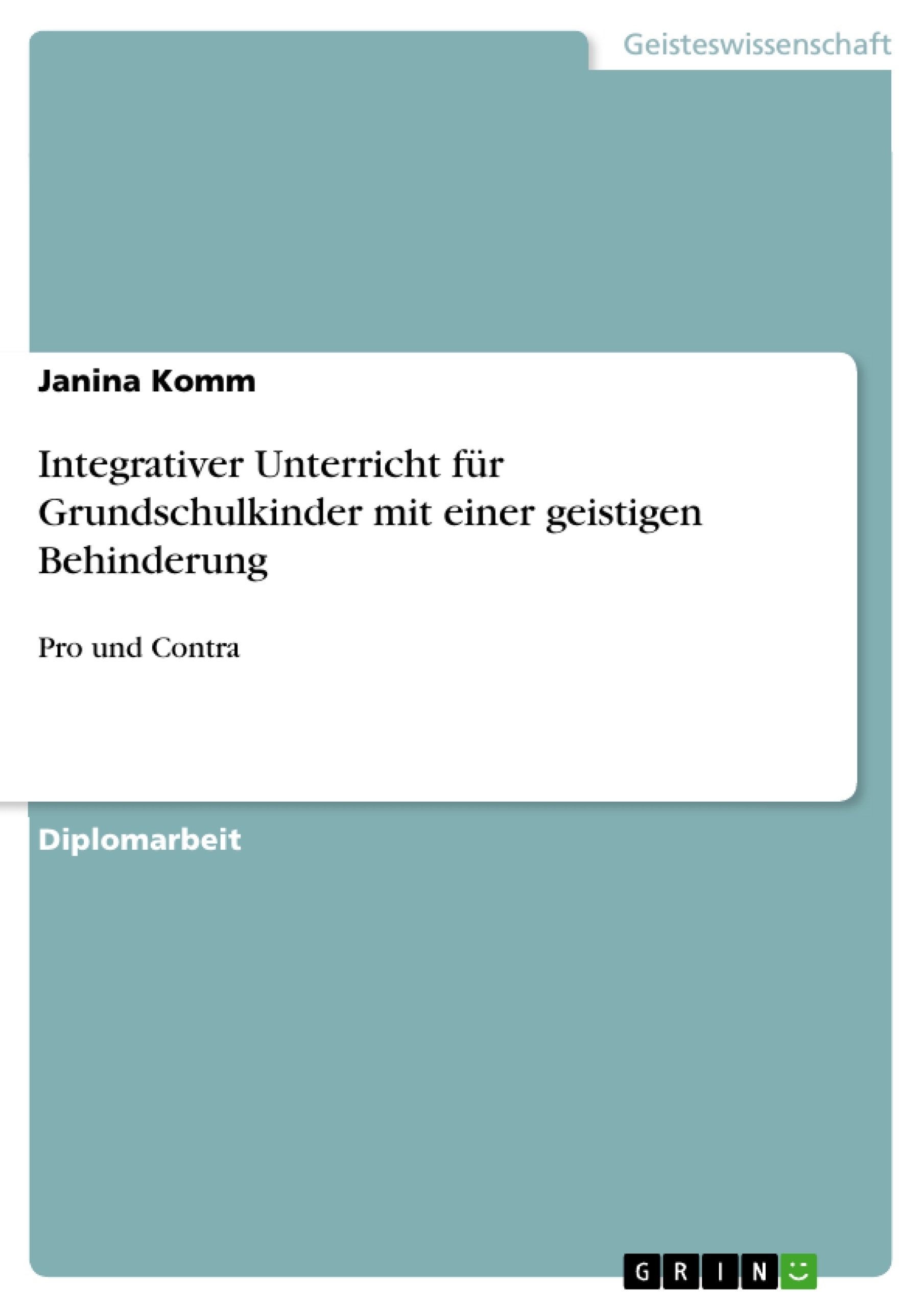

Kommentare