Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung und Gliederung
1.1. Konkretisierung der Aufgabenstellung
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Die ökonomische Theorie des Föderalismus
2.1. Begriffliches
2.2. Die Aussagen der ökonomischen Theorie des Föderalismus
2.2.1. Grundlegende Bemerkungen
2.2.2. Das Ausgangsmodell nach Olson
2.2.3. Die Verfolgung finanzpolitischer Zielsetzungen in föderativen Staaten
2.2.3.1. Allokationstheoretische Überlegungen zu einem föderativen Staatsaufbau
2.2.3.2. Verteilungspolitische Überlegungen zu einem föderativen Staatsaufbau
2.2.3.3. Stabilitätspolitische Überlegungen zu einem föderativen Staatsaufbau
2.3. Die Zuordnung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen
2.4. Fazit zur ökonomischen Theorie des Föderalismus
3. Die Erzberger’sche Finanzreform
3.1. Das Deutsche Reich von 1871
3.1.1. Die Stellung der Gemeinden während des Kaiserreichs
3.1.2. Fazit zum Deutschen Reich von 1871
3.2. Die Weimarer Republik
3.2.1. Die Kompetenzenverteilung in der Weimarer Verfassung
3.2.1.1. Die Aufgabenverteilung
3.2.1.2. Die Einnahmeverteilung
3.2.1.2.1. Die Regelung der Gesetzgebungshoheit
3.2.1.2.2. Die Regelung der Ertragshoheit
3.2.1.2.3. Die Regelung der Verwaltungshoheit
3.3. Die Elemente der Erzberger’schen Finanzreform
3.3.1. Die ideelle Ausgangslage
3.3.2. Das Reformwerk
3.3.2.1. Die Steuerreform
3.3.2.1.1. Die Regelung der direkten Steuern
3.3.2.1.2. Die Regelung der indirekten Steuern
3.3.2.2. Die Reichsabgabenordnung
3.3.2.3. Das Landessteuergesetz
3.3.2.3.1. Die Regelung der Landessteuern und Gemeindeabgaben
3.3.2.3.2. Die Regelung der Anteile an den Verbundsteuern
3.3.2.3.3. Die Regelung der Lastenverteilung
3.3.2.4. Die Auswirkung des Landessteuergesetzes auf die Gemeinden
3.3.3.Fazit zur Erzberger’schen Finanzreform
4. Die föderalismustheoretische Auswertung der Finanzreform
4.1. Die Steuerreform aus föderalismustheoretischer Sicht
4.1.1. Allokative Argumente
4.1.2. Distributive Argumente
4.1.3. Stabilitätspolitische Argumente
4.2. Die Reichsabgabenordnung aus föderalismustheoretischer Sicht
4.2.1. Allokative Argumente
4.3. Das Landessteuergesetz aus föderalismustheoretischer Sicht
4.3.1. Allokative Argumente
5. Schlussresümee
Literaturverzeichnis
Anhang
Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung und Gliederung
Die Erzberger’sche Finanzreform[1] war eine der wichtigsten Reformen in der jüngeren deutschen Finanzgeschichte – auch wenn sie heutzutage weitgehend vergessen ist, prägt sie doch von ihrer Form her und auch von einzelnen Bestimmungen sogar noch die Finanzverfassung der Bundesrepublik.[2] Sie ist gleichsam als Reaktion auf die Niederlage im 1. Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches[3] zu sehen. Nach Kriegsende erdrückte das Reich eine immense Schuldenlast durch die Kriegsanleihepolitik sowie Reparationszahlungen und kriegsbedingten sozialen Folgekosten nach der Niederlage. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ein großes fiskalisches Interesse des sich neu konstituierenden Staates (Weimarer Republik) bestand und in der Verfassung durch eine starke Stellung des Reichs ihren Niederschlag fand. Zudem schon zu Beginn des 1. Weltkriegs eine Stimmung herrschte, die auf politische und gesellschaftliche Einheit drang. Wirtschaftspolitisch einschneidende Maßnahmen wurden reichseinheitlich durchgeführt (Ermächtigungsgesetz), was die herrschende Stimmung zusätzlich unterstützte.[4] Auch muss beachtet werden, wenn man bedenkt, dass Staatsstrukturen oft historisch, kulturell oder gesellschaftspolitisch bedingt sind und nicht ökonomischen Argumenten folgen[5], dass Begriffe auch von gesellschaftlichen und politischen Werten abhängen und sich wandeln können.
So wird heute Föderalismus als Organisationsprinzip von verschiedenen politischen und wissenschaftlichen Grundpositionen grundsätzlich positiv gesehen. Man versteht darunter u.a. mehr Basisdemokratie, horizontale und vertikale Machtbegrenzung des Staates sowie eine Verbesserung der Effizienz staatlicher Entscheidungen durch politischen Wettbewerb zwischen Gebietskörperschaften.[6]
In der Historie sieht das anders aus: Meinte Föderalismus bei der Reichsgründung 1871 noch einen Bundesstaat und damit die Struktur des Deutschen Reiches, verstand man in der zweiten Hälfte des Bestands des Deutschen Reiches die Wahrnehmung der Interessen der Gliedstaaten gegenüber dem Bundesstaat, danach sogar diese selbst als Föderalismus. Der Begriff hatte sich gewandelt und sich beschränkt auf die Beziehung zwischen Gliedstaaten und Gesamtstaat; die Beziehung zwischen Reich und Länder sollten föderativ sein. Da aber die gesellschaftliche und politische Stimmung zu Beginn der Weimarer Republik von Einheit geprägt war, waren die Vertreter einer starken Stellung der Gliedstaaten den Anhängern einer starken Reichsgewalt suspekt. Sie übertrugen ihre Ablehnung auf den Begriff Föderalismus und engten ihn insofern ein, dass damit nur die Erhaltung der Eigenstaatlichkeit der Gliedstaaten als Föderalismus galt. Wer Föderalismus befürwortete, meinte die unverminderte Stärke der Gliedstaaten in Gegensatz zum Reich. Wer Zentralismus oder Unitarismus sagte, wünschte eine starke Reichsgewalt – die Idee, dass Föderalismus die Bundesstaatsidee als solche meinte, ging verloren.[7]
Die Mehrheit der Nationalversammlung in Weimar war unitarisch gesonnen, eine zentralistische Grundstimmung überwog. Verstärkt wurde dies durch die Taktik der sich als Unitarier fühlenden Akteure, föderalistische Strukturen im Gegensatz zur staatlichen Einheit zu stellen und so zu diskreditieren. Damit war auch die Vorstellung verbunden, dass das deutsche Volk sich erst im Einheitsstaat eine demokratische Verfassung geben könne. Die Orientierung zum Einheitsreich bedeutete Abkehr vom „obrigkeitlich-konstitutionellen Föderalismus[8] “, hin zu einer demokratischen Ordnung.
Die unitarischen Ideen wurden zusätzlich von dem auf Druck der Alliierten am 28. Oktober 1918 eingeführten parlamentarischen System dadurch gefördert, dass der Bundesrat des Deutschen Reichs als föderatives Element und daher zentrales Reichsorgan zugunsten des Reichstags in den Hintergrund trat. Der politische Einfluss der einzelstaatlichen Regierungen, besonders die hegemoniale Übermacht Preußens, wurde damit erheblich vermindert.[9]
1.1. Konkretisierung der Aufgabenstellung
Man merkt hier schon, dass ein historisches besetztes Thema andere Anforderungen und Schwerpunkte hat, als ein aktuelles. Wie schon oben angedeutet, kennen viele die Erzberger’sche Finanzreform nicht. Also ist zu fragen, was sie denn überhaupt war, was veränderte und bewirkte sie? Fragt man nach einer Änderung, sollte man eine Ausgangsbasis haben, also eine Einbettung in die Geschichte. Gleichzeitig muss man auch die „Wirkung“ der Änderung interpretieren. Dies soll laut Themenstellung aus der Sicht der ökonomischen Theorie des Föderalismus geschehen. Die Frage ist demnach, wie das Ergebnis der Erzberger’schen Finanzreform aus der Sicht der ökonomischen Föderalismustheorie zu bewerten ist.
Die ökonomische Föderalismustheorie geht dabei normativ von der Existenz unterschiedlicher regionaler Präferenzen aus, die am besten durch dezentrale Einheiten befriedigt werden können. Produktionstechnisch gesehen kann diese Aussage allerdings modifiziert werden, wenn steigende Skaleneffekte zu erwarten sind. Betrachtet man auch verteilungs- und stabilitätspolische Aspekte, so ist ein föderativer Aufbau als die geeignete Organisationsform zu sehen. Die ökonomische Föderalismustheorie fragt in dieser Hinsicht auch nach der zweckmäßigen Zentralität der Aufgabenerfüllung und der Finanzierung.
Wie sicherlich in der Einleitung ersichtlich geworden ist, wurde durch die Erzberger’sche Finanzreform die Stellung des zentralen Reichs enorm gestärkt, sogar das gesamte Steuersystem auf eine neue Basis gestellt. Die Hypothese lautet daher, dass die Reform aus föderalismustheoretischer Sicht insgesamt negativ zu bewerten ist.
Es ist offensichtlich, dass aus Zeit- und Platzgründen keine detaillierte Beschreibung der Geschichte und der Finanzreform, wie bei Historikern üblich, erfolgen kann. Die zu beschreibenden Teile sind daher nach der föderalistisch-theoretischen Fragestellung gemäß ausgewählt und gewichtet.
1.2. Aufbau der Arbeit
Die Aufgabenstellung erfolgt in vier Schritten, die im folgenden kurz skizziert sind:
- In Kapitel 2 soll die zugrundegelegte „Ökonomische Theorie des Föderalismus“ dargelegt werden. Eingeführt wird dieses Kapitel durch einige notwendige definitorische Begriffe, die zum Verständnis des Themas wichtig sind.
- Kapitel 3 ist vorwiegend deskriptiv aufgebaut und nach föderalismustheorie-relevanten Gesichtspunkten ausgewählt. Zunächst soll ein kurzer historischer Überblick über die Entwicklung der Finanzgeschichte des Deutschen Reiches seit 1871 gegeben werden, um eine Ausgangsbasis zu haben. Hierbei ist nicht nur das Reich-Einzelstaaten-Verhältnis relevant, sondern auch die Stellung der Kommunen im Deutschen Reich. Anschließend soll die Erzberger’sche Finanzreform analysiert werden. Ausgangspunkt ist dabei die Finanzverfassung - der Weimarer Republik. Diese Vorgehensweise ist notwendig für das Verständnis der in Kapitel 4 folgenden Bewertung.
- Im 4. Kapitel wird die Erzberger’sche Finanzreform aus der Sicht der ökonomischen Theorie des Föderalismus bewertet sowie im in 5. Kapitel die Ergebnisse zusammengefasst und abschließend dargelegt.
2. Die ökonomische Theorie des Föderalismus
2.1. Begriffliches
Im Verlauf dieser Arbeit werden einige Begriffe genannt, über deren Bedeutung Klarheit herrschen sollte, daher werden im folgenden die Begriffe Föderalismus, Bundesstaat, Unitarisierung, Zentralisierung und Dezentralisierung sowie dezentraler Einheitsstaat definitorisch festgelegt.
Föderalismus bezeichnet nach Laufer/Münch[10] ein Organisationsprinzip für ein gegliedertes Gemeinwesen, in dem grundsätzlich gleichberechtigte und eigenständige, aber auch in enger Verbindung stehende Glieder zu einer übergreifenden politischen Gesamtheit zusammengeschlossen sind. Viele Autoren[11] zählen fernerhin soziologische, staatsrechtliche, institutionelle sowie philosophische Definitionen auf und fragen u.a. nach einer möglichen Verzahnung mit der ökonomischen Fragestellung , die überwiegend aus allokationstheoretischen Überlegungen abgeleitet werden und daraus einen föderativen Aufbau des Staates begründen.
Der Begriff des Bundesstaats bezieht sich hingegen nur auf die staatliche Gliederung als solche und ist die staatsrechtliche Verbindung nicht-souveräner Gliedstaaten, bei der die völkerrechtliche Souveränität allein beim Zentralstaat liegt. Sowohl Gesamtverband als auch die Glieder besitzen von der Verfassung her Staatscharakter. Die Kompetenzen sind dabei zwischen Zentral- und Teilorganen so aufgeteilt, dass keine der Ebenen uneingeschränkte Regelungsmacht erhält, insbesondere nicht über die Kompetenz verfügt, die Kompetenz der anderen Ebene ohne deren Zustimmung einzuschränken oder auszuweiten (die sog. „Kompetenz-Kompetenz“). Die wichtigsten Aspekte eines Bundesstaates sind eigenverantwortliche Entscheidungskompetenz, gewisse finanzielle Eigenständigkeit sowie verfassungsrechtlich gesicherte Möglichkeiten, an der Willensbildung des Zentralstaats beteiligt zu sein.[12]
In der ökonomischen Theorie wird der Begriff des föderativen System allerdings auf jeden Staatsaufbau angewendet, der auch untere Entscheidungsebenen mit Aufgaben- und Einnahmenautonomie umfasst. Es wird also nicht explizit nach „föderativ“ und „bundesstaatlich“ getrennt. Der „föderative Gehalt“ eines Staatsaufbaus wird aber auch graduell verwendet und beschreibt zum einen die Zentralität oder Dezentralität der Entscheidungskompetenzen. Zum anderen wird der Begriff des föderativen Systems auf einen Staatsaufbau beschränkt, bei dem zwischen zentraler und kommunaler Ebene eine weitere selbständige Gebietskörperschaftsebene eingerichtet ist.[13] Also gibt es je nach Definition entweder Staaten, die mehr oder weniger stark föderativ aufgebaut sind, oder eben föderative oder unitarische Staaten (die nach dieser Definition die Mehrzahl bilden würden).[14] Den Gegensatz zum Bundesstaat stellt der Einheitsstaat dar, in dem alle Kompetenzen einer einheitlichen staatlichen Organisation zufallen. Allerdings ist zu bemerken, dass die Länderebene selbst als mittlere Ebene explizit in der ökonomischen Föderalismustheorie keine Rolle spielt - man beachte dort die Unterscheidung „nationale“ versus „lokale“ öffentliche Güter – aber von anderen Wissenschaften in ihrer Existenz und ihrem Gewicht als konstitutiv für föderative Gemeinwesen gesehen werden.[15]
Die Begriffe Unitarisierung und Zentralisierung werden inzwischen fast synonym benutzt, wobei zunehmend nur noch der Begriff Zentralisierung verwendet wird, wenn man Entwicklungstendenzen von föderativen Systemen beschreiben will. Unter Unitarisierung wird die durch freiwillige Kooperation und Koordination der unteren Gebietskörperschaften sachlich organisatorische Vereinheitlichung innerhalb eines Staates verstanden. Ziel ist dabei, eine möglichst einheitliche Problemlösung über die grundsätzlichen Normen eines Staatswesens hinaus zu finden. Dahingegen wird mit Zentralisierung nicht nur der Grad der organisatorischen Vereinheitlichung, sonder auch das Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen den staatlichen Ebenen beschrieben. Hierbei werden einheitliche Problemlösungen meist von der übergeordneten Ebene den nachgeordneten vorgegeben, ohne dass diese über einen eigenen Entscheidungsspielraum verfügen.
Leichter lässt sich der Begriff Dezentralisierung als Ausprägung eines Einheitsstaates verstehen. In einem Einheitsstaat ist die staatliche Gewalt auf wenige Institutionen konzentriert. Es gibt keine regionalen Unterebenen mit politischer Selbständigkeit, alle staatlichen Entscheidungsbefugnisse sind an einer Stelle konzentriert.
Dezentralisierte Einheitsstaaten hingegen sind in regionale Gebietskörperschaften gegliedert, die auch jeweils über einen eigenen autonomen Entscheidungsbereich verfügen . Im Unterschied zu föderativen Systemen haben die unteren Ebenen dabei jedoch nur einen schwachen rechtlichen Status und geringen Einfluss. Zudem besitzt die Zentralregierung die Kompetenz-Kompetenz und kann daher den Grad der Dezentralisierung willkürlich bestimmen.[16]
2.2. Die Aussagen der ökonomischen Theorie des Föderalismus
2.2.1. Grundlegende Bemerkungen
Erst seit den 60er Jahren hat sich eine eigenständige ökonomische Theorie des Föderalismus entwickelt.[17] Die traditionelle finanzwissenschaftliche Definition des Föderalismus in Deutschland beschäftigte sich mit der Frage nach der optimalen Aufgabenverteilung zwischen verschiedenen Gebietskörperschaftsebenen und der Regelung der finanziellen Beziehung zwischen ihnen. Im deutschen Raum wurde darüber hinaus die Frage nach der Dynamik der Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften, das sogenannte „Popitz’sche Gesetz von der Anziehungskraft des größten Etats[18] “ behandelt[19], was in dieser Arbeit ebenfalls kurz betrachtet werden soll.
Genau genommen, werden Gebietskörperschaften erst dadurch „geschaffen“, dass es aus noch zu darlegenden Gründen[20] sinnvoll ist, bestimmte öffentliche Aufgaben von verschiedenen Ebenen erfüllen zu lassen.[21] Das Ziel ist hierbei herauszufinden, welcher Aufbau der öffentlichen Finanzwirtschaft bestimmte ökonomische Kriterien am besten erfüllt. Die ökonomische Theorie des Föderalismus liefert die ökonomischen Kriterien für die optimale Verteilung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen auf öffentliche Entscheidungsträger in einem bestehenden föderativen Staat wie auch bei anstehenden Reformen in der Staatsorganisation . Damit ist nicht der Anspruch verbunden, bestimmte Staatsstrukturen zu erklären oder in ihrem föderalen Gehalt erfassen zu wollen, da wie oben angeführt, Staatsstrukturen oft Ergebnis historischer Prozesse sind.[22]
Die Kriterien zur Bestimmung des ökonomisch „bestgeeigneten“ Aufbaus der öffentlichen Finanzwirtschaft werden den Zielen der Finanzpolitik entnommen, die sich nach der analytischen Konzeption von Musgrave in originäre Ziele nach allokativen, distributiven und stabilitätsorientierten (Konjunktur- und Wachstumsziele) Kriterien sowie abgeleiteten Zielen (fiskalisches und Ziel der staatsinternen Effizienz) einteilen lassen.[23] Die Vor- und Nachteile einer Dezentralisierung und Zentralisierung sind theoretisch gesehen zumeist allokativ begründet und allgemein akzeptiert.[24]
Kirsch[25] erfasst unter dem Begriff „fiscal federalism“ neben der Ausgaben- und Einnahmenverteilung u.a. das Problem einer zweckmäßigen vertikalen Aufgabenverteilung zusammen, wobei er neben wohlfahrtstheoretischen Aspekten auch politökonomische[26] Aspekte ergänzend berücksichtigt.[27]
Zimmermann/Henke[28] sprechen auch eher von einer „Theorie des (vertikalen) Finanzausgleichs“, worunter nicht nur die Regelung der finanziellen Beziehung zwischen öffentlichen Körperschaften (intergovernmental fiscal relations) fällt, sondern auch Fragen des Staatsaufbaus, der Verteilung der Kompetenzen für die Aufgabenerfüllung, die Ausgaben und die Einnahmenerzielung auf die einzelnen Ebenen. Damit werden auch Fragen der finanziellen Autonomie angesprochen.
2.2.2. Das Ausgangsmodell nach Olson
Das Ausgangsmodell der Föderalismustheorie beruht nach Olson[29] neben den Annahmen des Modells des „homo oeconomicus“ (hier übersetzbar als das „Verhalten“ der einzelnen Gemeinden analog zu dem der Individuen) auf fünf weiteren Annahmen. Es werden nur „reine“ öffentliche Güter betrachtet, so dass es unmöglich ist, nicht-zahlungswillige bzw. –fähige „Individuen“ von ihrem Konsum abzuhalten. Räumliche Nutzen- und Belastungskreise der öffentlichen Güter sind eindeutig definierbar, so dass man nationale und lokale öffentliche Güter als zwei Eckpunkte einer Skala mit dem kleinsten und dem größten räumlichen Nutzenkreis unterscheiden kann. Dies bedeutet, dass lokale öffentliche Güter, die nach diesem Kriterium definierbar und insofern räumliche „Mischgüter[30] “ sind, nicht unter diesen Ansatz fallen. Sodann sind die produktspezifischen Produktionskosten eines öffentlichen Gutes, die beim Zentralstaat („Mehr-Produkt-Anbieter“) und der Gemeinde („Ein-Produkt-Anbieter“) anfallen, nicht verschieden. Die Skalenerträge sind konstante und die öffentlichen Güter mengenmäßig beliebig teilbar.
2.2.3. Die Verfolgung finanzpolitischer Zielsetzungen in föderativen Staaten
2.2.3.1. Allokationstheoretische Überlegungen zu einem föderativen Staatsaufbau
Das Allokationsziel bietet den zentralen normativen Begründungsrahmen für einen föderativen Staatsaufbau. Oberstes Ziel ist die Abstimmung der öffentlich abgegebenen Leistungen an die Präferenzen der Bürger. Dabei wird angenommen, dass es regionale Unterschiede in der Präferenzen sowohl für das Niveau als auch für die Struktur und die Ausgestaltung der öffentlichen Leistungen gibt. Gleichzeitig fragt die ökonomische Theorie nach der effizienten Produktion an gewünschten öffentlichen Gütern, wobei die effiziente Produktion i.S.d. Pareto-Kriteriums als präferenzengerechte und kostenminimale Produktion[31] von öffentlichen Gütern verstanden wird.
Welche Gebietskörperschaftsebene soll also welche öffentlichen Güter anbieten, um die Wünsche der Bürger präferenzengerecht zu erfüllen? Damit erfolgt der optimale Zentralitätsgrad in der Aufgabenerfüllung nachfrageseitig an einer Orientierung des Leistungsangebots an den Präferenzen der Bürger und angebotsseitig am Kriterium der Kostenminimierung bei der Erstellung des öffentlichen Leistungsangebots.
Im allgemeinen wird das von Oates formulierte Dezentralisierungstheorem angenommen. Es besagt, dass wenn ein öffentliches Gut in abgeschlossenen geographischen Teilräumen bei jedem Outputniveau zu konstanten Grenz- und Durchschnittskosten angeboten werden kann, unabhängig davon, ob zentral oder dezentral, es immer effizienter oder mindestens gleich effizient ist, dieses Gut lokal anzubieten. Denn dezentrale Einheiten sind besser geeignet, den Output an die im Ort herrschende Nachfrage anzupassen.[32] Dies ist die zentrale Begründung für einen föderativen Staatsaufbau.
Führt man anhand von externen Effekten und Kostendegressionseffekten (s.u.) lokale und nationale öffentliche Güter ein, entstehen allerdings unterschiedliche Nutzenkreise öffentlicher Güter.[33] Hier ist sodann zu überlegen, inwiefern das Dezentralisierungstheorem zu modifizieren bzw. wie die allokative Effizienz von föderativen Staatsstrukturen zu beurteilen ist . Es werden hierbei drei Faktoren angeführt, inwiefern ein föderativer Staatsaufbau dem Allokationsziel am ehesten entspricht. Hierzu ist als erstes die Abstimmung des öffentlichen Angebots auf die individuellen Präferenzen unter Beachtung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz (s.u.), des Subsidiaritätsprinzips und der Berücksichtigung von spillovers[34]. Als zweites kommt die Produktion zu geringstmöglichen Kosten und als letzter Faktor das Element des dezentralen Wettbewerbs.
Gemäß der normativen Ausgangsbedingung allokativer Effizienz geht man von regional unterschiedlichen Präferenzen und daraus folgend, von einem unterschiedlichen Angebot lokaler Güter aus. Bei einer zentralen Bereitstellung dieser Güter, fallen sehr hohe Transaktionskosten[35] zur Ermittlung der einzelnen Präferenzen an. Das Ergebnis wäre aus zwei Gründen suboptimal. Zum einen kann der Fall eintreten, dass sich die Zentralregierung bei Nichtberücksichtigung der Kosten einer zu hohen Nachfrage nach öffentlichen Gütern gegenübersieht. Dies resultiert aus einer unvollständigen Anlastung der Kosten an die Bürger.[36] Der andere mögliche Fall wäre ein zu geringes Angebot bei zentraler Entscheidung. Dies kommt zustande, wenn an der nationalen Entscheidung Wähler beteiligt sind, die zwar die Kosten in Form von Steuern mittragen, aber nicht an dem Nutzen teilhaben können. Ein geringeres Angebot wäre tendenziell zu erwarten[37], weil es realistischerweise nur über „politischen Kuhhandel“ („log-rolling[38] “) durchsetzbar wäre. Dies zieht allerdings höhere Transaktionskosten (in Form von Verhandlungs-, Informations-, Abwicklungskosten etc., vgl. Fußnote unten) nach sich. Aufgrund dessen wird auch eher eine Tendenz zu einem einheitlichen Angebot bestehen, wobei aber die regional unterschiedlichen Präferenzen nicht berücksichtigt werden. Die regionalen Minderheiten werden überstimmt, es kommt zu Frustrationskosten.
Diese suboptimalen Ergebnisse lassen sich dadurch verhindern, dass man jede Region selbständig über ihr Angebot an öffentlichen Gütern, die Ausgaben sowie die nötigen Einnahmen selbst entscheiden lässt, also Eigenverantwortlichkeit und Einnahmenautonomie zubilligt. Es vermindert die Finanzierungsillusion, erhöht das Kostenbewusstsein und die Orientierung an den Präferenzen der Bürger. Dies ist auch die Aussage des Prinzips der „ fiskalischen Äquivalenz[39] “ von Olson. „Wenn die Grenzen einer Jurisdiktion mit der Reichweite eines von ihr angebotenen öffentlichen Gutes nicht deckungsgleich sind, kommt keine effiziente Allokation zustande. Für jedes Kollektivgut mit spezifischem Wirkungsbereich ist dann eine separate Regierungsinstitution erforderlich, damit sichergestellt ist, dass jene, die aus dem öffentlichen Gut einen Nutzen erhalten, auch die sind, die dafür bezahlen.[40] “
Nimmt man aber nun an, dass ein Gut externe Effekte, aufweist, so ist eine zentrale Bereitstellung zu überlegen. Bei dezentralem Angebot eines nationalen öffentlichen Gutes könnte das jeweilige Angebot kleiner ausfallen (z.B. wegen Trittbrettfahrerverhalten) als bei zentraler Produktion. Die einzelnen Kommunen würden ihre Angebotsmenge nach den lokalen Präferenzen ausrichten, also die externen Effekte, verstanden als den Nutzen für andere Gemeinden oder den Gesamtstaat, in ihrer Produktion nicht mitberücksichtigen. Selbst wenn jede Gemeinde ihren Bedürfnissen entsprechend dieses öffentliche Gut bereitstellen würde, würden im Endergebnis so hohe Transaktionskosten[41] anfallen, dass ein suboptimales Angebot im Vergleich zu dem Fall zentraler Produktion zustande käme. Die zentrale Bereitstellung von nationalen öffentlichen Gütern internalisiert also externe Effekte, daher sollte ein nationales öffentliches Gut auch auf zentraler Ebene hergestellt werden.[42] Jedoch muss dies nicht bei jedem Gut mit externen Effekten zutreffen. Bei Gütern mit räumlichen externen Effekten, d.h. diese Güter haben einen kleinräumigen Nutzenkreis, können auch korrigierende Maßnahmen von der Zentralebene durchgeführt werden, so dass ein optimales Ergebnis zustande kommen kann. Dies kann sich z.B. in Form von Finanzhilfen[43] u.ä. zutragen.
Weiterhin lässt sich das Subsidiaritätsprinzip als Begründung für einen föderativen Aufbau des Staates heranziehen. Es beschreibt ein umfassendes Prinzip des „Vorrangs der unteren Einheit[44] “. Mit Hilfe von ökonomischen Überlegungen (z.B. Föderalismustheorie) kann man diese Aussage präzisieren und so praktisch anwendbar machen, z.B. durch das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz.[45] Weiterhin kann die Forderung nach Subsidiarität auch aus nicht-ökonomischen Gründen verstanden werden. Dann findet es Anwendung bzgl. horizontaler und vertikaler Gewaltenteilung; letzteres bezieht sich auf den föderativen Staatsaufbau.
Das zweite Element der Allokationseffizienz ist die Produktion zu geringstmöglichen Kosten. Das Dezentralisierungstheorem gilt jedoch laut den eigenen Prämissen nur bei konstanten Grenz- und Durchschnittskosten, was nicht unbedingt der Realität bei der Produktion entspricht. Wird diese Prämisse aufgehoben, ergeben sich einige Änderungen. Lässt man steigende und sinkende Skalenerträge zu, so muss aus pareto-optimalen Gründen diejenige Produktionsmenge bzw. diejenige Größe einer Gebietskörperschaft ermittelt werden, bei der die Durchschnittskosten für ein öffentliches Gut am geringsten sind. Man muss diesbezüglich zwischen Präferenzengerechtigkeit und Kostengünstigkeit abwägen.
Bei steigenden Skalenerträgen ergeben sich bei einer Erhöhung der Produktion niedrigere Durchschnittskosten („economies of scale“). Die pareto-optimale Produktionsmenge ist in diesem Fall dann erreicht, wenn die Gebietskörperschaftsgröße auch den gesamten Nutzenkreis abdeckt. Dies bietet sich speziell dann an, wenn die Kosten der „Kleinheit“ – vor allem im verwaltungstechnischen Bereich – umgangen werden können, insbesondere wenn mögliche Kooperationen zwischen Gebietskörperschaften nicht zu einer Internalisierung bestehender Skaleneffekte führen.[46] Dies spricht für eine Bereitstellung durch die zentrale Ebene. Probleme ergeben sich allerdings dann, wenn produktionstechnisch steigende Erträge zu erwarten sind, aber ein kleinräumlicher Nutzenkreis betroffen ist. Dann muss zwischen Zentralität, Kosteneinsparung und möglichen Frustrationskosten durch Nichtbeachtung der lokalen Präferenzen abgewägt werden. Eine andere Möglichkeit zur Lösung des Problems stellen Kooperationen bei der Produktion zwischen Gebietskörperschaften gleicher Ebene dar. Die lokale Ebene behält in diesem Fall die Aufgabenkompetenz, die technisch-organisatorische Bereitstellung erfolgt allerdings durch die Kooperationseinheit. Auch eine Vergrößerung der lokalen Ebene („Fusion“) i.S.d. optimalen Ortsgröße stellt eine Lösungsmöglichkeit dar. Hier ist insbesondere an Gebietsreformen zu denken, die aber oft gegen großen politischen Widerstand der Bevölkerung stoßen können. Daher wäre diese Lösung durch eine Beachtung der Frustrations- und möglicher Ballungskosten gut abzuwägen.[47]
Bei sinkenden Skalenerträgen kommt es bei einer Vergrößerung der Ausbringungsmenge zu steigenden Durchschnittskosten. Bei einem kleinräumlichen Nutzenkreis stellt die dezentrale Aufgabenerfüllung und Produktion die ideale Lösung dar. Probleme entstehen, wenn sinkende Skalenerträge zusammen mit einem weiten räumlichen Nutzenkreis, der eine nationale Aufgabenerfüllung nahe legt, auftreten. Wird in diesem Fall die Aufgabe zentral wahrgenommen, besteht zwar von der Nachfragerseite her ein pareto-effizienter Zustand, aber von der angebotsseitigen Lage ist diese Lösung suboptimal. Umgekehrtes gilt für ein dezentrales Angebot. Auch hier muss man letztendlich unter der Annahme eines operationalisierbaren und messbaren Nutzens (Wohlfahrtsgewinne und –verluste) zwischen den angebots- und nachfrageseitigen Vor- und Nachteilen einer (De-) Zentralisierung jene Lösung wählen, die den größten Nettonutzen aufweist.
Wenn der Produktionsvorteil zum Zuge kommen soll, könnte hier eine Lösung sein, dass durch Verhandlungen und prozesspolitische Eingriffe (z.B. Finanzzuweisungen, oder geteilte Zuständigkeit: Rahmenkompetenz beim Bund, Gemeinde darf Umfang und Qualität des Angebots bestimmen etc.) die auftretenden Effizienznachteile annähernd beseitigt werden.
Bei öffentlichen Gütern kann der Marktmechanismus auch bei vollkommenen Wettbewerbsbedingungen wegen der spezifischen Gütereigenschaften nicht für eine effiziente Allokation der knappen Ressourcen sorgen. Tiebout[48] fand dabei heraus, dass dies nur für nationale öffentliche Güter gelten könne, lokale öffentliche Güter damit also trotz der Eigenschaften öffentlicher Güter unter bestimmten idealtypischen Annahmen einer optimalen Allokation unterliegen. Ausgangspunkt ist ein Staat mit föderativer Struktur, inklusive lokaler Ebene, in dem nur auf die dezentrale Ebene mit lokalen öffentlichen Gütern abgestellt wird. Unter bestimmten Annahmen[49] (vollkommene Mobilität und Wissen, Einkommen ist exogen vorgegeben, Anzahl der Wohnorte variiert mit den Präferenzen, Existenz einer optimalen Gemeindegröße etc.) sind die zentralen Ergebnisse im Tiebout-Modell, dass die Konsumenten durch die Wahl ihres Wohnortes ihre Präferenzen offen legen („voting by feet[50] “), und so auch ihre tatsächliche Zahlungsbereitschaft für lokale öffentliche Güter darlegen. Gleichzeitig passt sich das öffentliche Leistungsangebot damit den Präferenzen an. Es erfolgt eine kostenminimale Leistungserstellung, da vollkommene interkommunale Wettbewerbskonkurrenz herrscht und die Konsumenten (Bürger) über vollständige Information verfügen. Politische Entscheidungsprozesse über das Leistungsangebot und die Höhe der individuellen Steuerbelastungen werden zudem nicht mehr benötigt, so dass es auch keine politikinternen Handlungsspielräume mehr gibt.[51] Zusätzlich wird als Vorteil einer solchen föderalistisch-dezentralisierten Aufgliederung eines Staates die Möglichkeit zur Intensivierung des Wettbewerbs gesehen, so dass aus dynamischer Sicht innovatorische Energien (durch Auslösung von „Wissensprozessen“) zum Zuge kommen können, die eine bessere Bedürfnisbefriedigung in Aussicht stellen.[52] Implizit zeigt Tiebout damit auch auf, dass eine föderative Staatsstruktur die Voraussetzung für eine Erhöhung der allokativen Effizienz bei der Bereitstellung öffentlicher Güter mit unterschiedlichen Nutzenkreisen ist.[53]
2.2.3.2. Verteilungspolitische Überlegungen zu einem föderativen Staatsaufbau
Teilweise wird bei Verteilungsfragen eine dezentrale Aufgabenerfüllung[54] als zweckmäßig angesehen, da die unmittelbare Nähe der Gemeinden zu den Bürgern Bedürftigkeiten schneller und genauer zu Tage fördert. Man könnte auch anführen, dass dadurch ein Anreiz für die Kommunen entsteht, ihre bestehenden Arbeitsplätze zu pflegen. Mit steigender Umverteilungsintensität einer Gebietskörperschaft wird aber der Anreiz für die reicheren Bevölkerungsschichten steigen, sich durch Abwanderung und Konzentration in einer eigenen Gebietskörperschaft dem verteilungsbedingten Besteuerungsdruck zu entziehen. Das Ergebnis wäre im Extremfall eine räumliche Segmentierung von armen und reichen Gebietskörperschaften. Eine zentrale Verteilungspolitik kann solchen Wanderungs- und Segmentierungseffekten die Grundlage entziehen. Aus diesem Grund wird der große Teil der Umverteilungspolitik auf höheren Ebenen als der der Gemeinden geregelt. Verteilungspolitik kann daher auch auf der zentralen Ebene mit guten Gründen verfolgt werden.[55]
2.2.3.3. Stabilitätspolitische Überlegungen zu einem föderativen Staatsaufbau
Das Stabilitätsziel setzt sich aus konjunktur- und wachstumspolitischen Teilen zusammen. Konjunkturpolitik und Wachstumspolitik betreffen beide Stabilitätsaspekte einer Volkswirtschaft. Während aber die Konjunkturpolitik sich mit Ausgabenprogrammen zur Steigerung der (fehlenden) Gesamtnachfrage sowie Auslastung des Produktionspotentials („Einkommenseffekte der Nachfrage/Investition“) beschäftigt und „kurzfristig“ ist, handelt es sich in der Wachstumspolitik um die Angebotsbedingungen („Ausweitung des Produktionspotential“) bzw. strukturellen Bedingungen in einer Volkswirtschaft („Kapazitätseffekte der Investition“), damit um langfristige Ziele.
Bei der Erfüllung des Konjunkturziel wird ein begrenztes Interesse der Gemeinden unterstellt, da es bei einer Rezession zu Einnahmeausfällen und gleichzeitig aber auch zu erhöhten Sozialausgaben kommt. Durch externe Effekte profitieren aber auch andere Regionen von durchgeführten Maßnahmen[56] der einen Gemeinde gegen die negativen Wirkungen des Konjunktureinbruchs. Diese trägt demnach allein die Kosten der Stabilisierung, während der Nutzen der gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung zukommt. Bei einer rein dezentralen Lösung wären daher die Anreize gering, eigene stabilitätspolitische Maßnahmen zu ergreifen. In der Boomphase fehlt dieser Anreiz ebenso, da die Gemeinden dann nur die positiven Effekte der Konjunktur spüren, aber die Preisniveausteigerungen als nationales Phänomen begreifen.
Folglich wäre zu erwarten, dass das Gut „ Konjunkturstabilisierung “ nicht dezentral angeboten werden würde. In föderativen Systemen tendieren Länder und Gemeinden, soweit sie autonom über Ausgaben und Einnahmen entscheiden können, bei rezessionsverursachtem Absinken der Einnahmen dazu, die Ausgaben zu kürzen bzw. Steuererhöhungen zwecks Deckung des Haushaltsdefizits durchzusetzen. In Boomzeiten werden dagegen die gestiegenen Einnahmen zu höheren Ausgaben bzw. zu Steuersenkungen genutzt. Mögliches Ergebnis eines solchen prozyklischen Verhaltens wäre in dem erstgenannten Fall eine zusätzliche Verstärkung des Abschwungs, da die verminderte Ausgabentätigkeit zu einer Verringerung der öffentlichen Nachfrage führt, erhöhte Steuern aber auch eine Verringerung des Konsums und der Investitionstätigkeit nach sich ziehen. Im zweiten Fall könnten die zusätzlichen Ausgaben und die Steuersenkungen eine unerwünschte Belebung der Konjunktur nach sich ziehen. Die hier angebrachte antizyklische Politik würde nicht verfolgt werden. Dagegen kann eine Entscheidung auf der zentralen Ebene die unteren Gebietskörperschaftsebenen zu konjunkturpolitisch angemessenem Verhalten verpflichten – Konjunkturpolitik lässt sich also am besten auf der zentralen Ebene verfolgen.[57]
Das Wachstum einer Volkswirtschaft wird anhand der realen Zuwachsraten des Sozialprodukts als wichtiger Indikator für eine Steigerung des Lebensstandards und des Wohlstands[58] angesehen. Diesbezüglich gibt es (bundes-) einheitlich festgelegte Wachstumsfaktoren, die für die Rahmenbedingungen der Wirtschaftsstruktur bzw. den Standortvorteil eines Landes eine wichtige Rolle spielen (gedacht sei an den Rechtsrahmen, den Geldwert, Steuern, Wettbewerbsordnung, Arbeitsrecht, Patentrechte usw.). Es gibt aber auch kommunale Entscheidungen mit Bedeutung für das jeweilige regionale Wachstum und damit für dessen Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum[59]. Zwei Drittel der öffentlichen Investitionen werden so von den Gemeinden getätigt werden, die oft unmittelbar in die unternehmensrelevante Infrastruktur fließen. Insofern ist die kommunale Infrastruktur in der Summe der Wachstumsprozesse für die Volkswirtschaft ein wichtiger Faktor. Auch ist es für das Wachstum vorteilhaft, wenn Unternehmer und Arbeitnehmer nach ihren Präferenzen zwischen Regionen wählen können. Ein Anreiz, diese Präferenzen der Unternehmen und Bürger zu unterstützen, ist dadurch gegeben, dass regionales Wachstum eine Erweiterung der Bemessungsgrundlagen für Landes- und Gemeindesteuern bietet. Dies fördert auch die mögliche Konkurrenz zwischen Ländern bzw. Kommunen[60], die zu Innovationen im öffentlichen Sektor führen kann, damit einhergehend auch zu Effizienzgewinnen und zu einer höheren Präferenzengerechtigkeit.
Zentrale Entscheidungen können also teilweise besser zum Wachstum beitragen, zur Unterstützung des regionalen und damit gleichzeitig des gesamtwirtschaftlichen Wachstums sind dezentrale Ebenen hingegen geeigneter.[61]
2.3. Die Zuordnung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen
Aus allokativen Überlegungen sollte die konkrete Zuordnung von Aufgaben zum einen derjenigen Ebene zugesprochen werden, die klein genug ist, um eine regionale Abgrenzung der Präferenzen für ein Gut zu vollziehen. Im Zweifelsfall wird das Subsidiaritätsprinzip angewendet. Zum anderen sollte die betroffene Ebene aber auch groß genug sein, um eventuelle Kostendegressionseffekte ausnutzen zu können.[62] Die Aufgabenverteilung sollte gleichzeitig dem Konnexitätsprinzip entsprechen. Das Konnexitätsprinzip besagt, dass die Ausgabenhoheit der Aufgabenhoheit folgen soll, d.h. dass die Ebene die Verantwortung für die Erfüllung einer Aufgabe besitzt, auch die hierzu erforderlichen Ausgaben zu tätigen hat. Dies verspricht nicht nur eine höhere Wirtschaftlichkeit, wenn die Ausgaben- der Aufgabenkompetenz folgt, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit, einer sachgerechten Aufgabenerfüllung. Jedoch ist ohne eine zusätzliche Einnahmenautonomie die vorausgesetzte Selbstverantwortung eine Fiktion. Nur wenn jede Ebene auch ihre Einnahmen flexibel mit den Aufgaben in Einklang bringen kann, kann sie auch ihre Problemlösungskompetenzen ausschöpfen.[63] Eine hohe Steuerautonomie der Länder und Gemeinden würde so auch den Forderungen der fiskalischen Äquivalenz und des Subsidiaritätsprinzips genügen. Andererseits kann es je nach Zielbezug auch Fälle geben, bei denen es sinnvoll ist, die Zuständigkeit der Zentrale zuzuordnen. Ist aber dennoch eine möglichst hohe dezentrale Aufgabenerfüllung erwünscht, stehen der Zentralinstanz verschiedene Instrumente zur Verfügung. Diese haben je nach Gestaltung verschiedene Anreizwirkungen und Folgen für die finanzielle Eigenständigkeit und das Maß der Aufgabenerfüllung der betroffenen Ebene.
Dies betrifft vor allem Fragen der Steuerverteilung. Zum einen kann darüber entschieden werden, welche Steuern welcher Gebietskörperschaftsebene zugeordnet werden sollen, um z.B. föderalismusökonomischen Zielen gerecht zu werden. Zum anderen kann bei jeder einzelnen Steuer nochmals danach unterschieden werden, welcher Ebene welche Steuerhoheit zugewiesen werden soll. Da die Steuern den größten Anteil an den Einnahmen darstellen, ist gerade hier die Zuordnung der Steuerhoheit von zentraler Bedeutung für die Finanzautonomie einer Ebene. Die Steuerhoheit umfasst die Ertrags- oder Aufkommenshoheit, die Durchführungs- oder Verwaltungshoheit sowie die Gesetzgebungshoheit mit den Elementen der Objekt- und Gestaltungshoheit. Die Objekthoheit berechtigt zur Einführung und Abschaffung von Steuern, während die Gestaltungshoheit Elemente wie die Abgrenzung der Bemessungsgrundlage, Umfang der Steuerpflicht sowie die Bestimmung des Tarifs beinhaltet. Gerade die Gesetzgebungshoheit ist im Rahmen der Föderalismustheorie derart interessant, da hier überlegt werden kann, welche Ziele und Kriterien eine Steuer geeignet erscheinen lassen, damit Allokations-, Verteilungs- und Stabilitätsziele wirksam verfolgt werden können sowie welcher Ebene sodann dieses Recht zugewiesen werden soll. Im Rahmen dessen wird angenommen, dass Aufkommensstärke, Mobilität, Elastizität, Distributionsfähigkeit, Konjunkturabhängigkeit einer Steuerbasis relevante Kriterien sein können.[64] Aber ebenso spielt die Ertragshoheit eine gewichtige Rolle, da auch sie Auswirkungen auf die Finanzautonomie und Aufgabenerfüllung hat. Es können hierbei verschiedene Systeme der Zuordnung von Einnahmenkompetenzen unterschieden werden: Trennsysteme, Verbund- und Zuschlagssysteme sowie Zuweisungssysteme.
Von einem Trennsystem spricht man solange, wie das gesamte Aufkommen einer Steuerart einer Körperschaft zusteht. In einer strikten Form des Trennsystems (ungebundenes, freies Trennsystem, auch Konkurrenzsystem) kann jede Körperschaft über ihre Steuern sowohl in der Art der Steuer als auch in ihrer Höhe unabhängig bestimmen. Es kann aber sein, dass untere Ebenen in Form eines gebundenen Trennsystems, über weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten oder auch nur Hebesatzrechte verfügen können. Ihnen steht so der Ertrag zu, währende die obere Ebene die Objekthoheit innehat. Je weniger Gestaltungshoheit dem Einnahmenempfänger gebilligt wird, desto geringer ist der Autonomiegrad des Empfängers. Als Vorteil des Trennsystems wird die allokative Komponente, die Erfüllung der fiskalischen Äquivalenz, angesehen. Nachteilige Auswirkungen könnte aufgrund der mangelnden Flexibilität des Trennsystems die ungenügende Beachtung der Dynamik der Aufgaben- und Ausgabenentwicklung haben.
[...]
[1] Benannt nach dem Vizekanzler und Finanzminister der Weimarer Republik der Zentrumspartei, Matthias Erzberger (20. September 1875 - 26. August 1921) - ernannt Juni 1919, Rücktritt März 1920 - der dieses Reformwerk durchsetzte. Vgl. Klaus Epstein: Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, Verlag Annedore Leber, Berlin und Frankfurt/Main 1962, vgl. Theodor Eschenburg: Matthias Erzberger – Der große Mann des Parlamentarismus und der Finanzreform, R. Piper & Co. Verlag, München 1973.
[2] Vgl. Wilfried Herz: Das Jahrhundertwerk – Die Staatsfinanzen des Deutschen Reichs waren zerrüttet, in Die Zeit vom 8.08.1997, Nr. 33, S. 15.
[3] Zur Unterscheidung soll in dieser Arbeit mit dem Begriff „Deutsches Reich“ nur das Reich von 1871 bis 1918 gemeint sein, daher auch die synonyme Verwendung der Begriffe „Deutsches Kaiserreich“ und „Deutsches Reich von 1871“, während nach 1918 bis 1933 für das deutsche Staatsgebiet die Begriffe „Weimarer Republik“ bzw. „Weimarer Reich“ benutzt werden soll.
[4] Vgl. Heinz Laufer/Ursula Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, Leske+Budrich Opladen utb 1998, S. 59. Vgl. Jürgen John: Die Reichsreformdiskussion in der Weimarer Republik, in Jochen Huhn/Peter-Christian Witt (Hrsg.): Föderalismus in Deutschland – Traditionen und gegenwärtige Probleme, 1. Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1992, S. 112.
[5] Dies muss aber nicht heißen, dass ökonomische Argumente niemals Beachtung finden würden bei politischen Entscheidungen, die (Staats-) Strukturen betreffen, als Beispiel sei die EU genannt. Vgl. Rolf-Dieter Postlep/Thomas Döring: Entwicklungen in der ökonomischen Föderalismusdiskussion und im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland, S. 8, vgl. Thomas Döring: Zum Zentralisierungsgrad einer europäischen Regionalpolitik, S. 99-139; beides in Rolf-Dieter Postlep (Hrsg.): Aktuelle Fragen zum Föderalismus – Ausgewählte Probleme aus Theorie und politischer Praxis des Föderalismus, metropolis Verlag, Marburg 1996.
[6] Vgl. Postlep/Döring: Entwicklungen in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 7, vgl. Rolf-Dieter Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik – Ein Beitrag zur ökonomischen Föderalismustheorie, 1. Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1993, S. 16.
[7] Vgl. Ernst Deuerlein: Föderalismus – Die historischen und philosophischen Grundlagen des föderativen Prinzips, Paul List Verlag, München 1972, S. 153 f.
[8] Nach Nipperdey, zitiert nach Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S. 60.
[9] Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S. 59 f.
[10] Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S. 15.
[11] Vgl. Guy Kirsch: Einleitung, in Guy Kirsch (Hrsg.): Föderalismus, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart und New York 1977, S. 5 f., vgl . Deuerlein: Föderalismus, a.a.O., S. 11 ff, vgl. Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 17.
[12] Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S. 15 f.
[13] Vgl. Horst Zimmermann/Klaus-Dirk Henke: Finanzwissenschaft – Eine Einführung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft, 8. Aufl., Verlag Vahlen, München 1994, S. 175, 474.
[14] Vgl Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 19.
[15] Vgl . Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 18.
[16] Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S. 16 ff.
[17] Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 178.
[18] Popitz stellte fest, dass in einem föderativen System Aufgabenhoheiten und Finanzvolumen des Zentralstaats relativ im Zeitablauf zu anderen Gebietskörperschaftsebenen zunehmen. Dies kann auf zwei möglichen Wegen passieren: Einerseits kann die Zentralisierungstendenz darauf beruhen, dass der Zentralstaat Aufgaben an sich zieht, denen dann die Zentralisierung der Ausgaben und Einnahmen folgt. Andererseits kann der Zentralstaat aber auch dadurch seine Kompetenzen ausweiten, weil er von den unteren Ebenen um finanzielle Unterstützung gebeten wurde, und damit später seine Aufgabenkompetenz begründet. Vgl. Johannes Popitz: Der Finanzausgleich, in Wilhelm Gerloff/Franz Meisel (Hrsg.): Handbuch der Finanzwissenschaft, 1. Aufl., 2. Bd., Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen 1927, S. 347 f. Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 186 f. Nach Postlep/Döring handelt es sich hierbei nicht im streng methodologischen Sinn um ein „Gesetz“. Es handelt sich eher um eine empirische Beobachtung. Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 17.
[19] Vgl. Guy Kirsch: Fiscal Federalism, in WiSt, Heft 3/1984, S. 118 f.
[20] siehe Kapitel 2.2.3.1./ 2.2.3.2./ 2.2.3.3.
[21] Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 176.
[22] Vgl. Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 19.
[23] Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 2 ff.
[24] Vgl. Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 9.
[25] Kirsch: Einleitung, in Kirsch, a.a.O., S. 7 f und Kirsch: Fiscal Federalism, in WiSt, Heft 3/1984, S. 118 f.
[26] In dieser Arbeit wird nicht auf die Neue Politische Ökonomie eingegangen werden, da der Schwerpunkt auf der Föderalismustheorie liegt.
[27] Siehe Postlep auch für eine sehr umfassende Darstellung des Standes der ökonomischen Theorie des Föderalismus. Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O.
[28] Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 175 ff. Soweit nicht anders angegeben, bezieht sich dieses Kapitel auf Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 175-197 und Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O.
[29] Im folgenden wird zum Großteil auf Postlep zurückgegriffen. Nach Mancur Olson Jr., zitiert nach Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 71 f. Vgl. auch die Übersetzung, Mancur Olson Jr.: Das Prinzip „fiskalischer Gleichheit“: Die Aufteilung der Verantwortung zwischen verschiedenen Regierungsebenen, in Kirsch, a.a.O., S. 69 ff.
[30] Mischgüter sind Güter mit räumlich externen Effekten bzw. „spillovers“, Bsp. Flughafen. Vgl. Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 71.
[31] Ökonomische Effizienz setzt eine Abwägung zwischen Grenzausgaben und Grenzeinnahmen voraus, das sog. „Marginalkalkül“, und gehört zur Allokationseffizienz. Vgl. Horst Zimmermann: Kommunalfinanzen – Eine Einführung in die finanzwissenschaftliche Analyse der kommunalen Finanzwirtschaft, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 1999, S. 41.
[32] Vgl. Charles B. Blankart: Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 3. Aufl., Verlag Vahlen, München 1998, S. 527. Vgl. Wallace E. Oates: Fiscal Federalism – Ein ökonomischer Ansatz zum Föderalismusproblem, in Kirsch, a.a.O., S. 15-26
[33] Vgl. Bernd Hansjürgens: Föderalismustheorie und europäische Umweltpolitik, in Postlep, a.a.O., S. 77
[34] Zur Unterscheidung von personalen externen Effekten wird bei räumlich externen Effekten i.d.R. von „spillovers“ gesprochen. Vgl. Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 71
[35] Transaktionskosten sollen hier (als ex ante-Kosten) als Informations- (Anbahnungskosten) und Verhandlungskosten sowie (als ex post- Kosten) als Abwicklungs-, Kontroll- und Anpassungskosten definiert sein. Vgl. Arnold Picot: Organisation, in Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaftslehre, Bd. 2, 3. Aufl., Verlag Vahlen, München 1993, S. 107. Vgl. Reinhard H. Schmidt: Transaktionskostenorientierte Organisationstheorie, in Erich Frese (Hrsg.): Handwörterbuch der Organisation, E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1992, S. 1856. Hier würden insbesondere hohe Informationskosten zur Ermittlung der regionalen Besonderheiten in den Präferenzen bei lokalen öffentlichen Gütern anfallen.
[36] Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 179.
[37] Müssen x-Prozent der Individuen einer bestimmten Wählerschaft einer Maßnahme zustimmen, bevor sie als angenommen gilt, und stiftet ein bestimmtes öffentliches Gut für mehr als x-Prozent der Wähler Nutzen, so wird sich tendenziell wahrscheinlich ein supra-optimales Angebot dieses Gutes ergeben. Das ist nach Tullock darauf zurückzuführen, dass die Minorität, die keinen Nutzen aus den Gut zieht, ebenfalls Steuern entrichtet und die Nutznießer daher für ein Angebotsniveau stimmen können, bei dem nur ihre eigene Steuerlast marginal betrachtet gleich dem gesamten Nutzen des öffentliches Gutes ist. Vgl. Olson: Das Prinzip „fiskalischer Gleichheit“, in Kirsch, a.a.O., S. 71.
[38] Olson: Das Prinzip fiskalischer Gleichheit, in Kirsch, a.a.O., S. 70.
[39] Also eine Übereinstimmung von Entscheider-, Kostenträger- und Nutzerkreis. Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 179.
[40] Olson: Das Prinzip „fiskalischer Gleichheit“, in Kirsch, a.a.O., S. 71.
[41] Z.B. in Form von Koordinations- und Entscheidungskosten aufgrund der anfallenden Informations-, Konsensfindungs- und Kontrollkosten.
[42] Vgl. Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 10 f.
[43] siehe Kapitel 2.3.
[44] Thomas Döring: Subsidiaritätsprinzip, in WiSt Heft 5/1994, S. 245. Das Subsidiaritätsprinzips entstammt der katholischen Soziallehre. Die bekannteste Version stammt aus der sozialpolitisch intendierten Enzyklika „Quadragesimo Anno“ von Papst Pius XI.
[45] Dies heißt nicht, dass Subsidiaritätsprinzip und fiskalische Äquivalenz deckungsgleich sind, da bei letzterem kein ausschließlicher Vorrang zu Gunsten unterer Ebenen besteht. Vgl. hierzu Döring: Subsidiaritätsprinzip, in WiSt Heft 5/1994, S. 243 f.
[46] Vgl. Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 11.
[47] Vgl. Zimmermann: Kommunalfinanzen, a.a.O., S. 46 ff.
[48] Nach C. M. Tiebout, zitiert nach Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 82 ff.
[49] Vgl. ausführlicher zu den Annahmen des Modells Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 82 ff.
[50] Hier übertragen auf die Gemeindeebene. Vgl. Albert O. Hirschman: Abwanderung und Widerspruch – Reaktionen auf Leistungsabfall bei Unternehmungen, Organisationen und Staaten, J. C. B. Mohr, Tübingen 1974, S. 13 ff.
[51] Vgl. Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 85 ff.
[52] Vgl. Kirsch: Fiscal Federalism, in WiSt, Heft 3/1984, S. 120.
[53] Empirische Studien zum Tiebout-Modell untersuchten daraufhin vor allem die Frage, ob Haushalte und Unternehmen ihre Wohn- und Standorte aufgrund der fiskalischen Anreize aussuchen und ob diese Wahl dann im Gleichgewicht tatsächlich effizient ist. Die erste Frage ist für die Schweiz untersucht worden und konnte bejaht werden. Die zweite Frage ist für die USA sowie die Schweiz untersucht worden und konnte ebenfalls bestätigt werden. Aus diesen empirischen Ergebnissen wird gefolgert, dass es sinnvoll ist, öffentliche Güter auf der niedrigst möglichen staatlichen Ebene bereitzustellen und zu finanzieren, wobei wohl eher immobile Faktoren zur Finanzierung herangezogen werden müssen. Nach Untersuchungen von Feld/Kirchgässner (1997), Kirchgässner/Pommerehne (1996) und Kirchgässner/Pommerehne/Feld (1996). Auch Inman/Rubinfeld (1997), zitiert nach Feld/Kirchgässner: Fiskalischer Föderalismus, in WiSt, Heft 2/1998, S. 66 f.
[54] Empirische Studien bestätigen eine dezentrale Aufgabenzuständigkeit. Eine kurze Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse findet sich in Feld/Kirchgässner: Fiskalischer Föderalismus, in WiSt, Heft 2/1998, S. 67 f. Man könnte auch anführen, dass dadurch ein Anreiz für die Kommunen entsteht, ihre bestehenden Arbeitsplätze zu pflegen , ebenso kann man natürlich auch altruistisches Verhalten annehmen. Vgl. auch Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 13. Vgl. Postlep: Gesamtwirtschaftliche Analyse kommunaler Finanzpolitik, a.a.O., S. 185.
[55] Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 183 f und vgl. auch Postlep/Döring: Entwicklung in der ökonomischen Föderalismusdiskussion (...), in Postlep, a.a.O., S. 11.
[56] Vorstellbar sind lokale Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterstützungszahlungen an Unternehmen etc.
[57] Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 184. Andererseits ist auch diese Auffassung hier kritisiert worden, da man nachweisen konnte, dass Zentralstaaten tatsächlich nur selten antizyklische Finanzpolitik betreiben. Diese Aussage muss man einschränkend auf die USA als einen aus großflächigen, stark eigenständigen Gliedstaaten bestehenden Staat treffen. Näheres hierzu, siehe J. von Hagen (1992) zitiert nach Feld/Kirchgässner: Fiskalischer Föderalismus, in WiSt, Heft 2/1998, S. 68 f.
[58] Für genauere Ausführungen bzw. Kritik betr. Wachstumsziel, Messung des Sozialprodukts und deren Verhältnis zu Annahmen über wirtschaftlichen Wohlstand vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 384 f.
[59] Im Prinzip lässt sich das „gesamtwirtschaftliche Wachstum“ als gedankliche Zusammenfassung von unendlich vielen regionalen Wachstumsvorgängen vorstellen. Vgl. Zimmermann: Kommunalfinanzen, a.a.O., S. 56 f. Vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 184.
[60] siehe Kapitel 2.2.3.1.
[61] Vgl. Zimmermann: Kommunalfinanzen, a.a.O., S. 55 ff. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 184.
[62] Im folgenden vgl. Zimmermann/Henke: Finanzwissenschaft, a.a.O., S. 182-195.
[63] Vgl. Döring: Subsidiaritätsprinzip, in WiSt, Heft 5/1994, S. 246.
[64] Vgl. Horst Zimmermann: Allgemeine Probleme und Methoden des Finanzausgleichs, in Fritz Neumark (Hrsg.): Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. IV, J. C. B. Mohr, Tübingen 1983, S. 38 ff. Vgl. Feld/Kirchgässner: Fiskalischer Föderalismus, in WiSt, Heft 2/1998, S. 66 ff.
- Arbeit zitieren
- Fatma Deniz (Autor:in), 2002, Die Erzberger´sche Finanzreform aus der Sicht der ökonomischen Theorie des Föderalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6564
Kostenlos Autor werden








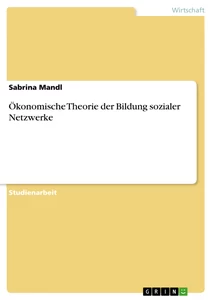







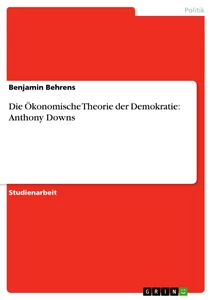



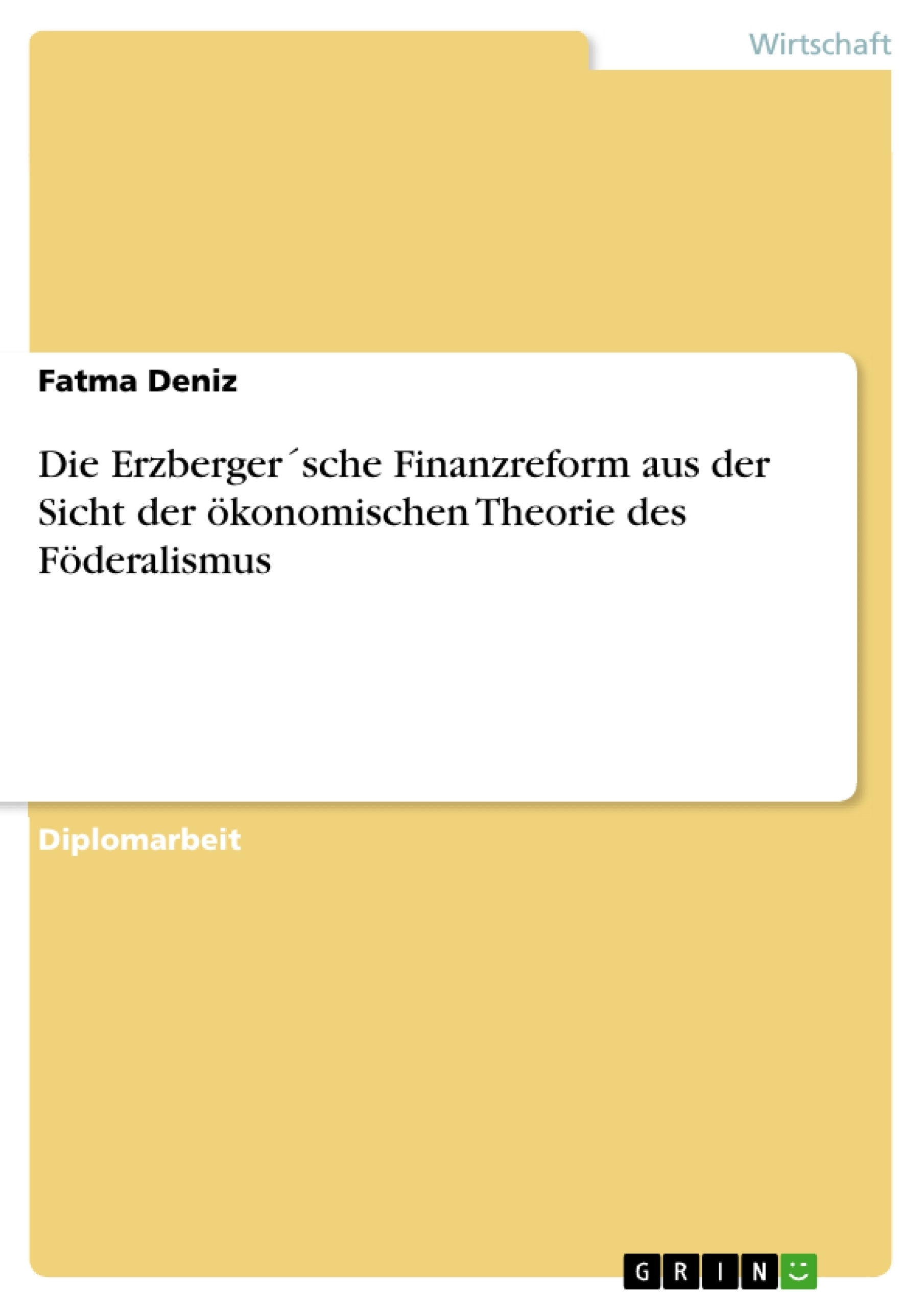

Kommentare