Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 „BillWer?“ – Ein No-Name wird Präsident von Amerika
2 Was ist eigentlich Politmarketing?
3 Die Rahmenbedingungen in den USA im
3.1 Wahljahr
3.2 Wahljahr 1996 als Amtsinhaber
4 Hauptmerkmale einer amerikanischen Kampagne am Beispiel der Clinton-Wahlkämpfe: Ein Überblick
4.1 Die Geschichte des Campaigning
4.2 Wesentliche Bestandteile der Clinton-Kampagne
5 Negative Campaigning: Der Angriffswahlkampf
5.1 Die Geschichte des Negative Campaignings
5.2 Die Ausprägungen im Clinton-Wahlkampf
5.3 Die Kampagne
5.4 Negative Campaigning und die Medien
5.5 Negative Campaigning: Pro vs. Contra!
6 Die Clinton-Wahlkämpfe: Eine gelungene Umsetzung der Theorie?
Bibliographie
1 „Bill…Wer?“ – Ein No-Name wird Präsident von Amerika
„DREAM ON, DEMOCRATS“[1] titelte die US-Zeitung Newsweek noch Anfang 1992 und hat damit der scheinbaren Utopie treffend Ausdruck verliehen, sich als Demokrat ernsthaft Hoffnung auf einen Wahlsieg des eigenen Kandidaten bei den US-Präsidentschaftswahlen 1992 zu machen. Viel zu stark schien der politische Gegner, der Republikaner George Bush im Sattel zu sitzen. Aber getreu dem Motto „Erstens kommt alles anders, zweitens als man denkt“ wurde Bill Clinton, der Kandidat der demokratischen Partei, entgegen allen Unkenrufen der 42. Präsident der USA. Er hat mit seinem spektakulären Wahlerfolg, den er innerhalb eines knappen halben Jahres möglich machte, bei Politprofis und Marketingstrategen große Anerkennung ausgelöst. Ein demokratischer Herausforderer fügt einem republikanischen, amtierenden Präsidenten eine schmerzliche Niederlage zu – das hat es seit 1932, als Franklin Roosevelt über Herbert Hoover siegte, nicht mehr gegeben.[2]
„IN THE PRESIDENTIAL ELECTION of 1992, a president once acclaimed as unbeatable was defeated by a candidate initially declared unelectable.”[3]
Mit diesem Satz kann man wohl die Sensation am Besten beschreiben. Dieser Umstand nötigte die Politologen und Marketingstrategen dazu, das Phänomen Clinton genauer zu betrachten: Wie war dieser unerwartete Sieg zustande gekommen? Wie konnte ein demokratischer Kandidat gegen einen Präsidenten, dessen Popularitätsvorsprung sich nach dem Golfkrieg 1991 in stratosphärischen Höhen bewegte (knapp 91% Zustimmung in der Bevölkerung)[4], dermaßen an Boden gewinnen? Unstrittig ist, dass hierbei eine Reihe von Faktoren bemüht/herangezogen werden müssen (z. B. die außenpolitische Lage, die stagnierende Wirtschaft in den USA, nicht eingehaltene Wahlversprechen der Gegner, psychologische Aspekte auf der Wählerseite etc.). Es herrscht allerdings auch Einigkeit darüber, dass die hervorragend funktionierende und professionell geführte Wahlkampfmaschinerie des Clinton-Lagers den Erfolg entscheidend mit beeinflusst hat. Grund genug, sich dessen Wahlkampf näher anzusehen.
Diese Arbeit möchte zum einen die gängige Theorie eines erfolgreichen Politmarketings vorstellen (Soll-Zustand), anschließend sollen die Clinton-Wahlkämpfe 1992 und 1996 überblickartig auf ihre Marketingstrategie hin untersucht werden (Ist-Zustand).
Ein besonderes und ausführliches Augenmerk wird auf den Angriffswahlkampf (Negative Campaigning) verwendet werden: Woher kommt er? In welcher Ausprägung fand er sich bei den Clinton-Wahlkämpfen wieder? Wie ist er zu beurteilen? Schließlich soll durch einen Abgleich von Theorie und Wirklichkeit die Eingangsfrage beantwortet werden, inwieweit Clinton und sein Wahlkampfteam die theoretischen Grundlegungen des Politmarketing umgesetzt haben.
2 Was ist eigentlich Politmarketing?
Zuallererst gilt es, den Begriff Politmarketing zu definieren. Dazu muss erst der Begriff „Marketing“ näher erläutert werden. Er stammt ursprünglich aus der Ökonomie und bedeutet wortwörtlich übersetzt „Handel treiben“. Gemeint sind damit „alle betrieblichen Maßnahmen, die sich am so genannten Marktgeschehen orientieren und darauf ausgerichtet sind, den Absatz zu fördern.“[5] Marketing soll behilflich sein, ein Produkt durch den Einsatz diverser Marketinginstrumente an den Verbraucher zu bringen. Um einen Markt überhaupt erst bedienen zu können, muss man sich möglichst viel Wissen über denselben aneignen. Dies geschieht durch kontinuierliche und repräsentative Marktbeobachtung und –analyse: Was bietet die Konkurrenz? Was sind die Wünsche der Kunden? Auf Basis dieser Erkenntnisse wird anschließend versucht, mit Hilfe diverser Marketinginstrumenten für ein Produkt möglichst viele Abnehmer zu finden. Solche Marketinginstrumente können sein Produktpolitik, Kommunikationspolitik, Leistungspolitik, Preispolitik, Vertriebspolitik etc. Auf das politische Parkett lassen sich die ersten drei hervorragend übertragen: Das Produkt ist der Kandidat, ihn gilt es zu verkaufen. Die Kommunikation erfolgt über die Massenmedien (TV, Radio, Zeitungen, Zeitschriften, Internet) und über Direct Mailings. Die Leistung ist die Agenda, also das, was ein Kandidat während seiner Amtszeit gedenkt, besser zu machen als sein Vorgänger. Die geforderte und praktizierte Anwendung von professionellem Marketing in der Politik hat in der Vergangenheit schon oft Kritik hervorgerufen, da, so die Argumente der Kritiker, es in der Politik nicht um ein Produkt gehe, nicht um Angebot und Nachfrage, nicht um Gewinnmaximierung, geschweige denn um Marktbeherrschung, sondern um Überzeugungen, Visionen, verschiedene Meinungen, eine Konkordanz, das Gemeinwohl, Botschaften, also letztendlich um Demokratie. In ihren Augen ist das Marketing in einer Welt zu Hause, die von Kalkül und vom Kosten-Nutzen-Prinzip geprägt ist und lediglich dem ökonomischen Prinzip dient, wohingegen die Politik etwas Ehrenhaftes, Pathetisches und Selbstloses sein sollte, die in erster Linie den Bürgern dienen sollte und nicht als Bühne für machtbesessene Selbstdarsteller fungiert, die es mit Hilfe der Politik zu Macht und Reichtum bringen möchten.
Hier das Eine (Marketing) zu negativ dargestellt, während das Andere (die Politik) zu naiv und blauäugig präsentiert wird. Im Prinzip geht es auch in der Politik darum, einem Verbraucher (=Wähler) etwas (= den Glauben: „Ich sorge dafür, dass es euch besser geht!“) zu verkaufen. Da viele Wähler dem Parteiprogramm keine oder nur wenig Beachtung schenken bzw. ihnen bei bestimmten Sachverhalten auch die Kompetenz dazu fehlt, werden sie ihre konkrete Kandidatenwahl überwiegend aus dem „Bauch heraus“ treffen. Besser formulierte es der US-Wahlkampfberater Rob Engle, als er sagte:
„Unterschätze nie die Intelligenz der Wähler, aber überschätze
nie ihr Interesse am politischen Prozess. Sie hören nie richtig zu.“[6]
Die Wähler werden den Kandidaten wählen, dem sie am ehesten die Vertretung ihrer eigenen Interessen zutrauen und der sie vermeintlich in ihrem Sinne im Parlament repräsentiert. Dazu muss der Kandidat ihre Sympathie gewinnen, ebenso wie er kompetent erscheinen sollte. Dies ist nun unter vielen anderen Aspekten Aufgabe des Politmarketings: Einem Kandidaten ein Image zu verpassen, das geeignet ist, dem Wähler die Frage beantworten zu lassen: Warum soll ich gerade dich wählen? Ein gelungenes Politmarketing hilft dem Kandidaten dabei, das Vertrauen des Wählers in die angepriesenen Fähigkeiten zu gewinnen. Ist der Kandidat mit seinen Bemühungen erfolgreich, wird der Wähler ihm seine Stimme schenken. Was er dann während seiner Amtszeit daraus macht, steht auf einem anderen Blatt und soll nicht hier diskutiert werden. Legitim ist es allemal, sich mit professionellen Mitteln die Art von Macht zu erkämpfen, die man benötigt, um Dinge durchzusetzen oder zu verändern. Sicherlich kann Politmarketing zu einem zweischneidigen Schwert werden: Es kann der Schlechteste gewinnen und der Beste verlieren, wenn die Strategie (nicht) stimmt, aber auch umgekehrt.
Die Erforschung des Marktes ist ein Grundpfeiler erfolgreichen Marketings. Sie hat kontinuierlich zu erfolgen, um auf Veränderungen rechtzeitig reagieren zu können und um ein Feedback über das bisherige Vorgehen zu erhalten. Liegen die Daten erst mal vor, können Kandidat und Wahlkampfteam Überlegungen anstellen, wie der Wähler gezielt beeinflusst werden kann.
Marco Althaus definiert den Begriff „Politikmarketing“ folgendermaßen:
„Anwendung von Marketingdenken und –instrumenten in der Politik. Marketing orientiert sich an dem Prozess, durch den ein Produkt vom Hersteller gegen das Geld eines Konsumenten eingetauscht wird. Befördert wird der Tausch durch eine Vermarktungsstrategie des Herstellers, die das Produkt, die Werbung und Promotion, den Preis sowie Platzierung/Vertrieb des Produkts formen muss. Übertragen auf die Politik heißt das nicht, dass ein Politiker wie Waschpulver oder Margarine vermarktet wird; der Politiker ist eher ein Dienstleistungsanbieter, ähnlich wie ein Versicherungsagent, der eine Police verkaufen möchte. Das Produkt ist das Wahlprogramm. Zum Marketing gehört die Analyse und Aufteilung eines Marktes durch SEGMENTIERUNG, die POSITIONIERUNG eines Politikers oder einer Organisation bei bestimmten ZIELGRUPPEN durch TARGETING, und das Formulieren und Ausführen einer STRATEGIE.[7]
Das wichtigste Einsatzgebiet des Politmarketing und somit auch Haupttummelplatz von Marketingstrategen und Politikmanagern ist der Wahlkampf. In ihm kann das gesamte zur Verfügung stehende Repertoire an Marketinginstrumenten zum Einsatz kommen. Was ihn für die Media Consultants zudem reizvoll macht ist die Tatsache, dass Belohnung und Strafe für den eigenen Einsatz relativ zeitnah zur Verteilung kommen, und zwar durch das Ergebnis der anvisierten Wahl. Hier entscheidet sich, ob die unternommenen Anstrengungen, ob die Strategie die richtige war und der Kandidat als Sieger aus der Wahl hervorgeht.
3 Die Rahmenbedingungen in den USA im…
3.1 …Wahljahr 1992
Die Rahmenbedingungen für das Wahljahr 1992 in den USA waren insofern besonders, als sich die Welt den gravierendsten Veränderungen seit dem zweitem Weltkrieg gegenüber sah: Der Fall der Berliner Mauer und die damit verbundene deutsche Wiedervereinigung 1989, das Ende des kalten Krieges durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, der Golfkrieg 1991. Diese historischen Ereignisse beeinflussten natürlich den Wahlkampf und seinen Ausgang nachhaltig. Direkt nach Beendigung des Golfkriegs 1991, den die Amerikaner als heroischen Meilenstein in der Geschichte ihres Landes einstuften und der schnell und zu Gunsten der Amerikaner entschieden werden konnte, fand George Bush 91% Zustimmung in der Bevölkerung,[8] so viel, wie noch kein anderer Präsident vor ihm. Mit dieser komfortablen Unterstützung im Volk schien er zunächst unschlagbar im darauf folgende Wahljahr 1992. Das war auch der Grund, warum hoch gehandelte, starke und beliebte demokratische Herausforderer wie Tennessees Senator Al Gore oder der Gouverneur von New York Mario Cuomo auf eine Gegenkandidatur verzichteten und schließlich ein vergleichsweise unbekannter Gouverneur aus dem Bundesstaate Arkansas mit Namen Bill Clinton die Chance bekam, als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten ins Rennen zu gehen.[9]
Ein Großteil der Amerikaner wandte sich nun, nachdem die unmittelbare Gefahr eines Krieges der Ideologien (Kapitalismus vs. Kommunismus) gebannt schien, wieder verschärft dem Landesinneren zu. Jetzt spielte nicht mehr die außenpolitische Stärke der USA die entscheidende Rolle, um für oder gegen einen Kandidaten zu votieren, sondern innenpolitische Themen rückten stärker in den Vordergrund. Und hier zeichnete sich seit Sommer 1990 eine wirtschaftliche Krise ab, genauer gesagt stagnierte die amerikanische Wirtschaft seitdem und wollte nicht mehr so richtig in Schwung kommen - ein Umstand, der vorzüglich und treffend auf dem berühmten Plakat des Clinton-Wahlkampf-Stützpunktes, dem legendären War Room, 1992 zum Ausdruck kam und der die Wichtigkeit von Wirtschaftswachstum und Aufschwung bei der Präsidentschaftswahl in drei Worten verdeutlichte: „ The economy, stupid! “[10]. Für George Bush’ Wiederwahlpläne stellte die schwächelnde US-Konjunktur ein ernstes Problem dar, denn eine „enge Verquickung von wirtschaftlicher Entwicklung und Wahlchancen ist eine der wenigen gesicherten Erkenntnisse der Politikwissenschaft“[11]. Und – historisch betrachtet – hielten die meisten Amerikaner die Demokraten über weite Strecken des 20. Jahrhunderts für die „ party of prosperty “[12], also die Partei, die ihnen Wachstum und Wohlstand bescheren konnte, wohingegen die Republikaner für Sicherheit im Land und außerhalb, für Aufrüstung und für außenpolitische Erfolge standen. Bushs Wirtschaftspolitik fand Ende Juni 1992 nur noch bei 16% der US-Bürger Zustimmung. Das Wachstum der US-Wirtschaft war, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), mit 1,2% eines der niedrigsten der Nachkriegszeit und die amtierende Exekutive vermittelte nicht den Eindruck, diesen drängenden, innenpolitischen Problemen begegnen zu können. Die fast zum Erliegen gekommene Wirtschaft traf die Bevölkerung mit all ihren schmerzlichen Ausprägungen: Eine für amerikanische Verhältnisse hohe Arbeitslosenquote (7,8%), eine relativ hohe Inflationsrate (durchschnittlich 4,3%) und das Fehlen neuer Arbeitsplätze.[13] Hinzu gesellte sich ein hohes Handelsbilanzdefizit, das, vor allem mit Amerikas wichtigstem Handelspartner Japan, ständig anwuchs. Eine Reise von George Bush im Januar 1992 nach Japan zur Verbesserung der amerikanischen Exporte und zur Schaffung von Arbeitsplätzen vor allem in der Automobilindustrie entpuppte sich als Desaster und ließ ihn, der bis dahin in den Umfragewerten, welche Partei die Probleme des Landes am Besten bewältigen konnte, noch vorne lag, in der Wählergunst rapide fallen: Die Demokraten hatten nach Bushs Japanreise einen Vorsprung von 42 zu 29 Punkten.[14] 1992 ist zudem das Haushaltsdefizit mit 7% des BIP stärker gewachsen, als bei all seinen Vorgängern seit Kennedy.[15] Aber obwohl sich die Wirtschaft langsam erholte und in einem schwachen Aufwärtstrend befand, dachten 77% der befragten Amerikaner noch Ende Oktober 1992, dass es um die Wirtschaft und somit um ihre persönliche Lage schlecht stünde.[16] Entscheidend für den Ausgang der Wahl war somit, was die Wähler dachten und nicht die Fakten.
All diese Faktoren ließen die Wiederwahlchancen des Republikaners Bush rapide sinken, während die Hoffnungen - zu Recht, wie sich zeigen sollte - bei den Demokraten auf einen Wahlsieg stiegen. Die USA befanden sich 1992 in einer Sinnkrise: Ihre Rolle als erster Verteidiger der freien Welt war überflüssig geworden, an ihre Stelle musste jetzt eine neue Rolle treten. Die amerikanischen Wähler wollten, dass ihr Land die erste Handelsmacht der Welt wird, was aber eine Mehrheit 1992 eher den Japanern denn dem eigenen Land zutraute. Die Republikaner respektive George Bush galten bisher, wie bereits erwähnt, als die Partei für nationale Sicherheit und für gute außenpolitische Beziehungen. Nach dem Ende des kalten Krieges waren dies jedoch kaum relevante Politikfelder. Für die entstandene Definitionslücke „Für wen oder für was steht Amerika? Wer sind wir heute? Welche Aufgabe übernimmt Amerika in der Zukunft?“ konnte George Bush dem amerikanischen Wähler keine Antworten geben, geschweige denn Konzepte vermitteln. Er hatte offensichtlich nicht „ the vision thing “[17], das die Amerikaner veranlassen hätte können, ihm zu folgen – Visionen über die neue Rolle Amerikas in der Welt und innerhalb seiner Grenzen konnte ihnen offensichtlich ein anderer glaubhaft vermitteln: Bill Clinton!
George Bush musste sich aber nicht nur gegen Bill Clinton zur Wehr setzen, sondern auch gegen Ross Perot, einen Selfmade-Millionär, der als Independent -Kandidat ins Rennen ging und der Mitte Juni noch mit knapp 38% der Stimmen weit vor Clinton lag.[18] Sein Abschneiden bei der Wahl mit 19% spricht eine deutliche Sprache.[19] Erwähnenswert ist diese Tatsache hier nur, weil auch er gegen Bush antrat und auch er The Economy zu seinem Hauptangriffspunkt machte. Somit hatte Bush zwei Gegner, die sich ihrerseits wiederum in mehreren Punkten einig waren. „Was wäre gewesen, wenn…“ - Spekulationen über einen Wahlausgang ohne einen dritten Kandidaten namens Perot stehen hier allerdings nicht zur Debatte.
3.2 …Wahljahr 1996 als Amtsinhaber
Die wirtschaftlichen Errungenschaften waren 1996 für den amtierenden Präsidenten Bill Clinton durchweg schmeichelhafter: Die Wirtschaft wuchs, die Arbeitslosigkeit war niedrig, die Inflationsrate war unter Kontrolle und der Aktienmarkt auf einem Rekordhoch.[20] War es schon 1992 die Wirtschaft bzw. ihre Wahrnehmung in der Bevölkerung, die einen großen Anteil an der Wahlniederlage George Bushs hatte, so trug sie auch diesmal erheblich zum Ausgang der Wahl bei; diesmal verhalf sie dem Amtsinhaber allerdings zum Sieg. Die Amerikaner blickten optimistisch in die Zukunft. Clinton blieb trotzdem wachsam und überließ auch bei seiner Kampagne 1996 nichts dem Zufall. Trotz der wirtschaftlichen Verbesserungen, deren Grundsteinlegung einige auch in der Bush-Ära sahen, mussten die Demokraten bei den 1994er midterm elections einen enormen Stimmenverlust hinnehmen und den Republikanern sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus überlassen.[21] Aber Bill Clinton wäre nicht seinem Ruf als „Comeback Kid“[22] gerecht geworden, hätte er sich nicht aus diesem Stimmungstief befreien können. Wie bereits erwähnt trugen die florierende US-Wirtschaft (niedrige Arbeitslosenquote, neue Jobs, Produktivitätszuwachs, technologischer Fortschritt), die steigenden Exporte und eine Reduzierung des Haushaltdefizits sehr zum Ansehen des Amtsinhabers bei.[23]
Zusätzlich kamen Bill Clinton weitere Vorteile eines amtierenden Präsidenten zu Gute: So wird über einen Präsidenten natürlich mehr und kontinuierlich berichtet als über einen bloßen Präsidentschaftskandidaten. Allein die Nachrichten sind „gespickt“ mit Aktivitäten des Präsidenten, mit seinen Auslandsbesuchen, mit hochrangigen Besuchern anderer Länder im Weißen Haus, mit Charitiyaktivitäten etc. Medienpräsenz ist das Eine – die Art der Berichterstattung ein anderes Thema. „Incumbents tend to receive more negative coverage than challengers.“[24] Bill Clinton bildete jedoch auch hier eine Ausnahme.
Er hatte die beste Presse seiner gesamten Amtszeit im Wahljahr 1996. So konnte ihn Bob Dole nur im August 1996 kurzzeitig in der positiven Wahlkampf-Berichterstattung übertrumpfen.[25]
[...]
[1] Zitiert nach Samuel L. Popkin, The reasoning voter. Communication and persuasion in presidential campaigns, Chicago 1994, S. 237.
[2] Vgl. ebd., S. 238.
[3] Ebd., S. 237.
[4] Vgl. Mieczkowski, The Routledge historical atlas of Presidential Elections, New York 2001, S. 140.
[5] Microsoft Encarta 2005.
[6] Zitiert nach Marco Althaus, Kampagne. Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying, Münster 32002, S. 21.
[7] Ebd., S. 368.
[8] Vgl. Yanek Mieczowski, The Routledge Historical Atlas of Presidential Elections, New York 2001, S. 140.
[9] Vgl. ebd.
[10] Samuel L. Popkin, The Reasoning Voter. Communication and Persuasion in Presidential Campaigns, Chicago 1994, S. 239.
[11] Stephan Bierling, Zur Lage der US-Wirtschaft. Bestandsaufnahme und Perspektiven am Ende der ersten Amtszeit von George Bush, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/92, 1992, S. 35.
[12] Everett Carll Ladd, The 1992 Vote for President Clinton. Another Brittle Mandate, in: Political Science Quarterly, Volume 108, 1993, S. 13.
[13] Vgl. Bierling, a. a. O., S. 37f.
[14] Vgl. Popkin, a. a. O., S. 242ff.
[15] Vgl. Bierling, a. a. O., S. 38.
[16] Vgl. Ladd, a. a. O., S. 15.
[17] Louis Maisel/S. Buckley/Z. Kara, Parties and Elections in America. The Electoral Process, Lanham 2005, S. 362.
[18] Vgl. Edward Keynes/Michael R. King, U.S. Presidential Elections 1992. Politics in the post-cold war era, S. 16.
[19] Vgl. Mieczkowski, a. a. O., S. 141.
[20] Vgl. Stephen J. Wayne, The Road to the White House, 2000. The Politics of Presidential Elections, Bedford/St. Martin’s 2000, S. 201.
[21] Vgl. Mieczkowski, a. a. O., S. 144.
[22] Diesen Spitznamen bekam Clinton, als er 1980 seine Wiederwahl zum Gouverneur von Arkansas verlor, 1982 aber das Amt zurück erobern konnte. Vgl. ebd., S. 140.
[23] Vgl. ebd. S. 144.
[24] Wayne, a. a. O., S. 227.
[25] Vgl. ebd., S. 228.
- Arbeit zitieren
- Mirjam Rothenbacher (Autor:in), 2006, Stigmatisierung und die Folgen für psychisch Kranke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65567
Kostenlos Autor werden












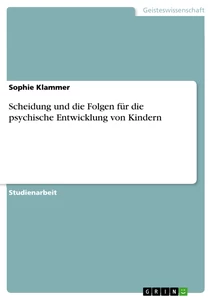






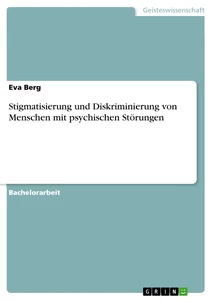
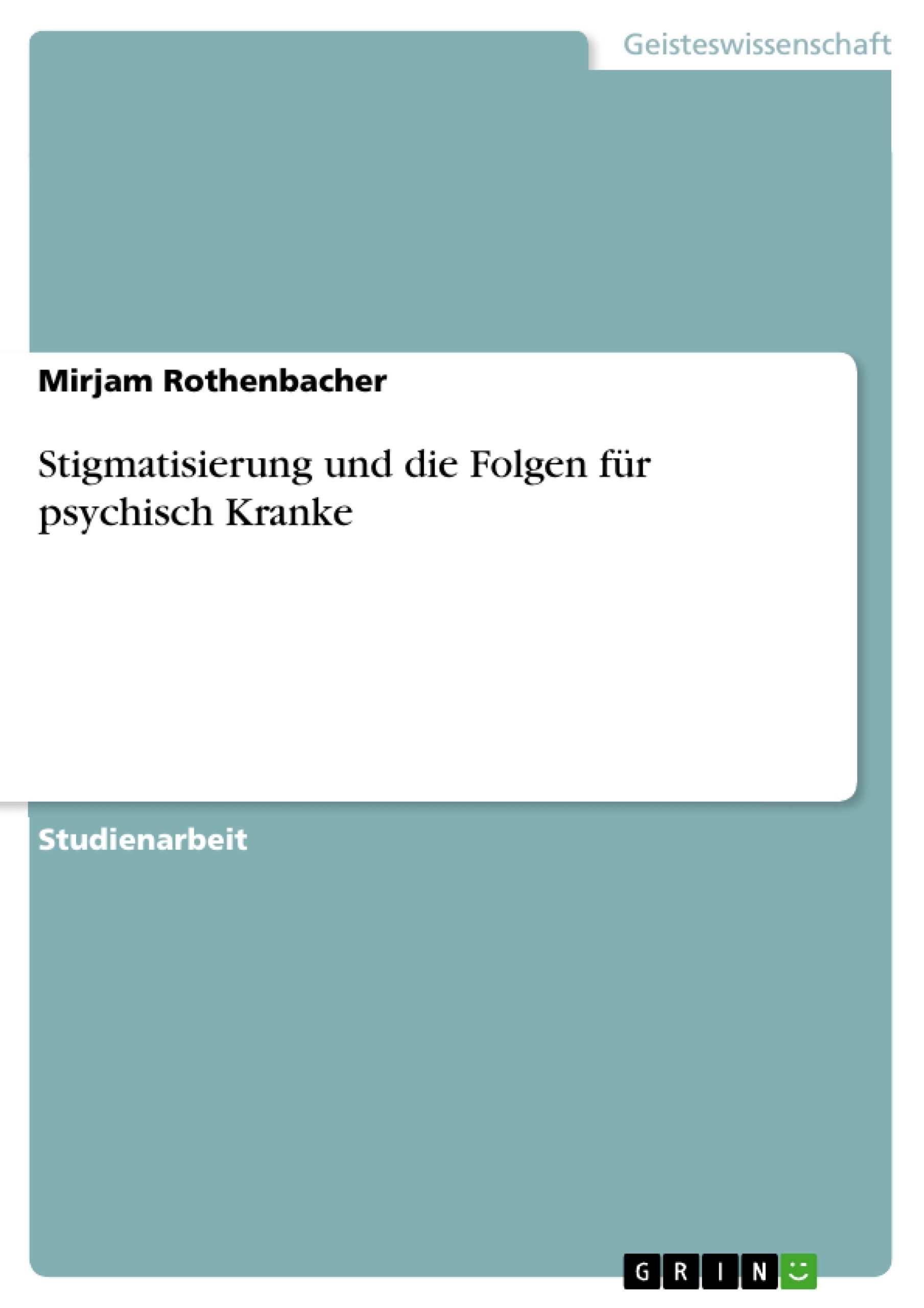

Kommentare