Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Theoretische Einführungen
1.1 Definition von Behinderung
1.2 Definition von Schwerstbehinderung
1.3 Geschichte der Entwicklung der Sonderschulen in Österreich
2 Definition der Integration
2.1 Gesetze zur Integration
2.2 Thesen zu Integration von Georg Feuser
2.3 Forderung der Integration in Österreich
2.4 Entwicklung der schulischen Integration in Österreich
2.4.1 Die braven 70er Jahre
2.4.2 Die kämpferischen 80er Jahre
2.4.3 Die grundlegenden 90er Jahre
2.4.4 Die beschwerliche Gegenwart
2.5 Gesetzliche Bestimmungen für die Volksschule
2.5.1 Integration oder Sonderschule? Die Wahlmöglichkeit der Eltern
2.5.2 Lehrplaneinstufung
2.5.3 Kriterien bei der Aufnahme behinderter Schüler/innen
2.5.4 Leistungsbeurteilung
2.6 Integrativer Unterricht
2.6.1 Unterrichtsdifferenzierung
2.6.2 Offenes Lernen
2.7 Modelle der Integration
2.7.1 Integrationsklasse
2.7.2 Kooperative Klasse
2.7.3 Klein- oder Förderklasse
2.7.4 Stützlehrer
2.8 Schwierigkeiten und Probleme der Integration von schwerstbehinderten Kindern
2.8.1 Schwierigkeiten und Probleme der Integration – Team – Teaching
2.9 Qualität der Integration
3 Von der Integration zur Inclusion - eine Schule für alle
4 Kinder mit schweren Behinderungen in der Schule
4.1 Schulische Situation von schwerstbehinderten Kindern in Graz
4.2 Welche Schulen bieten in Graz Integration an?
5 Empirischer Teil
5.1 Die Methode
5.1.1 Das Leitfadeninterview
5.1.2 Das qualitative Interview
5.2 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
5.2.1 Techniken qualitativer Inhaltsanalyse
5.3 Das Untersuchungsdesign
5.3.1 Interviewleitfaden
5.3.2 Interviewverlauf
5.4 Auswertung der Interviews
5.4.1 Darstellung der qualitativen Inhaltsanalyse anhand des Interviews der Mutter
5.4.2 Erklärung der folgenden Tabelle
5.4.3 Quervergleich innerhalb der Ergebniskategorien
6 Gesamtdarstellung der Ergebnisse
6.1 Kategoriale Auswertung der Interviews der Eltern
6.1.1 Kind und Behinderung
6.1.2 Entscheidung für die Integration
6.1.3 Organisatorischer Aufwand
6.1.4 Eltern über das Kind in der Schule
6.1.5 Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Eltern
6.2 Kategoriale Auswertung der Interviews der Lehrerinnen
6.2.1 Meinung zur Integration
6.2.2 Das Kind in der Schule
6.2.3 Sozialverhalten der Mitschüler/innen
6.2.4 Kind und Unterricht
6.2.5 Meinung zum Team-Teaching
6.2.6 Unterstützung des Landesschulrates
6.2.7 Zusammenarbeit mit den Eltern
6.2.8 Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Lehrerinnen
7 Zusammenfassung der Ergebnisse
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Eltern
7.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der Lehrerinnen
8 Schlussfolgerungen
9 Schlussworte
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Internetliteratur
Anhang
Einleitung
Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen stellt wohl eine der größten pädagogischen Herausforderungen an die heutige Schule dar. Schulische Integration ist aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe und erfordert ein Umdenken über die Institution Schule hinaus.
„ Es gibt ein individuelles Recht jedes Kindes auf Nichtaussonderung. (…) es hat jedes Kind das Recht, in der Gemeinschaft bleiben zu dürfen. Das ist ein Grundrecht. (…) es sollten sich eigentlich (…) die Institutionen, die Umwelt, die Umgebung muss sich verändern und nicht das Kind muss sich anpassen, sondern wir alle müssen uns überlegen: Was können wir tun für alle Kinder? Den Unterricht so zu gestalten, so zu verändern, dass alle Kinder was davon haben.“ (Mitarbeiterin des Landesschulrates, 5. März 2004)
Einstellungen und Erfahrungen der Beteiligten sind eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung schulischer Integration. Einstellungen und Erfahrungen als Determinanten der Bereitschaft zur schulischen Integration sind Gegenstand dieser vorliegenden Diplomarbeit.
Der erste Teil der vorliegenden Diplomarbeit umfasst die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema der schulischen Integration.
Im ersten Kapitel werden zunächst die Begriffe Behinderung und Schwerstbehinderung definiert und ein geschichtlicher Rückblick des österreichischen Sonderschulwesens gegeben.
Das zweite Kapitel führt die Gesetze zur Integration, die Entwicklung der schulischen Integration in Österreich, gesetzliche Bestimmungen in der Volksschule, das Wahlrecht der Eltern, die Lehrplanbestimmungen, die Leistungsbeurteilung, die Aufnahmekriterien, die Unterrichtsdifferenzierung und den integrativen Unterricht näher aus. Weiteres behandelt das zweite Kapitel die Themen: Modelle der Integration, Schwierigkeiten und Probleme in der Integration von schwerstbehinderten Kindern, Schwierigkeiten und Probleme im Team-Teaching und die Qualität der Integration.
Das dritte Kapitel spricht ein wichtiges Thema an, von dem in letzter Zeit auch immer mehr in der Öffentlichkeit die Rede war, nämlich der Begriff Inclusion (von der Integration zur Inclusion) und „Pädagogik der Vielfalt“. Das bedeutet, dass sich alle Schulen und Schulsysteme strukturell so verändern und für alle Kinder offen stehen, um als inklusive Schule alle Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zu integrieren und ihnen gemeinsames Lernen zu ermöglichen.
Das vierte Kapitel spricht speziell die schulische Integration von schwerstbehinderten Kindern an. Hier hat sich die Autorin vor allem mit Jutta Schöler auseinandergesetzt. Jutta Schöler schreibt hier in einem ihrer Bücher (siehe Schöler, 1987, S. 231-240):
„Einige Kinder haben so große Defizite, dass sie nicht in der Lage sind, die Lernziele aller anderen Schüler und Schülerinnen auch nur annähernd zu erreichen. Dennoch gibt es keine Begründung dafür, ein Kind als nicht lernfähig zu bezeichnen. Man würde diesem Menschen das Menschsein absprechen.“
Danach folgen Einblicke in die schulische Situation von schwerstbehinderten Kinder in Graz und welche Schulen der Integration von schwerstbehinderten Kindern positiv gestimmt sind. Diese Informationen und Daten wurden in Gesprächen mit Mitarbeiterinnen des Sonderpädagogischen Zentrums (SPZ) und des Landesschulrates eruiert.
In diesem Punkt findet der/die Leser/in auch Ausschnitte eines Interviews mit einer Mitarbeiterin des Landesschulrates über die schulische Situation von schwerstbehinderten Kindern in Graz zusammengefasst.
Im fünften Kapitel wird nun die empirische Untersuchung, die Methode und die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Es wird das Untersuchungsdesign näher erläutert. Man findet dort auch eine Übersichtstabelle der Behinderungsarten der schwerstbehinderten Kinder.
Das fünfte Kapitel beinhaltet sowohl den Interviewleitfaden der Eltern als auch der Lehrerinnen. Im Weiteren werden der Interviewverlauf und der Ablauf der Auswertung der Interviews genauestens beschrieben, sodass der/die Leser/in einen Ein- und Überblick über die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring erhält. Hier wird auch die Auswertung des Interviews einer Mutter (M1) exemplarisch dargestellt. Auf dieselbe Art und Weise wurden alle Interviews (sowohl der Eltern als auch der Lehrerinnen) ausgewertet. Die gesamten Ergebnisse liegen zur Einsicht bei der Autorin auf.
Im sechsten Kapitel erfolgt die Gesamtdarstellung der Ergebnisse. Hier sind auch Ausschnitte der Interviews zu lesen (die gesamte Transkription aller Interviews liegt bei der Autorin auf). Zunächst sind alle Kategorien der Eltern erläutert und statistisch mit dem Chi – Quadrat - Abweichungsmaß belegt. Dann folgt die kategoriale Auswertung der Interviews der Lehrerinnen.
Das siebte Kapitel stellt eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Interviews der Eltern und der Sonderschullehrerinnen dar.
Zum Schluss folgt in Kapitel 8 eine Schlussfolgerung der Ergebnisse, in der Probleme und Schwierigkeit der Integration schwerstbehinderter Kinder noch einmal aufdeckt werden und über eventuelle Lösungen diskutiert wird.
Im Kapitel 9 folgen abschließende Schlussworte.
1 Theoretische Einführungen
1.1 Definition von Behinderung
Wenn wir uns fragen: „Was ist Behinderung ? Wer ist behindert?“, scheint die Frage klar zu beantworten zu sein. Wir sind der Meinung, dass jemand der im Rollstuhl sitzt, behindert ist. Ist aber auch jemand, der so kurzsichtig ist, dass er selbst die großen Buchstaben des Lesebuches dicht vor die Nase halten muss, um sie entziffern zu können, und der mit einer Brille fast wieder „normal“ sehen kann, wird der auch als behindert, als sehbehindert deklariert?
Aus dieser kurzen Erläuterung wird klar, dass es keinen einheitlich, allgemein anerkannten Begriff für Behinderung gibt und dass die verschiedenen Behinderungsbegriffe unterschiedliche Folgen für die betroffenen Personen hinsichtlich ihrer sozialen und gesellschaftlichen Integration (im weitesten Sinne) haben.
Es ist klar, dass ein Zusammenhang zwischen Behinderung und gesellschaftlichem Umfeld besteht. Bach (1985, zit. n. Sander, 1998, S. 77) stellt dazu fest: „Behinderung ist ihrem Wesen nach keine Eigenschaft, sondern eine Relation zwischen individualen und außerindividualen Gegebenheiten.“
Bach, Bleidick und andere namhafte Vertreter der bundesdeutschen Sonderpädagogik wirkten im Ausschuss „Sonderpädagogik“ des Deutschen Bildungsrates bei der Erarbeitung der viel zitierten Empfehlung „Zur sonderpädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ zusammen, die im Oktober 1973 verabschiedet und seither mehrfach wiederaufgelegt wurde (Sander, 1998, S. 78):
„Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. (…)“
(Deutscher Bildungsrat, 1979, S. 32, zit. n. Sander, 1998, S. 78)
Die Formulierung lässt durchscheinen, dass Behinderung auf Grund von Schädigungen oder von Beeinträchtigungen wichtiger menschlicher Funktionen entsteht. Die Behinderung eines Menschen ist nicht identisch mit seiner – medizinisch oft genau fassbaren – Schädigung, und sie ist auch nicht linear abhängig von der Schädigung; vielmehr wird sie von anderen, außerindividualen Bedingungen wesentlich bestimmt (Sander, 1998, S. 78).
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach langen Vorarbeiten 1980 eine „International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“ vorgelegt, die die außerindividualen Bedingungen systematisch berücksichtigt. Zudem wird darin der Zusammenhang zwischen Schädigung und Behinderung thematisiert (Sander, 1998, S. 78).
Zur Beschreibung von Behinderung (letzte Fassung 1980) werden drei Dimensionen der Betrachtung unterschieden (Bleidick 1998, S.11).
- Impairment : Schädigung von Organen oder Funktionen des Menschen;
- Disability: Beeinträchtigung des Menschen, der auf Grund seiner Schädigung in der Regel eingeschränkte Fähigkeiten im Vergleich zu nicht geschädigten Menschen gleichen Alters besitzt;
- Handicap: Benachteiligung des Menschen im körperlichen und psychosozialen Feld, in familiärer, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht auf Grund seiner Schädigung und Beeinträchtigung.
1.2 Definition von Schwerstbehinderung
Ist es notwendig, den Begriff „schwerstbehindert“ genau zu definieren?
Im Alltagsgebrauch kennen wir verschiedene Bezeichnungen für schwere Behinderung: schwerst-geistig behindert, schwerstbehindert, schwerstmehrfachbehindert, extrem behindert oder schwerst cerebral bewegungsgestört.
Die Diskussion von Schweregraden des Behindertseins scheint ein Problem grundlegender Art zu sein, denn wie im vorherigen Kapitel festgestellt wurde, gibt es keine allgemein gültig anerkannte Definition der Behinderung.
Es ist auch nicht erwünscht, dass für alle Zeiten allgemeingültig festgelegt werde, wer als behindert zu gelten hat und wer nicht. Die Tatbestände Behindertsein und Behinderung sind sozial vermittelt: Soziale Normen, Konventionen und Standards bestimmen darüber, wer behindert ist. Der Begriff der Behinderung selbst unterliegt einem handlungsgeleiteten Erkenntnisinteresse. Darum sind Aussagen darüber, wer gestört, behindert, beeinträchtigt, geschädigt ist usw., relativ von gesellschaftlichen Einstellungen und diagnostischen Zuschreibungen abhängig (Bleidick 1998, S. 18-19).
Schwerste Behinderung lässt sich mit Hilfe des Konzeptes der Lebensformen folgendermaßen definieren: Gemeint sind Menschen, die diesbezüglich auf umfassende Unterstützung angewiesen sind, weil sie hier kaum Autonomie entwickelt haben. Dies umfasst die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse (wie Pflege usw.), die Bewegung, die Betätigung wegen interessanter Effekte, Fertigkeiten, Gestaltung ihres Lebensumfeldes und des Austausches von Mitteilungen. Mit dem Modell der Lebensformen gelingt es auch, die Problematik einer Begrenzung dieser Menschen auf eine eng und nur medizinisch verstandene Pflege nachzuweisen: Sie würden damit nur auf ihre organismischen Bedürfnisse reduziert, es würde nicht respektiert, dass sie auch Bildung benötigen, um sich (durch interessante Bewegungen und Betätigungen) zu unterhalten, etwas bewirken, in einer individuell gestalteten Welt zu leben und Mitteilungen austauschen zu können[1].
Wenn hier also von Kindern mit Schwerstbehinderung gesprochen wird, so sollen damit generell die Kinder gemeint sein, deren Entwicklungsprozesse extrem erschwert sind und vielfältigere pflegerische, pädagogische und existenzsichernde Hilfe brauchen.
Fröhlich (Fröhlich, 1981, S.23) beschreibt schwerstbehinderte Kinder wie folgt (1975):
„Die betroffenen Kinder sind in der Regel nicht in der Lage, einfachste motorische Muster eigenständig zu erwerben, mit denen sie eine gewisse Eigenständigkeit erwerben könnten. Sie sind nicht in der Lage: zu gehen, zu krabbeln, bei einigen ist ein Robben in Ansätzen möglich. Sie sind nicht in der Lage, ohne Stütze zu sitzen, viele können den Kopf nicht ohne fremde Hilfe heben und in aufrechter Stellung halten. Sie können keine gezielten Greifbewegungen mit den Händen vornehmen, es persistieren primitive Massenbewegungen. Häufig ist die Muskulatur des Mund-Rachen-Raumes mit betroffen, sodaß die Funktionen des Kauens und Schluckens stark beeinträchtigt sind. An eine Selbstversorgung in den Bereichen Körperpflege, Toilette, Essen, Ankleiden etc. ist demzufolge nicht zu denken. Die Kommunikationsfähigkeit der Kinder ist durch in fast allen Fällen vorliegende Anarthrie (Unfähigkeit zu artikulieren) ebenso reduziert wie durch Beeinträchtigung der Augenmuskulatur, Mimik und Handmotorik.“
Die Schwerstbehinderung ist in der Regel eine Mehrfachbehinderung, die aus einer Verbindung von zwei oder mehreren Behinderungen (z.B. geistige Behinderung und Körperbehinderung, Blindheit oder Gehörlosigkeit) besteht, wobei der Ausprägungsgrad der einzelnen Behinderungen immer gravierend ist. Zur Schwerstbehinderung gehört immer eine geistige Behinderung (Fornefeld, 2002, S. 70).
Fornefeld bezeichnet jene behinderte Menschen als schwerstbehindert, „die sowohl in ihren motorischen als auch in ihren geistig-seelischen Fähigkeiten aufs schwerste beeinträchtigt sind, die bei allen alltäglichen Verrichtungen der Hilfe anderer bedürfen, die unter Umständen gefüttert, angezogen, gepflegt, gelagert werden müssen und die darum ihr Leben lang in besonderer Abhängigkeit von Eltern, Lehrern, Betreuern bleiben.“ (ebda. S.70)
Schwerstbehindert werden solche Menschen genannt, „die häufig nicht erwartungsgemäß auf Kontakt- und Lernangebote reagieren, die sich nicht durch aktive Sprache, sondern eher durch Laute oder mittels somatischer Erscheinungen ihres Leibes (durch Speichelfluss, Tränenflüssigkeit oder Körpergeruch) ausdrücken vermögen. Sie sind zur Verwirklichung ihrer Wünsche und Bedürfnisse in besonderer Weise auf das Verstandenwerden seitens der Bezugspersonen angewiesen“ (Fornefeld, 2002, S. 71).
1.3 Geschichte der Entwicklung der Sonderschulen in Österreich
Das Recht auf Bildung für behinderte Kinder ist heute in allen Kulturnationen unbestritten und durch internationale Bestimmungen abgesichert. Alle Staaten streben das Ziel der persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration des behinderten Menschen an.
Die Durchsetzung des Bildungsrechts für Behinderte im 19. Jahrhundert geschah in der Weise, dass Sonder(schul)klassen und Sonderschulen für diejenigen Schüler/innen eingerichtet wurden, die in allgemeinen Schulen dem Lehrstoff nicht folgen konnten.
Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung waren in die im 19. Jahrhundert beginnenden Versuche zum Nachweis der Erziehungs- und Bildungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen nicht einbezogen. Sie verblieben überwiegend in Anstalten, in denen ihnen allenfalls Pflege, Versorgung und Bewahrung zukam, das heißt pädagogische Förderung blieb ihnen weitgehend vorenthalten (Mühl 1991, zit. n. Heinen/Lamers, 2001, S. 14).
Die geschichtlichen Wurzeln für die Entstehung eigener Sonderschulen und Klassen für behinderte Kinder reichen bis in das Zeitalter der Aufklärung zurück. Anfangs standen karitative Motive im Vordergrund. Doch bald stellten behinderte Kinder in überfüllten Schulklassen einen Störfaktor dar und wurden selbst zum Züchtigungs- und Spottobjekt (Gruber/Ledl 1992, S. 16).
Einige Schlüsselzahlen über die Entwicklung des österreichischen Sonderschulwesens [2]
1779 Gründung des k.k. Taubstummeninstitutes in Wien
1804 Eröffnung eines Blindeninstitutes in Wien durch J.W. Klein, ab 1817 Staatsanstalt
1816 Errichtung einer Klasse für schwachsinnige Kinder in Hallein durch den Lehrer G.
Guggenmoos
1853 Gründung der Sondererziehungsanstalt „Levana“ in Baden bei Wien durch H. M.
Deinhardt und J. D. Georgens
1864 In der Folge: Gründung verschiedener „Idioten- “ und „Schwachsinnigen- “ Anstalten
(1864 Ybbs, 1873 eigene Schulabteilung in der NÖ- Landesirrenanstalt in Wien, 1877
Gallneukirchen, 1878 Knittelfeld: „Idiotenstiftung“, 1879 Bruck/Mur: „Pius-Stiftung“,
1883 Biedermannsdorf: „Stefanienstiftung“, 1885 Währing/Wien, 1895 Grinzing/Wien)
1881 Durch Ministerialerlass wird festgelegt, dass die allgemeine Schulpflicht auch für blinde
und taubstumme Kinder gilt und diese entsprechende Anstalten/Institute oder als
„Notbehelf“ allgemeine öffentliche Volksschulen zu besuchen haben.
1883 Novelle zum Reichsvolksgesetz: Die Landesgesetzgebung kann hinsichtlich der
„Errichtung von Schulen und Erziehungsanstalten für nicht vollsinnige, ferner von
solchen sittlich verwahrloste Kinder […] geeignete Anordnungen treffen“.
1905 Die „Schul- und Unterrichtsordnung für allgemeine Volksschulen und Bürgerschulen“
legt fest, dass „für den Unterricht nicht vollsinniger oder schwächer veranlagter Kinder“
mit Bewilligung der Landesschulbehörde besondere „Hilfs- oder Förderklassen“
errichtet werden können. In der Folge Errichtungen von „Hilfsklassen“ für nicht
vollsinnige Kinder und von „Förderklassen“ für schwächer veranlagte Kinder
1911 Errichtung der Heilpädagogischen Abteilung an der Wiener Universitäts- Kinderklinik
durch Clemens Pirquet
1920 Aufschwung der Sonderpädagogik unter Otto Glöckel und Errichtung selbstständiger
Hilfsschule
1928 Erster definitiver Lehrplan für Hilfsschulen (ab 1921 Versuchslehrplan)
1938 Eingliederung in das nationalsozialistische Erziehungssystem mit katastrophalen
Auswirkungen (Vernichtung „unwerten“ Lebens)
1945 Wiederaufbau des österreichischen Sonderschulwesens
1950 Erste Versuchsklasse für imbezille Kinder
1955 Eröffnung von zwei Spezialsonderschulen (für geistig behinderte Kinder)
1962 Das Schulgesetzwerk 1962 bringt eine Neuordnung der österreichischen Schule und die
gesetzliche Verankerung des Sonderschulwesens.
1974 Beginn der Schulversuche zur integrierten Grundschule und differenzierten
Sonderschule mit ersten Ansätzen zum gemeinsamen Unterricht behinderter und
nichtbehinderter Kinder
1988 Rechtliche Grundlagen für Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht in der
13. SchOG-Novelle
1993 15. SchOG-Novelle, die im Bereich der Volksschule die Übernahme der Integration ins
Regelschulwesen beinhaltet
1996 17. SchOG-Novelle, die die gesetzliche Verankerung des gemeinsamen Unterrichts
behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Hauptschule und Unterstufe der AHS
schafft
Die Einführung der Sonderschulen war - historisch betrachtet – sicherlich ein wichtiger Schritt, der mit der Aufhebung der Jahrhunderte lang vorherrschenden sozialen Ausgrenzung und Isolierung behinderter Menschen begann und dazu führte, dass heute das Recht behinderter Kinder auf Bildung und Erziehung allgemein anerkannt ist. Mit dem stetigen Ausbau und der Ausdifferenzierung des Sonderschulwesens wurden aber auch Erfahrungen gewonnen, die den Nutzen der Spezialschulen immer stärker in Frage stellten, da die Einweisung in eine Sonderschule mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung verbunden ist und die Zusammenfassung von Kindern mit Behinderungen zur Reduktion wichtiger sozialer Erfahrungen führt, wodurch eine positive Veränderung kognitiver, sozialer und emotionaler Persönlichkeitseigenschaften kaum herbeigeführt werden kann (Burgener-Woeffray, Jenny-Fuchs & Moser-Opitz 1993, zit. n. Feyerer 1998, S.22).
Die 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle war eine Weichenstellung im österreichischen Schulwesen. 1993 wurde mit ihr die Grundlage für die Integration in der Volksschule gelegt. Die Zielvorgabe lautete nach Volker Rutte (in Schulheft 94/1999, S. 13):
„Die Volksschule hat in den ersten vier Schulstufen (Grundschule) eine für alle Schüler gemeinsame Elementarbildung, unter Berücksichtung einer sozialen Integration behinderter Kinder zu vermitteln.“
Mit diesen Schulversuchsmodellen zu einem gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder hat das österreichische Parlament eine grundlegende Neuordnung der sonderpädagogischen Förderung in Österreich beschlossen. (vgl. Gruber/Ledl, 1992, S. 257)
Heute jedoch strebt die Integrationsbewegung eine völlige Abschaffung des Sonderschulwesens an und es ist immer mehr die Rede von einer „unteilbaren“ inklusiven Pädagogik bzw. Integration.
2 Definition der Integration
Unter dem Begriff der „Integration“ werden gegenwärtig Fragen des gemeinsamen Lebens und Lernens behinderter und nichtbehinderter Menschen über alle Bereiche hinweg diskutiert, die die Lebensspanne eines Menschen enthalten. Integration verfolgt das Ziel der möglichst unbehinderten Teilnahme behinderter Menschen am öffentlichen Leben.
In der Pädagogik wurde die Bezeichnung Integration zunächst ausschließlich im persönlichkeits- und entwicklungspsychologischen Sinne gebraucht. Erst von den sechziger Jahren weg dringt sie, vor einem didaktischen Sinnhorizont, auch in Curriculumsdiskussionen ein. Der Begriff findet ferner Verwendung im Zusammenhang mit kritischen Auseinandersetzungen um das Selektionswesen in vertikal gegliederten Schulsystemen (vgl. Kobi, 1998, 57).
Der Begriff der sozialen Integration ist gekennzeichnet „(…) durch die dialogische Struktur der Beziehungen, in der sich sowohl der Behinderte als auch der Nichtbehinderte in wechselseitigen Interaktionen auf einen gemeinsamen Lernprozess einlassen. (…) Integration in einem sozialen Kontext bezeichnet also einen permanenten, aktiven, kreativen und dialogischen Lernprozess zu sich selbst, zur Gruppe, zur Umwelt und zur Gesellschaft, mit dem Ziel gemeinsam sich verändernder Erneuerungen“ (Schuchardt 1980, zit. n. Feyerer, 1998, S. 17).
Die Integration ist in diesem Sinne als ein dynamischer Prozess zu sehen, der eigentlich nie beendet werden kann, sondern jeden Tag aufs Neue durch die konkrete Interaktion zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen erarbeitet werden muss. Der Weg ist gleichzeitig das Ziel.
Im Wörterbuch der Pädagogik von Wilfried Böhm findet man unter „Integration“ folgende Erläuterung:
„Integration (lat.: Wiedereinbeziehung, Eingliederung in ein Ganzes) ist ein in verschiedenen Zusammenhängen gebrauchter Begriff, der heute zunehmende Bedeutung gewinnt. In der gegenwärtigen sonderpädagogischen Diskussion wird der Gedanke der Integration im Sinne einer gemeinsamen Erziehung und Bildung von behinderten und nichtbehinderten Menschen vermehrt in den Blick genommen. […] Die möglichst weitgehende Eingliederung von behinderten Menschen in die soziale Einheit soll die Trennung von Regel- und Sondererziehung aufheben und eine Aussonderung vermeiden. Auf dieser Basis werden pädagogische Grundfragen wie der Ausgleich von Individuum und Gruppe, das Verhältnis von Gleichheit und Ungleichheit, der Widerspruch von Selbstwertgefühl und gesellschaftlich definierter Tüchtigkeit in Bezug auf Behinderungen neu gestellt und gemäß dem Leitsatz der italienischen Integrationsbewegung „ tutti uguali – tutti diversi“ (alle sind gleich – alle sind verschieden) erörtert. […]“ (in Böhm, 2000, S. 263)
In der Geschichte der Pädagogik kann man dann von Integration sprechen, wenn behinderte Kinder öffentliche und solidarische Beachtung als Schüler/innen gefunden haben. Integration beansprucht demnach drei Bestimmungsstü>Begrenzt ist eine Integration, wenn nicht alle Kinder einer Gruppe integriert sind; umfassend, wenn für alle behinderten Kinder einer Gruppe Schulplätze im öffentlichen Schulwesen geschaffen werden. Schließlich ist noch zu unterscheiden, ob in das Schulwesen, in Schulen und in den Unterricht integriert wird. Die Integration in das Schulwesen gilt als Vorbedingung für die Integration in den Unterricht (vgl. Möckel, 1998, S. 30/31).
Der Begriff „Integrationspädagogik“ steht für eine neue Sichtweise zur Erziehung und Unterrichtung Behinderter sowie für einen veränderten Auftrag in Vorschule und Schule.
„Integrationspädagogik“ ist ein Substitutionsbegriff; in ihm ist die Aufhebung der Sonderpädagogik begriffslogisch enthalten. Als Ziel verfolgt Integrationspädagogik die Überwindung aussondernder Einrichtungen sowie deren pädagogischer Konsequenzen zugunsten gemeinsamen Lernens und Lebens. Damit verbinden sich weitreichende strukturelle Veränderungen im Schul- und Bildungswesen (vgl. Eberwein, 1998, S. 45).
In neuerer Zeit verlagerte sich das Gewicht mehr auf den innerschulischen, das heißt den lern- und lehrpsychologischen Bereich. Bemühungen um ein „integratived curriculum“ (im Gegensatz zu Fächerung) und ein „integrated learning system“ (verstanden als Verbundsystem verschiedenartiger Lehr-/Lernformen in Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel), und eine „comprehensive school“ erfuhren in der Nachkriegszeit via USA und Skandinavien, zum Teil auch über das sozialistische Schulwesen auch im deutschsprachigen Kulturraum eine Wiederbelebung (Eberwein, 1998, S. 57).
2.1 Gesetze zur Integration
Die Menschenrechtskonvention (MRK) zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten Artikel 2 (1950/1958) beschloss: Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden.
„Der Genuss, der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten, ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sonstigen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder ein sonstiger Status zu gewährleisten.“ [3]
Der Staat hat bei Ausübung, der von ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben, auf das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.
Leider ist es in Österreich noch immer so, dass so genannten „schulunfähigen“ Kindern (§ 15 Schulpflichtsgesetz) das Recht auf Bildung verweigert wird. Da die MRK keinerlei Ausnahmen zulässt, ist § 15 Schulpflichtgesetz verfassungs- und konventionswidrig. Sollten (schwer)behinderte Kinder auf dieser Grundlage gegen den Willen der Eltern am Schulbesuch gehindert werden, könnte der Verfassungsgerichtshof und gegebenenfalls danach auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof (Straßburg) angerufen werden.
Mit 14. August 1997 wurde mit Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 87/1997 Art. 7 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes wie folgt ergänzt:
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des alltäglichen Lebens zu gewährleisten.“
Schon seit 1993 gehört die soziale Integration behinderter Kinder zu den Aufgaben der österreichischen Schule. Die ehemals nur für die Volksschule verankerte Verpflichtung wurde nun auch auf die Hauptschule und AHS ausgedehnt. Diese gesetzlichen Regelungen sind für Lehrer/innen und Direktor/innen bindend. Sie legen deren Dienstpflichten fest.
Integration ist nicht von ihrem Belieben oder ihrer persönlichen pädagogischen Überzeugung abhängig: Sie ist zu verwirklichen!
2.2 Thesen zu Integration von Georg Feuser
Feuser entwickelte folgende Thesen zur gemeinsamen Erziehung, Bildung und Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher in Kindergarten und Schule (Integration)(Feuser, 1996, bidok):
1.) Integration umschreibt die Idee vom Erhalt bzw. der Wiederherstellung gemeinsamer Lebens- und Lernfelder für behinderte und nichtbehinderte Menschen, um der Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten aller willen.
2.) Integrativer pädagogischer Arbeit geht es (in Anlehnung an E. Séguin, 1812-1880) um
- die „Wiederherstellung der Einheit des Menschen in der Menschheit“ und
- die „Wiederherstellung der Einheit unserer zusammenhangslos gewordenen Mittel und Werkzeuge der Erziehung“. Sie ist Reformpädagogik.
Ihre Ziele lassen sich als Bemühen um „Humanisierung“ und Demokratisierung“ des gesamten Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtswesens zusammenfassen.
3.) Integration erfordert, dass (Regel -) Kindergärten und (Regel -) Schulen für alle so gestaltet werden, dass jedes Kind jede/r Schüler/in ohne sozialen Ausschluss und ohne persönliche Etikettierung als „defekt“, „abweichend“ oder „behindert“ seinen/ihren individuellen Voraussetzungen gemäß umfassend gefördert und unterrichtet wird. Sie realisiert (…), dass allen von „Behinderung“ und/oder „psychischer Krankheit“ betroffenen Kindern und Jugendlichen
- die volle Teilhabe an den gesellschaftlichen Gütern und am sozialen Verkehr garantiert bleibt,
- sie an den Orten/in den Stadtteilen, in denen sie leben, zusammen mit ihren nichtbehinderten Alterskameraden, Nachbarn und Freunden, Kindergarten und Schulen besuchen können und
- dort alle speziellen Hilfen (…) gewährt bekommen, derer sie für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung bedürfen (Prinzip der Dezentralisierung)
4.) (…) Unter pädagogischen Aspekten kann „Be-Hinderung“ als Ausdruck dessen
verstanden werden, was ein Mensch mangels angemessener Möglichkeiten und
Hilfen und durch vorurteilsbelastete Vorenthaltung an Inhalten und sozialen
Bezügen nicht lernen durfte und als Ausdruck unserer Art und Weise, ihn
wahrzunehmen mit ihm umzugehen.
5.) Integration bedeutet (…) dass
- alle Kinder und Schüler/innen (ohne Ausschluss der behinderten Kinder und Jugendliche wegen Art und Schweregrad einer vorliegenden Behinderung)
- in Kooperation miteinander
- auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau (= ihre momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen)
- an und mit einem „gemeinsamen Gegenstand“ (Projekt/Vorhaben/Thema/Inhalt)
- spielen, lernen und arbeiten.
Integration ist kooperative (dialogische, interaktive, kommunikative) Tätigkeit im Kollektiv!!!
6.) Integration begründet eine allgemeine (basale und kindzentrierte) Pädagogik.
Sie ist eine
- basale Pädagogik, als sie die Kinder und Jugendlichen aller Entwicklungsniveaus, aller Grade der Realitätskontrolle, Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen ohne sozialen Ausschluss zu lehren und mit ihnen zu lernen vermag, eine
- kindzentrierte Pädagogik, als sie die Subjekthaftigkeit des Menschen und damit seine Heterogenität einer jeden menschlichen Gruppierung voraussetzt und Lehr- und Lernangebote an den Gesetzmäßigkeiten menschlicher Entwicklung orientiert, d.h. unter Berücksichtigung der „aktuellen Zone der Entwicklung“ eines Kindes/Schülers/Schülerin sich mit diesem handelnd in Beziehung setzt und das Lehren und Lernen auf dessen „nächste Zone der Entwicklung“ orientiert und eine
- allgemeine Pädagogik, als sie unter den vorgenannten Bedingungen keinen Menschen von der Aneignung der für alle Menschen in gleicher Weise bedeutenden gesamten gesellschaftlichen Erfahrungen ausschließt,
was lern- und unterrichtsorganisatorisch bedeutet:
- „Gewähren“ anstatt ‚vorenthalten’
- „Handeln“ anstatt ‚behandeln’ und
- pädagogisches Handeln „spezialisieren“ (=> differenzieren durch
entwicklungslogisch-biographisch orientiertes Individualisieren) anstatt
Kinder/Schüler/innen ‚segregieren’.
Sie kann folglich prinzipiell auf eine Trennung zwischen Regel- und Sonderkindergarten bzw. Sonderschulen und verschiedene Regelschulformen verzichten.
7.) Integration bedarf zu ihrer Realisierung im Feld der Pädagogik einer Didaktik, die
vier Momente im Sinne eines nicht zu unterschreitenden und unveräußerlichen,
didaktischen Fundamentums ausweist, nämlich
- einen durch biographisch-entwicklungslogische und –bezogene „Individualisierung“ zu realisierende „Innere Differenzierung“ (=> sie konstituiert das Humanum einer Pädagogik) und
- (nach Maßgabe des vorgenannten Humanums) die „Kooperative Tätigkeit“ (der Subjekte einer sozialen Gemeinschaft mit dem Ziel der Realisierung der Qualitäten eines Kollektivs) an einem „gemeinsamen Gegenstand“ (=> sie konstituiert das Moment des Demokratischen).
Der „gemeinsame Gegenstand“ist nicht das materiell Fassbare, das letztlich in der Hand der Kinder und Schüler/innen zum Lerngegenstand wird, sondern der zentrale „Prozess“, der hinter den Dingen und beobachtbaren Erscheinungen steht und sie hervorbringt.
8.) Integrative Pädagogik ist auf allgemeiner Ebene insofern
- demokratisch, als alle Kinder/Schüler/innen alles lernen dürfen und insofern
- human, als dies unter Zurverfügungstellung aller erforderlichen, materiellen und personellen Hilfen auf die einem/r jeden Kind/Schüler/in mögliche Art und Weise ohne sozialen Ausschluss erfolgen kann.
Integrative Pädagogik verlangt folglich nicht „individuelle Curricula“ (z. B. gesonderte Lehrpläne für verschiedene behinderte und nichtbehinderte Schüler/innen), sondern „individualisierte“ und das Lernen in Projekten und in Formen projektorientierten, offenen, zieldifferenten Unterrichts (am „gemeinsamen Gegenstand“).
Nur ein solcher Unterricht ermöglicht, dass:
- sich jedes Kind wahrnehmend und handelnd in das Geschehen einbringen kann,
- das Tun des einen, das des anderen beeinflusst und mit bedingt, wodurch jedes/r/e Kind/Schüler/in für jedes/n/e andere/n Bedeutung gewinnen kann und
- sich alle Kinder/Schüler/innen subjektiv als kompetent und wichtig für die Gemeinschaft erfahren können, d.h. eine Identität mit dem anderen aufzubauen, am DU zum ICH werden.
9.) Integrative Erziehungs- und Unterrichtspraxis erfordert organisatorisch
- das Prinzip der Regionalisierung: Den wohnort-/stadtteilbezogenen, im unmittelbaren Lebensumfeld aller Kinder und Jugendlichen möglichen Besuch von Kindergarten und Schule,
- das Prinzip der Dezentralisierung: Die materiellen und personellen Hilfen sind am Ort des Lebens und des Lernens und dort nicht isoliert z. B. in Therapieräumen, sondern eingebettet in das Gruppen-/Klassengeschehen zu gewähren.
- das Prinzip des Kompetenztransfers: Im Zusammenhang mit der unverzichtbaren Team-Arbeit aller pädagogischen, therapeutischen und mitarbeitenden Fachkräfte unterschiedlichster Ausgangsberufe und Berufserfahrungen bzw. dem Team-Teaching von Regel- und Sonderschullehrer/in geht es (…) um den Austausch über und um die wechselseitige Aneignung von Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen- und
- das Prinzip der integrierten Therapie: Therapeutisch einzulösende Bedarfe der Kinder und Schüler/innen sind schon bei der gemeinsamen Planung der Vorhaben so zu berücksichtigen, dass sie direkt im Gruppen- und Unterrichtsgeschehen zum Tragen kommen und von den Kindern und Schülern als Hilfen bei Tätigkeiten erfahren werden können und für sie in der kooperativen Tätigkeiten motivierend sind. Darüber hinaus können so alle Kinder und Schüler präventive Qualitäten gewinnen.
10.) Pädagogik und Therapie erkennen im integrativen pädagogischen
Arbeitszusammenhang die als „pathologische“ erscheinende Tätigkeitsstruktur
eines Menschen, gegen die immer antherapiert wurde, als entwicklungslogisches
Produkt, als eine unter den gegebenen Bedingungen seiner Biographie optimal
herausgearbeitete Aneignungsstrategie und Handlungskompetenz. Ausgehend
von dieser geht es darum, neue Tätigkeitsstrukturen zu entfalten und eine
Verbesserung der Realitätskontrolle anzustreben, d.h. auf Erweiterung und
Stabilisierung der Autonomie und Identität des Betroffenen, auf dem ihm nächst
erreichbaren Entwicklungsniveau hinzuarbeiten.
„Das „Besondere“ der Pädagogik, derer wir für Integration bedürfen, liegt nicht in der „Besonderung“ der Kinder und Schüler/innen, sondern im „Allgemeinen“ der Grundlagen menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens, im „allgemeinen“ einer basalen, subjektorienierten Pädagogik. Dieses „Allgemeine“ herauszuarbeiten, ist das Spezielle unserer Arbeit; es in der „Besonderung“ der Kinder und Schüler/innen zu suchen , ist ein Irrweg. (…) Integration ist Ziel und Weg zugleich! “ (Feuser, 1996, bidok)[4]
2.3 Forderung der Integration in Österreich
Die Schaffung eigener Bildungseinrichtungen für behinderte Kinder in Österreich wurde über Jahrzehnte als besondere pädagogische und sozialpolitische Leistung anerkannt. In den letzten Jahren jedoch bringen veränderte gesellschaftliche und pädagogische Einsichten und
Einstellungen auch Erneuerungen in der Auffassung über die schulische Erziehung.
Kindergärten, Grundschulen, Hauptschulen und Allgemeinbildende Höhere Schulen sollen die Sonderschulen soweit als möglich entbehrlich machen. Diese Richtung entspricht der Forderung der Normalisierung, wonach im Sinne der Verhältnismäßigkeit der Mittel jeweils solche Institutionen und Maßnahmen im Leben von behinderten Kindern bevorzugt werden sollen, die den üblichen am nächsten kommen. Wenn ein Kind die Volksschule besuchen kann, soll es keiner Sonderschule zugewiesen werden. Kindergärten und allgemeine Schulen sollen grundsätzlich auch heilpädagogische Schulen sein und durch zusätzliche personelle Ausstattung jederzeit in die Lage versetzt werden können, ein ortsansässiges behindertes Kind aufzunehmen. Integration meint, dass Kinder immer am Heimatort unterrichtet werden sollten. Die Geschichte der Pädagogik zeigt eine große Zahl von Versuchen, die Solidarität für behinderte Kinder unbegrenzt und überregional, möglichst weltweit wirksam werden lassen (vgl. Möckel, 1998, S. 35/36).
Die Tendenz führt zu einer Stärkung des Elternrechts (in Gruber/Ledl, 1992, S. 30):
- Viele Eltern behinderter Kinder wollen einen frühzeitigen Ausschluss („Aussonderung“)
ihrer Kinder aus der Gruppe der Gleichaltrigen vermeiden. Meist beginnt die gemeinsame
Förderung schon im Kindergarten und soll nun in der Schule weitergeführt werden. Es
werden viele Vereine und Initiativgruppen gegründet, um die Interessen der Eltern
(schulische Integration) durchsetzen zu können.
- Der Besuch einer Sonderschule stellt in der allgemeinen gesellschaftlichen Betrachtung eine
zusätzliche Stigmatisierung eines ohnehin schon beeinträchtigen Kindes dar.
- Da viele Behinderungen relativ selten auftreten und das Netz der zugeordneten
Sonderschulen ziemlich weitmaschig ist, ist mit langen Schulwegen oder Heimaufenthalten
zu rechnen, was für viele Eltern eine zusätzliche Belastung darstellt.
- Integration ist eine Wertvorstellung, die in weiten Teilen der Bevölkerung einen hohen
Rang einnimmt. Sie beinhaltet die Bejahung des menschlichen Grundbedürfnisses am
sozialen Leben und die Erziehung zur sozialen Akzeptanz und Solidarität. (…)
- Welt- und europaweit werden behinderte Kinder nicht im Vorhinein in eigene Schulen
aufgenommen, sondern es wird versucht, beide Gruppen gemeinsam zu unterrichten (Bsp.:
Amerika, Skandinavien,…).
- Behinderte Menschen sollten in ihrem So - Sein anerkannt werden und nicht nur ihr
medizinischer „Defekt“ in den Vordergrund gerückt werden.
2.4 Entwicklung der schulischen Integration in Österreich
Behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben in Österreich Probleme auf der Ebene der „Gleichstellung“. Die Vorstellung gleicher Bürgerrechte schließt mit ein, einen mit nichtbehinderten Personen vergleichbaren Lebenslauf zu haben und an den gleichen Orten leben und tätig sein zu können, wie so genannte Nichtbehinderte – wie es das „Normalisierungsprinzip“ verlangt (Bank – Mikkelsen/Berg 1982, zit. n. Rutte/Schönwiese, 2000, S. 205). Das bedeutet Integration in Kindergarten, Grund- und Sekundarschule, Integration in den Berufsbildungsbereich, Recht auf Arbeit, „normale“ Wohnverhältnisse, Gleichheit vor dem Gesetz usw.
Die schulische Integration in Österreich wurde im Wesentlichen durch die Initiative betroffener Eltern behinderter Kinder mit der Unterstützung von Eltern nichtbehinderter Kinder, Lehrer und Lehrerinnen und der Medien erreicht.
Die wesentlichsten Leitideen können verschiedenen Modellbeschreibungen entnommen
werden, die vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst (BMUK) genehmigt worden sind (vgl. Gruber/Ledl 1992, S. 31):
- Soziale Integration behinderter Menschen stellt eine gesellschaftliche Entscheidung dar, und wir, das BMUK, bekennen uns zu diesem Wert.
- Die soziale Integration wird als ein Recht behinderter Menschen erachtet und vorrangig gegenüber schulischen und therapeutischen Maßnahmen, sofern der Behinderte bzw. dessen Interessenvertretung dies will.
- Die Ablehnung Behinderter durch die Gesellschaft stellt keinen Teufelskreis dar, sondern kann vor allem durch soziale Integration in der Vor- und Grundschule verändert werden.
- Soziale Integration behinderter Menschen in die Regelschule bedeutet vielleicht
ein verunsicherndes Abgehen von schulischen und gesellschaftlichen Traditionen,
eine Vergrößerung des Arbeitsaufwandes und der Kosten in der Anfangsphase,
aber vor allem eine außerordentliche Bereicherung der Lebenserfahrung und
Lebensqualität für alle Beteiligten.
Vor allem behinderte Kinder brauchen Anregungen und Impulse der gesunden Kinder. Das Lernen am Modell ist für sie sehr wichtig. Sie benötigen aber auch die Möglichkeit, in alltäglicher und behutsamer Auseinandersetzung mit einem realitätsgerechten sozialen Umfeld Erfahrungen zu sammeln, um ihre Identität zu finden und sich später behaupten zu können. Die „gesunden“ Kinder erhalten auch die Chance, im Miteinander mit dem behinderten Kind zu lernen, Individualität und Normabweichung zu achten, Rücksicht zu nehmen und dort Hilfe zu leisten, wo sie nötig ist.
Integration ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Integration hat viele Formen und muss der jeweiligen Situation angepasst werden. Um Integration zu ermöglichen, sind die äußeren Rahmenbedingungen wichtig, die von der Schulbehörde geschaffen werden müssen (Anlanger 1993, S.14).
Nur den wenigsten war bewusst, dass Integrationsversuche das allgemeine Schulwesen insgesamt verändern würden. Essentielle Grundprinzipien des österreichischen Schulsystems werden hinterfragt: z.B. die Leistungsbeurteilung, Aufsteigen und Wiederholen, Unterrichtsgestaltung und einheitliche Lehrpläne in einer Klasse.
Die Schulbehörde reagierte auf die inzwischen breit gewordene Integrationsbewegung nur zögernd. Trotzdem war die Geschichte der österreichischen Integrationsbewegung sehr bewegt. Die wichtigsten Ereignisse sind nun in den folgenden Kapiteln aufgelistet (aus Anlanger 1993, ab S.19).
2.4.1 Die braven 70er Jahre
Der Initiator und Förderer war Karl Köppel (1982), dessen Engagement für die Integrationsbewegung erst sein Tod 1991 beendete. Es gab bereits ausgearbeitete Schulversuche vom Unterrichtsministerium: unter anderem die „Integrierte Grundschule“ oder die „differenzierte Sonderschule mit Förderstunden für lernbehinderte Schüler/innen“.
In dieser Periode wurde auch das Beratungslehrer- und Beratungslehrerinnensystem für verhaltensauffällige Kinder geschaffen. Das bedeutete einen Entwicklungsschritt zur Integration und konnte sich bis heute bewähren, obwohl die Kinder auch teilweise in „Förderklassen“ endeten.
1974 startete der Schulversuch „Integrierte Grundschule“ auf der Basis des Artikels III der 5. SchOG- Novelle. Dieser Schulversuch ging von der Schulverwaltung bzw. Schulpolitik aus. Mit der Durchführung wurden das Schulversuchszentrum Klagenfurt und die dortige
Universität für Bildungswissenschaften betraut. Aus dem Schulversuchsplan ging
hervor, dass nie daran gedacht war, geistig behinderte Kinder zu integrieren. Dieses
Versuchsmodell wurde letztlich von den Grundschulen nicht angenommen. Der Schulversuch wurde nach seinem Auslaufen nicht mehr fortgeführt.
1976 erstellte OStR Walter Schindl in Zusammenarbeit mit Schulpsychologen und dem Jugendamt das Konzept Beratungslehrer/in und Förderklassen zur Integration erziehungsschwieriger Kinder. Förderklassen wurden eingerichtet, wenn für manche Kinder ambulante Betreuung durch Beratungslehrer nicht ausreichend war.
2.4.2 Die kämpferischen 80er Jahre
Die Initiative zur schulischen Integration ging in Österreich in den frühen 80er Jahren von der „Basis“ aus. Schlagworte sind vor allem das Projekt „Stützlehrer“ in Wien, das von Lehrer/innen ausgearbeitet wurde. Im Burgenland begann die Arbeit an einem Modell für eine Alternativschule, das sich zur Integrationsklasse entwickelte. Im Herbst 1984 entstand in Oberwart die erste Integrationsklasse Österreichs. Ein Jahr darauf folgten Weißenbach bei Reutte und Kalsdorf mit Integrationsklassen. Zusätzlich formierten sich Arbeitskreise und Initiativgruppen wie Integration Steiermark, ARGE Integration Wien,… die sich um politische Durchsetzung der Integrationsgesetze bemühten.
1985 und 1986 fanden die ersten Integrationssymposien der österreichischen Elterninitiativen in Bad Tatzmannsdorf statt. Erst 1986 reagierte der Staat Österreich. Es kam zu einer Entschließung des Bundesrates, in der die Bundesregierung aufgefordert wurde, integrative Schulversuche zu ermöglichen.1987 begann die Arbeit des ministeriellen Arbeitskreises „Behinderte Kinder im Regelschulwesen“. Es gab eine Koalitionsvereinbarung über die Ausweitung der integrativen Schulversuche und die Übernahme ins Regelschulwesen. Im Juni 1987 wurde die 11. Novelle der Schulgesetze beschlossen, in der die Schulversuche auf 10 Prozent der Sonderschulklassen erweitert wurden.
Im gleichen Jahr erschien der ministerielle Rahmenplan der Schulversuche (1989 Gruber/Petri zit. n. Rutte/Schönewiese, 1998, S.205).
Er unterschied
- eine Integrationsklasse mit Zusammenarbeit von Volks – und Sonderschullehrer/innen und grundsätzlich allem Unterricht gemeinsam,
- eine Kooperationsklasse mit grundsätzlicher Trennung in „Fächern mit stärkeren kognitiven Komponenten und im Bereich der spezifischen sonderpädagogischen Förderung“,
- eine Förderklasse, das Modell eines Sonderschulinspektors, nur für lernbehinderte Schüler/innen, ohne Einbeziehung nichtbehinderter Kinder und
- eine Stützlehrerklasse, in der ein(e) Sonderschullehrer/in stundenweise unterrichtet sowie Klassenlehrer/in und Eltern berät.
1981 wurde von der UNO zum Jahr der Behinderten deklariert und damit wurden auch verstärkt Bildungsfragen benachteiligter Kinder diskutiert. In anderen Ländern setzte man sich schon mit Integrationsbestrebungen auseinander, z.B.: Italien. Dort wurde schon 1976 das Integrationsgesetz verabschiedet, wodurch die Sonderschulen abgeschafft wurden, und im Frühjahr 1977 wurde die Notenbeurteilung für die Pflichtschule (1.- 8. Klasse) per Gesetz abgeschafft.
1982 entwickelten die Sonderschullehrerin Brigitte Leimstättner, die Schulpsychologin Dr. Gertraud Schleichert und Mitarbeiter/innen einen ersten Entwurf für eine Integrationsklasse in Österreich (Herbst 1984 fertig gestellt). Das Konzept schränkte verschiedene Behinderungsarten ein oder sah sie sogar als nicht integrationsfähig an. Die erste Projektbeschreibung wurde an der Sonderschule Stegersbach/Burgenland im Mai 1982 eingereicht und dem Sonderschulinspektor weitergeleitet, der erklärte, dass die praktische Umsetzung dieses Konzeptes nicht möglich sei. Im Schuljahr 1982/83 wurde das im Jahr 1981 entwickelte Konzept des „Stützlehrers“ (Inge Frühwirt, Sonja Tuschel, Eduard Fuchs und Wilhelm Willner) in die Praxis umgesetzt. Dieses Modell bewährte sich und wurde erweitert.
Im Jänner 1984 entstanden Grundlinien für einen Schulversuch „Sozialintegrative Schule“ in der Steiermark: „Wir erachten die soziale Integration als ein Recht Behinderter und vorrangig gegenüber schulischen und therapeutischen Maßnahmen, sofern der Behinderte bzw. dessen Interessenvertretung dies will.“ (Initiative Soziale Integration)
Im Herbst 1984 erreichten Eltern einen Schulversuch im Burgenland. Durch aktive
Öffentlichkeitsarbeit der Elterngruppe in Oberwart/Burgenland wurde der vorläufige Beginn der Integrationsklasse für September 1984 erreicht, anfangs ohne gesetzliche Genehmigung und gegen großen Widerstand der Schulbehörde. Im Oberwarter Schulversuch waren 14 Kinder, vier davon behindert: ein Muskelschwundkind, eine mehrfach behinderte Spastikerin, ein geistig behindertes und ein schwer sprachgestörtes Kind. Im Juni 1985 wurde die Integrationsklasse rückwirkend als Vorversuch bewilligt.
Im Februar 1985 fand in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) das 1. Integrationssymposium des Verein BUNGIS (Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam in Schulen) statt.
Im Herbst 1985 entstanden die erste Integrationsklasse in Kalsdorf/Steiermark und der erste Integrationsversuch in Tirol.
1986 entschloss sich der Bundesrat, integrative Schulversuche zu ermöglichen . Im Mai 1986 kam es zu dem Grundsatzerlass „Körperbehinderte oder sinnesbehinderte Kinder im Schulwesen Österreichs“. In diesem Erlass wurden integrierte behinderte Kinder nicht nur geduldet, sondern ihre Aufnahme in die Regelschule erstmals auch befürwortet. In Wien wurde das Konzept zur „Schule ohne Aussonderung“ entwickelt.
1988 eröffnete die erste Integrationsberatungsstelle im Wiener Stadtschulrat: Diese sollte eine Koordinationsstelle für die Kooperation aller Beteiligten sein.
Im Februar 1989 machte der Wiener Stadtschulrat erstmals alle Eltern, deren Kinder im Schuljahr 1989/90 schulpflichtig waren, schriftlich darauf aufmerksam, dass es die Möglichkeit gäbe, Kinder in Integrationsklassen zu unterrichten.
2.4.3 Die grundlegenden 90er Jahre
1992 erfolgte die Erklärung von Unterrichtsminister Dr. Rudolf Scholten am 11. Juni, die Sternfahrt nach Wien, 1993 Gründung des Dachverbandes „Integration : Österreich“, Evaluation durch das Schulversuchszentrum in Graz und schließlich legte die
15. Schulgesetzesnovelle die Grundlage für die Integration in Volksschulen.
1990 wurde nach dem Beschluss der steirischen Landesregierung das Zentrum für integrative Betreuung (ZIB)/ Steiermark gegründet. Zu seinen Aufgaben gehören: die Betreuung der sozialintegrativen Schulversuche in der Steiermark, die Organisation der Integrationslehrerfortbildung im Rahmen des Pädagogischen Institutes, die Beratung von Lehrer/innen, Eltern und Behörden hinsichtlich Organisation und Pädagogik sozialintegrativer Schulversuche, Entwicklungsarbeit zu den Bereichen Didaktik, Materialbörse, Dokumentation, Evaluation. Im Schuljahr 1990/91 gibt es 133 integrative Klassen, 21 Kooperative Klassen und 30 Förder- (Klein-) Klassen. Es werden somit ca. 3300 behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet. Ca. 2500 Kinder werden durch einen „Stützlehrer“ betreut (ohne Wien).
1992 wurden am Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung Evaluationen der Schulversuche von Dr. Specht durchgeführt. Sowohl global, als auch hinsichtlich Lernfreude und Motivation, Förderung der behinderten Kinder, Förderung der begabten Kinder, Kontakten zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, positivem Gruppenklima, Belastung und Befriedigung der Lehrer und Lehrerinnen waren Integrations- und Stützlehrer/innenklassen am erfolgreichsten.
Juni 1992: Grundsatzerklärung von Unterrichtsminister Dr. Rudolf Scholten:
„Österreich bekennt sich zur „vollen Teilnahme“ und Integration behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben entsprechend der Zielsetzung der von der UN erklärten Dekade behinderter Menschen. Dazu gehört auch das Recht auf volle Teilnahme am schulischen Leben. Während in der Vergangenheit dieses Recht auf Teilnahme am schulischen Leben in Form der Schulpflichterfüllung in der Sonderschule seitens des Staates wahrgenommen wurde, verlangen seit Beginn der 80er Jahre Eltern, sowie auch Lehrer/innen und andere Advokat/innen behinderter Menschen, die Verwirklichung dieser „vollen Teilnahme“ im Rahmen eines Schulunterrichts, der nicht vom Unterricht anderer nichtbehinderter Kinder getrennt ist.“ [5]
Im September 1992 formulierten Elterninitiativen einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf. Sie formulierten 11 Kernpunkte zur Übernahme des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen in das Regelschulsystem. Diese beinhalteten Punkte wie: Freies Wahlrecht der Eltern (SchulpflichtG § 8 Abs. 1 bis 3), Klassenschülerzahlen, zweiter Klassenlehrer, Unterrichtsorganisation und Unterrichtsmethoden, Leistungsbeurteilungen, Integrationskonferenz, Schulpädagogische Zentren, Übergangsbestimmungen zur Sekundarstufe, Abschaffung der Schulunfähigkeit, Durchführungserlässe,….
Ein wichtiger Schritt dazu war, zum Beispiel, die im Oktober 1992 von den Elterninitiativen organisierte Sternfahrt nach Wien. Ungefähr 2500 Teilnehmer/innen marschierten und rollten über die breite Ringstrasse zum Ballhausplatz, um auf die bevorstehende gesetzliche Regelung für den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder positiv einzuwirken. Die Parole lautete: Gesetz statt Gnade!
1993 wurde mit der 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle die Grundlage für die Integration in der Volksschule gelegt. „Die Volksschule hat in den ersten vier Schulstufen (Grundschule) eine für alle Schüler gemeinsame Elementarbildung unter Berücksichtigung einer sozialen Integration behinderter Kinder zu vermitteln.“ (SchOG §9, Abs.2) Es war zweifellos ein Meilenstein und seine Bedeutung darf nicht gemindert werden. Die Eltern behinderter Kinder haben nun die Wahl zwischen Integration in die Regelschule oder Sonderschule, soweit geeignete Schulen vorhanden sind und der Schulweg zumutbar ist.
Im Oktober 1993 schlossen sich die einzelnen Initiativgruppen zu „Integration : Österreich“ zusammen. Das ist eine Elterninitiative für gemeinsames Leben behinderter und nichtbehinderter Menschen.
Am 14. Juli 1994 fasste der Nationalrat folgende Entschließung (Auszug):
„Im Bereich der Behindertenintegration sind alle geeigneten Maßnahmen- einschließlich der Vorbereitungen allfälliger Gesetzesvorschläge – zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die vollständige Integration und individuelle Entfaltung geistig und körperlich behinderter Kinder und Jugendlicher in allen Lebensbereichen gewährleistet ist. Weiters ist darauf hinzuwirken, dass diese Maßnahmen auch im selbständigen Wirkungsbereich der Länder realisiert werden.“
1996 Schulgesetzpaket: Auf Grund der Schulversuchsergebnisse in den Hauptschulen und in der Unterstufe der Allgemeinbildenden Höheren Schulen kam es zu einer neuerlichen Änderung des SchOG und des Schulpflichtsgesetzes 1985 – die Fortsetzung des gemeinsamen Unterrichtes behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulwesen in der 5. bis 8. Schulstufe. 1996 wurde nach einer Regierungsumbildung mit Ressortwechsel die 17. Schulgesetznovelle mit Bestimmungen für die Sekundarstufe I verabschiedet. Mit ihr wurde Integration für den gesamten Bereich der Pflichtschule ermöglicht – aber nicht gefördert.
2.4.4 Die beschwerliche Gegenwart
In Österreich hat sich in relativ kurzer Zeit eine sehr positive Veränderung vollzogen und die Gesetzgebung steckt einen Rahmen ab, in dem ein Entwicklungsprozess erfolgen wird. Es sind Tatsachen geschaffen worden.
Insgesamt entwickelte sich die Integration quantitativ relativ schnell und zum Ende der 90er Jahre war schon fast die Hälfte aller Pflichtschüler/innen mit SpF (Sonderpädagogischer Förderbedarf) integriert. Im Bundesland Steiermark sind beispielsweise im Schuljahr 2000/2001 auf der Grundstufe 86 Prozent der Schülerinnen mit SpF integriert, auf der Sekundarstufe 70 Prozent.
Aber es ist auch eine kritische Betrachtung der Integration in Österreich notwendig. Die Schulgesetze sind ein Appell, aber kein Garant für Qualität. Das Unterrichtsministerium will sowohl Sonderschule, als auch Integration. Man könnte von einem Schutz der Sonderschulen und traditioneller Sonderpädagogik sprechen, die sich leider noch in folgenden Begriffen widerspiegeln: sonder pädagogischer Förderbedarf und nicht besonderer Förderbedarf (special needs,…), Sonder pädagogische Zentren an Sonder schulen und nicht Förderzentren an Regelschulen (vgl. Rutte/Schönwiese, 1998, S. 213).
Ein weiterer Punkt ist, dass die Eltern zwar ein Recht auf Integration haben, aber die Ausbildung der Lehrer/innen dazu ist nicht verpflichtend.
Schulische Integration bzw. eine Pädagogik für heterogene Gruppen ist dennoch eine international angestrebte Schulreform und „in demokratischen Gesellschaften Aufgabe“ (Muth, zit. n. Rutte/Schönwiese, 1998, S. 213).
Sie wurde in Österreich im Wesentlichen auf Grund der Initiativen betroffener Eltern behinderter Kinder, Lehrer/innen und der Medien erreicht. Erst als sich mit erhöhtem Bewusstsein für Menschenrechtsfragen das Augenmerk der Öffentlichkeit auf behinderte Staatsbürger richtete, konnten sich diese gegen eine Tradition von Fremdbestimmung gewisse staatsbürgerliche Rechte erkämpfen. 15 Jahre nach dem beschriebenen, mühsamen Beginn und nach einer ungeahnten Ausweitung ist die Zahl der in Österreich an Regelschulen integrierten Kinder vergleichsweise nicht gering. Integration wird als Menschenrecht nicht abgelehnt, politisch gibt es über alle Parteien hinweg positive Lippenbekenntnisse. In dem Maß, in dem sie Schulreform bedeutet, findet sie Widerstand. Das Beispiel anderer Länder, wie Skandinavien oder USA, zeigt aber, dass Integration zwar für die Schule beschwerlich ist, da sie ein individuelles Vorgehen nötig macht, aber außer Frage steht (Rutte/Schönwiese, 1998, S.213/214).
2.5 Gesetzliche Bestimmungen für die Volksschule
Das Gesetz garantiert das Recht auf Integration, sofern sie mit den Mitteln der Schulverwaltung ermöglicht werden kann. Der Beweis der absoluten Unmöglichkeit die nötigen Rahmenbedingungen trotz Einsatzes aller Mittel des Bezirks- und Landesschulrates herzustellen, wird der Schulbehörde kaum je gelingen.
Allerdings werden Eltern sehr häufig über ihre Rechte nicht, unzureichend oder falsch informiert. Das Recht auf Integration in nächst gelegenen Schule besteht nicht. Daher muss ein „zumutbarer Schulweg“ in Kauf genommen werden.
Seit 1993 gehört die soziale Integration behinderter Kinder zu den Aufgaben der österreichischen Schule. Die seinerzeit nur für die Volksschule verankerte Verpflichtung wurde nun auch auf die Hauptschule und AHS ausgedehnt. Die gesetzlichen Regelungen sind für Lehrer/innen und Direktor/innen bindend. Integration ist nicht nach ihrer Willkür oder ihrer persönlichen pädagogischen Überzeugung durchzugreifen: Sie ist zu verwirklichen!
Der Weg der Integration hat für Eltern behinderter Kinder folgenden Ablauf:
- Vorinformation des Bezirks- bzw. Landesschulinspektors, um diesem/r die nötigen Vorarbeiten zu erleichtern
- Schuleinschreibung
- Das Gesetz garantiert ein Recht auf Integration, sofern sie mit den Mitteln der Schulverwaltung ermöglicht werden können. Der Beweis der absoluten Unmöglichkeit die nötigen Rahmenbedingungen trotz Einsatzes aller Mittel des Bezirks- bzw. Landesschulrates herzustellen, wird der Schulbehörde kaum je gelingen können.
2.5.1 Integration oder Sonderschule? Die Wahlmöglichkeit der Eltern
Durch die Novelle zum Schulpflichtsgesetz trat an die Stelle der Feststellung der Sonderschulbedürftigkeit, mit der die Aufnahme in eine Sonderschule verbunden war, nun die „Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (SpF)“.
Als Grund für eine entsprechende Entscheidung ist nach wie vor festgesetzt, dass das Kind „infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder im Polytechnischen Lehrgang ohne sonderpädagogischen Förderbedarf nicht zu folgen vermag“.
Bei der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs handelt es sich aus rechtlicher Sicht noch nicht um die Feststellung bestimmter Maßnahmen für das betreffende Kind, sondern um die allgemeine Feststellung, dass für das Kind sonderpädagogische Unterstützung erforderlich ist.
Die sonderpädagogischen Gutachten im Rahmen des Feststellungsverfahrens sind entscheidend, ob zusätzliche Stunden für sonderpädagogische Maßnahmen für Schüler/innen mit SpF genehmigt werden bzw. ob sie in integrativer Form oder an einer Sonderschule unterrichtet werden. Im Rahmen des Verfahrens sollen auch die Bedingungen für eine Integration und deren Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um für die Eltern eine realistische Wahlmöglichkeit, bezüglich der Beschulung ihres Kindes zu gewährleisten. Die Feststellung des SpF setzt eine sorgfältige diagnostische Analyse voraus. Bei der so genannten „Förderdiagnostik“ handelt es sich um eine Form der Diagnostik, die nicht nur die Messung weitgehend unveränderbarer Persönlichkeitsmerkmale zum Ziel hat, sondern vor allem Verhalten und Lernen im sozialen und situativen Kontext zu erfassen versucht, um daraus individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten (Ansperger/Wetzel, 1999, S. 74).
Laut § 8 Schulpflichtsgesetz (1) hat der Bezirksschulrat, in dessen Bereich das Kind seinen Wohnsitz hat, auf Antrag der Eltern den sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen. Er hat ein sonderpädagogisches Gutachten und erforderlichenfalls ein schul- oder amtsärztliches und nach Einwilligung der Eltern ein schulpsychologisches Gutachten einzuholen. Die im Verfahren einzuholenden Gutachten müssen jedenfalls aus dem Befund (festgestellten Tatsachen) und dem Gutachten im engeren Sinn (die aus den festgestellten Tatsachen gezogenen konkreten Schlussfolgerungen) bestehen. Wichtig ist es auch, im Verfahren, „eigene“ Gutachten vorzulegen – das können durchaus das Wissen und die Erfahrung der Eltern selbst sein. Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs erfolgt durch einen Bescheid. Dieser muss neben der ausdrücklichen Bezeichnung als Bescheid und dem Spruch eine übersichtliche und verständlich formulierte Begründung und eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. Sobald für ein Kind der sonderpädagogische Förderbedarf rechtskräftig festgestellt ist, sind konkrete Fördermaßnahmen ehestens einzuleiten.
Die bedeutende Neuerung der Novelle besteht darin, dass den Eltern die Wahlmöglichkeit zwischen der traditionellen Sonderschulerziehung und der Aufnahme in eine „den sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllende Volksschule, Hauptschule oder Unterstufe einer Allgemeinbildenden Höheren Schule“ gestattet wurde, wobei jeweils die Zumutbarkeit des Schulweges vorausgesetzt ist.
Anstelle der absoluten Sonderschulpflicht tritt nun für die ersten Jahre der Schulpflicht eine Berechtigung zum Besuch einer geeigneten Sonderschule (Sonderschulklasse) oder einer geeigneten Volksschule. Die Sonderschule wird dadurch zu einer Angebotsschule für physisch oder psychisch behinderte Kinder, deren Konzept für die Eltern eine attraktive Alternative und ein sonderpädagogisch ausgefeiltes Angebot sein muss. Als zweite Möglichkeit wurde nun der Besuch einer den sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllenden Volksschule vorgesehen. Somit wird es sich im Regelfall nicht um eine Volksschule in bisheriger Form handeln, sondern ist jeweils für ein bestimmtes Kind zu prüfen, ob das höherwertige Ziel einer dem Stand der pädagogischen Wissenschaften entsprechenden bestmöglichen Erziehung eines behinderten Kindes erreicht werden kann.“ (BMUK- Erlass). Diese Bemerkungen gelten ab dem Schuljahr 1997/98 sinngemäß auch für die Hauptschule sowie für die Unterstufe der Allgemeinbildenden höheren Schulen (Behördenfibel II, 1998, S. 15).
§ 8a Abs. 2 des Schulplichtgesetzes legt ausdrücklich fest, dass der Bezirksschulrat anlässlich der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, sowie bei einem Übertritt in eine Sekundarschule die Eltern über die bestehenden Fördermöglichkeiten in Sonderschulen und allgemeinen Schulen und den zweckmäßigsten Schulbesuch zu beraten hat. Wünschen die Eltern die Aufnahme in eine Volksschule, Hauptschule oder Unterstufe einer Allgemeinbildenden höheren Schule, so hat der Bezirksschulrat zu informieren, an welcher nächstgelegenen allgemeinen Schule dem sonderpädagogischen Förderbedarf entsprochen werden kann.
„Voraussetzungen für eine Bildungswegentscheidung ist eine möglichst vollständige Übersicht über verschiedene Bildungsmöglichkeiten und ihre Vor- und Nachteile. Der Bezirksschulrat hat nach Vorlage der Gutachten und allfälligen ergänzenden mündlichen Verhandlungen einen Überblick über die bestehenden bzw. herstellbaren Möglichkeiten. Somit wird der Bezirksschulrat Vorschläge über den jeweils zweckmäßigsten Schulbesuch und die dem Wohnort des Kindes nächstgelegene geeignete Volksschule unterbreiten, wodurch dem Prinzip des wohnortnahen Schulbesuches Rechnung getragen werden kann.“ (BMUK- Erlass) (vgl. Behördenfibel II, 1998, S.16).
Bestehen aber keine entsprechenden Fördermöglichkeiten an einer allgemeinen Schule, welche das Kind bei einem ihm zumutbaren Schulweg erreichen kann, so hat gemäß § 8a
Abs. 3 des Schulpflichtsgesetzes der Bezirksschulrat unter Bedachtnahme auf die Gegebenheiten im Rahmen seiner Zuständigkeiten, Maßnahmen zur Ermöglichung des Besuches der gewünschten Schulart zu ergreifen. Soweit andere Stellen (Landesschulrat, Schulerhalter) zuständig sind, hat der Bezirksschulrat bei diesen, die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen zu beantragen. Dies bedeutet bei einem von den Eltern gewünschten Besuch einer Allgemeinbildenden Höheren Schule, dass der Bezirksschulrat zum ehest möglichen Zeitpunkt, Beratungen mit der in Betracht kommenden Allgemeinbildenden Höheren Schule aufzunehmen und gleichzeitig auch den Landesschulrat als zuständige Schulbehörde zu verständigen haben wird. Sodann wird es Aufgabe des Landesschulrates sein, seinerseits entsprechende Bemühungen zur Ermöglichung des gewünschten Schulbesuches zu unternehmen (Behördenfibel II, 1998, S.16).
„Gerade in der Einführungsphase der neuen Regelungen wird noch nicht an allen Volksschulstandorten eine entsprechende Fördermöglichkeit unter Bedachtnahme auf die unterschiedlichen Behinderungsarten bestehen. In diesem Zusammenhang ist es Aufgabe der Schulbehörden, konstruktiv dazu beizutragen, die Sprengelvolksschule oder die am Wohnort des Kindes nächstgelegene Volksschule materiell und personell so auszustatten, dass diese Volksschule den sonderpädagogischen Förderbedarf eines Kindes erfüllen kann“ (BMUK- Erlass). Dies gilt nun sinngemäß auch für den Bereich der Sekundarschulen (5. bis 8. Schulstufe).
Soll das Kind eine den sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllende Volksschule oder Hauptschule außerhalb des eigenen Schulsprengels als Gastschüler besuchen, weil an der allgemeinen Schule des eigenen Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise erfolgen kann, so ist eine Zustimmung des Schulerhalters zur Aufnahme als Gastschüler nicht erforderlich.
Trotz aller Bemühungen des Bezirksschulrates kann es in Einzelfällen vorkommen, dass dem Wunsch der Eltern auf integrative Förderung des Kindes in der allgemeinen Schule bzw. in den auslaufenden Schulversuchen gemäß § 131 a SchOG nicht Rechnung getragen werden kann. Für diese Fälle trifft § 8b des Schulpflichtsgesetzes die aushilfsmäßige Regelung, dass diese Kinder eine ihrer Eigenart und Schulfähigkeit entsprechende Sonderschule oder Sonderschulklasse zu besuchen haben, soweit solche Schulen (Klassen) vorhanden sind und der Schulweg den Kindern zumutbar ist. Diese Verpflichtung geht unmittelbar aus dem Gesetz hervor und es ist in der Regel kein Bescheid zu erlassen.
Es ist also grundsätzlich nach Möglichkeit mit den Eltern ein Einvernehmen über den zweckmäßigsten Schulbesuch herzustellen. Die letztendlich getroffene Regelung des Schulbesuches ist jedenfalls beim Bezirksschulrat aktenkundig zu machen. Empfohlen wird eine nachweisliche schriftliche Information der Eltern und der betroffenen Schule.
Ein Feststellungsbescheid, welche Schule das Kind zu besuchen hat, wäre nur bei Vorliegen eines entsprechenden öffentlichen oder privaten Interesses (Verlangen der Eltern) an dieser Feststellung zulässig. Dies könnte in jenen oben erwähnten Ausnahmefällen auftreten, in welchen das Kind entgegen dem Wunsch der Eltern in eine Sonderschule aufgenommen werden muss, die Eltern aber die Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht einsehen wollen. Ein derartiger Feststellungsbescheid, gegen den die Eltern eine Berufungsmöglichkeit haben, soll auch dem Rechtsschutz dienen und müsste in der Begründung eine eingehende Darlegung enthalten, weshalb keine Möglichkeit zur Aufnahme in eine Integrationsklasse (Regelschulwesen bzw. Schulversuch) besteht (Behördenfibel II, 1998, S.17/18).
Zusammenfassend ist es wichtig, den Eltern eine umfassende Beratung zu geben, Hilfestellungen leisten im Hinblick auf die Zurücklegung des Schulweges (Schüler/innenbeförderung), Beratung betreffend allfälliger therapeutischer Maßnahmen, Hinweise wegen sonstiger Unterstützungen. Eben so wichtig ist, die rechtzeitige und vorausschauende Planung der Errichtung von Integrationsklassen (organisatorische und personelle Vorkehrungen). In diesem Zusammenhang können zum Beispiel bauliche Maßnahmen zur behindertengerechten Ausstattung der Schule beim Schulerhalter beantragt werden.
2.5.2 Lehrplaneinstufung
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei der Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf um eine soziale Integration handelt. Es ist somit auch an den allgemeinen Schulen eine der Aufgaben der Sonderschule, entsprechende Bildung zu vermitteln, wobei entsprechend den Lernvoraussetzungen des Schülers/der Schülerin die Unterrichtsziele der betreffenden allgemeinen Schule anzustreben sind (siehe § 9 Abs. 3 SchOG für die Volksschuloberstufe, § 15 Abs. 3 SchOG für die Hauptschule und § 34 Abs. 2 SchOG für die allgemein bildende höhere Schule).
In den ersten vier Schulstufen der Volksschule (Grundschule) ist überhaupt eine für alle Schüler gemeinsame Elementarbildung unter der Berücksichtigung einer sozialen Integration behinderter Kinder zu vermitteln; für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind die Bildungsaufgaben, der der Behinderung entsprechenden Sonderschulart zu berücksichtigen. Die Lehrpläne der Volksschule, der Hauptschule bzw. der Allgemeinbildenden Höheren Schule finden insofern Anwendung, als erwartet werden kann, dass ohne Überforderung die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird; im Übrigen findet der der Behinderung entsprechende Lehrplan der Sonderschule Anwendung ( siehe § 10 Abs. 4, § 16 abs. 5 und § 39 abs. 3 SchOG).
Gemäß § 17 Abs. 4 lit. a SchUG hat der Bezirksschulrat für Kinder, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, unter Bedachtnahme auf diese Feststellung zu entscheiden, ob und in welchem Ausmaß der Schüler nach dem Lehrplan einer anderen Schulart zu unterrichten ist. Hierbei ist anzustreben, dass der Schüler die für ihn bestmögliche Förderung erhält. Die Zuständigkeit zur Lehrplanfestsetzung kommt dann auch dem Bezirksschulrat zu, wenn das Kind die Allgemeinbildende Höhere Schule besucht.
Die zitierte Gesetzesstelle „ob und in welchem Ausmaß“ lässt grundsätzlich die Auslegung zu, dass für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die im Rahmen der Integration eine allgemeine Schule besuchen, nicht in jedem Fall unbedingt der Sonderschullehrplan zur Anwendung kommen muss. Im Regelfalle werden jedoch zur entsprechenden Förderung des Kindes zumindest teilweise, die entsprechenden Sonderschul-Lehrplanbestimmungen anzuwenden sein (BMKU – Erlass) (Behördenfibel II, 1998, S.19).
Bei der zu treffenden Entscheidung wird darauf zu achten sein, dass die Entscheidung rechtzeitig vor Ende des Unterrichtsjahres erfolgt, dass eine entsprechend verlässliche Jahresbeurteilung auf Grund des festgelegten Lehrplanes erfolgen kann. Im Zweifel sollte jedenfalls eine längere Beobachtungszeit vor der Lehrplaneinstufung vorgesehen werden; demgegenüber kann es Fälle geben, in denen Behinderungsart und –grad von vornherein so klar ersichtlich und unbestritten sind, dass die Festlegung des Lehrplanes zugleich mit der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes erfolgen kann. Voraussetzung für die Lehrplanbestimmung ist aber in jedem Fall, dass bereits feststeht, welche Schule das Kind besuchen wird.
Wenn das Kind die allgemeine Schule (Integrationsklasse) besucht, ist im Bescheid nur anzugeben, in welchen Gegenständen der/die Schüler/in nach dem Lehrplan einer anderen Schulart (zum Beispiel Allgemeine Sonderschule) zu unterrichten ist. In den im Bescheid nicht genannten Gegenständen ist der Schüler/die Schülerin nach dem Lehrplan der besuchten allgemeinen Schule zu unterrichten. Der Bescheid gilt somit immer nur für die Zeit des Besuches der betreffenden Schulart (z.B. Volksschule). Nach einem Schulwechsel (z.B. Aufnahme in eine Sekundarschule) wird der auf die bisher besuchte Schulart bezogene Bescheid hinfällig und es ist eine neue Entscheidung zu treffen.
Die Schulkonferenz hat zu entscheiden, ob und in welchen Unterrichtsgegenständen der/die Schüler/in nach dem Lehrplan einer anderen Schulstufe, als der seinem/ihrem Alter entsprechenden, zu unterrichten ist (§ 17 Abs. 4 lit. b SchUG), wobei eine gegebenenfalls bereits durch den Bezirksschulrat erfolgte Lehrplanfestlegung zu beachten ist. Zum Zweck der bestmöglichen Förderung des Kindes ist eine Kooperation zwischen Bezirksschulrat und Klassenkonferenz anzustreben.
Es wird auch auf § 25 Abs. 5a SchUG hingewiesen, wonach Schüler/innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf an allgemeinen Schulen berechtigt sind, in die nächst höhere Schulstufe aufzusteigen, wenn dies für die Schüler/innen insgesamt eine bessere Entwicklungsmöglichkeit bietet; hierüber hat die Schulkonferenz gemäß § 20 Abs. 6 zu entscheiden (Behördenfibel II, 1998, S.20/21).
[...]
[1] http://homepages.compuserve.de/KlaussTheo/theor_ueberl_sb_proj.htm, abgerufen am 23.12.2003
[2] in Viktor Ledl/Heinz Gruber: Allgemeine Sonderpädagogik, Grundlagen des Unterrichts für Schüler mit Schulschwierigkeiten und Behinderungen, Verlag Jugend & Volk Ges.m.b.H, Wien 1992, S. 16/17
[3] Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten v. 4.11.1950, http://www.kfunigraz.ac.at/zivilrecht/skripten.htm, (Prof. Schilcher), abgerufen am 8.8. 2003
[4] <http://www2.uibk.ac.at/bidok/bib/schule/feuser-thesen.html>, abgerufen 14.09.2003
[5] in: Otto Anlanger: Behinderten Integration, Geschichte eines Erfolges, Dokumentation, Schulheft 70/1993, Jugend & Volk – Edition; Wien – München 1993, S. 181
- Arbeit zitieren
- Mag. Susanne Biermair (Autor:in), 2004, Schulische Integration schwerstbehinderter Kinder , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65528
Kostenlos Autor werden




















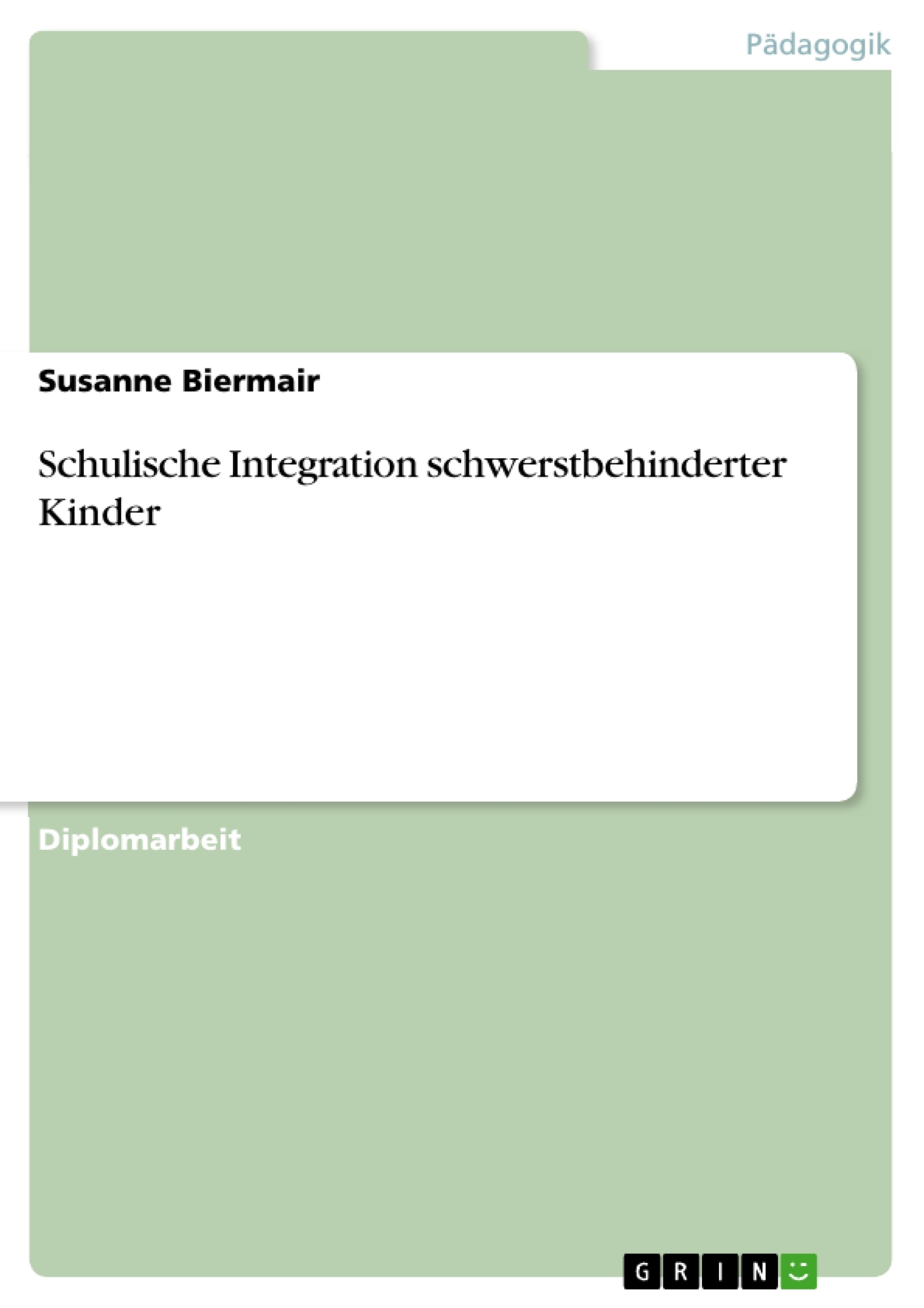

Kommentare