Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Brief als Zeugnis persönlicher Resignation
3. Der Brief als Voraussetzung politischer Aktion
3.1. Der Begriff „Fatalismus“ und seine Bedeutung
3.2. Der Fatalismus von Georg Büchner
3.3. Büchner und seine Arbeit am „Hessischen Landboten“
4. Der Einfluss des Fatalismusbriefes auf das Drama „Dantons Tod“
4.1. Das Studium der Geschichte: Büchners Vorarbeit zur Dramenkonzeption
4.2. Der „Fatalismusbrief“ als direkte Quelle
4.3. Der Fatalismus-Gedanke als charakterbildendes Element
5. Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Hier ist kein Berg, wo die Aussicht frei sei. Hügel hinter Hügel und breite Täler, eine hohle Mittelmäßigkeit in Allem; ich kann mich nicht an diese Natur gewöhnen, und die Stadt ist abscheulich.“[1] Als sich Georg Büchner im Jahre 1834 nach längerem Stillschweigen mit diesen Worten von Gießen aus an seine Verlobte Wilhelmine Jaeglé wendet, beginnt er damit einen Brief, dessen Interpretation die Forschung wie kaum ein anderer beschäftigen wird.
Schon die genaue zeitliche Einordnung des sogenannten „Fatalismusbriefs“ gestaltet sich schwierig, eine exakte Datumsbestimmung ist unmöglich, da Büchner selbst den Brief undatiert ließ. Sein Bruder Ludwig ordnet das Schriftstück nach dem Tod des Dichters in seinem Werk „Nachgelassene Schriften“ an erster Stelle der Reihe „Briefe an die Braut, aus Gießen, 1833 und 1834“ ein und die Herausgeber der späteren Sammelwerke folgen dieser Ordnung.[2] Die daraus resultierende Datierung bewegt sich um den Zeitraum des Frühjahrs 1834, gilt aber lange Zeit als sehr unsicher. Erst Max Zobel von Zabeltitz stellt diese Einordnung aber als erster so in Frage, dass er den Brief am Ende seiner Nachforschungen im Jahre 1915 mit folgendem Argument umdatieren kann: „Büchner war 1833 erst seit Herbst in Gießen [...]. Brief 1 könnte noch am ehsten 1833 geschrieben sein, wenn die Erwähnung von Frühling und Veilchen sich vielleicht nicht wörtlich nehmen lassen kann [...]“.[3] Ihm folgt sieben Jahre später Fritz Bergemann und Jan-Christoph Hauschild verschiebt das Datum nochmals um einige Monate in den Januar 1834. Den bis dahin geltenden inhaltlichen Widerspruch löst er folgendermaßen auf: „Halten wir fest: im Herbst und Winter 1833/34 schlug das Wetter Kapriolen. Der Satz ‚Bei uns ist Frühling, ich kann deinen Veilchenstrauß immer ersetzen‘ rückt den ‚Fatalismusbrief‘ also keineswegs ins Frühjahr 1834, genausogut könnte er Ende Oktober 1833 [...] im November oder Anfang Januar geschrieben sein.“[4] Als endgültigen Entstehungszeitraum legt Hauschild in seinem Aufsatz die Tage „zwischen dem 10. und 20. Januar 1834“ fest.[5]
Stützend für diese Datierung wirken auch die persönlichen Lebensumstände Büchners zu dieser Zeit. Den Dezember des Jahres 1833 verbringt er in seinem Elternhaus in Darmstadt um sich von einer schweren Krankheit zu erholen, doch ihn quält außer diesem physischen Leiden auch ein psychisches: Mit seinem Vater steht er in einem unausgesprochenen und deshalb unterdrückten Konflikt, das Studium der Medizin und vor allem die spätere Ausübung des Arztberufes sagen Georg Büchner nicht in dem Maße zu, wie der Vater es sich wohl für seinen Sohn wünscht.[6] Zurückgekehrt an seinen Studienort Gießen leidet Büchner dann zusätzlich unter der Trennung von seiner Verlobten und seinen Freunden in der „gute[n] Stadt Straßburg“ (GB). So spielt er im Fatalismusbrief wohl auf seine tatsächliche Krankheit und auf die vorhandenen seelischen Konflikte an, wenn er schreibt: „Ich glühte, das Fieber bedeckte mich mit Küssen und umschlang mich wie der Arm der Geliebten.“ (GB)
Zwischen den Beschreibungen seiner Umgebung, seiner persönlichen Situation und den Sehnsuchtsbekundungen an sein „Lieb Kind“ (GB) wirkt die Passage, deren Interpretation diese Arbeit gewidmet ist, sonderbar isoliert, obwohl sie fast die Hälfte des Briefes einnimmt. Unvermittelt beginnt der Autor sie mit den Worten: „Ich studirte die Geschichte der Revolution.“ (GB) um anschließend mit Hilfe einer Vielzahl von Metaphern seine Geschichtstheorie zu entwickeln, die er aus diesen Studien gewonnen zu haben scheint.[7] Vor allem ein Satz bringt diese Theorie auf den Punkt: „Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte.“ (GB) Am Ende dieser Beschreibungen scheint er sich selbst bewusst von diesen negativen Überlegungen entfernen zu wollen und schließt den Exkurs mit: „Ich mag dem Gedanken nicht weiter nachgehen. Könnte ich aber dies kalte und gemarterte Herz an Deine Brust legen!“ (GB)
Hauptsächlich der Gebrauch des Ausdrucks „Fatalismus“ gibt der Büchner-Forschung im vergangenen Jahrhundert Anlass zu kontroversen Interpretationsansätzen. Zum einen gilt die genannte Briefpassage als Zeugnis einer „entscheidende[n] Wende im Denken“[8], d.h. dem politischen Denken Georg Büchners. Es heißt, der Autor schwöre in diesem Brief seinen politischen Frühschriften ab, von denen er sich durch die Beschäftigung mit dem Verlauf der französischen Revolution bereits innerlich entfernt habe. Büchner sei zu der Überzeugung gelangt, dass jegliche revolutionären Anstrengungen von vornherein zum Scheitern verurteilt seien, da der Lauf der Geschichte nicht von Menschenhand beeinflusst werden könne.[9] Führt man diese Theorie weiter, stellt sich jedoch unweigerlich die Frage, in welchen Zusammenhang diese innere Resignation mit der darauf folgenden Zeit der politischen Aktion steht. Eine Zeit, in der Büchner bei der Entstehung und Verbreitung des „Hessischen Landboten“ mitarbeitet und im April oder Mai desselben Jahres die deutsche „Gesellschaft der Menschenrechte“ gründet.
Der zweite Interpretationsansatz gestaltet sich völlig gegenteilig zu dem bereits genannten. Er gründet sich zum Teil auf die Behauptung, die Bedeutung des Begriffs „Fatalismus“ sei zu Büchners Zeiten so, dass sie „überhaupt nur aus der Bedeutungstradition der Begriffe fatalité/fatalisme in Frankreich adäquat verstanden werden kann, während Auslegungsversuche mit den gegenläufigen Implikationen des deutschen Geistes die Forschung notwendig in die verschiedensten Sackgassen geführt haben.“[10] Büchner habe bei seinen Revolutionsstudien festgestellt, dass der herrschende Fatalismus nur dann „gräßlich“ sei, wenn man ihn durch die Augen der breiten Volksmasse betrachtet und begreift, dass die widrigen Lebensumstände der einfachen Arbeiter nicht durch revolutionäre Anstrengungen verbessert werden können.[11] Demnach liegt in dieser Feststellung und der ihr folgenden politischen Arbeit des Dichters auch kein Widerspruch.
Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich den beiden Interpretationsmöglichkeiten Raum geben und sie kritisch gegenüberstellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Begriff Fatalismus und seiner Bedeutung und der Tatsache, dass Büchner die Zeit nach der Entstehung des „Fatalismusbriefes“ zur aktiven poiltischen Mitarbeit nutzt. Darüberhinaus werde ich den direkten Einfluss des „Fatalismusbriefs“ auf Büchners Drama „Dantons Tod“ in Ansätzen untersuchen und die unmittelbar zu ziehenden Parallelen aufzeigen.
2. Der Brief als Zeugnis persönlicher Resignation
Werner L. Lehmann vertritt in seinem Aufsatz die Auffassung, dass der Dichter Georg Büchner während seiner Schaffenszeit eine entscheidende innere Veränderung durchlebt hat und dass der „Fatalismusbrief“ ein schriftliches Zeugnis davon ist. Der Ton, der in Büchners Frühschriften vorherrscht, ist geprägt von revolutionärem Bewusstsein, von der Unzufriedenheit mit den bestehenden politischen Verhältnissen, ist aggressiv und mitunter auch hetzerisch. Selbst zeitlich unmittelbar vor dem „Fatalismusbrief“, d.h. im Dezember 1833, schreibt Büchner an August Stoeber: „Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt geduldig den Karren, worauf die Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie spielen.“[12] Laut Lehmann glaubt Büchner zu dieser Zeit noch an die Verbesserung dieser Situation durch eine Revolution und verliert diesen Glauben durch die Beschäftigung mit den vergangenen Revolutionen von 1789 und 1830, bis er „seiner agitatorischen, idealistischen und pseudotheologischen Welt-, Geschichts-, und Menschendeutung nicht mehr affirmativ, sondern kritisch und feindlich gegenüber[steht].“[13] Die Worte, die Georg Büchner in seinem „Fatalismusbrief“ wählt, zeugen zwar weiterhin von einer politischen Unzufriedenheit, der Tonfall ist aber resigniert, als sei seine kämpferische Haltung unter dem Fatalismus der Geschichte regelrecht zusammengebrochen. Der Autor scheint nun sicher zu sein, dass ein Umsturz der Verhältnisse nicht durch eine Revolution herbeizuführen ist, diese Erkenntnis lähmt ihn und zerrüttet seinen Gerechtigkeitswillen. Passend zu dieser Ohnmacht, in der sich der Einzelne befindet und die ihn zu „Schaum auf der Welle“ (GB) reduziert, erscheint Büchner das Muß: „Das muß ist eins von den Verdammungsworten, womit der Mensch getauft worden.“ (GB) Lehmann bemerkt hierzu: „Die idealistische Einheit der Tathandlung zerfällt in Erkennen und Tun. Das Erkennen weist keinerlei Beziehung mehr auf zum Tun, das Tun trägt den Charakter des Müssens [...].“[14] Das Muß nimmt dem Einzelnen die Freiheit zum Handeln und die Handlungen, die er dennoch vollzieht, müssen sich dem Fatalismus der Geschichte ergeben.
Lehmann skizziert den damals 20-jährigen Georg Büchner als einen jungen Mann, der sein Weltbild und seine eigene Position darin vollkommen neu überdenken muss, der nicht nur desillusioniert ist, sondern dem plötzlich alles, woran er glaubte und wofür er kämpfte, falsch und unwirklich erscheint. Der unauflösbare Widerspruch einer Zeit, die eigentlich eine Revolution fordert, die jedoch gerade die Unmöglichkeit einer erfolgreichen Realisierung bewiesen hat, lässt den Dichter in einer depressiven Stimmung zurück, die düsteren Gedanken halten ihn gefangen und finden im „Fatalismusbrief“ ihren Ausdruck.[15] Auf dieser Basis muss die Arbeit am „Hessischen Landboten“ wie ein Akt wider besseres Wissens erscheinen, eine halbherzige Anstrengung, die sogar Züge der Selbstverleugnung trägt und „in dessen Verfolg der Ideologe in ihm [Büchner] überwunden und vernichtet wird“.[16]
[...]
[1] Büchner, Georg: Brief an Wilhelmine Jaeglé, Mitte/Ende Januar 1834. In: Georg Büchner. Schriften, Briefe, Dokumente. Hg. v. Henri Poschmann. Frankfurt: Dt. Klassiker Verlag, 1999 (Band 2). S. 377. Die folgenden wörtlichen Zitate aus dem Brief werden mit der Abkürzung (GB) gekennzeichnet.
[2] Vgl. Hauschild, Jan-Christoph: Neudatierung und Neubewertung von Georg Büchners „Fatalismusbrief“. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 108 (1989) Heft 4, S. 513f.
[3] Zobel von Zabeltitz, Max: Georg Büchner [,] sein Leben und sein Schaffen. In: Bonner Forschungen N. F. 8 (1915), S. 125f., Anm. 2.
[4] Hauschild (1989), S. 517.
[5] Hauschild (1989), S. 526.
[6] Vgl. Hauschild (1989), S. 517ff.
[7] Hauschild zur zeitlichen Einordnung dieser Studien: „Der Satz ‚Ich studirte die Geschichte der Revolution‘, mit dem Büchner sein bisheriges Schweigen begründete, ist demnach weniger auf die Gießener, als vielmehr auf die Darmstädter Zeit zu beziehen, auf die rund fünf im Elternhaus verbrachten Wochen etwa zwischen dem 28. November und 5. Januar.“ Hauschild (1989), S. 527.
[8] Lehmann, Werner L.: Prolegomena zu einer historisch-kritischen Büchner-Ausgabe. In: Gratulatio. Festschrift für Christian Wegner zum 70. Geburtstag am 9. September 1963. Hamburg: Christian Wegner Verlag, 1963, S. 210.
[9] Lehmann beschreibt diese Erkenntnis so: „Mit einem Schlage scheint Büchner die Unvernunft dieser revolutionären Vernunft, die sich daran macht, das lebendige Leben einem utopischen Traum zum Opfer zu bringen, durchschaut zu haben.“ Lehmann (1963), S. 210.
[10] Mayer, Thomas Michael: Büchner und Weidig – Frühkommunismus und revolutionäre Demokratie. In: Georg Büchner I/II. Sonderband der Reihe text+kritik. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. München: 1979. S. 86.
[11] Vgl. dazu Mayer (1979), S. 91.
[12] Büchner, Georg: Brief an August Stoeber, Darmstadt: d. 9. Dez. 33. In: Georg Büchner. Schriften, Briefe, Dokumente. Hg. v. Henri Poschmann. Frankfurt: Dt. Klassiker Verlag, 1999 (Band 2). S. 377.
[13] Lehmann (1963), S. 209.
[14] Lehmann (1963), S. 212.
[15] Gerhard Jancke bemerkt hierzu: „Man muß zunächst feststellen, daß die Auffassung von der Gleichförmigkeit aller Dinge, vom Puppenspiel und von der unrettbaren Schuld genuin melancholische Motive sind, und daß der ganze Umkreis dieses Briefes [...] eine tiefe melancholische Krise Büchners erkennen läßt.“ Jancke, Gerhard: Georg Büchner. Genese und Aktualität seines Werkes. Kronberg/Ts.: Scriptor Verlag, 1975. S. 130.
[16] Lehmann (1963), S. 210.
- Arbeit zitieren
- Jasmin Braun (Autor:in), 2005, Georg Büchners Fatalismusbrief - Zeugnis persönlicher Resignation oder Voraussetzung politischer Aktion?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65360
Kostenlos Autor werden







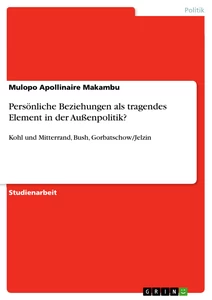


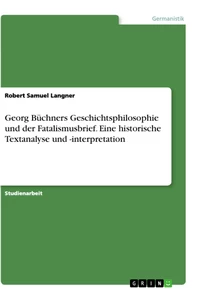







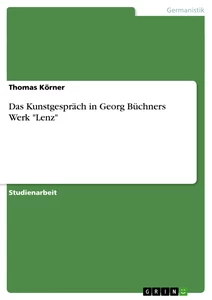

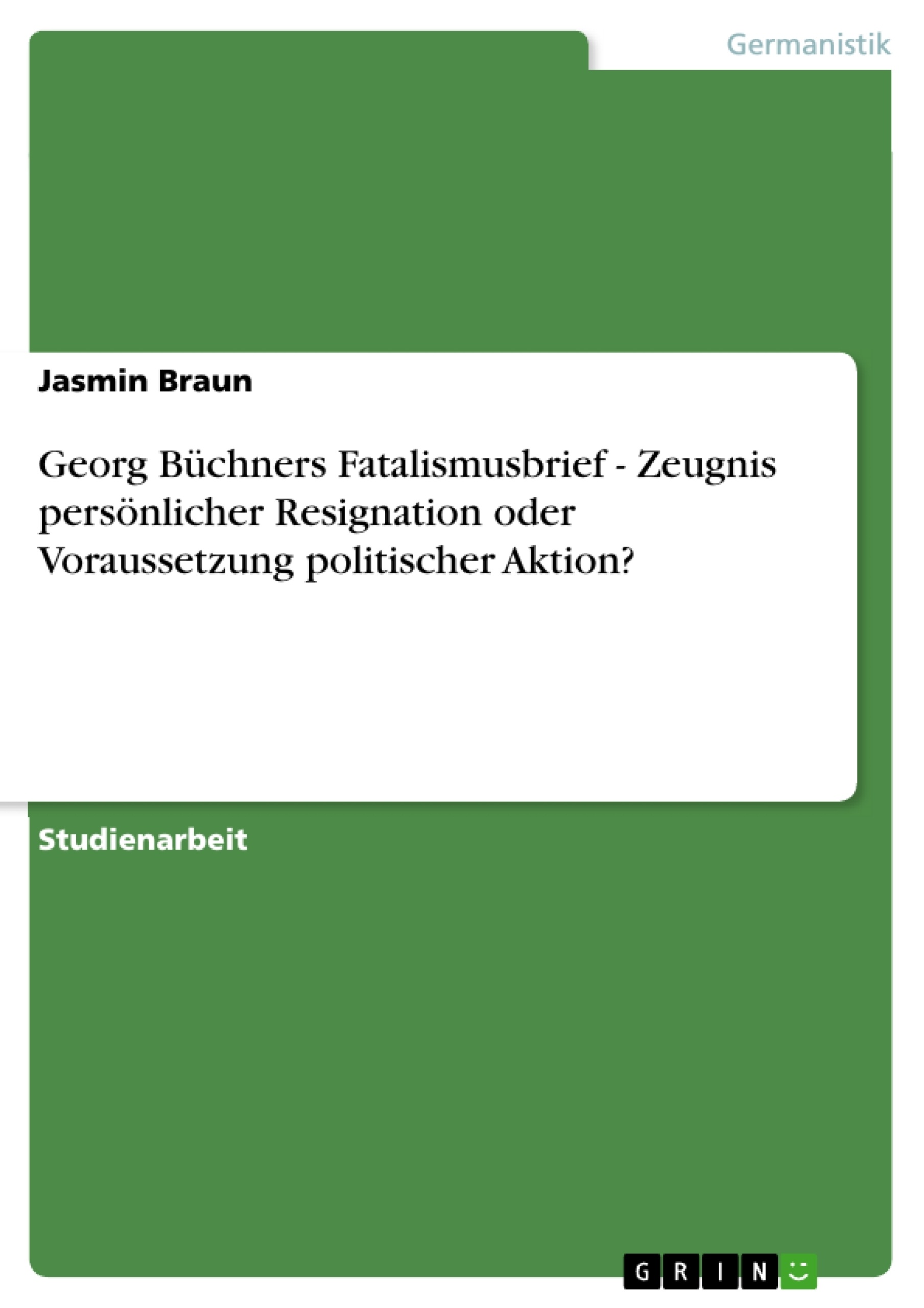

Kommentare