Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A Einführung
I. Fragestellung und Erkenntnisinteresse
II. Methodik und Quellenlage
III. Zentrale Definitionen
B Die Begriffe „Sicherheit“, „Rechtsstaat“ und „Bürgerrechte“ als Variablen vorherrschender gesellschaftlicher Paradigmen
I. Die Verwendung im „liberalen Paradigma“
II. Die Verwendung im „sozialen Paradigma“
III. Die zunehmende Überlagerung durch das „Paradigma der Risikogesellschaft“
IV. Die mangelnde Rezeption der Begriffsvarianz im sicherheitsrechtlichen Diskurs
C Ausgangspunkt: Der „klassische“ Bundesnachrichtendienst im liberalen Paradigma bis 1994
I. Der BND innerhalb der Sicherheitsarchitektur Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung des Trennungsgebotes
II. Formale und materielle Rechtsgrundlagen des BND
1.Verfassungsrechtliche Grundlagen: Legitimation und Gesetzgebungskompetenz
2.Gesetzliche Aufgabenbereiche des BND nach dem BND-Gesetz
3.Gesetzliche Befugnisse zum Eingriff in die Grundrechte nach Art. 10 GG (Gesetz G 10)
a) Zum Schutzbereich von Art. 10 GG
b) Das Gesetz G 10 in der Fassung von 1991
4. Die parlamentarische Kontrolle des BND
a) Die Parlamentarische Kontrollkommission
b) Das G 10-Gremium
c) Die G 10-Kommission
III. Die praktische Arbeitsweise des BND
IV. Die ersten Befugniserweiterungen
1. Erweiterung der Kontrollbefugnisse der Parlamentarischen
Kontrollkommission
2. Erweiterung der nachrichtendienstlichen Befugnisse bei
Individual – und strategischer Fernmeldekontrolle
3. Reaktion: BVerfGE 100,313 („III. Abhörentscheidung“)
vom 14.7.1999
a) Zulässigkeit des neuen Instrumentariums
b) Übermittlung an andere Behörden
c) Mitteilungspflicht
d) Der neue Befugniszuschnitt des BND und
der Risikogedanke
e) Eigene Bewertung der BVerfGE 100,313
D Exkurs: Die neue nachrichtendienstliche Herausforderung: Der islamistische Terrorismus und der Reflex der Risikogesellschaft
E Die Entwicklung des BND im Zuge der weiteren Ausbreitung des „Paradigmas der Risikogesellschaft“
I. Die Novellierung des G 10 vom 29.06.2001
1. Änderungen bezüglich der Individualmaßnahmen
2. Änderungen bezüglich der strategischen
Überwachungsmaßnahmen
3. Änderungen bezüglich der Übermittlungspflicht
4. Die strategische Überwachung bei einer im Einzelfall im
Ausland bestehenden Gefahr für Leib und Leben
5. Änderungen der Kontrollvorschriften für die
strategische Aufklärung
6. Änderungen bei den Benachrichtigungspflichten
7. Diskussion des novellierten G 10
II. Übernationale Einflüsse auf die weitere Gesetzgebung
III. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 09.01.2002
1. Die wesentlichen, für den BND relevanten Änderungen
2. Die herkömmlichen Argumentationen im Schrifttum
3. Diskussion der Geeignetheit, unter besonderer
Berücksichtigung von Risikosteuerungsbestrebungen
IV. Verstärkte informationelle Zusammenarbeit
V. Ausblick: „Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzentwurf“
VI. Zusammenfassung: Wesentliche Änderungen des
Befugniszuschnitts des BND von 1989 bis 2006
F Überlegungen zur künftigen Abwägung von Bürgerschutz und
Effizienzbedürfnis bei der sicherheitsbehördlichen Risikovorsorge
I. Rechtspolitische Lösungsansätze im Schrifttum
1. „Feindstrafrecht“
2. „Schnittmengentheorie“
II. Überlegungen zu einer modifizierten Abwägung unter
Einbezug aktueller höchstrichterlicher Entscheidungen
1. Bestimmtheitsgebot und Risikovorsorge
2. Verhältnismäßigkeit und Risikovorsorge
3. Kernbereichsschutz nach BVerfGE 109,279 und Risikovorsorge
4. Kurzbeispiel zu den bisherigen Überlegungen
III. Zusammenfassung
G Fazit, Ausblick und abschließende Bemerkungen
I. Fazit
II. Ausblick
III. Schlussbemerkungen
Anhang
I. Übermittlungen von personenbezogenen Daten, die außerhalb von Eingriffen in Art. 10 GG gewonnen wurden, zwischen BND und anderen Akteuren
II. Die Grundrechtsrelevanz des BND
III. Die Erweiterung der parlamentarischen Kontrolle des BND von 1992 bis 2006
IV. Der Geschäftsgang zum Einsatz von Fernmeldekontrollen durch den BND
V. Tägliche Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis nach dem G 10 durch den BND von 1999 bis 2003 / 2004
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A Einführung
Die bis dahin beispiellosen islamistisch motivierten terroristischen Anschläge vom 11.09.2001 auf Ziele in den USA[1] gelten mit ihren weitreichenden politischen und gesellschaftlichen Implikationen weithin (berechtigterweise) als zeitlicher Wendepunkt auch der deutschen Rechtsentwicklung.
Richtete sich bis dahin die bundesdeutsche Anti-Terrorgesetzgebung[2] noch vornehmlich gegen den binnenstaatlichen RAF-Terrorismus, der in der Nachschau doch mit einem Mindestmaß an Täterrationalität und Vorhersehbarkeit ausgestattet war, markieren die Anschläge vom 11.09.2001 eine grundlegend neue Risikolage. So kann dem nunmehr transnational operierenden und religiös fanatisierten Terrorismus eben keine Rationalität mehr eingeräumt werden; seine Aktionen sind zudem nahezu vollkommen unvorhersehbar. Angesichts der neuen Qualität der Bedrohung ändert sich auch die Qualität der legislativen Anti-Terrormaßnahmen.
Hier gilt nun ein „ganzheitlicher Bekämpfungsansatz“, der, im Gegensatz zur vormaligen Anti-Terrorgesetzgebung, eine Vielzahl von eben nicht originär sicherheitspolitischen Rechtsgebieten betrifft, und zunehmend sogar nichtstaatliche Akteure umfasst (beispielsweise durch die Verpflichtung von Telekommunikationsanbietern oder Finanzdienstleistern zu einer verstärkten Informationsvorsorge). Daneben wird die Terrorismusbekämpfung nunmehr als Gegenstand eines „Mehr-Ebenen-Systems der Rechtserzeugung“ betrieben. Der „ganzheitliche Ansatz“ wird nicht nur durch die nationale Gesetzgebung verfolgt, sondern auch in erheblichem Maße durch inter– und supranationale Akteure induziert. Es geht hierbei kaum noch um die klassischen Strategien der präventiven polizeilichen Gefahrenabwehr und repressiver Strafverfolgung, stattdessen „wird der Ausweg in einer Ausweitung und Verselbstständigung der Informationsvorsorge gesucht.“[3]
Der ganzheitliche Bekämpfungsansatz im Mehr-Ebenen-System spiegelt sich in der bundesdeutschen Rechtsentwicklung ab dem 11.09.2001 wieder, die ebenfalls vermehrt auf Informationsvorsorge abzielt. Dadurch soll ein terroristischer Anschlag mit seinen verheerenden Folgen möglichst frühzeitig verhütet werden. Nach allgemeinem Dafürhalten ist die herkömmliche polizeiliche Prävention hier eher ungeeignet, da sie – auch in Anbetracht der
bedrohten Rechtsgüter – zu spät komme, und ebenso eine Strafverfolgung nach einem Anschlag nachrangig sei.
Jedoch stellt sich nun die Frage, wie eine solche Qualität der Gesetzgebung mit hergebrachten liberalen Ansichten in Einklang zu bringen ist. Greift die beabsichtigte Steigerung von Qualität und Effizienz bei der Terrorbekämpfung nicht zu weit in die Freiheitsrechte der eben zu schützenden Bevölkerung ein? Findet „in Deutschland ein systematischer Zersetzungsprozess verfassungsrechtlich garantierter Freiheitsrechte“[4] durch eine „vertikale und horizontale Ausdehnung der Datenerfassung, Verortung und Vermessung der Bevölkerung insgesamt“[5] statt? Oder heiligt der Zweck alle Mittel: „Die zugrunde liegenden Gesetze“ für die Terrorismusbekämpfung „wurden zwar häufiger kritisiert, die Einwände zeichneten sich aber fast durchweg durch mangelnde Kenntnis der islamistischen Ziele [..] aus. Sie können unbeachtet bleiben.“[6] (eigene Hervorhebung)?
I. Fragestellung und Erkenntnisinteresse
Es geht in vorliegender Arbeit nur randständig darum, zu klären, ob die einzelnen konkreten Maßnahmen rechtmäßig sind, sondern vielmehr um die Frage, welcher „Kompass“ zur Beurteilung anzulegen ist. Insbesondere soll die Frage im Vordergrund stehen, ob hergebrachte „liberale“ Abwägungsmodelle angesichts einer auch gesellschaftlich veränderten Umwelt noch angemessen sind.
Beschäftigt man sich mit der aktuellen verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Diskussion, erinnert vieles an den Diskurs in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Man „findet ständige Wiederholungen und kaum neue Einsichten.“[7] Die Argumente heute unterscheiden sich von den damaligen im Kern nicht wesentlich. So kommt es vor, dass Argumente beispielsweise für und gegen die Volkszählung oder die Einführung der Rasterfahndung auch heute noch im Zusammenhang mit staatlichen Informationsbeschaffungsmaßnahmen im Zuge der Terrorbekämpfung wortwörtlich wiederholt werden.
Insoweit stellt sich die Frage, ob die Situation heute mit der Situation damals vergleichbar ist, so dass sich die relevanten Argumente nicht verändern müssten. Zwei Gründe sprechen dagegen: Zum einen werden die Bedürfnisse der „Risikogesellschaft“ in der Diskussion bisher kaum rezipiert, und wenn doch, nicht zu Ende gedacht. Das Denken der Risikogesellschaft erweitert nun jedoch das Denken einer liberalen Gesellschaft um entscheidende Aspekte. Dies muss bei einer Abwägung zwischen Sicherheit und Bürgerrechten mitgedacht werden. Zum anderen hat sich auch das Bedrohungsszenario geändert. Gerade an der kontingenten[8] Bedrohung durch den Terrorismus kristallisiert sich das postmoderne Risikodenken. Die diffuse Bedrohung durch den transnationalen Terrorismus unterscheidet sich grundlegend von Bedrohungen früherer Tage, beispielsweise von einem möglichen Angriff durch den Warschauer Pakt oder etwa auch vom RAF-Terrorismus der 1970er / 80er Jahre.
In der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, dass die bisherigen liberalen Argumentationsmuster weitgehend ins Leere laufen. Die risikopräventive Gesetzgebung entzündet sich ständig an einem liberalen Schema, das mit Rechtsinstituten und –begriffen operiert, die in Zeiten der Risikogesellschaft zumindest neu gedeutet, wenn nicht grundlegend neu konzipiert werden sollten.[9]
Der grundlegende Konflikt kann knapp zusammengefasst werden. Der wesentliche Bezugspunkt liberalen Denkens ist die „Abwehr gegen den Staat“. Der Staat solle nur dann tätig werden, wenn ganz bestimmte Tatbestände vorliegen, und auch dies nur unter klaren „Spielregeln“. Solange der einzelne Bürger sich gesetzestreu verhalte, solle der Staat nicht in dessen Rechtssphäre eindringen. Die Risikogesellschaft verlangt anderes. Anknüpfungspunkt staatlichen Handelns soll eben nicht mehr nur der „Störer“ sein, sondern auch die „Risikovermeidung“. Damit ist jedoch nicht alleine die herkömmliche polizeiliche Gefahrenprävention gemeint, denn der Staat solle bereits dann tätig werden, um bereits Risiken, die künftige Rechtsgüterverletzungen erst noch produzieren könnten, zu verhindern. Die geforderte Verlagerung staatlichen Handelns in das weite Vorfeld steht nun zum einen in Konkurrenz zum liberalen Bestimmtheitsgebot, zum anderen leidet sie an einem prinzipiellen Mangel an Anknüpfungspunkten für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der konkreten staatlichen Maßnahme.
Es ist evident, dass beide Denkweisen in ihren Schnittmengen nicht zueinander passen. Eine alleine auf „liberalem Parkett“ befindliche Argumentation kann nicht mehr sachdienlich sein, da sie die Belange der „Risikogesellschaft“ ausblendet. Die Existenz derselben ist jedoch in der
soziologischen Forschung seit Jahrzehnten thematisiert und vielfach belegt. Sie wird deshalb in der vorliegenden Arbeit nicht mehr näher erläutert.[10] Ohne eine Rezeption der Belange der Risikogesellschaft auch in der Rechtswissenschaft können jedoch auch keine Strategien diskutiert werden, deren vollkommener Verwirklichung Schranken zu setzen. Denn eine solche wäre sicherlich nicht mehr mit der freiheitlichen Grundordnung des Grundgesetzes in Einklang zu bringen, da in der Konsequenz jede freiheitliche Betätigung Anknüpfungspunkt staatlichen Risikovorsorgehandelns wäre.
Mit dieser Arbeit sollen zwei Ziele verfolgt werden:
1) Nachweis am Beispiel der Befugnismodifikationen des Bundesnachrichtendienstes seit dem Ende des „Kalten Krieges“, dass die bisherige verfassungsrechtliche und rechtspolitische Diskussion auf dem Gebiet des Sicherheitsrechtes nicht weiterführend ist, da weithin liberalen Zielvorstellungen verpflichtet
2) Aufzeigen von ersten Ansätzen, Elemente des Risikodenkens in die bisher liberal geprägten Abwägungsprozesse mit einzubeziehen.
II. Methodik und Quellenlage
Zunächst soll aufgezeigt werden, wie sich die Begriffe „Sicherheit“, Rechtsstaat“ und „Bürgerrechte“ im jeweiligen liberalen, sozialen bzw. risikoparadigmatischen Kontext voneinander unterscheiden. Dadurch soll insbesondere deutlich werden, welche Unterschiede zwischen dem liberalen Denken und dem Risikodenken bestehen. Dies ist die Voraussetzung, um zu verstehen, warum die herrschende rechtswissenschaftliche Diskussion weitgehend „leerläuft“.
Der Gesetzgeber richtet sich seit dem Fall des Eisernen Vorhanges verstärkt an Gesichtspunkten der Risikovorsorge aus. Dies zeigt sich naturgemäß insbesondere an der Gesetzgebungsaktivität für die Sicherheitsbehörden. Welche wirklich neue Qualität die Gesetzgebung aufweist, soll am idealen Beispiel des Bundesnachrichtendienstes (BND) aufzeigt werden. Da dieser bereits vor dem Fall des Eisernen Vorhangs Risikoprävention und Informationsvorsorge betrieben hat, kann aus dem Gegensatz heraus die neue Qualität der Gesetzgebung am besten aufgezeigt werden.
Dazu erfolgt zunächst eine Skizzierung des BND in seiner „klassischen Ausprägung“ um 1991, ehe in einem weiteren Schritt erste einschlägige Gesetzgebungen in Richtung Risikovorsorge vorgestellt werden: Die Erweiterung seiner Kompetenzen unter anderem durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.10.1994.
An der sich hieran entzündenden Argumentation pro und contra die Befugniserweiterungen soll nachgewiesen werden, dass sowohl Befürworter, als auch Gegner dem liberalen Denkschema verhaftet bleiben. Daneben soll kurz dargelegt werden, wie sich das Bundesverfassungsgericht zu dem Streit geäußert hat.
Ab dem 11.09.2001 sollten sich die Befugnisse des BND auch infolge der Berücksichtigung technischer Entwicklungen nochmals erweitern. Der Gedanke der Risikovorsorge steht noch klarer im Vordergrund, ebenso die Verlagerung der Risikovorsorge ins weite Vorfeld. Auch hier bleibt die Diskussion noch alten Schemata verhaftet, und nicht zielführend.
Eine anschließende Zusammenfassung der Kompetenzentwicklung des BND zwischen 1989 und Anfang 2006 soll noch einmal deutlich machen, dass der Gesetzgeber nicht zum Ziel hat (wie auf der „liberalen Folie“ argumentiert), den „gläsernen Bürger“ zu schaffen, um diesen letzten Endes völlig dem Staat zu unterwerfen, sondern lediglich, Risikovorsorge zu betreiben.
Zuletzt wird geprüft, ob Schrifttum und neueste höchstrichterliche Rechtsprechungen Impulse zur Überwindung des Dilemmas „liberales Paradigma“ versus „Risikovorsorge-Paradigma“[11] liefern. Hier soll der Versuch eines modifizierten Modells einer Verhältnismäßigkeitsprüfung als erste Lösungsskizze entwickelt werden.
Zur allgemeinen Quellenlage: Ganz im Gegensatz zur Fülle populärer Literatur[12] sind rechtswissenschaftliche Monographien zum Thema „Bundesnachrichtendienst“ rar. Das letzte umfangreiche Werk von 1998 behandelt den BND auf Grundlage des Verbrechensbekämpfungsgesetzes von 1994.[13] Spätere Monographien beschäftigen sich vor allem mit der parlamentarischen Kontrolle des BND. Besonders bemerkbar macht sich das Fehlen einer aktuellen Monographie, die das Nachrichtendienstrecht als Ganzes behandelt. Angesichts der doch erheblichen Änderungen, die mittlerweile gerade hier eingetreten sind, wäre ein neuer, aktualisierter Band zu begrüßen.
Dagegen gibt es eine Fülle auch aktueller Aufsätze, die sich mit ausgewählten Aspekten einzelner Rechtssetzungsakte befassen. Einige wenige geben auch einen globaleren Überblick über die Rechtsentwicklung des BND. Manche nehmen einen möglichen Bezug der Bedürfnisse der Risikogesellschaft zur Erweiterung von Kompetenzen des BND an, verwerten diesen Bezug jedoch rein liberal als Gegenargument zu Befugniserweiterungen.[14] Ein Aufsatz[15] hingegen setzt sich sehr prägnant mit den unterschiedlichen – und letztlich inkompatiblen – Funktionslogiken des „liberalen Rechtsstaates“ und des „Präventionsstaates“ auseinander. Insbesondere letzterer Ansatz diente als Gedankenanstoß.
Die vorliegende Arbeit berücksichtigt Sachstand und Literatur bis zum 31.03.2006. Eine Pressemeldung zu einem angedachten „Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz“ vom Februar 2006 soll die letzte zu berücksichtigende Entwicklung sein.
III. Zentrale Definitionen
Die folgenden Definitionen sind der deutschen Rechtsauffassung entlehnt und weisen mithin eine gewisse Zirkularität auf. Inhaltlich zwar befriedigendere, politikwissenschaftlich gefärbte Näherungen scheiden mangels Brauchbarkeit für den rechtswissenschaftlichen Anspruch der Arbeit aus.
„Behörde“: Eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt,[16] wobei eine Stelle eine organisatorische Einheit mit einer auf Dauer angelegten Zusammenfassung von Personal– und Sachmitteln ist. Der Begriff der „Öffentlichen Verwaltung“ stellt auf die Unumkehrbarkeit behördlichen Handelns gegenüber dem Rechtsunterworfenen ab (modifizierte Subjektstheorie).
„Sicherheitsbehörde“: Eine Behörde, die Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrnimmt, gleichwohl mit welchen Mitteln und in welchem Gefahrenstadium.[17]
Beispiele für deutsche Sicherheitsbehörden sind: Bundeswehr, Bundespolizei, Zollbehörden, Nachrichtendienste von Bund und Ländern, Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter sowie Staatsanwaltschaften und Landespolizeien;[18] daneben auch Ordnungsbehörden wie beispielsweise Gemeinden, Landräte und Innenministerien, die ebenfalls „Behörden“ sind, und soweit sie Aufgaben öffentlicher Sicherheit und Ordnung wahrnehmen.[19]
„Nachrichtendienst“ (ND): Eine Sicherheitsbehörde, der der Einsatz gesetzlich bestimmter nachrichtendienstlicher Mittel gestattet ist und deren Tätigkeit auf Informationsvorsorge im Vorfeld einer Gefahr beschränkt ist (insbesondere also keine polizeilichen Exekutivbefugnisse besitzt).
Hirsch[20] meint, ND seien Sicherheitsbehörden, die ihre zugewiesenen Aufgaben hauptsächlich mit dem Einsatz verdeckter Mittel erfüllten. Diese Definition ist abzulehnen, da sie zu wenig trennscharf ist. So würden beispielsweise Observationseinheiten der Polizei oder des Zollkriminalamtes (ZKA), die spezialisiert „Lauschangriffe“ durchführen, als ND firmieren. Zudem gewinnt beispielsweise der BND seine Erkenntnisse zu einem großen Teil aus der Auswertung offener Quellen.
„Nachrichtendienste“ sind (abschließende Aufzählung): Bundesnachrichtendienst (BND), Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), die Landesämter für Verfassungsschutz (LfV) und der Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr (MAD).
Die Grenzfälle „Nachrichtenabteilung des Auswärtigen Amtes“,[21] oder etwa das „Zentrum für Nachrichtenwesen der Bundeswehr“ sind keine ND. Da ihre Nähe zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eher fern liegt, mangelt es an dem Merkmal „Sicherheitsbehörde“, hilfsweise auch an dem Merkmal „gesetzlich bestimmte nachrichtendienstliche Mittel“.[22]
„Nachrichtendienstliche Mittel“: Nur den ND vorbehaltene Mittel und Hilfsmittel der heimlichen Informationsbeschaffung.[23] Nachrichtendienstliche Mittel sind: Einsatz von Vertrauensleuten und Gewährpersonen, Observationen, Bild– und Tonaufzeichnungen, Verwendung von Tarnpapieren und –kennzeichen und Verwendung von Legenden.[24] Weitere nachrichtendienstliche Mittel wären denkbar, da die gesetzliche Aufzählung ausdrücklich nicht enumerativ ist, und in einer – geheimen – Dienstvorschrift ausdrücklich näher konkretisiert werden soll. Die Wahl der Mittel bleibt aber an die Schranken der Verhältnismäßigkeit gebunden.
Ein gesondert zu betrachtendes nachrichtendienstliches Mittel sind die Brief–, Post– und Fernmeldeüberwachung von Einzelpersonen (Individualkontrollen) und die personenunabhängige Kontrolle von Individualkommunikation (strategische Fernmeldekontrollen).[25] Der Einsatz solcher Mittel greift unmittelbar in Art. 10 GG ein, und unterliegt besonderen Schranken.[26]
B Die Be griffe „Sicherheit“, „Rechtsstaat“ und „Bürgerrechte“ als Variablen vorherrschender gesellschaftlicher Paradigmen
Es geht, grob gesagt, Befürwortern wie Gegnern von Kompetenzerweiterungen von Sicherheitsbehörden um die Balance zwischen Sicherheit und Bürgerrechten, und wie diese im Rechtsstaat ausgestaltet werden müsse.
Um zu verstehen, warum die bisher herrschende Diskussion eindimensional bleibt und sich seit Jahrzehnten im Kreis dreht, ist an dieser Stelle nun ein rechtshistorisches Ausgreifen erforderlich. Hier soll gezeigt werden, dass zentrale Rechtsbegriffe wie „Sicherheit“ und „Rechtsstaat“ weder selbst, noch in ihrem Verhältnis zueinander als Konstanten aufgefasst werden dürfen, und damit – als wesentliches Ergebnis – ständig neu bewertet werden müssen.[27] Seit einiger Zeit werden diese Begriffe nun in Richtung „Risikogesellschaft“ neu interpretiert, deren Werthaltungen an dieser Stelle ebenfalls zu skizzieren sind. Die Wahrnehmung zentraler Rechtsbegriffe als „Variablen herrschender Kultur“[28] bildet die Voraussetzung, um sich neuen Argumentationsmustern zu öffnen.
I. Die Verwendung im „liberalen Paradigma“
Das mittelalterliche „Fehdeunwesen“, die verheerenden konfessionellen Bürgerkriege des Mittelalters und die nunmehr verbreitet als untragbar wahrgenommene völlige Rechtsunsicherheit waren Ausgangspunkt für die Ausformulierung frühneuzeitlicher Staatstheorien. Durch deren praktische Verwirklichung sollte die Anarchie des Mittelalters institutionell und konstitutionell überwunden werden.
Die Staats– und Vertragstheoretiker jener Zeit[29] gingen davon aus, dass eine Ansammlung von Individuen ohne jede staatliche Organisation in einem für alle gefährlichen Naturzustand leben würde, allgemein charakterisiert durch Unsicherheit und gegenseitiger „Tyrannei“. Um diesen Zustand (realisiert in den als negativ empfundenen Verhältnissen des späten Mittelalters) zu überwinden, müssten alle Individuen auf ihre – ihnen originär jedoch durchaus zustehende –Freiheit zur Ausübung von Gewalt[30] verzichten, und einer übergeordneten Instanz übertragen. Mit anderen Worten: Ein organisiertes Gemeinwesen, also der Staat, sollte zum Wohle aller das „Gewaltmonopol“ erhalten. Ihm allein fiele damit die Aufgabe zu, die physische Sicherheit seiner Bürger sowohl voreinander, als auch vor äußeren Bedrohungen zu sichern. So sollte eine maximale Freiheitsentfaltung des Einzelnen, ohne eben durch die Freiheitsentfaltung seiner Mitbürger behindert zu werden, gewährleistet werden.
Jedoch zeigte sich an der resultierenden Staatsform des Absolutismus, dass der Staat als Gewaltmonopolist geneigt war, die zugrunde liegende Freiheit der Individuen nun selbst aufzuzehren, obgleich er diese doch eigentlich gewährleisten sollte. Mit Merkantilismus und der Hilfe von „Polizey-Ordnungen“ regierte der Staat bis tief in die Privatsphäre seiner Untertanen hinein. Um die Freiheit der Bürger dennoch zu gewährleisten, ohne dabei das Gewaltmonopol des Staates aufgeben zu müssen, musste also wiederum der Staat in seiner Gewaltausübung beschränkt werden.[31]
Die Problemstellung mündete in die Idee eines „Rechtsstaates“. Das „Recht“ wurde auf den Schutz der bürgerlichen Freiheit bezogen, und „gegen den umfassenden Regelungsanspruch des Wohlfahrtsstaates in Stellung gebracht“.[32] Der Staat wurde bei der Ausübung seiner Gewalt daran gebunden, das „Recht“, mittelbar also die in Gesetzen kodifizierten Freiheitsansprüche seiner Bürger, zu respektieren. Die bürgerlichen Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts führten in der Folge europaweit zu konstitutionellen („gesetzesgebundenen“) Monarchien. „An die Stelle des polizeigemäßen setzt die europäische Aufklärung das Prinzip des >freien< Verhaltens“.[33]
Im liberalen Paradigma bedeutet „Sicherheit“ also zum einen Schutz vor Eingriffen der Mitbürger in eigene Freiheitsrechte, und zum anderen auch den Schutz vor staatlichen, „unrechtmäßigen“ Übergriffen. „Rechtsstaat“ beinhaltet, dass der Staat bei der Ausübung seines Gewaltmonopols dem Recht (kodifiziert in Gesetzen) verpflichtet ist, das die Freiheit des Individuums vor staatlichen Eingriffen schützt. Der Kanon dieser Rechte sind die „Bürgerrechte“.
Vor allem in Hinsicht auf das zu bearbeitende Thema ist entscheidend, dass aus der allgemeinen Orientierung an der liberalen Freiheitsidee ein materielles Prinzip des liberalen (Rechts–)Staates ableitbar ist: „Die Zuständigkeit des Staates ist prinzipiell begrenzt, die individuelle Freiheit dagegen prinzipiell unbegrenzt.“[34]
Die liberale Phase bestimmt nicht nur „noch heute dunkel das Bild des Rechtsstaates“,[35] sondern prägt noch heute ganz zentral insbesondere die im Folgenden zu skizzierende Sicherheitsgesetzgebung. So sind heute gültige strafprozessuale Garantien wie das Legalitätsprinzip, das Nemo-Tenetur-Prinzip, das Institut der Unschuldsvermutung, das Verbot staatlicher Täuschung (Fairness-Gebot) und viele andere[36] (vom Grundrechtskatalog des Grundgesetzes ganz zu schweigen), direkte Ausflüsse der liberalen Lesart des „Rechtsstaates“, und werden mit erheblichem Nachdruck in die Diskussion um die Erweiterung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden, hier besonders der ND, eingebracht.
II. Die Verwendung im „sozialen Paradigma“
Der liberale Staat sollte ein „Nachtwächterstaat“[37] sein und wurde darauf beschränkt, nur bei Freiheitsbedrohungen unter den „Spielregeln“ des, liberalen Werten verpflichteten, Rechts von seinem Gewaltmonopol Gebrauch zu machen. Der Liberalismus hatte die Gewährleistung maximaler individueller Freiheit zum Ziel. Dies sollte ebenfalls zu mehr Wohlstand und zu einem gerechten Interessenausgleich führen. Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, und in ihrem Gefolge die Entstehung einer verarmenden „Arbeiterklasse“ stellten nun aber die Frage nach der Richtigkeit, oder besser noch der Vollständigkeit der liberalen Idee.[38]
Um den Bestand des Staates vor nunmehr drohenden Revolutionen zu bewahren, wandelte sich in der Folge der Begriff „Sicherheit“. Zusätzlich zur Sicherheit vor dem übergreifenden Staat und dem Mitbürger trat nun gleichberechtigt die soziale Sicherheit in Gestalt eines Schutzes vor den Wechselfällen des Lebens. Der Staat wurde nun nicht mehr – nur – als eine obrige Instanz aus dem Recht der Über– und Unterordnung begriffen, sondern erstmals auch als ein gesellschaftlicher Zusammenschluss in Form einer „Solidargemeinschaft“ verstanden. „Bürgerrechte“ verloren ihre ausschließliche Bedeutung als Abwehrrechte gegenüber dem Staat, und wurden nun zunehmend nun auch zu sozialen Teilhaberechten umgedeutet. Historisch
erstmals verwirklicht wurde der resultierende neue Staatszweck durch die Einführung der Sozialversicherung durch Otto von Bismarck im Deutschen Kaiserreich im Jahre 1883.[39]
Das Grundgesetz weist heutzutage sowohl liberale, als auch soziale Züge auf. Art. 20 Abs. 1 GG enthält – neben der Orientierung an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung – auch den Sozialstaatsgedanken. Er ist mit der Freiheitlichkeit gleichgeordnet, was in der Formulierung „sozialer Rechtsstaat“ zum Ausdruck kommt.
Die Begrifflichkeiten des liberalen und des sozialen Paradigmas schließen einander nicht aus, stehen aber in Teilbereichen in Konkurrenz zueinander. Ein Beispiel wäre der nunmehr nötige staatliche Grundrechtseingriff in das Eigentumsinstitut, um eine Redistribution zugunsten Bedürftiger zu gewährleisten. Hier widerstreitet sich die Pflicht des Staates zum sozialen Eingreifen mit seiner liberalen Zurückhaltungspflicht (nur ein Beispiel für Zielkonflikte zwischen sozialem und liberalem Paradigma). Eine Ausbalancierung im Wege einer Verhältnismäßigkeitsprüfung kann solche Konflikte jedoch prinzipiell zufriedenstellend lösen, insbesondere da die Eingriffsbefugnis des Staates weiterhin prinzipiell begrenzt bleibt: Auch auf sozialem Gebiet soll er nur dann eingreifen, wenn sich soziale Schieflagen ergeben.
III. Die zunehmende Überlagerung durch das „Paradigma der Risikogesellschaft“
Die Leitidee des „fürsorgenden“ Staates wurde im weiteren Verlauf bis heute weiterentwickelt, und mehr in Richtung des „Gewährleistungsstaates“ gerückt. So kann etwa das „Lüth-Urteil“[40] mit seiner Bewertung von Grundrechten als „wertentscheidende Grundsatznormen“ mit Drittwirkung zwischen Privaten (!) durchaus auch als Ausdruck des „Gewährleistungsstaates“ gesehen werden, und gilt zudem als erste ausdrückliche Abkehr von der ausschließlichen Idee von Grundrechten als reine Abwehrrechte gegen den Staat.
Art. 1 Abs. 1 GG spricht zudem nicht nur davon, dass die Würde des Menschen – passiv – durch den Staat zu „achten“, sondern eben auch – aktiv – zu „schützen“ sei. In der Konsequenz sieht sich der Staat zunehmend in der Verantwortung für die „Herstellung erwünschter Lagen aller Art“:[41] Aktive Wirtschaftslenkung, Abbau von Diskriminierungen in der Gesellschaft, Minderheitenschutz, die Idee des „aktivierenden Staates“ sind nur einige praktische
Ausprägungen dieser Weiterentwicklung.[42] „Staatsabwehr [..] ist nur noch eine Seite des Rechtsstaats, der nun gleichberechtigt ein Handlungs– und Gewährleistungsmoment zur Seite gestellt wird.“[43]
Diese Akzentuierung grundrechtlicher Schutzpflichten durch (eben nicht „gegen“) den Staat,[44] und deren Verfestigung in der Verfassungswirklichkeit mündet in und speist ein neues „Risikovorsorge-Paradigma“. Dieses existiert parallel zum liberalen und sozialen Paradigma, determiniert aber zunehmend das staatliche Handeln.
Die wesentliche sicherheitspolitische Staatsaufgabe ist hier die Antizipation möglicher Krisenlagen weit jenseits von Kategorien wie dem strafprozessualen „Verdacht“, der polizeilichen „Gefahr“ und im gewissen Maße auch der politischen „Bedrohung“. Ihr Ziel ist die Erkennung von Lagen, die, bei gedanklicher Weiterentwicklung in die Zukunft, Gefahren produzieren könnten – es aber aktuell nicht unbedingt tun.[45] Illustrierend ist an dieser Stelle die rhetorische Frage von Ulrich Beck: „Wer hätte gedacht, daß die innere Sicherheit, beispielsweise Deutschlands, einmal in den hintersten Tälern Afghanistans verteidigt werden muß?“[46] Der Staatszweck ist hier nunmehr die Gewährleistung umfassender „angstfreie[r] Daseinsgewissheit“.[47]
Zwar gab es bereits zu Zeiten des Liberalismus „Prävention“. Diese war aber lediglich im Bereich des Polizeirechts verrechtlicht, und existierte im Übrigen – wenn überhaupt – als politische Zielsetzung. Zudem ging es auch hier nur um die Verhinderung der Entstehung konkret drohender Gefahren. Das Paradigma der Risikovorsorge verlagert die Bekämpfung jedoch nunmehr weit in das Vorfeld von Gefahren; statt Prävention wird „Präemption“[48] betrieben.[49]
Die wesentliche neue Qualität der Entwicklung ist die Verrechtlichung der bislang „nur politisch begründete[n] Garantiefunktion des Staates“[50] mit der Vorverlagerung des Risikoschutzes. Dabei sind die Konturen des geforderten Staatshandelns prinzipiell unscharf. Entsprechend sind herkömmliche Abwägungsmechanismen relativ schwieriger als ehemals zu handhaben.[51] Das Recht als Regulierungsmechanismus individuellen Verhaltens gerät damit in den Hintergrund; vermehrt soll durch dieses Instrument Risikosteuerung zur Sicherheitsmaximierung betrieben werden.[52] Diese Entwicklung macht sich besonders seit den 1990er Jahren bei einer Vielzahl von Politikfeldern bemerkbar [Beispiele: Lebensmittelrecht; Verkehrsrecht; Umweltrecht (hier besonders relevant das Immissions– und Atomrecht); zunehmende Informationsvorsorge („Informationskrieg“ gegen den Terrorismus); präemptive Tendenzen der Außenpolitik].[53]
Das eben vorgestellte Paradigma ist nun prinzipiell nicht mehr mit dem liberalen Paradigma vereinbar. Die Zuständigkeit des Staates ist eben nicht mehr prinzipiell begrenzt, sondern ist hier, wenn nicht deklaratorisch, so doch faktisch prinzipiell allumfassend.
IV. Die mangelnde Rezeption der Begriffsvarianz im sicherheitsrechtlichen Diskurs
Die Modifikation des liberalen Paradigmas, bzw. die Ergänzung durch das Paradigma der Risikovorsorge hat jedoch nur geringen Eingang in den rechtswissenschaftlichen Diskurs über das Sicherheitsrecht gefunden. Hier wird weithin immer noch auf Basis eines – unmodifizierten – liberalen Paradigmas argumentiert. Dies kritisiert, als einer der wenigen, auch Denninger,[54] der sehr treffend die Funktionslogik des liberalen Rechtsstaates mit der Funktionslogik des Präventionsstaates miteinander vergleicht und für unvereinbar erachtet.[55] In anderen Rechtsgebieten ist die Diskussion bereits fortschrittlicher (etwa im Umweltrecht,[56] Straßenverkehrsrecht, Lebensmittelrecht etc.). Dies mag verständlich sein, reiben sich doch grundlegende liberale Prinzipien gerade im Sicherheitsrecht besonders eklatant an risikovorsorgenden Bestrebungen, und geben damit zu einem ausgeprägten liberalen Konservatismus Anlass.
Dabei erkennen Befürworter wie Gegner einer auch im Sicherheitsrecht zu beobachtenden Erweiterung staatlicher Kompetenzen den Zweck „Risikovorsorge“ nicht als solchen, sondern wägen Befugniserweiterungen gegen liberale Zielvorstellungen ab. Die Realität ist eine andere. Gesellschaftlich ist nunmehr der prinzipiell unbegrenzte, weit im Vorfeld handelnde Staat gefordert. Argumentationen auf liberaler Basis müssen hier ins Leere laufen. Auch wenn Kompetenzerweiterungen als gesellschaftlich induziert oder gar tatsächlich als Ausfluss einer Paradigmenergänzung wahrgenommen werden, wird eine solche Erkenntnis in liberaler Manier verwendet. Dann wird – schon durch die Wortwahl ersichtlich – bedauert, dass sich Kompetenzerweiterungen in Zeiten des Terrorismus nahezu ohne Widerstand durchsetzen lassen; dann wird bedauert, dass sich beispielsweise „das Strafrecht [..] im Zugriff einer Sicherheitspolitik“ befinde, „die nach umfassender Sozialkontrolle strebt“.[57]
Es ist jedoch keine rechtliche Frage, ob die gesellschaftliche Forderung nach Risikovorsorge sinnvoll oder gerechtfertigt ist; deren Beantwortung bleibt dem demokratischen Diskurs vorbehalten.[58] Aufgabe der Rechtswissenschaft sollte es vielmehr sein, die veränderte gesellschaftliche Realität zu rezipieren und die Frage zu beantworten, wie man die Wünsche nach einer umfassenden Risikovorsorge mit ihrer prinzipiellen Allumfassendheit des Staates mit der verfassungsrechtlich gebotenen prinzipiell unbegrenzten individuellen Freiheit des Individuums in Einklang bringen kann. Dies erfordert jedoch mehr, als das Grundgesetz als bloßes liberales Abwehrinstrumentarium oder gar als reines „Nationalsozialismusverhütungsgesetz“ zu sehen.
Dazu wäre als erster Schritt zunächst eine Auseinandersetzung mit den tieferen Ursachen einer expansiven Sicherheitsgesetzgebung notwendig. Eine solche findet jedoch weithin nicht statt. Unausgesprochen herrscht die Auffassung vor, der Staat handele so, um seine Macht zu erweitern, seine Totalität zu steigern und letztlich den nunmehr „gläsernen“ Bürger besser unterdrücken zu können. Umgekehrt stellt sich darauf aufbauend die – insofern unrichtige – Frage, ob der Zweck einzelner Kompetenzerweiterungen die Schaffung des „gläsernen Bürgers“ rechtfertigen könne. Doch diese Argumentationsweise greift viel zu kurz. Niemand will einen neuen Nationalsozialismus (eine andere Behauptung wäre schlicht böswillig). Der repräsentativ-demokratische Staat versucht lediglich, den gesellschaftlichen Willen zur Risikovorsorge durchzusetzen. Der „gläserne Bürger“ ist Mittel zum Zweck, nicht das Ziel. Braum spricht in diesem Zusammenhang zutreffend sogar davon, dass „die politischen Akteure in zwanghafter Weise zum Handeln verdammt“[59] seien (eigene Hervorhebung).
Wenn eine Auseinandersetzung mit den Gründen „neuer“ staatlicher Aktivität schon nicht erfolgt, kann auch eine Auseinandersetzung um das Abwägen von Risikovorsorge und liberalen Freiheitsrechten nicht, oder nur „in der Luft hängend“ geschehen. Dementsprechend wird weithin kaum diskutiert, ob und wie Abwägungsprozesse für eine Befugniserweiterung der Sicherheitsbehörden modifiziert oder gar neu formuliert werden müssen. Dabei wären zentrale Fragen zu klären, die unter der Prämisse gesellschaftlich geradezu geforderter Risikovorsorge nicht mehr „liberal“ beantwortet werden können.
Wenn bereits die Entstehung eines Risikos im Sicherheitsbereich bekämpft werden soll, ist eine „Unschuldsvermutung“ nicht einzuhalten, und muss sich sogar ins Gegenteil verkehren. Darf der Staat auch dann in die Rechtssphäre von Bürgern eingreifen, wenn der Bürger noch gar nichts „verbrochen“ hat – oder darf er es eben nicht? Das „Durchhalten“ dieser und ähnlicher liberaler Prinzipien gerät unter den Vorzeichen einer ausgreifenden risikosteuernden Gesetzgebung sehr unter Druck. Wenn zur Risikovorsorge vermehrt der Weg der Informationsvorsorge gegangen wird, ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (strafprozessual: „Das Recht zu schweigen“) dermaßen angreifbar, dass möglicherweise dieses Grundrecht selbst zur Disposition stehen müsste.[60] Und weiterhin: Wo soll bei einer risikovorsorgenden Gesetzgebung ein „Übermaßverbot“ und ein „Bestimmtheitsgebot“ anknüpfen, wenn die prinzipiell nicht zu wiederlegende Keule des „Schutzes überragend wichtiger Rechtsgüter“ geschwungen wird?[61] Denn die zu verhindernden Gefahren, die aus einer ja gerade zu verhindernden Risikosituation entstehen könnten, müssen natürlich unscharf und unvorhersehbar bleiben. So beklagt Calliess zutreffend das neue Nichtvorhandensein von „ob“, „wie“ und „wo“ einer Gefährdung, der der Staat nunmehr entgegentreten müsse.[62]
Auch differenzierende höchstrichterliche Erwägungen und (allzu?) ausufernde „Ja, aber – Entscheidungen“ nehmen den Konflikt zwischen Risikovorsorge und liberalen Wünschen nicht grundsätzlich zur Kenntnis, sondern nehmen einen Ausweg über im Einzelfall (zu?) komplizierte Schrankenregelungen.
Die Häufung der auftretenden Zielkonflikte im Sicherheitsrecht, und nicht mehr ganz klare Sachlagen, wie sie noch bei der Bedrohung durch den Warschauer Pakt (oder auch durch die RAF) gegeben waren, erfordern eine Argumentation, die über die liberale Folie hinausgeht.
An dieser Stelle zur Verdeutlichung Einzelbeispiele für eine verfehlte Rezeption der Risikogesetzgebung: Die von Düx geführte Klage, dass „seit fast 25 Jahren [..] in Deutschland ein systematischer Zersetzungsprozess verfassungsrechtlich garantierter Freiheitsrechte“[63] stattfinde greift zu kurz, da sie eine Konstanz der Begriffe Freiheit und Sicherheit voraussetzt, die nicht mehr gegeben ist (besser: noch nie gegeben war). Er impliziert, dass der „böse Staat“ einen systematischen Zersetzungskurs fährt, ohne dass Düx die gesellschaftliche Induktion dieser Entwicklung zu erkennen vermag. In den letzten 25 Jahren gewannen eben die Vorstellungen der Risikogesellschaft an Raum. Die Gesellschaft ist zunehmend bereit, eigene Freiheiten zugunsten der Risikovorsorge aufzugeben.[64] Mit Konfliktschemata, wie sie Düx geistig zu Grunde legt (zuletzt aktuell etwa bei dem Konflikt um die „informationelle Selbstbestimmung“ versus „staatliche Volkszählung“ in den 1980er Jahren) hat dieses Phänomen jedoch kaum etwas zu tun. Regelrecht bizarr wirkt der Interpretationsversuch des gleichen Autors für die zunehmende staatliche Risikovorsorge in Gestalt der Ausweitung sicherheitsrechtlicher Kompetenzen für die Sicherheitsbehörden: Der Staat wolle damit als Ablenkungsmanöver eine Kompetenz versprechen, die er auf sozialem Gebiet nicht erfüllen konnte.
Dieses Beispiel verdeutlicht die teilweise vorhandene Ratlosigkeit einschlägiger Autoren, denen das liberale Feindbild „Staat“ abhanden gekommen ist, und zeigt, wie wenig Bezug der rechtswissenschaftliche Diskurs in der Sicherheitspolitik zu den Prämissen der Risikogesellschaft aufweist – kurz, wie verhaftet das Denken noch an das liberale Paradigma ist.
Verfehlt erscheint in diesem Zusammenhang auch die Klage von Mertin über die Entstehung eines „Präventionsstaates“, der „nur noch an der Effektivität der Strafverfolgung und nicht etwa an der Unschuldsvermutung orientiert“[65] ist; dies gleichzeitig verbunden mit der – angesichts der bisherigen Überlegungen unrichtig gestellten – Frage, wie Terrorbekämpfung „in der Tradition eines liberalen Rechtsstaates und nicht in der Rolle eines überwachenden Sicherheitsstaates geschehen kann“[66] (eigene Hervorhebung). Auch Mertin nimmt das neue Paradigma der Risikovorsorge nicht wahr. Er wähnt sich noch immer im bürgerlichen Freiheitskampf gegen einen übermächtigen, übelwollenden Staat. Dabei verkennt er die Tatsache, dass die deutsche
Gesellschaft zur Risikogesellschaft wurde, Terrorbekämpfung somit also auch den erweiterten Bedürfnissen nach Risikovorsorge Rechnung tragen muss. Der „überwachende Sicherheitsstaat“ ist im Übrigen die immer wieder zitierte liberale Abwertung des „risikovorsorgenden Staates“, der jedoch gesellschaftlich durchaus gewollt ist – zumal er keineswegs gegen die Freiheit der Bürger als solche gerichtet ist, sondern eben „nur“ gegen das Risiko. Politisch mag man das bedauern, als Rechtswissenschaftler sollte man hingegen die gesellschaftliche Realität akzeptieren.
Die Aussage, „man bekämpft die Feinde des Rechtsstaates nicht mit dessen Abbau“[67] ist ebenfalls symptomatisch für den Diskurs; ebenso die Klage, das Strafrecht legitimiere „sich nicht gegen einen machtvollen Staat, sondern gegen einen bösen Feind“.[68] Auch hier wird wieder unrichtigerweise eine Konstanz von Begriffen wie „Staat“ und „Rechtsstaat“ angenommen. „Rechtsstaat“ bedeutet zwar in liberaler Lesart den Schutz der Bürger voreinander und auch der Schutz der Bürger vor dem Staat, der gegen den Bürger nur im Wege des Rechts handeln darf – „Rechtsstaat“ ist aber ein Begriff, der ebenso wie „Sicherheit“ oder „Freiheit“ im Kontext des Paradigmas der Risikovorsorge neu gedeutet werden muss. „Rechtsstaat“ bedeutet hier eben auch, dass der Bürger zusätzlich ein Recht auf Sicherheit vor dem Risiko hat. Ebenso ist der Staat hier nicht mehr die übermächtige, beargwöhnte Bedrohung der eigenen Freiheit, sondern die „erste Adresse“ (aber beileibe nicht die einzige), um Risikofreiheit zu gewährleisten. So gesehen, verlieren die eben zitierten Aussagen ihren logischen Sinn und zeigt einmal mehr, wie sehr eine rein liberale Bearbeitung der Fragestellung ohne Ergebnis bleiben muss.
Klar ist aber auch: Die Ablösung der Koexistenz der drei vorgestellten Paradigmas, und die vollkommene Verwirklichung alleine des Paradigmas der Risikovorsorge würde tatsächlich zum Verschwinden jeder liberalen, freiheitlichen Errungenschaft führen. Es gäbe keine persönliche Freiheit mehr, da gerade jede Ausübung persönlicher Freiheit ein Anknüpfungspunkt für den risikosteuernd handelnden Staat wäre.[69] Sollte das Hoffen auf einen garantierten Zustand der Risikofreiheit Realität werden, wäre der Preis die totale Kontrolle der Bürger und der totale Kontrollverlust des Staates[70] – dies wäre mit der freiheitlichen Grundordnung des Grundgesetzes natürlich unvereinbar (einmal abgesehen davon, dass auch in einem solchen Fall völlige Risikofreiheit nicht denkbar wäre). So ist es schon deshalb bedenklich, wenn Frisch angesichts der kontingenten Terrorbedrohung davon spricht, dass liberale Einwände gegen die neue Anti-Terrorgesetzgebung „unbeachtet bleiben können“.[71]
Die freiheitliche Grundordnung soll selbstverständlich auch angesichts einer veränderten Realität nicht aufgegeben (höchstens anders akzentuiert) werden, und steht in dieser Arbeit a priori nicht zur Disposition. Hier dürfte sich darüber hinaus einmal mehr die große Stärke des Grundgesetzes bestätigen, nämlich seine Anpassungsfähigkeit und prinzipielle Offenheit für neue Begebenheiten, ohne dabei gewisse Kernideen preiszugeben. Jedoch ist, wie bereits gesagt, bei dieser noch zu führenden Diskussion von einer anderen Prämisse auszugehen: „Die Bedrohung der Freiheit in der modernen Gesellschaft kommt nicht vom Staat, wie der Liberalismus annimmt, sondern von der Gesellschaft.“[72]
Es müssen jedoch neue Formen der Abwägung gefunden werden, die die prinzipielle Unvereinbarkeit zwischen dem allumfassenden staatlichen Regelungsanspruch auf Risikovorsorge einerseits und der liberalen Idee andererseits aufheben.[73] Für diese Herausforderung muss erst einmal ein entsprechendes Bewusstsein geschaffen werden, welches jedoch im rechtswissenschaftlichen Diskurs gerade bezüglich des Sicherheitsrechts noch fast gar nicht vorhanden ist (anders als etwa im Diskurs über das Umweltrecht, hier besonders im Immissions– und Atomrecht).[74]
C Aus gangspunkt: Der „klassische“ Bundesnachrichtendienst im liberalen Paradi gma bis 1994
Um das soeben eröffnete Feld weiter zu verdeutlichen und zu belegen, werden nun die Diskussionen um die Erweiterung der Kompetenzen des Bundesnachrichtendienstes nachgezeichnet. Der Bundesnachrichtendienst bietet sich aus mehreren Gründen für eine solche Betrachtung besonders an:
– Die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes berühren potentiell in besonderer Weise liberale
Werte
– Der Bundesnachrichtendienst in seiner „klassischen“ kompetenzionellen Ausgestaltung bis
ist weitgehend arrangiert mit liberalen Zielvorstellungen, und eignet sich damit besonders als
Ausgangspunkt einer Betrachtung in Hinsicht auf den konstatierten Paradigmenwechsel
– Der BND betrieb bereits vor 1994 Risikovorsorge im staatlichen Auftrag. Die wirklich neue
Qualität der staatlichen Risikovorsorge ab 1994 lässt sich aus dem auftretenden Kontrast heraus
gerade hier am besten zeigen
– Die gesellschaftliche Rezeption des internationalen Terrorismus als Kristallisationspunkt
gesellschaftlicher „Angst“ und damit eines hohen Bedürfnisses nach Risikovorsorge führte im
Nachrichtendienstrecht zu vergleichsweise deutlichen Änderungen des kompetenzionellen
Zuschnitts
– Dem Bundesnachrichtendienst als klassische „Risikovorsorge-Behörde“ wird eine zunehmend
größere Bedeutung zugemessen, wobei das Polarisierungspotential recht hoch ist. Gerade das
Schreckgespenst „Gestapo“ spornt gerade liberale Autoren zu rhetorischen Höchstleistungen an;
während andererseits die vermeintlichen Gefahren des internationalen Terrorismus den
Verfechtern des „law-and-order“ und des „Kampfes der Kulturen“ zu wortreichen Plädoyers für
eine umfassende – auch nachrichtendienstliche – Risikovorsorge dienen. Auf kaum einem
anderem Diskussionsfeld dürften Aussagen so explizit sein wie hier, und damit auch leichter zu
analysieren.
Zunächst soll der BND in Abgrenzung zu anderen deutschen ND verortet werden, um im Anschluss seine rechtliche Stellung um 1991 zu skizzieren. In einem weiteren Schritt werden dann erste Befugniserweiterungen ab 1994 aufgezeigt, die aufgrund ihrer risikosteuernden Grundrichtung nur noch mit Mühe an liberalen Werten gemessen werden können. Abschlusspunkt des Kapitels ist die III. Abhörentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 14.7.1999 (BVerfGE 100,313).
I. Der BND innerhalb der Sicherheitsarchitektur Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung des Trennungsgebotes
An den Grundzügen der bundesdeutschen Sicherheitsarchitektur und der bundesnachrichtendienstlichen Aufgabenzuweisung hat sich seit den Gründerjahren der Bundesrepublik bis heute auch durch die zwischenzeitliche Erlassung gesetzlicher Grundlagen am 20.12.1991 nichts geändert.
Der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland. Er klärt Sachzusammenhänge auf, die einen außen– und sicherheitspolitischen Bezug aufweisen und damit für die Bundesregierung als Entscheidungsgrundlage nötig sind. Dies geschieht nach Maßgabe des BND-Gesetzes[75] und des Gesetzes G 10.[76] Er darf zur Aufgabenerfüllung auch im Inland aktiv werden, nicht jedoch zur Aufklärung rein innerer Zusammenhänge. Einzige Ausnahme sind die Eigensicherung[77] und die eigensichernde Spionageabwehr.[78] Ebenfalls nur in diesen Fällen darf er auch individuelle Fernmeldekontrollen nach G 10 oder auch „Lauschangriffe“[79] durchführen. Strategische Fernmeldekontrollen, also die Durchsuchung des gesamten internationalen Fernmeldeaufkommens mittel Suchwortrasterung, stehen nur dem BND zu. Allen anderen ND ist diese Form der Informationsgewinnung verwehrt. Der BND untersteht der Dienst– und Fachaufsicht des Chefs des Bundeskanzleramtes.
Zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder dem Schutz des Bestandes des Bundes oder eines Landes oder zum Schutz vor ungesetzlicher Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane vor einer Bedrohung von innen sind die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern als Inlandsnachrichtendienste nach Maßgabe des BVerfSchG[80] und des Gesetzes G 10 verantwortlich. Sie klären verfassungsfeindliche Bestrebungen auf (etwa rechts– bzw. linksextremistische Zusammenhänge oder verfassungsfeindliche Vereine). Dazu zählt auch die Bedrohung durch Spionage und Sabotage von ausländischen Mächten, solange sie nicht direkt gegen den BND gerichtet sind.
Auch die Verfassungsschutzämter betreiben Vorfeldaufklärung, stellen aber, anders als der BND, gerade bei Durchführung von Maßnahmen der Individualkontrolle eine gewisse Nähe zur Strafverfolgung her.[81] Verfassungsschutzbehörden dürfen keine strategische Fernmeldekontrollen anwenden, haben jedoch im Vergleich zum BND faktisch weitergehende Befugnisse zu Individualkontrollen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht der Dienst– und Fachaufsicht des Bundesministers des Inneren. Landesverfassungsschutzämter (eine im Übrigen weltweit einmalige föderale Konstruktion) unterstehen typischerweise den jeweiligen Staatsministern des Innern.
Zum Schutz vor verfassungsfeindlichen, und damit wehrkraftzersetzenden Bestrebungen, und zur Spionageabwehr im Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung ist der Militärische Abschirmdienst (MAD) als – im internationalen Vergleich atypisch ausgestalteter – militärischer ND zuständig. Er hat die gleichen Kompetenzen für den Bereich der Bundeswehr, wie die Verfassungsschutzämter für den Bund bzw. das jeweilige Bundesland. Auch ihm stehen keine strategischen Fernmeldekontrollen zu, jedoch analog zu den Verfassungsschutzbehörden ein im Vergleich zum BND de facto weitgehenderes Betätigungsfeld bei der Individualkontrolle. Er betreibt keine Feindaufklärung, sondern hat alleine die Wehrbereitschaft der Streitkräfte im Auge. Der MAD wird nach Maßgabe des MAD-Gesetz[82] und des Gesetzes G 10 tätig, und untersteht der Dienst– und Fachaufsicht des Bundesministers der Verteidigung.
Allen ND ist gemeinsam, dass ihnen ausdrücklich keine polizeilich-exekutiven Befugnisse[83] zukommen. Sie dürfen ferner einer Polizeidienststelle nicht angegliedert werden. Diese Beschränkungen dürfen nicht auf dem Wege der Amtshilfe systematisch umgangen werden.[84]
Die Trennung zwischen den verschiedenen ND einerseits und das Verbot der Aufgabenvermischung mit der Polizei andererseits ist sowohl Ausdruck einer organisatorisch-institutionellen als auch einer personalen und sachlich-funktionalen Gewaltenteilung. Sie soll „die Kumulation nachrichtendienstlicher Aufgaben und polizeilicher Exekutivbefugnisse“[85] verhindern, um so einen möglichen Machtmissbrauch bereits präventiv zu verhindern. Die
normativ geforderte Trennung zwischen ND und den Polizeibehörden wird als „Trennungsgebot“ bezeichnet. ND sollen sich auf die Informationsvorsorge im weiten Vorfeld beschränken, und sich dazu zwar nachrichtendienstlicher, nicht jedoch imperativer Mittel bedienen dürfen. Die Polizei hingegen soll sich auf die Gefahrenabwehr bzw. die Strafverfolgung im Rahmen der Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaften beschränken.[86] Dafür dürfen sie sich grundsätzlich nicht heimlicher Maßnahmen, dafür aber imperativer Mittel bedienen. „Wer (fast) alles weiß, soll nicht alles dürfen; und wer (fast) alles darf, soll nicht alles wissen“.[87] Eine weitere verbreitete Formulierung ist abzulehnen: Während die Polizei dem Legalitätsprinzip unterworfen sei (jede Straftat muss verfolgt werden), seien die ND dem Opportunitätsprinzip unterworfen (diese müssten nicht jede Straftat verfolgen lassen). Dem ist entgegenzuhalten, dass der Bezugspunkt „Straftaten“ für ND keine logische Gültigkeit besitzt, da sie nicht nach Straftaten an sich forschen, sondern ein Abbild von Sachlagen zu produzieren versuchen.
Das Trennungsgebot birgt eine Fülle von Rechtsfragen, insbesondere dort, wo Schnittstellen zur Zusammenarbeit, sowie von Meldungen und Benachrichtigungen zwischen der Polizei und den ND vorgesehen sind.[88] Darauf wird an geeigneter Stelle näher eingegangen.
Die rechtliche Qualifizierung dieses im rechtspolitischen Bewusstsein stark verankerten Gebotes ist im Schrifttum nicht abschließend beurteilt. Die These, nach der bereits die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes ein verfassungsrechtliches Trennungsgebot nahe lege, ist seit einer aktuellen verfassungshistorischen Untersuchung von Dorn[89] widerlegt. Der in diesem Zusammenhang herangezogene „Polizeibrief“ der Alliierten vom 14.04.1949, wonach ein einzurichtender Verfassungsschutz keine polizeilichen Befugnisse haben dürfe, wurde aus besatzungspolitischen Gründen und nicht etwa aus den Erfahrungen mit der „Gestapo“ heraus so verfasst. Zudem dachten die Verfassungsväter bei der Schaffung des Grundgesetzes ausschließlich an die noch einzurichtenden Verfassungsschutzbehörden, und schlichtweg noch nicht an einen bundesdeutschen Auslandsnachrichtendienst. Entsprechend stellen die Normen des Grundgesetzes nicht auf diesen ab.
Sonstige Herleitungen des Trennungsgebotes,[90] insbesondere aus Art. 87 Absatz 1 Satz 2 GG sowie aus Art. 73 Ziffer 10 und 87 Abs. 1 Satz 2 GG strapazieren die Semantik sehr und dehnen den Wortlaut des Grundgesetzes über Gebühr.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich bisher zu diesem Themenkomplex nur am Rande geäußert. So gibt es Andeutungen in den BVerfGE 100,313 (370)[91] sowie BVerfGE 97,198 (217),[92] dass möglicherweise das Rechtsstaatsprinzip ein Trennungsgebot als „Binnendifferenzierung der Exekutive, gleichsam als institutionalisierte Umsetzung des rechtsstaatlichen Übermaßverbotes“,[93] verlange.
Insgesamt erscheinen die Bemühungen um eine verfassungsrechtliche Herleitung des Trennungsgebotes arg konstruiert und erzwungen, und mehr von rechtspolitischen Überzeugungen als von rational nachvollziehbaren Argumenten geprägt.[94]
Entsprechend richtet sich die Diskussion im Schrifttum seit der Jahrtausendwende eher gegen eine verfassungsrechtliche Gebotenheit des Trennungsgebots, und führt ihre Legitimation auf die einfachgesetzliche Normierung der Dienstgesetze zurück. Weit überwiegend wird dabei das Trennungsgebot dennoch als notwendiges Organisationsprinzip von ND und Polizeien[95] angesehen.[96] Besonders vor dem Hintergrund, dass letztlich jede Machtanhäufung auch zu Machtmissbrauch führt, sollte das Trennungsgebot weiter Prinzip bleiben;[97] es soll in vorliegender Arbeit auch nicht in Frage gestellt werden.
Im Übrigen ist generell zu beobachten, dass das Trennungsgebot für die ND strikter ausgelegt wird als für die Strafverfolgungsbehörden. Während exekutive Kompetenzen den ND bis heute nicht zustehen, nehmen originär nachrichtendienstliche Mittel bei der Strafverfolgung einen breiteren Raum ein als früher (etwa der Einsatz von V-Leuten; „Lauschangriffe“; Maßnahmen zur Informationsvorsorge etc.). Eine Diskussion dieser Entwicklung und des damit wohl zu Recht als „semipermeabel“[98] zu qualifizierenden Trennungsgebotes würde jedoch den Rahmen der Darstellung sprengen.[99]
II. Formale und materielle Rechtsgrundlagen des BND
Bis 1990 beruhte die Legitimation des BND auf einen geheimen Kabinettsbeschluss vom 11.7.1955, durch den die aus Organisationseinheiten der Wehrmacht hervorgegangene „Organisation Gehlen“[100] als „Bundesnachrichtendienst“ in den deutschen Behördenapparat übernommen wurde. Bis 1990 unterstand er lediglich der Organisationsgewalt des Bundeskanzlers und wurde durch geheime Dienstanweisungen geführt. Erst seit dem 20.12.1990 existierten eine explizite gesetzliche Regelung seiner Aufgaben und Befugnisse, sowie eine organisationsgesetzliche Grundlage.
Bei der Beschränkung des Brief–, Post– und Fernmeldegeheimnisses aus Art. 10 GG ist er jedoch bereits seit 1968 dem Gesetz G 10 unterworfen.
Die im Folgenden zitierten Normen des Nachrichtendienstrechts beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die gültige Fassung vom 01.01.1991.
1. Verfassungsrechtliche Grundlagen: Legitimation und Gesetzgebungskompetenz
Während das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter für Verfassungsschutz ihre Legitimation direkt aus Art. 73 Nr. 10 b, c GG beziehen, dort auch legal definiert und bereits seit 1950 bundesgesetzlich normiert sind, und der Militärische Abschirmdienst indirekt über die Streitkräfte erfasst ist, fehlt eine ausdrückliche Verfassungsnorm für den BND.[101] Ein „ausdrückliches Schweigen“ der Verfassungsväter ist hier nicht anzunehmen. Der verfassungshistorischen Untersuchung von Dorn zufolge[102] hatten die Verfasser des Grundgesetzes schlicht noch nicht an einen Auslandsnachrichtendienst gedacht.
Der BND betreibt Auslandsaufklärung und arbeitet dazu im Grundsatz auslandsbezogen. Er arbeitet direkt für die Bundesregierung und dient als Informationsquelle für außenpolitische Entscheidungen. Dem gegenüber hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebung über die auswärtigen Angelegenheiten (Art. 73 Nr. 1 Fall 1). Nach Art. 87 Abs. 3 Satz 1 GG können nun durch Bundesgesetz Bundesoberbehörden eingerichtet werden, sofern der Bund für die jeweilige Angelegenheit gesetzgebungskompetent ist. Da der Bund auf dem Politikfeld „Auswärtiges“ gesetzgebungskompetent ist und das Auslandsnachrichtenwesen zu diesem Politikfeld gehört, darf der Bund per Gesetz eine einschlägige Bundesoberbehörde einrichten. Er ist hier alleine gesetzgebungskompetent.[103]
So begründet, machte der Bund von seinem Recht 1990 Gebrauch und produzierte das Errichtungsgesetz für den BND, das BND-Gesetz. Damit wird die Organisation BND auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, und Bedenken früherer Jahrzehnte aufgehoben.[104]
Nach § 1 Abs. 1 BNDG ist der Bundesnachrichtendienst folgerichtig eine Bundesoberbehörde der unmittelbaren Bundesverwaltung. Es gibt keine nachgeordneten Mittel– und Unterbehörden. Er ist im Geschäftsbereich des Chefs des Bundeskanzleramtes angesiedelt, und unterliegt seiner Dienst– und Fachaufsicht. Der Chef des Bundeskanzleramtes hat damit bezüglich des BND die Rechtsstellung einer obersten Dienstbehörde. Der BND wird durch einen Präsidenten geleitet
(§ 1 Abs. 1 Satz 1 BNDG).
Wesentlicher Grund für die lange Periode untergesetzlicher Regelungen waren zunächst Geheimhaltungsinteressen angesichts real bestehender Spannungen mit dem Ostblock; andererseits auch die vorherrschende Rechtsüberzeugung, dass ein Auslands nachrichtendienst (!) per se schon keine Grundrechtseingriffe produzieren könne – und damit der parlamentarische Gesetzesvorbehalt nicht zum Zuge komme. Schließlich sei der Schutzbereich von Grundrechten schon formal nicht im Ausland anwendbar. Wo Grundrechtseingriffe dennoch möglich erschienen (etwa durch internationale, strategische Fernmeldekontrollen nach dem G 10, bei welchen durchaus ein inländischer Kommunikationsteilnehmer mit erfasst werden darf), existierten abmildernd bereits seit 1968 gesetzliche Beschränkungen.
Mit dem „Volkszählungsurteil“ des Bundesverfassungsgerichtes[105] wurde diese Auffassung jedoch unhaltbar. Hier wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG explizit als Grundrecht formuliert: Jeder Mensch habe das Recht, über seine persönlichen Daten frei zu verfügen. Nur aufgrund eines Gesetzes dürfe in dieses Recht eingegriffen werden. Die Implikationen dieses „neuen“ Grundrechts legten eine nunmehr gesetzliche Grundlage für die Arbeit des BND nahe, um auch den Datenschutz zu gewährleisten.[106] Es erschien nämlich denkbar, dass durch inländische Aktivitäten des BND (etwa bei Sicherheitsüberprüfungen oder Schnittstellen mit der Strafverfolgung) der Datenschutz von Bundesbürgern betroffen sein könnte, der dann unter Gesetzesvorbehalt stünde. Folgerichtig war das neue BND-Gesetz als Art. 4 im „Gesetz zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes“ vom 20.12.1990 enthalten.
2. Gesetzliche Aufgabenbereiche des BND nach BND-Gesetz
Das BND-Gesetz regelt die Aufgaben und Kompetenzen des Bundesnachrichtendienstes. In diesem Gesetz nehmen insbesondere Datenschutzregelungen einen breiten Raum ein, und sind recht detailliert, um nicht zu sagen hart an der Grenze zur Einzelfallbezogenheit und ohne Mut zur datenschutzrechtlichen Generalklausel.
§ 1 Abs. 2 BNDG regelt die Aufgaben des BND. Danach darf er zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen– und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind, die erforderlichen Informationen sammeln und auswerten (Auslandsaufklärung).
Konkretisiert wird diese Generalklausel durch eine durch das BND-Gesetz eigentlich aufgehobene „Allgemeine Dienstanweisung für den BND“ vom 04.12.1968, deren wesentlicher Inhalt jedoch mindestens für 1990 weiter Aktualität besitzen dürfte.[107] Demnach sind konkrete Ausgestaltungen:
– Nachrichtendienstliche Auslandsaufklärung durch Informationsbeschaffung auf
außenpolitischem, wirtschaftlichem, rüstungstechnischem und militärischem Gebiet
– Gegenspionage (Aufklärung gegnerischer ND) im Ausland
– Erledigung nachrichtendienstlicher Aufträge im Ausland im Auftrag der Bundesregierung
– Spionageabwehr innerhalb des Bundesnachrichtendienstes (Abwehr feindlicher Spione).
Im Rahmen seiner o.a. Aufgaben darf der BND auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aktiv werden, jedoch nur, wenn Informationen mit Aussicht auf Erfolg nur hier zu erlangen sind und keine anderen Behörden (etwa Polizeien[108] oder auch die Verfassungsschutzbehörden) zuständig sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 BNDG).[109] Ein Beispiel für eine erlaubte Inlandsaktivität wäre etwa die Einrichtung von gegen das Ausland gerichteten Abhöreinrichtungen im Inland. In reinen Inlandsbezügen darf der BND jedoch nur tätig werden, um eigensichernde Spionageabwehr und Eigenschutz zu betreiben (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BNDG), Sicherheitsüberprüfungen von für ihn tätige Personen nach Maßgabe der Sicherheitsüberprüfungsgesetze durchzuführen (Nr. 2), oder Nachrichtenauswertung zu betreiben (Nr. 3). Diese Aufzählung ist abschließend.
[...]
[1] Vgl. NATIONAL COMMISSION ON TERRORIST ATTACKS UPON THE UNITED STATES: Stand 20.09.2004;
abrufbar unter http://www.9-11commission.gov (aufgerufen 04.04.2006).
[2] Beispielsweise das „Anti-Terrorismusgesetz“ (BGBl I, S. 2181) von 1976, das „Gesetz zur Bekämpfung des
Terrorismus“ (BGBl I, S. 2566) von 1986 oder das „Kriminalitätsbekämpfungsgesetz“ (BGBl I, S. 3186) von 1992.
[3] Zitate aus SAURER, JOHANNES: Die Ausweitung sicherheitsrechtlicher Regelungsansprüche im Kontext der
Terrorismusbekämpfung, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ), Heft 3 / 2005, S. 276.
[4] DÜX, HEINZ: Globale Sicherheitsgesetze und weltweite Erosion von Grundrechten. Statt „Feindstrafrecht“ globaler
Ausbau demokratischer Rechte, in: Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 6 / 2003, S. 189.
[5] DÜX: Globale Sicherheitsgesetze, ZRP 6 / 2003, S. 190.
[6] FRISCH, PETER: Der politische Islamismus, in: Volker Foertsch / Klaus Lange (Hrsg.), Islamistischer Terrorismus.
Bestandsaufnahme und Bekämpfungsmöglichkeiten, München 2005, S. 25 [Berichte & Studien der Akademie für
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, Bd. 86].
[7] BULL, HANS-PETER: Freiheit und Sicherheit angesichts terroristischer Bedrohung. Bemerkungen zur
rechtspolitischen Diskussion, o.O. 2003, in: Datenschutz, Informationsrecht und Rechtspolitik. Gesammelte
Aufsätze, Berlin 2005, S. 280 [Beiträge zum Informationsrecht, Bd. 16].
[8] Als „kontingent“ wird ein Prozess, ein System oder ein Zustand bezeichnet, in dem jedes Szenario prinzipiell
möglich, aber vollkommen unvorhersehbar und damit unkalkulierbar ist.
[9] So ansatzweise auch ROELLECKE, GERD: Der Rechtsstaat im Kampf gegen den Terror, in:
Juristenzeitung (JZ) 6 / 2006, S. 265 – 270.
[10] Einführende Literatur: Grundlegend BECK, ULRICH: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne,
Frankfurt am Main 1986; aktueller, leichter verständlich und mit Bezug zu sicherheitspolitischen Fragestellungen
aus soziologischer Sicht KLEINWELLFONDER, BIRGIT: Der Risikodiskurs. Zur gesellschaftlichen Inszenierung
von Risiko, Raeren 1996; die Risikogesellschaft, ihr neuer Anspruch auf „staatliche Sicherheitsgewährung“ und der
dadurch bedingte Wandel des gesellschaftlichen Staatsbegriffs wird hervorragend in GLAEßNER, GERT-
JOACHIM: Sicherheit in Freiheit. Die Schutzfunktion des demokratischen Staates und die Freiheit der Bürger,
Berlin 2003, diskutiert.
[11] Synonym werden u.a. die Bezeichnungen „Paradigma der Risikovorsorge“, „Risikovorsorge-Bedürfnisse“,
„Bedürfnisse der Risikogesellschaft“, „Risikodenken“ etc. gebraucht.
[12] Eine polemische Abrechnung mit dem Dienstalltag, die in der Folge auch das Parlamentarische Kontrollgremium
beschäftigte, von JURETZKO, NORBERT / DIETL, WILHELM: Bedingt dienstbereit. Im Herzen des BND –
Abrechnung eines Aussteigers, o.O. 2004. Sehr aktuell und mit starken Bezügen zum Thema vorliegender Arbeit
GUJER, ERIC: Kampf an neuen Fronten. Wie sich der BND dem Terrorismus stellt, o.O. 2006.
[13] HAEDGE, KARL-LUDWIG: Das neue Nachrichtendienstrecht für die Bundesrepublik Deutschland. Ein Leitfaden
mit Erläuterungen, Bonn 1998.
[14] Vgl. etwa HETZER, WOLFGANG: Terrorabwehr im Rechtsstaat, in: Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 4 / 2005,
S. 132 ff. oder auch BULL: Freiheit und Sicherheit, 2003 (Fn. 7).
[15] DENNINGER, EBERHARD: Freiheit durch Sicherheit? Wie viel Schutz der inneren Sicherheit verlangt und
verträgt das deutsche Grundgesetz?, in: Rainer Pitschas / Harald Stolzlechner (Hrsg.), Auf dem Weg in einen „neuen
Rechtsstaat“. Zur künftigen Architektur der inneren Sicherheit in Deutschland und Österreich, deutsch-
österreichisches Werkstattgespräch zur inneren Sicherheit an der Deutschen Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer, Oktober 2002, Speyer 2004, S. 113 – 126
[Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 160].
[16] Nach § / Art. 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfg).
[17] In Abwandlung von HIRSCH, ALEXANDER: Die Kontrolle der Nachrichtendienste. Vergleichende
Bestandsaufnahme, Praxis und Reform, Diss. jur., Berlin 1996 [Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 711], S. 22.
Die hier gewählte Definition erfasst beispielsweise Nachrichtendienste nicht. Neuere Definitionen sind nicht
existent. Eine möglich erscheinende Binnendifferenzierung zwischen Sicherheitsbehörden und Ordnungsbehörden
wäre breit zu erläutern, und hinsichtlich vorliegenden Themas unergiebig.
[18] Staatsanwaltschaften, Kriminalämter und Landespolizeien werden in vorliegender Arbeit als
„Strafverfolgungsbehörden“ angesprochen.
[19] Das bayerische „Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung“ (LStVG); BayRS 2011-2-I vom 13.12.1982, i.d.F. vom 24.04.2001 ist hier konträr: Art. 6
LStVG definiert als Sicherheitsbehörden nur die allgemeinen Ordnungsbehörden der unmittelbaren Verwaltung
(Gemeinde, Landrat, Bezirksregierung, bayerisches Staatsministerium des Inneren). Diese so gezogene Definition
zielt jedoch einerseits darauf ab, in einer darauf aufbauenden Rechtskonstruktion unter anderem auf das
Kompetenzverhältnis zwischen den (Landes–)Behörden unmittelbarer Verwaltung und der Landespolizei zu
verweisen. Zum anderen ist sie eine bayerische Besonderheit, und daher im Rahmen dieser Arbeit wenig
brauchbar. Insofern zutreffend HIRSCH: Kontrolle der Nachrichtendienste, 1996, S. 22 Fn. 10.
[20] Vgl. ebd., S. 26.
[21] Vgl. ebd..
[22] So auch die weit überwiegende Ansicht im Schrifttum, jedoch vorzugsweise mit der mangelnden
organisatorischen Selbstständigkeit dieser Organisationen begründet. Da jedoch auch der MAD
organisatorisch vom Bundesministerium der Verteidigung abhängig ist, ist eine solche Argumentation
anzuzweifeln. Das Ergebnis einer Prüfung bliebe jedoch gleich, darum soll die Fragestellung im Zuge
vorliegender Arbeit nicht vertieft werden. Beispielhaft etwa die Argumentation bei HAEDGE: Das neue
Nachrichtendienstrecht, 1998, S. 231 ff. m.w.N. (Fn. 13) sowie bei HIRSCH: Kontrolle der Nachrichtendienste,
1996, S. 28.
[23] Nur Nachrichtendienste dürfen nachrichtendienstliche Mittel anwenden. Diese banale Aussage verdeutlicht jedoch,
dass beispielsweise der Einsatz von V-Leuten oder die Durchführung von Observationen durch die Polizei eine
andere gesetzliche Grundlage hat. Sie wendet hier keine nachrichtendienstlichen, sondern polizeirechtlichen
Mittel an.
[24] Beispielhafte Aufzählung in § 8 Abs. 2 des „Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz“ (BVerfSchG);
BGBl I, S. 682 vom 27.09.2950, i.d.F. vom 26.06.2005. Andere Dienstgesetze verweisen auf diese Norm.
[25] Synonym werden in vorliegender Arbeit „strategische Aufklärung“, „strategisch Überwachung“, „strategische
Maßnahmen“ und weitere Abwandlungen verwendet.
[26] Durch das „Gesetz zur Beschränkung des Brief–, Post– und Fernmeldegeheimnisses“ (Artikel 10 - Gesetz – G 10);
BGBl I, S. 949 vom 13.08.1968, i.d.F. vom 11.02.2005.
[27] Vgl. VOLKMANN, UWE: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaats, in: Juristenzeitung (JZ) 14 / 2004, S. 696, der die
Rezeption von „Rechtsstaat“ als „variable[n] und deutungsoffene[n] Begriff“ anmahnt.
[28] HOFFMANN-RIEM, WOLFGANG: Freiheit und Sicherheit im Angesicht terroristischer Anschläge, in:
Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 12 / 2002, S. 498.
[29] Insbesondere Thomas Hobbes im „Leviathan“ (1651), John Locke in den „Two Treaties of Government“ (1690) und
Jean-Jacques Rousseau im „Contrat Social“ (1762) in jeweils unterschiedlichen Akzentuierungen. Vgl. dazu die
kurze Darstellung von KERSTING, WOLFGANG: Vertragstheorien, in: Dieter Nohlen, Rainer-Olaf Schultze
(Hrsg.), Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe, München 2002, S. 1043 ff. [Bd. 2].
[30] Gemeint war vor allem die physische Gewalt, wie sie im Mittelalter vorherrschend war.
[31] Vgl. CALLIESS, CHRISTIAN: Sicherheit im freiheitlichen Rechtsstaat. Eine verfassungsrechtliche Gratwanderung
mit staatstheoretischem Kompass, in: Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1 / 2002, S. 3 sowie HOFFMANN-RIEM:
Freiheit und Sicherheit, ZRP 12 / 2002, S. 497.
[32] VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 697.
[33] ALBRECHT, PETER-ALEXIS: Grenzen „geheimer Verbrechensbekämpfung“? Die G 10 – Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfGE 100, 313 ff.), in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft (KritV) 3 – 4 / 2003, S. 274; aus historischer Sicht vgl. MÜLLER, HELMUT: Schlaglichter der
deutschen Geschichte, Bonn 2003 [Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 402], S. 114 ff..
[34] SCHMITT, CARL: Verfassungslehre, Berlin 1928 [8. Neuauflage 1993], S. 126.
[35] So aber VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 697.
[36] Eine kurze Skizzierung nimmt ALBRECHT: Grenzen „geheimer Verbrechensbekämpfung“,
KritV 3-4 / 2003, S. 276 f. vor.
[37] Durch den Arbeiterführer Ferdinand Lassalle im 19. Jahrhundert geprägtes, wenig schmeichelhaft gemeintes
Bonmot.
[38] Aus historischer Sicht MÜLLER: Schlaglichter der deutschen Geschichte, 2003, S. 168 ff..
[39] Vgl. ebd., S. 193 f..
[40] BVerfGE 7,198 vom 15.01.1958.
[41] VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 698.
[42] In diesem Sinne vgl. auch ebd., S. 698 f..
[43] Ebd., S. 699. Höchstrichterliche Beispiele: Mannigfache staatliche Aktivierungspflichten etwa aus BVerfGE 39,1
(Schwangerschaftsabbruch) oder auch aus BVerfGE 46,160 („Schleyer-Urteil“) u.v.m..
[44] In diesem Sinne auch bei der von ihm erwünschten Risikosteuerung SCHWARZ, KYRILL: Die Dogmatik der
Grundrechte – Schutz und Abwehr im freiheitssichernden Staat, in: Ulrich Blaschke / Achim Förster u.a. (Hrsg.),
Sicherheit statt Freiheit? Staatliche Handlungsspielräume in extremen Gefährdungslagen, Berlin 2005, S. 31
[Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 1002].
[45] Vgl. VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 700 sowie der Grundtenor bei
ROELLECKE: Der Rechtsstaat im Kampf gegen den Terror, JZ 6 / 2006, S. 265 – 270 (Fn. 9).
[46] Zitiert nach DENNINGER, ERHARD: Thesen zur „Sicherheitsarchitektur“, insbesondere nach dem 11. September
2001, in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV) 3 / 2003, S. 314.
[47] Sehr treffend HETZER: Terrorabwehr im Rechtsstaat, ZRP 4 / 2005, S. 134 (Fn. 14).
[48] „Präemption“ (politikwissenschaftlicher Begriff aus den USA) wird betrieben, wenn durch eine zuvorkommende
staatliche Aktivität bereits der Entstehung von Risiken, und eben nicht dem Risiko an sich entgegengewirkt werden
soll (Beispiel: Amerikanischer Angriffskrieg gegen den Irak, um gar nicht erst in die Gefahr zu kommen, mit
irakischen Atomwaffen konfrontiert zu werden).
[49] Vgl. HETZER: Terrorabwehr im Rechtsstaat, ZRP 4 / 2005, S. 134.
[50] VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 700.
[51] Grundsätzlich dazu ISENSEE, JOSEF: Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen
Verfassungsstaates, Berlin 1982 [Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft e.V., Heft 79]; am Beispiel des
Umweltrechts festmachend und aktueller CALLIESS, CHRISTIAN: Rechtsstaat und Umweltstaat. Zugleich ein
Beitrag zur Grundrechtsdogmatik im Rahmen mehrpoliger Verfassungsrechtsverhältnisse, Habil., Saarbrücken
2000, S. 321 ff. sowie S. 443 ff..
[52] Nur am Rande erwähnt werden soll, dass dieses Instrument oftmals zu starr ist, daher im zunehmenden Maße ein
Ausweichen auf nichtimperative Steuerungstechniken stattfindet („aktivierender Staat“, „net-working“), dabei auch
auf die Stärkung von Kontrollinstanzen abgestellt wird. Vgl. dazu VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des
Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 700.
[53] Eine Vielzahl weiterer Beispiele ebd., S. 700 f..
[54] Vgl. DENNINGER: Freiheit durch Sicherheit, 2002, S. 114 ff. (Fn. 15).
[55] Noch aktueller, aber auf das Polizeirecht bezogen die Klage bei ROELLECKE: Der Rechtsstaat im Kampf gegen
den Terror, JZ 6 / 2006, S. 265 ff..
[56] Dazu vgl. umfassend CALLIESS: Rechtsstaat und Umweltstaat, 2000.
[57] BRAUM, STEFAN: Erosionen der Menschenwürde – Auf dem Weg zur Bundesfolterordnung (BFO)?, in:
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV) 3 / 2005, S. 283.
[58] Lediglich ROELLECKE: Der Rechtsstaat im Kampf gegen den Terror, JZ 6 / 2006, S. 265 ff. erkennt diese
Beschränkung wenigstens implizit an.
[59] BRAUM: Erosionen der Menschenwürde, KritV 3 / 2005, S. 285.
[60] Gerade dieses Konfliktfeld ist für die ND sehr bedeutsam. Zur gestiegenen Bedeutung von „Information“ für die ND
vgl. auch WIECK, HANS-GEORG: Demokratie und Geheimdienste, Eichstätt 1995
[Otto-von-Freising-Vorlesungen der Katholischen Universität Eichstätt, Bd. 11], S. 3 ff..
[61] In diesem Sinne auch VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 702 (Fn. 22) sowie
HETZER: Terrorabwehr im Rechtsstaat, ZRP 4 / 2005, S. 133 (Fn. 14).
[62] Vgl. CALLIESS: Sicherheit im freiheitlichen Rechtsstaat, ZRP 1 / 2002, S. 2 (Fn. 31) sowie die Klage von
BRAUM: Erosionen der Menschenwürde, KritV 3 / 2005, S. 285, wonach der Kampf gegen Risiken von
„mangelnder Definition“ bleibe.
[63] DÜX: Globale Sicherheitsgesetze, ZRP 6 / 2003, S. 189 (Fn. 4).
[64] Vgl. BORGS-MACIEJEWSKI, HERMANN: Vertrauensbildung durch Kontrolle der Polizei und der
Geheimdienste, in: Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2 / 2006, S. 41 ff..
[65] MERTIN, HERBERT: Abbau von Freiheitsrechten – Der Rechtsstaat in Gefahr, in:
Zeitschrift Recht und Politik 3 / 2005, S. 149 mit einer Fülle weiterer Beispiele.
[66] Ebd., S. 148.
[67] Ebd., S. 150.
[68] BRAUM: Erosionen der Menschenwürde, KritV 3 / 2005, S. 283 (Fn. 57).
[69] Vgl. HETZER: Terrorabwehr im Rechtsstaat, ZRP 4 / 2005, S. 134 (Fn. 14).
[70] So auch VOLKMANN: Sicherheit und Risiko des Rechtsstaates, JZ 14 / 2004, S. 702 (Fn. 22).
[71] FRISCH: Der politische Islamismus, 2005, S. 25 (Fn. 6).
[72] Hannah Arendt bereits 1960, zitiert nach SCHWARZ: Die Dogmatik der Grundrechte, 2005, S. 29 (Fn. 44).
[73] So im Ansatz auch DENNINGER: Thesen zur „Sicherheitsarchitektur“, KritV 3 / 2003, S. 318 (Fn. 46).
[74] Zum Umweltrecht vgl. die detaillierte Darstellung bei CALLIESS: Rechtsstaat und Umweltstaat, 2000 (Fn. 51).
[75] „Gesetz über den Bundesnachrichtendienst“ (BND-Gesetz – BNDG); BGBl I, S. 2954 vom 20.12.1990.
[76] Zur vollen Gesetzeszitierung siehe Fn. 26.
[77] „Eigensicherung“ richtet sich auf die Sicherung gegen Angriffe auf Dienststellen und Beamte des BND selbst
(Beispiel: Aufklärung gegen einen BND-Beamten, der mutmaßlich Doppelagent ist).
[78] „Eigensichernde Spionageabwehr“ richtet sich gegen Spionage und Sabotage durch fremde Mächte oder feindlich
gesonnene Einzelpersonen gegen Dienststellen, Einrichtungen und Beamte des BND selbst.
[79] „Lauschangriffe“ sind unter Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung zustande gekommene Abhörmaßnahmen
(etwa durch Verwanzen der Wohnung oder des Telefonapparates).
[80] Zur vollen Gesetzeszitierung siehe Fn. 24.
[81] Vgl. Grundsätzliches zum Verfassungsschutzes BRENNER, MICHAEL: Abgeordnetenstatus und
Verfassungsschutz, in: Michael Brenner / Peter M. Huber / Markus Möstl (Hrsg.), Der Staat des Grundgesetzes –
Kontinuität und Wandel, Tübingen 2004, S. 37 [Festschrift für Peter Bandura zum siebzigsten Geburtstag] sowie in
Kürze FRISCH, PETER: Verfassungsschutz und innere Sicherheit, in: Waldemar Schreckenberger (Hrsg.),
Staatliche Kommunikation und Sicherheit. Vorträge von Staatssekretären und Präsidenten von Sicherheitsbehörden
des Bundes nebst einer Abhandlung über die Nachrichtendienste im Zeitalter der Globalisierung, Speyer 1999, S. 71
[Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Speyerer Arbeitshefte 113].
[82] „Gesetz über den Militärischen Abschirmdienst“ (MAD-Gesetz – MADG); BGBl I, S. 2977 vom 20.12.1990.
[83] Insbesondere: Verhaftung, Vernehmung, Anwendung von Zwangsmaßnahmen etc..
[84] Solche Beschränkungen finden sich in allen Dienstgesetzen: § 3 Abs. 3 BVerfSchG; § 2 Abs. 4 BNDG;
§ 1 Abs. 4 MADG.
[85] NEHM, KAY: Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot und die neue Sicherheitsarchitektur, in: Neue Juristische
Wochenschrift (NJW) 46 / 2004, S. 3289.
[86] Vgl. ebd..
[87] GUSY, CHRISTOPH: Polizei und ND im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität, MS 1994, S. 3, zitiert nach
MÜLLER-TERPITZ, RALF: Die „strategische Kontrolle“ des internationalen Telekommunikationsverkehrs durch
den Bundesnachrichtendienst, in: JURA 6 / 2000, S. 296.
[88] Summarisch, aber sehr an Detailfragen aufgehängt GÖSSNER, ROLF: Da wächst zusammen, was nicht
zusammengehört. Die Verzahnung von Polizei und Geheimdiensten, in: Rolf Gössner (Hrsg.), Mythos Sicherheit.
Der hilflose Schrei nach dem starken Staat, Baden-Baden 1995, S. 203 ff..
[89] Vgl. das Fazit von DORN, ALEXANDER: Das Trennungsgebot in verfassungshistorischer Perspektive. Zur
Aufnahme inlandsnachrichtendienstlicher Bundeskompetenzen in das Grundgesetz vom 23. Mai 1949, Diss. jur.,
Frankfurt am Main 2004 [Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 967], S. 191 ff..
[90] Zusammenfassend NEHM: Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot, NJW 46 / 2004, S. 3290 f. m.w.N. (Fn. 85).
[91] „III. Abhörentscheidung“ vom 14.07.1999 zu erweiterten strategischen Aufklärungsbefugnissen des BND.
[92] Vom 28.01.1998 zu Befugniserweiterungen des damaligen Bundesgrenzschutzes.
[93] NEHM: Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot, NJW 46 / 2004, S. 3291.
[94] So auch DORN: Das Trennungsgebot in verfassungshistorischer Perspektive, 2004, S. 192.
[95] Der sprachunübliche Gebrauch des Plurals „Polizeien“ soll die föderale Sicherheitsarchitektur mit ihrer
Existenz getrennter Landes– und Bundesorganisationen verdeutlichen.
[96] Vgl. NEHM: Das nachrichtendienstliche Trennungsgebot, NJW 46 / 2004, S. 3292 sowie GÖSSNER: Verzahnung
von Polizei und Geheimdiensten, 1995, S. 200 fast bedauernd: „Das Trennungsgebot sei nicht mehr nur historisch
herzuleiten“.
[97] Bereits BRENNER, MICHAEL: Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat. Zwischen geheimdienstlicher Effizienz
und rechtsstaatlicher Kontrolle, Diss. jur., Baden-Baden 1990 [Nomos Universitätsschriften Recht, Bd. 34], S. 53
diese Auffassung vertretend.
[98] „Halbdurchlässig“; in der neueren Literatur vereinzelt verwendeter Begriff.
[99] Vgl. aber die gute Darstellung bei BULL, HANS-PETER: Polizeiliche und nachrichtendienstliche Befugnisse zur
Verdachtsgewinnung, o.O. 2004, in: Datenschutz, Informationsrecht und Rechtspolitik. Gesammelte Aufsätze,
Berlin 2005, S. 296 ff. [Beiträge zum Informationsrecht, Bd. 16]; vgl. auch PAEFFGEN, HANS-ULRICH /
GÄRDITZ, KLAUS: Die föderale Seite des „Trennungsgebotes“ oder: Art. 87 III, 73 GG und das G 10 – Urteil, in:
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV) 1 / 2000, S. 65 ff. sowie
ROGGAN, FREDRIK: Über das Verschwimmen von Grenzen zwischen Polizei- und Strafprozessrecht – Ein
Beitrag zur rechtspolitischen Diskussion, in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft (KritV) 3 / 1998, S. 336 ff..
[100] Generalleutnant Reinhard Gehlen war Chef der früheren Wehrmacht-Nachrichtenabteilung „fremde Heere Ost“.
Er diente die vorhandene Infrastruktur nach Ende des Zweiten Weltkrieges als Auslandsnachrichtendienst gegen die
sowjetische Bedrohung an. Einen Überblick über die Geschichte der „Organisation Gehlen“ gibt BRENNER:
Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, S. 3 ff. sowie mit Fokus auf die Legitimation des BND durch die
„wehrhafte Demokratie“ HAEDGE: Das neue Nachrichtendienstrecht, 1998, S. 201 ff. (Fn. 13).
[101] Vgl. HAEDGE: Das neue Nachrichtendienstrecht, 1998, S. 212.
[102] Vgl. DORN: Das Trennungsgebot in verfassungshistorischer Perspektive, 2004, S. 191 ff. (Fn. 89).
[103] Auslegung wiederholt bestätigt durch das Bundesverfassungsgericht, zuletzt BVerfGE 100,313 (368 f.) vom
14.07.1999.
[104] Zeitgenössisch wurde die untergesetzliche Regelung sehr kritisch gesehen, alleine schon wegen der bestehenden
Rechtsunsicherheit für den Dienst selbst; umfassend dazu BRENNER: Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat,
1990; kürzer BEIER, EGBERT: Geheime Überwachungsmaßnahmen zu Staatssicherheitszwecken außerhalb des
Gesetzes zur Beschränkung von Art. 10 GG (G 10) unter besonderer Berücksichtigung völkerrechtlicher Aspekte
sowie einer rechtsvergleichenden Betrachtung mit den Vereinigten Staaten von Amerika, Diss. jur., Berlin 1988
[Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 531], S. 63 ff.; Datenschutzbedenken vor allem bei KAUß, UDO:
Der suspendierte Datenschutz bei Polizei und Geheimdiensten, Frankfurt am Main 1989.
[105] BVerfGE 65,1 vom 15.12.1983.
[106] Vgl. WIECK: Demokratie und Geheimdienste, 1995, S. 25 ff. (Fn. 60).
[107] So BRENNER: Bundesnachrichtendienst im Rechtsstaat, 1990, S. 76 und noch HAEDGE: Das neue
Nachrichtendienstrecht, 1998, S. 214 (Fn. 13). Die Dienstanweisung selbst wird nach BT-Drucks. 7 / 3246, S. 47
zitiert.
[108] Vgl. Fn. 95.
[109] Vgl. WIECK: Demokratie und Geheimdienste, 1995, S. 25 ff..
- Arbeit zitieren
- Alexander Pillris (Autor:in), 2006, Zwischen Bürgerrechten und Risikovorsorge. Wann ist das Eingreifen des Staates richtig?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64111
Kostenlos Autor werden



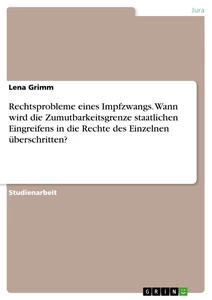
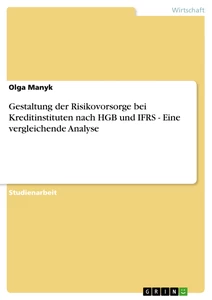


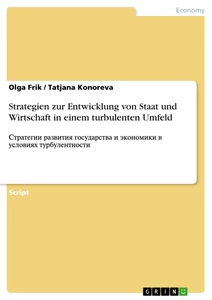














Kommentare