Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Spezifische Aspekte zum Selbstkonzept, zur Motivation und zur Aqua – Fitness
2.1 Selbstkonzept
2.1.1 Kennzeichen des Selbstkonzepts
2.1.1.1 Definition und Entstehung des Selbstkonzepts
2.1.1.2 Nutzen des Selbstkonzepts
2.1.1.3 Erfassung des Selbstkonzepts
2.1.1.4 Ausgewählte Studien zum Selbstkonzept
2.1.2 Kennzeichen des Körperkonzepts
2.1.2.1 Definition des Körperkonzepts
2.1.2.2 Das Körperkonzept im Wandel der Zeit
2.1.2.3 Körperkonzept und Sport
2.1.2.3.1 Körperwahrnehmung und Schwimmen.
2.1.2.3.2 Ausgewählte Studien zum Körperkonzept
2.2 Motivationale Aspekte
2.2.1 Kennzeichen von Motiven
2.2.1.1 Motiv und Motivation
2.2.1.2 Prozessmodell der Motivation
2.2.1.3 Motiventwicklung
2.2.1.4 Extrinsische und intrinsische Motivation
2.2.2 Motive und Motivation im Sport
2.2.2.1 Klassifizierung von Motiven im Sport
2.2.2.2 Ausgewählte Studien zur Motivation im Sport
2.3 Aqua-Fitness
2.3.1 Definition von Aqua-Fitness
2.3.1.1 Varianten der Aqua-Fitness
2.3.1.2 Trainingsbedingungen für die Durchführung von Aqua-Fitness
2.3.1.2.1 Das Schwimmbecken.
2.3.1.2.2 Die Wassertemperatur
2.3.1.2.3 Der Aqua-Trainer
2.3.1.2.4 Die Übungsausführung.
2.3.2 Grundlagen der Bewegung im Wasser
2.3.2.1 Physikalische Eigenschaften des Wassers
2.3.2.1.1 Der Auftrieb.
2.3.2.1.2 Der Wasserwiderstand.
2.3.2.1.3 Der Wasserdruck.
2.3.2.1.4 Die Wärmeleitfähigkeit
2.3.2.2 Gesundheitliche Auswirkungen von Aqua-Fitness
2.3.2.2.1 Allgemeine Effekte.
2.3.2.2.2 Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System...
2.3.2.2.3 Auswirkungen auf Stoffwechsel und Atmung.
2.3.2.2.4 Auswirkungen auf den Stütz- und Bewegungsapparat
2.3.3 Einsatzmöglichkeiten von Aqua-Fitness
2.3.3.1 Aqua-Fitness im Leistungssport
2.3.3.2 Aqua-Fitness in der Rehabilitation
2.3.3.3 Indikationen und Kontraindikationen für Aqua-Fitness
2.3.3.4 Aqua-Fitness mit speziellen Zielgruppen
2.3.4 Konzeption einer Aqua-Fitness-Kursstunde
3 Methodik
3.1 Untersuchungsverfahren
3.2 Untersuchungspersonen
3.2.1 Gesamtgruppe
3.2.2 Weibliche und männliche Aqua-Fitness-Teilnehmer
3.2.3 Jüngere und ältere Aqua-Fitness-Teilnehmer
3.3 Untersuchungsdurchführung
3.3.1 Zeitlicher Verlauf
3.3.2 Auswahl der Stichprobe
3.4 Untersuchungsauswertung
3.5 Spezifische Fragestellungen
4 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
4.1 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse zum Selbstkonzept
4.1.1 Das Selbstkonzept in der Gesamtgruppe
4.1.2 Vergleich des Selbstkonzepts zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
4.1.3 Vergleich des Selbstkonzepts zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
4.2 Darstellung und Diskussion der motivationalen Aspekte
4.2.1 Motivationale Aspekte zur Aqua-Fitness in der Gesamtgruppe
4.2.2 Vergleich der motivationalen Aspekte zur Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmern
4.2.3 Vergleich der motivationalen Aspekte zur Aqua-Fitness zwischen jüngeren und älteren Teilnehmern
4.3 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse zu speziellen Aspekten des Aqua-Fitness-Trainings
4.3.1 Spezielle Aspekte zum Aqua-Fitness-Training in der Gesamtgruppe
4.3.2 Vergleich der speziellen Aspekte zum Aqua-Fitness-Training zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmern
4.3.3 Vergleich der speziellen Aspekte zum Aqua-Fitness-Training zwischen jüngeren und älteren Teilnehmern
5 Zusammenfassung
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang
Tabellenverzeichnis
Tab. 2. 1 Frankfurter Selbstkonzeptskalen
Tab. 2. 2 Frankfurter Körperkonzeptskalen
Tab. 2. 3 Merkmale zur Klassifizierung von Motiven im Sport
Tab. 2. 4 Klassifizierung und Vielfalt der Motive im Sport
Tab. 2. 5 Dreigeteilte Motivstrukturierung nach dem Gesichtspunkt der Sportspezifität
Tab. 2. 6 Indikationen und Kontraindikationen zur Aqua-Fitness
Tab. 2. 7 Aufbau einer Aqua-Fitness-Kursstunde
Tab. 3. 1 BMI-Kategorien
Tab. 4. 1 Darstellung der Angaben zum Selbstkonzept in der Gesamtgruppe
Tab. 4. 2 Darstellung der Veränderungen des Selbstkonzepts durch Aqua-Fitness in der Gesamtgruppe
Tab. 4. 3 Vergleich des Selbstkonzepts zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Tab. 4. 4 Vergleich der Veränderungen des Selbstkonzepts durch Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Tab. 4. 5 Vergleich des Selbstkonzepts zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness- Teilnehmern
Tab. 4. 6 Vergleich der Veränderungen des Selbstkonzepts durch Aqua-Fitness zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Tab. 4. 7 Motivationale Aspekte im Aqua-Fitness
Tab. 4. 8 Vergleich der motivationalen Aspekte im Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Tab. 4. 9 Vergleich der motivationalen Aspekte im Aqua-Fitness zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2. 1 Beispiel eines hierarchischen Selbstkonzeptmodells
Abb. 2. 2 Schematische Darstellung der vier Handlungsphasen des Rubikon-Modells
Abb. 2. 3 Die Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow
Abb. 2. 4 Hierarchie der Motivgruppen aufgrund relativer Vorrangigkeit in der Bedürfnis-befriedigung nach Maslow
Abb. 2. 5 Bälle
Abb. 2. 6 Manschetten
Abb. 2. 7 Schwimmnudeln
Abb. 2. 8 Schwimmbretter
Abb. 2. 9 Sprosse
Abb. 2. 10 Auftriebsgürtel
Abb. 3. 1 Untersuchungspersonen
Abb. 3. 2 Untersuchungspersonen
Abb. 3. 3 Häufigkeitsverteilung des Faktors Geschlecht
Abb. 3. 4 Häufigkeitsverteilung des Faktors Alter bei der untersuchten Personengruppe
Abb. 3. 5 Häufigkeitsverteilung der BMI-Kategorien
Abb. 3. 6 Prozentuale Verteilung der Wohnortverhältnisse
Abb. 3. 7 Häufigkeitsverteilung des Familienstandes
Abb. 3. 8 Anzahl der Kinder der Untersuchungspersonen
Abb. 3. 9 Häufigkeitsverteilung des höchsten Bildungsabschlusses
Abb. 3. 10 Häufigkeitsverteilung der momentanen Tätigkeit
Abb. 3. 11 Vorliegen einer Behinderung
Abb. 3. 12 Ursache der Behinderung
Abb. 3. 13 Häufigkeitsverteilung der bisherigen Aqua-Fitness-Kursteilnahmen
Abb. 3. 14 Wie sind Sie auf Aqua-Fitness aufmerksam geworden
Abb. 3. 15 Mit wem kommen Sie (zumeist) zum Aqua-Fitness-Kurs
Abb. 3. 16 Angaben zu Sportarten, die neben der Aqua-Fitness noch ausgeübt werden
Abb. 3. 17 Angaben zur Häufigkeit der sportlichen Aktivität innerhalb einer Woche
Abb. 3. 18 Prozentuale Verteilung des Faktors Alter der weiblichen und männlichen Aqua- Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 19 Prozentuale Verteilung der BMI-Kategorien der weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 20 Prozentuale Verteilung des Familienstandes der weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 21 Anzahl der Kinder der weiblichen und männlichen Untersuchungspersonen
Abb. 3. 22 Prozentuale Verteilung des höchsten Bildungsabschlusses der weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 23 Prozentuale Verteilung der momentanen Tätigkeit der weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 24 Prozentuale Verteilung der bisherigen Aqua-Fitness-Kursteilnahmen der weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 25 Wie sind die weiblichen und die männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer auf Aqua- Fitness aufmerksam geworden
Abb. 3. 26 Mit wem kommen die weiblichen und die männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer (zumeist) zum Aqua-Fitness-Kurs
Abb.3. 27 Prozentuale Angaben der sportlichen Aktivität innerhalb einer Woche der weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb.3. 28 Häufigkeitsverteilung der Anzahl der jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 29 Prozentuale Verteilung der BMI-Kategorien der jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 30 Prozentuale Verteilung des Familienstandes der jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 31 Anzahl der Kinder der jüngeren und älteren Untersuchungspersonen
Abb. 3. 32 Prozentuale Verteilung des höchsten Bildungsabschlusses der jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 33 Prozentuale Verteilung der momentanen Tätigkeit der jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 34 Prozentualer Vergleich des Vorliegens einer Behinderung bei jüngeren und älteren Untersuchungspersonen
Abb. 3. 35 Prozentuale Verteilung der bisherigen Aqua-Fitness-Kursteilnahmen der jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 3. 36 Wie sind die jüngeren und die älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer auf Aqua-Fitness aufmerksam geworden
Abb. 3. 37 Mit wem kommen die jüngeren und die älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer (zumeist) zum Aqua-Fitness-Kurs
Abb. 3. 38 Prozentuale Angaben der sportlichen Aktivität innerhalb einer Woche der jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer
Abb. 4. 1 Darstellung der Angaben zum Selbstkonzept in der Gesamtgruppe
Abb. 4. 2 Darstellung der Veränderungen des Selbstkonzepts durch Aqua-Fitness in der Gesamtgruppe
Abb. 4. 3 Welche gesundheitlichen Beschwerden liegen vor
Abb. 4. 4 Einschätzung der gesundheitlichen Beschwerden
Abb. 4. 5 Veränderungen der gesundheitlichen Beschwerden während und nach der Aqua- Fitness
Abb. 4. 6 Verbesserung der Beschwerden durch Aqua-Fitness
Abb. 4. 7 Auswirkungen auf Grund der Aqua-Fitness
Abb. 4. 8 Befinden nach der Aqua-Fitness
Abb. 4. 9 Vergleich des Selbstkonzepts zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 10 Vergleich der Veränderungen des Selbstkonzepts durch Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 11 Vergleich des Vorliegens von gesundheitlichen Beschwerden zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 12 Welche gesundheitlichen Beschwerden liegen bei den weiblichen und den männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern vor
Abb. 4. 13 Vergleich der Einschätzung der gesundheitlichen Beschwerden zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 14 Veränderungen der gesundheitlichen Beschwerden während und nach der Aqua-Fitness bei den weiblichen Kursteilnehmern
Abb. 4. 15 Veränderungen der gesundheitlichen Beschwerden während und nach der Aqua-Fitness bei den männlichen Kursteilnehmern
Abb. 4. 16 Vergleich der Verbesserung der Beschwerden durch Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 17 Vergleich der Auswirkungen auf Grund der Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 18 Vergleich des Befindens nach der Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 19 Vergleich des Selbstkonzepts zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness- Teilnehmern
Abb. 4. 20 Vergleich der Veränderungen des Selbstkonzepts durch Aqua-Fitness zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 21 Vergleich des Vorliegens von gesundheitlichen Beschwerden zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 22 Welche gesundheitlichen Beschwerden liegen bei den weiblichen und den männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern vor
Abb. 4. 23 Vergleich der Einschätzung der gesundheitlichen Beschwerden zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 24 Veränderungen der gesundheitlichen Beschwerden während und nach der Aqua-Fitness bei den jüngeren Kursteilnehmern
Abb. 4. 25 Veränderungen der gesundheitlichen Beschwerden während und nach der Aqua-Fitness bei den älteren Kursteilnehmern
Abb. 4. 26 Vergleich der Verbesserung der Beschwerden durch Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 27 Vergleich der Auswirkungen auf Grund der Aqua-Fitness zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 28 Vergleich des Befindens nach der Aqua-Fitness zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 29 Motivationale Aspekte im Aqua-Fitness
Abb. 4. 30 Prozentuale Verteilung der Gründe der Teilnahme am Aqua-Fitness-Kurs
Abb. 4. 31 Motivationale Aspekte zur sportlichen Aktivität
Abb. 4. 32 Vergleich der motivationalen Aspekte im Aqua-Fitness zwischen weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 33 Vergleich der Gründe der Teilnahme am Aqua-Fitness-Kurs von weiblichen und männlichen Teilnehmern
Abb. 4. 34 Werden die weiblichen und die männlichen Teilnehmer Aqua-Fitness in Zukunft fortführen
Abb. 4. 35 Vergleich der motivationalen Aspekte zur sportlichen Aktivität von weiblichen und männlichen Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 36 Vergleich der motivationalen Aspekte im Aqua-Fitness zwischen jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 37 Vergleich der Gründe der Teilnahme am Aqua-Fitness-Kurs von jüngeren und älteren Teilnehmern
Abb. 4. 38 Werden die jüngeren und die älteren Aqua-Fitness-Teilnehmer Aqua-Fitness in Zukunft fortführen
Abb. 4. 39 Vergleich der motivationalen Aspekte zur sportlichen Aktivität von jüngeren und älteren Aqua-Fitness-Teilnehmern
Abb. 4. 40 Häufigkeitsverteilung der Hilfsmittelpräferenz beim Aqua-Fitness-Training
Abb. 4. 41 Einschätzung der Belastung während dem Aqua-Fitness-Kurs
Abb. 4. 42 Prozentuale Verteilung der Hilfsmittelpräferenz der weiblichen und männlichen Teilnehmer beim Aqua-Fitness-Training
Abb. 4. 43 Einschätzung der Belastung während dem Aqua-Fitness-Kurs der weiblichen und männlichen Kursteilnehmer
Abb. 4. 44 Prozentuale Verteilung der Hilfsmittelpräferenz der jüngeren und älteren Kursteilnehmer beim Aqua-Fitness-Training
Abb. 4. 45 Einschätzung der Belastung während dem Aqua-Fitness-Kurs der jüngeren und älteren Kursteilnehmer
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
„Sportlich aktiv und körperlich fit zu sein, gilt allgemein als erstrebenswert“ (Schwarzer, 1996, S.202). Dafür sprechen zum einen die gesundheitlichen Vorteile und zum anderen das in unserer Gesellschaft vorherrschende Bild des attraktiven Menschen. Bewegung, bzw. Sport trägt zu einer positiveren Einstellung zum Körper und damit zu einem höheren Selbstwertgefühl bei. Weiterhin haben körperlich aktive Menschen seltener Übergewicht, sind weniger krank, leben länger und verzeichnen eine höhere Lebensqualität. Dennoch ist die Anzahl der regelmäßig Sporttreibenden in Deutschland relativ gering. Gut ein Drittel der deutschen Bevölkerung treibt überhaupt keinen Sport (Abele & Brehm, 1990, S.141; Schwarzer, 1996, S.202; Mrazek, 1991, S.244). Den Alltag verbringen heute die meisten Menschen sitzend am Schreibtisch, im Auto oder vor dem Fernseher. Dabei vernachlässigen wir unseren Körper. Für den menschlichen Körper kommt es zu einer immer bedrohlicher werdenden Gesamtsituation, welche sich aus Bewegungsmangel, ungesunder Ernährung, Rauchen, Alkohol, Umweltverschmutzung sowie dem immer größer werdenden psychosozialen Stress zusammensetzt. Ein Indiz dafür ist der dramatische Anstieg von Herz-Kreislauf-Leiden und Krebs-Erkrankungen. Mit etwa 46% sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland die häufigste Todesursache (Mrazek, 1991, S.244; Statistisches Bundesamt, 2005, S.6). Im Ergebnis der raschen Veränderung unserer Gesellschaft wird der Prävention, also der Krankheitsvorbeugung, ein immer höherer Stellenwert zugeordnet. Im Jahr 2000 wurden mit der Gesundheitsreform die Primärprävention und die betriebliche Gesundheitsförderung als finanzierte Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt. Dies ist festgeschrieben im §20 Sozialgesetzbuch (SGB) V Prävention und Selbsthilfe. Ziel der Primärprävention ist die Gesundheitsförderung und die Verhinderung der Krankheitsentstehung (MDS 2006). Die gesetzlichen Krankenkassen bieten ihren Mitgliedern inzwischen ein umfangreiches Präventionsangebot. Die Bereiche Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung und Entspannung, sowie Nichtrauchertraining bilden dabei die Schwerpunkte. Bis zu 80 % der Kursgebühren werden von den meisten Kassen übernommen. Voraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme an dem jeweiligen Präventionsprogramm (Köhler, 2005). Zu den speziellen Bewegungsangeboten der Krankenkassen gehören beispielsweise Nordic-Walking-Kurse, Rückenschulen und Aqua-Fitness-Kurse.[1]
In der vorliegenden Arbeit werden Probanden eines solchen Aqua-Fitness-Präventionskurses befragt. Es wird untersucht, inwieweit sich die Einstellung zum eigenen Körper durch Aqua-Fitness verändert und welche Motive für die Teilnahme an diesem 10-wöchigen Kurs ausschlaggebend sind.
Aqua-Fitness gilt allgemein als eine sehr gesunde Sportart, nicht zuletzt wegen der physikalischen Eigenschaften des Wassers. Die Entlastung der Wirbelsäule und Gelenke durch die Auftriebskraft sowie die erweiterten Bewegungsmöglichkeiten bei minimalem Verletzungsrisiko sprechen für sich. Durch Aqua-Fitness können sowohl die Beweglichkeit, als auch Ausdauer- und Kraftfähigkeiten verbessert werden. Ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen Aqua-Fitness zu einem Sport für jedermann (Köhler, 2005).
In der vorliegenden Arbeit erfolgt zunächst die theoretische Darstellung von spezifischen Aspekten des Selbstkonzepts. Anschließend werden Grundlagen zu motivationalen Aspekten herausgestellt. Daraufhin wird sich ausführlich der Aqua-Fitness gewidmet. Im Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen der Untersuchung aufgeführt. Die Ergebnisse dieser Studie werden im vierten Kapitel detailliert dargestellt und diskutiert.
2 Spezifische Aspekte zum Selbstkonzept, zur Motivation und zur Aqua – Fitness
„Unser Körper ist uns wichtig. Wir bearbeiten ihn mit Maschinen, hetzen durch kaputte Wälder und ernähren uns nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. In einer immer unübersichtlicheren und gefährdeteren Umwelt scheinen wir uns mehr und mehr auf uns selbst – unseren Körper zu konzentrieren“ (Mrazek & Rittner, 1986a, S.54).
Mit diesem Zitat stellen Mrazek & Rittner die Behauptung auf, dass das Interesse der Menschen an ihrem eigenen Körper zunimmt. Woher kommt diese verstärkte Konzentration auf uns selbst und welche Motive sind für die sportliche Aktivität entscheidend? Dies sollen Inhalte des folgenden Kapitels sein.
2.1 Selbstkonzept
Folgend wird zunächst ein theoretischer Überblick über die Kennzeichen des Selbstkonzepts gegeben. Anschließend wird das Körperkonzept charakterisiert. In diesem Abschnitt stehen die Definition und Entstehung, der Nutzen sowie die Messung von Selbstkonzepten im Vordergrund. Abschließend werden einige ausgewählte Studien zum Selbstkonzept vorgestellt.
2.1.1 Kennzeichen des Selbstkonzepts
In der langen Geschichte der Selbstkonzeptforschung, welche bis zur frühen griechischen Philosophie reicht, existiert bislang keine allgemein anerkannte Theorie des Selbstkonzepts (Deusinger, 1986, S.11; Mrazek, 1984a, S.108). Selbstkonzept ist ein Begriff, der von den Forschern nicht einheitlich definiert wird. Es gibt in der Literatur mittlerweile eine große Zahl von Vorstellungen darüber, wie Selbstkonzepte strukturiert sind und welche Funktionen sie für das Individuum besitzen. Es bestehen neben dem Begriff Selbstkonzept noch weitere Bezeichnungen, wie „Selbstwahrnehmung, Selbstbild, Selbstevaluation, etc. – ohne klare Abgrenzung dieser voneinander.“ Im Verlauf dieser Arbeit werden diese Begriffe daher synonym verwendet, denn sie beziehen sich im Grunde alle auf „mehr oder weniger überdauernde, selbstbezogene Kognitionen“ (Spiel, 1994, S.150f.).
2.1.1.1 Definition und Entstehung des Selbstkonzepts
Der Begriff „self-concept“ wurde ursprünglich von Victor Raimy im Jahre 1943 eingeführt (Neubauer, 1976, S.37). Unter dem Selbstkonzept wird von verschiedenen Autoren weitgehend übereinstimmend „die kognitive Repräsentation der eigenen Person“ oder anders, „die Einstellung gegenüber der eigenen Person“ verstanden (Deusinger, 1986, S.11; 1996, S.88f.; Neubauer, 1976, S.36f.; Mrazek, 1984a, S.108; Mummendey, 1995, S.56). So stellt auch Epstein (1984, S.42) das Selbstkonzept als eine so genannte Selbsttheorie dar, die der Organisation von Erfahrungen, der Herstellung eines günstigen Verhältnisses von Lust- und Unlusterlebnissen und der Etablierung eines zufrieden stellenden Maßes an Selbstwertschätzung dient. Unter dem Selbstkonzept einer Person lässt sich weiterhin „die Gesamtheit selbstbezogener Beurteilungen“ bzw. „die Gesamtheit der Merkmale, die man der eigenen Person zuschreibt“ verstehen. Hierzu zählen Beurteilungen über körperliche als auch psychische Merkmale sowie Merkmale aus der Vergangenheit, Merkmale, die sich eine Person gegenwärtig zuschreibt oder Merkmale, die von einer Person als in der Zukunft erstrebenswert angesehen werden (Mummendey, 1988, S.73; Mummendey & Mielke 1989, S.33; Mummendey, 1995, S.55, S.71). Nach Neubauer (1976, S.36) umfasst das Selbstkonzept weiterhin alle gespeicherten Informationen über den eigenen Körper, eigene Fähigkeiten und Kenntnisse sowie über eigene Besitztümer, Verhaltensweisen und Interaktionspartner. Auch Deusinger (1986, S.11; 1996, S.88f; 1998, S.16) fasst das Selbstkonzept als ein multidimensionales Konzept auf, denn es bezeichnet die individuellen Ansichten des Menschen über jedes wesentliche Merkmal der eigenen Person, wie beispielsweise Erfahrungen und Einschätzungen eigener Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, Wünsche, Gefühle, Stimmungen, Wertschätzungen und Handlungen. Weiterhin umschreiben Selbstkonzepte auch die individuellen Auffassungen der Person zum eigenen Körper. Nach Baumann (1993, S.310) besteht das Selbstkonzept aus kognitiven und affektiven Anteilen. Dabei enthält der kognitive Anteil all das, was man über sich selbst weiß, der affektive Anteil besteht aus den gefühls- und stimmungsmäßigen Einstellungen, wie z.B. der Zufriedenheit mit sich selbst, dem Gefühl der Unsicherheit oder Überlegenheit.
Pörzgen (1993, S.17) definiert das Selbstkonzept als das „Insgesamt der relativ stabilen und subjektiv relevanten selbstbezogenen Meinungen einer Person“. Nach Pörzgen (1993, S.21) lassen sich im Prozess der Selbstkonzeptbildung schematisch zwei verschiedene voneinander abhängige Phasen unterscheiden, die Datenerhebungsphase und eine Validierungsphase. Die Datenerhebung kann beispielsweise durch Beobachtungen von Verhaltensweisen oder aber auch im Anschluss an Entscheidungen erfolgen, die Validierungsphase beinhaltet zum Beispiel das „Aushandeln von Identitäten“. Nach Witte & Linnewedel (1993, S.30) wird die Struktur des Selbstkonzepts durch drei Arten von Selbstbildern beschrieben. Sie unterscheiden das kognitive, das affektive und das konative Selbstbild. Das kognitive Selbstbild besteht aus den Eigenschaften und Merkmalen, die man sich selber zuschreibt. Das affektive Selbstbild bezieht sich auf die Bewertung der kognitiven und konativen Elemente des Selbstbildes. Das konative Selbstbild beinhaltet die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Witte (1993, S.12) nimmt an, dass Menschen generell ein positives Selbstwertgefühl anstreben. Die eben genannten Ansätze oder Interpretationen des Selbstkonzepts haben gemeinsam, dass sie Selbstkonzepte als „vielfältig strukturierte kognitive Systeme“ auffassen, die erheblichen Einfluss auf unser Verhalten haben (Alfermann, 1998, S.212; Mrazek & Hartmann, 1989, S.218; Mummendey, 1995, S.59).
Mummendey (1995, S.62) betrachtet das Selbstkonzept als ein hierarchisches System, welches in das körperbezogene, das emotionale, das leistungsbezogene und das soziale Selbstkonzept untergliedert werden kann. Das körperbezogene Selbstkonzept wird weiter unterteilt in das die Gesundheit und das die äußere Erscheinung betreffende Selbstkonzept. Das leistungsbezogene Selbstbild umfasst Selbstkonzepte in Bezug auf die schulischen, sportlichen und künstlerischen Leistungen. Diese können weiter in Selbstkonzepte zu einzelnen Handlungen oder Fertigkeiten ausdifferenziert werden. Nach Mummendey (1995, S.62) ergibt sich aus den Beziehungen zu Eltern, Freunden und anderen Personen das soziale Selbstkonzept. Die folgende Abbildung verdeutlicht Mummendeys hierarchisches Selbstkonzeptmodell.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2. 1 Beispiel eines hierarchischen Selbstkonzeptmodells (Mummendey, 1995, S.62).
Selbstkonzepte können mehr oder weniger generell unterschiedliche Situationen (z.B. Zeitpunkte, Umgebung) oder Gegenstandsbereiche (z.B. die eigene Leistung) umfassen (Mummendey, 1981, S.6; 1995, S.60). Deusinger (1996, S.89) geht davon aus, dass es für die einzelne Person verschiedene Selbstkonzepte gibt die miteinander in Wechselbeziehung stehen. Die Struktur von Selbstkonzepten ist nach Spiel (1994, S.155) von der kognitiven Entwicklung abhängig. So wird mit zunehmendem Alter eine größere Anzahl von Selbstkonzeptbereichen unterschieden. Es wird davon ausgegangen, dass Selbstkonzepte gelernt werden und sich im Laufe der Sozialisation, vor allem in der Interaktion mit anderen Personen, entwickeln. So spiegeln Selbstkonzepte die individuellen Unterschiede der erfahrenen Umwelt wider (Alfermann, 1998, S.212; Deusinger, 1986, S.13; 1996, S.89; Sygusch, 2000, S.40). Das Finden einer eigenen Identität zählt zu den zentralen Aufgaben der Entwicklung im Jugendalter. Das Bild von der eigenen Person festigt sich mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter und beeinflusst nachhaltig den gesamten Lebensweg, wie etwa bestimmte Interessen sowie die Berufs- und die Partnerwahl.
Die Selbstkonzepte bilden ein organisiertes, stabiles aber nicht starres Konzept des Individuums zur eigenen Person. Sie werden als etwas „Überdauerndes, Stabiles, Situationsübergreifendes“ aufgefasst (Mummendey, 1995, S.190). Selbstkonzepte sind nach Gergen in hohem Maße durch Umweltschwankungen beeinflussbar. Sie werden vor allem über Prozesse der Selbstbeobachtung aufgebaut (Gergen, 1984, S.79, S.86). Diese Informationen über die eigene Person, speichern die Menschen im Gedächtnis als so genannte „interne Selbstmodelle“ (Spiel, 1994, S.152). Filipp stellt 1984 (S.132ff.) ein Modell von fünf Informationsquellen vor, die den Menschen zum Aufbau von internen Selbstmodellen zur Verfügung stehen:
(1) Direkte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen (Zuschreibung von Eigenschaften und Merkmalen durch andere Personen. Bsp.: Ein Lehrer lobt den Fleiß eines Schülers).
(2) Indirekte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen (Informationen durch Interpretation des Verhaltens anderer Personen).
(3) Komparative Prädikaten-Selbstzuweisungen (Vergleich mit anderen Personen hinsichtlich bestimmter Merkmale und Fähigkeiten. Bsp.: „Ich bin gepflegter als René“).
(4) Reflexive Prädikaten-Selbstzuweisungen (Rückschlüsse auf Fähigkeiten, Eigenschaften, Gewohnheiten etc. durch Beobachtung des eigenen Verhaltens).
(5) Ideationale Prädikaten-Selbstzuweisungen (Zukünftige Vorstellungen und Erinnern an vergangene Selbsterfahrungen in einer Art Gedankenexperiment).
2.1.1.2 Nutzen des Selbstkonzepts
Jedes Individuum besitzt ein unterschiedliches Selbstkonzept, auf Grund dessen können Selbstkonzepte als „Aspekte der individuellen Struktur der Persönlichkeit“ verstanden werden (Deusinger, 1996, S.90). Teilaspekte des Selbstkonzepts sind beispielsweise das Körperkonzept und das Konzept über die individuellen Fähigkeiten und Begabungen (Neubauer, 1976, S.48).
Selbstkonzepte steuern nach Auffassung von Mrazek & Hartmann (1989, S.218) maßgeblich das Verhalten einer Person und damit die Gelegenheiten, weitere Erfahrungen zu sammeln. So wird beispielsweise eine Person, die sich selbst als sportlich einschätzt eher sportlichen Aktivitäten nachgehen.
Deusinger (1986, S.13f.) geht davon aus, dass psychisch gesunde Personen eher dazu neigen, „positive“, also mit „sozial erwünschten Merkmalen gekennzeichnete Selbstkonzepte“ zu entwickeln. Die Autorin schlussfolgert, dass positive Selbstkonzepte auf psychische Stärke und psychische Stabilität der Person hinweisen. Dementsprechend sind nach Alfermann (1998, S.216) Personen mit einem hohen Selbstwertgefühl erfolgreicher als Personen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl.
Weinert (1993, S.51) beschreibt das Selbstkonzept als einen wichtigen Kernbereich der menschlichen Persönlichkeit, welches das Bild darstellt, das eine Person von sich selbst im Hinblick auf Talente, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Werte hat. Das Selbstkonzept stellt die verschiedenen Lebensinteressen und Lebensziele des Menschen dar, die sich durch ständige Suchprozesse und Lebenserfahrungen ganz allmählich entwickeln. Dieser Prozess des „Sich-selbst-Entdeckens“ dauert bei jedem Menschen unterschiedlich lange. Nicht selten benötigt ein Mensch sein halbes Leben um für sich selbst einen klaren Weg zu erkennen und um herauszufinden, was er in seinem Leben erreichen möchte. Das Selbstkonzept hat nach Weinert (1993, S.52) einen steuernden Einfluss bei personenrelevanten Entscheidungen. Es motiviert, hält zurück und selektiert.
Neubauer (1976, S.40) verdeutlicht den Nutzen des Selbstkonzepts, in dem er davon ausgeht, dass das Individuum im Laufe seines Lebens ein Selbstkonzept entwickelt, um für die eigene Person Schutz und Absicherung zu schaffen.
Selbstkonzepte bzw. die Messung der Selbstkonzepte sind vor allem in der Psychiatrie und der Klinischen Psychologie zur „Beurteilung von Krankheitsverläufen und Wirkungen therapeutischer Maßnahmen der Pharmakopsychiatrie“ sinnvoll (Deusinger, 1986, S.6; 1996, S.94). Die Frankfurter Selbstkonzeptskalen von Ingrid M. Deusinger stellen hier ein geeignetes Selbstkonzept-Messmittel dar.
2.1.1.3 Erfassung des Selbstkonzepts
Die Erfassung des Selbstkonzepts fällt je nach seiner theoretischen Grundlegung unterschiedlich aus. Versteht man das Selbstkonzept als „Gesamtheit selbstbezogener Einstellungen“, kommen im Wesentlichen solche psychologischen Verfahrensweisen zum Einsatz, die auch zur Einstellungsmessung verwendet werden (z.B. Items) (Mummendey, 1995, S.71). Warum macht es nun aber Sinn Selbstkonzepte zu messen? Eine Antwort liefert Mummendey (1995, S.72), indem er erklärt, dass es mittels Selbstkonzeptmessung möglich wird, eine Reihe von Vergleichen anzustellen, das heißt, man kann die eigenen Selbstkonzepte mit denen von anderen Personen vergleichen, oder aber auch das eigene aktuelle Selbstkonzept mit den eigenen vergangenen Selbstkonzepten vergleichen.
Selbstkonzept-Messmittel können sowohl strukturiert als auch unstrukturiert sein. Strukturierte Verfahren sind Verfahren, bei denen genaue Vorgaben entweder auf der Reiz- oder der Reaktionsseite existieren. Bei gängigen Testverfahren sind sowohl die Items als auch die Art und Weise des Antwortens geregelt und vorgeschrieben. (Mummendey, 1995, S.72).
Die am häufigsten angewandten Verfahren der Selbstkonzeptmessung sind strukturierter Art, beispielsweise Persönlichkeitsfragebögen und Ratingskalen. Die starke Strukturierung dieser Verfahren wird durch vorgegebene Sätze, Fragestellungen und Antwortkategorien deutlich. Aber auch unstrukturierte Selbstkonzeptmessungen, bei denen die Person frei wählen kann, über welche Persönlichkeitsaspekte sie etwas sagen möchte und in welcher Art und Weise sie dies tun will, sind mengenmäßig auswertbar. Es gibt weiterhin Mischformen von strukturierten und unstrukturierten Verfahren mit denen eine Selbstkonzepterfassung möglich ist. So kann man zum Beispiel Eigenschaftswörter vorgeben, es aber der Person selbst überlassen, in welcher Form sie eine Selbstbeschreibung abgibt. Oder man stellt es der untersuchten Person frei, über welchen Persönlichkeitsaspekt sie sich äußern möchte, legt aber fest, in welcher Form sie sich äußern soll (Mummendey, 1995, S.72f.).
Selbstkonzepte können ‚reaktiv und nichtreaktiv’ erhoben werden. Bei der reaktiven Selbstkonzeptmessung weiß die Person, dass ihre Persönlichkeit oder ihre Selbstkonzepte untersucht werden. Daraus ergibt sich jedoch das Problem der ‚sozialen Erwünschtheit’ (social desirability). Es wird angenommen, dass eine Person in einem gewissen Maße anders antwortet wenn sie weiß, dass man etwas über sie erfahren möchte. So kann ein ‚beschönigtes Selbstkonzept’ zu Stande kommen. Eine nichtreaktive Selbstkonzepterfassung erfolgt hingegen ohne das Bewusstsein der Person untersucht zu werden. Eine geeignetere Unterscheidung ist diejenige von offenen und getarnten Selbstkonzept-Messmitteln. Bei der so genannten getarnten Vorgehensweise gibt man ein vom eigentlichen Untersuchungsziel abweichendes Ziel an, so soll der Proband zum Beispiel Angaben zu seinen Fähigkeiten oder Leistungen machen. Damit gelingt es dem Untersucher ein möglichst natürliches, also wenig gespieltes Selbstbild des Probanden zu erhalten (Mummendey, 1995, S.73f.). Zusammenfassend handelt es sich bei den meisten Selbstkonzeptmessungen um strukturierte, reaktive, offene und ungetarnte Verfahren (Mummendey, 1984, S.176; 1995, S.74).
Empirische Untersuchungen des Selbstkonzepts beziehen sich meist nur auf Teilaspekte/ -inhalte des Selbstkonzepts (Neubauer, 1976, S.44). Ingrid M. Deusinger entwickelte 1986 die so genannten Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN) zur Bestimmung der Selbstkonzepte. Dieses Selbstkonzeptinventar besteht aus zehn eindimensionalen Skalen (Quasiskalen), das gesamte Inventar besteht aus 78 Items. Es ist allerdings auch möglich, zur Bestimmung einzelner Selbstkonzepte die Version mit sechs, zehn oder zwölf Items einzusetzen. Die Items werden 10 verschiedenen Selbstkonzepten zugeordnet und umfassen „Überlegungen, Gedanken, Bewertungen, Stimmungen, Gefühle, Befindlichkeiten und Verhalten im Alltag“. Die FSKN stellen besonders ökonomische Fragebogenverfahren dar, denn sie geben reichliche quantitative und qualitative Auskünfte zu bedeutenden Aspekten der Persönlichkeit und sind zudem zweckmäßig anzuwenden und auszuwerten. Allerdings sind die FSKN für Probanden mit deutlich unterdurchschnittlicher Intelligenz kaum anwendbar. Als Antwortmöglichkeit stehen dem Befragten sechs Stufenantworten zur Auswahl: (1) „trifft sehr zu“, (2) „trifft zu“, (3) „trifft etwas zu“, (4) „trifft eher nicht zu“, (5) „trifft nicht zu“ und (6) „trifft überhaupt nicht zu“. Je positiver das Gefühl gegenüber der eigenen Person ist, umso mehr Punkte erhält der Proband für seine Antwort (Deusinger, 1986, S.6f.; 1996, S.94f.; 1998, S.34).
In der folgenden Tabelle sowie im Anhang 1 werden die Frankfurter Selbstkonzeptskalen anschaulich dargestellt.
Tab. 2. 1 Frankfurter Selbstkonzeptskalen (Deusinger, 1986, S.6f.) .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Jahr 1996 veröffentlichte Ingrid M. Deusinger die Frankfurter Körperkonzeptskalen (FKKS). Hierbei handelt es sich um die Bestimmung von Einstellungen des Individuums zum eigenen Körper. Deusinger unterscheidet neun Körperkonzepte.
Tab. 2. 2 Frankfurter Körperkonzeptskale n (Deusinger, 1998, S.159f.) .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Fragebogen besteht aus 64 Items zu 9 eindimensionalen Skalen. Die einzelnen Skalen werden aus 4 bis 14 Items gebildet. Die Items beziehen sich ebenso wie die Items der Frankfurter Selbstkonzeptskalen auf „alltägliche Überlegungen, Gedanken, Bewertungen, Stimmungen, Gefühle, Befindlichkeiten und auf alltägliches Verhalten“. Als Antwortmöglichkeit stehen dem Befragten auch hier sechs Stufenantworten zur Auswahl von: (1) „trifft sehr zu“ bis (6) „trifft überhaupt nicht zu“ (Deusinger, 1996, S.95f.; 1998, S.8). Tabelle 2. 2 und Anhang 2 veranschaulichen die Frankfurter Körperkonzeptskalen.
2.1.1.4 Ausgewählte Studien zum Selbstkonzept
Mummendey (1995, S.232ff.) nahm 1995 eine Untersuchung zur Persönlichkeitsmessung von Sportlern vor. Er untersuchte 72 Personen mittels der Methode der systematischen Variation der Instruktion. Mummendey unterteilt die Versuchsbedingungen in die Bedingungsfaktoren A1, A2 und A3 (Impression-Management) sowie B1 und B2. Dabei werden die Probanden in Bedingung A1 des Versuchsplans ohne Andeutung der Thematik Sport untersucht. Diese Bedingung enthält kaum Anreiz zur „sportspezifischen Selbstdarstellung“. Die Probanden in Bedingung A2 des Versuchsplans werden dagegen in einer sportbezogenen Umgebung untersucht, also entweder direkt beim Training oder durch den Trainer angesprochen. Diese Versuchsbedingung enthält somit einen Anreiz zur sportspezifischen Selbstdarstellung. Gleiche Vorrausetzungen der Bedingung A2 gelten auch für die Probanden in Bedingung A3, zusätzlich bekommen diese jedoch den Hinweis, dass das Idealbild von Sportlern untersucht wird. In diesem Fall handelt es sich um eine „verschärfte Impression-Management-Bedingung“. Der zweite Faktor des Versuchsplans wird durch die Versuchsbedingungen B1 und B2 dargestellt und bezieht sich auf das sportliche Leistungsniveau. In Bedingung B1 werden Breitensportler und in Bedingung B2 Leistungssportler zusammengefasst. Die Probanden erhielten einen Fragebogen mit 62 Items, welcher aus den Skalen der Extraversion, des Neurotizismus und des Psychotizismus besteht, und einen Selbstratingbogen mit 56 Items, welcher sechs Persönlichkeitsdimensionen umfasst (Leistungsfähigkeit, Selbstsicherheit, Flexibilität, Soziale Kontaktfähigkeit, Toleranz, Disziplin). Als Ergebnis dieser Studie lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich Leistungssportler gegenüber Breitensportlern als tendenziell extravertierter (p=0,058) und sozial kontaktfreudiger (p=0,067) beschreiben. Dabei beschreiben sich die Sportler umso extravertierter und umso psychisch stabiler je größer die Gelegenheit zum Impression-Management ist. Weiterhin schreiben sich Leistungssportler unter Bedingung A2 eine höhere Leistungsfähigkeit zu als Breitensportler. Schlussendlich wird deutlich, dass es bei Forschungen mit Persönlichkeitsfragebögen in vielen Fällen zu statistisch signifikanten Impression-Management-Effekten in Abhängigkeit von Art und Umfang des Sporttreibens oder dem sportlichen Leistungsniveau kommt. Mummendey (1989, S.32) zufolge besagt die Impression-Management-Theorie, dass Personen in Testsituationen versuchen, anderen Menschen einen bestimmten Eindruck von sich zu vermitteln.
Morse & Gergen schrieben 1970 für ein Experiment einen Ferienjob aus. Die Bewerber wurden aufgefordert in einem Raum einige Fragebögen auszufüllen. Darunter befand sich ein Fragebogen zur Erfassung des Selbstwertgefühls. Während die Probanden die Bögen ausfüllten, wurde ein zweiter Bewerber in den Raum geführt, welcher speziell für die Untersuchung vorbereitet wurde. Die Hälfte der Probanden wurde mit einem sehr gepflegten und äußerlich beeindruckenden Mitbewerber, die andere Hälfte mit einem sehr unordentlich gekleideten Mitbewerber mit schlechten Manieren konfrontiert. Im Ergebnis dieser Studie wird klar, dass die „Einführung des perfekten Gentleman“ das Selbstwertgefühl der Bewerber deutlich sinken lässt, dagegen das Selbstwertgefühl derer die mit der ungepflegten Person konfrontiert werden erheblich ansteigt. Demnach bewerten sich die Probanden im sozialen Vergleich mit ihrem jeweiligen Gegenüber (Gergen, 1984, S.80f.).
Mit Hilfe ihrer Frankfurter Selbstkonzeptskalen und den dazugehörigen Auswertungsbögen untersuchte Deusinger 1986 die Selbstkonzepte von 87 depressiven Patienten einer psychiatrischen Klinik. Zu den Probanden zählten 31 Männer und 56 Frauen zwischen 23 und 81 Jahren. Die Autorin verglich die Ergebnisse mit einer Kontrollgruppe von 87 gesunden Probanden. Die depressiven Patienten beschreiben sich in allen untersuchten Selbstkonzepten (FSAL, FSAP, FSVE, FSSW, FSEG, FSST, FSKU, FSWA, FSIA, FSGA) weniger „günstig“ als die Kontrollgruppe. Die größten Differenzen zeigen sich in den Skalen zur Leistungsfähigkeit (FSAL), zur allgemeinen Problembewältigung (FSAP) und zur Standfestigkeit gegenüber bedeutsamen Anderen und Gruppen (FSST) (Deusinger, 1986, S.66ff.).
Tschakert untersuchte 1986 das Selbstkonzept von Nichtschwimmern. Durch die Teilnahme an einem dreiwöchigen Schwimmkurs kam es bei den Nichtschwimmern zu einer positiven Veränderung des Selbstkonzepts im Sinne einer Erhöhung ihres Selbstwertgefühls.
2.1.2 Kennzeichen des Körperkonzepts
In diesem Abschnitt wird die Kennzeichnung bzw. Charakterisierung des Körperkonzepts thematisiert. Der definitorischen Klärung des Begriffes Körperkonzept folgt die Auseinandersetzung mit dem Körperkonzept im Wandel der Zeit, d.h. der Bedeutung des Körpers in unserer heutigen Gesellschaft. Anschließend werden Aspekte zum Zusammenhang von Körper und Sport sowie von Körperwahrnehmung und Schwimmen dargelegt. Den Abschluss bilden ausgewählte Studien zum Körperkonzept.
2.1.2.1 Definition des Körperkonzepts
Es gibt in der Literatur eine kaum überschaubare Anzahl an Begriffen und Begriffsdeutungen bezüglich des menschlichen Körpers. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die nähere Darlegung des ‚Körperkonzepts’. Das Körperkonzept stellt eines der wichtigsten Teilbereiche des Selbstkonzepts dar. Im Laufe der individuellen Entwicklung entsteht ein Konzept über den eigenen Körper (Neubauer, 1976, S.47). Die Bilder vom eigenen Körper werden also erlernt und können „als Aspekte der individuellen Identität betrachtet werden“ (Deusinger, 1998, S.12). Nach Deusinger werden Körperkonzepte als Selbstkonzepte verstanden,
„die sich auf verschiedene Aspekte des Körpers beziehen: Auf das körperliche Befinden, die körperliche Effizienz, auf Aspekte der Ästhetik der äußeren Erscheinung der Person insgesamt oder einzelner Teile des Körpers, auf Körpergeruch, Körperkontakt und Sexualität, auf Körperpflege etc. Es handelt sich um Einstellungen im Sinne von Attitüden des Individuums gegenüber dem eigenen Körper“ (Deusinger, 1998, S.15).
Schon kurz nach der Geburt, etwa im vierten Lebensmonat, gewinnt der Mensch durch den spielerischen Umgang mit den eigenen Körperteilen erste entscheidende Eindrücke zur Unterscheidung zwischen dem eigenen Körper („Ich“) und übrigen Gegenständen („Nicht-Ich“). Aber vor allem die Körperempfindungen, wie Schmerz, Kälte und Wärme sind für diese Unterscheidung wichtig. Die sensorischen Erfahrungen in den ersten Lebenswochen führen zum „Körper-Selbst“ des Neugeborenen, aus dem sich später dann das „Körper-Schema“ entwickelt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Bewusstwerdens des eigenen Körpers wird von Neubauer als „doppelte Wahrnehmung“ bezeichnet. Damit meint Neubauer doppelte Empfindungen beim Berühren des eigenen Körpers, die Bewegungskontrolle über die „äußere und innere Wahrnehmung“ sowie die Erfahrung der eigenmächtigen Kontrolle über körperbezogene Aktivitäten (Neubauer, 1976, S.72f.). Das Körperkonzept wird bei jeder Handlung automatisch miteinbezogen. Als Beispiel führt Neubauer (1976, S.75) an, dass der Mensch weiß, ob er mit den Händen ein bestimmtes entfernt liegendes Objekt erreichen kann. Nach einer bestimmten Trainingszeit kann das Körperkonzept sogar auf Gegenstände bezogen werden, „die mit unserem Körper eine Handlungseinheit bilden“. Beispielsweise löst das Streifen des Autodaches an Blättern oder Zweigen ein unangenehmes Gefühl aus (Neubauer, 1976, S.76).
Von großer Bedeutung für das Körperkonzept ist der Spiegel als „Vermittler von Selbst-Informationen“ (Neubauer, 1976, S.73). Körperliche Veränderungen stellen grundsätzlich eine Gefährdung der individuellen Identität dar. Dabei gilt, je schneller und je schwerwiegender sich die objektive Veränderung des Körpers vollzieht, z.B. durch Krankheit oder Unfall, umso größer ist die Bedeutung dieser Veränderung für das Individuum. Langsame Veränderungen, wie beispielsweise das Altern oder eine Gewichtszunahme sind dagegen weniger einschneidend, da sich das Körperkonzept allmählich an diese Veränderungen anpassen kann (Neubauer, 1976, S.77f.).
Nach Mrazek (1987, S.2) besteht das Körperkonzept aus mehreren voneinander unabhängigen Komponenten, die verschiedene Aspekte des Körpers betreffen, vor allem Aussehen, Figur/Körperbau, Gesundheit, Fitness, Sexualität und Körperkontakt. Mrazek unterteilt das Körperkonzept in die Teilkonzepte des ‚körperlichen Aussehens’ und der ‚körperlichen Leistungsfähigkeit’. Wobei das Körperkonzept stärker vom ‚Konzept des körperlichen Aussehens’ abhängt (Mrazek, 1984a, S.120; 1985, S.98).
Fuchs (1989, S.13) unterscheidet 2 Ebenen des Selbstkonzepts: das „globale Selbstkonzept“ und das „Körperkonzept“. Das globale Selbstkonzept bezieht sich auf alle selbstbezogenen Kognitionen und stellt damit die allgemeinste Form der Selbstsicht bzw. der Selbstbewertungen dar. Im Ergebnis einer Vielzahl von Untersuchungen führt Bewegung - im weiteren Sinne Sport - zu einer Steigerung des Selbstwertgefühls respektive zu einer positiveren Wahrnehmung der eigenen Person. Ähnlich der oben aufgeführten Definition von Deusinger, umfasst auch nach Fuchs das Körperkonzept all diejenigen selbstbezogenen Kognitionen, die sich auf den eigenen Körper, seine Eigenschaften, Funktionsweisen und Fähigkeiten beziehen (Fuchs, 1989, S.13).
2.1.2.2 Das Körperkonzept im Wandel der Zeit
Der eigene Körper stellt für jedes Individuum im Grenzbereich von Selbst und Umwelt eine bedeutende Komponente dar (Mrazek, 1986, S.99). Heinemann zufolge ist der Körper ein Ausdrucksmedium. Er ist Träger von Symbolen und Elementen der Gesellschaft. Über den Körper werden soziale Beziehungen aufgebaut und gefestigt, er ist Basis für einen Austausch mit der Welt als auch der eigenen Selbstdarstellung. Mit ihrem Körper grenzen sich die Menschen voneinander ab. Auch bei der Entwicklung des Selbstkonzepts spielt der eigene Körper eine wichtige Rolle, denn jeder Mensch lernt sich zunächst über den eigenen Körper kennen (Heinemann, 1994, S.21; Mrazek & Hartmann, 1989, S.218; Reinecke, 2000, S.27; Rittner, 1991, S.125ff.). Der Körper ist ein „soziales Gebilde“, welches von Geburt an bis zum Ende der Pubertät starken biologischen Veränderungen unterliegt. Im Alltag wird der eigene Körper von uns oft einfach nur als selbstverständlich hingenommen. Wir achten erst dann bewusst auf ihn, wenn er in seiner Funktion beeinträchtigt ist, zum Beispiel bei Schmerz, Verletzung oder Krankheit (Bielefeld, 1991, S.4f.; Mrazek, 1983, S.155; Mrazek, 1991, S.228; Schnabel & Thieß, 1993, S.254).
In unserer Gesellschaft hat sich ein eher „mechanistisches Körperverständnis“ durchgesetzt. Dieses geht einher mit dem Ziel einer vollständigen Kontrolle des Körpers. Mrazek (1983, S.156; 1984a, S.107) spricht in diesem Fall von einer so genannten „Entkörperlichung“: Maschinen und Computer machen körperliche Kraft zunehmend überflüssig und Kommunikation setzt physische Anwesenheit nicht mehr voraus. Es gibt immer mehr Menschen, die Probleme mit ihrem Körper haben, weil er auf der einen Seite unterfordert ist (Bewegungsmangel), auf der anderen Seite aber auch überfordert ist, denn in unserer hochtechnisierten Umwelt werden sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit die intellektuell-kognitiven Fähigkeiten immer mehr gefordert, die körperlichen Fähigkeiten dagegen eher überflüssig. Es treten immer häufiger Funktionsstörungen und pathologische Reaktionen auf, vor allem ist eine Zunahme an psychosomatischen Krankheiten und Herz-Kreislauf-Beschwerden zu verzeichnen, die wiederum „technisch“ mittels Tabletten behandelt werden (Heinemann, 1994, S.25; Mrazek, 1983, S.156; Mrazek, 1984b, S.58). „Die Betonung des Geistes bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Körpers scheint in unserer Zeit ihren Höhepunkt erreicht zu haben“ (Mrazek, 1984b, S.58).
In den letzten Jahren kann man nun die Tendenz verzeichnen, dass sich immer mehr Menschen bewusst um ihren Körper kümmern, sowohl um sein Aussehen, als auch seine Funktionsfähigkeit. Dafür spricht z.B. der verstärkte Aufwand für Körperpflege und eine bewusst gesunde Ernährung, vor allem aber das wachsende Interesse an sportlichen Aktivitäten (Mrazek, 1984a, S.107). Durch die Wiederentdeckung des Körpers in der „Fitness-Bewegung moderner Industriegesellschaften“ erfahren Themen zur Körperlichkeit des Menschen in der heutigen Forschung ein Comeback (Knobloch & Hölter, 1986, S.134). Nach Weiss & Russo (1994, S.30) besteht in höheren sozialen Schichten ein größeres Interesse und eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen Körper.
In einer immer komplexer werdenden Umwelt wird das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper immer schwieriger. Die Werte und Normen unserer Gesellschaft führen zu einer Unterdrückung des Körpers, wodurch es den Menschen zunehmend schwer fällt eine eigene Identität aufzubauen (Mrazek, 1983, S.155, S.171; Mrazek & Hartmann, 1989, S.218). Charakteristisch für unsere Zeit und unsere Gesellschaft sind Stress, Bewegungsmangel, psychosomatische Störungen und Probleme mit der Figur und dem Aussehen (Mrazek, 1984b, S.52). Mrazek & Rittner (1986a, S.58) sprechen von einem so genannten „Körperkult“, der in unserer heutigen Gesellschaft besteht. Als Beispiel führen sie an, dass immer mehr Frauen dem starken Wunsch nach Formung ihres Körpers nachgehen und nicht zuletzt das Frauen-Bodybuilding an Zuwachs erfährt. Früher definierte der Körper die sozialstrukturelle Stellung des Menschen, man konnte von Körperhaltung, Posen, Gesichtsausdruck, Kleidung und Requisiten auf den Beruf schließen. In der heutigen Zeit der Individualisierung sind diese Zusammenhänge weitgehend verschwunden. Im Idealfall ist der neue Körper schlank und sportlich. Sportkleidung und Sportgeräte sind die heutigen Individualisierungsgeräte (Mrazek & Rittner, 1986a, S.58, S.62).
2.1.2.3 Körperkonzept und Sport
Durch die im vorangegangen Abschnitt erläuterten veränderten Arbeitsbedingungen durch Industrialisierung etc. wird der Mensch einseitig belastet und es wird vermutet, dass sich ein gestörtes Körpergefühl entwickelt. Der Sport kann hier gut als Ausgleich dienen (Andrecs, 1994, S.141). Sportliche Betätigung erhöht die Konzentration auf den eigenen Körper und ruft damit Körpererfahrungen hervor, welche im alltäglichen Leben so nicht vorzufinden sind. Aus diesem Grund sieht Fuchs die Vermutung bestätigt, dass sportliche Aktivität eine zentrale Determinante des Körperkonzepts darstellt (Fuchs, 1989, S.14). In zahlreichen Studien wurde ebenso ein positiver Zusammenhang von Sporttreiben und Selbstkonzept festgestellt. Sportler haben demnach ein positiveres Selbstkonzept (Alfermann, 1998, S.219; Deusinger, 1998, S.93ff.; Spiel, 1994, S.157; Mrazek & Hartmann, 1989, S.218ff.). Für Mrazek & Rittner (1986b, S.64) stellt der Sport das beste Mittel dar, um Fortschritte in allen wichtigen Bereichen des eigenen Körpers zu schaffen. Die Autoren fügen an, dass Menschen mit Sport existentielle Probleme lösen.
2.1.2.3.1 Körperwahrnehmung und Schwimmen
"Alles ist aus dem Wasser entsprungen! Alles wird durch das Wasser erhalten!"
(Johann Wolfgang von Goethe )
Mit diesem Zitat machte schon Goethe auf die außerordentlich große Bedeutung des Wassers für den Menschen aufmerksam. Beim Schwimmen umhüllt das Element Wasser fast den ganzen Körper und spricht damit unsere Sinne stark an, es werden Bewegungsmöglichkeiten und Sinneseindrücke geboten, wie sie an Land nur schwer zu finden sind. Unger (1992, S.143ff.) stellt die Frage, welche Wahrnehmungen man im Wasser spüren und bemerken kann. Er benennt die Atmung als „Zentrum unseres Empfindens“. Im Wasser spüren wir unsere Atmung ganz bewusst und intensiv. Durch ruhiges Ein- und Ausatmen spüren wir Entspannung. Weiterhin zählt Unger das Gleichgewicht und das Wassergefühl zu wichtigen Wahrnehmungen im Wasser. Zunächst finden Arme, Hände und Füße keinen Halt im Wasser, erst durch vieles Üben und Austesten lernen wir, wie wir uns im Wasser festhalten und abdrücken können. Unger bezeichnet das Schwimmen als eine „Empfindungsschule“, denn bei unterschiedlichen Wassertemperaturen erfahren wir unterschiedliche Reaktionen unserer Haut und spüren unseren Kreislauf entspannt oder angeregt. Die Bewegung im Wasser fällt uns anfangs schwer und strengt uns an. Erst allmählich lernen wir mit dem Wasser umzugehen und uns seine Eigenschaften zu Nutze zu machen. Wir spielen mit den Wellen und genießen kraftvolles Schwimmen. Eine weitere Wahrnehmung, die wir im Wasser erfahren, ist der Kontakt mit anderen Menschen. Vor allem Kinder bewegen sich bevorzugt mit anderen zusammen im Wasser, sie verständigen sich verbal sowie nonverbal mit und durch ihre Bewegungen und ihren eigenen Körper (Unger, 1992, S.143ff.). Für viele Menschen stellt Wasser ein Element dar, in dem sie sich entspannen oder abkühlen können, in dem sie Gelegenheit finden mit der Familie gemeinsam Spaß zu erleben oder sie nutzen es schlicht und ergreifend für den Freizeitsport. Es gibt aber auch Menschen, die mit diesem Element ein negatives Körpererleben verbinden, hier spielen beispielsweise Unsicherheit, Ängstlichkeit sowie Frösteln und Frieren eine Rolle (Unger, 1992, S.141). Im Schwimmbad entdeckt man oft Menschen, die beim Schwimmen den Kopf zur Seite drehen, um keine Spritzer ins Gesicht zu bekommen. Sie wollen offensichtlich den Gesichtskontakt mit dem Wasser vermeiden. Nach Unger (1992, S.142) ist die Einstellung zum Wasser abhängig von der „Schwimm-Biographie“, das heißt also, wo, bei wem und unter welchen Umständen das Schwimmen erlernt wurde hat einen Einfluss auf die eigene Einstellung zum Wasser. Im Wasser lernt unser Körper allmählich, sich auf ungewohnte Bedingungen einzustellen. Wir fühlen das Wasser als etwas Nasses, Warmes, Kühles oder Kaltes und richten uns auf die Gegebenheiten des Elementes ein. Das Schwimmen bietet viele Möglichkeiten der Körpererfahrung, beispielsweise durch den Wasserwiderstand, den Auftrieb, die Massagewirkung des Wassers, die unterschiedlichen Temperaturen und ein völlig neues Raumerleben (Unger, 1992, S.145).
2.1.2.3.2 Ausgewählte Studien zum Körperkonzept
Mrazek & Hartmann stellen 1989 (S.218ff.) die Ergebnisse einer umfassenden Studie zur Struktur und Entwicklung des Selbst- und Körperkonzepts im Jugendalter dar. Es wurde unter anderem überprüft, ob es Zusammenhänge zwischen dem Konzept der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie weiteren Komponenten des Körper- und Selbstkonzepts und der eigenen sportlichen Aktivität gibt. 1026 Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren wurden mittels eines 240 Items umfassenden Fragebogens befragt. Nach Mrazek & Hartmann ist die körperliche Leistungsfähigkeit für männliche Jugendliche aufgrund ihrer Geschlechterrolle wichtiger als für weibliche Jugendliche. Das Körper- und Selbstkonzept der Mädchen ist allerdings differenzierter als das der Jungen. Weiterhin stellen die Autoren fest, dass die sportlich Aktiven mit ihrer Leistungsfähigkeit zufriedener sind als die sportlich Inaktiven. Gegenüber den sporttreibenden Jugendlichen beurteilen die Nicht-Sportler ihr Aussehen negativer (Mrazek & Hartmann, 1989, S.226f.). Offenbar sensibilisiert sportliche Aktivität für die Wahrnehmung körperlicher Vorgänge. Es ist nach Mrazek & Hartmann zusammenfassend festzustellen, dass sich das Konzept der körperlichen Leistungsfähigkeit und weitere Komponenten des Körper- und Selbstkonzepts sowie die eigene sportliche Aktivität wechselseitig beeinflussen. Dabei lässt sich erkennen, dass das Körperkonzept im Jugendalter besonders bedeutsam für die Entwicklung des Selbstwertgefühls ist.
Deusinger fasst 1998 (S.93ff.) die Ergebnisse ihrer Studie von 1997 zusammen. Sie vergleicht die Körperkonzepte von 753 Erwachsenen (367 Frauen, 386 Männer) zwischen 20 und 30 Jahren mit den Körperkonzepten von 145 Erwachsenen (67 Frauen, 78 Männer) zwischen 50 und 60 Jahren mittels dem Mann-Whitney U-Test. Sie stellt vergleichbar positive Selbstkonzepte sowohl bei den jüngeren als auch den älteren Erwachsenen fest. Das Alter hat demnach keinen Einfluss auf den Grad der Positivität der Körperkonzepte. Die Probanden zwischen 50 und 60 Jahren weisen ein positiveres Selbstkonzept der Pflege des Körpers und der äußeren Erscheinung auf. Die Probanden zwischen 20 und 30 Jahren haben ein vergleichbar positiveres Körperkonzept zum Körperkontakt. Ältere Erwachsene haben weiterhin ein deutlich positiveres Körperkonzept der Akzeptanz durch andere, sie lassen sich demnach weniger von Kritik an ihrem Aussehen irritieren und beschreiben ihre Wirkung auf andere im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen eher als anziehend.
Deusinger legt 1998 (S.95ff.) weitere Studienergebnisse zum Körperkonzept vor. So wurden 1993 durch Gabriele Kupka die Körperkonzepte von 30 aktiven Damenfußballerinnen zwischen 16 und 28 Jahren untersucht und einer Vergleichsgruppe gegenübergestellt. Die Ergebnisse zeigen ein hochsignifikant positiveres Selbstkonzept der körperlichen Effizienz bei den Fußballerinnen. Die Sportlerinnen haben zudem ein statistisch signifikant günstigeres Selbstkonzept der Gesundheit und des körperlichen Wohlbefindens als die Vergleichsgruppe. Damit belegt diese Studie, dass Personen, die aktiv Sport treiben, ein positiveres Selbstkonzept haben als Personen, die keinen Sport treiben.
In einer Umfrage von Mrazek (1984b) zur Wahrnehmung des eigenen Körpers werden die Unterschiede der Einstellung zum Körper zwischen den Geschlechtern dargelegt. Die Stichprobe umfasst 3265 Personen zwischen 18 und 81 Jahren. Männer stufen ihren Körper als größer, belastbarer und leistungsfähiger ein, Frauen dagegen stufen ihren Körper als gepflegter ein. Es wird nach Mrazek (1984b, S.53) deutlich, dass Frauen mehr auf ihren Körper achten und sich seiner intensiver bewusst sind als Männer. Dies ist auch der Grund, weshalb Frauen Probleme mit ihrem Körper häufiger registrieren. Im Ergebnis der Umfrage haben die männlichen Probanden ein eher instrumentelles Verhältnis zum Körper, sie definieren sich häufiger über Leistungen im intellektuellen Bereich und beruflichen Erfolg. Die weiblichen Umfrageteilnehmerinnen definieren sich dagegen stärker über ihren eigenen Körper, ganz besonders im Vordergrund steht das Aussehen. Männer sind mit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit und ihrer Figur zufriedener als Frauen.
2.2 Motivationale Aspekte
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt das Selbstkonzept und im Speziellen das Körperkonzept dargestellt wurde, stehen nun motivationale Aspekte im Vordergrund.
Die Motivationsforschung im Sport hat eine große Bedeutung. Deutlich wurde dies schon im Jahr 1970, als sich der V. Kongress für Leibeserziehung mit dem Thema „Motivation im Sport“ beschäftigte. Das erste deutschsprachige Lehrbuch der Motivationspsychologie veröffentlichte Heckhausen 10 Jahre später (Pölzer, 1994, S.20). Der gegenwärtigen Motivationspsychologie liegt eine Vielzahl von Definitionen, Theorien, Modellen und Ansätzen zu Grunde. Es gibt derzeitig keine allgemeingültige Motivationstheorie (Zarotis, 1999, S.48).
Heckhausen charakterisiert das Leben jedes Menschen als „einen nicht abreißenden Strom von Aktivitäten“ (Heckhausen, 1989, S.1). Die Motivationspsychologie beschäftigt sich demzufolge mit Aktivitäten, „die das Verfolgen eines angestrebten Zieles erkennen lassen“ (Heckhausen, 1989, S.1). In der Motivationsforschung geht es darum, das Wozu solcher Aktivitätseinheiten zu erklären (Heckhausen, 1989, S.1). Motivationale Aspekte stellen für das Handeln des Menschen eine wichtige Teilerklärung dar (Gabler, 2000, S.197).
2.2.1 Kennzeichen von Motiven
In diesem Abschnitt werden die Begriffe Motiv und Motivation voneinander abgegrenzt. Nach der Darstellung eines speziellen Prozessmodells der Motivation, reihen sich die Beschreibung der Motiventwicklung sowie die nähere Charakterisierung extrinsischer und intrinsischer Motivation an.
2.2.1.1 Motiv und Motivation
Erdmann (1983, S.13) stellt fest, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten mit wechselnder Intensität und Ausdauer verschiedene Ziele verfolgen. Zimbardo und Gerrig (1999, S.319) merken an, dass sich jedes Lebewesen, angeregt von seinen Neigungen und Abneigungen, von bestimmten Reizen und Aktivitäten stärker angezogen fühlt als von anderen. Motivationsfragen wollen den Zweck herausfinden, zu welchem jemand eine Handlung ausführt. Motive sind also Erklärungsgründe für menschliches Verhalten (Heckhausen, 1989, S.1; Oerter, 1987, S.102). Janssen (1981, S.4) versteht unter dem Begriff Motiv eine sprachliche Ableitung des lateinischen Verbs „movere“ (übersetzt: sich bewegen). Somit ist ein Motiv für ihn ein Beweggrund. Fuchs (1997, S.22) bezeichnet Motive als relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale, die das Verhalten des Individuum in einer bestimmten Situation beeinflussen. Nach Heckhausen (1989, S.9) handelt es sich hierbei um überdauernde und relativ konstante Wertungsdispositionen, wobei jedes einzelne Motiv eine definierte Inhaltsklassen von Handlungszielen (z.B. Leistung, Hilfeleistung, Macht oder Aggression) umfasst. Diese eben genannten Wertungsdispositionen unterliegen einer Sozialisation sowie den gesellschaftlichen Normen der Umwelt, denn sie entwickeln sich erst im Laufe der Ontogenese (Heckhausen, 1989, S.9f.). Hierbei stimmt Heckhausen mit Erdmann (1983, S.17) überein, welcher ein Motiv als relativ stabile Verhaltensdispositionen bezeichnet, die das Produkt eines Lernprozesses darstellen. Nach Erdmann (1983, S.16) sind Motive also erlernt und können aus diesem Grund beeinflusst und verändert werden, allerdings bei zunehmendem Alter mit größerem Aufwand. Weiterhin schreibt Erdmann den Motiven eine verhaltenssteuernde Wirkung zu. Um jedoch ein bestimmtes Verhalten zeigen zu können, müssen sowohl Einschätzungs- als auch Bewertungsprozesse ablaufen (Erdmann, 1983, S.15). Fuchs führt ebenso an, dass Motive durch eine konkrete Situation aktiviert werden müssen, damit sie verhaltenswirksam werden (Fuchs, 1997, S.22). Die Person steht dabei der Situation nicht einfach gegenüber, sondern sie befindet sich in der Situation und handelt aktiv. Die aktuelle Handlung besteht damit aus der Wechselwirkung zwischen personinternen Verhaltensdispositionen und situativen Umweltbedingungen (Gabler, 2000, S.205). Einem Motiv kann man viele einzelne Parameter zuordnen. Das Motiv bleibt aber immer „ein sog. hypothetisches Konstrukt“, also „etwas Ausgedachtes, nicht unmittelbar Beobachtbares“ (Heckhausen, 1989, S.10). Motive sind „gedankliche Hilfskonstruktionen“ zur Erklärung menschlichen Handelns. Sie dienen der Beschreibung der „überdauernden Bewertungen, Erwartungen und Zielvorstellungen, die mit Grundsituationen kognitiv und emotional in Verbindung gebracht werden“ (Gabler, 2002, S.14). Auch Erdmann fasst 1983 zusammen, dass Motive nicht direkt beobachtbar sind, sondern lediglich aus dem Verhalten erschlossen werden können. Motive erklären als hypothetische Konstrukte das menschliche Verhalten, welches dadurch überschaubarer und für wissenschaftliche Bemühungen zugänglicher gemacht wird (Erdmann, 1983, S.13f., S.26). Motive sind aus dem menschlichen Verhalten sowie den verbalen Äußerungen erschlossene Bereitschaften, sich in situationsüberdauernder, zeitlich stabiler und individueller Weise zielgerichtet zu verhalten (Gabler, 1988, S.232).
Mit Motivation meint Gabler (1988, S.232) dagegen die aktuellen Prozesse, die in einer bestimmten Situation zu Verhalten führen können und dieses in Gang halten. Oerter (1987, S.98) fasst ebenso alle Bedingungen, welche die Aktivität eines Organismus ankurbeln, als Motivation zusammen. Dementsprechend stellt die Motivation nach Fuchs (1997, S.22) eine „akute Verhaltensbereitschaft“ und das Motiv „die im Hintergrund wirkende chronische Verhaltenspräferenz“ dar. Gabler (2002, S.13) definiert Motivation als einen Sammelbegriff für alle personbezogenen Zustände und Prozesse, „mit deren Hilfe versucht wird, das `Warum` und `Wozu` menschlichen Verhaltens zu klären“. Für Erdmann (1983, S.17) stellt Motivation dagegen die konkrete Handlungsweise dar, welche durch das Motiv gesteuert und von der Situation angeregt wird. Dabei erfolgt die Motivation durch das Zusammenwirken von einem Motiv und einem Situationsanreiz. Sie ist ferner ein Prozess der Auswahl von Handlungsalternativen sowie der Ausrichtung des Handelns auf jeweilige Zielzustände (Erdmann, 1983, S.17). Demzufolge ist Motivation eine „momentane Gerichtetheit auf ein Handlungsziel“ (Heckhausen, 1989, S.3) und somit nur für kurze Zeit und in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation wirksam.
Gabler führt 2000 (S.206) den Begriff Motivierung an. Wobei Motivierung für ihn den Prozess der Motivanregung darstellt. Motivation ist folglich das Ergebnis dieser Motivierung. Kognitive und emotionale Prozesse machen die Motivation aus. Diese Prozesse werden in Prozessmodellen dargestellt (Gabler, 2000, S.206).
2.2.1.2 Prozessmodell der Motivation
Im Folgenden wird das Prozessmodell der Motivation nach Heckhausen näher erläutert.
Motivation ist nicht allein Auslöser einer Handlung, denn es fehlen Entscheidungsprozesse hinsichtlich der Umsetzung verschiedener Motivationstendenzen. Heckhausen versucht mit seinem Prozessmodell der Motivation die verschiedenen Probleme der Motivation im Handlungsverlauf einzubeziehen. Dabei werden Zielbildungsprozesse und handlungsunterstützende Prozesse berücksichtigt (Zarotis, 1999, S.58). Heckhausens Prozessmodell ist ein psychologisches Konstrukt, mit Hilfe dessen die ablaufenden psychischen Prozesse vor, während und nach einer Handlung dargestellt und begründet werden (Hoff, 2000, S.21). Heckhausen selbst bezeichnet sein Prozessmodell als Rubikon-Modell der Handlungsphasen, welches zum Ziel hat, einen theoretischen Rahmen darzubieten, mit dessen Hilfe die Wahl von Handlungszielen und die Realisierung dieser Ziele analysiert werden können (Gollwitzer, 1991, S.39). In der gegenwärtigen Motivationsforschung stellt das Prozessmodell ein sehr umfassendes und differenziertes Modell dar, welches sich am Verlauf einer Handlung orientiert, die mit Entscheidungs-, Planungs-, Durchführungs- und Bewertungsprozessen zustande kommt. Heckhausens Modell gliedert sich in vier Phasen mit jeweils speziellen Übergängen (Zarotis, 1999, S.58). Gollwitzer ordnet den vier Handlungsphasen des Motivationsmodells entsprechend vier verschiedene Vorgänge bzw. Phänomene zu: Abwägen (prädezisionale Phase), Planen (präaktionale Phase), Handeln (aktionale Phase) und Bewerten (postaktionale Phase) (Gollwitzer, 1991, S.55). Um zu belegen, dass diese Phänomene qualitativ unterschiedlich sind, spricht Heckhausen von zwei unterschiedlichen Bewusstseinslagen. Der prädezisionalen und postaktionalen Phase ordnet er die Bezeichnung motivationale Bewusstseinslage zu, die präaktionale und aktionale Phase werden als volitionale Bewusstseinslagen bezeichnet. Charakteristisch für die motivationalen Prozesse ist die Realitätsorientierung, volitionale Prozesse sind hingegen realisierungsorientiert (Gollwitzer, 1991, S.63; Heckhausen, 1989, S.13; Zarotis, 1999, S.59).
Die erste Phase im Handlungsverlauf ist die prädezisionale Motivationsphase . In Anlehnung an Heckhausen (1987, S.123) geht es um „Wünschen, Wägen und Wählen“ bevor es zur Bildung einer Intention kommt. Diese erste Phase bezieht sich auf den Prozess der Intentionsbildung, in der es also um das Abwägen von möglichen Handlungsalternativen geht. Die prädezisionale Motivationsphase schließt mit der Bildung der Zielintention ab. Diesen Moment bezeichnet Heckhausen als das „Überschreiten des Rubikon“, welcher eine zentrale Rolle im Motivationsmodell einnimmt (Fuchs, 1997, S.140; Heckhausen, 1987, S.123; Heckhausen, 1989, S.212; Zarotis, 1999, S.58f.). Bevor ein Handlungsziel bindend sein kann, muss eine Handlungsabsicht, eine Intention, gebildet werden. Damit ist die Intention die Voraussetzung für den Beginn einer Handlung. Handlungsabsichten entscheiden über die Aufnahme und Fortsetzung der Motivationstendenzen (Zarotis, 1999, S.58). Der Prozess des Abwägens zwischen Wünschen und Bedürfnissen wird nicht endlos fortgesetzt, sondern nur solange, bis eine Fazit-Tendenz entsteht (Heckhausen, 1989, S.213; Zarotis, 1999, S.58). Während dieser prädezisionalen Phase befindet sich die Person wie oben erläutert in einer realitätsorientierten Bewusstseinslage. So ist man nach Fuchs (1997, S.140) in diesem Zustand „für alle entscheidungsrelevanten Informationen und Anregungen aus der umgebenden Wirklichkeit“ zugänglich.
In der zweiten Phase des Handlungsverlaufs, der präaktionalen Volitionsphase , erfolgt die Handlungsinitiierung der Zielintentionen (Heckhausen, 1989, S.214). Ausschlaggebend für den Beginn der präaktionalen Volitionsphase ist die veränderte Bewusstseinslage, welche nunmehr durch Fassen von Vorsätzen auf die Realisierung verbindlich gewordener Handlungsziele abzielt (Fuchs, 1997, S.140; Gollwitzer, 1991, S.63). Damit eine Handlung effektiv ist, kann nur eine einzelne Zielintention das Handeln bestimmen. Aus diesem Grund werden alle Zielintentionen auf ihre Realisierbarkeit hin geprüft und gegeneinander abgewogen (Heckhausen, 1989, S.214; Zarotis, 1999, S.59). Heckhausen führt als variable Größe jeder Zielintention in der präaktionalen Volitionsphase eine so genannte Fiat-Tendenz ein. Bei konkurrierenden Zielintentionen setzt sich diejenige mit der stärksten Fiat-Tendenz durch. Wobei die Stärke der Fiat-Tendenz von der Stärke der Zielintention und vom Grad der Günstigkeit, die Zielintention zu realisieren, abhängt (Gollwitzer, 1991, S.46; Heckhausen, 1989, S.214).
Im Anschluss an die präaktionale Volitionsphase folgt die aktionale Volitionsphase. Diese Phase beginnt mit der Intentionsinitiierung und endet mit der Realisierung des angestrebten Endzustandes. Die aktionale Volitionsphase besteht demnach aus dem „intentionsrealisierenden Handlungsvollzug“ (Fuchs, 1997, S.140). Die Volitionsstärke der Zielintention, welche von der zu überwindenden Schwierigkeit abhängt, bestimmt die Intensität und die Ausdauer der Handlung (Heckhausen, 1989, S.215).
Der Phasenverlauf schließt mit der postaktionalen Motivationsphase ab. Hier werden die erreichten Handlungsergebnisse bewertet und Folgerungen für zukünftiges Handeln abgeleitet (Heckhausen, 1989, S.212; Zarotis, 1999, S.59).
Der im Rubikon-Modell dargestellte Phasenablauf darf nicht so verstanden werden, als müsste jede Handlung erst alle vier Phasen durchlaufen, bevor die nächste Handlung in Angriff genommen werden könnte (Fuchs, 1997, S.142). Es ist weiterhin auch nicht davon auszugehen, dass alle Phasen stets in gleicher Weise durchlaufen werden, da sportliche Handlungen sehr vielfältig und unterschiedlich komplex sind (Gabler, 2000, S.225). In Abbildung 2. 2 sind die vier Handlungsphasen schematisch veranschaulicht. Deutlich sind die drei Einschnitte des Handlungsstroms zu erkennen: die Intentionsbildung („Rubikon“), die Handlungsinitiierung und die Intentionsdesaktivierung (Zielerreichung und Abschluss des Handelns) (Heckhausen, 1989, S.212).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2. 2 Schematische Darstellung der vier Handlungsphasen des Rubikon-Modells (Heckhausen, 1989, S.212).
2.2.1.3 Motiventwicklung
Motive entwickeln sich im Laufe der Ontogenese und unterliegen dem Einfluss der gesellschaftlichen Umwelt (Heckhausen, 1989, S.9f.). Sie stellen somit das Produkt eines Lernprozesses dar. Nach Erdmann (1983, S.16) sind Motive also erlernt und können aus diesem Grund beeinflusst und verändert werden. Für die Ausprägung bestimmter Motive beim Individuum ist das Ausmaß des Sozialisationsprozesses maßgeblich. Der Erziehungsstil bestimmt beispielsweise die starke oder schwache Ausprägung des Leistungsmotivs (Zarotis, 1999, S.50). Heckhausen charakterisiert fünf Motive, die sich im Laufe der menschlichen Entwicklung herausbilden. Das am frühesten entwickelte Motiv ist das Anschlussmotiv . Mit Anschluss (Kontakt, Geselligkeit) sind hierbei soziale Interaktionen gemeint. Heckhausen unterscheidet weiter das Aggressionsmotiv , welches andere Personen beeinträchtigt oder ihnen Schaden zufügt sowie das Machtmotiv , welches das Schicksal anderer den eigenen Absichten unterordnet, es lenken und beeinflussen will. Das Hilfemotiv beinhaltet alles Handeln, das darauf gerichtet ist, das Wohlergehen anderer Menschen zu fördern. Das Leistungsmotiv ist das bis heute bestuntersuchte Motiv, welches zum Ziel hat, bei der Lösung von Aufgaben möglichst gut abzuschneiden und die gestellten Anforderungen zu erfüllen (Heckhausen, 1989; Zarotis, 1999, S.51)
2.2.1.4 Extrinsische und intrinsische Motivation
Es gibt eine große Anzahl an verschiedenen Auffassungen darüber, welche Unterschiede zwischen extrinsischem und intrinsischem Verhalten liegen. In Anlehnung an Heckhausen (1989, S.455) scheint menschliches Verhalten entweder von „innen heraus“ (intrinsisch) oder von „außen her“ (extrinsisch) motiviert zu sein. Sportliches Handeln geht einher mit körperlicher Anstrengung und psychischer Herausforderung. Dies führt zu entsprechenden psychophysischen Erlebnissen und Befindlichkeitszuständen. Man spricht dann von intrinsisch motivierten Handlungen, wenn diese psychophysischen Erlebnisse und Befindlichkeitszustände motivierend wirken und das emotionale Erleben während des Handlungsablaufs den Anreizwert der Handlung darstellt (Gabler, 2000, S.230). Heckhausen gibt an, dass ein Handeln dann intrinsisch motiviert ist, „wenn Mittel (Handlung) und Zweck (Handlungsziel) thematisch übereinstimmen“. Extrinsisch ist Handeln dann, „wenn Mittel (Handeln) und Zweck (Handlungsziel) thematisch nicht übereinstimmen“, also das Handeln ein andersartiges Ziel verfolgt (Heckhausen, 1989, S.456). Nach Gabler (1983, S.133) erfolgt intrinsisches Verhalten um seiner selbst willen, wobei die Tätigkeit und das Erleben, welches die Handlung begleitet im Vordergrund stehen. Als Beispiel für intrinsisch motiviertes Verhalten nennt Gabler die Freude an sportartspezifischen Bewegungsformen, die Selbsterfahrung, das Spielen um des Spielen willens sowie das Streben nach Risiko, Abenteuer und Spannung (Gabler 1983, S.133). Heckhausen (1989, S.456) merkt an, dass intrinsisches Verhalten nicht der Befriedigung physiologischer Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst und Schmerzvermeidung dient. Auch Csikszentmihalyi (1999, S.16) weist auf wichtige Aspekte intrinsisch motivierter Handlungen hin. Im Mittelpunkt seiner Forschungen steht das flow-Erleben. Csikszentmihalyi interviewte Schachmeister, Chirurgen, Maler, Athleten und Musiker und ließ sie beschreiben, was sie bei den Aktivitäten die ihnen am liebsten waren, empfanden. Hieraus entwickelte er „eine Theorie der optimalen Erfahrung, die auf der Annahme von flow beruht“ (Csikszentmihalyi, 1999, S.16). Flow ist eine sich selbst motivierende Erfahrung eigenen Handelns. Es ist ein Zustand, bei dem man in seinem Handeln ganz und gar aufgeht und Raum und Zeit vergisst (Weinert, 1991, S.8). Vorraussetzung für das Zustandekommen von flow ist die Wahrnehmung einer Anforderung. Die Fähigkeit flow zu erleben lässt sich allerdings erlernen, z.B. durch verschiedene Arten von Meditation. Flow tritt meist bei klar strukturierten Aktivitäten auf (z.B. bei Spiel, Sport oder Ritualen), bei denen das Anforderungsniveau und die erforderlichen Fähigkeiten gesteuert werden können (Csikszentmihalyi, 1991, S.43ff.). Schon eine einfache körperliche Aktion macht Spaß, wenn sie so verändert wird, dass sie flow erzeugt (Csikszentmihalyi, 1999, S.134). Nach Gabler 2002 (S.160) kann Sporttreiben intrinsisch, also um seiner selbst willen, aber auch extrinsisch, also mit Zielen die außerhalb der sportlichen Handlung liegen, betrieben werden. Komponenten extrinsisch motivierter Ziele können z.B. Strafvermeidung, soziales Ansehen oder materielle Werte sein (Zarotis, 1999, S. 53). So ist nach Baumann (1993, S.132) jemand der Sport treibt, um in den Medien bekannt zu werden oder um Geld zu verdienen, extrinsisch motiviert. Dagegen derjenige, der durch seine sportliche Tätigkeit eine unmittelbare Befriedigung erfährt, intrinsisch motiviert. Im Gegensatz zu intrinsisch motivierten Menschen, die durch das Handeln eine unmittelbare Befriedigung ihrer Motive erleben, benötigen extrinsisch motivierte Menschen Bestätigungen von außen (z.B. Anerkennung oder Bezahlung). Aus diesem Grund sind intrinsisch motivierte Menschen stärker motiviert und erleben ihr Handeln tiefer und befriedigender (Baumann, 1993, S.132f.).
2.2.2 Motive und Motivation im Sport
Warum treiben Menschen Sport und warum sind die einen aktiv und die anderen nicht? Welche Motive sind dafür ausschlaggebend?
Diese Fragen sind Forschungsgegenstand vieler Autoren und Wissenschaftler. Nach Gabler (2000, S.245) ist Sporttreiben mit vielfältigen Motiven verbunden. Er beschreibt Motive im Sport als „Bereitschaften, sich in situationsüberdauernder, zeitlich überdauernder und persönlichkeitsspezifischer Weise in Situationen zielgerichtet zu verhalten“ (Gabler, 1988, S.233). Motivationen im Sport sind somit die emotionalen und kognitiven Prozesse vor, während und nach dem Sporttreiben (Gabler, 1988, S.233). Motive im Sport werden als „persönlichkeitsspezifische Wertungsdispositionen“ (Gabler, 2002, S.13) verstanden, welche auf Situationen im Sport gerichtet sind. Hiermit sind Grundsituationen gemeint, wie z.B. Leistung, Anschluss, Macht, Hilfe, Spiel und Aggression. Diesen Grundsituationen entsprechen das Leistungs-, das Anschluss-, das Macht-, das Hilfe- und das Aggressionsmotiv (Gabler, 2000, S.208). Grundsituationen sind häufig wiederkehrende Situationen, zu denen man relativ stabile und individuelle Bewertungssysteme entwickelt (Gabler, 2002, S.13). Macák bezeichnet die Motivation der Sporttätigkeit als einen dynamischen Prozess. Motive der sportlichen Tätigkeit determinieren als die inneren und äußeren Ursachen des Sportlerverhaltens den dynamischen Prozess der Motivation. Damit ist die Motivation also ein Prozess, der sowohl inhaltlich als auch formativ Einfluss auf die Sporttätigkeit hat (Macák, 1983, S.141). Fuchs (1997, S.174) betont, dass die Motivation zur sportlichen Aktivität ein lebenslanger Prozess ist. Wobei nach Gabler (2002, S.12) die Frage nach der Motivation des Sporttreibens gleichzusetzen ist mit der Frage nach dem Warum und Wozu des Verhaltens, nach den Beweggründen des Verhaltens, danach, was uns bewegt, uns so und nicht anders zu verhalten. Er stellt fest, dass sich Personen in ihrem sportlichen Verhalten dahingehend unterscheiden,
- „ob sie das Sporttreiben eher aufsuchen oder eher meiden,
- wie intensiv und ausdauernd sie sich jeweils sportlich betätigen,
- was sie während ihrer sportlichen Aktivitäten fühlen und erleben,
- welche Art des Sporttreibens sie bevorzugen,
- welches Risiko sie dabei eingehen und
- wie lange sie das Sporttreiben aufrechterhalten.“
Motivationale Aspekte für das Sporttreiben im Alltag können sich nach Gabler (2002, S.12f.) auf folgende Gesichtspunkte beziehen:
- auf die Freude an bestimmten Bewegungsformen und an ästhetischen und kinästhetischen Erfahrungen,
- auf die Lust an der Bewegung und am spannenden Geschehen,
- auf die Suche nach Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis, nach körperlicher Herausforderung und Selbstüberwindung, nach Risiko und Abenteuer,
- auf das Streben nach Leistung zur Selbstbestätigung und zur sozialen Anerkennung,
- auf die Möglichkeit zur Präsentation der eigenen Person und des Erreichens von Prestige und Macht oder
- auf das Streben nach Gesundheit, Fitness und körperlicher Tüchtigkeit, nach Abwechslung und Naturerlebnis, nach Sozialkontakten und Anschluss, Geselligkeit und Kameradschaft, aber auch nach materiellen Gewinnen und sozialem Aufstieg.
Pölzer (1994, S.23) führt an, dass sportliche Aktivität nicht „monothematisch“ begründet, sondern „multithematisch“ veranlasst ist. Das bedeutet, dass menschliches Handeln in der Regel nicht auf ein einziges Motiv zurückzuführen ist. So sind einzelne Motive nur ein Teil eines ganzen „Motivbündels“ und werden erst in Verbindung mit anderen Motiven wirksam. Pölzer führt als Beispiel das Gesundheitsmotiv an, welches für die regelmäßige sportliche Aktivität handlungsleitend ist. Andere Motive, wie z.B. das Leistungsmotiv, sind hierbei jedoch ebenfalls handlungsveranlassend. (Pölzer, 1994, S.23). Ein Motiv, welches bei der Aufnahme einer sportlichen Tätigkeit dominiert, kann Zarotis (1999, S.61) zufolge bei der weiteren Fortführung dieser sportlichen Aktivität gegenüber anderen Motiven an Bedeutung verlieren. Zu der Frage, warum manche Menschen gar keinen Sport treiben, liegen kaum Befunde vor. Es wird aber angenommen, dass hier ähnliche Motive wie beim Abbruch einer sportlichen Aktivität ausschlaggebend sind. Beispielweise Zeitmangel, Bequemlichkeit, negative Erfahrungen oder Einflüsse, mangelnde Gesundheit sowie bestimmte Ängste können angeführt werden (Abele & Brehm, 1990, S.143f.; Eberle, 1990, S.139f.).
2.2.2.1 Klassifizierung von Motiven im Sport
In der empirischen Motivationsforschung werden Motive in Klassifikationen eingeteilt. Abraham H. Maslow beschreibt eine Theorie über die Hierarchie der Motive. Er postulierte 1954, dass stets eine Hierarchie existiert, in der die menschlichen Bedürfnisse angeordnet sind. Dieses Hierarchiemodell (Abb. 2. 3) ist das Basismodell gegenwärtiger motivations-psychologischer Arbeiten. Als grundlegend werden die physiologischen Bedürfnisse angesehen. Es folgen die Bedürfnisse nach Sicherheit, die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe sowie das Bedürfnis nach Achtung. Die Spitze dieser Bedürfnishierarchie nimmt schließlich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ein. Die niedrigen Bedürfnisgruppen bezeichnet Maslow als Mangelbedürfnisse, welche das Individuum zur Verbesserung ihrer gegenwärtigen Lage treiben. Die höheren Bedürfnisgruppen werden als Wachstumsbedürfnisse bezeichnet, die das eigene Potential bestmöglich zu steigern versuchen. Bevor die höheren Bedürfnisse aktiviert werden, müssen zuerst die niedrigen Bedürfnisse befriedigt sein. Bei Konflikten zwischen Bedürfnissen verschiedener Hierarchieebenen erweisen sich die jeweils niedrigeren in der Regel als stärker (Maslow, 1978, S.74ff.; Heckhausen, 1989, S.68ff.; Zarotis, 1999, S.51f.; Zimbardo und Gerrig, 1999, S.324f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2. 3 Die Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow (eigene Abbildung in Anlehnung an Maslow 1978 S.74ff.).
Ausgangspunkt der Theorie von Maslow sind die so genannten physiologischen Bedürfnisse. Hier sind als klassische Beispiele Hunger, Durst und Sexualität zu nennen. Diese physiologischen Bedürfnisse sind nach Maslow die mächtigsten aller Bedürfnisse. Sie sind allerdings nicht vollständig isolierbar. Das bedeutet beispielsweise, dass man das Nahrungsbedürfnis mit anderen Aktivitäten, wie z.B. Wassertrinken, befriedigen kann. Sind nun die physiologischen Bedürfnisse relativ gut befriedigt, so motivieren uns die Bedürfnisse auf der nächsten Ebene – die Sicherheitsbedürfnisse. Diese können ebenso wie die physiologischen Bedürfnisse den gesamten Organismus dominieren. Beispielhaft kann man Begriffe wie Stabilität, Geborgenheit, Ordnung, Schutz und Angstfreiheit in diese Hierarchieebene einordnen. Der gesunde Erwachsene ist in unserer Gesellschaft in seinen Sicherheitsbedürfnissen im Großen und Ganzen befriedigt. Wenn nun sowohl die physiologischen als auch die Sicherheitsbedürfnisse zufrieden gestellt sind, tauchen die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Zuneigung, Liebe und Geliebtwerden auf. Die darauf folgende Hierarchieebene - Bedürfnisse nach Achtung – impliziert das Bedürfnis oder den Wunsch nach einer festen und hohen Wertschätzung der eigenen Person, nach Selbstachtung und der Achtung durch andere. An der Spitze der Hierarchie steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, welches erst dann auftritt, wenn alle anderen Bedürfnisse befriedigt sind. Personen in dieser Hierarchieebene akzeptieren sich selbst, sind offen für Veränderungen, selbstaufmerksam und möchten ihr eigenes Potential ausschöpfen. Die spezifische Form des Bedürfnisses nach Selbstverwirklichung ist jedoch von Person zu Person verschieden (Maslow, 1978, S.74ff.; Heckhausen, 1989, S.68ff.; Zarotis, 1999, S. 51f.; Zimbardo und Gerrig, 1999, S.324f.). Maslows Modell ist nicht als starr anzusehen, denn es gibt eine Anzahl von Ausnahmen bei denen eine Umkehrung der Rangordnung im Hierarchiemodell vorliegt. So gibt es beispielsweise Personen, denen Selbstachtung wichtiger erscheint als Liebe. Weiterhin wird nicht jedes Verhalten von den Grundbedürfnissen determiniert und ein Bedürfnis muss nicht hundertprozentig befriedigt sein, bevor das nächste auftritt (Maslow, 1978, S.95ff.). Kritiker halten dem sehr allgemein formulierten Modell der Bedürfnishierarchie die optimistische Annahme vor, dass in jedem Menschen das Bedürfnis nach Wachstum und voller Entfaltung seines Potentials vorhanden ist. Eine derart positive Sichtweise ist allerdings nicht haltbar, da neben den von Maslow benannten Bedürfnissen Menschen auch Macht, Dominanz und Aggression zum Ausdruck bringen (Zimbardo und Gerrig, 1999, S.325). Bezieht man Maslows Hierarchie der Motivgruppen auf das Sporttreiben und impliziert die Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung (Abb. 2.4), dann könnte daraus geschlussfolgert werden, dass im frühen Jugendalter vor allem die sozialen Bindungen im Sport von besonderer Bedeutung sind. Postpubertär sowie im Erwachsenenalter stehen Selbstverwirklichungsbedürfnisse und Identitätsbildung im Vordergrund (Gabler, 2000, S.202f.). In der folgenden Abbildung sind diese Zusammenhänge anschaulich dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2. 4 Hierarchie der Motivgruppen aufgrund relativer Vorrangigkeit in der Bedürfnisbefriedigung nach Maslow (In Anlehnung an Heckhausen, 1989, S.69).
Eine andere Klassifizierung der Motive im Sport veröffentlicht Gabler 2002 (S.14-16). Er unterscheidet die Motive danach, ob sie sich zum einen auf das Sporttreiben selbst, auf das Ergebnis des Sporttreibens oder auf das Sporttreiben als Mittel für weitere Zwecke beziehen und zum anderen, ob sie in erster Linie direkt auf die eigene Person bezogen („ichbezogen“) oder ob auch andere Personen dabei eingeschlossen sind („im sozialen Kontext“). So stellt beispielsweise das Motiv ‚Gesundheit’ ein ichbezogenes Motiv dar, wobei das Sporttreiben als Mittel für weitere Zwecke dient. Das Motiv ‚Soziale Interaktion’ steht dagegen im sozialen Kontext und ist auf das Sporttreiben selbst bezogen. In Tabelle 2. 3 ist diese einfache Klassifizierung ersichtlich.
Tab. 2. 3 Merkmale zur Klassifizierung von Motiven im Sport (Gabler, 2002, S.14) .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gabler baut nun diese Klassifizierung durch weitere Situationen aus, die im Sport immer wieder auftreten und denen Motive zuzuordnen sind (Tab. 2. 4). Er führt verschiedene Zitate von Athleten an, welche er dann den Motiven zuordnet. Als Beispiel gilt folgendes Zitat: „So, nun bin ich gespannt, ob mein Trainer endlich zufrieden ist“. Dieses Zitat ordnet Gabler dem Motiv ‚Leistung als Fremdbestätigung und soziale Anerkennung’ zu, welches ein Motiv im sozialen Kontext darstellt und sich im Wesentlichen auf das Ergebnis des Sporttreibens bezieht (Gabler, 2002, S.16f.).
Tab. 2. 4 Klassifizierung und Vielfalt der Motive im Sport (Gabler, 2002, S.17) .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In seiner Dissertation im Jahr 2000 beschreibt Hoff eine weitere Klassifizierung von Motiven im Sport. Er nahm eine Dreiteilung der Motive nach dem Gesichtspunkt der Sportspezifität vor (Tab. 2. 5).
Tab.2. 5 Dreigeteilte Motivstrukturierung nach dem Gesichtspunkt der Sportspezifität (Hoff, 2000, S.51) .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
So grenzt Hoff (2000) ‚sportspezifische Motive’ von ‚gemischten Motiven’ und ‚allgemeinen Motiven’ ab. Sportspezifische Motive, wie z.B. Körperformung, sind überwiegend oder nur durch Sport umsetzbare Motive. Gemischte Motive, wie z.B. Spannung und Risiko, sind besonders gut im Sport umzusetzen. Allgemeine Motive, wie z.B. Gemeinschaftserleben, sind in vielen Freizeitbereichen umsetzbar (Hoff, 2000, S.50f.).
2.2.2.2 Ausgewählte Studien zur Motivation im Sport
Eine Studie über die nähere Bestimmung und Ergründung fitnessbezogener Motive wurde 1999 von Georgios F. Zarotis veröffentlicht. Mit Hilfe eines Fragebogens befragte er von 1990 bis 1993 insgesamt 3248 Frauen und Männer in gesundheitsorientierten Fitness-Clubs. Die Fragestellung, welche Trainingsziele und Erwartungen die Probanden an ihr Training stellen, beinhaltet 16 Items. Diese Items ordnet er 7 verschiedenen Motivkomplexen zu: „Fitness/Gesundheit“, „Aussehen“, „Psychisches Erleben“, „Kognitive Dimension“, „Soziale Dimension“, „Leistung“ und „motorische Dimension“. Mit 83,3% der Nennungen ist das Item „Allgemeine Verbesserung der körperlichen Fitness“ das höchst bewertete Einzelmotiv des Motivkomplexes „Fitness/Gesundheit“ und der gesamten Untersuchung überhaupt. An zweiter Stelle folgt mit 49,9% der Nennungen das Item „Gewichtsreduktion (allgemeiner Fettabbau)“ aus dem Motivkomplex „Aussehen“. Dritte Position der Motive für den Besuch im Fitness-Club nimmt mit 43,3% der Nennungen das Item „Ausgleich zu beruflichem Stress“ aus dem Motivkomplex „Psychisches Erleben“ ein. Zarotis bezeichnet die eben genannten Motive als die „Top-drei-Motive aus der Gesamtstichprobe“. Auffällig ist, dass diese drei Einzelmotive einer extrinsischen Motivation zuzuordnen sind. „Intrinsische Motivationen können ihr Anreizpotential erst dann vollkommen entwickeln, wenn extrinsische Motive zum größten Teil erfüllt wurden“ (Zarotis, 1999, S.97). Bei der Betrachtung geschlechtsspezifischer Unterschiede stellt Zarotis zum Teil hochsignifikante Unterschiede fest. So liegt beispielsweise bei der Bewertung des Items „Muskelaufbau (Bodybuilding)“ aus dem Motivkomplex „Aussehen“ ein hochsignifikanter Unterschied zwischen Frauen (14,7%) und Männern (52,8%) vor. Hinsichtlich des Motivs „Ausgleich zum beruflichen Stress“ unterscheiden sich die Nennungen von Frauen und Männern nicht signifikant. Beim Vergleich der Altersgruppen stellt Zarotis fest, dass sich bei den Nennungen des Items „Ausdauerbetontes Herz-Kreislauf-Training“ aus dem Motivkomplex „Fitness/Gesundheit“ hoch signifikante Unterschiede darstellen. So ermittelt Zarotis 31,6% der Nennungen bei den über 45-jährigen, dagegen nur 20,5% der Nennungen bei den unter 25-jährigen. Keine signifikanten altersspezifischen Unterschiede stellen sich im Motivkomplex „Leistung“ dar. Die zentrale Aussage dieser Studie ist das betonte Gesundheitsbewusstsein der Menschen im Fitness-Sport. Fitness und Gesundheit sind das Top-Motiv der Fitness-Sportler und -Sportlerinnen.
Conzelmann, Gabler und Nagel befragten 2001 in einer Studie zur Sportentwicklung in Tübingen über 800 Einwohner mittels Fragebögen, warum sie sportlich aktiv sind. Sie sollten für bis zu drei Sportarten/Sportaktivitäten angegeben, inwieweit vorgegebene Motive zutreffen. Nach Berechnung der Mittelwerte wird deutlich, dass Menschen besonders aus Spaß bzw. Freude an der Bewegung, zum Wohlfühlen und als Ausgleich zum Alltag Sport treiben. Von ähnlich großer Bedeutung sind die Motive Fitness, Gesundheit, Entspannung und Stressabbau. Vergleicht man beide Geschlechter hinsichtlich ihrer Motive fällt auf, dass Frauen offensichtlich in größerem Maße aus gesundheitlichen Gründen sportlich aktiv sind und Sport eher als Ausgleich zum Alltag betreiben. Dagegen stehen für Männer eher leistungsbezogene Motivitems wie „sportliche Ziele verfolgen“, „“sich mit anderen messen“, „sportliches Können verbessern“ und „körperliche Anstrengung“ im Vordergrund (Gabler 2002, S.21). Im Vergleich der Altersgruppen (15-18 Jahre, 19-25 Jahre, 26-40 Jahre, 41-65 Jahre, 65 Jahre und älter) zeigt sich, dass leistungsbezogene Motive, wie z.B. sportliche Ziele und sportliches Können verbessern, mit zunehmendem Alter an Bedeutung verlieren. Dagegen wird das Motiv jung bleiben mit zunehmendem Alter wichtiger. Für jüngere Menschen ist das Motivitem „soziale Anerkennung“ von großer Bedeutung. Mit zunehmendem Alter treiben die Menschen dagegen eher aus Freude an der Bewegung, um sich wohl zu fühlen und aus gesundheitlichen Gründen Sport. Bei den 19- bis 65-Jährigen steht der Motivbereich Ausgleich, Entspannung und Stressabbau im Vordergrund.
Die SPORT+MARKT AG führte 2001 im Auftrag der Brauerei C. & A. Veltins und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sportbund die so genannte Veltins Sportstudie 2001 durch. Untersucht wurden unter anderem die Motive für sportliche Aktivitäten allgemein und die Funktion des Sportvereins. Per Telefonumfrage wurden die Daten von 1023 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren erhoben, die regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche, Sport treiben. Im Ergebnis dieser Studie werden Radfahren, Schwimmen und Joggen als beliebteste Sportarten herausgestellt. Durchschnittlich 2,9-mal bzw. 5,4 Stunden pro Woche widmen die Probanden ihrer Sportart. Hauptmotive für die sportliche Aktivität sind „Spaß“ (84%), „körperliche Fitness (80%) und die „Förderung der Gesundheit“ (68%). Danach folgen die Motive „Stressabbau/Entspannung“ (54%), „Figurbewusstsein“ (51%) und „Ausgleich von Bewegungsmangel“ (50%). Lediglich 47% der Nennung treffen auf das Motiv „Geselligkeit/Gemeinschaft“.
[...]
[1] Im Verlauf dieser Arbeit kann es zur Verwendung von Bezeichnungen in der männlichen Form kommen. Dies ist als geschlechtsneutral zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Juliane Vaupel (Autor:in), 2006, Selbstkonzeptbezogene und motivationale Aspekte im Aqua-Fitness, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63497
Kostenlos Autor werden
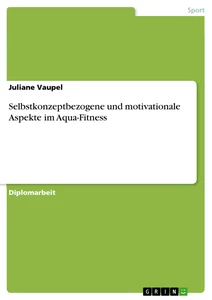
















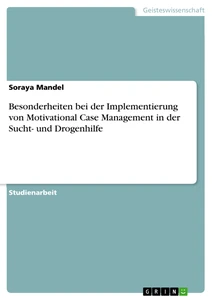
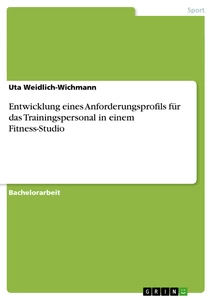
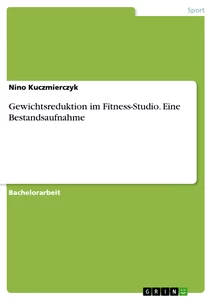
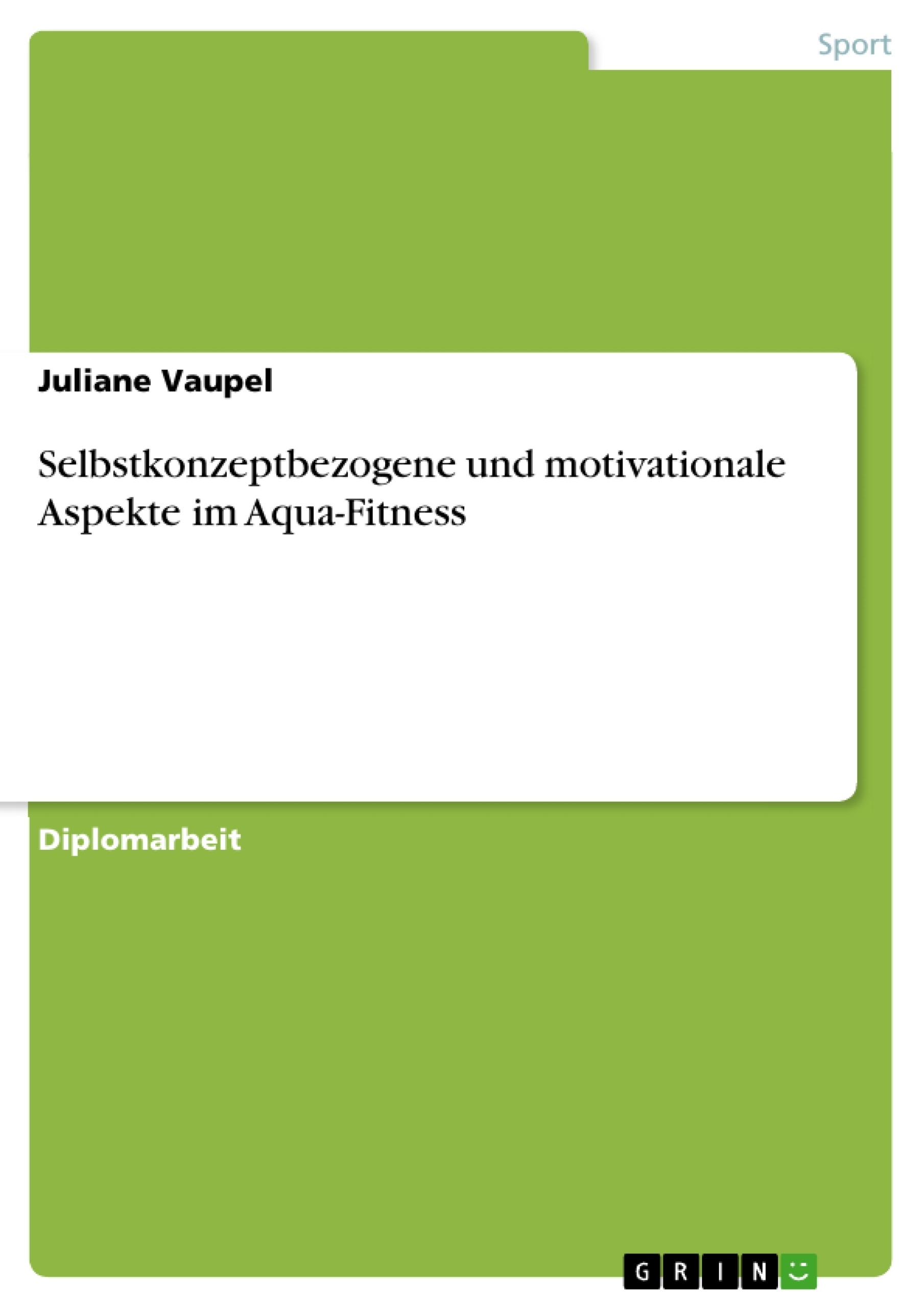

Kommentare