Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Anstoß zu diesem Thema
Aufbau und Überblick über die Arbeit
Theoretischer Teil
Kapitel 1 – Der Traumatisierte
1. Das Trauma
1.1. Kritische Lebensereignisse
1.2. Trauma
1.2.1. Typ I/II Traumatisierungen
1.2.2. Historie
1.2.3. Reaktionsweisen
1.2.3.1. Häufigkeiten und Komorbiditäten
1.2.3.2. Unfälle
1.2.3.3. Lagererfahrungen
1.2.3.4. Sekundäre Traumatisierung
1.3. Behandlungsmöglichkeiten
Kapitel 2 – Der Angehörige
2. Inhalt der Untersuchung
2.1. Der Angehörige in der Psychotraumatologischen Forschung
2.1.1. Exkurs: Sekundäre vs. Teritäre Traumatisierung21
22. Definition der Sekundären Traumatisierung.
2.3. Theorie der Entstehung von Sekundärer Traumatisierung
bei Angehörigen
2.3.1. Compassion Fatigue
2.4. Der Angehörige in der Therapie des Traumatisierten
2.4.1. Das System Familie
2.4.2. Familiäre Bewältigung
2.4.3. Das ABCX Modell
2.5. Bedeutung des Traumas für das Zusammenleben
2.5.1.Generationseffekt/ Familienaufgaben
2.6. Eigene Emotionen
Methodenteil
Kapitel 3 - Die Durchführung der Untersuchung
3. Qualitative Sozialforschung
3.1. Die Grounded Theory
3.2. Das Problemzentrierte Interview
3.2.1. Bestandteile des Interviews
3.2.2. Der Interviewleitfaden
3.2.3. Festlegung der Stichprobe
3.2.3.1. Einschlusskriterien
3.2.3.2. Ausschlusskriterien
3.2.3.3. Stichprobengröße.
3.3. Rekrutierung
3.4. Durchführung der Interviews
3.5. Computergestütze Auswertung
3.6. Gütekriterien
Ergebnisteil
Kapitel 4 – Die Darstellung der Ergebnisse
4.1. Die Ergebnisse.
4.1.1. Personenbezogene Daten
4.1.2. Die Interviewpartner
4.2. Das Paradigmatische Modell
4.2.1. Das Kernphänomen: Enttäuschung/ Frustration des Anlehnungsbedürfnisses
4.2.2. Ursächliche Bedingungen
4.2.2.1. Emotionalen Unerreichbarkeit des Traumatisierten
4.2.2.2. Traumabedingte Isolation des Traumatisierten
4.2.2.3. Seelische und gesundheitliche Traumafolgen
4.2.3. Intervenierende Bedingungen
4.2.3.1. Gesicherte Versorgung vs. Existenzsorgen
4.2.3.2. Gute vs. schlechte Therapie
4.2.3.3. Soziales Umfeld
4.2.4. Kontext
4.2.4.1. Interaktion mit dem Traumatisierten
4.2.4.2. Traumabewertung durch den Angehörigen
4.2.4.2.1. Bekanntes Trauma
4.2.4.2.2. Unbekanntes Traum
4.2.4.3. Überforderung durch Leistungsanspruch
4.2.4.4. Mehrbelastung durch Aufgabenübernahme
4.2.4.5. Pflichtbewusstsein
4.2.4.6. Schuld und Scham
4.2.4.7. Emotionale Kontamination
4.2.5. Handlungs- und Interaktionalen Strategien
4.2.5.1. Gespräche und andere Integrationsversuche
4.2.5.2. Konfliktvermeidung
4.2.5.3. Leugnung eigener Belastung
4.2.5.4. Versuch der aktiven Bewältigung
4.2.5.4.1. Interaktiv
4.2.5.4.2. Individuell
4.2.5.5. Hilfe von außen
4.2.6. Konsequenzen
4.2.6.1. Partnerschaftliche Bewältigung
4.2.6.2. Wünsche
4.2.6.3. Trost durch überleben
4.2.6.4. Akzeptanz der bestehenden Bedingungen
4.2.6.5. Autonomiezuwachs
4.2.6.6. Unzufriedenheit mit der partnerschaftlichen Beziehung
4.2.6.7. Fatalismus
4.2.6.8. Selbstüberforderungstendenzen
4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse
Kapitel 5 – Die Diskussion der Ergebnisse
5.1. Geltungsbereich
5.1.1. Repräsentativität
5.1.2. Sättigung
5.2. Methodendiskussion
5.2.1. Grounded Theory…
5.2.2. Problemzentriertes Interview
5.3. Diskussion der Befunde
5.4. Ausblick
6. Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Kapitel 1
Abb. 1 Normale Trauma-Reaktions-Phasen
Abb. 2 Arten der Reaktion auf ein traumatisches Ereignis Kapitel 2
Abb. 3 Reaktionen des Systems Familie
Abb. 4 Hill’s ABCX Modell
Abb. 5 McCubbins doppeltes ABCX Modell nach Hill Kapitel 3
Abb. 6 Theorieverständnis in der qualitativen Forschung Kapitel 4
Abb. 7 Tabelle der ausgewerteten Interviews
Abb. 8 Paradigmatisches Modell
Abb. 9 Dimensionale Darstellung der gefundenen Emotionen
Abb. 10 Graphische Darstellung der zusammengefassten Ergebnisse
Einleitung
Anstoß zu diesem Thema
Die Idee zu dieser Diplomarbeit hatte einen langen Vorlauf. Schon seit langer Zeit galt mein Interesse den menschlichen Folgen von Katastrophen, im großen wie im kleinen. Ausgelöst wurde dieses Interesse durch die Flugschau-Katastrophe von Ramstein. Die Meldungen darüber fesselten meine Aufmerksamkeit über einige Tage, ähnlich den Ereignissen des Zugunglückes von Eschede und der WTC-Katatstrophe. Viele Fragen gingen mir durch den Kopf: Was geschieht dort mit den Menschen? Erhalten sie genug Hilfe? Wer kümmert sich um die Retter, wenn sie verzweifelt am Wegrand sitzen bleiben? Wie geht es den Angehörigen der Primär-Betroffenen, wer kümmert sich um sie?
Im Rahmen meiner Diplomarbeit wollte ich nun eine dieser Fragen untersuchen. Meine Wahl fiel auf die Betrachtung der Gruppe der erwachsenen Angehörigen (wobei ich die Ehe- und Lebenspartner mit einschließe) von Primär-Betroffenen, denn diese sind, wie ich noch aufzeigen werde, vor allem in Deutschland noch kaum erforscht.
Bislang galt das wissenschaftliche und auch öffentliche Interesse in erster Linie natürlich den Betroffenen. Außerdem begann man sich zu fragen, wie es wohl den Helfern vor Ort gehen könnte, den Feuerwehrleuten, Notärzten oder Polizisten. Forschungsarbeiten zu diesem Thema gelangten regelmäßig zu dem Schluß, dass diese Personengruppe ebenso traumatisiert und in der Folge eine posttraumatische Belastungsstörung ausbilden kann, wie die Hauptbetroffenen (siehe Maercker/Pieper, 1999 u. Stamm, 2002).
Die Situation der Angehörigen bleibt weiterhin im dunkeln. Zwar perfektioniert sich die Kette derer, die Menschen in Unglückssituationen zu Hilfe eilen, zu nennen wären hier die Notärzte, Sanitäter, Feuerwehren und weiterhin Notfallpsychologen. Eine Aufgabe der Notfallpsychologen ist u.a. die Begleitung und Betreuung von Angehörigen während und nach der Überbringung einer Todes- oder Unfallnachricht. Die Betreuung erstreckt sich auf maximal eine Woche (Berliner Krisendienst).
In das Feld der Betrachtung rücken die Angehörigen dann erst wieder bei der Behandlung des Posttraumatischen Belastungssyndrom's ihrer nahen Verwandten oder Partner. Hier wird ihnen die schwierige Situation des Erkrankten ausführlich erklärt, denn es hat sich gezeigt, dass das soziale Netz um einen Traumatisierten herum von äußerster Wichtigkeit ist (Fischer, 2000).
Aber was erleben oder fühlen Angehörige von Menschen, die eine oder sogar mehrere traumatische Erfahrungen gemacht haben, in den Monaten und Jahren, die auf das Unglück folgen?
Genau an diesem Punkt möchte ich mit dieser Arbeit ansetzen. Niemand weiß genau, wie sich Menschen fühlen, die zuhause in ihrer Familie mit einem, unter Umständen, extrem schwierigen Menschen zusammenleben. Einen schweren Unfall, oder ein vergleichbares Ereignis, mit all seinen juristischen und finanziellen Folgen verarbeiten zu müssen, ist an sich schon eine sehr große Aufgabe. Wieviel schwerer muß eine solche Aufgabe wiegen, wenn der Hauptbetroffene des Unglücks zusätzlich psychische Symptome entwickelt? Etwas Licht in das Dunkel dieses Gebietes zu bringen ist Anliegen der vorliegenden Arbeit.
Aufbau und Überblick über diese Arbeit
Die Diplomarbeit besteht aus zwei Bänden. Der erste Band beschäftigt sich mit der Theorie, der Durchführung der Untersuchung und ihrer Auswertung und Diskussion. Der zweite Teil liegt in Form einer CD-ROM vor, auf der sich die Interviewtranskripte, der Interviewleitfaden und die Auswertungsprotokolle aus ATLAS/ti befinden.
Band 1 ist zunächst in drei Teile gegliedert:
1. Theoretischer Teil
2. Methodenteil, und
3. Ergebnisteil
Der Theoretische Teil ist dabei der Übersichtlichkeit halber in zwei Teile untergliedert. Obwohl sich diese Arbeit mit den Angehörigen von traumatisierten beschäftigt, beginnt sie mit der eingehenden Betrachtung der Traumatisierten. Das erlebte Trauma ist die Ursache der hier untersuchten Auswirkungen. Dieses Trauma wirkt zunächst auf eine Person ein, die entsprechend darauf reagiert. Dann erfolgt die prompte Reaktion des gesamten Umfeldes, meist sofort im Anschluß an das Trauma. Die daraus resultierenden Auswirkungen sind Gegenstand der Untersuchung. Aus Gründen der besseren Verständlichkeit wird diese chronologischen Abfolge hier beibehalten.
Im Methodenteil schließt sich die qualitative Untersuchung des Thema's an.
Im Anschluss daran werden die Untersuchungsergebnisse im Ergebnisteil ausführlich erläutert und diskutiert.
Der Deutlichkeit halber soll an dieser Stelle noch darauf hingewiesen sein, dass in dieser Untersuchung stets von zwei Personengruppen gesprochen werden wird:
- den von einer traumatischen Erfahrung Betroffenen, die nachfolgend immer die Bezeichnung Traumatisierte tragen werden,
- und den Angehörigen, bzw. Ehepartnern der primär Betroffenen, die Gegenstand dieser Untersuchung sind, und die nachfolgend zusammenfassend als Angehörige bezeichnet werden.
1. Das Trauma
In diesem Kapitel wird der Traumabegriff abgegrenzt und definiert und die Reaktionsweisen auf eine traumatische Erfahrung erläutert. Dabei wird deutlich werden, dass eine traumatische Erfahrung nach menschlichem Ermessen einen Einfluß auch auf die Personen in der direkten Umgebung der Traumatisierten haben müßte.
Der Begriff des Traumas wird auf vielfältige Weise benutzt, in Forschung und Wissenschaft wie im alltäglichen Umgang. Da der Begriff sehr häufig im Alltag genutzt wird, um auch einschneidende Erlebnisse, wie etwa Life-Events (zu deutsch: Kritische Lebensereignisse) zu bewerten, erscheint eine Begriffsbestimmung vorab angebracht.
1.1. Kritische Lebensereignisse
Life-Events, bzw. Kritische Lebensereignisse werden nach Oerter/Montada (1998, S. 68) als Einschnitte in den Lebenslauf definiert, die eine Neuorientierung und die Bewältigung von Verlusten verlangten. Dazu zählen u.a. die Geburt eines Kindes, Scheidung, Umzug, Arbeitslosigkeit, schwerwiegende Erkrankungen oder Behinderungen und der Verlust nahestehender Personen durch Tod. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Ereignisse multiple Probleme generieren können, die als Herausforderung und Chance für eine positive Entwicklung wahrgenommen werden können oder sich als Risiken für Fehlanpassungen und Störungen auswirken können.
Sigrun-Heide Filipp (1981, S. 23) beschreibt kritische Lebensereignisse als Veränderungen in der sozialen Lebenssituation einer Person die durch eine Anpassungsleistung beantwortet werden müssen. Damit wird klar, wo der Unterschied zu einer traumatischen Erfahrung liegt. Wie unten beschrieben, sind die Auslöser eines Traumas Katastrophen, bzw. katastrophale Ereignisse. Kritische Lebensereignisse werden dagegen durch normale soziale Entwicklungen hervorgerufen, wie z.B. die Geburt eines Kindes, dass ebenfalls sehr großen Stress verursachen kann. Die Begriffe Stress und Trauma sind zwar in der Bezeichnung Posttraumatisches-Streß-Syndrom (PTBS) eng miteinander verbunden, dieser Umstand wird jedoch von Fischer & Riedesser als nicht ganz unproblematisch angesehen (1999, S. 16). Sie merken an, dass auch im alltäglichen Leben zwischen Stress und Trauma deutlich unterschieden wird. Unter Trauma verstehe man eine seelische Verletzung, unter Stress dagegen eher eine alltägliche Erscheinung.
1.2. Trauma
Ein Trauma ist ein Ereignis, das bei nahezu jeden Menschen eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Das Wort Trauma stammt ursprünglich aus dem griechischem und bedeutet "Wunde". (Lexikon der Psychologie, 1995, S. 503)
Auslöser von Traumata sind Katastrophen.
Katastrophen können grob in zwei Arten gegliedert werden: in Naturkatastrophen und sogenannten Man-Made-Desaster. Zu den Naturkatastrophen zählen Lawinen (Murren, Schnee), extreme atmosphärische Strömungen (Tornados, Hurrikane, Orkane), Erdbeben (und Vulkanausbrüche) und Hochwasserkatastrophen (Sturmfluten, Tsunamis und Flußüberschwemmungen). Man-Made-Desaster werden eingeteilt in Technikkatastrophen (Flugzeugabstürze, Bahnunfälle, Schiffsunglücke, Reaktorkatastrophen u.a. Industrieunfälle), Krieg (Lager, Gefangenschaft, Folter, Vertreibung, Bombenangriffe, Kampfhandlungen Flucht) und Verbrechen (Überfälle, Vergewaltigungen, Kindesmissbrauch, -misshandlungen).
Das DSM-IV (309.81) beschreibt ein traumatisches Ereignis wie folgt:
„Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten. Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen.“ (APA, 1996)
W. Butollo (1999, S. 110) beschreibt traumatische Erlebnisse als Grenzerfahrungen, die Menschen an die Grenze ihrer Belastbarkeit, ihrer Flexibilität, ihres Handlungs-, und Fassungsvermögens bringt, und mitunter auch an die Grenze zwischen Leben und Tod. Dabei betont er, dass zwar die Art der traumatischen Erfahrung durchaus unterschiedlicher Natur sein kann, die Reaktion auf ein erlebtes Trauma sich aber bei vielen Menschen so sehr ähnelt, dass daraus auf grundlegende Anpassungsprozesse geschlossen werden kann. Neuere Untersuchungen zeigen eher einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Traumatisierung und der Reaktion darauf. (Butollo, 1999, S. 111). Dabei beschreibt Butollo eine traumatische Erfahrung immer auch als eine existentielle Erfahrung. Sie hat einen bestimmten Platz im Erfahrungsraum einer Person und lässt sich durch folgende Dimensionen definieren (Butollo, 1999, S. 117):
- Dauer und Intentionalität
- Vertrauensbruch
- Vorhersehbarkeit
- Kontrollierbarkeit
- Entsetzlichkeit und Absurdität
- Verlust, Bedrohung und Verletzung
- Verantwortlichkeit
Fischer und Riedesser (1999, S. 351) definieren die traumatische Erfahrung als vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den Bewältigungsmöglichkeiten der Person. Eine traumatische Erfahrung gehe mit Gefühlen der Hilflosigkeit und schutzlosen Preisgabe einher und bewirke auf diese Weise eine dauerhafte Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses. Die Reaktionen darauf können von katatoner Lähmung bis panikartiger Bewegung reichen (Fischer & Riedesser, 1999, S.79). Die Autoren entwickelten zur Beschreibung dieses Prozesses ein Modell des Situationskreises. Dabei stellen sie eine zirkuläre Beziehung zwischen einer Person (Subjekt) und ihrer Umwelt auf einer Handlungs-(effektorische Sphäre) und Wahrnehmungsebene (rezeptorische Sphäre) her. Unter normalen Bedingungen befinden sich beide Ebenen im Zustand einer Selbstregulation, die durch eine traumatische Erfahrung unterbrochen werden kann und in denen Handlungstendenzen (z.B. Flucht) sich auf die Wahrnehmung auswirken können (z.B. Tunnelsicht) (Fischer & Riedesser, 1999, S.82).
1.2.1. Typ I/II Traumatisierungen
In der Literatur hat sich die Einteilung in Typ I und Typ II Traumatisierungen durchgesetzt (Butollo, 1999, S. 39). Diese Einteilung ging von Terr (1991, in Butollo, 1999 ) aus und wurde ursprünglich zur Einteilung kindlicher Traumata eingeführt. Typ I Traumatisierungen beschreiben dabei die Folgen eines unerwarteten einzelnen Ereignisses, wie das eines Unfalles. Eine Typ II Traumatisierung entsteht dagegen durch mehrmalige, sich wiederholende oder andauernde Traumata, z.B. bei sexualisierter Gewaltanwendung, wie beim wiederholten Kindesmissbrauch. Hauptunterschied zwischen beiden Typen ist die Reaktion des Traumatisierten darauf. Eine Person mit einer Traumatisierung vom Typ II verhält sich zunächst wie eine Person, die eine Traumatisierung vom Typ I erlitten hat. Aber dann erlebt sie, wegen des Wiederholungscharakters, einen Anpassungsprozeß etwa in Form der Selbsthypnose oder Dissoziation. Typ I Traumatisierungen dagegen prägen sich ins Gedächtnis ein und führen eher zur Symptomatik eines Posttraumatischen Belastungssyndroms (im weiteren Verlauf: PTBS). Die Betroffenen werden von den Ereignis überwältigt und bleiben erschüttert zurück.
Bevor wir nun die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf traumatische Ereignisse betrachten, werfen wir einen Blick auf die historische Entwicklung des Traumabegriffs.
1.2.2. Historie
Traumatische Erfahrungen mussten Menschen zu allen Zeiten machen, aber die Aufmerksamkeit der Wissenschaft erlangten solche Erfahrungen erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts (Sachsse, 1998, S. 1), als sich eine Gruppe von Gerichtsmedizinern zur Erstellung von Kriminalstatistiken mit der Traumatisierung von Kindern auseinandersetzte. 1887 wurde das Konzept der traumatischen Erfahrung von Charcot in Frankreich entwickelt und durch Oppenheim 1888 als „traumatische Neurose“ weitergeführt. Er beschrieb Desorientiertheit, Probleme beim sprechen sowie Schlafstörungen in der Folge von Eisenbahn- und Arbeitsunfällen. Allerdings wurde sein Konzept nicht anerkannt, weil es zu einer Entschädigungspflicht der Arbeitgeber geführt hätte. (Seidler, et al, 2002 S. 2).
Nach Fischer & Riedesser (1999, S. 32) kann die Entwicklung der Psychotraumatologie historisch wie inhaltlich in drei Abschnitte gegliedert werden, die sich im Lauf der Zeit bis auf den heutigen Tag immer weiter annäherten und sich heute, durch die Konzentration auf den Zusammenhang zwischen Individuum und Umwelt, gegenseitig ergänzen.
Die früheste Richtung stellt dabei die Psychoanalyse dar.
Besonders bedeutsam waren in diesem Zusammenhang die Erkenntnisse von Charcot, Janet und Freud an der Pariser Salpetriere (Fischer &Riedesser, 1999, S. 32). Charcot bemerkte, dass viele psychopathologische Symptome im Zusammenhang mit verdrängten Erinnerungen standen. Janet prägte den Begriff der Dissoziation. Manche Erinnerungen überforderten das Bewusstsein so sehr, das es zu einem Abspaltungsprozess käme, mit dem Ziel einer späteren Verarbeitung. Eine solche Verarbeitung kann in verschiedenen Formen auftreten: als emotionaler Erlebniszustand, körperliches Zustandsbild, als innere Bilder oder Vorstellungen oder in der Reinszenierung des Verhaltens. Die Entdeckung, dass sich eine traumatische Erfahrung auf kognitiver und konativer Ebene sowie als physiologische Reaktionen auswirkt, ist das Verdienst von Janet.
In seinen Studien zur Hysterie (1875) war Sigmund Freud davon überzeugt, dass eine reale traumatische Erfahrung (insbesondere sexueller Natur) die Grundlage jeder späteren hysterischen Störung sei. Etwa ab 1905 relativierte er diese Auffassung und entwickelte den Zusammenhang zwischen kindlichen Triebwünschen und der Entwicklung einer neurotischen Störung (Fischer & Riedesser, 1999, S. 33).
Als ebenfalls der psychoanalytischen Schule zugehörig lässt sich weiterhin Abraham Kardiner als bedeutsam für die Entwicklung der Psychotraumatologie nennen. Während des 2. Weltkrieges beschrieb er die Auswirkungen von Kampfhandlungen auf die Soldaten in seinem 1941 erschienenen Buch „The traumatic neuroses of war“. Fischer & Riedesser (1999) betonen den Zusammenhang von erschütternden Ereignissen in der Sozialgeschichte und der Entwicklung der Psychotraumatologie. So waren in den beiden Weltkriegen die Ärzte mit den Opfern der sogenannten Kriegsneurosen (Shell Shock) konfrontiert.
Nach dem 2.Weltkrieg befasste sich die Wissenschaft mit den Überlebenden des Holocaust. Grund dafür war vor allem die Argumentation deutscher Psychiater in Entschädigungsverhandlungen. Sie behaupteten, KZ-Folgeschäden seien auf eine genetische Ursache zurückzuführen, nicht auf die Bedingungen der Umwelt. Solche aus der Luft gegriffenen Behauptungen führten in der Folgezeit jedoch zu einer verstärkten Forschungsanstrengung, die einen weiteren Höhepunkt durch den Vietnamkrieg erfuhr. Einige Soldaten entwickelten nach ihren Einsätzen in Kampfgebieten so schwere und auffällige Symptome, dass sie einer Behandlung bedurften. Aus der Arbeit mit ihnen erwuchs ein immer größeres Wissen über den Zusammenhang zwischen einer traumatischen Erfahrung und der Reaktion darauf. Ein Ergebnis dieses Erkenntniszuwachses ist die 1980 erfolgte Aufnahme der Diagnose „Posttraumatisches Belastungssyndrom“ (PTBS) in das DSM III (Seidler, et al, 2002, S. 2).
Die zweite Forschungsrichtung war die Lerntheoretisch/Behavioristische Schule. Das von Max Stern 1988 entwickelte Konzept beschreibt als Folge massiver Traumatisierungen eine katatonoide Reaktion einerseits, einem Erstarren oder einem agitierten Bewegungsturm andererseits. Diese Zustände, die sogenannten Katastrophischen Reaktionen, ähneln dem Konzept der „erlernten Hilflosigkeit“ von Seligman und schließen damit den Bogen zu einer behavioristischen Betrachtung traumatischer Erfahrungen.
Als dritte Forschungsrichtung nennen Fischer & Riedesser (1999, S. 39) eine neurobiologische Betrachtungsweise auf der Grundlage der Pionierarbeiten zur Stressforschung von Selye. 1936 konzipierte er das Modell der Stressreaktion mit drei Phasen des Alarms, vom Widerstandstadium bis zum Erschöpfungsstadium. Er unterteilt Stressoren in positive und negative und nennt sie „Eustress“ und „Disstress“.
Die sogenannte „Kognitive Revolution“ führte zu einer differenzierteren Betrachtung der Subjekt-Umwelt-Beziehung in dessen Folge Lazarus 1984 sein transaktionales Stressmodell entwickelte. In diesem Modell werden subjektive Vermittlungsgrößen wie z.B. Abwehr- und Copingprozesse berücksichtigt.
1.2.3. Reaktionsweisen
Eine traumatische Erfahrung zu machen ist für jeden Menschen ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass zu verschiedenen Störungsbildern führen kann.
Die Reaktion beinhaltet vor allen Dingen eine Neuorientierung innerer Überzeugungen der Person von sich und der Welt. Beide Einstellungen müssen auf die veränderte Realität nach dem traumatischen Ereignis angepasst werden (Horowitz, 1999, S. 3).
Allgemein beschreibt Horowitz die Reaktion auf ein traumatisches Ereignis in sechs aufeinanderfolgenden Phasen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Normale Trauma-Reaktions-Phasen (Horowitz, 1999, S. 5)
In der ersten Phase sind alle psychischen Funktionen normal, die Erfahrungen werden bewusst aufgenommen. Dann setzt das Trauma ein. In der Phase des Aufschrei’s erlebt die Person intensive Emotionen, ihre Gedanken rasen. Die Phase der Leugnung schließt sich unmittelbar an das traumatische Ereignis an. Die Gefühle scheinen wie abgeschaltet. Erinnerungen und Gedanken an das Ereignis werden vermieden. Während der Phase des Wiedererlebens erfährt die Person sich unwillkürlich aufdrängende Erinnerungen die so genau sein können, dass das Gefühl besteht, das Ereignis noch einmal zu erleben. Solche Erfahrungen sind von intensiven Emotionen begleitet. In der Verarbeitungsphase wechseln Stadien sich aufdrängender Gedanken mit Stadien vollkommener Verdrängung. Diese Phasen können mehrfach durchlaufen werden und wechseln einander solange ab, bis die Traumaverarbeitung abgeschlossen ist (Horowitz, 1999, S. 5).
Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Phasen der Reaktion in unterschiedlichem Ausmaß und unter unterschiedlichen inneren wie äußeren Bedingungen einer Person durchlaufen werden.
Daher unterscheidet Horowitz drei Arten der Reaktion auf ein traumatisches Ereignis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 Arten der Reaktion auf ein traumatisches Ereignis (Horowitz, 1999, S. 7)
Ein anderer Erklärungsansatz für die Reaktionen auf eine traumatische Erfahrung kommt aus der Neuropsychologischen Forschung. Intensive Forschung mit bildgebenden Verfahren, wie der Kernspintomographie, haben einen Zusammenhang zwischen einem bestehenden PTBS und der Atrophie der Hippokampusformation gezeigt. (Fischer et al, 2002). Die massive Ausschüttung von Neurohormonen führt danach zur Veränderung der zentralen Wahrnehmungsverarbeitung im Gedächtnis. Es besteht in diesem Fall keine normale, kategoriale Wahrnehmungsverarbeitung mehr, sondern nur noch ein chaotisches Abspeichern zusammenhangloser Sinneseindrücke (timeless und ego-alien). Dadurch kommt es zur Desynchronisation von implizitem und explizitem Gedächtnis. Diskutiert wird, ob das vorgefundene Zustandbild schon vorher bestand, durch die traumatische Einwirkung entstand, oder Folge des PTBS ist.
Basierend auf strenger wissenschaftlicher Methodologie wurde das „Internationale Klassifikationsschema für Krankheiten“ (International Classification of Diseases, ICD-10) entwickelt, darin werden 7 verschiedene Reaktionsweisen unterschieden, die in drei große Bereiche unterteilt sind:
F43.0 Akute Belastungsreaktion:
Eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt, und die im allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt. Die individuelle Vulnerabilität und die zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen (Coping-Strategien) spielen bei Auftreten und Schweregrad der akuten Belastungsreaktionen eine Rolle. Die Symptomatik zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit einer Art von "Betäubung", mit einer gewissen Bewußtseinseinengung und eingeschränkten Aufmerksamkeit, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und Desorientiertheit. Diesem Zustand kann ein weiteres Sichzurückziehen aus der Umweltsituation folgen (bis hin zu dissoziativem Stupor, siehe F44.2) oder aber ein Unruhezustand und Überaktivität (wie Fluchtreaktion oder Fugue). Vegetative Zeichen panischer Angst wie Tachykardie, Schwitzen und Erröten treten zumeist auf. Die Symptome erscheinen im allgemeinen innerhalb von Minuten nach dem belastenden Ereignis und gehen innerhalb von zwei oder drei Tagen, oft innerhalb von Stunden zurück. Teilweise oder vollständige Amnesie bezüglich dieser Episode kann vorkommen.
F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung
Diese entsteht als eine verzögerte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Prädisponierende Faktoren wie bestimmte, z.B. zwanghafte oder asthenische Persönlichkeitszüge oder neurotische Krankheiten in der Vorgeschichte können die Schwelle für die Entwicklung dieses Syndroms senken und seinen Verlauf erschweren, aber die letztgenannten Faktoren sind weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung zu erklären. Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Alpträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung über.
Das DSM IV teilt die diagnostischen Kriterien eines PTBS in 4 große Bereiche ein (APA, 1996):
- Konfrontation mit einem traumatischen Ereignis:
Wobei die Person mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen reagierte.
- Unwillkürliches Wiedererleben des traumatischen Ereignisses:
In Form von plötzlich einschießenden, belastenden, wiederkehrenden Erinnerungsfetzen, wiederkehrenden Alpträumen, heftiges Wiedererleben der traumatischen Situation bei Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, heftiger körperlicher Reaktion bei Konfrontation.
- Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind:
In Form von Vermeidung von Gedanken,, Gefühlen, Gesprächen, Aktivitäten, Orten oder Menschen, die die Erinnerung an das Trauma wachrufen, der Unfähigkeit wichtige Aspekte des Traumas zu erinnern, vermindertest Interesse an wichtigen Aktivitäten, Entfremdung von anderen, eingeschränkte Bandbreite des Affekts, Gefühl, eine eingeschränkte Zukunft zu haben.
- Übererregung:
In Form von Schlafstörungen, Reizbarkeit und Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten, übertriebene Wachsamkeit, übertriebene Schreckreaktionen
Das Störungsbild muss länger als einen Monat bestehen und in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursachen.
1.2.3.1. Häufigkeiten und Komorbiditäten
Nicht jeder Mensch entwickelt jedoch in der Folge einer traumatischen Erfahrung eine der oben beschriebenen Störungen. Z.B. entwickeln 25% – 29% von Katastrophenopfer und Kriegsveteranen ein PTBS (Nathan & Fischer, 2001, S. 3). Nach einer Studie der Universität Göttingen entwickeln Opfer von Brandkatastrophen, die eigene, schwere Verbrennungen davongetragen haben in bis zu 40% der Fälle ein PTBS (Winter, 2001).
Die Lebenszeitprävalenz für die Entwicklung eines PTBS liegt nach einer Untersuchung des US-amerikanischen „National Comorbidity Survey“ in der Allgemeinbevölkerung der USA bei 7,8%. (Butollo, 1999, S. 66). Damit ist sie eine so häufige Störung wie etwa die Depression und andere Angststörungen. Dabei lag der Anteil der Personen, die mindestens eine traumatische Erfahrung berichten konnten bei 60,7% bei Männern und 51,2% bei den Frauen. Außerdem variiert die Häufigkeit einzelner Stressoren und das damit verbundene Risiko, ein PTBS auszubilden, erheblich. So wurde als der häufigste Stressor für Männer in dieser Untersuchung die Zeugenschaft von gewaltsamem Tod oder schwerer Verletzung mit 35,6% angegeben, eine PTBS entwickeln aber nur 6,4% der auf diese Weise Betroffenen. Andererseits liegt die Häufigkeit einer Vergewaltigung bei Männern bei nur 0,7%. Im Anschluss daran entwickeln jedoch 65% der Männer ein PTBS.
In den „Leitlinien für Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik“ (2004) wird die Lebenszeitprävalenz für das PTBS mit 2%-7% für die deutsche Allgemeinbevölkerung angegeben. Dabei sei die Häufigkeit des Auftretens abhängig von der Art des Traumas. So bestehe eine Prävalenz von 50% nach einer Vergewaltigung, aber nur von 15% bei Verkehrsunfallopfern.
Die Rate der Komorbidität muss als hoch bezeichnet werden, haben doch 88,3% der Männer und 79% der Frauen nach einer viel zitierten Untersuchung durch Kessler et al (1995), die die Diagnose PTBS hatten, auch irgendwann in ihrem Leben noch andere psychische Störungen, meist affektiver Art, Suchterkrankungen oder Angststörungen (Butollo, 1999, S. 59). Aber nicht nur in der Allgemeinbevölkerung ist diese Rate hoch, auch spezifische Gruppen weisen eine hohe Rate auf, z.B. bei Vietman-Veteranen. Butollo nennt vier mögliche Gründe für diese hohe Rate:
1. Es kann sich um Artefakte handeln
2. Die belastenden Symptome des PTBS kann die Komorbidität, v.a. für Depressionen erst auslösen
3. Beide Störungen können voneinander unabhängig durch eine erhöhte Vulnerabilität verursacht sein
4. Eine vorausgehende Depression z.B. könnte die Vulnerabilität für die Ausbildung eines PTBS nach einer traumatischen Erfahrung erhöhen.
In einer von „National Center of PTSD“ veröffentlichen Untersuchung zum Zusammenhang von PTBS und Verkehrsunfällen wird eine relativ hohe Komorbiditätsrate bestätigt (Edward B. Blanchard & Edward J. Hickling, 1998). Danach entwickelten 43,5% der untersuchten Personen neben eines PTBS auch eine Depression, 56,5% entwickelten zusätzlich eine affektive Störung.
Im Anschluss an diese allgemeinen Erläuterungen folgen nun Beschreibungen der in dieser Untersuchung aufgetauchten traumatischen Erfahrungen.
1.2.3.2. Unfälle
Obwohl ein schwerer Verkehrsunfall für die Betroffenen sicher ein sehr einschneidendes Ereignis darstellt, erkranken nur wenige Menschen im weiteren Verlauf an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Maercker & Ehlers berichten von einer Rate von 10% der Betroffenen von Verkehrsunfällen und Naturkatastrophen die ein PTBS entwickeln (Maercker & Ehlert, 2001, S. 23). Unfälle zählen zu den häufigsten traumatischen Erfahrungen. So werden in den USA 25% der Männer und 14% der Frauen im Laufe ihres Lebens Opfer eines lebensbedrohlichen Unfalls (Maercker & Ehlert, 2001, S. 152). Nach einem Artikel der „Berliner Zeitung“ vom 29.12.2003 ist die Zahl der Toten durch Verkehrsunfälle in Berlin im Jahre 2003 im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurückgegangen. Sie erreichte mit 77 Menschen nur den zweitniedrigsten Wert in der Verkehrsunfallstatistik, die seit 1947 geführt wird. Die Zahl der Verunglückten liegt jedoch noch wesentlich höher. „Die Welt“ berichtet in ihrer Ausgabe vom 09.Oktober 2003 von 581 Unfallverletzten und sechs Toten auf der Schlossstraße in Berlin-Steglitz in sieben Jahren (1995-2002). Insgesamt ereigneten sich nach Informationen der Berliner Verkehrspolizei im Jahre 2003 128006 Unfälle in ganz Berlin, bei denen 15076 Personen leicht und 1782 schwer verletzt wurden (Berliner Verkehrspolizei, 2003).
In den USA verunglücken jedes Jahr mehr als 3 Mill. Menschen bei Verkehrsunfällen (Edward B. Blanchard & Edward J. Hickling, 1998) Damit sind Verkehrsunfälle die häufigste traumatische Erfahrung bei männlichen US-Bürgern. 800.000 von allen Verunglückten zusammengenommen entwickeln in der darauffolgenden Zeit ein PTBS, d.h. ca. 2/3 der Verunglückten genesen ohne schwere psychische Folgeerscheinungen. Angehörige dieser Gruppe wurden auch in dieser Untersuchung gefunden.
Hickling & Blanchard berichten in diesem Report von einer recht hohen spontanen Remissionsrate. Danach erholen sich über 50% der Opfer, bei denen ein PTBS diagnostiziert wurde, spontan nach Ablauf des ersten Jahres nach dem traumatischen Ereignis.
Wenn wir uns nun der Frage zuwenden, wie die Reaktionen einer Person beschrieben werden, die Opfer eines Unfalles geworden ist, können wir zunächst die Haltung des Opfers an sich beschreiben. Dazu schreibt Prof. Dr. Thomas Feltes M.A., Rektor der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen (2003): das Opfer sei im Zustand der Traumatisierung überflutet von seinen Affekten, wie Todesangst, Verzweiflung und Schmerz, es erdulde und erleide die Folgen, aber es gäbe auch noch die Konsequenz, dass das Opfer in seinem Leid zur Kenntnis genommen wird. Es würde durch die Umwelt stärker wahrgenommen und erlange dadurch sogar einen Gewinn aus seiner „Opferrolle“. Er beschreibt die sozialen Beziehungen als sehr beeinträchtigt, z.B. durch Mitleid, Bedauern aber auch Unverständnis und Neid.
Soziale Unterstützung habe eine positive Wirkung auf den gesamten Genesungsverlauf. Ebenfalls positiv auf den Genesungsverlauf wirkt sich die innere Einstellung gegenüber dem Unfallgeschehen aus. Das Betrachten des Unfalls als abgeschlossenes, unvermeidbares Ereignis, an dem man keine eigene Schuld trägt, hat sich ebenfalls als positiv herausgestellt (Maercker, 1998, S.120)
1.2.3.3. Lagererfahrungen
Erfahrungen in Arbeitslagern oder Konzentrationslagern zählen zu den schrecklichsten Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben widerfahren kann. Bei Fischer & Riedesser (1999, S. 235) findet sich eine ausführliche Beschreibung des Verhaltens und der Symptomatik von Überlebenden derartiger unmenschlicher Erscheinungen. Sie beschreiben dort die Merkmale des KZ-Überlebenden-Syndroms, dass von Niederland (1980), Krystal & Niederland (1965) und Eitinger (1964) untersucht wurde. Danach können bei Überlebenden 10 Symptome auftreten:
1. Angst- und Erregungszustände
2. Gefühl des Andersseins
3. Tiefe Überlebensschuld gegenüber Angehörigen und Kameraden
4. Zustand des seelischen „Verringertseins“ (Unfähigkeit zu Freude und Genuss, Starre, geistige Abgestumpftheit)
5. Schattenhaftes, furchtsames, gedrücktes Verhalten („lebendiger Leichnam“)
6. Hypermnesie (quälendes Wiedererleben des Lagerschreckens)
7. Leichte Erschöpfbarkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen
8. Sexuelle Störungen
9. Psychosomatische Beschwerden (an Herz, Kopf, Magen, Darm, Schlafstörungen, Schweißausbrüche)
10. Psychotische Zustände mit Wahnvorstellungen (Gefühl, noch immer im Lager zu sein)
Für die vorliegende Untersuchung sind dabei diejenigen Symptome von Bedeutung, die von außen beobachtbar sind. Dazu zählen:
- Erregungszustände
- Zurückgezogenheit, Kontaktmangel, Unfähigkeit zu Freude und Genuss
- Gedrücktes Verhalten
- Gedächtnisstörungen
- Sexuelle Störungen
- Psychosomatische Beschwerden
Fischer & Riedesser (1999, S.236) berichten auch von einem „Pakt des Schweigens“ der sich zwischen Überlebenden und ihrer späteren sozialen Umgebung bildet. Ein solcher Pakt sei nicht hilfreich, sondern führe immer wieder zu sehr belastenden Reinszenierungen.
1.2.3.4. Sekundäre Traumatisierung
Da in der vorliegenden Untersuchung auch ein Fall von sekundärer Traumatisierung durch die Einwirkung berufsbedingter Erfahrungen auftrat, wird nun eine kurze Erläuterung zu dieser Problematik gegeben.
1996 wurden Sekundäropfer indirekt auch in das DSM IV aufgenommen. Dort heißt es zur Konfrontation einer Person mit einem traumatischen Ereignis:
"Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die den tatsächlichen oder drohenden Tod oder einer ernsthaften Verletzung oder Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhaltete." (APA,1996)
Opfer von sekundärer Traumatisierung werden nicht nur unter Angehörigen angetroffen, sondern sehr häufig in helfenden Berufen. Speziell für diese Gruppe findet sich bei Fischer & Riedesser (1999, S. 125) der Begriff der „vicariierenden“ (=stellvertretende) Traumatisierung.
Alphamänner:
Die lange Zeit vorherrschende Meinung ging davon aus, dass Angehörige helfender Berufe, wie Polizei, Feuerwehr und Rettungspersonal, auch die grausamsten Bilder, Erlebnisse und Eindrücke, die während ihrer Berufsausübung auf sie einwirkten, an sich abprallen lassen könnten, dass sie gewissermaßen über ein Art Schutzanzug verfügten. Eine Verarbeitung war, nach dieser Auffassung, daher nicht erforderlich (Pieper & Maercker, 1999, S. 222). Diese Ansicht hat sich, nicht zuletzt durch aufgetretene Katastrophen, wie z.B. das ICE-Unglück von Eschede im Jahre 1998, bei dem die Problematik sehr schwer betroffener Helfer besonders deutlich zutage trat, verändert. Allerdings sei es schwierig, den unter traumatischen Erfahrungen leidenden Personen, meistens Männer, zu helfen, da diese sich einem hohen Männlichkeitsideal unterworfen hätten. Die Autoren beschreiben in diesem Zusammenhang das Modell eines Risikoprofils für posttraumatische Komplikationen. Dieses Profil ist bekannt unter der Bezeichnung „Alphamann“. Der Begriff stammt aus der Verhaltensforschung und bezeichnet eine Führungsposition (Alpha-Position).
Hier nun eine kurze Beschreibung des Risikoprofils von Alphamännern:
- Sie sind Angehörige von Polizei, Feuerwehr, Grubenwehr, Personenschützer, Bundeswehr, Rettungssanitäter
- Ihr Selbstbild entspricht dem eines harten Mannes, den nichts erschüttern kann
- Gefühle wie Angst oder Betroffenheit gelten als unmännlich, sie werden geleugnet und Gespräche darüber werden kategorisch abgelehnt
- Sie empfinden sich mit ihrer Gruppe einer Art Elite zugehörig, in der hohe Ideale herrschen, mit denen sie sich identifizieren.
Pieper & Maercker (1999, S. 226) geben zwei Punkte zur Erklärung dieses Verhaltens an. Danach hätten sogenannte „Alphamänner“ ein besonders maskulines Rollenverständnis. In der sozialpsychologischen Literatur wird der Begriff „Marlboro-Mann-Prototyp“ für diese Gruppe vorgeschlagen. Definiert werden maskuline Qualitäten durch Unabhängigkeit, Macht, Stärke, Unerschütterlichkeit und Leistung. Als zweiten Erklärungspunkt wird das soziale Lernen herangezogen. Jungen werden danach für geschlechtstypisches Verhalten belohnt und für geschlechtsuntypisches ignoriert, oder bestraft. (Alfermann, 1996; Bussey & Bandura, 1984)
Gernot Brauchle vom Notfallpsychologischen Dienst Österreichs (Gernot Brauchle et al, 2003 S. 2) beschreibt emotionale, kognitive und psychische Reaktionen bei Helfern. Zu den emotionalen Reaktionen zählen Wut und Hilflosigkeit über die Ungerechtigkeit der Situation und das Ausmaß an Zerstörung, der Schmerz über den Tod von Kindern und der Verlust des Glaubens, man könne Kinder vor Unglück schützen. Außerdem kann Zorn über die Berichterstattung der Medien auftauchen. Helfer leiden nach Einsätzen öfter an Depressionen, allgemeine Reizbarkeit Zunahme von Angst und Beklemmung sowie von innere Anspannung und Niedergeschlagenheit. Als kognitive Reaktionen beschreibt er Konzentrationsstörungen, Verwirrtheitszustände und die Veränderung innerer Werte und Einstellungen. Als physische Reaktionen beschreibt Brauchle eine Vielfalt körperlicher Beschwerden, dazu zählen Erkältungen, Schlafstörungen, Appetitverlust, ein reduziertes Sexualleben, Erschöpfungszuständen, Kopf- und Bauchschmerzen, Nacken- und Rückenbeschwerden, sowie Hautirritationen und Ausschläge.
Compassion Fatigue:
Da der Punkt noch ausführlicher in Kapitel Zwei erläutert werden wird, wird hier nicht weiter darauf eingegangen. Nur soviel sei angemerkt, dass der Effekt nicht auf Familienmitglieder und Freunde beschränkt bliebt. Er trat ebenso bei Therapeuten und Angehörigen helfender Berufe auf. Charles Figley vermutet in diesem Zusammenhang, dass dieselben Mechanismen, die ein Trauma innerhalb einer Familie „ansteckend“ machen, ebenso zwischen Therapeut und Klient wirken (Figley, 1989 in Stamm, 2002).
1.3. Behandlungsmöglichkeiten
In den „Leitlinien für Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik“ (2004) wird die Behandlung grob in folgende Bereiche gegliedert:
- Erste Maßnahmen (Herstellen einer sicheren Umgebung, Organisation des psychosozialen Helfersystems, Behandlung durch erfahrenen Psychotherapeuten)
- Traumaspezifische Stabilisierung (Engmaschige Betreuung, Krisenintervention, symptomorientierte Pharmakotherapie)
- Traumabearbeitung (nur durch speziell ausgebildeten Psychotherapeuten, dosierte Rekonfrontation, traumaadaptierte Verfahren)
- Psychosoziale Reintegration (Einbeziehung der Angehörigen, berufliche Rehabilitation, Opferentschädigung)
Es werden verschiedene Arten einer Traumatherapie angeboten. Nach einem Bericht des Deutschen Ärzteblattes von Günter Seidler (2002) gelten folgende Therapieformen als gut belegt:
- Kognitiv behaviorale
- Hypnotherapeutisch imaginative
- Modifizierte Psychodynamische
- EMDR Methode
Darüber hinaus muß noch die mehrphasige integrative Traumatherapie nach Willi Butollo (1999, S. 183) und das Kognitive Expositionsverfahren nach Anke Ehlers (1999, S. 31) Erwähnung finden.
Nach Hickling & Blanchard (1998) sind frühe Interventionen nach schweren Verkehrsunfällen nicht von großen Erfolg gekrönt.
Für die Therapie der sogenannten Alphamänner ergeben sich Pieper & Maercker (1999, S. 227) zufolge einige Konsequenzen für die Therapie. So sollte eine anfängliche emotionale Einfühlungsphase seitens des Therapeuten wegfallen und durch eine psychoedukative Phase ersetzt werden. Als besonders geeignet erwiesen sich den Autoren zufolge spezifische Gruppeninterventionen mit Angehörigen desselben Berufes.
Die Berliner Feuerwehr hat zu diesem Zweck 1996 ein Einsatznachsorgeteam (ENT) eingerichtet, dass sich auf die Betreuung traumatisierter Einsatzkräfte spezialisiert hat (Quelle: Berliner Feuerwehr, 2004)
2. Inhalt der Untersuchung
Mit dieser Untersuchung soll beschrieben werden, wie sich die durch eine traumatische Erfahrung eines Menschen aufgetretenen Veränderungen auf das subjektive Erleben der Partner der Betroffenen auswirken. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allen Dingen auf das innere Erleben der Angehörigen. Sie und ihre Empfindungen stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Erleben wird dabei als stark gefühlsbetontes und unmittelbares Ergriffenwerden anlässlich eines Ereignisses verstanden (Lexikon der Psychologie, 1995).
Beispielsweise kann sich nach einem Unfall mit schweren Verletzungen die gesamte Lebenssituation verändert haben. Wie noch gezeigt werden wird, bekommen Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche und existentielle Sorgen ein großes Gewicht im alltäglichen Leben. Wie gehen die Partner der Betroffenen damit um? Wie empfinden sie die zusätzlichen Belastungen, die in aller Regel auf sie zugekommen sind? Wie erleben sie das Unglück, dass ihrem Partner widerfahren ist und wie reagieren sie auf emotionaler und kognitiver Ebene auf die Veränderungen in alltäglichen Leben, sowie auf die Veränderungen, die ihre Partner an sich erfahren müssen?
Ziel der Untersuchung ist es, auf diese Fragen eine Antwort zu finden, um die emotional-kognitive Situation dieser Angehörigengruppe etwas zu erhellen. Zwar wird auf die Mitarbeit der Angehörigen von traumatisierten Menschen bei Therapie und Genesung großen Wert gelegt. Sie sollen ihren verletzten, oder sonstwie betroffenen Partner nach besten Kräften unterstützen, um eine möglichst schnelle Überwindung des traumatischen Ereignisses mit zu fördern. Aber dabei bleibt, wie noch aufgezeigt werden wird, fast immer unklar, wie belastet die Angehörigen von Betroffenen sind. Eine Erforschung der intrapersonellen Bedingungen von Partnern von Trauma-Opfern könnte v.a. zu einer Vorhersage ihres individuellen Belastungsgrades führen. Dadurch bestünde z.B. für einen behandelnden Therapeuten die Möglichkeit, einer eskalierenden Belastung entgegen zu wirken, um ein Auseinanderbrechen des sonst so hilfreichen Systems Familie bei der Bewältigung des Traumas zu verhindern.
2.1. Der Angehörige in der Psychotraumatologischen Forschung
In Theorie und Praxis der Psychotraumatologie werden folgende Gruppen von Traumatisierten unterschieden:
1. direkt oder primär Traumatisierte
2. indirekt oder sekundär Traumatisierte
3. tertiär Traumatisierte (siehe Exkurs)
Die Unterscheidung zu 1 und 2 geht auf Bolin (1985 in Figley, 1995) zurück, der zwischen primären und sekundären Opfern unterschied. Dabei erlitten die ersteren physische Verletzungen, während die Sekundäropfer nur Zeugen von Ereignissen wurden, bei denen sie selbst nicht verletzt wurden. Allerdings war diese Unterscheidung für viele Forscher nicht zufriedenstellend, denn die Angehörigen der Opfer blieben aus dieser Unterscheidung ausgeschlossen, obwohl sie sehr engen Kontakt zu einer traumatisierten Person haben und dadurch den Einflüssen der Traumatisierung direkt ausgesetzt sind (Figley, 1995). In demselben Buch (S.78) schlägt Charles Figley daher die folgende Unterscheidung vor:
- Opfer eines traumatischen Ereignisses zu sein, bedeutet die direkte Konfrontation mit einem extremen Ereignis und wird als primärer Stressor definiert.
- Sekundäre Traumatisierung bedeutet dagegen die Kenntnis der Traumatisierung einer nahestehenden Person. Sekundärer traumatischer Streß resultieren aus Emotionen und Verhaltensweisen, die als Konsequenzen dieser Kenntnis auftreten.
Schon 1988 hatten Miller, Stiff & Ellis (in Figley, 1995) den Begriff "emotionale Ansteckung" benutzt. Damit beschrieben sie einen Prozess, bei der eine Person durch die Beobachtung einer leidenden Person und deren antizipierter Affekte quasi selbst "angesteckt" werden kann (siehe unten).
Andere Forscher bezeichneten Personen, die nicht selbst bei einer Katastrophe anwesend waren als "Periphere Opfer" (Dixon, 1991 in Figley, 1995).
Ferner wurden noch folgende Bezeichnungen vorgeschlagen:
- Mitempfundene Traumatisation (McCann & Pearlman, 1990 in Figley, 1995)
- Sekundärer Überlebender (Remer & Elliot, 1988, a,b in Figley, 1995)
- ripple effect
- trauma infection
2.1.1. Exkurs: Sekundäre vs. Tertiäre Traumatisierung
In der deutschsprachigen Literatur findet sich eine Abweichung in der Klassifizierung von nicht direkt von einer traumatischen Erfahrung Betroffener. Angehörige werden dort sehr häufig der Gruppe der tertiär Traumatisierten zugesprochen. So spricht Peter Eichenberger in seinem Notfallseelsorgekonzept des Kantons Bern (Eichenberger, 2003) von Angehörigen, die nicht direkt beim Geschehen anwesend waren, als Tertiäropfer. Ebenso spricht die ev. Landeskirche der Schweiz in ihrem Reader zum Krisenmanagement der psychologischen Notfallhilfe von Tertiäropfern, wenn diese das Ereignis "weder direkt, noch indirekt erlebt haben. Ihre Konfrontation mit dem Ereignis besteht darin, dass sie durch eine enge persönliche Beziehung mit einem Primär- oder Sekundäropfer verbunden sind." Dazu werden in der Regel die Angehörigen der Opfer oder der Rettungskräfte gezählt (Ott, 2000). Fischer & Riedesser dagegen verwenden den Begriff „Tertiäropfer“ (1999, S. 124), um Angehörige nachfolgender Generationen von Opfern des Holocaust zu benennen.
Allgemein lässt sich feststellen, dass in der Literatur eine Unschärfe bei den Bezeichnungen besteht. Wenn der Begriff „Tertiäropfer“ verwendet wird, wird damit immer zu Ausdruck gebracht, dass die betreffende Person durch ihre Beziehung zum Primäropfer selbst involviert ist, ohne das traumatische Ereignis selbst miterlebt zu haben. Wobei sich der Umstand des „Miterlebens“ sowohl auf die räumliche, wie auf die zeitliche Distanz erstreckt.
2.2. Definition der Sekundären Traumatisierung
Die Definition der sekundären Traumatisierung ist enthalten in der allgemeinen Definition einer traumatischen Erfahrung des DSM IV, siehe dazu Kapitel Eins, Seite 17 (Unterpunkt 1.2.3.4.). Dadurch waren nun auch erstmalig Familienmitglieder von primär Betroffenen eines traumatischen Ereignisses mit in die Kriterien des DSM IV einbezogen (Stamm, 2002, S. 28).
2.3. Theorie der Entstehung von Sekundärer Traumatisierung bei Angehörigen
Das Zusammenleben mit einer traumatisierten Person kann mit soviel Stress verbunden sein, dass allein dadurch eine sekundäre Traumatisierung entstehen kann (National Center for PTSD, kurz: NCPTSD, 2003, b). Charles Figley & Rolf Kleber (1995, S. 93) unterscheiden zwei Ursachen für die Entwicklung von sekundärem traumatischen Stress bei Angehörigen:
1. Ansteckung/Kontamination durch Empathie
2. Traumatisierung durch Erschöpfung
Zu 1.:
Mitglieder eines Familiensystems neigen zur Identifikation untereinander, auch mit einem Traumatisierten und seinem Leiden. Dadurch machen sie ähnliche emotionale Erfahrungen wie der Traumatisierte. Sie erleben Gefühle der Machtlosigkeit und Unterbrechung des normalen Alltags, ihre Grundüberzeugungen bezüglich ihrer personellen Unverletzlichkeit werden erschüttert. Die traumatische Erfahrung muss verarbeitet werden. Dieser Prozess erfordert auch von den Mitgliedern des sozialen Systems des Traumatisierten eine Beschäftigung mit dem Trauma. Dadurch erfahren sie aber ähnliche Emotionen wie der Traumatisierte. Dies beinhaltet sogar visuelle Eindrücke, etwa in Form von Flashbacks, die dadurch zustande kommen, dass der Traumatisierte seine Erlebnisses berichtet, die in der Vorstellungswelt des Angehörigen Gestalt annehmen und zu ungebetenen visuellen Eindrücken führen können, die dem des primär Traumatisierten ähneln. Es können auch Schlafprobleme oder depressive Gefühle resultieren.
Mitfühlende Reaktionen auf Erlebnisse eines Familienmitglieds finden sich auch in einem ähnlich gelagerten Umstand, der sogenannten „Folie á deux“ , bei der sich ein Ehepartner die psychiatrische Erkrankung des anderen zu eigen zu machen scheint (Stamm, 2002, S. 44)
Zu 2.:
Die zweite Ursache entsteht durch sehr angestrengte Bemühungen seitens des Angehörigen bei der Unterstützung des Traumatisierten. Dies kann zu Symptomen führen, die dem Burn-out-Syndrom ähneln. Es tritt vor allem dann auf, wenn der Angehörige sich für das Wohlergehen des Traumatisierten verantwortlich fühlt und versucht, die nach dem Trauma aufgetretenen Schwierigkeiten durch eigene vermehrte Anstrengungen auf vielen Gebieten, gewissermaßen rückgängig zu machen, oder doch zumindest erheblich zu mildern. Figley & Kleber (s.o.) kommen zu dem Schluss, dass dieses Verhalten dem Verhalten von Angehörigen chronisch Erkrankter ähnelt.
[...]
- Arbeit zitieren
- Veronika Opitz (Autor:in), 2004, Auswirkungen einer traumatischen Erfahrung auf das subjektive Erleben der Partner oder Angehörigen der Betroffenen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62646
Kostenlos Autor werden
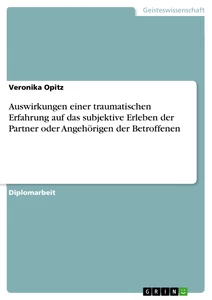





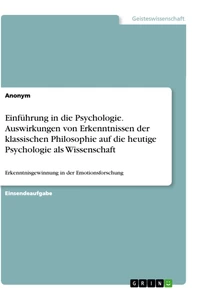






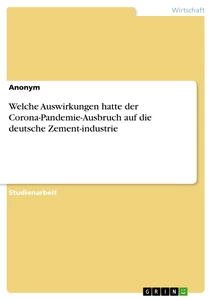






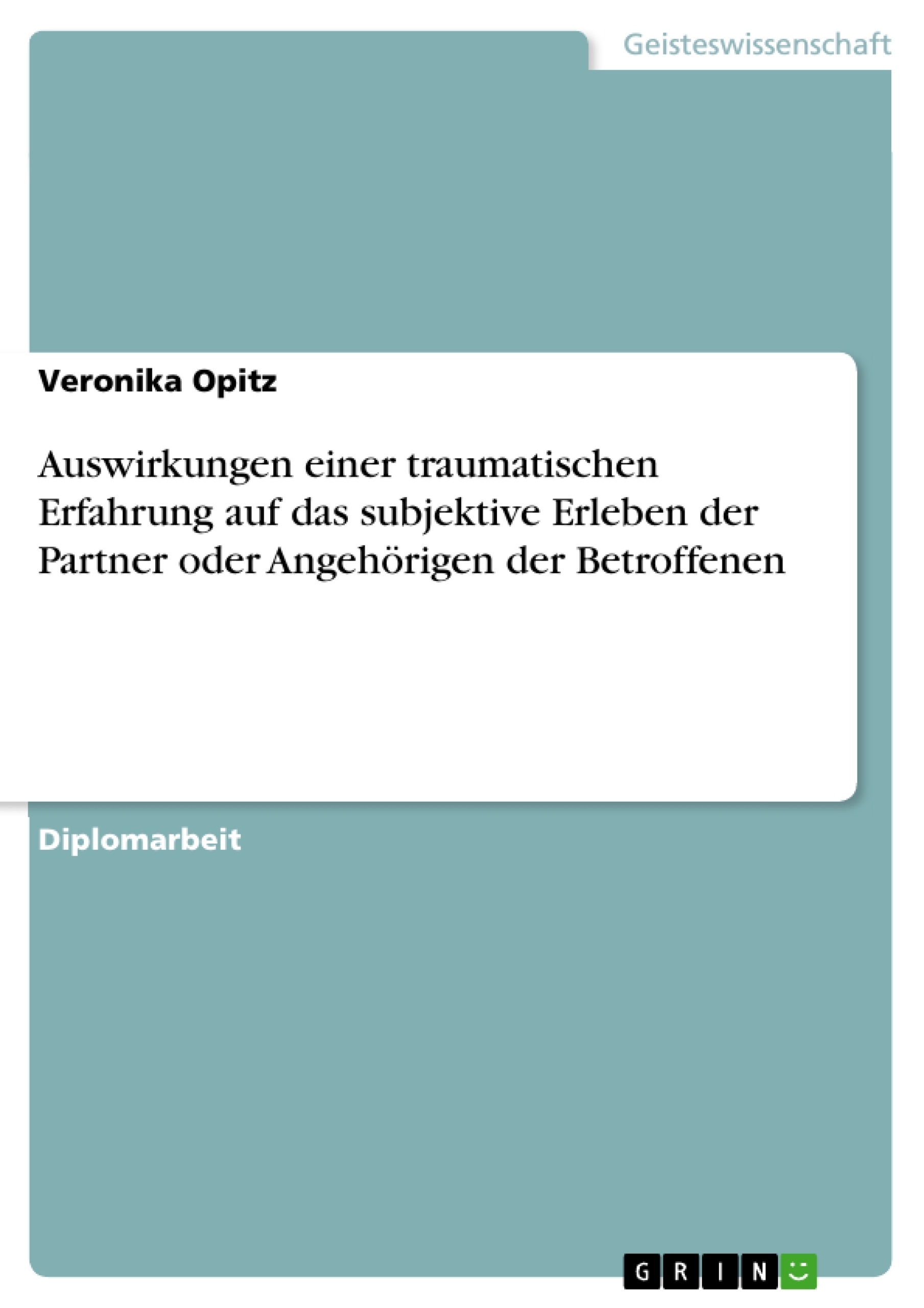

Kommentare