Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Grundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung
2.1 Der Aufbau der gesetzlichen Krankenversicherung
2.2 Grundsätze der GKV
2.3 Das Solidaritätsprinzip und der Kassenwettbewerb
2.4 Das Solidaritätsprinzip und der Wettbewerb um gute Risiken
3. Der Risikostrukturausgleich
3.1 Ziele des RSA
3.2 Die Funktionsweise des Risikostrukturausgleichs
3.2.1. Der Beitragsbedarf und der Ausgleichsbedarfssatz
3.2.2. Die Finanzkraft
3.2.3. Der Transfer im RSA
4. Kritik am derzeitigen RSA
4.1 Fehlende Morbiditätsorientierung
4.2 Unvollständigkeit des Finanzkraftausgleichs
4.3 Fehlende Berücksichtigung der Kassenwechsler
5. Bisherige Erweiterungen des RSA
5.1 Risikopool
5.2 Strukturierte Behandlungsprogramme (DMP)
6. Reform des RSA: Die direkte Morbiditätsorientierung
7. Brauchen wir den Risikostrukturausgleich?
7.1 Standpunkt der Gutachtergruppe Jacobs/Reschke/Cassel/Wasem
7.2 Standpunkt der Gutachter Lauterbach und Wille
7.3 Standpunkt der Gutachter Breyer und Kifmann
7.4 Zwischenfazit
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
Der bestehende Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist ein zentrales Element der GKV, gleichwohl ist er nicht selbstverständlich. Denn die Möglichkeit der Kassenwahl besteht für Versicherte der GKV erst seit 1996. Vorher gab es ein System der gesetzlichen Zuweisung ohne Wettbewerb zwischen den Kassen. In Verbindung mit dem Solidaritätsprinzip, dem zweiten Wesensmerkmal der GKV, führt der freie Wettbewerb jedoch zu erheblichen Verzerrungen. Um diese zu neutralisieren, wurde der Risikostrukturausgleich (RSA) eingeführt.
Diese Arbeit soll untersuchen, ob ein RSA in der bestehenden Wettbewerbsordnung notwendig ist und ob er die gesetzten Ziele verwirklicht. Als Grundlage dafür werden in den ersten beiden Kapiteln die Grundprinzipien der GKV erläutert und die Funktionsweise des RSA verdeutlicht. Im darauf folgenden Abschnitt werden Kritikpunkte am gegenwärtigen RSA angebracht und bisherige Erweiterungen aufgezeigt. Der letzte Teil der Arbeit stellt einen Reformvorschlag vor und nimmt eine Bewertung des RSA hinsichtlich seiner Zielerreichung und Notwendigkeit vor.
2. Grundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung
2.1 Der Aufbau der gesetzlichen Krankenversicherung
Die gesetzliche Krankenversicherung besteht aus etwa 267 Krankenkassen (Stand: 03/2005), die jeweils einer von acht Kassenarten angehören[1]. Aufgabe der Krankenkassen ist, die gesundheitliche Versorgung der rund 70 Mio. Versicherten zu organisieren. Die Kassen wirtschaften nicht nach dem Gewinnprinzip[2]. Sie finanzieren sich hauptsächlich über die Beiträge ihrer Mitglieder und der Arbeitgeber, die sich die Beitragslast paritätisch teilen. Die Versicherten der GKV zahlen bis zur Beitragsbemessungsgrenze (2006: jährliches Bruttogehalt von 42.750 €) monatliche Beiträge als prozentualen Anteil ihres Arbeitseinkommens[3]. Die Höhe der Beiträge ist somit unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand der Versicherten. Beitragsfrei sind Familienmitglieder der Versicherten, die nicht erwerbstätig sind.
2.2 Grundsätze der GKV
In der GKV besteht Kontrahierungszwang, d.h. eine Kasse hat die gesetzliche Pflicht, neue Mitglieder aufzunehmen und zwar unabhängig von dessen Gesundheitsstatus und finanzieller Leistungskraft[4]. Der Kontrahierungszwang gilt auch für Versorgungsverträge mit den Leistungserbringern, also z.B. für Ärzte und Krankenhäuser die mit der Krankenkasse einen Vertrag abschließen wollen. Außerdem wurde den Krankenkassen ein Diskriminierungsverbot auferlegt, das ihnen untersagt, Beiträge nach dem Krankheitsrisiko der Versicherten zu differenzieren[5].
Ein Wesensmerkmal der GKV ist das Solidaritätsprinzip. Es bezeichnet die gemeinsam finanzierte gleichmäßige Versorgung aller Versicherten im Krankheitsfall[6], d.h. in der GKV werden die Versorgungskosten durch Umverteilung der Beitragseinnahmen von allen Mitgliedern der GKV gemeinschaftlich getragen. Das Solidarprinzip kommt in der Art der Beitragserhebung und der Leistungsgewährung zum Ausdruck[7]. Der zu zahlende Beitrag ist unabhängig von der Inanspruchnahme der Kassenleistungen, er wird nur in Abhängigkeit vom Einkommen erhoben. Die Leistungsverteilung dagegen richtet sich nach dem Bedarfsprinzip[8], d.h. jeder Versicherte erhält in ausreichender und wirtschaftlicher Form die medizinische Leistung, die er benötigt. Somit richtet sich die Beitragslast nach der individuellen Zahlungsfähigkeit, jedoch die Leistungen der GKV nach der individuellen Bedürftigkeit der Versicherten. In diesem solidarischen System der Umverteilung kommen gesunde, besser verdienende, junge, ledige und kinderlose sowie männliche Mitglieder der GKV für Kranke, schlechter Verdienende, Ältere, Familien mit Kindern und für Frauen auf[9].
Die Zusammensetzung der Mitglieder bestimmt die Risikostruktur einer Krankenkasse. Dabei kann man hohe (schlechte) Risiken und niedrige (gute) Risiken unterscheiden. Risikofaktoren und somit Faktoren für die unterschiedlichen Versichertenstrukturen sind das Alter, der Gesundheitszustand, das Einkommen, Bezug einer Erwerbsminderungsrente, die Familienlast und das Geschlecht. Demnach sind schlechte Risiken Versicherte mit hohem Morbiditätsrisiko[10], geringem Einkommen und viele beitragsfreie Familienmitglieder. Kassen mit einer schlechten Risikostruktur haben relativ geringe beitragspflichtige Einnahmen[11] und relativ hohe Versorgungsausgaben. Ein gutes Risiko hingegen hat ein hohes Einkommen, ist ledig und kinderlos, sodass hohe Beiträge abgeführt werden. Außerdem ist der Versicherte jung und gesund damit die Ausgaben der Krankenkasse gering bleiben[12].
Eine Kasse mit schlechter Risikostruktur muss, im Vergleich zu einer Kasse mit günstiger Risikostruktur, die höheren Ausgaben mit einem höheren Beitragssatz finanzieren. Da die gesetzlichen Kassen annähernd gleiche Leistungen anbieten[13], ist der Beitragssatz der einzige Wettbewerbsparameter.
2.3 Das Solidaritätsprinzip und der Kassenwettbewerb
Mit der ersten durchgreifenden Strukturreform der GKV, dem Gesundheitsstrukturgesetz von 1992, wurde der ordnungspolitische Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) neu gestaltet. Das GKV-System wurde damit in eine „solidarische Wettbewerbsordnung“ transformiert[14]. Das Gesetz umfasste die Einführung der freien Kassenwahl (zum 1.1.1996) und des Risikostrukturausgleichs (zum 1.1.1994).
Bis 1996 konnten die Versicherten der GKV nicht uneingeschränkt wählen, bei welcher Krankenkasse sie sich versichern wollten, sie waren bestimmten Kassen per Gesetz zugewiesen. Wettbewerb zwischen den Kassen fand daher nur bedingt statt. Der alte gesetzliche Rahmen der GKV führte zu erheblichen Unterschieden in den Risikostrukturen der einzelnen Kassen, was sich in den weit auseinander driftenden Beitragssätzen bemerkbar machte. 1993 waren die höchsten Beitragssätze doppelt so hoch wie die Niedrigsten[15]. Durch den fehlenden Wettbewerb gelang es außerdem nicht, geeignete Anreize zur Wirtschaftlichkeit bezüglich der Ausgaben der Krankenkassen zu setzen. Dadurch entstehen Wohlfahrtsverluste, da zwar Einsparpotenziale bei den Kassen vorhanden sind, sie jedoch keinen Anreiz haben, diese auch zu realisieren.
Mit der Einführung der Kassenwahlfreiheit durch das Gesundheitsstrukturgesetz sollte der Wettbewerb um Mitglieder zwischen den Kassen entfacht werden und somit eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Versorgung der Versicherten erzielt werden. Beitragssatzdifferenzen zwischen den Kassen sollten nur die unterschiedliche Leistungsfähigkeit ausdrücken und nicht die heterogene Risikostruktur wiedergeben.
Der Beitragssatz wurde damit zum Wettbewerbsparameter der Krankenkassen. Kassen, die in der Leistungserbringung wirtschaftlich effizient arbeiten, können die Kostenvorteile durch Beitragssatzsenkungen direkt an ihre Mitglieder weitergeben. Somit ist der Beitragssatz theoretisch gesehen ein verlässliches Signal für Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsunterscheide[16]. Als Ziel dieses Leistungswettbewerbes soll sich am Markt der beste Anbieter durchsetzen.
2.4 Das Solidaritätsprinzip und der Wettbewerb um gute Risiken
Mit der Einführung des Kassenwahlrechts begann zwischen den Kassen mehr ein Wettbewerb um gute Risiken als um die bessere Versorgung und Wirtschaftlichkeit. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Zur Beitragssatzsenkung und damit zur Gewinnung neuer Mitglieder ist es einfacher, günstige Risiken anzuwerben, als Anstrengungen zur Verbesserung der eigenen Leistung zu unternehmen.
In der solidarischen GKV erfolgt die Leistungsgewährung der Krankenkassen nach dem Bedarf, die Beitragszahlung jedoch nach der Finanzkraft des Versicherten. Durch das Verbot, risikoabhängige Prämien zu erheben, ist die Versorgung der Mitglieder unabhängig von deren Beiträgen, die Ausgaben der Kassen losgelöst von den Einnahmen. Eine Kasse mit gegebener ungünstiger Risikostruktur hat somit einen erheblichen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu einer Kasse mit überwiegend günstigen Risiken. Das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben wird für Kassen mit hohen Risiken negativ, während Kassen mit niedrigen Risiken Gewinne erzielen.
Daher müssen die Kassen mit vergleichsweise schlechter Risikostruktur einen höheren Beitragssatz kalkulieren, um die Ausgaben der Gesundheitsversorgung zu decken und werden dadurch für neue Mitglieder unattraktiv. Mit dem Beitragssatz als einzigen Wettbewerbsparameter müssen die Kassen aber alles daran setzen, ihre Beitragssätze konkurrenzfähig niedrig zu halten. Somit besteht für die Kassen ein Anreiz, die Versicherten nach guten Risiken zu selektieren, d.h. möglichst viele junge, gesunde, ledige und einkommensstarke Mitglieder zu versichern, um ihren Beitragssatz niedrig zu halten und ihre Mitgliederzahl zu steigern.
Krankenkassen können aktive und passive Risikoselektion betreiben[17]. Bei aktiver Risikoselektion versucht die Krankenkasse selbst Einfluss auf den Vertragsabschluss zu nehmen, z.B. durch Anwerben niedriger Risiken mit Hilfe von Geldzahlungen. Passive Risikoselektion erfolgt über die Gestaltung der Kassenleistungen, so dass diese für niedrige, aber nicht für hohe Risiken attraktiv ist[18]. Anhand einer Auswertung von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) konnte eine aktive Risikoselektion nicht empirisch nachgewiesen werden[19]. Dies hat auch der Gesetzgeber weitgehend verhindert, z.B. durch die Einführung des Kontrahierungszwangs oder das Verbot von Prämienzahlung an hohe Risiken bei Vertragsauflösung. Auch Vermittlung von Zusatzleistungen oder Geldzahlungen können per Gesetz verboten werden. Passive Risikoselektion dagegen ist vorhanden, wurde durch die Festlegung des Leistungspakets im SBG V jedoch auch teilweise eingeschränkt.
Der zentrale Unterschied zwischen aktiver und passiver Selektion ist, dass bei ersterer die erwarteten Ausgaben anhand beobachtbarer Eigenschaften für eine Kasse unterscheidbar sein müssen um danach zu selektieren. Bei passiver Risikoselektion dagegen selektieren sich die Versicherten selbst.
Passive Risikoselektion ist daher eng verwandt mit dem Phänomen der adversen Selektion[20], die in der GKV durch asymmetrische Informationen auf der Käufer- und Verkäuferseite bezüglich der Risikotypen der Versicherten entsteht. Die Versicherten kennen in der Regel ihren Gesundheitszustand besser als die Krankenkassen und wählen ihre Krankenkasse so, dass die zu zahlenden Beiträge geringer sind als die erwarteten Krankheitskosten. Die Krankenkasse kann dann aber zum gegebenen Beitragssatz nicht die laufenden Kosten decken und wird eine Beitragssatzerhöhung vornehmen müssen. Die günstigen Risiken wechseln daraufhin zu einer preiswerteren Krankenkasse. Die Risikostruktur verschlechtert sich und kann zum Ausscheiden der Kasse aus dem Markt führen.
Eine Selektion nach Risiken seitens der Krankenkassen steht dem Ziel der Einführung des Kassenwettbewerbs entgegen, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern. Denn durch Risikoselektion kann eine Kasse trotz unwirtschaftlichen Handelns und ohne die Versorgungsleistungen zu verbessern, ihren Beitragssatz senken und neue Mitglieder anlocken. Risikoselektion ist außerdem unfair und wohlfahrtsökonomisch ineffizient, da Kassen mit verbesserter Wirtschaftlichkeit im Wettbewerbsnachteil sind, wenn sie gleichzeitig eine ungünstige Risikostruktur aufweisen und deshalb einen höheren Beitragssatz kalkulieren müssen. Bei der Gegenwart des Kontrahierungszwanges würden bei einem freien Wettbewerb um Risiken irgendwann alle Versicherten bei der günstigeren Kasse versichert sein. Es würde unausweichlich zu einem Konzentrationsprozess kommen, der Kassenvielfalt und –wettbewerb tendenziell beseitigen würde[21]. Kontrahierungszwang und Diskriminierungsverbot allein können also das Wettbewerbsziel nicht erreichen. Es bedarf eines Mechanismus, der die unerwünschten Effekte ausgleicht: der Risikostrukturausgleich.
3. Der Risikostrukturausgleich
3.1 Ziele des RSA
Da ein unflankierter Kassenwettbewerb nicht zu den erwünschten Zielen, sondern zu „selbstzerstörerischen Monopolisierungstendenzen“[22] führt und falsche Anreize bei den Kassen setzt, soll der RSA die Effizienz des Wettbewerbs um Versicherte steigern. Der RSA ist ein Kassenarten übergreifender finanzieller Ausgleichsmechanismus, der Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unterschiedlicher Risikostrukturen der Kassen bereinigen soll. Somit verfolgt der RSA die folgenden zentralen Ziele[23]:
- Vermeidung von Risikoselektion und Herstellung von Chancengleichheit
Mit dem RSA erfolgt in der GKV mittels Transferzahlungen eine Umverteilung zwischen niedrigen und hohen Risiken, sodass Anreize zur Selektion günstiger Risiken gemindert werden. Die Idee des RSA ist es, alle Kassen finanziell so zu stellen, als ob ihre Versicherten die durchschnittliche Risikostruktur der gesetzlichen Kassen aufweisen würden[24].
Die Einführung des RSA erfolgte bewusst vor der Einführung der Kassenwahlfreiheit, um die historisch gewachsenen Risikounterschiede auszugleichen und somit den Kassen annähernd gleiche Startbedingungen für den Wettbewerb zu geben. So hatten vor allem die Allgemeinen Ortskrankenkassen wegen ihrer ungünstigen Mitgliederstruktur besonders hohe Beitragssätze und somit schlechte Wettbewerbsbedingungen[25]. Diese Ausgangssituation hätte sich noch verschärft, wenn ein unflankierter Wettbewerb eingetreten wäre, denn die risikogünstigeren Mitglieder wären an beitragsgünstigere Kassen verloren gegangen und es hätte eine weitere Entmischung der Risiken stattgefunden. Der Grund dafür ist, dass besser verdienende, junge und gesunde Versicherte eher auf Beitragssatzunterschiede reagieren als alte, morbide und gering verdienende Mitglieder[26].
[...]
[1] Die acht Kassenarten sind: AOK, Verband der Angestellten-Krankenkassen, Arbeiter-Ersatzkassen, BKK, IKK, Bundesknappschaft, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen und See-Krankenkasse. Vgl. Redaktionsbüro Gesundheit, Thema: Krankenkassen, www.die-gesundheitsreform.de, Abrufdatum: 10.06.2006
[2] Vgl. Jacobs/Reschke/Cassel/Wasem 2001, S. 21
[3] Vgl. Redaktionsbüro Gesundheit, Thema Beitragssatz, www.die-gesundheitsreform.de, Abrufdatum: 10.06.2006
[4] Vgl. AOK Bundesverband, www.aok-bv.de, Abrufdatum: 07.06.2006
[5] Vgl. Breyer/Zweifel/Kifmann 2005, S. 273
[6] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 12
[7] Vgl. Andreas 1994, S. 23
[8] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 13
[9] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 14
[10] Die Morbidität gibt die Krankheitshäufigkeit eines Versicherten an. Ein hohes Morbiditätsrisiko bedeutet eine hohe Krankheitshäufigkeit eines Versicherten.
[11] Der Begriff der beitragspflichtigen Einnahmen bezeichnet sämtliche Einnahmequellen der Krankenkassen. Vgl. § 226 ff SGB V
[12] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 22
[13] Das Leistungsangebot der Kassen ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten einen identischen Katalog von so genannten Regelleistungen anzubeten. Dieser umfasst 95% aller Leistungen. Darüber hinaus können zusätzliche Leistungen, so genannte Satzungsleistungen angeboten werden. Vgl. § 11 SGB V
[14] Vgl. Jacobs et al. 2001, S.12
[15] Vgl. Schulz/Kifmann/Breyer 2001, S. 2
[16] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 18
[17] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 21, 22
[18] Vgl. Breyer et al. 2005, S. 274
[19] Vgl. Stapf-Finé 2004, S.565
[20] Vgl. im Folgenden Blankart 2003, S. 12-13
[21] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 23
[22] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 17
[23] Vgl. Breyer/Kifmann 2001, S. 2-3; Jacobs et al. 2001, S. 21
[24] Vgl. Schulz et al. 2001, S. 2
[25] Vgl. BT-Drucksache 14/5681, S. 4
[26] Vgl. Jacobs et al. 2001, S. 22
- Arbeit zitieren
- Christina Jordan (Autor:in), 2006, Wettbewerb der Krankenkassen - Brauchen wir den Risikostrukturausgleich?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62609
Kostenlos Autor werden







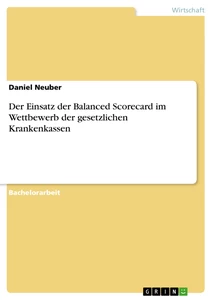














Kommentare