Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Vom Werden des Autors
2.1 Der technisch versierte und der göttlich inspirierte Dichter
2.2 Mittelalterliche Anonymität
2.3 Genialität muss geschützt werden
2.4 Der Autor als variable Größe
2.4.1 Das autorzentrierte Interpretationsmodell
2.4.2 Das werkbezogene Interpretationsmodell
3 Strukturalismus und Poststrukturalismus Exkurs: Ähnlichkeit, Repräsentation und Mensch
4 Der Autor – lebendig begraben
4.1 Schrift statt Autor
4.2 Funktion statt Tod
4.2.1 Kritik an den Lückenbüßern
4.2.2 Autorname vs. Eigenname
4.2.3 Merkmale der Autorfunktion
4.2.4 Diskursivitätsbegründer
5 Schluss
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Was würde passieren, wenn man durch einen glücklichen oder vielleicht auch unglücklichen Zufall entdeckte, dass „Die Leiden des jungen Werthers“ gar nicht von Johann Wolfgang von Goethe verfasst wurde? Es wäre nicht nur ein Schock für alle Goetheliebhaber, sondern vor allem für die literaturwissenschaftliche Forschung und die Literaturhistoriker. Unzählige Interpretationen und Quellennachweise wären überholt und falsch. Die biographischen Aspekte in dem Roman müssten neu überdacht werden, ein ganzer Diskurs würde zusammenbrechen. Oder sollte man sagen, ein neuer Diskurs um Goethe würde möglich und „Werther“ von seinem Autorkäfig befreit?
Wahrscheinlich würde sich Michel Foucault über eine solche Entdeckung freuen, denn nun müsste der psychoanalytische Zweig der Literaturwissenschaft über andere Zugänge als den biographischen nachdenken, und neue Räume könnten eröffnet werden: „Halten wir daher unsere Tränen zurück!“[1]
Für Foucault ist der Autor nicht der Ursprung oder der Schöpfer eines Textes. Diesen Status möchte Foucault auch nicht für sich selbst beanspruchen. Um der Zuschreibungsmaschinerie und der einseitigen Deutung seiner Worte zu entgehen, gab er sogar ein anonymes Interview, in dem er einen Traum ausspricht: „Ich schlage ein Spiel vor: das des ‚Jahres ohne Namen’. Ein Jahr lang würde man Bücher ohne Autorennamen veröffentlichen. Die Kritiker hätten mit einer rein anonymen Produktion klarzukommen. Aber vielleicht – wie mir gerade einfällt – hätten sie nichts zu sagen: alle Autoren würden das nächste Jahr abwarten, um ihre Bücher zu publizieren.“[2]
Das Spiel wird wohl immer ein Traum bleiben, aber gerade das zeigt, wie vorherrschend das Autormodell des Schöpfers, besonders im literarischen Bereich, in der heutigen Zeit ist: „Literarische Anonymität ist uns unerträglich; wir akzeptieren sie nur als Rätsel.“[3] Bleibt dieses ungelöst, gibt es Unsicherheiten bei der Rezeption, weil die Begrenzung der Einordnung fehlt und der Leser verloren ist.
Da es in der Geschichte seit der Antike nicht immer gleich um den Autor, seine Funktion und seinen Einfluss bestellt war, soll im folgenden Kapitel eine skizzenhafte Vorstellung verschiedener Autorenmodelle und des Urheberrechts vorgenommen werden. Foucault erwähnt diese historische Entwicklung lediglich, hier soll sie aber verdeutlichen, wie es zu der gegenwärtigen Funktion des Autors, die Foucault untersucht, gekommen ist.
Welche Funktion der Autor in den Diskursen der Gegenwart übernimmt, oder unter welchen Bedingungen die Funktion eines Autors existieren kann, analysiert Foucault in seinem Vortrag „Was ist ein Autor?“, den er 1969 am Collège de France hielt. Ein Jahr zuvor hatte Roland Barthes seinen Aufsatz „Le mort de l’auteur“ veröffentlicht und die Diskussion um die Bedeutung der Autorbiographie für die Interpretation eines Werkes erneut belebt.
Bevor es aber um die erwähnten Aufsätze, dabei schwerpunktmäßig um Foucaults Ansatz, gehen soll, wird im dritten Kapitel eine kurze Einführung in das strukturalistische und das poststrukturalistische Denken gegeben, denen Foucault und Barthes zugerechnet werden.
Der zwischengeschaltete Exkurs zu Foucaults Subjektphilosophie soll die Parallelität des Status’ erklären, den das Subjekt und der Autor in der Moderne einnehmen. Dazu wird auf Foucaults Werk „Die Ordnung der Dinge“ (1966) in kurzer Form eingegangen. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Kapitel „Der Mensch und sein Doppel“, in dem Foucault darstellt, wie sich die Existenz des modernen Subjekts von der Renaissance über das klassische Zeitalter bis heute herausbilden konnte.
Da Foucault in „Die Ordnung der Dinge“ dem Menschen, kaum dass er aufgetaucht ist, sein baldiges Verschwinden prophezeit, muss sich der Autor als Subjekt notwendig auch auflösen. Das vierte Kapitel hat deshalb das Verschwinden des Autors zum Thema, wobei sich mit Foucault zunächst herausstellen wird, dass er trotzdem und sogar in bereicherter Form als Funktion wieder auftaucht.
Im Schlusskapitel werden die vorherigen Analysen zusammengefügt. Dabei soll noch einmal besonders herausgestellt werden, ob der Autor um seine Existenz fürchten muss, wie er vielleicht weiterexistieren kann und was nötig wäre, damit er verschwindet.
2 Vom Werden des Autors
Wenn Foucault in seinem Aufsatz „Was ist ein Autor?“ das Verschwinden des Autors analysiert, dann liegt die Vermutung nah, dass es irgendwann einmal einen Autor gegeben haben muss. Dass es sich dabei um eine reale Person handelt, die einen Text verfasst, wird von Foucault nicht bezweifelt. Ihm geht es präziser um den Autor als „Angelpunkt für die Individualisierung in der Geistes-, Ideen- und Literaturgeschichte,[...]“[4] und dessen Verhältnis zum Text. Wie sich eine solch individuelle Vorstellung eines Autors herausbilden konnte, wird hier kurz historisch aufgerollt.
Es sollen zwei Sachverhalte dargestellt werden: Zum einen soll die historische Entwicklung einer anonymen zu einer signierten Literatur gezeigt werden. Zum anderen soll es um ein besonderes Phänomen gehen, das sich erst mit der signierten Schrift herausbilden konnte, nämlich das der Autorintentionalität und der damit einhergehenden Interpretationsrelevanz der Autorbiographie. Die Autorintentionalität wird oft dazu verwendet, um Texte zu interpretieren und ihren vermeintlich einzigen Sinn herauszustellen.
Im vierten Kapitel wird deutlich werden, dass Foucault seine Kritik nicht so sehr gegen den Autor als rechtlichen Urheber eines Textes richtet, sondern eher gegen die Interpretationsrelevanz des Autors und seine Absicht. Da die Relevanz der Autorintentionalität aber erst durch das vorherige Kenntlichmachen des Autors und das Urhebergesetz möglich wurde, ist es wichtig, zuvor diese Entwicklungen in einer kurzen Darstellung herauszuarbeiten.
2.1 Der technisch versierte und der göttlich inspirierte Dichter
In der antiken Literatur und als Beispiel hierfür in der „Poetik“ von Aristoteles, ist nachzulesen, dass der Autor, oder hier der Dichter, nicht als individueller Schöpfer erscheinen solle, sondern eher eine nachahmende Funktion einzunehmen habe. Dabei solle der Dichter möglichst wenig in der eigenen Person sprechen, weil sonst die Nachahmung zur Darstellung werde.[5]
Aristoteles nennt zwar die Namen einiger Autoren, wie etwa Homer, Aischylos oder Sophokles, bezieht sich dabei aber auf deren Technik, wie sie ihre Dramen oder Epen konstruieren, um das Publikum zu erfreuen und zu belehren. Nach Fotis Jannidis et. al. ist hier das „in der rhetorischen Tradition favorisierte Modell vom Autor als kompetentem Kenner und Anwender von ‚technischem’ Fachwissen, dem poeta faber“[6] gemeint. Die Autoren grenzen ihn vom Autorenmodell „des inspirierten Dichters, des poeta vates“[7] ab, das in Platons „Ion“ vorgestellt wird. Der Autor werde hier eher als Medium benutzt, durch den die göttlichen Botschaften ausgesprochen werden, als dass er als ihr Urheber betrachtet und für sie verantwortlich gemacht werden könne.
2.2 Mittelalterliche Anonymität
Fallen Begriffe wie ‚Mittelalter’ und ‚Autorschaft’ in einem Zusammenhang, dann kommt einem schnell das „Nibelungenlied“ in den Sinn und der dazugehörige Streit. Bis heute konnte das Lied keinem Autornamen zugeordnet werden und so ist es um zahlreiche Überlieferungen aus dieser Zeit bestellt.
Wie aus Thomas Beins Ausführungen hervorgeht, könne man in der Mediävistik und dabei vor allem im Bereich der Lyrik, kaum einen „Autor als biographisch greifbare Größe“[8] ausfindig machen. Man befasst sich hier eher mit der Zuschreibung von Werken zu einem Autornamen. Dabei gibt es nach Bein zwei Vorgehensweisen: Zum einen kommt es, wenn auch selten, vor, dass es eine Eigensignatur des Autors gibt. Das heißt, dass dieser am Anfang oder am Ende eines Liedes seinen Namen in den Vers integriert und sich als Verfasser kenntlich macht. Meist waren die lyrischen Texte jedoch für einen mündlichen Vortrag gedacht, sodass sie von ihren verschiedenen Interpreten immer wieder abgewandelt wurden. So kann man auch bei eigensignierter Literatur nicht sicher davon ausgehen, dass sie auch authentisch ist.[9]
Zum anderen kann ein Text in einem sekundären Prozess einem Autornamen zugeschrieben werden, dieses Verfahren nennt man Fremdsignatur. Schon im Mittelalter selbst hat man sich damit beschäftigt, Handschriften zu sammeln und zu ordnen. Laut Bein wird hier deutlich, „dass ein Namensprinzip integrativer Bestandteil der mittelalterlichen Literaturkultur ist.“[10] Man stiftete damit jedoch mehr Verwirrung, als eine eindeutige und geordnete Zuschreibung zu erreichen. Bein gibt dazu folgendes Beispiel:
„In der Kleinen Heidelberger Liederhandschrift A wird ein zweistrophiges Lied (nennen wir die Strophen hier ›A‹ und ›B‹) dem ›Autor‹ Hug von Mulndorf zugewiesen. Diese Strophen ›A‹ und ›B‹ stehen in einem fünfstrophigen Liedverband (mit den weiteren Strophen ›C‹, ›D‹ und ›E‹) in der Großen Heidelberger Liederhandschrift C unter dem Namen Kunz von Rosenhein. An anderer Stelle dieser Handschrift taucht Strophe ›B‹ noch einmal auf, nun in einem Liedkorpus, das Heinrich von Veldeke zugewiesen wird, während die Strophen ›C‹, ›D‹ und ›E‹ in der Kleinen Heidelberger Handschrift A mit Wachsmout von Kunzich signiert sind...“[11]
Bei diesem Durcheinander stellt sich die Frage, was diese Ordnung für einen Sinn hatte. Deshalb liegt die Schlussfolgerung nah, dass man sich zwar um eine Zuschreibung gekümmert hat, aber die festgestellte Autorschaft für eine etwaige Interpretation der Texte nicht relevant zu sein schien.
Auch wenn die Mediävistik noch heute damit beschäftigt ist, Texte nachträglich einem Autor zuzuschreiben, um die Literaturgeschichte zu ordnen, dann ist dies nach Bein eine fragwürdige Tätigkeit. Man versuche, die zu signierenden Texte in die schon vorhandenen Autorschaftsraster einzuordnen, indem man sie hindurchsiebe: „Auf dieser Grundlage werden dann die Autorprofile bestätigt, die bereits zur Konstruktion der Siebe Verwendung fanden, und auf dieser Grundlage wird Literaturgeschichte geschrieben.“[12]
Dient dieses Verfahren also wirklich der Zuschreibung von Authentizität? Es scheint, dass es sich hierbei eher um eine sehr wage Konstruktion von Autorprofilen handelt, die weder den Anspruch auf Echtheit erheben können und aus diesem Grund wenig Nutzen für die Geschichtsschreibung und die biographische Interpretationsrelevanz des Autors bringen.
Am Beispiel von mittelalterlicher Liebeslyrik stellt Ulrich Müller in seinem Aufsatz „Der mittelalterliche Autor“ einige Werke heraus, „die authentisch mit der Biographie der Autoren zusammenhängen und durch die Namensnennung, also die Zuschreibung, auch als Werke dieser Autoren autorisiert waren.“[13] Diese Form der Erlebnislyrik sei vor allem bei den Werken der Trobadors zu finden, worauf hier aber nicht mehr eingegangen wird.
Im 18. Jahrhundert kommt es zu einer gegenläufigen Entwicklung: Der Autor gewinnt als individueller Schöpfer seiner Werke an Einfluss und findet mit der Entstehung des Urheberrechts Eingang in die Gesetzbücher. Beides ist Thema des folgenden Abschnitts.
2.3 Genialität muss geschützt werden
Im 18. Jahrhundert führen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen dazu, dass der Autor als schöpferisches Individuum an Bedeutung gewinnt und dessen Werke in unveränderter und authentischer Form in das kulturelle Gedächtnis eingehen können.
Durch die Bewegung des Sturm und Drang wird nicht nur eine neue Auffassung der Dichtkunst proklamiert, sondern es wird zudem ein neues Autorkonzept generiert. Laut dem vorherrschende Modell der Regelpoetik war die Dichtkunst lehr- und lernbar. Man brauchte demzufolge keine besondere Kreativität, sondern nur ein Regelwerk, eine normative Poetik, um ein Dichter zu werden. Die Vertreter des Sturm und Drang ersetzen das Programm der normativen Poetik durch eine Poesie, die nicht nach objektiven Regeln geschrieben wird, sondern dem subjektiven Ausdruck folgt. Hier geht es nicht mehr um Nachahmung, sondern um die individuelle Schöpfung von Literatur, die ohne Vorbild auskommt. Der freie und kreative Geist bringt eine Dichtung hervor, die eine Welt von unerschöpflichen Bedeutungen eröffnet: Das Genie ist geboren.
Des Weiteren fördert der Buchdruck und die zunehmende Produktion und Verbreitung von Literatur das Bewahren der Authentizität. Durch die handschriftlichen Abschriften, aber vor allem auch durch mündliche Weitergabe von Texten kam es vormals zu Übertragungsfehlern. Durch das neue Speichermedium behalten die Werke nun ihren ursprünglichen Ausdruck.
Mit der wachsenden Buchproduktion und der Möglichkeit des Nachdrucks von Werken entsteht aber auch das Problem des Verfügungsrechts über das Geschriebene. Das geistig Geschaffene liegt jetzt in materieller, vielfältiger und ungeschützter Form vor und kann grenzenlos und von jedermann vervielfältigt werden. Deshalb wird die Herausbildung des Urheberrechts (in Deutschland um die Jahrhundertwende von 1800) und damit der Schutz des sogenannten geistigen Eigentums unerlässlich. Im Urheberrecht wird verfügt, dass die Werke eines Autors zu dessen Lebzeiten und für eine festgelegte Zeit nach seinem Tod gegen Nachbildungen geschützt sind: „In der ständischen Gesellschaft garantierte der Souverän durch seine Privilegien die Nutzung des Werks – in der modernen Gesellschaft ist der Autor an die Stelle des Königs getreten.“[14] Nach Heinrich Bosse enthalte das moderne Urheberrecht aber außer dem Anspruch auf die privilegierte Nutzung des Werkes auch noch „personenrechtliche Elemente, wie die Voraussetzung, dass im Werk die Individualität des Schöpfers zum Ausdruck gelangt.“[15] Diese Elemente machen es unter anderem möglich, dass der Autor auch biographisch wichtig wird und in hermeneutischen Interpretationsverfahren in die Deutung von Texten mit eingebunden wird.
Aus diesen drei Entwicklungsprozessen, dem Aufkommen des schöpferischen Autors, dem wachsenden Buchmarkt und der Entstehung des Urheberrechts, wird deutlich, dass das Subjekt in der Literatur an Bedeutung gewinnt. Hier wird das neuzeitliche Menschenbild mit generiert, das den Menschen als selbständigen und verantwortlichen Begründer und Urheber zeichnet. Die juristischen Veränderungen wirken sogar an der Konstruktion des genialen Schöpfers mit. Denn wenn etwas oder jemand es verdient, durch ein Gesetz geschützt zu werden, dann kann dies zu dem Eindruck in der Gesellschaft führen, es handle sich um eine Sache oder Person von besonderem Status. In Bezug auf den Autor heißt das, dass er jetzt enger mit seinem Werk verknüpft wird und er das alleinige Recht hat, über dessen Deutungsmöglichkeiten zu bestimmen und auf jener zu beharren, die er intendierte.
[...]
[1] Foucault, 2003: S. 267
[2] Foucault, 1999: S. 14
[3] Foucault, 2003: S. 247
[4] Foucault, 2003: S. 237
[5] vgl. Aristoteles 1953 : S. 369
[6] Jannidis et.al., 1999: S. 5
[7] ebd.: S. 4
[8] Bein, 2004: S. 19
[9] vgl. Bein, 1999: S. 307-315
[10] ebd., S. 315
[11] ebd., S. 315
[12] Bein, 1999: S. 319
[13] Müller, 2004: S. 92
[14] Bosse, 1981: S. 7
[15] ebd.: S. 11
- Arbeit zitieren
- Sabrina Radeck (Autor:in), 2005, Problemdarstellung des Autorbegriffs - zur historischen Entwicklung des Autorbegriffs mit dem Schwerpunkt von Michel Foucaults diskursanalytischem Konzept der Autorfunktion , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62242
Kostenlos Autor werden


















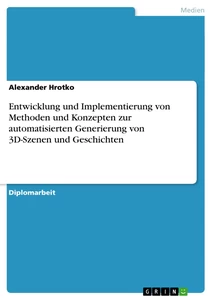


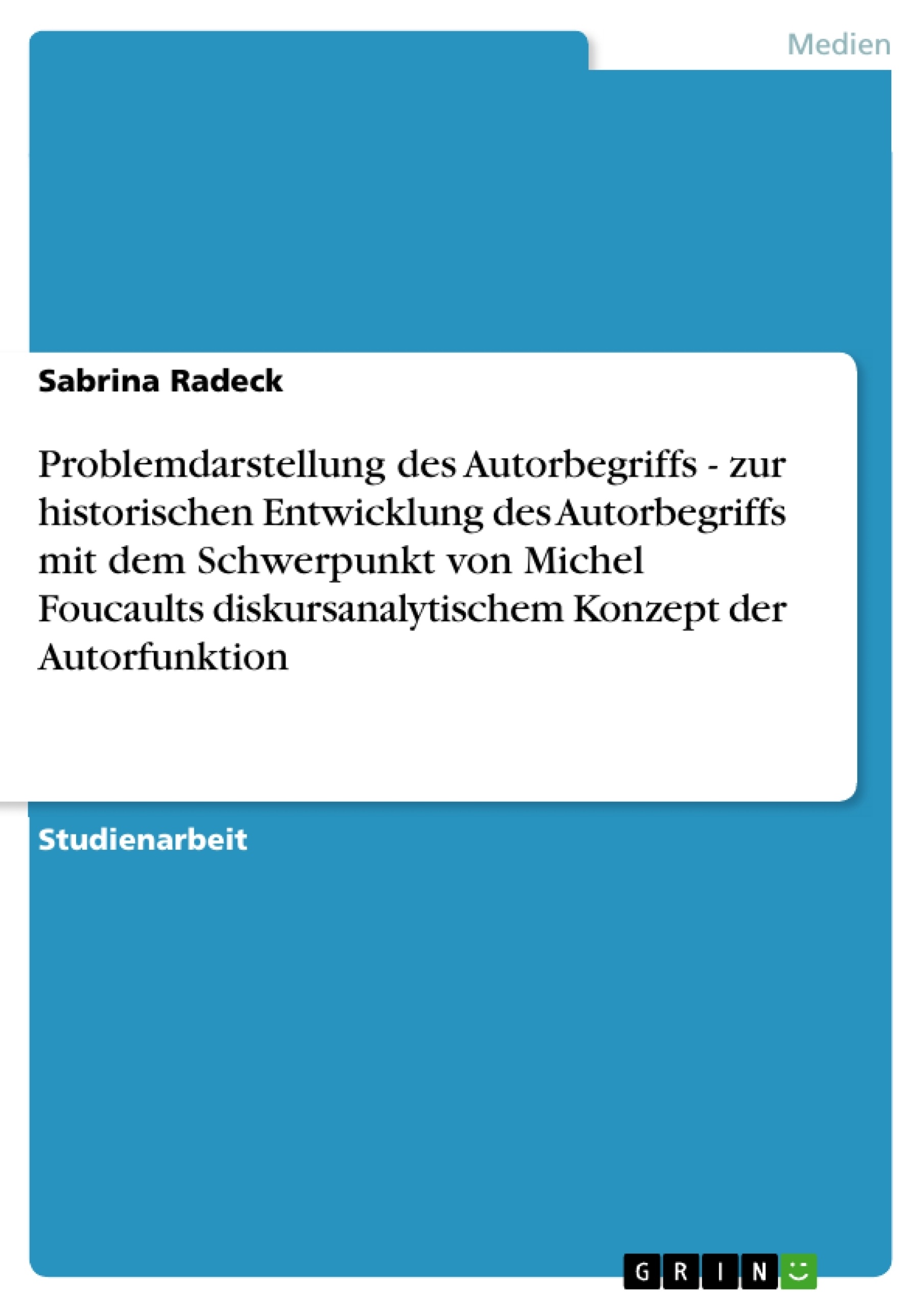

Kommentare