Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Die Entstehung der ersten Hilfsschulen in Deutschland
III. Die Hilfsschulen in der Zeit bis 1933
IV. Die Zeit des Nationalsozialismus
V. Zwischenbilanz
VI. Die Zeit von 1945 bis in die 1960er
VII. Die veränderte Sichtweise in den 70er Jahren
VIII. Paradigma – ein Definitionsversuch
IX. Paradigmata in der Sonderpädagogik
1. Der Paradigmenbegriff bei Ulrich BLEIDICK
1. 1. Das individualtheoretische Paradigma – Behinderung als medizinische Kategorie
1. 2. Das interaktionstheoretische Paradigma – Behinderung als Etikett
1. 3. Das systemtheoretische Paradigma – Behinderung als Systemfolge
1. 4. Das gesellschaftstheoretische Paradigma – Behinderung als Gesellschaftsprodukt
1. 5. Analyse der vier Paradigmata aus heutiger Sicht
2. Der Paradigmenbegriff bei Walter THIMM
2. 1. Analyse des Stigma – Paradigmas von THIMM
3. Der Paradigmenbegriff bei Emil KOBI
3. 1. Das Caritative Model
3. 2. Das Exorzistische Modell
3. 3. Das Rehabilitations – Modell
3. 4. Das Medizinische Modell
3. 5. Das Interaktionsmodell
3. 6. Analyse der fünf Paradigmen von KOBI
4. Der Paradigmenbegriff bei Markus MÜLLER
4. 1. Primär die Behinderung analysierende, kausalorientierte Determination
4. 2. Primär am Berufsstand orientierte Determination
4. 3. Primär an einem ideologischen Überzeugungssystem orientierte Determination
4. 4. Behinderungsorientierte Ansätze
4. 4. 1. Der Individualansatz
4. 4. 2. Der Mikrosoziologische Ansatz
4. 4. 3. Der makrosoziologische Ansatz
4. 5. Berufsständisch orientierte Ansätze
4. 5. 1. Der medizinische Ansatz
4. 5. 2. Der psychologische Ansatz
4. 5. 3. Der soziologische Ansatz
4. 6. Ideologisch orientierte Ansätze
4. 6. 1. Der humanistische Ansatz
4. 6. 2. Der kritisch – materialistische Ansatz
4. 6. 3. Der anthroposophische Ansatz
4. 6. 4. Der theologische Ansatz
4. 6. 5. Der analytisch – realwissenschaftliche Ansatz
4. 7. Analyse der elf Paradigmen von MÜLLER
5. Das integrationspädagogische Paradigma von Hans EBERWEIN
5. 1. Analyse des integrationspädagogischen Paradigmas von EBERWEIN
X. Vergleich der Paradigmenansätze
XI. Folgerungen für die Lernbehindertenpädagogik
XII. Die Schule für Lernbehinderte heute
XIII. Der Weg zur Namensänderung
XIV. Resümee und Ausblick
XV. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Schule für Lernbehinderte, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Hilfsschule, Schule für Schwachbegabte, ... die Liste der Namen für diese Schulart könnte um einige weitere ergänzt werden. Aber warum ist dies so? Wieso findet man keine einheitliche Bezeichnung für eine Schülergruppe, die an einer Sonderschule unterrichtet wird, an der zu einem großen Teil Kinder sind, die in der Regelschule nicht dem Unterricht folgen können und einen unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten aufweisen?
Der Lernbehindertenpädagogik fällt es sichtlich schwer, eine Definition dieser Schülerschaft zu finden, was sich meines Erachtens auch auf die Namengebung der Schulart auswirkt. Sehen wir – die Sonderpädagogen – die Behinderung als Eigenschaft, die an einem Kind festzumachen ist oder sehen wir Behinderung als Störung in der Interaktion zwischen Person und Umwelt? Sind diese Kinder also wirklich „behindert“ oder werden sie durch Schule, Gesellschaft und Familie behindert?
Die folgende Arbeit soll zeigen, in welchem Dilemma sich die Lernbehindertenpädagogik nicht erst seit knapp dreißig Jahren befindet, und wie es dazu kam, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, eine Stigmatisierung und Etikettierung von Kindern zu vermeiden, die die „Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ besuchen.
Wichtig hierzu ist der wissenschaftliche Hintergrund, also das Fach Lernbehindertenpädagogik, welches sich seit nun fast 130 Jahren mit diesen Kindern beschäftigt. Seit der ersten Stunde gab es Kritik an der – damals so genannten – Hilfsschule. Sie sei aussondernd, behebe nicht die Ursache des Problems, sondern forciere eine gesellschaftliche Aussonderung der Schüler, die diese Schule besuchen.
Um die Entwicklung dieser Schulart und der Lernbehindertenpädagogik zu verstehen, ist eine historische Betrachtung von Nöten. Schon KLEBER stellte fest, dass die Lernbehindertenpädagogik „weitgehend nur historisch gedeutet und verstanden werden“ kann (KLEBER 1980, Seite 84). Daher ist die Arbeit folgendermaßen aufgebaut:
Zuerst wird die Phase der Entstehung der ersten Hilfsschulen und deren Begründung aufgezeigt. In der Phase der Konsolidierung um 1860 bis 1870 zeigten sich schon Legitimationsversuche und auch –probleme, die zur Kritik an der Schulart und auch zur Kritik am Begriff – der damals so bezeichneten – Schwachbegabten oder Schwachbefähigten führte. Viele Vertreter der damaligen Hilfsschule wollten die Volksschule von den Kindern entlasten, die dem Unterricht nicht genügend folgen konnten – ELLGER – RÜTTGART spricht hier von der „These vom Schwachsinn des Hilfsschulkindes“ (ELLGER-RÜTTGART 1980; Seite 367) – und somit die ganze Klasse am lernen hinderte. Zudem waren zu diesem Zeitpunkt teilweise bis zu hundert Kindern in einer Klasse, was zur Folge hatte, dass schwache Schüler nicht genügend gefördert wurden und sie dem Unterricht nicht folgen konnten.
Schon zu diesem Zeitpunkt war der Name der Schulart so gewählt, dass man eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft vermeiden wollte. Der allgemeine Sprachgebrauch handelte von schwachbegabten und schwachbefähigten Kindern, die Schule aber wurde Hilfsschule genannt, weil man den Aspekt des „Den-Kindern-helfen-wollens“ in den Vordergrund zu stellen versuchte. Dies betrifft vor allem den Zeitabschnitt von 1860 bis Anfang der ersten Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts.
Im darauffolgenden Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der Jahre von 1914 bis Ende 1945. Dieser Zeitraum der zwei Weltkriege und ihren verheerenden Folgen hatte natürlich auch Auswirkungen auf die damalige Hilfsschulpädagogik. Die Phase bis 1933, der Machtergreifung Hitlers wird nur kurz angeschnitten, der Schwerpunkt wird auf das sogenannte „Dritte Reich“ gelegt wird, da die Folgen des Krieges und der Nazidiktatur direkte Auswirkungen auf die Aufbauzeit nach 1945 hatte. So wurde in den dreißiger und vierziger Jahren das Sonderschulwesen in Deutschland weiter ausgebaut. 1938 erließ das Reichsschulministerium per Anordnung, dass die Hilfsschule als eigenständige Sonderschule anzusehen ist und keinen Zweig der Volksschule mehr darstellt. Die Ziele waren freilich andere als in den Jahren zuvor. Gerade die Hilfsschule erlebte einen großen Aufschwung. Alle Behinderten und somit auch die Hilfsschüler[1] wurden als lebensunwert angesehen und waren unvereinbar mit der Hitlerideologie der deutschen Herrenrasse. Viele wurden zwangssterilisiert, deportiert oder getötet. Die Hilfsschule war nicht mehr Ort der Förderung der Schwachen, sondern Auffang- und Sammelbecken der „Krüppel“.
Schließlich erfolgt die Betrachtung der Jahre nach 1945 bis in die 1960er Jahre. Der Aufbau des Schulwesens im allgemeinen und der Hilfsschule im speziellen prägt diese Zeit. Zudem erfolgt eine recht schwache Auseinandersetzung mit der Nazizeit in Deutschland ( wobei dieses Thema nur am Rande angeschnitten werden soll, eine ausführliche Bearbeitung würde den Rahmen sprengen und ist meines Erachtens nicht primär für die weitere Entwicklung ausschlaggebend) und ihre Auswirkungen auf die Sonderpädagogik[2]. So wurde das im Dritten Reich erlassene Gesetz zur Regelung des Sonderschulwesens fast ohne Änderung übernommen. Warum dies von den damaligen Sonderpädagogen nicht als Neuanfang genutzt wurde, um einen neuen Weg der Beschulung zu beschreiten wird ebenfalls analysiert werden.
In den 60er Jahren erfolgte eine Abkehr vom Begriff der Hilfsschule, weil er zu negativ besetzt war. Man merkte, dass die Schüler den „Stempel des Hilfsschülers“ ihr Leben lang mit sich tragen mussten. Sie wurden, weil sie leistungsschwach waren, gesellschaftlich abgewertet. Der Schulbesuch wirkt sich also nicht nur auf das Kindes- und Jugendlichenalter aus, auch das spätere Berufsleben hing davon ab. So waren die Berufschancen eines Hilfsschülers evident schlechter als die eines Hauptschülers. Aber auch die Namensänderung der Schule in „Schule für Lernbehinderte“ änderte nicht – wie von vielen erhofft – wirklich die Situation der Schüler.
In den 70er Jahren erfolgte dann eine grundlegende Kritik am Sonderschulwesen und speziell an der Schule für Lernbehinderte. Dies geschah aber nicht aus der Sonderpädagogik heraus, sondern vor allem von betroffenen Eltern, die die Stigmatisierung ihrer Kinder nicht länger hinnehmen wollten. So wurde auch die Lernbehindertenpädagogik in ihrem Selbstverständnis erschüttert. Heftige Diskussionen folgten, in denen man zu klären versuchte, wer denn nun als lernbehindert gilt beziehungsweise, was Lernbehinderung ist. Hierfür sind vor allem die Erläuterungen von unter anderem BLEIDICK und auch BÜRLI zu erwähnen, die für die Sonderpädagogik die grundlegende theoretische Basis geschaffen haben.
Seit diesem Zeitpunkt wird von dem vielbeschworenen Paradigmenwechsel gesprochen. Ob es denn einen Paradigmenwechsel gab, und woran dieser festzumachen ist, wird der Schwerpunkt der Arbeit bilden. So wird erstens eine wissenschaftstheoretische Definition folgen, in der zu klären ist, wer diesen Begriff geprägt hat und wie dieser definiert wurde. Zweitens wird analysiert, inwieweit die Sonderpädagogik den Paradigmenbegriff sich zu nutzen machte, und ob dies überhaupt in dem geschehenen Maße gerechtfertigt war.
Immerhin ist die Diskussion nun mit Unterbrechungen schon seit fast dreißig Jahren in Gange und ein Ende ist nicht in Sicht. Das Gegenteil scheint eher der Fall zu sein. Die Diskussion wird immer wieder neu entfacht und mit unterschiedlichen Aspekten weiter ausgebaut. So fordert EBERWEIN seit den achtziger Jahren konsequent die Auflösung der Sonderpädagogik als den zu leistenden Paradigmenwechsel unserer Zeit.
Schließlich erfolgt eine Analyse des Ist – Standes. Was ist seit Beginn der Diskussion geschehen? Gab es einen Paradigmenwechsel in der Lernbehindertenpädagogik, der an dem neuen Namen der Schule festzumachen ist oder handelt es sich um eine neue Etikette, die man auf die alte klebte, um vor allem den Betroffenen zu zeigen, dass man die Stigmatisierung der Schüler nicht weiter gutheißen kann? Oder befinden wir uns nicht nur zeitlich an einer Schwelle in ein neues Jahrtausend, sondern auch (sonder-)pädagogisch, in dem wir sagen können: Wir haben einen großen Schritt nach vorne getan !!
Als Schluß werden die gesammelten Ergebnisse verglichen und resümiert. Inwiefern darf die Sonderpädagogik und die Lernbehindertenpädagogik von einem Paradigmenwechsel sprechen und als Folge daraus: Ist er denn eingetreten? Aufgrund dieser Ergebnisse wird ein Ausblick gewagt, der die (neuen ????) Wege der Sonderpädagogik aufzeigen soll.
II. Die Entstehung der ersten Hilfsschulen in Deutschland
Zuerst soll ein kurzer geschichtlicher Abriß die Zeit der ersten Hilfsschulen[3] in Deutschland aufzeigen, die Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Zwar sind in den Jahren zuvor bereits vereinzelte Tendenzen festzustellen, die von einer speziellen Förderung schwacher Schüler ausgehen, jedoch war von einer eigenständigen Institution zur Förderung dieser schwachen Kinder nicht die Rede (vgl. MYSCHKER 1983; Seite 121ff). Die Pädagogen gingen in der Regel davon aus, dass Kinder, gleich ob leistungsschwach oder –stark, zusammen unterrichtet werden sollten. Allein die Unterrichtsmethodik unterschied sie voneinander.
Im 18. Jahrhundert spielte Pestalozzi eine große Rolle. Er beschäftigte sich mit einem schwer geistig behinderten Mädchen beschäftigte, „wobei er zu bedeutungsvollen Einsichten über eine adäquate Erziehung kam“ (MYSCHKER 1983; Seite 123). So stellte er fest, dass eine differenzierte Beschulung von Nöten sei, damit alle Kinder ihren Bedürfnissen gerecht unterrichtet werden könnten. Genaue Definitionen der Schulschwierigkeiten der Kinder wurden jedoch in dieser Zeit kaum vorgenommen; auch ist von einer eigenständigen Institution nicht die Rede.
Erst Anfang des 19. Jahrhunderts fand eine erste Einteilung der Schüler durch Traugott WEISE statt. Er unterteilt die Geistesschwachen – so der damalige Terminus – in drei Kategorien ein:
- „die fast gar keiner Begriffe fähig sind, und alle Bemühungen, sie nur in etwas aufzuhellen, vereiteln;
- die höhere und niedere Geisteskräfte zwar besitzen, aber diese Kräfte sind zu schwach, oder gehörig stark, doch gleichsam wie mit einer Kruste überzogen;
- die entweder höhere Seelenkräfte mit schlechten niedern oder gute niedere mit schlechten höheren besitzen“ (MYSCHKER 1983; Seite 125).
Die ersten beiden genannten Gruppen können zusammen unterrichtet und erzogen werden, wobei ihnen aber eine Bildungsfähigkeit abgesprochen wird. Die dritte Gruppe fällt im Schulalltag nicht weiter negativ auf und wird daher nicht genauer berücksichtigt.
Neben dieser Einteilung stellt WEISE erste didaktische Prinzipien auf, wenn man sie denn so nennen kann. So ist unter anderem das Prinzip der Veranschaulichung von ihm als wichtig erachtet worden, da Kinder so den im Unterricht zu lernenden Stoff verinnerlichen können. Dadurch entstanden die ersten Nachhilfeklassen, in denen diejenigen Schüler unterrichtet wurden, die dem Unterricht nicht folgen konnten.
Aber wieso kam es ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zu einer solchen Entwicklung? Erstens war die Volksschule erst in einer Phase des Etablierens, denn das Schulsystem befand sich noch in den Anfangsjahren. Zweitens hatte Mitte des 19. Jahrhunderts die industrielle Revolution auch Deutschland erreicht. Schulen bildeten die zukünftigen Arbeiter aus und musste die Schüler nach der „Unterschiedlichkeit der zu erwartenden Arbeitsverhältnisse“ einteilen (REICHMANN-ROHR, WEISER 1996; Seite 19f). Die Volksschule wurde also zu einer Leistungsschule, in der diejenigen zurückblieben, die dem Lerntempo nicht gewachsen waren. Heute kann man auch die Sichtweise vertreten, dass die Lehrer den Stoff nicht methodisch klar aufarbeiteten.
Dennoch gab es bisher noch keine eigenständige Schulart für schwache Kinder. In einer kleinen Schrift machte 1864 Heinrich Ernst Stötzner (1832 – 1910) darauf aufmerksam, dass es eine Schule für schwachbefähigte Kinder geben müsse. Der Titel“ Schulen für schwachbefähigte Kinder. Erster Entwurf zur Begründung derselben“ (SCHRÖDER 2000; Seite 11) zeigt die Tragweite des Werkes auf. Stötzner war der erste, der eine eigenständige Schulart für schwachbefähigte Kinder forderte und diese Forderung auch noch begründete.
Essentiell und neuartig ist hierbei die von ihm vorgenommene Einteilung der Schüler. Es sind dies „Kinder, für die er schulisch sorgen will“ , die er „von den „Blödsinnigen“, die nicht schulbildungsfähig seien, deutlich abgrenzen möchte“ (SCHRÖDER 2000; Seite 11). Stötzner kreiert also eine, wie es SCHRÖDER nennt, „intermediäre Population“ (SCHRÖDER 2000; Seite 11). Die Kinder, die also zu „schlau“ sind für die damalige Blödsinnigenschule ( heute Geistigbehindertenschule ) aber zu schwach für die Volksschule. Wichtig für Stötzner war vor allem die Trennung zur Blödsinnigenschule, da die Schüler damals als nicht bildungsfähig galten, was auf die schwachbefähigten Schüler nicht zutreffe.
In seiner Schrift führte Stötzner folgende drei Motive zur Errichtung der Hilfsschule auf:
- das humanitäre Motiv zeigt auf, dass diese Kinder nur unter Lehrern und Mitschülern leiden
- das schulorganisatorische Motiv stellt dar, dass die guten Schüler nicht adäquat unterrichtet werden können, was bei einer Klassengröße von bis zu hundert Schülern so schon schwierig war
- das ökonomische Motiv, welches zeigt, dass diese Kinder zu guten Mitglieder der Gesellschaft erzogen werden können und so der Gemeinde nicht zur Last fallen (vgl. MYSCHKER 1983; Seite 128).
Stötzner stellte somit erstmals Basisbedingungen zur Beschulung schwachbefähigter Kinder – so die damals von ihm stammende Bezeichnung – auf. Mit einer Förderung in Nachhilfeklassen gab er sich nicht zufrieden, da die Schüler seiner Meinung nach dort nicht genügend gefördert werden konnten. Ein nicht unwesentlicher Faktor hierbei war auch die enorme Klassengröße der damaligen Zeit. Bis zu einhundert Schüler besuchten eine Klasse. Somit war die Entlastung der Volksschule ein wichtiger Ansatzpunkt in seiner Begründung.
Stötzner war, aus heutiger Sicht betrachtet, der erste Lehrer, der für eine eigene Schulform plädierte, in der lernschwache Schüler unterrichtet werden sollten. Den Vorwurf der Aussonderung dieser Schüler ist in diesem Fall nicht zu vermeiden, wenn er auch aus seiner Sicht hehre Ziele verfolgte, eine Etikettierung war jedoch unvermeidbar. Stötzner war sich dieses Problems auch bewußt, denn er vermied die Bezeichnung der „Schwachsinnigenschule“ oder ähnlichem. Die Schüler sollten in der Gesellschaft nicht zu einer Randgruppe werden. „Ich würde diese Anstalten Nachhilfeschulen nennen, ... so klingt er doch weniger hart und abstoßend, weniger niederdrückend als der Name Schule für Schwachsinnige. (STÖTZNER, in: BLEIDICK 1968, Hervorhebung vom Autor). Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein Euphemismus bei der Namengebung die zu erwartenden Probleme wirklich kaschiert hätte.
In den darauffolgenden Jahren bildeten sich nun in Deutschland vermehrt die ersten Schulen für schwachbefähigte Kinder. MYSCHKER sagt, dass die „Schrift Stötzners“...“nicht als «Gründungsurkunde der Hilfsschule » aufgefaßt werden kann, sondern als eine zu jener Zeit dringend benötigte Pädagogik der Schwachsinnigen“ (MYSCHKER 1983; Seite 129). Stötzner als alleinigen Begründer der Schule für Lernbehinderte anzusehen wäre zuviel gesagt, jedoch war seine Art der Didaktik und Methodik, die er für diese Schule begründete, neu.
Ein Problem, das bisher noch nicht ausführlich besprochen wurde, ist die Etikettierung derjenigen Schüler, die in der Volksschule nicht mehr dem Unterricht folgen konnten. Die damaligen Befürworter der neuen Schulart setzten sich stark dafür ein, dass alle Kinder in dieser Schule eine Bildung erhielten. Durch die Festlegung, dass sie „Schrittchen für Schrittchen“ und so anschaulich wie möglich lernen sollen (so Stötzner), wird ihnen meines Erachtens ein gewisser Grad an Intelligenz abgesprochen. Auch kann eine Definition der Schülergruppe als „Hilfsschüler“ nur unbefriedigend vorgenommen werden.
Die damalige Pädagogik richtete sich noch so sehr an der Medizin aus, dass sie von ihr eine wissenschaftliche Begründung für den Besuch der Hilfsschule erwartete. So suchte man vor allem im kognitiven Bereich der Schüler die Gründe für eine Umschulung. Dieser medizinisch – naturwissenschaftliche und auch defektorientierte Ansatz reicht – meines Erachtens – noch bis in die heutige Zeit hinein. Man konzentrierte sich zu sehr auf das „Nichtkönnen“ als auf das „Können“ der Schüler, wenngleich auch Stötzner, Kielhorn und andere Pädagogen schon damals immer wieder betonten, dass auch die Stärken der Schüler wichtig seien und sie im Lernfortschritt eine wichtige Rolle spielten.
III. Die Hilfsschulen in der Zeit bis 1933
Dieses Kapitel soll kurz darlegen, wie sich die Hilfsschule Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland etabliert hat und inwiefern sie Einfluß auf die Bildungslandschaft in Deutschland nahm.
Trotz des anfänglichen Widerstandes bei den Lehrern und Eltern gelang es den Befürwortern der Hilfsschule, sie in vielen Städten zu etablieren. Einen großen Beitrag leistete hierzu der Verband der Hilfsschulen Deutschlands (VdHD), der nicht müde wurde zu betonen, dass für schwache Schüler nur eine adäquate Förderung an diesen Schulen erfolgen konnte (vgl. MYSCHKER 1983; Seite 137). ELLGER – RÜTTGART verweist auf eine standespolitische Profilierung der Lehrerschaft, wodurch nach ihrer Darstellung von Anfang an ein wichtiger Grundstein gelegt wurde, diese Schulform schnell zu etablieren ( vgl. hierzu ELLGER - RÜTTGART 1980). Zudem gab der Erfolg den Schulen recht. So konnten viele Schüler nach Besuch der Hilfsschule einen Beruf erlernen und schließlich auch ausüben, und wurden somit wieder nützliche Mitglieder der Gesellschaft (was zu dem damaligen Zeitpunkt immer wieder als ökonomisches Motiv genannt wurde, siehe dazu die Erläuterungen später im Text ).
Während des Ersten Weltkrieges wurde die weitere Entwicklung gestoppt. Eine große Anzahl der Lehrer zog in den Krieg, viele Schulen wurden als Lazarette benutzt und eine Beschulung der Kinder während der Kriegswirren konnte man auf Grund der massiven Zerstörung ganzer Städte nicht mehr aufrecht erhalten.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde, wegen der damaligen politischen und gesellschaftlichen Situation, die Abschaffung der Hilfsschule wie auch der Volksschule gefordert, hin zur Einheitsschule. Doch der damalige VdHD konnte aufgrund geschickt ausgespielter Beziehungen zu den behördlichen Vertretern eine Manifestierung der Hilfsschule vorantreiben ( vgl. hierzu ELLGER – RÜTTGART 1980 ). Hier stellt sich meines Erachtens die Frage, ob wirklich die Interessen der Schüler noch im Vordergrund standen. MYSCHKER führt zwar sehr sachlich die damalige Entwicklung auf, verliert aber in meinen Augen die „Klientel“ der Hilfsschule aus dem Blickwinkel (vgl. MYSCHKER 1983; Seite 139ff). Denn hätte der Verband seine Beziehungen nicht genutzt, wären die als schwachbegabt geltenden Schüler wieder an die Regelschule eingeschult worden, und hätten vielleicht, da die Klassen jetzt kleiner waren als zwanzig bis dreißig Jahre zuvor, die Volksschule mit Erfolg besuchen und beenden können.
Mit Hilfe von Erlassen wurde die Schulbesuchspflicht an der Hilfsschule eingeführt und schließlich durch erste Gerichtsurteile bestätigt.
Hier befindet sich die damalige Schule in meinen Augen auf „sehr dünnem Eis“. Nicht nur, dass eine Rückführung in die Volksschule fast nicht mehr durchzusetzen war, auch der medizinische Erklärungsansatz wurde weiter verstärkt als Begründung für Sonderschulbedürftigkeit herangezogen (vgl. MYSCHKER 1983; Seite 143). Die Schüler, einmal als „bildungsfähige Schwachsinnige“ (MYSCHKER 1983; Seite 143) etikettiert, wurden von diesem Makel ihre ganze Schullaufbahn und das spätere Leben hindurch begleitet. Somit war eine gesellschaftliche Ausgrenzung erreicht, ob gewollt oder nicht.
SCHRÖDER stellt dar, dass nun auch die Psychologie aufgrund der Entwicklung erster Intelligenztests ein Diagnostikum lieferte, um schwachbefähigte Kinder aus der Volksschule an die Hilfsschule zu überweisen (vgl. SCHRÖDER 2000; Seite 32). Auch hier ist die defektorientierte Sichtweise festzustellen. Nur an den kognitiven Leistungen der Schüler wurde festgemacht, ob sie für die Volksschule geeignet waren. Ein ganzheitlicher Ansatz, wie es auch die Reformpädagogik forderte, wurde nicht beachtet.
Die Chancen zu einem Wechsel , der sich durch die Reformpädagogik anbot, wurde nicht genutzt. Im Gegenteil, er wurde abgelehnt, und das sich aus der Sicht der Hilfsschullehrer mühsam erkämpfte ( die individuelle Förderung des schwachbegabten Kindes) wurde manifestiert.
Kritiker der Hilfsschule fanden kaum Gehör, so wurde Louis Esche, Lehrer an der Braunschweiger Hilfsschule ( an der Kielhorn Direktor war ), versetzt, weil er die medizinische Sichtweise ablehnte und die Meinung vertrat, dass „Jeder Lehrer, dem die Pädagogik Kunst und nicht Handwerk ist,“[...] ein „Heilpädagoge“ ist (REICHMANN – ROHR, WEISER 1996; Seite 26).
IV. Die Zeit des Nationalsozialismus
Die Zeit des Nationalsozialismus ist in Bezug auf die Sonder- und Heilpädagogik, eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte.
1933, schon kurz nach der Machtergreifung Hitlers wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen“. Eingebettet in die sozialdarwinistische Tradition half es, Hitlers Ziel, einer gesunden Herrenrasse zu schaffen, ein Stück näher zu kommen. Die Schüler der Hilfsschule wurden durch dieses Gesetz direkt in ihrem Anspruch auf Existenz angegriffen. Aufgrund einer medizinischen Sichtweise galten die Schüler als krank ( im psychiatrischen Sinne ) und somit als lebensunwert. Folglich wurden sie als nicht zur deutschen Herrenrasse zugehörig angesehen. Zudem erschien dem Regime die Unterhaltung der zahlreichen Schulen als zu teuer und uneffektiv.
Mitte der dreißiger Jahre „erhielt die Hilfsschule [dann] ihre eindeutigen Funktionen für den NS-Staat zuerkannt: Entlastung der Volksschule“ (SCHRÖDER 2000; Seite 34). Was auf den ersten Blick wohlwollend erscheint, stellte sich aber für die Schüler als umso gefährlicher, sogar lebensbedrohlich heraus. Denn das bereits erwähnte „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ besagte auch, dass, wer erbkrank ist, durch einen chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht (sterilisiert) werden soll.
Die Zahl der Zwangssterilisationen unter den Hilfsschülern stieg in den folgenden Jahren drastisch an, wobei hier die Hilfsschulen ihren Beitrag durch „Abfassung von Gutachten für Erbgesundheitsgerichte“ (REICHMANN-ROHR, WEISER 1996; Seite 28) leistete.
Zwar wurde in der Heilpädagogik in den Jahren vor 1933 Eugenik wie auch Sozialdarwinismus schon heftig diskutiert, ihre Umsetzung erfolgte aber schließlich erst unter der Diktatur Hitlers. REICHMANN – ROHR bemerkt hierzu, dass es sich nicht um „einen Umschwung“ handelte, sondern, dass es „zu einer Verschärfung bereits vorhandener Strukturen und Tendenzen“ kam (REICHMANN – ROHR 1991). So erschien – um dies noch einmal zu verdeutlichen – schon 1913 in der Zeitschrift „Die Hilfsschule“ folgender Abschnitt: „ ... dass es unrichtig sei, das „unheilbar minderwertige Massenmaterial“, also die Hilfsschüler, „wieder dem öffentlichen Leben“ zurückzugeben. „Die dauerhafte Entfernung solcher Menschen aus dem Volke“ seien „eine wichtige soziale Lebensaufgabe der Hilfsschule““ (SPECK 1998; Seite 75).
Dies zeigt auf, in welcher Zwickmühle sich die damalige Heilpädagogik befand. Einerseits wollte sie die schwachen Kinder und Jugendliche fördern, ihnen helfen, das spätere Leben zu bewältigen. Andererseits rechtfertigte die damalige medizinische Sichtweise zu großen Teilen die dann durchgeführten Zwangssterilisationen und Umsetzung der rassenhygienischen Bestimmungen und Gesetze. MYSCHKER spricht in diesem Zusammenhang davon, dass „der Begriff des Schwachsinns, der zur Gründung von Hilfsschule geführt hatte, ... nun zum Menetekel“ wurde (MYSCHKER 1983; Seite 154).
Ab 1938 wurden die Hilfsschulen immer mehr zu einem Sammelbecken derjenigen Kinder, die in der Volksschule nicht mehr dem Unterricht folgen konnten. Sie nahmen somit eine Entlastungsfunktion der Volksschule ein, damit dort ein besserer und effektiverer Unterricht erfolgen konnte. Von einem Fördergedanken konnte nun nicht mehr die Rede sein. Im Zuge der Kriegsentwicklung ab 1942 wurde eine Großzahl der gegründeten Hilfsschulen wieder abgebaut, da man die Gebäude als Notlager und Lazarette brauchte. Zudem wurden durch die Bombardierung ganzer Städte viele Gebäude zerstört.
V. Zwischenbilanz
Zusammenfassend kann man meines Erachtens folgendes in dem Zeitraum der Entstehung der ersten Nachhilfeklassen bis zum Ende des zweiten Weltkrieges konstatieren:
- Die Schülerschaft der Hilfsschulen oder Schule für Schwachbegabte setzte sich zu einem großen Teil aus Schülern zusammen, die dem Unterricht an der Volksschule aus unterschiedlichen Gründen nicht folgen konnten. So wurde ein zweijähriger Rückstand als Anlaß zur Umschulung als begründet angesehen.
- Die Schülerschaft der Hilfsschule gab es nicht. Eine Definition wurde – trotz einiger Versuche – nicht gefunden. Viele Schüler stammten aus sozial schwachen Schichten, was aber nicht als Ursache, sondern als Folge von Schwachsinn gesehen wurde.
- Die damals entstehende Hilfsschulpädagogik richtete sich nach „der an gesellschaftspolitischer Erklärungskraft gewinnenden Erblehre“ (MOSER 2000; Seite 266). Die vorherrschende Sichtweise war medizinisch – im speziellen psychiatrisch – geprägt, später folgte der zunehmende Einfluß der Psychologie aufgrund entsprechender Testverfahren.
- Die Hilfsschule hatte vor allem erzieherische Funktion und sollte die Schüler zu brauchbaren Individuen in der Gesellschaft erziehen. Dazu diente unter anderem der durchstrukturierte Unterricht.
- Die Lehrerschaft der Hilfsschulen trug nicht unwesentlich dazu bei, dass sich diese Schulart manifestierte und ihr Berufsstand gesichert wurde. Bestrebungen der Reformpädagogik und der Einheitsschule wurde größtenteils mit allen Mitteln widersprochen.
- In der Zeit der Nazidiktatur wurden die sogenannten Schwachsinnigen Opfer der sozialdarwinistischen biologistischen Sichtweise und wurden durch die Eugenikprogramme in ihrer Menschenwürde zutiefst verletzt.
Obwohl sich die Hilfsschulpädagogik erst in ihren Anfängen befand, ist es in meinen Augen zu großen Teilen nicht nachvollziehbar, wie sie trotz aller Bemühungen eine Aussonderung der sogenannten Schwachsinnigen vornahm und ihre Begründung in einem medizinischen Verständnis suchte. Stötzner hob in seiner 1864 erschienenen Schrift hervor, „das schwachsinnige Kind könne „doch denken, wollen und empfinden“.[...] er bestreitet also eine gänzliche Andersartigkeit“ (SCHRÖDER 2000; Seite 11). Dennoch ist man sehr schnell bei einer defektorientierten Sichtweise angelangt. Die Schwächen der Schüler stehen im Vordergrund, von ihren Stärken wird kaum mehr gesprochen. Ebenso wird völlig außer acht gelassen, dass die meisten Kinder aus unteren sozialen Schichten stammen, und die Ursache mitunter dort zu suchen ist.
So wurden die Schüler als schwachsinnig, geistig schwach oder stumpfsinnig etikettiert und davon wurde auch nicht mehr abgewichen. Nach Feststellung der „Behinderung“ war die Schullaufbahn und das spätere Leben in großen Teilen schon vorgegeben. Auch der Name Hilfsschule anstelle „Schule für Schwachsinnige“ konnte die Stigmatisierung der Schüler nicht verhindern, zudem der Schulbesuch später als zwingend vorgeschrieben wurde, wenn (hauptsächlich) Schulversagen vorlag.
Eine einschneidende Veränderung bei der Schülerschaft gab es in den Jahren von 1920 bis ca. 1945, die Hofmann als „Strukturwandel“ bezeichnete, im Verständnis der Hilfsschule. „Die Bezeichnung Strukturwandel bezog sich auf die Unterscheidung von geistigbehinderten und lernbehinderten Kindern und auf die Ziele der Schule“ (MÖCKEL 1976; Seite 117).
Dies bedeutete, dass nicht mehr die Kinder in der Schule unterrichtet wurden , die geistig behindert waren, sondern „nur“ noch Schwachbegabte und Schulleistungsschwache. Es fand somit eine Verlagerung „nach oben“ statt und eine Begrenzung des Personenkreises. Ob aber der „gewichtige Ausdruck“ „Strukturwandel““ (SCHRÖDER 2000; Seite 33) diese Entwicklung trifft, sei in Frage gestellt, den am Grundverständnis gegenüber den Schülern und der Schule änderte sich nichts.
Man verstand die Hilfsschule also nicht mehr als Ort des „Nur – Bewahren und Betreuenwollens“ (MÖCKEL 1976; Seite 117f.), sondern als Förderstätte, an denen lernbehinderte Kinder und Jugendliche Leistungen erbringen sollen, und dementsprechend auch gefördert werden. Dies sollte „natürlich nur im Rahmen des biologisch und intellektuell Möglichen“ (HOFMANN in MÖCKEL 1976; Seite 118) erfolgen.
VI. Die Zeit von 1945 bis in die 1960er
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges knüpfte die Heilpädagogik an den Jahren vor 1933 an, wobei „versäumt wurde..., kritisch zu reflektieren, ob die vermeintlich bewährten heilpädagogischen Traditionen der Vor – Nazizeit ... wirklich so bewährt waren“ wie man im allgemeinen glaubte (ELLGER – RÜTTGART 1996). Eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen ( Zwangssterilisationen; Vernichtung „unwerten Lebens“, usw.) während der Nazizeit erfolgte, wenn überhaupt, nur unzureichend. Die theoretischen Grundlagen der Zeit um 1900 wurden ebenso beibehalten, wie das Verständnis von Behinderung der Schüler an den Hilfsschulen. Die Hilfsschulen selbst trugen mittlerweile den im Dritten Reich offiziell eingeführte Titel „Sonderschule“ (Reichsschulpflichtgesetz vom 6.7.1938). SCHRÖDER weist jedoch darauf hin, dass dieser Titel nichts mit dem nazistischen Gedankengut zu tun habe, da er bereits um 1900 gebraucht wurde ( SCHRÖDER 2000; Seite 35 ).
So wurde nicht nur die Struktur des Schulwesens im wesentlichen beibehalten – und in den folgenden Jahren weiter ausgebaut – auch im Verständnis der „Schwachsinnstheorie“ änderte sich nichts. „Die Schwachsinnstheorie wurde durch neue Definitionen und Begriffe abgeändert, die den «Wert» der Hilfsschüler nach ihrer «Unwertmachung» im Faschismus wieder herstellen sollte“ (REICHMANN-ROHR, WEISER 1996; Seite 29), in ihrem Grundverständnis aber blieb sie gleich.
Ein weiterer wichtiger Punkt – den auch schon Stötzner betonte – war das ökonomische Motiv. So heißt es, dass „die Förderung des Sonderschulwesens ... aber auch aus wirtschaftlichen Gründen notwendig“ ist. „ Mittel, die heute für die Sonderschulen ausgegeben werden, werden später in vielfacher Höhe bei den Ausgaben für Unterstützung, Gefängnisse und Heilanstalten eingespart“ (MYSCHKER 1983;: Seite 159). Man rechtfertigt also das auf den ersten Blick scheinbar teurere Sonderschulwesen mit seiner präventiven Wirkung auf die Hilfsschüler, die somit zu nutzbaren Mitgliedern der Gesellschaft werden können.
Zusammenfassend kann man für die Jahre bis 1960 grundlegend festhalten, dass
- eine grundlegende Veränderung im Verständnis zu Hilfsschülern nicht stattfand, also weiterhin eine personen- und defektorientierte Sichtweise vorherrschend war
- das medizinische Verständnis von Schwachsinn beibehalten wurde, Schwachsinn also genetisch bedingt ist ; andere Faktoren, wie zum Beispiel sozio – kulturelle Bedingungen wurden fast vollständig vernachlässigt
- die Motive weitestgehend die gleichen sind, die bereits Stötzner propagierte (Entlastung der Volksschule; individuellere Förderung; Nutzen für die Gesellschaft)
- die Hilfsschulen weiterhin als der Ort angesehen wurden, an dem schwachbegabte Schüler am besten gefördert werden und sich frei entfalten können.
Trotz der sich zum Vorteil der Hilfsschule entwickelnden starken Stellung im Schulsystem, wurde sie immer noch als Teil der Volksschule verstanden, sehr zum Unmut der Vertreter der Sonderschulen für schwachbegabte Schüler, da sie sich mittlerweile als eigenständige Schulform sah, die eigens der Förderung behinderter Kinder diente. So blieb „die Sprachregelung des gemeinsamen, wenn auch weithin formalen Rahmens mit der allgemeinen Schule ... bis zum Erlaß der Sonderschulgesetze in den Ländern der Bundesrepublik in den sechziger Jahren erhalten“ (SPECK 1998; Seite 77).
In den 50er und vor allem 60er Jahren wird immer deutlicher, wie stigmatisierend der Begriff der Hilfsschule sich auf die Schüler auswirkte. Gesellschaftliche Ausgrenzung und lebenslange Etikettierung sind die Folgen des Besuchs einer Hilfsschule. So erfolgte unter anderem aus diesem Grund 1960 ein Gutachten der Kultusministerkonferenz, welches sich für eine Umbenennung in Schule für Lernbehinderte ausspricht. Aus heutiger Sicht mag es seltsam sein, dass gerade der Begriff der Behinderung hier als Aufwertung genutzt wurde, aber zu dem damaligen Zeitpunkt waren Begriffe, wie „schwachsinnig“, „Hilfsschüler“, „debil“ derart negativ besetzt und stigmatisierend, dass man sie aus dem offiziellen Sprachgebrauch zu entfernten versuchte, und durch neue (euphemistische???) zu ersetzen versuchte. „Es mag erstaunen, dass man die Image–Aufwertung ausgerechnet durch eine mit „behindert“ zusammengesetzte Wortprägung erzielen wollte. Doch zeigt dies nur, wie sehr diese Sonderschulform sich von Geringschätzung und Diskriminierung betroffen sah – mehr als andere Sonderschulen, so dass es vorteilhaft erscheinen konnte, sich begrifflich an diese anderen Sonderschulen anzulehnen“ (SCHRÖDER 2000; Seite 71).
Interessanterweise wurde also eine Aufwertung durch den Behinderungsbegriff erwartet. Dies zeigt ein grundlegendes Problem der Fachdisziplin und seiner schulischen Realisation zur damaligen Zeit: Die fehlende Zuordnung der Schulform der „Sonderschule für Lernbehinderte / Hilfsschule“ im Schulsystem. Immer noch wurde sie als Teil der Volksschule verstanden, welche diejenigen Schüler aufnahm, die dem Unterricht nicht mehr folgen konnten. Den Vertretern der Hilfsschule war dennoch klar, dass diese Namensänderung auch nur kurzfristig zu einer Verbesserung führen würde und, dass auch neue Begrifflichkeiten nach absehbarer Zeit negativ besetzt sein werden ( vgl. auch MYSCHKER 1983; Seite 160 und BLEIDICK 1968; Seite 450f ).
[...]
[1] Auf den folgenden Seiten wird der Einfachheit halber immer die männliche Form benutzt, wobei dies natürlich die weibliche Form mit einschließt. Ebenso wird von Lehrern oder Pädagogen gesprochen, was ebenso Lehrerinnen und Pädagoginnen mit einbezieht
[2] Im folgenden werden die Begriffe Sonderpädagogik, Behindertenpädagogik und Heilpädagogik synonym verwendet. Sie alle haben in dieser sogenannten speziellen Pädagogik ihren Platz gefunden und werden von ihren Vertretern begründet und verteidigt.
[3] Der Name Hilfsschule geht auf Heinrich Kielhorn zurück, der ihn wie folgt begründet: „Nach meiner Auslegung bringt die Hilfsschule Hilfe den schwachen Kindern, deren Familie, der Volksschule und dem ganzen Volke“; aus: MÖCKEL 1976; Seite 101. Inwieweit Kielhorns Annahme verwirklicht wurde, wird im Folgenden noch aufgezeigt werden.
- Arbeit zitieren
- Thomas Fey (Autor:in), 2001, Von der Schule für Lernbehinderte zur Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6219
Kostenlos Autor werden






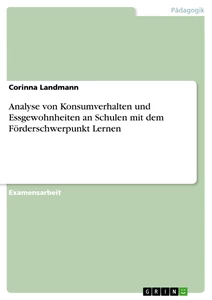















Kommentare