Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zur Landfriedensforschung nach dem Zweiten Weltkrieg
3. Der Mainzer Reichsfriede von 1235
3.1 Verdrängung der Fehde in die Subsidiarität
3.2 Bestimmungen zur Gerichtsbarkeit
4. Die Reformatio Friderici von 1442
4.1 Fehderegulierende Maßnahmen
4.2 Zum Problem der Schiedsgerichtsbarkeit
5. Die Reichsfriedenskonstitution Friedrichs III. von 1467
5.1 Befristetes vollständiges Fehdeverbot
5.2 Bestimmungen zur Gerichtsbarkeit
5.3 Das crimen laesae maiestatis
6. Der Wormser Reichsfriede von 1495
6.1 Unbefristetes vollständiges Fehdeverbot
6.2 Staatsbildende Maßnahmen
7. Schlussbetrachtung
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der berühmten Präambel der lateinischen Fassung des Mainzer Reichsfriedens von 1235 werden im Wesentlichen zwei Gründe für die Proklamation des Gesetzes genannt. Dies ist zum einen der Wunsch, „eine Regierung des Friedens und der Gerechtigkeit stattfinden zu lassen“; der andere Grund sind die bestehenden deutschen Rechtsgewohnheiten. So sei das Gesetz erlassen worden, da „die Bewohner ganz Deutschlands in ihren Rechtsstreitigkeiten und privaten Rechtsgeschäften noch ganz nach den überlieferten alten Gewohnheiten und ungeschriebenem Recht leben“ und Gerichtsurteile „mehr durch bloßes Gutdünken als durch ein auf gesatztes Recht gestütztes“ Verfahren entschieden würden[1].
In dieser Begründung artikuliert sich ein wesentliches Ziel der mittelalterlichen Landfriedensbewegung insgesamt; die Absicht nämlich, an die Stelle althergebrachten Gewohnheitsrechtes willentlich gesetztes Recht treten zu lassen. Die in etwa seit der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert auftretenden Landfrieden[2] können schließlich als „Träger des ersten positiven und nur positiven Rechts“ gelten. In ihnen „setzt sich zum ersten Mal im deutschen Raum die menschliche Freiheit dem Recht gegenüber durch“[3].
Grundsätzlich richtete sich die Landfriedensgesetzgebung gegen alle die öffentliche Sicherheit und den sozialen Frieden bedrohenden Handlungen. Landfriedensrechtlicher Hauptregulierungsgegenstand aber war das tradierte Rechtsinstitut der Fehde, die in dem hier behandelten Zeitraum vor allem die Ritterfehde meint, d.h. ganz allgemein die vom waffenfähigen Adel ausgeübte legitime Rechtsdurchsetzung auf dem Weg der Selbsthilfe[4]. Ein Großteil der landfriedensrechtlichen Bestimmungen seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts waren diesem Rechtsmittel gewidmet, das als ein „konstitutives Strukturelement mittelalterlicher Verfassungswirklichkeit“ betrachtet werden muss[5]. Dabei werden die überaus zahlreichen, teilweise für das gesamte Reich, weitaus häufiger jedoch mit regionaler Geltungsbegrenzung beschlossenen Friedenstexte getragen von einem gleichsam programmatischen, im Laufe der Zeit immer deutlicher hervortretenden Bemühen: Der offene, gewalttätige Streit eigenmächtig handelnder Parteien wurde, soweit das Friedensgebot reichte, schrittweise an Rechtsregeln gebunden, durch derartige ‚Verrechtlichung’ zunehmend delegitimiert und schließlich gänzlich kriminalisiert. Im Vordergrund stand nun nicht mehr die Befriedung im einzelnen konkreten Streitfall, sondern das planerische, in die Zukunft gerichtete Bemühen um einen dauerhaften sozialen Rechtsfrieden[6]. Dies schloss die Gewaltanwendung gegen Friedensbrecher ein; die Verpflichtung auf die „neue Friedensidee“[7] rechtfertigte gegebenenfalls das Verletzen und Töten des Straftäters. Mit der Festlegung einzelner Tatbestände und korrespondierender Sanktionsandrohung hatten die mittelalterlichen Landfrieden großen Einfluss auf die Entwicklung der peinlichen Strafgesetzgebung[8].
Sollte nun das in den Landfrieden niedergelegte Recht zur Geltung kommen und die Fehde erfolgreich zurückgedrängt werden, mussten interesselos urteilende Gerichtsinstanzen und adäquate Verfahrensweisen zur konsequenten Strafverfolgung, kurzum ein zuverlässiges Monopol physischer Gewaltsamkeit etabliert werden. Dieses existierte jedoch im Mittelalter nicht und wurde erst in einer sich über Jahrhunderte erstreckenden Entwicklung allmählich ausgebildet. Die sukzessive Verdrängung der Fehde als legitimes Rechtsinstitut dokumentiert damit zugleich „die Geschichte der Entwicklung von lockeren Formen des gesellschaftlichen Zusammenschlusses zum modernen Staat“[9].
Die nachstehenden Überlegungen bemühen sich nun darum, anhand der grundlegenden spätmittelalterlichen Reichsfriedenstexte diesen keineswegs linear verlaufenden Entwicklungsgang nachzuzeichnen.
Den Ausgangspunkt bildet der bereits zu Beginn zitierte, auch in deutscher Sprache vorliegende und gemeinhin als eine entscheidende Zäsur der mittelalterlichen Friedensbewegung geltende Mainzer Reichsfriede Friedrichs II. von 1235. Im Hinblick auf die Eindämmung der Selbsthilfe ist hier neben den institutionellen Neuerungen des Reichhofgerichtes und des Reichshofgerichtsschreibers der eine rechtmäßige Fehdeansage nun notwendig bedingende gerichtliche Klagezwang von besonderer Relevanz – die häufig sogenannte juridische Verdrängung der Fehde in die Subsidiarität.
Vor diesem Hintergrund – der dem rückblickenden Betrachter gewissermaßen als regulativer Maßstab für die reichsrechtlichen Befriedungsbemühungen der folgenden 130 Jahre gelten kann – werden dann die Reichsfrieden von 1442 und 1467 näher in den Blick genommen. Für ersteren sind das Wiederaufgreifen des Subsidiaritätsprinzips sowie die Zuständigkeitsbestimmung von Austragsgerichten wesentliche Bedeutungsmomente, für letzteren die Ausweitung des Straftatbestandes des crimen laesae maiestatis auf den Landfriedensbruch. Darüber hinaus wird 1467 reichsgesetzlich erstmalig ein zunächst auf fünf Jahre befristetes absolutes Fehdeverbot erlassen.
Abschließend soll in einer notgedrungen knappen Skizze Inhalt und Kontext des Wormser Reichsfriedens von 1495 vorgestellt werden, in dessen uneingeschränkter Kriminalisierung jedweder Form von Selbstjustiz die mittelalterliche Reformanstrengung für den inneren Frieden schließlich einen reichsrechtlichen Endpunkt findet.
2. Zur Landfriedensforschung nach dem Zweiten Weltkrieg
Zuvor jedoch noch einige Anmerkungen zum Verlauf der Forschungsdiskussion nach dem Zweiten Weltkrieg[10]. In einer groben Differenzierung lassen sich mit A. Buschmann seit 1945 zwei grundsätzliche Positionen ausmachen, die zugleich mehr oder weniger chronologisch aufeinander folgten. Die ältere, insbesondere für die Forschung der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte charakteristische Position kann als vorwiegend rechtsgeschichtlich orientiert beschrieben werden. Die in diesem Zusammenhang richtungsweisende Arbeit stammt von J. Gernhuber. Dieser hatte in seiner 1952 erschienenen Habilitationsschrift Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer Reichslandfrieden von 1235 zum einen die letztlich wohl nicht hinreichend reflektierte These vom auf hoheitlicher Befehlsgewalt beruhenden Gesetzescharakter der Gottes- und Landfrieden verfochten, und zum anderen die innovativen Neuerungen betont, welche die Landfrieden im Bereich des Strafrechts und der Strafgerichtsbarkeit gebracht haben, vor allem im Hinblick auf die Entstehung und das breite Vordringen der peinlichen Strafe[11].
In Abkehr von dieser rechts geschichtlichen Betrachtungsweise entwickelte sich Mitte der 60er Jahre, ausgelöst von H. Angermeiers Werk mit dem Titel Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter, ein dezidiert verfassungs geschichtlich ausgerichteter interpretatorischer Zugang zur Landfriedensgesetzgebung. Angermeier forderte, man müsse sich intensiver der verfassungspolitischen Funktion der Landfrieden zuwenden, um ihre historische Relevanz voll erfassen zu können. In einem Aufsatz über die Landfriedenspolitik und Landfriedensgesetzgebung unter den Staufern hatte er dann 1974 eine stärkere Beachtung verfassungs- und gesellschaftspolitischer Aspekte auch für die Landfriedensgesetze vor 1250 gefordert. Nicht so sehr um Struktur und Inhalt der Landfrieden als solche, die für die juristische Praxis der Staufer keine nennenswerte Rolle gespielt hätten, ging es ihm vielmehr um die konkreten machtpolitischen Hintergründe ihrer Entstehung, sah er in ihnen vor allem einen Ausdruck herrschaftlicher Macht[12].
Gegen diese Position mit ihrer vorrangig politischen Gewichtung können Einwände erhoben werden. Mögen beim Zustandekommen von Landfriedensgesetzen immer auch machtpolitische Aspekte eine Rolle gespielt haben, so widerlegt dies jedoch keineswegs ihren intentionalen Anspruch, Gesetze zur Wahrung des öffentlichen Friedens zu sein. Überdies lässt sich gegen Angermeiers verengte Perspektive einwenden, dass ein politisch gestaltungsfähiges, starkes Königtum, wie es etwa Friedrich II. zur Zeit der Entstehung des Mainzer Reichsfriedens verkörpert hat, kein Selbstzweck war, sondern vielmehr eine wesentliche Voraussetzung für die Möglichkeit einer Umsetzung der in den Gesetzen festgelegten Bestimmungen darstellte.
Neuerdings hat in diesem Zusammenhang A. Buschmann wieder eine stärkere Berücksichtigung der rechtsgeschichtlichen Betrachtungsweise gefordert und daran erinnert,
„dass es sich bei den Landfrieden auch und nicht zuletzt um die schriftliche Fixierung von Recht, also um Rechtsquellen, handelt, die ungeachtet aller anderen möglichen Betrachtungsweisen jedenfalls zunächst eine spezifisch rechtliche, und, da es historische Rechtsquellen sind, eine spezifisch rechtsgeschichtliche Betrachtungsweise erfordern.“
Auf eine andere Art und Weise sei eine substanzielle Erfassung ihres Inhaltes und ihrer Bedeutung nicht möglich. „Landfrieden sind nun einmal“, so Buschmann, „ihrer ganzen Struktur nach Rechtszeugnisse, die zunächst als solche zu betrachten und zu analysieren sind“. Da Rechtsetzungen aber offensichtlich häufig politische Machtverhältnisse widerspiegeln müssen sie auch – allerdings erst „in zweiter Hinsicht“ – als „Manifestationen politischer Ambitionen“ angesehen werden[13].
3. Der Mainzer Reichsfriede von 1235
Friedrich II. hat den Mainzer Reichsfrieden in einer für ihn äußerst günstigen politischen Situation „auf Anraten und mit Zustimmung der geliebten geistlichen und weltlichen Fürsten“ erlassen[14]. Er ist im Gegensatz zu sämtlichen Reichsfrieden vor ihm mit unbefristeter Geltungsdauer verkündet worden[15]. Die vermutlich unter Mitwirkung gelehrter Juristen formulierten Bestimmungen[16] wurden Mitte August des Jahres 1235 „auf dem zu Mainz abgehaltenen, feierlichen Reichstag“[17] als erstes ,Reichsgesetz’ in deutscher Sprache abgefasst und verkündet, was wesentlich zur Anerkennung des Deutschen als Urkunden- und Kanzleisprache beigetragen hat[18]. Etwa um dieselbe Zeit dürfte auch die amtliche Ausfertigung in lateinischer Sprache entstanden sein. Keine der Fassungen ist im Original erhalten[19].
Vorausgegangen war seinem Zustandekommen eine Periode gravierender politischer Erschütterungen im Reich, in deren Mittelpunkt der Konflikt zwischen Kaiser Friedrich und seinem widerspenstigem Sohn Heinrich (VII.) stand[20]. Seinen Höhepunkt erreichte diese Auseinandersetzung in der Zeit nach der Verkündigung des Statutum in favorem principum (1231, vom Kaiser bestätigt im Mai des Jahres 1232), als bekannt wurde, dass König (seit 1228) Heinrich nicht nur eine Koalition mit oppositionellen Reichsstädten und einer Anzahl süddeutscher Fürsten eingegangen war, sondern sich sogar mit den Todfeinden des Vaters, dem lombardischen Städtebund, verbunden hatte. Zur Beseitigung des durch dieses Bekanntwerden verursachten Aufruhrs war der Kaiser von Sizilien nach Deutschland geeilt. Nachdem er zuvor in Worms über seinen Sohn Gericht gehalten und ihn als König abgesetzt hatte, berief er einen Reichstag nach Mainz ein mit der Absicht, die Folgen des Verfassungskonfliktes zwischen Kaiser und König zu beseitigen, die deutschen Verhältnisse neu zu ordnen und den Frieden im Reich wiederherzustellen. Auf dem Mainzer Reichstag erklärte nun Friedrich II., von den Fürsten unterstützt, den lombardischen Städten den ,Reichskrieg’. Um Deutschland aber in geordneten Verhältnissen zurückzulassen, erließ er vor seinem Aufbruch einen Reichsfrieden[21], der mit seinen 29 Artikeln (in der lateinischen Fassung) den umfangreichsten Friedenstext darstellt, den die mittelalterliche Landfriedensbewegung hervorgebracht hat und der nach Inhalt und Wirkung alle bis dahin erlassenen Landfrieden weit übertrifft[22].
Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, gilt dies sowohl im Hinblick auf seine unmittelbar die Fehde betreffenden Regelungen als auch hinsichtlich des Ausbaus der Reichsgerichtsbarkeit.
3.1 Verdrängung der Fehde in die Subsidiarität
Der in Bezug auf die rechtliche Einhegung der Selbsthilfe wesentliche Aspekt des Mainzer Reichsfriedens ist als Verdrängung der Fehde in die „Subsidiarität [...] gegenüber dem gerichtlichen Streitaustrag“ bezeichnet worden[23]. Durch die betreffenden, in den Paragrafen 5 und 6 dargelegten Regelungen ist „das gleichberechtigte Entweder-Oder zwischen Fehde und Staatsgewalt ersetzt [worden] durch ein Erstens und Zweitens“[24]. Allerdings begegnet die erste Bestimmung, die den Vorrang der gerichtlichen Verhandlung von Rechtsstreitigkeiten vor deren Austrag durch Fehde festschreibt, vergleichsweise früh und nicht erst – wie J. Gernhuber meint – in den Reichsfrieden von 1234[25] und 1235. Die erste Regelung, in der dies ausdrücklich festgelegt wird, findet sich bereits im sog. Ronkalischen Landfrieden Friedrichs I. Barbarossa von 1158. Dort wird im zweiten Kapitel unmissverständlich festgelegt:
„Wenn aber jemand glaubt, er habe in irgendeiner Sache oder Handlung ein Recht gegen jemanden, so soll er sich an die richterliche Gewalt wenden, und durch sie soll er das ihm zustehende Recht erlangen.“[26]
Der entsprechende Abschnitt des Mainzer Reichsfriedens ist dagegen zunächst irritierend. In der kurzen Arenga zu Kapitel 5 wird zunächst ein allgemeiner Grundsatz vorangestellt:
„Recht und Gericht sind geschaffen, damit niemand Rächer seines eigenen Unrechts werde; denn wo die Autorität des Rechtes fehlt, herrschen Willkür und Grausamkeit.“[27]
Die Selbsthilfe wird also, da sie zu „Willkür und Grausamkeit“ führe, in einen diametralen Gegensatz zur objektiv urteilenden Gerichtsbarkeit gesetzt. Der nun folgende Satz scheint diesem Prinzip jedoch in gewisser Weise zu widersprechen. Darin heißt es:
„Daher bestimmen wir, dass niemand, in welcher Streitsache auch immer ihm Schaden oder Unrecht zugefügt worden sein mag, sein Recht im Wege der Fehde durchsetzen soll, wenn er nicht zuvor Klage vor dem zuständigen Richter erhoben und sein Recht bis zu einem rechtskräftigem Urteil verfolgt hat, es sei denn, dass er gezwungen war, zum unmittelbaren Schutz von Leib und Gut Gewalt mit Gewalt abzuwehren, was gemeinhin als Notwehr bezeichnet wird“.[28]
Es wird also verfügt, dass in jedem Streitfall, der bisher legitimerweise eine Fehde nach sich ziehen konnte, nun zunächst der prozessuale Rechtsweg beschritten und ein richterliches Urteil abgewartet werden muss – außer in den Fällen unmittelbarer Notwehr.
Soll dies nun aber bedeuten, dass ein Kläger, der vor Gericht ein seinem individuellen Rechtsempfinden widersprechendes Urteil erhalten hat, dieses schlichtweg missachten darf, um sein vermeintliches Recht dann doch wieder auf dem Weg der Selbsthilfe zu suchen? Eine solche Interpretation, die die Rechtsverfolgung vor Gericht unterminieren und ihr letztlich jede Autorität nehmen würde, wäre sinnlos. Der in Kapitel 5 formulierte Klagezwang kann andererseits aber auch wohl kaum bedeuten, dass ein erfolgreicher Gerichtsprozess automatisch zur Eröffnung einer Fehde berechtigt. Für welche konkreten Fälle soll die Fehde als subsidiäres Rechtsmittel also noch legitim sein?
Sucht man in der dieser Arbeit zugrunde liegenden Literatur nach Interpretationen zu diesem Textabschnitt, so ist festzustellen, dass von kaum einem Autor detailliert – von den meisten überhaupt nicht – auf dieses Verständnisproblem eingegangen wird[29].
Abwegig erscheint der Interpretationsvorschlag H. Hattenhauers, der in dem „Vorhandensein einer richterlichen Genehmigung“ die entscheidende Bedingung für eine straffreie Ausübung der Fehde zu erkennen glaubt[30]. Für eine solche Auslegung, die eine explizite Erlaubnis zur eigenmächtigen Rechtsverfolgung wohl in dem rechtskräftigen Urteilsspruch (diffinitiva sentencia), wie es in Kapitel 5 heißt, vermutet, ergeben sich im Text jedoch keinerlei Anhaltspunkte.
Eine befriedigende Antwort auf die Frage, unter welchen Umständen der Mainzer Reichsfrieden die individuelle Rechtsdurchsetzung durch Fehde noch für zulässig erklärt, muss Kapitel 6 in die Deutung obiger Textstelle miteinbeziehen. Darin heißt es:
„Erhebt jemand wie vorgeschrieben vor dem zuständigen Richter Klage, wird ihm das Recht verweigert [si ius non fuerit consecutus] und muss er notgedrungen seinem Gegner den Frieden aufkündigen [diffidare inimicum suum] [...]“[31].
Die entscheidende Passage des lateinischen Textes – „si quis vero coram iudice sicut predictum est in causa processerit, si ius non fuerit consecutus“ – ist nicht eindeutig zu übersetzen, da „si ius non fuerit consecutus“ sich sowohl auf den Urteilsspruch als auch auf die Urteilvollstreckung beziehen kann[32].
A. Patschovsky gelangt in seiner Interpretation dieser Textstelle zu dem Urteil, dass die Ausübung einer Fehde nur bei „Rechtsverweigerung der zuständigen Instanzen – das heißt bei dadurch eintretendem Fortfall der Geschäftsgrundlage für ein generelles Fehdeverbot – zulässig sein sollte“. Unter Rechtsverweigerung versteht er konkret „amtliche Urteilsverweigerung oder Vollstreckungsunfähigkeit“, keineswegs jedoch die „Freiheit des Klägers oder potentiellen Fehdeansagers, ein rechtsgültig zu Stande gekommenes Urteil als unrecht, weil unbefriedigend, abzulehnen“[33]. Patschovsky will sich mithin auf keine der beiden genannten möglichen Lesarten festlegen. Er bezieht den Ausdruck „si ius non fuerit consecutus“ sowohl auf den Urteilsspruch (so dass Fehdeführung im Falle „amtlicher Urteilsverweigerung“ zulässig ist) als auch auf die Urteilvollstreckung (so dass „Vollstreckungsunfähigkeit“ die Bedingung für die Rechtmäßigkeit der Selbsthilfe ist).
Wenngleich von amtlicher Urteilsverweigerung in den Bestimmungen des Mainzer Reichsfriedens nirgends explizit die Rede ist – ganz im Gegenteil wurde doch in Kapitel 5 als Voraussetzung rechtmäßiger Fehde ein rechtskräftiges Urteil voraussetzt[34] – so wird es derartige Fälle in der Gerichtspraxis doch sicher gegeben haben. Die in den Landfrieden immer wieder zu findenden Ermahnungen an die Richter, ihr Amt korrekt zu führen – so auch gerade im Mainzer Reichsfrieden (Kap. 4)[35] – könnten diese Vermutung stützen.
[...]
[1] Übersetzung von Arno Buschmann, in: Buschmann 1994, S. 82-83.
[2] Nach Kaufmann 1978b, Sp. 1459 ist es „müßig zu streiten, welches das erste Landfriedensgesetz gewesen ist“. Ein tabellarischer Überblick über die einzelnen Landfriedensgesetze bis 1235 findet sich bei Gernhuber 1952, S. XII.
[3] Ebd., S. 103.
[4] Vgl. dazu Kaufmann 1978a.
[5] Patschovsky 1996, S. 146.
[6] Vgl. Wadle 2001a, S. 28; Wadle 2002, S. 81-82.
[7] Ebd., S. 82.
[8] Vgl. für die Bedeutung der Landfriedensbewegung im Hinblick auf die strafrechtsgeschichtliche Entwicklung Wadle 2001d. Zur diesbezüglichen Forschungsdiskussion vgl. Wadle 2001a, S. 37-38.
[9] Kaufmann 1978a, Sp. 1084.
[10] Die folgende Zusammenfassung einzelner Aspekte der Forschungsdiskussion nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgt im engen Anschluss an die Ausführungen bei Buschmann 2002, S. 95-99 und Wadle 2001a.
[11] Vgl. ebd., S. 14-15; Buschmann 2002, S. 96. Die zahlreiche zusätzliche Probleme aufwerfende Kontroverse in der Forschung, ob die Landfrieden ihren Geltungsgrund aus einer auf die Autorität des Königs gestützten Friedenshoheit (als ein quasigesetzliches ‚Rechtsgebot’ oder ‚Herrscherbefehl’) oder aus einer eidlichen Einung (als vertragliche ‚Satzung’ oder ‚Willkür’) ableiteten, ob dieser Eid konstitutiven oder nur deklaratorisch-bestärkenden Charakter gehabt hat, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Gernhubers These, die deutschen Landfrieden seien „in all ihren Erscheinungsformen Gesetze und niemals Verträge“ (Gernhuber 1952, S. 102), dürfte sich mittlerweile jedoch als unhaltbar erwiesen haben. Die frühen Landfrieden werden i.d.R. nicht auf dem Gebot eines Gesetzgebers, sondern auf einer eidlichen Selbstbindung aller, die zur Einhaltung des Friedensprogrammes verpflichtet sein sollen, beruht haben. „Die ,Grundform’ des Rechtsgebotes ist mit der Verfassung des deutschen regnum in der Zeit der frühen Land- und Reichsfrieden kaum zu vereinbaren“ (Wadle 2001b, S. 96). Und selbst dort, wo Formulierungen auftauchen, die sich wie ein „reiner Herrscherbefehl“ (Wolf 1996, S. 98) ausnehmen, ist der König auf die Mitwirkung und den Konsens der Fürsten angewiesen, um einem ,Friedensgesetz’ praktisch wirksame Rechtsgeltung zu verschaffen. Entgegen aller verallgemeinernden Überlegungen zum Geltungsgrund kann größtmögliche Sicherheit letztendlich nur die konkrete Betrachtung der einzelnen Texte bzw. ihrer Überlieferungen und der Umstände ihres Zustandekommens gewährleisten. Die Geltungskraft der einzelnen Landfrieden dürfte darüber hinaus auch wesentlich davon abhängen, wie sich die in ihnen niedergelegten Bestimmungen zum überkommenen Recht verhalten haben. Vgl. zu diesem Problemkomplex die ausführlichen Überlegungen bei Wadle 2001a, S. 32-37; Wadle 2001b; Holzhauer 1978, Sp. 1469-1472.
[12] Vgl. ebd., S. 97-99; Wadle 2001a, S. 21-22.
[13] Ebd., S. 98-99.
[14] „Mainzer Reichslandfrieden. 1235, August 15“, in: Weinrich 1977, S.465. Soweit nicht anders vermerkt, wird der Landfriedenstext im Folgenden nach dem entsprechenden Band der von Lorenz Weinrich herausgegebenen und übersetzten „Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters“ zitiert. Die eine völlig andere Anordnung aufweisende älteste deutsche Textüberlieferung – die über keine eigene Kapitelzählung verfügende Handschrift P (= Passau) – wird gemäß der bei Buschmann 1994, S.95-103 abgedruckten, mit den entsprechenden Kapiteln des lateinischen Textes versehenen und ergänzten Fassung zitiert. Bei Weinrich 1977 wird der Text der ältesten deutschen Handschrift nur in den Fußnoten mitgeteilt.
[15] Vgl. Buschmann 2002, S. 103, Anm. 21.
[16] Nach Coing 1964, S. 43-44 ist es wahrscheinlich, dass Friedrich II. von einigen seiner römisch-rechtlich gebildeten sizilischen Hofrichter auf den Reichstag in Mainz begleitet worden ist (weitere Literaturverweise ebd.). Grundsätzlich konnte die römische, genauer die justinianische Gesetzgebung jedoch nur bedingt ein unmittelbares Vorbild für die mittelalterliche Landfriedensgesetzgebung bieten, die vielmehr „in Problemstellung und -lösung [...] eine durchaus eigenständige mittelalterliche Entwicklung“ darstellt (Coing 1964, S. 41). Dies liegt in erster Linie darin begründet, dass die Auseinandersetzung mit ,innerstaatlichen’ lokalen Gewalten und die Tatsache der Fehde als ein Rechtsinstitut in den spätantiken staatlichen Verhältnissen, für die das Corpus iuris civilis geschaffen worden ist, keine Entsprechung finden. Im Römischen Recht „sind vielmehr das grundsätzliche Verbot der Selbsthilfe und eine wirksame staatliche Justiz als dessen Korrelat selbstverständlich vorausgesetzt“ (ebd.); kein Rechtsstreit durfte außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit entschieden werden. Römisch-rechtliche Einflüsse sind daher insbesondere dort relativ gering, wo die Landfriedensgesetze nur auf eine regulative Beschränkung, nicht auf ein vollständiges Verbot der Fehde hinauslaufen. Trotz dieser Einschränkungen lassen sich „im Stil und Aufbau der Gesetze, [...] in der Verwendung von Begriffen und Sätzen des römischen Straf- und Besitzrechtes“ sowie bei der „Festlegung der Sanktionen“ Einwirkungen des römischen Rechts erkennen (ebd., S. 42). Dies gilt auch für den Mainzer Reichsfrieden von 1235, der nicht nur „eine Reihe von römisch-rechtlichen Begriffen und Termini enthält“ (ebd., S. 43), sondern auch inhaltlich durch die justinianische Gesetzessammlung beeinflusst ist. Als Beispiele hierfür seien zunächst die sich an justinianischem Sprachgebrauch anlehnenden Rechtswörter und Formeln angeführt, mit denen die Person und die charakteristischen Eigenschaften des Kaisers im Prooemium bezeichnet werden (vgl. dazu Buschmann 1983, S. 376-378, der die justinianische Grundlage des Mainzer Reichsfriedens ebenfalls betont). Weitere Belege sind die Umschreibungen der kaiserlichen Herrschaftsauffassung und der Ziele seiner Gesetzgebung. Wichtigster Satz des Prooemiums ist der Grundsatz, dass Grundlage und Ziel kaiserlicher Herrschaft die Wahrung des Friedens und die Ausübung der Gerechtigkeit sowie eine von diesen Prinzipien bestimmte Ordnung des Reiches darstellt, von denen auch die nachfolgenden Gesetze veranlasst seien (Satz 2; vgl. oben ‚Einleitung’). Die ursprünglich auf Augustinus zurückgehende Paarformel „pax et iustitia“ findet sich im Prooemium gleich dreifach. Inhaltlich verweist Coing 1964, S, 44 auf den römisch-rechtlicher Auffassung entsprechenden Klagezwang und das damit einhergehende grundsätzliche Fehdeverbot (Kap. 5), wozu sich in der von Nikolaus Wurm (vor 1386) verfassten Glosse des Mainzer Reichsfriedens (er ist als einziger Friedenstext überhaupt glossiert worden – wenn auch in der späteren, ergänzten Fassung Albrechts I.; vgl. Buschmann 1994. S.18; Buschmann 1981, S. 450 m. Anm. 5) ein Hinweis auf eine Institutionen- und eine Konstitutionenstelle des Corpus iuris civilis findet. Kapitel 5 des Mainzer Reichsfriedens verfügt darüber hinaus entsprechend den Digesten den Verlust des Klagerechts bei eigenmächtigem Vorgehen des Gläubigers. Unter explizitem Verweis auf die „bürgerlichen Rechte“ (secundum iura civilia) werden in Kapitel 27 Hehler und Dieb einander gleichgestellt.
Diese Beispiele mögen hier als Hinweis auf die römisch-rechtliche Beeinflussung des Mainzer Reichsfriedens genügen.
[17] Weinrich 1977, S.465.
[18] Vgl. Buschmann 1981, S. 449.
[19] Das Verhältnis des lateinischen zum deutschen Text war lange heftig umstritten. Arno Buschmann gelangt in seinen diesbezüglichen Arbeiten zu dem Urteil, dass nur die lateinische Fassung als authentisch anzusehen ist; die deutsche Fassung „stellt lediglich einen protokollartigen Bericht über die Abfassung und Verkündung des Mainzer Reichlandfriedens auf dem Mainzer Reichstag dar“ (Buschmann 1981, S. 456). Daraus folgt, dass bei der „unzweifelhaft in deutscher Sprache“ (ebd.) erfolgten Verkündigung „ein uns nicht überlieferter Text Verwendung gefunden hat, der seiner ganzen Anordnung nach dem überlieferten lateinischen Text entsprach“ (Buschmann 1980, S. 44).
[20] Für den folgenden knappen Überblick über die Entstehungsgeschichte des Mainzer Reichsfriedens vgl. Mitteis 1942, S. 33-36; Klingelhöfer 1955, S. 97-99; Buschmann 1994. S.17-19; Buschmann 1980, S. 36-37;
[21] So argumentiert Klingelhöfer 1955, S. 98.
[22] Die Beantwortung der Frage nach der praktischen Bedeutung der Landfrieden, ob also – was implizit immer angenommen zu werden scheint – das Regelwerk der Friedenstexte als paragraphenmäßig gesetztes Recht in Einzelfällen tatsächlich umgesetzt worden ist, gestaltet sich aufgrund der häufig recht dürftigen Quellenlage für das Hochmittelalter schwierig (vgl. dazu Wadle 2002). Auch auf die Wirkungsgeschichte des Mainzer Reichsfriedens kann im Rahmen dieser Arbeit nicht gebührend eingegangen werden. Nach dem Urteil von H. Angermeier lässt sich „als einzige Maßnahme Friedrichs II. zur Durchführung des Reichslandfriedens 1235 [...] die Errichtung des Reichshofgerichtes und die Besetzung des Hofrichteramtes im September 1235 mit dem Edlen Albert v. Rosswach feststellen“. Nachdem dessen Tätigkeit schon 1236 geendet sei, habe man einen anderen Adligen, C. v. Wyler, zum Reichshofrichter ernannt. „Eine Tätigkeit beider Hofrichter zur Durchführung des Reichslandfriedens lässt sich aber nicht finden“ (Angermeier 1974, S. 172). Man müsse daher den „wesentlichen Unterschied zwischen dem Gesetz von 1235 und seinen späteren Erneuerungen“ herausstellen, um zu verstehen, dass es „aus der Perspektive des späteren Mittelalters [...] als Fixierung des Reichlandfriedensrechts schlechthin“ erscheine (ebd., S. 184). H. Koller weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man die Wirkung der Gesetze auch nicht zu einseitig in der Rechtspraxis suchen darf, da eine Verwirklichung der Gesetze und Verordnungen im modernen Sinn einen umfangreichen Beamten- und Verwaltungsapparat voraussetzt, der den staufischen Königen in Deutschland mit ihrem ständig umherziehenden Hof weitgehend fehlte. „So wirkten die Verordnungen indirekt und langsam auf dem Weg über die Rechtswissenschaft wohl sehr stark, nur für die Rechtspraxis des 13. Jahrhunderts gewannen sie keine größere Bedeutung“ (vgl. dazu Koller 1958, insbes. S. 46-48 (das hier verw. Zitat: S. 48). Nach dem sog. Interregnum (1250-1273) wurde der Mainzer Reichsfriede sowohl von Rudolf von Habsburg als auch von seinen Nachfolgern immer wieder erneuert. Darüber hinaus ist er vielfach als Vorbild für territorial begrenzte Landfriedensregelungen verwendet worden. Vgl. dazu Angermeier 1974, S. 184-185; Buschmann 1981, S. 450; Wolf 1996, S. 99.
[23] Wadle 1999, S. 85.
[24] Gernhuber 1952, S. 188.
[25] An der entsprechenden Stelle des Friedenstextes Heinrichs (VII.) von 1234 (§ 4) heißt es: „Wenn jemand einen anderen verletzt oder Fehde gegen ihn anfängt ohne vorausgehende Klage, so soll er, falls er ein Fürst ist, 100 Mark Gold an die königliche Kammer liefern; wenn er aber ein Graf oder ein Vornehmer oder sonst ein Herr ist, soll er 100 Mark Silber abliefern“; Weinrich 1977, S. 457.
[26] Weinrich 1977, S. 251. A. Buschmann will in Kapitel 2 des Rheinfränkischen Landfriedens Friedrichs I. Barbarossa von 1179 eine Präzisierung dieser Vorschrift sehen, so dass nunmehr „jedermann verpflichtet [sei], einen verfolgten und gefangenen Feind [...] unverzüglich dem Gericht zur Aburteilung zu übergeben“ (Buschmann 2002, S. 117). Die entsprechende Textstelle lautet jedoch: „Wenn jemand einen Feind hat, den er verfolgen will, mag er ihn verfolgen auf freiem Felde, ohne Schaden an dessen Hab und Gut, oder er mag ihn gefangen nehmen und dann sofort dem Richter vorführen“; Weinrich 1977, S. 293. Verboten wurde mithin die Fehdehandlung der Schädigung von Hab und Gut, darüber hinaus wurde auch das Recht, den Fehdegegner längere Zeit gefangen zu nehmen, untersagt. Die Verwundung und Tötung des Gegners „auf freiem Feld“ aber kommen m. E. 1179 sehr wohl noch als erlaubte Fehdehandlungen in Betracht. So auch Gernhuber 1952, S. 219-220. Völlig unverständlich und schlichtweg falsch erscheint mir die Behauptung Buschmanns, der Sächsische Landfriede von 1221 verfüge in Kapitel 10, „dass jeder, dem ein Schaden zugefügt wird, diesen beim zuständigen Richter einzuklagen und sich dessen Urteil zu unterwerfen hat“ (Buschmann 2002, S. 118 m. Anm. 80). Tatsächlich steht dort in der Übersetzung L. Weinrichs: „Jeder, der wegen der Untat, die man ,Schach’ [d.i. Raub] nennt, von einem belangt wird, soll sich selbst verteidigen oder den Spruch des Richters hinnehmen“; Weinrich 1977, S. 387.
[27] Buschmann 1994, S. 85.
[28] Ebd. Wer gegen diese Vorschrift verstößt, wird zum Schadenersatz in doppelter Höhe, d.h. zum Duplum, verpflichtet und soll außerdem das Recht auf Ersatz des möglicherweise selbst erlittenen Schadens verlieren.
[29] Überhaupt nicht erwähnt wird Kapitel 5 des Mainzer Reichsfriedens etwa bei Klingelhöfer 1955, auch Kaufmann 1978b und Boockmann 1989 nehmen darauf keinen Bezug. Ein weiterer, großer Teil der Literatur begnügt sich mit dem unkommentierten Verweis auf die Verdrängung der Fehde in die Subsidiarität. So etwa Brunner 1965, S. 49-50; Angermeier 1974, S. 184; Kaiser 1983, S. 69 oder Wadle 1999, S. 85-86. Unklar drückt sich auch Kaufmann 1978a, Sp. 1091 aus, wenn er als erlaubten Fehdegrund den „vergebliche[n] Versuch, auf dem Rechtswege zum Ziel zu kommen“, anführt.
[30] Hattenhauer 1958, S. 240-241.
[31] Zitiert nach Buschmann 1994, S. 86.
[32] Weinrich 1977, S. 469 übersetzt folgendermaßen: „Wenn aber jemand vor dem Richter (wie oben angegeben) in einer Streitsache Klage führt und wenn er dabei nicht Recht erhält [...]“. Er bezieht mithin das „si ius non fuerit consecutus“ auf den Urteilsspruch selbst.
[33] Patschovsky 1996, S. 165 m. Anm. 63.
[34] In diesem ‚Spannungsverhältnis’ zwischen dem 5. und 6. Kapitel kann man einen Widerspruch sehen, der sich letztlich wohl auch nicht aufheben lässt.
[35] Buschmann 1994, S. 85. Vgl. auch den Ronkalischen Landfrieden (Kapitel 5) von 1158 (Weinrich 1977, S. 251).
- Arbeit zitieren
- Oliver Laschet (Autor:in), 2005, Die Fehde. Von der regulativen Erfassung zum generellen Verbot in der Reichsfriedensgesetzgebung des Spätmittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61511
Kostenlos Autor werden



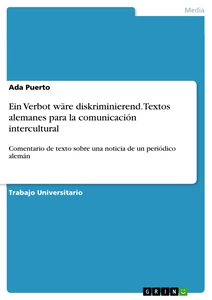


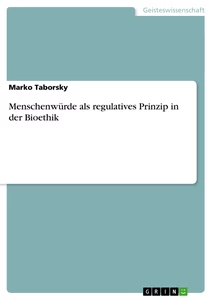
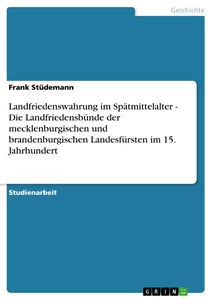












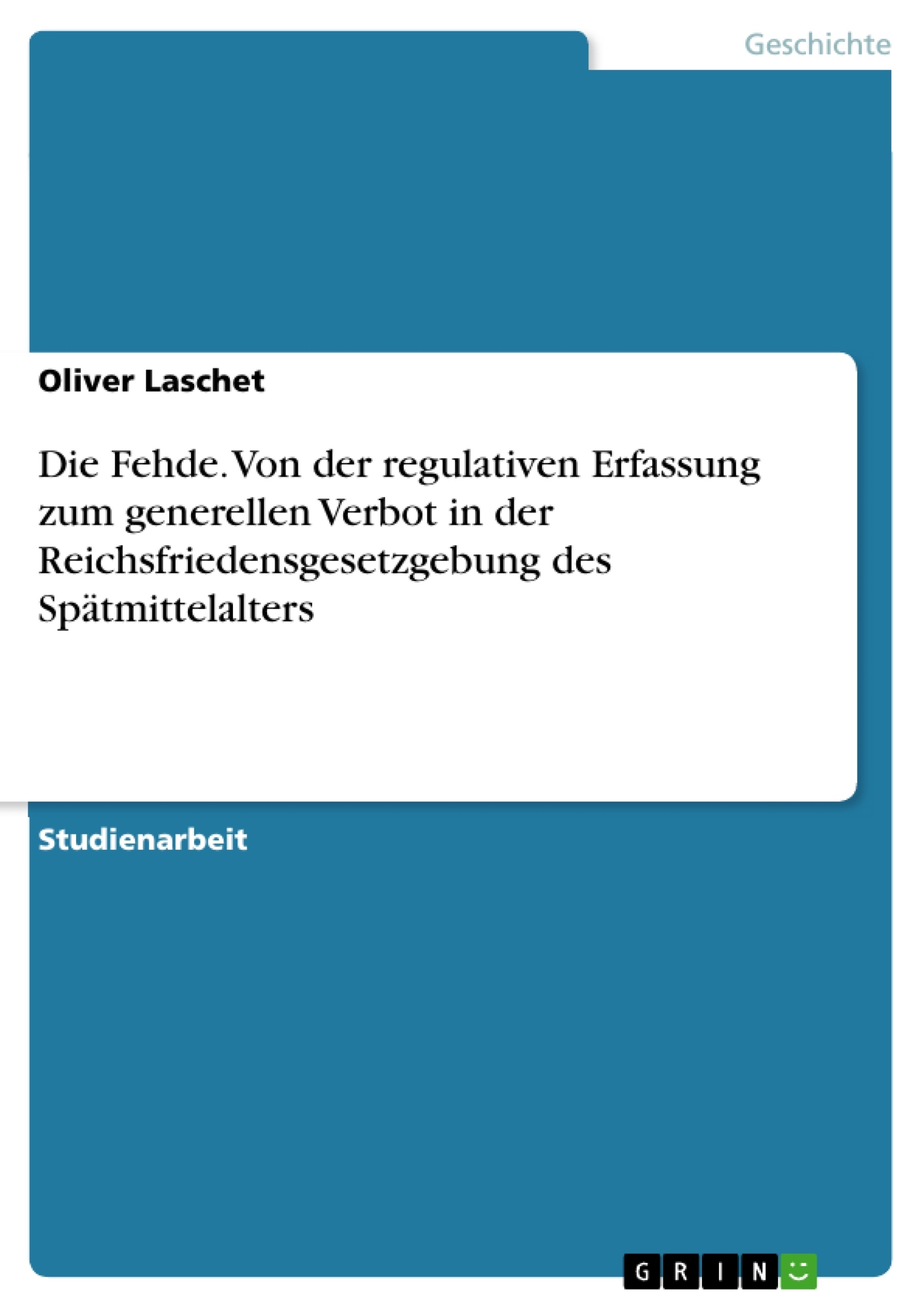

Kommentare