Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Prolog
2. Ausgangsproblem
2.1. Kognitionswissenschaft
2.2. Monismus-Dualismus-Debatte
3. Sinn – Bedeutung - Intentionalität
3.1. Zur Semantik von Sinn und Bedeutung
3.1.1. Zur Beziehung zwischen Sinn und Bedeutung
3.1.2. Zur Bedeutung von “Bedeutung”
3.2. Zur Semantik von Intentionalität
3.2.1. Praktische Intentionalitätsauffassung
3.2.2. Theoretische Intentionalitätsauffassung
3.2.3. Zeitgenössische Intentionalitätstheorien
3.2.4. Intentionalität und das Problem der Wahrnehmung
4. Wissenschaftsphilosophische "Wirklichkeits"- und Wissenskonzeptionen
4.1. Realismus-Konzeptionen
4.2. Entwicklung der Realismuskonzeptionen im Verhältnis von Ontologie und Epistemologie – Descartes bis Kant
4.3. Antirealismus-Konzeptionen
4.3.1. Anti-Realismus und Verifikationismus
4.3.2. Idealismus und Idealrealismus
4.3.3. Phänomenologie
4.3.4. Konstruktivismus
5. “Wirklichkeit” in den Kognitionswissenschaften
5.1. Psychologie zwischen Realismus und Konstruktivismus
5.2. Kognitive Referenz und Selbstreferenzialtiät des Gehirns
6. Sprache und "Wirklichkeit"
7. “Wirklichkeit” und “Wissen” in der Philosophie des Geistes
7.1. Zur Realität intentionaler Zustände
7.2. Epistemologischer Realismus und die Wirklichkeit des Wissens
7.2.1. “Intellectus effabilis”
7.2.2. Wissen als anthropologisches Datum
8. Epilog
9. Bibliographie
1. Prolog
In der vorliegenden Arbeit möchte ich den Versuch unternehmen der für alle Wissenschaften zentralen Referenzproblematik und den damit verbundenen pluralen (Anti-) Realismuskonzeptionen deskriptiv nachzugehen. Das grundlegende Problem besteht hierbei in der Beziehung oder Denotation zwischen einem singulären Terminus und dem damit verbundenen Gegenstand oder Referenzobjekt, auf welches es rekurriert. Allgemein kann Referenz verstanden werden als die Beziehung eines sprachlichen Ausdrucks (einer Prädikation) zu seiner Extension, was wiederum die Unterscheidung zu seiner Bedeutung (Intension) gewährleistet. Die Frage nach den sprachlichen Mechanismen, auf denen die Referenz von Ausdrücken basiert, sowie nach der Art der Beziehung zu den bezeichneten Gegen-ständen ist eines der zentralen Themen der sprachanalytischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, bei dem es letztendlich um den Zusammenhang zwischen Denken, Sprache und außersprachlicher Realität geht. Dieses Thema ist deswegen so zentral, da jeder Wissenschaft (und nicht nur der Sprachanalytik und Soziologie) implizit oder explizit Annahmen über die Beschaffenheit einer subjektunabhängigen Welt zugrunde liegen, über welche sie Aussagen zu formulieren versucht. Die Tragweite besteht nun darin, daß je nach Auffassung der möglichen Beschaffenheit der zu untersuchenden Welt ebenfalls die Aussagen über sie variieren und in gewissem Grade abhängig sind. Fundamental tangiert werden dadurch ebenfalls unsere Vorstellungen der Möglichkeit von Erkenntnis und dem daraus extrapolier-baren Wissen. Traditionell wird Erkenntnis oft als eine adäquate Repräsentation der Objektwelt im Subjekt verstanden, d.h. Erkennen ist auf Erkenntnisgegenstände ausgerichtet und hat somit intentionalen Charakter. Der Prozeß des Erkennens ist der eines Separierens und eines darauf folgenden Synthetisierens mit dem Ziel der Generierung einer “richtigen” Ordnung der vorhandenen Daten oder Informationen. Erkenntnistheoretisch problematisch wird dies alles durch Frage, wie nun eine dem Alltagsverständnis als selbstverständlich erscheinende Objektivität begründet ist. Hierbei geht es um das Verhältnis von Mensch (als erkennendem Subjekt) und Welt (als erkanntem Objekt), sowie die Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen von Erkenntnis. Es geht schlichtweg darum, plausibel zu machen, ob eine vom menschlichen Bewußtsein unabhängige Realität ontischer Entitäten existiert oder nicht. Ob unsere Wahrnehmung danach zu beurteilen sei, wie genau diese den objektiven Gegebenheiten entspricht, oder ob nicht sich die Gegebenheiten nach unserer Wahrnehmung richten.
Ich möchte aus interdisziplinärer Perspektive (v.a. der Philosophie, Psychologie, Linguistik und Neurobiologie) den folgenden Fragen nachgehen:
Was ist Wirklichkeit bzw. Realität? Repräsentiert Wissen Realität oder ist Wirklichkeit Konstruktion nach dem Maß menschlichen Geistes? Ist die Welt als unabhängig von einem erkennenden Subjekt vorzustellen oder erst in bezug auf die Denkleistungen eines Subjekts? Welche Realitäts- und Wissenskonzeptionen setzen Wissenschaftler – im Rahmen welcher wissenschaftlicher Weltbilder – voraus? Gibt es eine Realität, welche in ihrer Existenz wie Beschaffenheit unabhängig von menschlichen Erfahrungen, Denkformen und Annahmen besteht (Alltagsrealismus)? Existieren die Entitäten wissenschaftlichem Theorien, ob beobachtbar oder nicht, unabhängig von mentalen (phänomenalen, intentionalen) Zuständen (Wissenschaftsrealismus)? Sind die einzigen existierenden Entitäten physische und physikalisch beschreibbare und können physikalische Gesetze alles erklären, was erklärt werden kann (z.B. Denken)? Sind mentale Vorgänge auf neurophysiologische Vorgänge reduzierbar?
Aus heuristischen Gründen erscheint es mir, bei der von mir intendierten Form des Exposés, geboten etwas weiter auszuholen und im 2. Teil das u.a. für die Soziologie und Jurisprudenz äußerst relevante Ausgangsproblem (des Seminarthemas), im Anschluß an die KI-Forschung, angesichts der rasant fort-schreitenden technischen Entwicklung, zu formulieren, welches implizit mit der oben umrissenen Thematik in Verbindung steht. Hierbei geht es um die fundamentale und folgenreiche Frage, ob sich mentale menschliche Prozesse, wie z.B. Denken maschinell simulieren lassen. In diesem Teil werde ich mich mit einer knappen Einführung in die allgemeine Problematik bescheiden. In Teil 3 werde ich versuchen der Beziehung und semantischen Unterschiede zwischen Sinn, Bedeutung und Intentionalität nachzugehen. Wichtig und notwendig erscheint mir dies, da diesen Grundbegriffen eine außerordentliche Relevanz innerhalb der gesamten Diskussion inhärent ist. Im vierten Kapitel werde ich mich mit den wissenschaftsphilosophischen Wirklichkeits-/Realitäts- und Wissenskonzeptionen im Verhältnis von Ontologie und Epistemologie auseinandersetzen, und eine Typologie derselben vorschlagen. Im Anschluß an die vorgestellten (Anti-) Realismuskonzeptionen werde ich dann im 5. Teil auf kognitionswissenschaftliche Realitäts/-Wirklichkeitskonzeptionen übergehen und hierbei das Paradigma des radikalen Konstruktivismus, im Ausgang an systemtheoretische Überlegungen hinsichtlich der informationellen Geschlossenheit und Selbstreferentialität (Autopoiesis) des menschlichen Zentralen Nervensystems, (knapp) rekonstruieren. In Kapitel 6 werde ich aus linguistischer Perspektive der Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit nachgehen und hierbei zwei konkurrierende Auffassungen vorstellen (semantischer Realismus vs. semantischem Antirealismus). Im siebten Abschnitt werde ich dann Wirklichkeits-/Realitäts- und Wissens-konzeptionen in der Philosophie des Geistes darstellen und der Frage nachgehen, ob und wie es denkbar wäre, menschlicher “geistiger” Tätigkeit eine von neurophysiologischen Prozessen unter-schiedene Seinsform einzuräumen.
Ich werde mich bei all dem primär auf deskriptiver Ebene bewegen, da es mir aus didaktischer Sicht geboten (ergo sinnvoller) erschien, die gesamte Kontroverse mit ihren gegensätzlichen Auffassung und in ihren differenzierten Ausprägungen rekonstruierend darzustellen, um auf diesem Wege zum Verständnis des grundlegenden epistemologischen Problems beizutragen. (Daran anknüpfend ließen sich dann ihre weiteren Konsequenzen beispielsweise für die kognitionswissenschaftliche Debatte diskutieren, was den Rahmen allerdings sprengen würde). Ferner möchte ich mich schon vorab für den Umfang der vorliegenden Arbeit entschuldigen, aber aufgrund der Vielfalt und Fülle erschien es mir nur so angemessen dieser Thematik auch nur ansatzweise gerecht zu werden.
2. Ausgangsproblem
2.1. Kognitionswissenschaft
Die Kognitionswissenschaft ist eine interdisziplinär zwischen Philosophie, Informatik, Linguistik, Psychologie und Neurobiologie angelegte Wissenschaft, welche sich mit Erwerb, Verarbeitung, Vermittlung und Speicherung von Wissen beschäftigt. Dabei reicht das Spektrum der Wissens-bestimmung von “kausal erklärbarer, simulierbarer, elektronisch implementierbarer Repräsentation von Objektivität über eine wechselseitige Bedingtheit von Wahrnehmungsorganen und Wahr-genommenem bis zu autonom gesetzter, intentionaler Interpretation individueller und gesellschaftlicher Wahrnehmung”[1].
Den Kern der Kognitionswissenschaft bildet die um 1960 entstandene KI-Forschung der Computer - wissenschaften, welche in ihrem Bemühen um Sprachimplementierung und Algorithmisierung intelligenter Denkleistungen verstärkt auf linguistische Sprachforschung und denkpsychologische Theorien zurückgriff. Zur Aufnahme philosophischer, v.a. sprachanalytischer, erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Ansätze kam es, nachdem sich die situativ bedingte Selektivität von Wahrnehmung und die wertende Intentionalität von Wissensverarbeitung als zentrales Problem der Simulation menschlichen Denkens erwies. In der KI-Forschung wird die Auffassung vertreten, daß Denken auch außerhalb des menschlichen Körpers prinzipiell möglich sei, daß es mit wissen-schaftlichen Methoden formalisiert werden könne und digitale Rechner hierfür das beste Werkzeug darstellen . Künstliche Intelligenz wird hierbei in verschiedenartiger Weise definiert: a) als der Versuch, Computermodelle von kognitiven Prozessen zu entwickeln; b) als die Untersuchung von Ideen, die es Computern ermöglicht intelligent zu sein; c) als Zweig der Computerwissenschaften, welcher sich damit befaßt, Computer derart zu programmieren, daß sie in der Lage wären Aufgaben durchzuführen, die, wenn sie von einem Menschen vollbracht würden, Intelligenz erfordern bzw. voraussetzen; d) als ein Verfahren, das flexible, nichtnumerische Problemlösungen zur Verfügung stellt.
Letztendlich ist die KI versucht eine Technologie zu erzeugen, die es Computern ermöglicht, in komplexen Situationen, zumindest ansatzweise Phänomene der realen Welt zu verstehen. Generell kann die KI-Forschung angesehen werden, als der Versuch spezifisch menschliche Fähigkeiten, insbesondere dessen Intelligenz, maschinell nachzuahmen bzw. von einer “intelligenten” Maschine unter Umständen in “perfektionierterer” Form ausführen zu lassen. Dabei ist man versucht, nicht nur die rein rationalen Fähigkeiten des Menschen, sondern auch die mit ihm verbundenen leiblichen Funktionen des Wahrnehmens, Empfindens, Erkennens und Handelns mit Computerhilfe zu simulieren. Die KI hat es immer mit nicht numerischen Prozessen zu tun, die komplex, ungenau, mehrdeutig sind und für die es keine allgemein bekannten algorithmischen Lösungen gibt. Ihre Komplexität läßt sich anhand der Hauptgebiete der KI-Forschung verdeutlichen: 1. Natürlichsprachliche Systeme; 2. Expertensysteme; 3. Deduktionsysteme; 4. Robotersteuerung; 5. Bilderkennung /- verstehen; 6. Intelligente Recherche.
Das wichtigste Paradigma der Kognitionswissenschaft ist der konstruktivistische Ansatz der dialektischen Entwicklung von Denk-/Begriffs- und Weltstrukturen im Handeln unter Einbeziehung der psychologisch genetischen Epistemologie und der genuin biologisch evolutionären Erkenntnis-theorie. Spätestens mit der elektronischen Simulation neuronaler Netze, gewannen neurobiologische Theorien der Signalverarbeitung und der Selbstorganisation (Autopoiesis) und in Folge die philosophische Diskussion im die “Leib-Seele-Dualität” und Intentionalität große Bedeutung. Angesichts der fortschreitenden Gehirnforschung und den damit verbundenen Erklärungsversuchen hinsichtlich mentaler Fähigkeiten, wird sogar angenommen, daß die Neurobiologie in Zukunft die Führungsrolle innerhalb der Kognitionswissenschaften übernehmen wird, deren Grunddogma in der Reduktion geister Aktivitäten auf die Einheitssprache der Neuronen (Elektrizität) besteht.
2.2. Monismus-Dualismus-Debatte
Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung innerhalb der KI-Forschung und den Äußerungen führender Köpfe innerhalb dieser, daß es wünschenswert, ja erstrebenswert sei, daß Computer die nächste, den Menschen ablösende Evolutionsstufe darstellen, wird das Problem evident, ob und wie es möglich ist kognitive Kompetenz als geistiges Vermögen faßbar, erklärbar, denkbar zu machen und etwaige Differenzen hierbei zwischen Mensch und Maschine aufzuweisen. Es geht schlicht um die folgenreiche Frage, worin der Unterschied zwischen menschlichen Individuen und kybernetischen “Organismen” – hinsichtlich der je spezifischen Informationsverarbeitung und dem daraus resultierenden Verhalten – besteht, ergo wie die Einzigartigkeit des menschlichen Subjekts zu retten sei. In den Geisteswissenschaften (v.a. der Philosophie und Psychologie) wurden Kognitions-leistungen bisher schlicht am “Output”-Modell[2] gemessen, dem Kriterium, ob die Bedeutung von Information derart verstanden wurde, daß daraus eine sinnvolle Handlung folgen, und ob bzw. inwiefern dies einen Beitrag zu Vergesellschaftung leisten könnte (nach J. Habermas sind dies die drei wesentlichen Funktionen von Sprache). Abgesehen von der prinzipiellen Frage, ob Geist, Bewußtsein oder freier Wille überhaupt meßbar sind, wird hierbei deutlich, wie defizitär und ungenügend dieser Maßstab ist, da es technisch durchaus machbar ist (bzw. sein wird) Maschinen zu konstruieren, welche in der Lage sein werden auf sprachlich artikulierte Befehle angemessene Verhaltensprozesse in Gang zu setzen[3].
Während die KI Kognition als symbolische Repräsentation (analog Softwareprozeß) definiert, somit Denken auf die syntaktische Ebene beschränkt und als frei von Gesellschaft/Affekten ansieht, vernachlässigt sie dabei die semantische Ebene des Bedeutungsverhältnisses, die Dialektik von Verweis und Differenz. Die Repräsentation von Bedeutung kann nur ein hinreichende Bedingung für Kognition sein, während hierfür ein bestimmtes Vorverständnis (bei der Lösung mathematischer Gleichungen beispielsweise darüber was eine Zahl ist) als notwendige Bedingung angesehen werden muß. Zum bedeutungsvollen Verständnis von sprachlich artikulierten “Gesten” (Mead) bedarf es grundsätzlich der Kenntnis des allgemeinen Kontext und Zusammenhangs[4], welcher immer gesell-schaftlicher Art ist. Eine weitere elementare Bedingung für Kognition ist die Zeitlichkeit natürlich-sprachlicher Äußerungen[5], wie Perzeption i.A. auch immer temporär verzögert ist. Es gibt keine direkte und unvermittelte Wahrnehmungsleistung (intentio recta) bzw. zeitgleiche Abbildung, weder visuell, auditiv noch sensitiv-taktil, da beispielsweise Photonen eine bestimmte Zeit benötigen um vom ausgehenden Objekt, von dem sie reflektiert werden, auf die rezipierende Netzhaut zu treffen, wo die Information umcodiert wird, ehe sie in den entsprechenden Bereich des Cortex weitergeleitet wird, wo sie dann ihre weitere Verarbeitung widerfährt. Trotz der Analogie zu Computern, hinsichtlich der (binären) Codierung/ Transformation der Information in Elektronenimpulse (im Ggs. zum Ionenfluß der neuronalen Aktionspotentiale) in den Rezeptoren, ist nicht die Codierung von Informationen über Phänomene, sondern die Repräsentanz innerhalb des Systems selbst ausschlaggebend für die Bestimmung der Bedeutung des perzipierten Phänomens/Objekts. Kognitives Vermögen bemißt sich an der Fähigkeit der ideellen Rekonstruktion von Phänomenen, der Erfassung ihrer Bedeutung und impliziert eine Kompetenz zur Unterscheidung zwischen Innen- und Außenwelt seitens des Systems. Weiterhin muß die Repräsentation von Bedeutung (wie bereits erwähnt) immer unter den Modi von Vergangenheit (deren Aussagen entscheidbar sind aufgrund der Geschlossenheit), Gegenwart (deren Äußerungen nur zum Zeitpunkt der Äußerungen entscheidbar sind) und Zukunft (wahrheitstheoretisch nicht entscheidbar, aufgrund der Offenheit) organisiert sein. In diesem Kontext könnte die These formuliert werden, daß die Kompetenz Zeitlichkeit der objektiven Welt erfahren zu können, bereits Zeitlichkeit des erkennenden Systems voraussetzt, worin ein fundamentaler Unterschied zwischen Mensch und Maschine begründet liegt.
Bei der Analyse von Kognition lassen sich zwei grundlegende Positionen von einander unterscheiden: einerseits das monistische Erklärungsmodell[6], demzufolge Geist rein naturwissenschaftlich (bzw. vice versa auch rein geisteswissenschaftlich/philosophisch) erklärt werden kann, beispielsweise aus den physikalischen, neurobiologischen Vorgängen des zentralen Nervensystems. Ihm liegt ein monistisches, physikalistisches Weltbild zugrunde, demzufolge alles (inklusive Geist) auf physikalische Vorgänge zurückgeführt werden könne. Als ein Protagonist dieser reduktionistischen Auffassung kann G. M. Edelmann angesehen werden, der die Auffassung vertritt, daß Geist nur neurobiologisch erklärt werden kann, vulgo von der physiologischen Organisation des Gehirns abhängig ist[7].
Im Gegensatz dazu steht das dualistische Erklärungsmodell[8], dem zufolge die Naturwissenschaften allein unzureichend sind für die Beantwortung der Frage was Geist sei, vielmehr bedarf es zur weiteren Explikation dieses Problems notwendigerweise der Geistes- und Sozialwissenschaften. Geist/Bewußtseins kann nicht nur materialistisch erklärt werden bzw. ist mehr als nur neuronale Tätigkeit, besitzt einen independenten Status gegenüber physikalischen Prozessen. Ein Vertreter dieser holistischen, antiphysikalistischen und antireduktionistischen Position ist u.a. John Eccles. In seiner Theorie des dualistischen Interaktionismus werden Geist und Gehirn als getrennt voneinander existierende unabhängige Entitäten angesehen, welche miteinander in Interaktion stehen[9] [10].
3. Sinn – Bedeutung – Intentionalität
3.1. Zur Semantik von Sinn und Bedeutung
Etymologisch[11] wurzelt die Wortsippe von “Sinn” im ursprünglichen Bedeutungsbereich Absicht-Wille-Streben (Wunsch). Dem Substantiv “Sinn” lag einst die Bedeutung einer Ortsbewegung (“gehen, reisen”) zugrunde. Im Verb läßt sich als älteste Bedeutungskomponente die eines zielgerichteten Handelns finden. Diese Bedeutungsdimension verschob oder erweiterte sich in den Bereich Bewußtsein-Verstand-Denken, in das geistige Innere eines Menschen. Hierbei kommen die Komponenten Auffassungsvermögen-Sinnlichkeit mit ins Spiel, welche einerseits das Verständnis für irgend etwas, und andererseits die (organische Ausstattung der körperlichen) Wahrnehmung beschreibt. Andererseits kann Sinn auch für die Bedeutung, die ausgedrückte Meinung oder den geistigen Gehalt einer Aussage oder eines Werks stehen. Von hier aus ließen sich dann eine Menge Zusammenhänge zwischen den Substantiven Sinn und Meinung und Verbindungen zu den Ausdrücken “Geist, Gemüt und Verständnis” konstruieren. “Bedeutung” als Wortsippe hingegen gruppiert sich semantisch um einen Bereich der Zeichengebung und – auslegung und dient der Verständlichmachung. Deutung rekurriert hierbei auf den Sinn, Grund oder Zweck einer Sache. Bedeutung beschreibt desweiteren die Tätigkeit der Gewichtung (Beurteilung) von Ereignissen und Personen.
3.1.1. Zur Beziehung zwischen Sinn und Bedeutung
Eine “echte” Synonymität zwischen “Sinn” und “Bedeutung” muß verneint werden, da bestimmte Ableitungen, wie z.B. “sinnlos” und “bedeutungslos” nicht synonym sind[12]. Der Ausdruck Sinn kann insofern von Bedeutung unterschieden werden, als der Erstgenannte mehr den Zweck einer Sache oder eines Handelns (in einem bestimmten Zusammenhang) zum Ausdruck bringt. Dieser Zweck einer Sache ist im semantischen Bereich der Wortsippe Bedeutung hingegen nicht enthalten. Bedeutung könnte definiert werden als Inhalt , welcher angibt, wie etwas aufzufassen oder zu beurteilen sei. >>“Sinn” hat, insofern dieser Ausdruck mit “Bedeutung” gleichgesetzt werden kann, den Gehalt von “Geist”. Der Sinn eines Satzes beispielsweise ist der Geist, der sich in diesem Satz ausdrückt. “Bedeutung” wiederum meint das, worauf ein Zeichen deutet, oder was seine korrekte Deutung ergibt. Die in der deutschen Sprache vorhandene Synonymität von “Sinn” und “Bedeutung” schafft somit eine Verbindung zwischen dem Geist und seinem Ausdruck, der Sprache, wobei der Ausdruck als Zeichen auftritt<<[13]. Diese Unterscheidung kann auf Gottlob Frege[14] zurückgeführt werden, welcher von einer Betrachtung des Erkenntniswertes von Identitätsaussagen ausging und bei der Konstruktion einer formalen Semantik, in Gestalt einer mathematischen Funktion, neben dem Zeichen und dem was es bezeichnet eine dritte Größe einführte: das Zeichen als Argument, der Sinn als Funktion und das Bezeichnete als Funktionswert. Um diese Dreiteilung vornehmen zu können, mußte er die Ausdrücke “Sein” und “Bedeutung” semantisch voneinander abheben. Er unterschied zwischen “Sinn” und “Referenzgegenstand” bzw. “Bezugsgegenstand”, wobei er zwischen “Bedeutung” und “Referenz ” nicht differenzierte. “Meaning ” rekurriert auf “Sinn”, da “meaning” etymologisch mit “mind” (Geist) verwandt ist. Reduziert man die logische Form der Bilder hinter “meaning” und “Bedeutung” auf eine zweistellige Relation (Subjekt-Objekt[15] ), läßt sich erkennen, daß die Verbformen “deuten” bzw. “mean” dieselbe Relation implizieren, während sich jedoch die Substantivierung “Bedeutung” auf die Objektseite und “meaning”, über die äußerliche (phonetische) Verquickung mit “mind”, stark auf die Subjektseite bezieht. Zum Verständnis von “Bedeutung” im Sinne von “Referenz” ist jeweils der spezifische Kontext der Zeichengebung relevant.
“Sinn ”, als die “Art des Gegebenseins” des Bezeichneten, meint den Weg, die Richtung der Erkenntnis einer Sache. Die gängige sprachphilosophische Auffassung, daß der Sinn eines Ausdrucks darin besteht seine Bedeutung zu bestimmen, ist nichts anderes als eine semantische Reformulierung der ursprünglichen erkenntnistheoretischen Gedankens, daß der Weg das Ziel, nämlich den Gegenstand der Erkenntnis erkennen läßt[16]. Als Bedeutung eines Satzes hat Frege dessen Wahrheitswert [17] bestimmt, was zu einer Kritik der Inadäquanz seiner Theorie, in Anwendung auf Sätze, und dem Vorwurf der logischen Fehlerhaftigkeit hinsichtlich der Äquivokation von Bedeutung mit “Wichtigkeit” führte.
3.1.2. Zur Bedeutung von “Bedeutung”
H. Putnam synthetisierte einen theorieunabhängigen Referenz- und Wahrheitsbegriff durch die Erkenntnis, daß sowohl natürliche als auch die soziale Umgebung zur Referenzbestimmung von Wörtern beiträgt und sich in sprachlicher Arbeitsteilung manifestiert[18]. Methodologisch ebenso wie bei seiner Relativierung analytischer Wahrheiten verfährt er mit Wahrheiten a priori. Seine These von der relativen epistemischen Notwendigkeit mangels Alternativen, in Anlehnung an Kripkes sogenannte kausale Theorie der Referenz, besagt, daß Apriozität immer relativ zu dem jeweiligen Erkenntnis-gegenstand und somit niemals absolut sein kann. In Bezug auf die Philosophie des Geistes wendet Putnam sich gegen die Dualismus-Materialismus-Kontroverse und seiner vermeintlichen Lösung durch den logischen Behaviorismus. Sowohl dualistische als auch behavioristische Positionen erweisen sich seiner Meinung nach als mangelhaft, solange sie nur Referenz- und keine Bedeutungs-behauptungen über psychische Ausdrücke aufstellen. Da die zu einem psychischen Ausdruck gehörige Gleichheitsrelation auf funktionale und nicht materielle Strukturgleichheit abzielt, verwirft Putnam ebenso die materialistische Position. Ihm zufolge läßt sich von funktionalen Zuständen nicht auf materielle schließen, aber auch der umgekehrte Schluß ist logisch nicht durchführbar, er muß immer von empirischen Gesetzen und Zusatzannahmen ausgehen. Putnams Kritik richtet sich gegen die Annahmen der traditionellen (Sprach-) Philosophie und resultiert aus der Überzeugung, daß im Gegensatz zur syntaktischen Tiefenstruktur sprachlicher Formen die semantische Sprachdimension nur unzureichend analysiert und elaboriert wurde. Besonders der Wortbedeutung – im Gegensatz zur Satzbedeutung – wurde dabei nur geringfügige Relevanz beigemessen.
In der klassischen Bedeutungstheorie wird differenziert zwischen der Extension eines Ausdrucks (der “Idee” oder platonischen Entität eines Begriffs), welche mit einer Annahme operiert, der zufolge es eine Menge von Dingen gibt, die unter einen bestimmten Ausdruck subsumiert werden können, und andererseits hinsichtlich der Intension eines Begriffs, seiner Bedeutung[19]. Die Bedeutung eines Ausdrucks ist (im Sinne der Intension) der Begriff, woraus sich folgern ließe, daß aus Intensions-gleichheit die Extensionsgleichheit folge. Darüber, ob diese Bedeutungen nun geistige oder abstrakte Entitäten seien, ließe sich weiter streiten, unstrittig sei jedoch, daß das Erfassen dieser Entitäten ein individueller psychischer Vorgang ist. Er setzt einen bestimmten “psychischen Zustand” (im engen Sinne) voraus, in welchem Gedächtniszustände und psychische Dispositionen psychische Zustände darstellen. Hieraus könnte die Annahme eines “methodologischen Solipsismus” konstruiert werden, die davon ausgeht, daß kein psychischer Zustand im eigentlichen Sinne die Existenz irgendeines Individuums voraussetzt, außer dem Subjekt, dem der Zustand zugeschrieben wird. Nicht einmal die Existenz des Körpers des Subjekts dürfte vorausgesetzt werden, da es logisch denkbar bleibe, daß sich ein körperloser Geist in ihm befindet.
Im Anschluß an die Kritik dieser herrschenden Auffassungen, formuliert Putnam die These, daß die Extension nicht vom psychischen Zustand determiniert wird: es sei möglich, daß sich mehrere Sprecher in exakt demselben psychischen Zustand befinden können, während sich die Extension im jeweiligen Idiolekt unterscheidet. Extension wird erst durch den soziolinguistischen Zustand des Sprachkollektivs, der Gesellschaft und der natürlichen Welt, festgelegt. Die Indexikalität natürlicher Prädikate (wie z.B. “Wasser”) bedeutet, daß ein Extensionsunterschied ispo facto einen Bedeutungs-unterschied ausmacht. Damit kann die Vorstellung aufgegeben werden, daß Bedeutungen Begriffe oder irgendwie geartete geistige Entitäten seien. Zur sinnvollen Kommunikation ist die Aneignung sprachlicher Konventionen nötig, wobei das erforderliche Mindestmaß dieser Kompetenz kultur-spezifisch und vom jeweiligen Gegenstand abhängig ist. Diese Rolle füllt das “Stereotyp” aus, welches Merkmale impliziert, denen allerdings nicht der Status analytischer Wahrheiten inhärent ist. Sie berufen sich nicht auf normale oder repräsentative Elemente einer natürlichen Art, vielmehr fangen Stereotype Eigenschaften paradigmatischer Elemente der jeweiligen Klasse ein[20]. Kategorial-indikatoren hoher Zentralität sind hierbei “semantische Marker”, während im Distinktor die übrigen Merkmale zusammengefaßt werden. Beide sind geeignet ein System zur Repräsentation von Stereotypen aufzubauen, wobei sie weder notwendige noch hinreichende Bedingungen darstellen oder gar mit Analytizität zu tun haben.
Putnams Definition von “Bedeutung” besteht in dem Versuch eine “Normalform” für die Beschreibung einer Bedeutung (d.h. vielmehr einen Normalform typ) anzugeben, und nicht ein Objekt zu klassifizieren und mit Bedeutung gleichzusetzen. Diese Normalformbeschreibung der Bedeutung eines Wortes (z.B. “Wasser”) soll folgende Komponenten beinhalten: 1. syntaktische Marker (wie z.B. Kontinuativum, konkret); 2. semantische Marker, die dieses Wort beschreiben (z.B. natürlicher Art, Flüssigkeit); 3. eine Beschreibung der weiteren Merkmale des zugehörigen Stereotyps (z.B. farblos, transparent, geschmacklos, durstlöschend...etc.); 4. eine Beschreibung der Extension (H2O). Alle Vektorkomponenten, abgesehen von der für die Extension zuständigen, beinhalten eine Hypothese über die individuelle Kompetenz des Sprechers. “Nennen wir zwei Normalform-Beschreibungen äquivalent, wenn sie die gleich Extension enthalten und bis auf die Beschreibung der Extension sogar identisch sind. Wenn dann die in den beiden Beschreibungen unterschiedlich beschriebene Menge tatsächlich die Extension des betroffen Wortes ist und wenn außerdem die anderen, identischen Komponenten der Beschreibung korrekte Charakterisierungen der verschiedenen Aspekte der zu repräsentierenden Kompetenz sind, so sind beide Beschreibungen korrekt. Zwei äquivalente Beschreibungen sind entweder beide korrekt oder beide nicht korrekt. Dies soll lediglich ausdrücken, daß wir zwar eine Beschreibung der Extension verwenden müssen, um die Extension anzugeben, und daß aber nichtsdestotrotz die fragliche Komponente unserer Intention nach aus der Extension selbst (aus der Menge) und nicht aus der Beschreibung der Extension bestehen soll” (Putnam; a.a.O.; S.95). Wir können somit behaupten, daß Bedeutung die Extension – per constructionem – bestimmt und nicht der psychische Zustand eines Sprechers die Bedeutung.
3.2. Zur Semantik von Intentionalität
Der Begriff der Intentionalität zeichnet sich durch eine Doppelsemantik aus: einerseits verweist er auf Absichtlichkeit des Sprachgebrauchs alltäglicher Kommunikation im Kontext von Handlungs-absichten. Demgegenüber rekurriert die Bedeutung des scholastischen “intentio”, als “Bedeutung, Idee, Begriff ” auf ein außerpraktisches intentionalitätstheoretisches Konzept und somit allein auf die Bewußtseinsebene. Husserl zufolge sind phänomenologisch relevante Intentionen psychische Akte im Sinne von passiven “intentionalen Erlebnissen”.
3.2.1. Praktische Intentionalitätsauffassung
Dem handlungstheoretischen Konzept liegt die Annahme zugrunde, daß unter dem Tätigkeitsbezug des Beabsichtigens ein Handlungsbezug zu verstehen sei. Absichtsbekundungen können generell als Handlungsvoraussagen verstanden werden: Handlungen sind somit absichtliche Handlungen. Die Bedingung für das sinnvolle Zuschreiben von Leistungen bzw. dem Mißerfolg ihres Nicht-Erbringens (Gelingen/Nicht-Gelingen), ist das “Ergehen” einer entsprechenden Absicht[21] durch den Akteur. J. Düffel[22] zufolge ist die Handlungstheorie nicht über die Identifizierung und Formalisierung von Zweck-Mittel-Kalkülen hinausgegangen, statt dessen habe sie versäumt das philosophische Problem des Handelns, die dynamische Natur absichtlichen Handelns denkend zu begreifen. Allerdings könne die erfolgsterminologische Spezifikation, im Sinne leistungsorientierter Absichtlichkeit, des Intentionalitätsbegriffes diese transzendieren, und somit fruchtbar gemacht werden für die Anwendung auf die Ebene der Bewußtseinstheorie.
3.2.2. Theoretische Intentionalitätsauffassung
F. Brentano unternahm den Versuch der (Wieder-) Einführung eines rein bewußtseinstheoretisch orientierten Intentionalitätsbegriffes. Er definierte psychische Phänomene als immanent gegen-ständlich: die intentionale Inexistenz eines Gegenstandes rekurriert auf die Beziehung auf einen Inhalt, die Gerichtetheit auf ein Objekt. Brentanos Konzept von Richtung oder Beziehung setzt eine diametrale Relation voraus, nämlich Beziehung oder Richtung von etwas auf etwas (von Psychischem auf bewußtseinstranszendente Objektivität). Solange jedoch die Eigentümlichkeit dieser Relata nicht angegeben werden kann, insbesondere der Status der Gegenstände (als zweite Form), bleibt diese Konzeption mangelhaft. Die Charakterisierung von Objekten als bewußtseinsimmanent ist zirkulär, auch sind die als bewußtseinstranszendent beschriebenen nicht immer gegeben[23].
Auch die Husserl sche Trichotomisierung der Subjekt-Objekt-Relation in Noesis, Noema[24] (als vermittelndes Glied) und bewußtseinstranszendentem Objekt, innerhalb welcher das Noema in Generalisierung von “Sinn” und “Bedeutung” entwickelt wurde, verlagert lediglich die problematische Relation von Psyche und zweitem Glied auf jene zwischen Noema und bewußtseinstranszendierendem Objekt. Das Noema ist keine unabhängig von ihren Relaten bestehende relative Struktur[25].
3.2.3. Zeitgenössische Intentionalitätstheorien
Aus der psychologischen Perspektive der “inneren” Erfahrung und Erlebnisbeschreibung ist ein intentionaler Zustand gekennzeichnet durch einen bestimmten propositionalen Gehalt und einen bestimmten Modus, innerhalb dessen er auftritt. Der Modus ist die Art und Weise, in der die Proposition psychisch gegeben ist (z.B. Wissen, Wahrnehmen, Vorstellen, Erinnern, Wünschen, Wollen, Beabsichtigen, Befürchten, Bezweifeln, Glauben...), man könnte es auch als die psychische “Einstellung” zu der betreffenden Proposition bezeichnen. In der phänomenologischen Denktradition bezeichnet man einen psychischen Zustand, der Intentionalität besitzt, als einen psychischen Akt. Der analytischen Philosophie zufolge bezeichnet der Begriff propositionale Einstellung psychische Zustände, die auf einen Gegenstand oder Sachverhalt gerichtet sind. Der propositionale Inhalt repräsentiert seinen Gegenstand. Aus der “erlebnispsychologischen” Sicht hängt Intentionalität mit Intention (Absicht) zusammen, beide sind aber nicht identisch. Eine Absicht stellt vielmehr einen Spezialfall von Intentionalität dar, explizit, einen intentionalen Zustand mit einem bestimmten Modus. Der propositionale Gehalt wäre im Falle einer Absicht die Zielvorstellung, sie richtet sich intentional auf denjenigen Sachverhalt, den man herbeiführen möchte. Da bei der Vorstellung eines bestimmten Sachverhaltes immer nur bestimmte Aspekte (ein verhältnismäßig kleiner Ausschnitt der Eigen-schaften) dieses repräsentiert werden, transzendiert der propositionale Gehalt diese Wahrnehmung, welche insofern nur als eine Hypothese betrachtet werden kann (das gleiche gilt selbstverständlich für Sinneseindrücke). Die Perspektive oder der Standpunkt dieser Wahrnehmung ist immer dort, wo wir uns unseren Leib vorstellen. “Der Leib ist das Sturmzentrum, der Ursprung der Koordinaten, der beständige Platz in der Spannung im Ganzen der Erlebniskette. Das Wort ‚ich‘ ist also primär ein Positionalnomen, genau wie ‚dieses‘ und ‚hier‘”[26]. Mit den Wort “ich” beziehen wir uns auf dieses Zentrum. Die psychischen Akte richten sich auf Gegenstände. Der jeweilige Gegenstand ist der eine Pol der intentionalen Beziehung, der andere ist das Ich, das im intentionalen Zustand ist bzw. den psychischen Akt vollzieht. Weiterhin läßt sich sagen, daß Intentionalität und Bewußtsein nicht immer gleichzeitig vorliegen müssen. Beispielsweise sind Zustände wie Erregung, Schmerz, Verwirrung oder Ratlosigkeit nicht unbedingt auf etwas bezogen/gerichtet sein, d.h. etwas repräsentieren. Intentionalität ist mitunter auch ohne Bewußtsein gegeben, da das Wissen um einen bestimmten Sachverhalt auch unbewußt vorliegen kann. “Die Menge der intentionalen Zustände, bei denen Intentionalität als eine Eigenschaft des Bewußtseins verstanden wird, ist nicht deckungsgleich mit der Menge der psychischen Zustände, die durch Sätze der Form ‚P..., daß ‘ beschrieben werden”[27].
J. Searles Entwurf ist analog Husserls dreigliedrig angelegt: Modus-Darstellung-Objekt. Für die Charakterisierung sowohl der semantischen Relation in seiner Theorie der Sprechakte als auch für die Bestimmung der intentionalen Beziehung macht er von dem Konzept der Darstellung (Repräsentation ) Gebrauch: intentionale Beziehungen sind darstellende Beziehungen. Das Verhältnis von Sprechakten und “intentionalen Zuständen” (Searles Bezeichnung für das gerichtete Psychische) zeichnen sich dadurch aus, daß sich der Sache nach Sprache von Intentionalität herleitet und nicht umgekehrt. Die Gerichtetheit intentionaler Zustände besteht nicht eigentlich in der Darstellung an und für sich, sondern in der Beziehung der Repräsentation auf Reales. Wird der Begriff auf Sprache angewandt, “können wir mit ihm mehr abdecken als bloß sprachlichen Bezug: auch Prädikation, Wahrheitsbedingungen und Erfüllungsbedingungen schlechthin. (...) Intentionale Zustände mit einem propositionalem Gehalt und einer Ausrichtung repräsentieren ihre verschiedenen Erfüllungs-bedingungen in demselben Sinn, in dem Sprechakte mit einem propositionalem Gehalt und einer Ausrichtung ihre Erfüllungsbedingungen repräsentieren. (...) Der Sinn von >repräsentieren<, in dem eine Überzeugung ihre Erfüllungsbedingung repräsentiert, ist der selbe Sinn, in dem eine Feststellung ihre Erfüllungsbedingung repräsentiert. Eine Überzeugung ist eine Repräsentation – d.h. heißt: sie hat einen propositionalen Gehalt und einen psychischen Modus, ihr propositionaler Gehalt legt eine Menge von Erfüllungsbedingungen (unter gewissen Aspekten) fest, ihr psychischer Modus legt eine Ausrichtung ihres propositionalen Gehaltes fest, und all dies geschieht so, wie es sich aus der Erläuterung dieser Begriffe – propositionalem Gehalt, Ausrichtung usw. – in der Sprechakt-Theorie ergibt”[28]. Intentionalität, als intrinsische Form der Repräsentation von Sachverhalten, kann somit verstanden werden als die Gerichtetheit geistiger Zustände oder Ereignisse - jedoch nicht geistiger Akte - (z.B. Überzeugungen, Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen, usf.), wobei Beabsichtigen/ Absicht (Intendieren/Intension) Formen der Intentionalität darstellen. Intentionale Zustände sind nicht notwendig oder wesentlich etwas Sprachliches, obwohl die sprechakt-theoretische Unterscheidung zwischen propositionalem Gehalt und illokutionärer Rolle auf intentionale Zustände (Repräsentationsgehalt & psychischer Modus) übertragbar ist.
Düffel zufolge wird auch bei Searle in dem Begriff der Darstellung wiederum eine Verdinglichung der Subjektivität selbst, als verdinglichender Instanz, evident. “Demnach handelt es sich bei den Entwürfen der außerpraktischen Intentionalitätstheorien keineswegs um zirkuläre Explikations-versuche eines intuitiv verständigen Konzepts, sondern um die Zirkularität in der Konstruktion eines solchen Konzepts selbst” (Düffel.; S. 42). Intentionale Zustände können lediglich im Rahmen eines grundsätzlich dynamischen Konzepts leistungsorientierter Absichtlichkeit, der Kontingenz des erfolgreichen Ergehens, einsichtig gemacht werden. “Erst in dieser Begründung als Absichtlichkeit kann von einem Intentionalitätsbegriff gesprochen werden, der freilich kein außerpraktischer mehr ist, sondern der sich in seiner Dynamik vielmehr für ein Gesamtverständnis sowohl erkennender als auch handelnder Subjektivität bietet” (ebd; S. 43). Dadurch könnte die Disjunktion verschiedener Arten von Intentionalität überwunden werden und in seiner Konsequenz fruchtbar gemacht werden für ein gänzlich anderes Bewußtseinsverständnis.
3.2.4. Intentionalität und das Problem der Wahrnehmung
Düffel untersucht das Wahrnehmungsproblem im Rahmen des Konzepts leistungsorientierter Absichtlichkeit, also dem konzeptualen Zusammenhang von Bestrebung und Leistung. Die Klassifizierung der Wahrnehmungsausdrücke als Leistungswörter erlaubt es, das Problem der Wahrnehmung als Frage zu formulieren, auf welche eigentümliche Weise die Bestrebung ergeht, jene bekannte Leistung einer Wahrnehmung von etwas zu erbringen, wobei der prinzipiellen Möglichkeit Rechnung zu tragen ist, daß diese Bestrebung auch ohne Erfolg ausgehen kann und somit nicht Wahrnehmung sondern Wahrnehmungsirrtum vorliegt (Kontingenz erfolgsterminologischer Qualifizierbarkeit). Es liegt ein dialektisches Verhältnis von Wahrnehmung und Wahrnehmungsirrtum vor: Wahrnehmung kann nur dann sinnvoll als eine Leistung bezeichnet werden, wenn die prinzipielle Möglichkeit des Nicht-Ergebnisses einer solchen Leistung gegeben ist. Von diesem Standpunkt aus muß die Rezeptivitätsauffassung des Empirismus, die Unterscheidung zwischen Seins- und Sinngebilden, abgelehnt werden, da das zugrunde liegende Rezipieren nicht erfolgsterminologisch qualifizierbar ist. Dies ist nur in Bezug auf Subjektivität, d.h. auf leistungsbezogene Absichtlichkeit bzw. die qualifizierbare Unterscheidung von Wahrnehmung von etwas oder als Wahrnehmungsirrtum (und d.h. mit oder ohne Erfolg) möglich. Kant erkannte, daß allein durch Reflexion auf den subjektiven Ursprung des Erkennens überhaupt auch nur die Aussicht auf eine philosophische Grundverständigung über Fakten von Wahrnehmung wie auch von Wahrnehmungsirrtum gegeben sei. Seine, philosophiegeschichtlich die “Kopernikanische Wende” einleitende, Annahme war, daß nicht die Erkenntnis[29] sich nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände nach der Erkenntnis richten. Dies impliziert sowohl methodologisch die Umkehr der Reflexionsrichtung als auch inhaltlich die Einsicht in die erkenntnistheoretische Leistung von Subjektivität. Sein Anliegen war es die Bedingungen von wahrer oder falscher Erkenntnis und somit der Gegenstände wahrer Erkenntnis in ihrer Kontingenz im Subjekt auszumachen. Ebenso wie wahre Erkenntnis nur eine kontingente Art von Erkenntnis überhaupt repräsentiert, so sind die Gegenstände von Erkenntnis qua wahrer Erkenntnis der Erkenntnis überhaupt und d.h. wahrer oder falscher Erkenntnis gegenüber kontingent. “Damit wird das Ausmaß deutlich, in welchem jene Bestrebung, etwas wahrzunehmen, logisch unabhängig von dem tatsächlichen Erbringen einer Leistung des Typs >Wahrnehmung von etwas< zu sein scheint. Dieses Bestreben darf in keinem Fall als angewiesen auf jenes >Etwas< tatsächlicher Wahrnehmung bzw. Erkenntnis konzipiert werden, da ein solcher Gegenstand im Fall von Irrtum qua Erkenntnis von nichts keineswegs vorliegt. Ein unter der Voraussetzung eines solchen Gegenstands charakterisiertes Bestreben könnte demnach in diesem Fall nicht vorliegen, womit die logisch notwendige Bedingung dafür, von Irrtum im Sinne eines Mißerfolgs zu sprechen – nämlich das Ergehen einer erfolgsdifferenten Bestrebung -, nicht erfüllt wäre. Die Identifikationsauffassung von Wahrnehmung, welche für das in jedem Fall ergehende Bestreben qua Identifizieren von etwas ein zu identifizierendes Gesehenes oder Gehörtes usf. voraussetzt, ist daher unhaltbar, eben weil keineswegs in jedem Fall etwas gesehen oder gehört usf. wird, sondern einzig und allein dann, wenn die Leistung, etwas wahrzunehmen, erbracht ist. Die Charakterisierung der Gattung von Bestrebungen als richtiges oder falsches Identifizieren von etwas Wahrgenommenen weist also nicht die erforderliche logische Unabhängigkeit von dem faktischen Erbringen der Wahrnehmungsleistung auf. Etwas identifizieren setzt etwas wahrnehmen voraus, so daß durch eine solche Charakterisierung Wahrnehmungsirrtum als Wahrnehmung von nichts und somit nicht Wahrnehmen prinzipiell nicht eingeholt werden kann” (a.a.O.; S. 67).
Im Anschluß daran, gelangt Düffel zu einem Modell von Bewußtsein als Leistungsbewußtsein, im Unterschied zum Gegenstandsbewußtsein [30], im Sinne eines Bestrebtseins etwas zu leisten. Dadurch ließe sich auch der Wahrnehmungsirrtum einholen, sowie das Postulat wirklichkeitsdifferenter Erkenntnisgegenstände umgehen. “Im Fall des Wahrnehmungsirrtums sind nicht etwa Empfindungen oder Sinnesdaten unleugbar gegenständlich, wie die Sinnesdaten-Theorie es meint. Statt dessen ist das Beziehen des Empfindens auf etwas überhaupt in einem solchen Fall bloß vermeintlicherweise erfolgreich, was bedeutet, daß irrigerweise lediglich geglaubt wird, etwas Bestimmtes zum Gegenstand zu gewinnen, tatsächlich aber nichts vergegenständlicht ist. Im Wahrnehmungsirrtum sind demnach weder Erkenntnisgegenstände im Modus der Unwirklichkeit noch Empfindungen als solche gegenständlich. Vergegenständlichen von etwas ist die in sinnenunspezifischer Weise formulierte Wahrnehmungsleistung, die als Bezug auf etwas überhaupt von dem schlechthin ungegenständlichen Empfinden ausgeht und dabei kontingenterweise etwas Bestimmtes vergegenständlicht, so daß zuweilen eben auch kein Vergegenständlichen von etwas vorliegt” (ebd.; S. 113). Erkenntnisse sind nicht mit Bestimmungsbestrebungen, sondern mit Bestimmungsleistungen gleichzusetzen. “In dieser Kontingenz sind Bestimmungs- bzw. Erkenntnisleistungen nicht das, als was das Erkenntnissubjekt qua Absichtlichkeit ergeht, sondern dasjenige, worauf es in seiner Leistungsorientiertheit ausgeht. Es ist somit >Erkenntnissubjekt< nicht wesentlich im Sinne eines Subjekts einer Erkenntnisleistung. Subjekt einer Erkenntnis von etwas überhaupt als etwas ist es vielmehr nur kontingenterweise, während es wesentlich eine auf Erkenntnis von etwas aufgehende Absichtlichkeit darstellt, die als eine solche Erkenntnisbestrebung lediglich kontingenterweise erfolgreich und somit nur dann Erkenntnis von etwas überhaupt als etwas ist. Ein Erkenntnissubjekt, so wäre daher zu explizieren, ist ein auf Erkenntnis von etwas Ausgehendes” (ibid.; S. 123).
4. Wissenschaftsphilosophische “Wirklichkeits”- und Wissenskonzeptionen
Die Diskussion zum Thema Realismus-Antirealismus betrifft die Frage, ob und ggf. in welchem Maße und auf welche Weise die Entitäten unserer Welt erkenntnissubjektunabhängig existieren bzw. die Sachverhalte, welche in unserer Welt vorliegen oder nicht vorliegen können, erkenntnissubjekt-unabhängig vorliegen oder nicht, und wurde bereits in den vorangegangenen Kapitel verschiedentlich tangiert. Dabei variieren die Vorstellungen über die Art der Abhängigkeit. Zuweilen wurde angenommen, Entitäten könnten nicht existieren oder Sachverhalte nicht vorliegen ohne einen Wahrnehmungsvorgang, der sie - auf evtl. nicht näher beschreibbare Weise - konstituiert (z.B. im Berkeleyschen Idealismus). Eine zeitgenössische Hypothese besagt beispielsweise, daß Entitäten ohne einen, durch unsere Sprachen und Theorien gelieferten, konzeptuellen Rahmen nicht existieren könnten, oder das ohne entsprechende Nachweise bzw. Nachweisbarkeit Sachverhalte nicht vorliegen können. Mittlerweile wird die Realismusdiskussion nicht mehr aus einer traditionellen ontologischen, sondern aus einer erkenntnistheoretischen Perspektive heraus geführt. Dabei wird danach gefragt, ob das Prädikat “wahr” ein mehrstelliges oder einstelliges ist, oder ob Wahrheit mit Verifizierbarkeit bestimmter Art identisch ist oder nicht. Da der Wahrheitsbegriff seit einigen Jahren in der logischen Semantik wesentlich vorkommt und in der modernen Sprachphilosophie in sogenannten Bedeutungs-theorien (“theories of meaning”) eine wichtige Rolle spielt, spricht man vielleicht irreführenderweise auch von semantischem Realismus oder Antirealismus. Irreführend deshalb, da man tatsächlich nicht an Wahrheit in semantischer Hinsicht, sondern in epistemischer Hinsicht interessiert ist (man möchte z.B. wissen, ob, falls man weiß, daß bestimmte Sachverhalte vorliegen und andere nicht, dies erkenntnissubjektunabhängig der Fall ist oder nicht).
4.1. Realismus-Konzeptionen
Der Ausdruck “Realismus” dient in der Philosophie der Bezeichnung einer Vielzahl unterschiedlicher Positionen, innerhalb deren sich drei grundlegend differente Bedeutungen unterscheiden lassen:
1. Die Auffassung, daß Universalien[31] (z.B. Eigenschaften und Relationen, die verschiedenen Dingen gemeinsam sein können), abstrakte individuelle Gegenstände (z.B. Zahlen, Propositionen, Tatsachen) oder abstrakte kollektive Einzeldinge (Mengen, Klassen) als irreduzible Bestandteile der Realität existieren. Dies steht in Opposition zum Nominalismus, dem zufolge alles, was existiert, konkret, individuell und partikulär, d.h. raum-zeitlich lokalisierbar und nicht rein begrifflich charakterisierbar (konkret, nicht abstrakt); entweder ohne Teile oder eindeutig in Teile zerlegbar, die selbst keine Teile haben (individuell, nicht kollektiv); ein einmaliges Einzelding, keine Eigenschaft oder Relation (partikulär, nicht universal) ist.
2. Die Auffassung, daß die Realität von subjektiven, geistigen Leistungen und Fähigkeiten wie Denken, Erkenntnis oder Sprache unabhängig ist, d.h. daß es materielle Dinge gibt, deren Existenz davon unabhängig ist, ob in geistigen Vorgängen wie Denken, Vorstellen oder Sprechen auf sie Bezug genommen wird (bzw. werden kann). Diese These steht im Gegensatz zu Descartes methodischen Zweifel und Berkeleys Idealismus (“esse est percipi”- Sein ist Wahrgenommen-werden).
3. Die, ebenfalls den beiden anderen Konzeptionen zugrundeliegende, semantische These besagt, daß die Wahrheit einer Aussage (hinsichtlich eines bestimmten Gegenstandsbereichs) und damit auch deren Bedeutung von der Möglichkeit ihrer Verifikation oder Rechtfertigung un abhängig ist. Realismus ist hier mit einer bestimmten Bedeutungstheorie und Wahrheitsdefinition verknüpft. Die Gegenposition des Anti-Realismus vertritt hingegen die Auffassung, daß die Wahrheit von Aussagen des fraglichen Bereichs in ihrer berechtigten Behauptbarkeit besteht, so daß eine Aussage, die berechtigterweise weder behauptet noch bestritten werden kann, weder wahr noch falsch ist.
Beispiele für einige wissenschaftsphilosophisch bedeutsame Varianten des Realismus sind u.a.:
Der starke ontologische und epistemologische (metaphysische) Realismus (Alltagsrealismus, common-sense-Realismus), demzufolge es eine Realität gibt, die in ihrer Existenz wie Beschaffenheit unabhängig ist von der Existenz und Beschaffenheit menschlicher Erfahrungen, Denkformen und Annahmen. Wahrheitstheoretisch folgt hieraus die Annahme einer Korrespondenz zwischen Realität und (richtiger) Erkenntnis. Die Korrespondenz wird erreicht durch Abbildung bzw. Repräsentation.
Der wissenschaftliche Realismus[32] , demzufolge Entitäten (richtiger, verifizierter) wissenschaftlicher Theorien, ob beobachtbar oder nicht (bzw. wahr oder falsch), unabhängig von mentalen (phänomenalen, intentionalen) Zuständen existieren.
Der Physikalismus/Naturalismus/wissenschaftlicher Materialismus : die einzigen existierenden Entitäten sind physische und physikalisch beschreibbare Entitäten; physikalische Gesetze erklären alles, was erklärt werden kann. Mentale Zustände sind physische Zustände (die stärkste Variante ist der eliminative Materialismus bzw. Reduktionismus[33]).
Dem schwachen Realismus nach, gibt es eine von menschlicher Erfahrung, Denkformen und Annahmen unabhängige Realität, von der wir aber die “Dinge, wie sie an sich selbst sind” (Kant) weder beobachten noch erkennen können. Wahrheitstheoretisch folgt hieraus die Leugnung von Korrespondenz, mit der möglichen Folge des Relativismus.
Laut epistemologischen (internen, konstruktiven) Realismus , sind die Entitäten, über die wir etwas aussagen, nicht Elemente einer (in ihrem “An-sich” unerkennbaren) Realität, sondern einer phänomenalen “Wirklichkeit nach Menschenmaß”, Resultate der konstruktiven Leistung menschlicher Erkenntnis. Wahrheitstheoretisch folgt hieraus ein mehr oder weniger gegen Relativismus gesicherter Pluralismus.
Dem konstruktiven Empirismus zufolge beziehen sich unsere (theoretischen) Aussagen über für uns beobachtbare “Wirklichkeit” nicht direkt auf Realität sondern auf Modelle der Realität. Diese Modelle haben zwei Ebenen: die des Beobachtbaren (Empirischen) und die des Nicht-Beobachtbaren (Theoretischen); Theoretisches prägt immer unsere Aussagen von für uns Beobachtbarem. Theorien konstruieren für uns beobachtbare Wirklichkeit.
Für den internen semantischen Realismus , sind Aussagen über Sachverhalte theoriegeladen und abhängig von Sprachen und Bedeutungssystemen.
Sämtlichen Spielarten dieser Realismuskonzeptionen ist die Bestrebung gemeinsam, einerseits das Realismusproblem stark von der epistemologischen Perspektive aus zu fassen, und andererseits gleichwohl ontologisch die extramentale Existenz von singularia, individuellen Entitäten anzuerkennen. Hierbei gilt es die Korrelativität von ontologischer und epistemologischer Perspektive, sowie die strukturelle Differenz zwischen beiden Ebenen aufzuzeigen. Ontologie [34] kann verstanden werden als die Lehre von den Formen der Konzeptualisierung der Formen dessen, was existiert, d.h. sie expliziert und klassifiziert (soweit möglich) die verschiedensten (in den Einzelwissenschaften angewandten) konzeptuellen Schemata. Epistemologie [35] hingegen beschreibt die Lehre von dem Vermögen der Konzeptualisierung und ihres systematischen Zusammenhangs, d.h. sie reflektiert und systematisiert die formalen und empirischen Verfahren, die in unseren Konzeptualisierungen zum tragen kommen. Daraus ergibt sich die Konsequenz, daß Ontologie und Epistemologie zueinander im Verhältnis der Komplementarität stehen müssen, da schon auf der Ebene der einzelwissenschaftlichen Konzeptualisierungen eine Komplementarität von ontischen und epistemischen Aspekten im Spiel ist. Wichtig ist dabei, daß man Ontologie nicht mit der Vorstellung von Bewußtseinsunabhängigkeit assoziiert. Aussagen, auch über Extramentales, sind immer nur möglich und sinnvoll, wenn sie reflektiert durch und reflektierend über die Vermögen der Konzeptualisierung erfolgen (die jeweiligen Einstellungen zum Realismusproblem sind jeweils entsprechende Folgerungen aus solchen Reflexionen und nicht ihre Voraussetzungen).
4.2. Entwicklung der Realismuskonzeptionen im Verhältnis von Ontologie und Epistemologie – Descartes bis Kant
Descartes (31.03.1596 - 11.02.1650) zufolge kann extramental Seiendes weder durch die sinnliche Wahrnehmung, noch durch Einbildungskraft auf abstraktivem Wege erkannt, sondern nur denkend begriffen werden (Disjunktion von res cogitans und res extensa). Andererseits sollen die klaren und distinkten Ideen, wie die der extensio, durchaus die extramental Seienden repräsentieren: die Ausdehnung sei die wesentliche Eigenschaft extramentaler körperlicher Substanzen. In seiner ontologischen Deutung liegt ein Kausalitätsprinzip vor, das punktuell und in einem quantitativen Sinn (und nicht qualitativ, wegen der substantiellen Verfaßtheit der res cogitans als einer selbständigen Entität) verwendet wird.
Clauberg unterscheidet zwischen absoluten und respektiven Attributen des Seienden, wobei die absoluten nur von Gott als ihrer Ursache abhängen, wohingegen die respektiven auf unseren Intellekt und seine vielfachen Weisen des Konzeptualisierens und Unterscheidens bezogen sind. Kausalität wird unter die respektiven Attribute subsumiert, ist aber im Endeffekt nicht im Sinne eines fluxus von irgend etwas Substantiellem, von der Ursache auf die Wirkung denkbar.
Hobbes (05.04.1588 – 04.12.1679) definiert seinen epistemologischen Ansatz explizit in Termen der Kausalitätsrelation: “Philosophie ist die rationelle Erkenntnis der Wirkungen oder Erscheinungen aus ihren bekannten Ursachen oder erzeugenden Gründen und umgekehrt der möglichen erzeugenden Gründen aus den bekannten Wirkungen”[36]. Für ihn gilt nicht die absolute cartesianische Trennung zwischen res cogitans und res extensa. Gegenstand der methodologischen Anwendung der Kausalität-srelation im Sinne der resolutiven und kompositiven Methode sind ausschließlich Körper und ihre Bewegungen - welche als von Natur bekannt vorausgesetzt werden -, womit er Gott als die höchste Ursache ausschließt. Im Gegensatz zu dieser scheinbar materialistischen Reduktion des Kognitiven auf etwas dem Physischen Analogen, steht seine nominalistische Grundposition, daß alle universalen Prinzipien wie Körper, Ausdehnung und Bewegung nichts anderes als bloße Definitionen bzw. Namen sind, deren Ordnung nicht eo ipso der Zusammensetzung der extramentalen Körper entspricht.
Spinoza (24.11.1632 – 21.02.1677) versuchte Descartes‘ ontologisches Argument extensiv zu nutzen, um einen starken Realismus zu legitimieren. Das Kausalitätsprinzip soll, auf den Ursprung alles Seienden angewandt, selbstbegründend sein, was ihn zu einem apriorischen Beweis einer göttlichen Substanz als causa sui führt. Auf dieser Grundlage gilt es uneingeschränkt sowohl für die Ordnung des Denkens (als logische Grund-Folge-Beziehung) als auch für die Ordnung des körperlichen Seins; und letzeres nur unter der Voraussetzung, daß dem göttlichen Ursprung selbst das Attribut der extensio zukommen muß, mit der Schlußfolgerung, daß er dann nicht mehr eine causa transiens, sondern eine causa immanens sein kann. Das Kausalitätsprinzip gilt nicht zwischen dem Modus der cogitatio und dem der extensio: beide Kausalreihen sind independent und verlaufen nur der Möglichkeit nach parallel, da sie Modi der einen Substanz sind.
Locke (29.08.1632 – 28.10.1704) vollzieht in der frühen Neuzeit die wohl am weitest reichende Wendung zu einem empirischen Realismus. Das Kausalitätsprinzip dient ihm zur Legitimierung eines direkten influxus physicus[37] zwischen extra- und intramentaler Ebene. Perzeption ist verursacht durch äußere Dinge, welche unsere Sinne affizieren. Insofern sein epistemologischer Ansatz auf der sinnlichen Wahrnehmung als dem basalen Erkenntnisvermögen beruht, ist sein ontologisches Gegenstück auf Singularitäten ausgerichtet. Ontologisch ist dazu die Annahme atomistischer Entitäten mit konstanten Eigenschaften[38] im extramentalen Bereich erforderlich, welche kausal die Wahrnehmungssubstanz und somit die Grundlage der Ideen im mentalen Bereich garantieren.
Leibniz (01.07.1646 – 14.11.1716) erkannte die ganze Tragweite der Konfrontation des (Hobbes‘schen) Nominalismus und des (Locke’schen) Empirismus mit dem Cartesianismus und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten für die Bestimmung des Verhältnisses von Ontologie und Epistemologie. Seine Monadenlehre kann angesehen werden als der Versuch diese Schwierigkeiten zu überwinden. Er hält zwar an der Substantialität der res cogitans fest, insofern es in seiner Monaden-lehre keines influxus physicus zwischen monadologischer Repräsentation und raum-zeitlicher Körperwelt bedarf; aber monadologische Repräsentation ist nun nicht mehr das Privileg nur des reinen Denkens, sondern Kennzeichen aller der Perzeption fähigen Entitäten[39]. Als reale Entitäten erkennt er nur singularia, konkrete Individuen an (und trägt somit dem Nominalismus Rechnung), aber als Ziel ihrer Konzeptualisierung strebt er nicht nur deren Allgemeinbegriff oder ihre Betrachtung, sondern deren vollständigen Begriff an. Auch teilt der die empiristische Kritik an den angeborenen, vom Körper abtrennbaren Ideen, insofern zum vollständigen Begriff einer individuellen, konkreten Entität die verités de raison und die verités de fait gehören. Umgekehrt ist für ihn die Vorstellung von “reinen” Körpern oder Atomen nur eine Abstraktion, bzw. ist ihm die raumzeitliche Existenzweise der Körper infolge ihrer unendlichen Teilbarkeit nur ein Phänomen, d.h. sie haben ihre Wirklichkeit nur aufgrund der ihnen immanenten und sie repräsentierenden Monaden. Dieser “starke”, aber gleichwohl “innere” Realismus liegt darin begründet, daß das Vermögen der “perception”, “l’expression” oder monadologischen Repräsentation nicht auf das spezifisch menschliche, mentale Vermögen der Apperzeption eingeschränkt, sondern im Gegenteil zum Kennzeichen der Seinsweise alles Seienden universalisiert wird.
Kant (22.04.1724 – 12.02.1804) versuchte erstmals auf jegliche ontologische Annahme zu verzichten und eine auf die ausschließlich epistemologische Perspektive konzentrierten, sozusagen internen Realismus zu begründen. Das Problem liegt dabei bekanntlich in der Ambiguität des Realismus-begriffs, bzw. in der Zielvorstellung, synthetische (im Sinne von erkenntniserweiternde) Urteile a priori zu gewinnen. Dies hat durchaus als minimalste Voraussetzung die Anerkennung der Existenz extramentaler Entitäten. Auch wenn solche Gegenstände nicht als Dinge an sich erkannt, so müssen sie doch wenigstens gedacht werden können. Hier liegt zugleich der Wendepunkt zu dem ganz anderen Begriff der Wirklichkeit, der internen Apriorität des Erkennens. Zwar affizieren die in der Tat nicht auszuschließenden extramentalen “Dinge an sich” uns in wechselnden Graden der Intensität, aber die Herstellung aller möglichen Verbindungen zwischen den einzelnen Affektionen ist für Kant eine reine Angelegenheit der mentalen Vermögen, und zwar konsequent von der Wahrnehmung bis hin zum reinen Verstandesgebrauch.
Zusammenfassend können hierbei also drei Hauptrichtlinien ausgemacht werden:
1. Als metaphysischer Realismus lassen sich diejenigen Varianten bezeichnen, die auf die Existenz eines, wie auch immer begründeten und näher bestimmten, höheren Wesens zurückgreifen. Dabei kann, wie im Cartesianismus, aus epistemologischer Perspektive durchaus ein interner Realismus (i.e. kein influxus physicus zwischen extra- und intramentaler Realität bzw. Wirklichkeit) vorliegen, der aber durch das ontologische Argument von der Existenz eines höheren Wesens in einen starken Realismus verwandelt wird, weil damit die Anwendbarkeit der auf der internen epistemologischen Ebene gewonnenen Aussagen auf extramentale Entitäten möglich und letztlich ihre Korrespondenz mit deren essentiellen Attributen garantiert wird.
2. Als empirischen Realismus können diejenigen Varianten bezeichnet werden, die einen influxus physicus zwischen extra- und intramentaler Realität behaupten. Die Internität der epistemischen Ebene wird überflüssig, weil die qualitative Korrespondenz zwischen episteme und onta durch die ontologische Annahme einer atomistischen und in ihren Wesensmerkmalen konstanten extra-mentalen Realität in ihrer direkten Einwirkung auf und adäquaten Abbildung durch die mentalen Vermögen im Prinzip abgesichert wird. Das schließt nicht aus, daß sozusagen nebenher auch ein Gottesbeweis geführt wird, die Motive dafür liegen dann aber im Bereich der Moralphilosophie.
3. Als internen Realismus im engeren Sinne, d.h. rein aus der epistemologischen Perspektive ohne metaphysische, empiristische oder andere ontologische Annahmen gewonnen, können wir wohl nur die Kantische Richtung nennen. Dies ist jedoch nur ein ganz schwacher “Realismus”, insofern nur die Existenz extramentaler Entitäten akzeptiert wird, ohne den Versuch zu machen, sie als onta zu konzeptualisieren, was zur Ausschaltung der ontologischen Perspektive führt.
Zur wissenschaftlichen Konzeptualisierung einer offensichtlich mehr als nur mentale Entitäten einschließenden Welt, wird zweifelsohne ein starker Realismus benötigt. Denn wenn es um wirklich erkenntniserweiternde Aussagen gehen soll, wird eine möglichst weite Felder der Konzeptualisierung erschließende Ontologie und eine kritisch auf die Systematik und Reichweite der jeweils einsetzbaren Erkenntnisvermögen reflektierende Epistemologie benötigt. Bemerkenswert bleibt weiterhin die Tatsache, daß eine realistische Position in einem Bereich durchaus zugleich mit einer antirealistischen im anderen vertretbar ist. So ist es z.B. gut möglich, etwa scholastischer (ontologischer) Realist zu sein, also an die erkenntnissubjektunabhängige Existenz von Eigenschaften zu glauben, gleichzeitig erkenntnistheoretischer Antirealist, also beispielsweise die Relativität der Wahrheit zur jeweiligen Sprache zu behaupten und auch wissenschaftsphilosophischer Antirealist bezüglich der Referenz theoretischer Terme zu sein. Denkbar wäre auch folgende Position, welche H. Putnam explizit vertritt: scholastischer Realismus, erkenntnistheoretischer Antirealismus und wissenschaftsphilosophischer Realismus der kumulativ-progressiven Art.
4.3. Antirealismus-Konzeptionen
4.3.1. Anti-Realismus und Verifikationismus
Die Gegenposition zum wissenschaftlichen Realismus ist der Anti-Realismus, welcher die Realität abstrakter wissenschaftlicher Konstruktionen, die sich weit von der unmittelbaren Erfahrungswelt entfernen, bestreitet. Dies wirft die Frage nach der Beziehung zwischen der Existenz theoretischer Entitäten und dem Induktionsproblem auf, hinsichtlich der Akzeptabilität des sogenannten “Schlusses auf die beste Erklärung ”[40], welcher von Realisten akzeptiert und von Anti-Realisten abgelehnt wird. Allgemein soll das Prinzip des Schlusses auf die beste Erklärung den Übergang von direkt zugänglichen Phänomenen auf Sachverhalte, die nicht direkt zugänglich sind, rechtfertigen. Insbesondere schließt man von Aussagen über beobachtete Phänomene auf Aussagen über unbeobachtete bzw. unbeobachtbare Sachverhalte. In diesem Fall besagt das Prinzip in etwa folgendes: Hat man für eine Menge von beobachtbaren Phänomenen die beste Erklärung gefunden und kommen in dieser Erklärung Aussagen über unbeobachtete/unbeobachtbare Entitäten vor, so existieren diese unbeobachteten/unbeobachtbaren Entitäten, und sie verhalten sich so, wie in der Erklärung behauptet wird. Kurz: Die beste Erklärung des Beobachteten liefert eine wahre Erklärung des Unbeobachteten/Unbeobachtbaren. Man verfügt damit über eine Erklärung eines Phänomenbereichs, die einen Bezug auf theoretische Entitäten enthält. Diese Erklärung ist empirisch adäquat, und man hält sie für besser als jede andere empirisch adäquate Erklärung. Man schließt auf die Wahrheit dieser Erklärung und auf die Existenz der betreffenden theoretischen Entitäten. “Ein induktiver Schluß und ein Schluß auf die beste Erklärung haben folgendes gemein: Bei beiden geht man aus von Beobachtungen und schließt auf etwas, was über diese Beobachtungen hinausgeht. Der wesentliche Unterschied scheint zu sein, daß man im ersten Fall auf (nur) faktisch Unbeobachtetes, aber Beobachtbares schließt, während man im zweiten Fall auf Unbeobachtbares schließt” (a.a.O.; S. 74)[41].
Der Realismus identifiziert die Bedeutung eines Satzes mit seiner Wahrheitsbedingung[42], geht also von der erkenntnisunabhängig gegebenen Wahrheitsbedingungen aus. Wahrheitsbedingungen werden von Vertretern einer solchen Bedeutungstheorie als Bedingungen aufgefaßt, die unabhängig von unserer Erkenntnis vorliegen. Sätze sind wahr oder falsch, und ihr Wahrsein oder Falschsein ist unabhängig von unserem Wissen davon. Die von den fraglichen Sätzen beschriebene Realität ist unabhängig von unserem Wissen von ihr. Diese Auffassung wird vom Anti-Realismus negiert[43]. Während dies vom molekularen Verifikationismus gestützt wird, bezieht der holistische Verifikationismus die Verifizierbarkeitsanforderung auf ganze Theorien oder Sprachen, und nicht nur auf einzelne Sätze. Dieser holistischen Auffassung zufolge hat ein Satz nur insofern Bedeutung, als er in einen größeren Zusammenhang eingebettet ist, welcher als ganzer durch Erfahrung bestätigt oder geschwächt werden kann. Methoden der Feststellung betreffen diesen ganzen Zusammenhang, und kognitive Bedeutsamkeit kommt in erster Linie diesem ganzen Zusammenhang zu. Im Anschluß daran ließe sich ein “empirischer Realismus” oder “interner Realismus” formulieren, wie ihn beispielsweise Putnam vertritt: Nur unter Bezugnahme auf einen umfassenden sprachlich-theoretischen Zusammen-hang lassen sich Fragen nach der Existenz von Gegenständen, nach der Wahrheit oder Falschheit von Sätzen stellen.
4.3.2. Idealismus und Idealrealismus
Die erkenntnistheoretische Grundhaltung des Idealismus, räumt dem Denken oder den Ideen, als einer geistigen Seinsart, gegenüber der materiellen oder sinnlich erfahrbaren Beschaffenheit der Welt, den Vorrang ein. Erstmals ausgeprägt mit der Ideenlehre[44] Platons, gilt als die maßgebliche Denkhaltung (metaphysischer Idealismus) in den neuplatonistischen Philosophien des Mittelalters von Augustinus bis ins 12. Jahrhundert. Mit dem Nominalismus formierte sich eine Gegenbewegung, welche die Realität der Gattungsbegriffe (z.B. Menschheit) bestreitet und dem Einzelding (z.B. Mensch) den Vorrang einräumte. Als wichtigster Vertreter des neuzeitlichen erkenntnistheoretischen Idealismus kann Descartes[45] betrachtet werden. Seine Überzeugung, daß die geistige Seinsweise leichter zu erkennen sei (“cogito ergo sum”, “ich denke, also bin ich”) als die körperliche, wirkte entscheidend auf die Subjektphilosophie des Deutschen Idealismus. Das denkende Ich, welches zugleich Sitz der Vernunft ist, wird zum ersten Prinzip der Philosophie erklärt, alles andere sinkt zur bloßen Funktion des Ich, zum “Nicht-Ich” (Fichte) herab. Dieses Prinzip erstreckt sich auf den gesamten Seinsbereich, und die externale Welt erscheint nur deshalb als erkennbar, da sie vernunftförmig strukturiert erscheint. Während aber bei Kant und seinen Nachfolgern der Idealismus vorwiegend dadurch gerechtfertigt ist (mit Ausnahme von Hegels objektivem Idealismus), daß die Eigenleistung des Denkens beim Zustandekommen einer jeden Erkenntnis im Vordergrund steht, geht der Idealismus Berkeleys davon aus, daß es überhaupt keine bewußtseinsunabhängige Materie gibt. Das erkenntnis-theoretische Grundproblem des Idealismus besteht darin, daß er ausgehend vom Denken, vom Ich oder von der Vernunft, eine zweite Seinsart erklären muß, die dieser untergeordnet bleibt. Andernfalls würde er in einen Solipsismus umschlagen, der außer den Bewußtseinsinhalten keine andere Seinsart mehr gelten läßt. Hierbei lassen sich zwei Varianten unterscheiden: Zum einen wird lediglich das dem Bewußtsein unmittelbar gegebene als real angesehen. Epistemologisch gesehen beruht sämtliches Wissen über die Welt außerhalb des Selbst auf dem Bewußtsein unmittelbar gegebener Sinnesdaten. In der radikalen Lesart (welche außer von Max Stirner wohl nie ernsthaft vertreten wurde) wird einzig das Selbst als real anerkannt. In seiner zweiten Variante bezeichnet Solipsismus eine negative Position bezüglich des Problems des Fremdpsychischen. So wird einigen Theorien des Geistes vorgeworfen, daß sich als Konsequenz ergebe, daß ein Subjekt lediglich sich selbst, aber keinen anderen Wesen geistige Zustände zuschreiben könnte. In der analytischen Theorie des Geistes, geht der methodo-logische Solipsismus (Putnam) davon aus, daß ein psychologischer Zustand die Existenz keines anderen Individuums voraussetzt als die Existenz des Individuums, das sich in ihm befindet[46]. In dem methodischen Solipsismus (Carnap) sind als Basis zur Entwicklung eines Konstitutionssystems nur solche Gegenstände zugelassen, welche bewußt einem Subjekt zugehören (i.e. das Eigenpsychische). Dies darf nicht als Beschränkung auf ein Subjekt verstanden werden, sondern lediglich als Beschränkung auf das tatsächlich erlebte.
Im Idealrealismus wird ein sich in je verschiedener Weise realisierender Zusammenhang von Idealem und Realem, von Gedanke und Realität behauptet[47]. Das Reale ist identisch mit dem Idealen bzw. beide implizieren einander wechselseitig. J.G. Fichte nennt den transzendentalen Idealismus seiner Wissenschaftslehre auch einen Idealrealismus, der nicht nur die Vereinbarkeit der Prinzipien von Idealismus und Realismus, sondern deren wechselseitige Bedingtheit behauptet, insofern der endliche Geist (das Individuum) notwendigerweise etwas Absolutes außer sich setzen muß (ein Ding an sich), aber dennoch anerkennen muß, daß dieses Ding nur für das Subjekt da sei. Eine ebenfalls idealistische Auflösung des Zusammenhangs von Realem und Idealem als eine Identität von beidem findet sich bei Schelling und Hegel.
4.3.3. Phänomenologie
Originär diente die Phänomenologie der Bezeichnung der Erscheinungen der Realität, wie sie in Raum und Zeit, in ihrer Mannigfaltigkeit und Veränderlichkeit dem menschlichen Bewußtsein gegeben sind (phänomenologische Wirklichkeit), in Abgrenzung zur eigentlichen Realität, wie sie in den hinter diesen Erscheinungen waltenden Ideen, der eigentlichen und unveränderlichen Wesensheit begründet liegt (Platon). Die Philosophie Kants bewirkte (wie bereits erwähnt) eine grundlegend veränderte Sichtweise des bewußtseinsmäßigen Bezugs der Realität: Die Realität besteht in nichts anderem als der Erscheinung (als Wirklichkeit), dem Gegenstand der Erfahrung, wie er sich dem wahrnehmenden Bewußtsein offenbart. Aussagen über eine darüber hinaus bestehende eigentliche Realität überschreitet demnach den Bereich des sinnvoll Aussagbaren. Im 20. Jahrhundert zeigte E. Husserl auf, daß alles raum-zeitliche Sein der Realität nur insofern ist, als es auf ein erfahrendes, wahrnehmendes, denkendes, sich erinnerndes Bewußtsein bezogen ist (Intentionalität von Bewußt-sein). Die Welt ist das Korrelat von Bewußtseinsleistungen. Erst die sinnstiftende Kompetenz des Bewußtseins ermöglicht das Verstehen der Welt in Bedeutungsdimensionen und hinsichtlich ihres Geltungscharakters als etwas Existierendes. Als Erkenntniskritik macht sich die Phänomenologie zur Aufgabe, diese konstituierenden Leistungen des Bewußtseins in ihrer allgemeinen Struktur auszu-weisen. Unsere alltagsweltlich als fraglos gültig angenommenen Vorstellungen der Welt (common sense), werden eingeklammert und bleiben hinsichtlich ihrer Geltung zunächst dahingestellt, bis in der phänomenologischen Reflexion die dafür grundlegenden allgemeinen Sinnkonstitutionsleistungen des Bewußtseins aufgezeigt werden. Der Begriff der transzendentalen Subjektivität soll diese Grund-legungsfunktion des Bewußtseins zum Ausdruck bringen. Aufgabe der Phänomenologie ist die Benennung der allgemeinen Strukturen jener Bewußtseinsleistungen, welche die Konstitution einer möglichen Welt, und mit der objektiven Sinngeltung zugleich deren intentionales Korrelat, die Welt als universalen intentionalen Verweisungszusammenhang vertrauter Sinngeltung begründen. Als die grundlegende Struktur benennt Husserl die Korrelation zwischen subjektivem Auffassungsmodi und ihren gedanklichen Gegenständen im intentionalen Bewußtseinserlebnis (Noema-Noesis-Korrelation). Hierbei zeigt sich, daß ein identischer noematischer Gehalt in einer Vielzahl konkreter noetischer Erlebnisse konstituiert sein kann und daß ein noematischer Gegenstand in verschiedenen noematischen Gehalten gegeben sein kann. Die Leistungen des transzendentalen Subjekts werden im weiteren im Hinblick auf die Konstitution von Ding, Raum, Zeit, Intersubjektivität und objektive Welt thematisiert.
4.3.4. Konstruktivismus
Unter Konstruktivismus wird im allgemeinen eine erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Richtung verstanden, welche die konstituierenden Leistungen des Beobachters im Erkenntnisprozeß betonen bzw. einen darauf bezogenen konstruktiven Begründungsbegriff zugrunde legen. Gemeinsam ist allen z.T. sehr unterschiedlichen konstruktivistischen Strömungen die Kritik realistischer, onto-logischer sowie korrespondenztheoretischer Auffassungen von Wahrheit und Wissen. Das traditionelle epistemologische fragen nach dem Was der Erkenntnis substituiert der Konstruktivismus durch die Frage nach dem Wie des Erkenntnisvorgangs. Jede Form der Kognition, Wahrnehmung und Erkenntnis wird somit als eigenständige aktive Konstruktion eines Beobachters und nicht als passive Abbildung aufgefaßt. Vertreter des radikalen Konstruktivismus [48] sind unter anderem H. Maturana, F. J. Varela, H. v. Foerster und E. v. Glaserfeld. Im Ausgang von systemtheoretischen[49], neurophysio-logischen und kybernetischen Forschungen formuliert der radikale Konstruktivismus eine empirische Kognitionstheorie, die in Fortsetzung skeptischer und konstitutionstheoretischer Überlegung jegliche Form der Erkenntnis – einschließlich des Erkannten selbst – als Konstruktion des Beobachters begreift. Erkennen meint nicht passive Abbildung einer äußeren objektiven Realität, sondern bezeichnet einen Prozeß der eigenständigen Generierung bzw. Konstruktion einer kognitiven Welt, ergo Wirklichkeit. Damit wird die Existenz bzw. Realität einer externalen Welt nicht geleugnet, bestritten wird aber die erkenntnistheoretische Relevanz einer ontologischen Darstellung der Welt. Die reale Welt ist als solche keine erfahrbare Realität. Realität ist vielmehr immer wahrgenommene, beobachtbare, erfundene, ergo konstruierte Wirklichkeit. Als Ausgangspunkt dient dem radikalen Konstruktivismus die neurophysiologische Einsicht, daß das menschliche Gehirn als Teil des Nerven-systems über keinen direkten, unmittelbaren Zugang zu seiner Umwelt verfügt. Das Gehirn operiert als ein selbstreferentiell-geschlossenes System, das sich in seinen Aktivitäten ausschließlich rekursiv auf sich selbst bezieht und auf diese Weise eine semantische und kognitiv abgeschlossene Welt generiert[50]. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß das Gehirn durch Umweltereignisse irritiert oder angeregt wird, aber allein die internen Operationen des Gehirns legen fest, in welchem Sinne die externen Ereignisse verarbeitet werden. Strenggenommen ist somit auch Irritation und Anregung ein systemeigener Zustand, für den es in der Umwelt des Gehirns keine Entsprechung gibt. Insofern operiert das Gehirn selbstexplikativ – das Gehirn muß alle Bewertungs- und Deutungsmuster mittels eigener Operationen aus sich selbst schöpfen. Auf Kritik ist die Annahme des radikalen Konstruktivis-mus gestoßen, daß jede Form der Kognition von lebenden Systemen erzeugt wird und somit als ein biologisches Phänomen zu begreifen ist (Reduktionsvorwurf).
5. “Wirklichkeit” in den Kognitionswissenschaften
Die pluralen Auffassungen vom Abbilden, Erkennen und Wissen haben direkte Auswirkungen auf die Position, die dem Beobachter in kognitiven, motivationalen und volitiven Prozessen zugeschrieben wird: dies reicht vom Versuch der gleichrangigen objektiven Beschreibung des Objekts und des Subjekts psychischer Prozesse im Behaviorismus , über die Betonung von deren Intentionalität in der Aktpsychologie und die Bevorzugung der introspektiven Methode bis zur phänomenologischen Betrachtung des Erkennens als ein “Tun des Selbstbewußtseins” oder zur modern-konstruktivistischen Hervorhebung des “Beobachtens von Beobachtungen”. Anhand der Willensproblematik lassen sich die einzelwissenschaftlichen Konsequenzen der philosophischen Vorentscheidungen zu eher realistischen oder eher konstruktivistischen Positionen darstellen. Im folgenden sollen einige Positionen skizziert und einer eingehender Betrachtung unterzogen werden.
5.1. Psychologie zwischen Realismus und Konstruktivismus
Nach Schelling besteht die erste Aufgabe der Transzendental-Philsosophie darin, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie die Vorstellungen zugleich als sich nach den Gegenständen richtend und die Gegenstände als sich nach den Vorstellungen richtend gedacht werden können. Mit G. Th. Fechners philosophischem Gedanken des “psychophysischen Parallelismus”[51] und seinem psychologischen Gedanken der “Weber-Fechner-Formel” (dem ersten psychologischen Gesetz), steht die Beantwortung der Schellingschen Grundfrage auch am Anfang der modernen wissenschaftlichen Psychologie. Je nach Wahl des Ansatzes wird aber das Abbild (Empfindungen, Vorstellungen, Wissen, Repräsentation, etc.) als der psychische Bezug auf eine – sehr unterschiedlich gefaßte – Dingwelt, Außenwelt, objektive Realität usw. ganz unterschiedlich verstanden, sind die Bestimmungen der Realität und der Zugang zu ihr sehr different. Abbildtheoretischen Konzeptionen zufolge ist das Bewußtsein psychologisch nicht ohne den des Abbilds, der des Abbilds nicht ohne den des Bewußtseins denkbar. Unter Abbild soll hierbei eine basale, philosophischen Inhalt tragende und deshalb ein “ewiges” Problem umreißende psychologische Kategorie verstanden werden[52]. In der wissenschaftlichen (empirischen, experimentellen) Psychologie wird seit Anbeginn der naive Realismus abgelehnt, wie dies Wundt beispielsweise in seiner Apperzeptionspsychologie tut, welche er zu einem “interaktionistischen Dualismus” weiterentwickelte. Der Gestaltpsychologie zufolge sind Abbildkonstanzen, Abbildprägnanzen, Figur-Grund-Phänomene, Kippfiguren, Transponierbar-keiten, sowie das “Phi-Phänomen” nur durch interne psychische Prozesse zu verstehen, welche immanenten Gesetzen gehorchen und von diesen her die Sicht auf die Realität strukturieren, ja diese Realität tatsächlich in einem zu definierendem Sinne (als erfahrbare Wirklichkeit) konstruieren. Diese immanenten Gesetze sind solcher der Selbstorganisation. Noch klarer präsentiert sich Lewins “topologische Psychologie” als eine antizipierte Selbstorganisationstheorie. Voluntative und motivationale Veränderungen des Individuums werden aus der internen Dynamik der Persönlichkeit erklärt. Es ist also kein Zufall, daß die modernen selbstoganisationstheoretisch (autopoietisch) argumentierenden Ansätze der Kognitionswissenschaften, darunter entsprechende kognitions-psychologische Versuche, gerade auf die Begrifflichkeit der Intentionalität und Phänomenologie zurückgreifen, und mit der Repräsentation einen Abbildbegriff zurückweisen, der eindeutige Entsprechungen zwischen den emergenten Vorgängen im Gehirn und einem spezifischen kognitiven Leistungsvermögen, also der erfolgreichen Bewältigung einer gestellten Aufgabe fordert. An der grundlegenden Frage, ob es überhaupt keine Entsprechung zwischen Umwelt und kognitivem System, etwa im Sinne einer Rekonstruktion gebe (wie vermittelt diese auch immer sein mag), scheiden sich die Geister eines (schwachen) Realismus und eins (moderaten) Solipsismus. Der radikale Konstruktivismus vertritt jedoch nicht etwa einen ontologischen Solipsismus (oder objektiven Realismus), sondern einen epistemologischen Solipsismus, der an den Begriff des Beobachters gebunden ist[53]. Er leugnet nicht “die Realität”, sondern besagt lediglich, daß alle meine Aussagen über diese Wirklichkeit zu hundert Prozent mein Erleben sind.
Man kann in der Geschichte der kognitiv orientierten wissenschaftlichen Psychologie eine schrittweise Abkehr vom naiven vorwissenschaftlichen Abbildrealismus, hin zu einem onto-epistemologischen Realismus beobachten, insofern die ontologische und die epistemologische Komponente der Realismusauffassung einerseits klar auseinandergehalten, andererseits in ihrem gegenseitigen Bedingen gesehen werden, wobei die Weiterentwicklung vor allem die epistemologische Komponente tangiert:
- Zu einem kritischen Realismus, insofern über die unmittelbaren Erfahrungen hinausgegangen wird und Realitäten “gesetzt”, d.h. als solche anerkannt werden, die nicht mit der Wirklichkeit (dem Inhalt) des Bewußtseins, den Empfindungen, Vorstellungen, Gefühlen, Gedanken zusammen-fallen.
- Zu einem hypothetischen Realismus, insofern davon ausgegangen wird, daß psychologische Theorien – wie alle wissenschaftlichen Theorien – Züge, Strukturen, Muster der realen Welt versuchsweise rekonstruieren, die den Sinnen nicht unmittelbar zugänglich sind.
- Letztendlich zu einem konstruktivistischen Realismus, insofern der hohe Anteil von Kon-struktionen im Rahmen der hypothetischen Rekonstruktion anerkannt und betont wird, wobei man jedoch konsequent den Solipsismus zurückweist.
5.2. Kognitive Referenz und Selbstreferenzialtiät des Gehirns
Gerhard Roth und Helmut Schwegler zufolge bilden die Resultate und Konzepte der Hirnforschung und der Wahrnehmungspychologie eine wichtige Grundlage für den Konstruktivismus, einer Theorie, die den Anspruch erhebt, zugleich Erkenntnistheorie und empirische Theorie der Wahrnehmung und Kommunikation zu sein[54]. Die kognitive Hirnforschung bzw. Neurobiologie ist versucht die Funktionsweisen und Leistungen des Nervensystem von Mensch und Tieren im Zusammenhang mit Wahrnehmung, Erkennen und Verhaltenssteuerung zu verstehen. Beim menschlichen Gehirn geht es zusätzlich um die Frage nach der Entstehung des Bewußtseins, der bewußten Wahrnehmung und dem Verhältnis zwischen derartigen “mentalen” Zuständen und Erregungsprozessen im Gehirn. Dabei hat eine Abkehr von der bis dato vorherrschenden Vorstellung stattgefunden, daß das kognitive System aus einer hierarchischen Anordnung von neuronalen Filtern besteht, die von der Sinnesperipherie zu den “höchsten Wahrnehmungszentren” immer spezifischer und komplexer werden und schließlich in sog. gnostischen Neuronen enden. Es wurde angenommen, daß in der Aktivität derartiger, an der Spitze der Wahrnehmungshierarchie stehender gnostischer Neuronen die Wahrnehmung komplexer, bedeutungshafter Gestalten und Szenen der Umwelt repräsentiert wird. An Stelle einer solchen Vorstellung von immer selektiver werdenden neuronalen Filtern wird heute das inzwischen empirisch gut bewährte Konzept einer parallelen und distributiven Erregungsleitung gesetzt. Dieses Konzept beinhaltet, daß komplexe Wahrnehmungszustände niemals durch einzelne Neurone und auch nicht durch kleine Neuronenverbände repräsentiert werden, sondern durch die räumlich verteilte, simultane Aktivität vieler Nervenzellen und Nervenzellverbände[55]. Simultan hat sich in der kognitiven Neuro-biologie die Einsicht in die Konstruktivität des Wahrnehmungsvorgangs durchgesetzt. Was an Reizzuständen über die Sinnesepithelien zum Gehirn gelangt, ist nicht eine Abbildung der Welt, die durch Filter nur sortiert wird. Vielmehr ist Wahrnehmung ein aktiver Prozeß, in welchem das Gehirn die Umwelt nach solchen Erwartungszusammenhängen absucht, die aufgrund seiner Vorerfahrung und seiner Erwartung wichtig oder zumindest interessant sind. Es differenziert Bedeutungshaftes von Unbedeutendem. Diese Unterscheidung existiert nicht in der Umwelt, sondern wird durch das kognitive System selbst getroffen. Die Kriterien dafür entstammen dem System selbst. Dies ist die grundsätzliche Selbstreferentialität des Gehirns bzw. des kognitiven Systems. Das Gehirn selegiert die Welt stets aufgrund seiner individuellen oder stammesgeschichtlichen Erfahrung. Wahrnehmung ist daher nicht ohne Gedächtnis denkbar, die aktuell einlaufende sensorische Erregung erhält erst im Rahmen der Erfahrung ihre Ordnung und ihren Sinn. Die Neurobiologie untersucht also zum Zweck der Aufklärung des Wahrnehmungsprozesses die Korrelationen zwischen Umweltereignissen und gehirninternen neuronalen Zuständen einerseits und zwischen gehirninternen neuronalen Zuständen und Verhaltensreaktionen andererseits.
Der Neurobiologie zufolge gibt es “keinen ontologischen Sprung im Sinne einer >Wesens-verschiedenheit< von Gegenstände (und gegenständlichen, physikalischen Prozessen) einerseits und Erlebnissen, Mentalem, Geist andererseits. Auch Gegenstände sind immer erlebte Gegenstände und gehören deshalb keiner anderen Seinsklasse an als Mentales. Dies ist ohne Zweifel eine monistische Auffassung, aber sie stellt keinen Psychologismus oder Idealismus dar (und freilich auch keine Materialismus); eine solche Charakterisierung hätte nur Sinn auf der Basis einer a priori-Unterscheidung von Gegenständlichem einerseits und Psychischem bzw. Geist andererseits. Nach unserer Auffassung verbietet sich aber ein solches Vorverständnis, da wir primär nur die eine phänomenale Welt erleben, die wir sekundär gemäß solchen oder ähnlichen Unterscheidungen aufgliedern”[56]. Das kognitive System kann als eine Erlebniseinheit verstanden werden und erfährt an und in sich die Gleichzeitigkeit von Zustandsbereichen, welche es aufgrund seiner (für die Handlungs-steuerung notwendigen) Selbstdiffenrenzierung unterscheidet, d.h. die Gleichzeitigkeit von Umwelt-prozessen, Körper und Geistigem. Fazit: die Differenzierung von Mentalem, Körper und Umwelt ist eine vom kognitiven System selbst getroffene, ontogenetisch verfestigte und daher im Erwachsenen-alter nicht willentlich wiederrufbare (jedoch instabile) Unterscheidung.
Um einen infiniten Regreß (als logische Konsequenz aus der Erkenntnis, daß die phänomenale Welt ein Konstrukt des Gehirns ist[57] ) zu vermeiden, müssen zwei Dinge in Einklang gebracht werden. Erstens die Tatsache, daß es für jedes Individuum nur ein Welt gibt, nämlich die Erlebniswelt oder “phänomenale Welt”. Sie ist für jeden von uns die einzige und einheitliche Realität, auch wenn sie sekundär in verschiedene (ko-existente) Wirklichkeitsbereiche aufgegliedert ist.
Zweitens die Tatsache, daß sich innerhalb des Bereichs meiner phänomenalen Welt, in dem sich neurobiologische und wahrnehmungspsychologische Experimente und Beobachtungen abspielen können, detaillierte und wiederholbare Korrelationen zwischen neuronalen Erregungen im Gehirn und der individuellen Erlebniswelt ergeben. Es kann empirisch nachgewiesen werden, daß eine Manipulation der Gehirnaktivität unter bestimmten Bedingungen zu voraussagbaren Veränderungen der (berichteten oder eigenerfahrenen) phänomenalen Welt führt[58]. Der Neurobiologe zieht daraus den Schluß, daß die phänomenale Welt in der Tat durch Hirnaktivität hervorgebracht wird. Simultan muß aber angenommen werden, daß dieses Hervorbringen nicht in seiner phänomenalen Welt geschieht, sonst wäre er wieder bei der absurden Tatsache angelangt, daß er als Konstrukt seines eigenen Gehirns eben dieses Gehirn untersuchen kann. Dieser Zirkel kann umgangen werden, indem angenommen wird, daß das Gehirn, welches als das eigene untersucht werden kann, nicht zugleich der Konstrukteur der phänomenalen Welt ist, sondern Teil der phänomenalen Welt, selbst ein Konstrukt. Die muß notwendigerweise für alle Gehirne in sämtlichen phänomenalen Welt gelten. Der Konstrukteur der phänomenalen Welt ist nicht in dieser enthalten. Trotz allem muß aus Gründen der logischen Konsistenz eine von unserer je individuellen phänomenalen Welt unabhängige Welt angenommen werden (sie kann als “Realität” bezeichnet werden, um sie von der “Wirklichkeit” zu unterscheiden), in der auf eine uns unbekannte Weise die individuellen phänomenalen Welten entstehen, die jeder von uns als seine Wirklichkeit erfährt (einschließlich seines eigenen Ich). Über das Wesen dieser “Realität” läßt sich nichts aufgrund unmittelbaren Erlebens sagen, sie ist uns erlebnismäßig völlig unzugänglich. Diese Annahme entspricht der eines schwachen ontologischen Realismus, welcher mit dem erkenntnistheoretischen Konstruktivismus kompatibel ist. Hinsichtlich der Existenz einer wissenschaftlichen Wirklichkeit läßt sich sagen, daß eine solche nicht unabhängig von den Individuen existiert, sondern sich immer wieder neu innerhalb der individuellen Wirklichkeit realisiert. Es gibt keine “dritte”, objektive Welt des Wissens. Jeder Teilnehmer am Prozeß der Wissenschaft muß individuell für sich Wissenschaft konstruieren[59].
Die fundamentale Selbstrefentialität kognitiver System besteht keineswegs in einer hermetischen “Abgeschlossenheit” von der Umwelt, sondern darin, daß die Bedeutung aller kognitiven Akte für das Verhalten stets nur an anderen kognitiven Akten und ihren Bedeutungen evaluiert werden können. Eine Evaluation an den “objektiven Gegebenheiten” ist prinzipiell nicht möglich, da den “objektiven Gegebenheiten” gar keine Bedeutung und kein Sinn inhärent ist. Was das kognitiven System an und in sich überprüfen kann, ist die Frage, ob dasjenige, was es jetzt erfährt und tut, im Lichte bisheriger Erfahrung Sinn macht oder ob es u.U. die Existenz beeinträchtigt.
6. Sprache und “Wirklichkeit”
Innerhalb der sprachphilosophischen Grundlagendiskussion spielt der semantische Realismus, in Anlehnung an Kutscheras Unterscheidung vom ontologischen Realismus, eine entscheidende Rolle. Je nach Wahl einer bestimmten Form des semantischen Realismus oder Antirealismus ergeben sich daraus folgend andere Konsequenzen für die Sprachtheorie. Es lassen sich hierbei zwei deutlich differente Positionen ausmachen, welche an den Auffassungen von Noam Chomsky , dem Begründer der generativen Grammatik, und René Thom , einem Vertreter der morphodynamischen Sprachtheorie veranschaulicht werden können. Aus heuristischen Gründen, kann Thom als semantischer Realist und Chomsky als semantischer Antirealist angesehen werden.
Wie Kutschera zeigt, ist es möglich, daß ein semantischer Realist zugleich ontologischer Idealist sein kann, da Sprachunabhängigkeit nicht gleichbedeutend damit ist, daß man auf etwas außerhalb des Psychischen Bezug nimmt. Sprache kann als eine psychische Teilfunktion angesehen werden, so daß Außersprachlichem auch immer noch der Status von Psychischem eingeräumt werden kann. Andererseits wird bei der extremen antirealistischen Interpretation der Sprache die Position des onto-logischen Realismus entleert, da man über die angenommene objektive Realität nicht reden könne. Faßt man Kutscheras Bezeichnungsfunktion, welche für die Definition des semantischen Realismus im Zentrum steht, nicht statisch, sondern dynamisch, da sie der Selbstorganisation im Entstehungs-zeitraum unterliegt, auf, so wird der historischen Genese, dem Spracherwerb und dem kreativen Sprachgebrauch Rechnung getragen.
Eine Skalierung des semantischen Realismus könnte wie folgt aussehen, wobei die Extremwert SR0 und SR5 jeweils den semantischen Antirealismus und den semantischen Hyperrealismus bezeichnen:
- SR1: die Bezeichnungsfunktion ist nicht mehr durch die Konventionen einer spezifischen Sprache restriktiv begrenzt, sondern durch die Form aller Sprachen, d.h. durch eine universale Grammatik, welche diesen zugrunde liegt. Jenseits dieser Grenze ist die Bezeichnungsfunktion leer, die Wahrheit der Sätze neutral (unbestimmt). Semantisch objektiv heißt somit bezeichnungs- bzw.- wahrheitsfähig im Rahmen einer Universalgrammatik.
- SR2: Die Existenz einer Universalgrammatik wird in Frage gestellt. Vielmehr wird die Bezeichnungsfunktion auf umfassendere (menschliche) kognitive Fähigkeiten gestützt, welche wiederum eine artspezifische Begrenzung darstellt, die ihrerseits auch die Grenze jeder möglichen Bezeichnungsfunktion festlegt. Semantisch objektiv heißt in diesem Kontext wahrheitsfähig im Rahmen der kognitiven Fähigkeiten des Menschen.
- SR3: Die Körperlichkeit des Menschen, insbesondere die psycho-physische Grenzlinie zwischen Körper und Umwelt, determiniert die Art und Weise, wie sich Sprache auf die Welt bezieht. Die Strukturen dieser Zonen (der Umwelt in der Reichweite des Körpers, der Sinnesorgane und des motorischen Handlungsraumes) definieren den Bezeichnungsraum des Menschen, welcher instrumentell erweitert werden kann (durch die Benutzung von Werkzeugen in der Motorik, Sensorik, usf.). Da deren effektive Kontrolle einer natürlichen körperzentrierten Metrik unterliegen, ergibt sich eine neue (wenn auch historisch langsam veränderbare) Grenze der Bezeichnungsfunktion des im Bezeichnen zuverlässig Erreichbaren. Semantisch objektiv bedeutet wahrheitsfähig im Rahmen der stabilen Körper(Geist)-Umwelt Beziehung des Menschen.
- SR4: Die Körperlichkeit des Menschen, ebenso wie seine Umwelt, sind in einer evolutionären Dimension variabel. Postuliert man nun ein evolutionäres Gedächtnis, d.h. daß in der körperlichen und sprachlichen Organisation Anpassungen an frühere Evolutionsstadien gespeichert und teilweise konserviert werden, so ist der Körper/Geist an einem bestimmten Punkt der Evolution auf eine ganze Klasse von Körper/Umwelt-Korrelationen beziehbar, von denen jeweils nur ein geringer Bruchteil benutzt wird. “Der prinzipielle Bezeichnungsraum umfaßt dann aber einen weit über das in jeweiligen Gesellschaften realisierte Inventar hinaus. In der Projektion eines den göttlichen Maßstab anpeilenden (geistig noch nicht entfalteten) Menschen wird der Rand der Skala, das Zusammenfallen von Sprache und kosmologisch umfassender (göttlicher) Erkenntnis sichtbar. Diese letzte Begrenzung spielte in der erkenntnistheoretischen Diskussion von Descartes und Leibniz eine konstitutive Rolle”[60]. Semantisch objektiv bedeutet also bezeichnungs- oder wahrheitsfähig im evolutionären Rahmen unserer Gattung.
In dem Ausmaß, wie die entsprechenden Wissenschaften (Allgemeine Grammatik, kognitive Psychologie des Menschen, Neurophysiologie und Evolutionstheorie des Menschen) etwas über den Menschen und seine Umweltbeziehung ontologisch objektiv auszusagen imstande (also objektiv realistisch) sind, sind infolge auch die Stufen des semantischen Realismus ontologisch objektiv. Im entgegengesetzten Fall, daß nur konventionelle Konstrukte vorliegen, ist die Unterscheidung von Stufen des semantischen Realismus ebenfalls nur eine Konstruktion. Und da aus dieser konstrukti-vistischen Perspektive auch die Sprache nur ein Konstrukt ist, kann die ganz Argumentation in einen konstruktivistischen Dialog übertragen werden, wobei dann die interne Kohärenz, z.B. der evolutions-theoretischen Konstrukte, als Entscheidungskriterien für einen semantischen Realismus auf der Stufe SR4 dienen könnte.
Noam Chomskys Position kann als ein semantischer Realismus der ersten Stufe angesehen werden. Durch die Parallelisierung von Linguistik und Physik, ergibt sich eine ontologisch realistische Interpretation, wobei über die Hypothese einer generellen Unterbestimmtheit physikalischer Theorien dieser Realismus eine theorienskeptische Konnotation erhält, d.h. die Sprachkompetenz selbst wird als ein reales, sehr gesetzmäßiges “Wirkliches” angesehen, während Theorien aber nur holistisch bewertbar und deshalb im technischen Detail neutral hinsichtlich der Realitätsproblematik sind.
René Thom hingegen versucht evolutionäre, morphogenetische und sogar physikalische Gesetz-mäßigkeiten als erklärungsnotwendige Bestandteile für sprachliches Bezeichnen einzuführen. “Die anwendbare, d.h. in der Anwendung bewährte Mathematik hat eine >>kritische semantische Masse<< und impliziert in einer sehr generellen Form Beobachtbares, ist also in diesem Sinne nicht rein analytisch (konventionell). Die dynamische Sprachtheorie nützt die semantische Masse der dynamischen System- und Stabilitätstheorie für Aussagen über die Wirklichkeit (gemeint ist Realität, Anm. d. Verf.). In dieser Hinsicht ist sie semantisch realer als eine Modellbildung, die nur metamathe-matische Axiomatisierung als Hintergrund nützt” (ebd.; 146).
Im Gegensatz zum semantischen Antirealismus führt der semantische Realismus zu einer Aufhebung disziplinärer Begrenzungen in der Bedeutungsproblematik, welche an Denkformen, an die menschliche Erfahrung, an die psycho-physisch relevante Umwelt und an seine Evolution gebunden ist. Durch den erweiterten Bedeutungsbegriff Thoms wird die Frage des ontologischen Realismus Kutscheras dem des semantischen Realismus untergeordnet. Wildgen zufolge, könnte die Realismus-debatte methodologisch zielstrebiger geführt werden, “wenn sie vom semantischen Realismus/ Antirealismus ausgeht und über die Problematik der wissenschaftlichen Methologie jene der Ontologie angeht, statt umgekehrt” (ibid.; S. 141).
7. “Wirklichkeit” und “Wissen” in der Philosophie des Geistes
Wissen bezeichnet einen Erkenntnisstand allgemeiner intersubjektiv-vermittelter Sicherheit hinsichtlich der Kenntnis einzelner Gegenstände oder prozessualer Vorgänge. Es wird abgegrenzt von Erfahrung, Erkenntnis, Gewißheit, Empfinden, Meinen und Glauben. Nach Aristoteles besteht Wissen in den, in Wissenschaften zusammengefaßten Kenntnissen. Der Erwerb von Wissen basiert auf der in “höherem Grade” bestehenden Kenntnis der Prinzipien und dem größeren Glauben an die Prinzipien als an das zu Beweisende selbst. Gegenstandswissen haben wir durch diesen “Besitz des allgemeinen und des besonderen Wissens” oder direkt durch Wahrnehmung als “aktuelles, wirkliches Wissen”. Sitz aller dieser Denkformen ist die Denkseele, ein Teil der Seele, welche die Fähigkeit besitzt, die Formen aufzunehmen. Im Gegensatz zu Aristoteles Wissensdefinition qua analytischer Beweisverfahren, wird in der Platonischen Philosophie die Teilhabe der erkennenden Seele an der Idee als Wissen bezeichnet. Im Liniengleichnis werden nous (intellectus) und sophia (sapientia) als höchste Formen des Wissens dem Meinen und Glauben übergeordnet. Dem Neuplatonismus nach beruht Wissen auf der Parti-zipation der Individual-Seele an einer allgemeinen Intellektual-Seele. Proclus zufolge ist jede Seele eine lebendige und wissende Substanz, ein substantielles und wissendes Prinzip des Lebens und ein Prinzip des Wissens als eine Substanz und ein Lebensprinzip. Alle drei Bestimmungen existieren in allen und für sich in der Seele. Im Mittelalter wurde Wissen als die Darlegung der Ordnung der Dinge verstanden. Dem neuplatonischen Erkenntniskonzept G. Brunos in der Renaissance nach, beruht Wissen auf einer Erkenntnishierarchie: nach der Wahrnehmung übersetzt der diskursive Verstand (ratio) die einzelnen im Gedächtnis gespeicherten Dinge in ein Allgemeines und ordnet sie in einer logischen Aufeinanderfolge durch analytische Beweisführung. Die Vernunft (intellectus) nimmt durch eine Intuition in einer inneren Anschauung die Ergebnisse des Verstandes auf, bis schließlich der Geist (mens) die vorherigen Ebenen miteinander identifiziert und unmittelbar alle Formen und Gestalten ohne logisch-diskursives Denken erfaßt. Das Denken findet sich nur auf dieser höchsten Stufe wieder. In der französischen Aufklärung wird Wissen als sicherer Schluß aus Vernunftgründen interpretiert, der den Status von mehr als nur Wahrscheinlichkeit besitzt. Wissen bezeichnet eine zuverlässige und bewiesene Kenntnis. Unkenntnis setzt eine Idee von der Sache voraus, ohne daß ein angemessenes Urteil gebildet werden könnte. Den Status bzw. Grad des Fürhwahrhaltens sieht Kant als Kriterium für Meinen, Glauben und Wissen. Schließlich thematisiert Hegel das reine Wissen, dessen Gegenstand das in seiner Vielfalt zu bestimmende Wissen selbst ist (absolutes Wissen). Hegel gilt das System der Wissenschaften als eine Darstellung des reinen Wissens. In einem schwächeren Sinne ist heute auch in der Künstlichen Intelligenz die Rede von Wissen als Expertensystem.
7.1. Zur Realität intentionaler Zustände
Quine zufolge unterscheiden sich ontologische Annahmen in ihren Status nicht von anderen wissenschaftlichen Annahmen, sie besitzen synthetischen Charakter. Dies gilt für die Annahme der Existenz von Steinen, Bäumen und Tieren, wie für die Annahme der Existenz von Protonen, Elektronen und Neutrinos und die der Existenz von Klassen und Eigenschaften, ebenso wie für die Annahme der Existenz der homerischen Götter Zeus, Hera und Poseidon. Vom epistemologischen Standpunkt unterscheiden sich physikalische Gegenstände und Homers Götter nur dem Grad, nicht aber der Art nach. Dasselbe gilt für das ontologischen Postulat, wenn Gegenstände auf der Ebene der Atome und Elementarteilchen, das Verhalten makroskopischer Gegenstände erklären sollen. Selbst die abstrakten Gegenstände der Mathematik (Klassen und Klassen von Klassen) befinden sich erkenntnis-theoretisch auf einer Stufe mit den physikalischen Gegenständen und den homerischen Göttern. Je größer der erklärende Wert einer ontologischen Annahme ist, um so stärker ist sie in unserem Überzeugungssystem verankert. Da dies für alle wissenschaftlichen Aussagen gilt, unterscheiden sich ontologische Annahmen in ihrem erkenntnistheoretischen Status nicht von anderen wissenschaftlichen Hypothesen.
Dieser Argumentation verpflichtet ist die intentionale Alltagspsychologie, deren prognostischer und explanatorischer Erfolg in der Nützlichkeit (und möglicherweise sogar Unentbehrlichkeit) hinsichtlich der Erklärung und Prognose menschlichen Verhaltens begründet liegt. Hierbei werden jedoch die zugrundeliegenden intentionalen Zustände von verschiedenen Autoren nicht im strengen Sinne als real angesehen, sondern lediglich als theoretische Konstrukte (abstracta). Dennett beispielsweise geht bei der Entwicklung seiner Theorie intentionaler Systeme von der Grundthese aus, daß man bei der Erklärung des Verhaltens komplexer Systeme drei fundamental verschiedene Einstellungen einnehmen kann:
In der physikalischen Einstellung wird das Verhalten eines Systems erklärt, indem man sich klarmacht, aus welchen physikalischen Komponenten das System besteht, wie diese Komponenten aufgrund der für sie geltenden physikalischen Naturgesetze interagieren und welches Systemverhalten aus diesen Interaktionen resultiert.
In funktionaler Einstellung wird überlegt, welche funktionalen Bestandteile das System enthält und welches Systemverhalten sich ergibt, wenn alle diese Bestandteile so funktionieren, wie sie funktionieren sollen.
In intentionaler Einstellung schließlich erklärt man das Systemverhalten, indem man unterstellt, daß es über bestimmte Informationen verfügt (bestimmte Überzeugungen hat), daß es bestimmte Ziele verfolgt und daß es sich angesichts dieser Informationen und Ziele adäquat rational verhält, d.h. das tut, was unter der Voraussetzung, daß die Informationen zutreffen, tatsächlich zur Realisierung seiner Ziele führt. Die intentionale Einstellung ist durch eine bestimmte Art der Erklärung von Verhalten charakterisiert und nicht durch den Typ des Verhaltens, das erklärt wird.
Verhalten im Sinne von Handeln scheint nur auf der intentionalen Ebene erklärbar zu sein. Dennett übernimmt im Zusammenhang mit der Frage nach der Realität intentionaler Zustände Quines Argumentationsstrategie hinsichtlich seiner Reflexionen zur Unbestimmtheitsthese, der nach es durchaus möglich ist, daß es verschiedene intentionale Interpretationen einer Person geben kann, die mit allen Verhaltensdispositionen dieser Person gleich gut in Einklang stehen. Dennetts Ablehnung des Status uneingeschränkter Realität von intentionalen Zuständen liegt in seiner Unterscheidung von externen und internen Verhaltenserklärungen begründet. Jedem theoretisch-funktionalem Zustand, der zur Erklärung des Verhaltens eines Systems postuliert wird, muß ein struktureller Zustand im inneren des Systems entsprechen. Dies setzte eine Rationalitätsannahme bei der Zuschreibung intentionaler Zustände voraus, dem kein physisches System a priori entsprechen kann[61]. Als Bedingungen für einen intentionalen Realismus formuliert Dennett folgende drei Kriterien:
1. Die Prinzipien der intentionalen Alltagspsychologie müßten sich so präzise formulieren lassen wie die Prinzipien der Arithmetik, welche das Verhalten von Menschen und höheren Säugetieren ebenso gut beschreiben, wie die Gesetze der Arithmetik das Verhalten von Taschenrechnern. Vulgo: die Prinzipien der internationalen Alltagspsychologie müßten eine adäquate Deskription auf computionaler Ebene liefern.
2. Es müßte veranschaulicht werden, daß es beim Rekurs von der computionalen auf die algorithmische Ebene nicht nötig ist, das Begriffssystem fundamental zu wechseln. Die Zustände, welche die Ausgangs- und Endpunkte der angenommenen Algorithmen bilden, müßten zumindest eine starke Affinität zu den auf der computionalen Ebene angenommen Zuständen aufweisen.
3. Die angenommenen Algorithmen müßten sich in natürlicher Weise auf die neuronale “Hardware” abbilden lassen, d.h. die im Gehirn stattfindenden neuralen Prozesse müßten sich zwanglos als Implementierung dieser Algorithmen interpretieren lassen.
Entscheidend ist hierbei die Frage, ob empirisch plausibel gemacht werden kann, daß es eine genaue Entsprechung zwischen den von der Alltagspsychologie angenommenen intentionalen Zuständen und den physischen Zuständen in den internen Mechanismen der jeweiligen Systeme gibt. Dennett vertritt innerhalb dieses Diskurses den Standpunkt, daß die neurobiologischen Strukturen nicht zu dem Begriffssystem passen, mit dem wir Verhalten klassifizieren, wenn wir es intentional erklären: Verhalten als Handeln ist neurobiologisch nicht erklärbar.
7.2. Epistemologischer Realismus und die Wirklichkeit des Wissens
Die Frage nach der Beziehung von Realität und Wissen wirft unweigerlich folgendes Problem auf: wer den Dualismus von Geist und Natur, Bewußtsein und Sein, vermeiden will, nimmt in der Regel Zuflucht zu einem Monismus; der Monismus wiederum muß entweder eines der beiden Elemente (Geist oder Natur) eliminieren (eliminativer Identismus) oder aber eines auf das andere reduzieren (Reduktionismus). Der entscheidende Antagonismus ist der zwischen Reduktionismus und Pluralismus, wobei einzig der Pluralismus der möglichen Welten den Diskreta der Realität in ihren denkmöglichen Einheiten Rechnung trägt.
Anstelle der Frage danach, wie die physikalische Welt bzw. Momente einer bewußtseinsunab-hängigen Welt in unser Gehirn oder Bewußtseins kommen, müßte die Frage gestellt werden, wie unser Geist das konstituiert, was für uns die Bedeutung “Realität” besitzt. H. J. Sandkühler zufolge sind Erkenntnis und Wissen >>Übersetzungen von Formen des Bewußtseins in sprachlich verfaßtes und in Weltbildsemantiken durch Bedeutung geformtes “Sein” und nicht umgekehrt. Die Wirklichkeit des Wissens wird in jene “Realität” transformiert, welche in unserem Bewußtsein als die “objektive Wirklichkeit” in phänomenalen und intentionalen Zuständen erscheint<<[62]. Diese These geht davon aus, daß jede Begründung für die Existenzannahme einer (wie auch immer gearteten) bewußtseinsun-abhängigen Realität, bereits bewußtseinsabhängig ist. Somit ist auch jede These eines metaphysischen Realismus selbstwiderlegend: der Begriff einer Realität, welcher nur artikuliert werden kann, indem er ex negativo durch sein Anderes definiert wird, kann keine Unabhängigkeitshypothese enthalten. In Anlehnung an die Naturphilosophie Schellings könnte gesagt werden, daß theoretisches Denken (Kunst, Philosophie, Wissenschaft) evolutionär als die gattungsspezifische Weise ausgebildet wurde, in welcher Menschen Wirklichkeit konstituieren, in Form vereinheitlichender welt bildender Kategorien und Theorien, semantischer Universa, Weltbildsemantiken, in einer dritten Welt des objektiven Wissens. Die Begriffe Vernunft und Geist gehören zum philosophischen Weltbild und zur philosophischen Selbstbeschreibung der conditio humana, sie sind nicht eliminierbar. In ihnen verhalten wir uns zur Gattungsgeschichte des Wissens. Der Reduktionismus als theoriegeladene Theorie kann den Geist weder reduzieren noch eliminieren. Indem er Referenz repräsentationalistisch definiert, übersieht der die wirklichkeitskonstituierenden Leistungen des Verstandes, wie sie keineswegs erst durch den neuzeitlichen Rationalismus, sondern bereits mit dem “Zwei-Säulen-Modell” (keine Erfahrung ohne Verstandesübersetzung) des Empirismus bekannt sein sollte. Es soll hierbei nicht bestritten werden, daß notwendige objektive (externe) Bedingungen der Möglichkeit von Erkennen und Wissen empirisch benannt werden können, wichtig sind jedoch ebenfalls hinreichende (transzendentale) Bedingungen der Möglichkeit (interner) mentaler intentionaler Zustände und Prozesse. Diese aufzuzeigen, so Sandkühler, sind empirische und naturalistische philosophische Konzeptionen wie der dialektische oder wissenschaftliche Materialismus nicht in der Lage. Der scientific materialism ist im strengeren Sinne ontologisch und epistemologisch monistisch und identisch, indem das Leib-Seele-Problem aufgelöst wird durch die Gleichsetzung mentaler mit physischen Phänomenen. Der radikale eliminative Materialismus versucht selbst die letzten Bindungen an rationalistische philosophische Traditionen zu sprengen, indem er noch das im Begriff der Identität anerkannte Problem des Entitäten- Unterschieds zwischen Mentalem und Physischem eliminiert. Obwohl die Neurobiologie, der zufolge hirnphysiologische Prozesse rekurrent und selbstreferentiell sind, den emergentistischen Materialismus stützt, ist sie ungenügend bei der Beantwortung der Frage, was Geist ist. Wissenschaftsphilosophisch fundamental und folgenreich ist der Einwand, daß Theorien über Identität, Konvergenz oder Kovarianz von mentalen und neuronalen Zuständen eben selbst keine neuronalen Zustände sind, sondern spezifische Leistungen des wissenschaftlichen Geistes. Hierbei stellt sich nun die Frage, ob die Probleme der Philosophie des Geistes naturalisierbar sind, oder nicht[63]. Der epistemologische Realismus ist ein nicht metaphysischer und folgt nicht aus einer Ontologie der Repräsentation (analog Abbild-Theorie), sondern zieht als Philosophie des Geistes eine epistemologisch transformierte Theorie ideeller Entitäten, eine Onto-Epistemologie nach sich. Er steht in der Tradition des rationalen Empirismus, ergo der Theorie verstandesinterpretierter Erfahrung und deduktiv normierter Induktion. Zum basalen Kern dieser epistemologischen Tradition gehört die Einsicht in die Theoriegeladenheit aller Erfahrung und der Konstitution von Daten der “äußeren” Welt, von “Tatsachen”, als res facti (Kant); d.h. als der Natur des Geistes entsprechende Transformationen von Sinnesdaten in solche der Anschauung. Ein weiteres für Kants empirischen Realismus konstitutives Element ist die Sicherung der Erfahrungssynthesis und des Wissens durch die apriorische Verfaßtheit der Natur des Geistes[64]. “Gleichwohl kommt ein interner Realismus nicht umhin, die dem Kantischen Apriorismus uneingestandene unterlegte Onto-logie natürlicher Eigenschaften des Geistes in die Transformation der Transzendentalphilosophie mit einzubeziehen: Wie die Kritik der praktischen Vernunft sich bestimmter Ideen als Postulate bedient, die aus Gründen der Konsistenz der Ethik unverzichtbar sind, so werden nun aus Apriori Postulate, die zur Begründung von Epistemologie unverzichtbar sind; sie laden die Epistemologie nicht mehr ontologisch auf, sondern sind Momente der Theoriegeladenheit der Theorie der Erkenntnis und des Wissens” (a.a.O.; 195f.).
Die Gaston Bachelard verdankte >epistemologische Revolution<[65] vermittelt einen rationalen Empirismus und Prinzipien von Kants Transzendentalphilosophie. Diese “rationalistische”, Kantische und zugleich anticartesianische Empirizismus-Kritik gründet in einem nicht-metaphysischen Realismus. Im Gegensatz zu Tendenzen der analytischen Philosophie ist die Epistémologie, in der Genealogie eines epistemologischen Realismus, nicht naturalisierend in Fragen hinsichtlich der Philosophie des Geistes. Die Hauptthese der von C. van Fraassens vertretenen antirealistischen Position des constructive empiricism besagt, daß wissenschaftliche Tätigkeit nicht Entdeckung, sondern Konstruktion von Entitäten sei, deren objektive Existenz der wissenschaftliche Realismus lediglich postuliere, empirisch aber nicht beweise. Theorien seien nicht nur als Instrumente zur Ordnung der Phänomene zu verstehen, sondern sie handeln von etwas, freilich nicht von einer Natur an sich, sondern – in semantischer Wendung – von Modellen, die darüber entscheiden, was für uns beobachtbar ist. Jedes Modell besitzt eine theoretische und eine empirische Dimension, die sich strukturgleich zu beobachtbaren Gegenständen verhält und eine Isomorphie mit Phänomenen, Gegenständen der phänomenalen Welt impliziert. Der nicht beobachtbare Anteil der Modelle läßt eine adäquationstheoretisch zu interpretierende Empirie nicht zu: das Modell verursacht eine Passung der Phänomene.
Putnams interner Realismus wendet sich gegen jegliche Abbild-Theorie der Wahrheit; die positivistische Annahme, daß wissenschaftliche Welt aus Sinnesdaten aufgebaut ist; gegen die These des Konstruktivismus, daß der Geist die Welt erschafft und gegen den metaphysischen Realismus als Externalismus. Er plädiert für eine internalistische Perspektive, für die Auffassung, daß die Frage nach den Gegenständen, aus denen die Welt besteht, nur im Rahmen einer Theorie bzw. einer Beschreibung sinnvoll ist, daß rationale Akzeptierbarkeit das einzige Kriterium dafür ist, was eine Tatsache ist und entsprechend Werttatsachen zugelassen werden müssen. “Ein Zeichen, das von einer bestimmten Gemeinschaft von Zeichenbenutzern auf bestimmte Weise verwendet wird, kann innerhalb des Begriffsschemas dieser Zeichenbenutzer bestimmten Gegenständen entsprechen. Unabhängig vom Begriffsschemata existieren keine >>Gegenstände<<. Wir spalten die Welt in Gegenstände auf, indem wir dieses oder jenes Beschreibungsschema einführen. Da die Gegenstände und die Zeichen gleichermaßen interne Elemente des Beschreibungsschemas sind, ist es möglich, anzugeben, was dem entspricht”[66]. Daraus resultiert eine Objektivität und eine Rationalität nach Menschenmaß, was in Anlehnung an (einen historisierten und sprach- und bedeutungstheoretisch revidierten) Kant (ohne “Ding-an-sich” und ohne transzendentales Subjekt) bedeutet: “Eine Erkenntnis (d.h. eine >>wahre Aussage<<) ist eine Aussage, die ein rationales Wesen akzeptieren würde, sofern es über hinlängliche Erfahrung der Art verfügt, wie sie für Wesen mit unserer Natur tatsächlich möglich ist. >>Wahrheit<< in jedem anderen Sinne ist uns unzugänglich und unbegreiflich . Wahrheit ist die letztliche Güte des Zusammenpassens”[67].
7.2.1. “Intellectus effabilis”
Die Ambiguität der modernen Epistemologie und neurobiologischen Ansätze hinsichtlich einer repräsentationalistischen und einer konstruktivistischen Deutung des menschlichen intellektuellen Vermögens kann bis in die Binnendifferenzierung der aristotelischen anima intellectiva zurückverfolgt werden, welche, analog der Unterscheidung zwischen sensitiver und intellektiver Seele, in den rezeptiven Intellekt und den tätigen Intellekt, der alles bewirkt, unterteilt ist. Aufgrund der Anforder-ungen an die Wissenschaftlichkeit der episteme sind sie für Aristoteles mit einer Metaphysik-Konzeption verknüpft, da nur das von der Akzidentalität des materiellen Seins Abtrennbare zu wahr-heitsfähigen Aussagen befähigt ist. Selbst der frühneuzeitliche Rationalismus, der die Selbstgewißheit der intellectio pura mit dem cartesischen cogito-Argument absicherte, bleibt noch auf die meta-physische Annahme eines göttlichen Intellekts angewiesen, da das cogito-Argument erfordert, daß Denkakt und Denkinhalte voneinander separiert werden, so daß die für wahrheitsfähige Rede erforder-lichen (konstanten) konzeptuellen Schemata (die klaren und distinkten Ideen und logischen Formen) von außen (der mens divina) als eingeborene Ideen gegeben sein müssen. Der frühneuzeitliche Empirismus, welcher den metaphysisch -aprioristischen Innatismus beerdigt (z.B. Locke), gibt dafür im Gegenzuge das klassische Wissenschaftsideal auf und zieht sich in seiner Wissenschaftskonzeption auf induktiv gewonnene, hypothetische Explantationen zurück. Erst Kants transzendental-aprioristischer Ansatz vollzieht die Entkopplung von Epistemologie und Metaphysik und die Abtrennung der empirischen Psychologie von der transzendental-philosophischen Epistemologie. Er enthält sich jeglichen Fragen nach der Korrelation von philosophischen und möglichen empirischen Zugängen zur Theorie des Geistes, da er die für das rationalistische Wissenschaftsideal erforderte Apriorität der mentalen Vorgänge unangetastet lassen will. Er versucht sich der Zirkularität zu entziehen, daß jeder Versuch einer empirischen Erklärung apriorischer Strukturen diese selbst immer schon zur Voraussetzung hat. Konstitutiv für seine Epistemologie bleibt also die Abgrenzung des transzendentalen gegenüber dem empirischen Subjekt, eine Konsequenz, die wohl vor allem Husserl später in ihrer vollen Tragweite anerkannte und weiter fruchtbar zu machen versucht hat.
Es bleibt nun die Frage, ob nicht Argumente im Anschluß an eine Modifikation der Kantischen Setzung des transzendentalen Subjekts möglich sind, so daß mentale Phänomene als unterschiedene Formen des Seienden (als intellectus effabilis) interpretierbar werden und mithin eine Philosophie des Geistes ihre Funktion behält. Angesichts des Bereichs der reinen Anschauungsformen des Mentalen, den raum-zeitlichen Formen unserer bewußten Wahrnehmung, ist die empirische Kognitionsforschung offensichtlich imstande, Zusammenhänge mit neuronaler Aktivität nachzuweisen. Kants Apriori der Anschauung erfährt dadurch (paradoxerweise) eine Fundierung, weil sich gleichzeitig die These von der Konstruktivität und fundamentalen Selbstreferentialität des Wahrnehmungsvorgangs erhärtet. Allerdings ist dies der quantitativ und qualitativ begrenzte Bereich des Mentalen, der mit dem koinzidiert, was wir das für uns Beobachtbare nennen (müssen). Der mentale Bereich der reinen Verstandesfunktionen (den logischen Urteilsformen und konzeptuellen Schemata) scheint, anders als Kant dies annahm, nicht wie das Apriori der Anschauung auf eine statische “Art und Zahl” von logischen und kategorialen Formen beschränkt zu sein. Die Elemente unseres reinen Verstandes-vermögens unterliegen vielmehr einer Dynamik mit der Folge, daß die produktive Einbildungskraft, die Kant erst auf der Ebene der figürlichen Vorstellungen (der cartesianischen imaginatio) als synthesis speciosa ansetzt, bereits auf der Ebene des logischen Subjekts, d.h. der synthesis intellectualis anzusiedeln wäre, deren Produktivität als uneingeschränkt (d.h. nicht mehr gebunden an einen bestimmten, fixen Bestand von logischen Formen und kategorialen Schemata) anzusehen ist. Dabei muß die Produktivität der synthesis intellectualis als a priori, ihre Produkte hingegen immer als historisch betrachtet werden.
Auch wenn man den anschauenden und auf Beobachtbares fixierten Komponenten unseres Intellekts eine Korrelation mit neuronaler Aktivität eingestehen muß, so muß im Gegenzug dem tätigen (menschlichen) Intellekts, aufgrund seiner nicht eingrenzbaren Produktivität, eine von neurophysio-logischen Prozessen unterschiedene Seinsform zugebilligt werden. Das von den Neurobiologen untersuchte empirische Subjekt ist eben nicht identisch mit dem logischen Subjekt, welches nicht im gleichen Sinne individuiert ist und von dem er, als über das empirische Subjekt Aussagen und Theorien bildender Wissenschaftler, selbst ein Teil ist[68].
Philosophiehistorisch kann im Grunde die gesamte nachkantische Entwicklung im deutschen Idealismus als philosophische Fundierung der apriori-Setzung einer produktiven synthesis intellectualis oder eines intellectus effabilis (welche selbst kein apriorisches ist, sondern auf der faktischen Wissenschaftsdynamik beruht) angesehen werden: Fichte leitet das apriorische Vermögen zur Synthesis mittels dreier Grundsätze ab (um den Vorwurf des logischen Zirkels zu entgehen), welche die Begründung dieser logischen Grundsätze (der Identität, des Gegensatzes und des Grundes) mit einschließt, wobei die Identitätsrelation selbst aus einer empirisch (nicht beweisbaren) Tathandlung, dem sich im Selbstbewußtsein selbst setzenden Ich, entspringen muß. Während Fichtes Identitätssystem noch auf einem konsenstheoretischen Erfahrungsargument beruhte, versuchte Schelling dieses weiterzuentwickeln und ohne Rekurs auf eine empirische Basis zu fundieren. Indem er mit seinem Begriff von absoluter Identität die tautologische, analytische (A=A) und die informative, synthetische (A=B) Identität als Relata einer Grundstruktur ausweist, kann er zeigen, inwiefern das Fichtesche absolute Ich notwendigerweise ein unendlich produzierendes ist. Mit seinem “Real-Idealismus” ist er in der Lage, sowohl die identische wie auch die repräsentationalistische Interpretation des menschlichen Geistes zu vermeiden, so daß das seiner selbst bewußtes Subjekt nicht blindes, sondern vielmehr unendliches Selbstsetzen ist. Hegel schließlich transformiert Schellings Theorie der absoluten Identität in ein Konzept einer sich als die logische (das Logisch-Reelle) zur absoluten bestimmenden Idee, welche als solche erst zum Substanz/Subjekt aller ihrer Gestaltungen in Natur und endlichem Geist wird. Der Begriff des absoluten Geistes bleibt hierbei allerdings ambivalent, solange man ihn nicht derart interpretiert, als daß er nichts anderes meint als die Produktivität des endlichen Geistes, sich auf unendliche Weise fortzubestimmen. Hegel benutzt durchaus ähnliche Wendungen, wie die des “absoluten Wissens” und “absolutes Erkennen”. Ob aber damit Hegel nicht in modifizierter Form wiederum die Richtung einer Anbindung der Theorie des menschlichen Geistes an eine Metaphysik des einen logos einschlägt, bleibt eine schwer zu entscheidende Frage.
7.2.2. Wissen als anthropologisches Datum
Die Grundhypothese des dialektischen Materialismus besteht darin, daß die “Welt” als menschliche Wirklichkeit die Summe einer Vielfalt menschlicher Lebenstätigkeiten (>>sinnlich-gegenständlicher Praxis<<) ist, an denen Bewußtsein/Sprache/Erkenntnis/Wissen beteiligt sind, welche aber nicht auf diese reduzierbar sind. Diese Tätigkeiten erfolgen immer im Rahmen einer bereits durch menschliches Handeln geformten Wirklichkeit (Gesellschaft), die ihrerseits auf einer Naturgrundlage beruht. Diese ist als materieller Seinsgrund für die Menschen nicht hintergehbar. Die Realität der ‚Natur‘ ist der Existenz nach von uns und unserem Bewußtsein unabhängig, und weist Strukturen und Beschaffen-heiten auf, welche bewußtseinstranszendenter Art sind. Zumindest Ausschnitte dieser Realitäts-strukturen sind unserem Erkennen zugänglich und werden in unserem Wissen erfaßt. Die Realität der ‚ Gesellschaft/Kultur ‘ ist independent von dem je gegebenen empirischen Bewußtseins eines Subjekts, einer Gruppe oder Epoche in der Geschichte der Menschheit und weist entsprechende Strukturen und Beschaffenheiten auf. Da wir (als ‚Gattung‘ der ‚Menschheit‘) diese Wirklichkeit selbst sind, stehen wir als empirische Subjekte zu dem, was wir als diese Subjekte nicht sind, (so zu unserer geschichtlichen Vergangenheit) in einem Selbstverhältnis. Dem je individuellen Erkennen sind nennenswerte Teile der Ganzheit ‚Gesellschaft/Kultur‘ zugänglich und werden in dessen Wissen erfaßt.
In dem Rahmen solcher erkenntnistheoretisch-ontologischer Voraussetzungen muß die Frage nach “Wissen” neu formuliert werden. Nicht der Charakter von Wissen als Szientifisch-Epistemologisches (d.h. rein Wissenschaftstheoretisches), sondern in einem ontologischen oder anthropologischen Sinn ist ausschlaggebend. Wissen ist ein anthropologisches Datum und konstituiert menschliches Sein auf allen Stufen seiner Geschichte, es ist in diesem Sinne ein Existenzial. Im ontologischen Sinne impliziert ‚Wissen‘ vor- und außerwissenschaftliche Wissensformen. Einer elementaren Epistemologie zufolge, ist Wissen gleichbedeutend mit auf Erfahrung beruhender, in Rede oder Bild artikulierter richtiger Einsicht. Sie fragt nach dem anthropologischen Wissensbegriff und den verschiedenen Formen des Wissens. Eine solche Epistemologie, wenn sie adäquat entfaltet ist, wäre Teil einer Ontologie des gesellschaftlichen Seins, welche der Epistemologie voranginge (zumindest im Sinne eines Begründungszusammenhangs). Eine elementare Epistemologie in dem hier beabsichtigten Sinne erfordert einen die normative Orientierung am wissenschaftlichen Wissen – sowie der diesem zugrunde liegenden Norm szientifischer Rationalität – transzendierenden Wissens- und Rationalitäts-begriff. Als Voraussetzung bedürfte es einer Theorie der Wissensarten, welche sich von einem normativen Begriff des wissenschaftlichen Wissens als - ‚höchster Form des Wissen‘ – löst, und es statt dessen als Modus des Wissens mit bestimmten Funktionen begreift. Wissen im (weiten) Sinne von Episteme bezieht sich auf das Ganze von Akten und Resultaten der Kognition, gleichzeitig aber auch auf Geschicklichkeit im Sinne praktischer Fertigkeiten, d.h. die Fähigkeit, konzeptiv und teleologisch handeln zu können. Erst auf bestimmten Stufen des Wissens treten Können und Wissen als Einheit auseinander. Im lebenspraktischen Kontext gehört zu jedem Wissen ein Können, im Sinne eines instrumentellen Gebrauchens und Bestimmens von Zielen und Zwecken. In der elementaren Differenzierung zwischen instrumentellem und teleologischem Wissen betrifft teleologisches Wissen die Zwecksetzung von Handlungen, instrumentelles Wissen den Einsatz von Mitteln zum Erreichen von Zwecken in Handlungen (klassisches Paradigma dafür ist die menschliche Arbeit). In diesem Sinne ist Wissen ein anthropologisches Datum (Existenzial), gehört zur fundamentalen Verfassung menschlichem In-der-Welt-Seins und ist Bedingung des Überlebens. Diese epistemischen Grund-orientierungen sind, im Zusammenhang mit den materialen Raum-und-Zeit-Aprioris, für lebens-weltliche Praxis konstitutiv. Sie konstituieren eine elementare Erschlossenheit menschlicher Welt auf allen historischen Stufen. “Auf dem Niveau der Arbeit erhält menschliches Wissen eine inhärente systematische Struktur. Arbeit ist bewußte teleologische Setzung (Lukács). In ihr wird die Unter-scheidung zwischen Gegenstand, Ziel und Mitteln als Teil eines organischen Prozesses ausgebildet. In diesem Sinn ist Arbeit eine primäre Rationalitätsform. In der Arbeit bestimmt das Bewußtsein das Sein. Wissen vergegenständlicht sich in den Produktivkräften. Die Produktivkraftentwicklung selbst ist ein Vorgang der Wissensakkumulation”[69]. Alle historisch auftretenden Wissensformen wie auch die Formen kultureller Objektivation – Mythos, Religion, Kunst, Wissenschaft – basieren auf der Grund-lage eines elementaren lebensweltlichen Wissens und können aus dieser genetisch erklärt werden. Mit der Entstehung der Wissenschaft erhält die menschliche Kultur ein neues Niveau. Trotzdem ist es problematisch von diesem Punkt an menschliches Wissen allein an der epistemischen Form der Wissenschaft zu messen. Die Wissensform der Wissenschaft begründete einen geschichtlichen Ratio-nalitätstypus, welcher erst in der europäischen Kultur und später im globalen Maßstab dominierend wurde. Im Sinne eines erweiterten Wissensbegriffs und einer diesem entsprechenden Theorie der Wissensarten, bedarf es einer Unterscheidung zwischen folgenden (epistemischen) Wissensformen:
1) Lebenspraktisches oder lebensweltliches Wissen, dessen Vergegenständlichungsformen den historisch ausgebildeten und ausdifferenzierten Bereichen der menschlichen Tätigkeit entsprechen.
2) Produktivkräfte als grundlegende Vergegenständlichungsformen von Wissen.
3) Experientielles Wissen, bezogen auf menschliche Grunderfahrungen (elementare Tatsachen menschlicher Welt- und Selbsterfahrung), welches stets epistemischen Charakter besitzt. Im Vollzug lebenspraktischer, experientieller Wissensakte – in der epistemischen Form menschlicher Erfahrung - konstituiert sich Wissen, Bewußtsein, schließlich bewußte Identität (die Subjektform rationaler Wesen). Solche epistemischen experientiellen Formen besitzen die Qualität von “Existentialien”, sie gehören im ontologischen Sinne zur Existenz der Menschen.
4) Mythos und Religion als historisch frühe Formen vergegenständlichter und institutionalisierter Weltverständigung und Sinnorientierung, in denen experientielles Wissen verkörpert, ideologisch organisiert und gedeutet wird.
5) Ästhetische Episteme als das in den Künsten verkörperte und durch sie kommunizierte Wissen, welche neben dem wissenschaftlichen Wissen die am meisten entwickelte und differenzierteste Form menschlichen Wissens darstellt.
6) Theoretisches (wissenschaftliches, begriffliches) Wissen, welches methodisch gewonnen und in begrifflich verallgemeinerter Form artikuliert wird. Sein semantisches Ideal ist die Eindeutigkeit (Klarheit und Deutlichkeit im Sinne von Descartes). Es besitzt “desanthropomorphisierenden (entmenschlichenden) Charakter” (Lukács) auch dort, wo es menschliche Subjektivität zum Gegenstand hat.
7) Kulturelles Wissen rekurriert auf das Totum des Wissensschatzes der Menschheit und umfaßt die Summe existierenden Wissens zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt, und zwar sowohl im Sinne subjektiver Verfügung und Kompetenz als auch im Sinne objektiver Vergegenständlichung in Arbeitstechnologien, Ritualen, Gebräuchen, Erzählungen, in Mythos, Religion, Kunst, Wissen-schaft. Sie können als kulturelle Hauptformen epistemischer Vergegenständlichung bezeichnet werden. Nur über diese Vergegenständlichungen (grundlegend ist hierbei die Artikulation in Sprache und Bildern) ist menschliches Wissen tradierbar. In Mythos, Religion und Künste ist das älteste epistemische Erbe der Menschheit nicht begrifflich, sondern metaphorisch aufbewahrt. Und zwar in einer Weise (Handlung, Erzählung, Bild), die über emotionale Einstimmung und affektiven Nachvollzug hinausgeht und als Wissensform identifizierbar ist.
Epistemische Artikulationen von Wissen besitzen häufig einen symbolischen Charakter und wurden historisch sehr unterschiedlich geäußert. Die Hauptform stellt die sprachliche Artikulation dar, deren Modi sehr vielfältig sind. Dominante Formen sind Narration und Begriff. Narrative Artikulationen liegen oft in Gestalt von erzählten Geschichten, Gleichnissen, Sprichwörtern oder Parabeln vor, während begriffliche Formen den dominanten Artikulationsmodus wissenschaftlichen Wissens darstellen. v isuell-ikonische Artikulationen sind solche in der Form visueller Bilder. Sie bilden den Hauptfundus der ästhetischen Episteme in den bildenden Künsten. Historionische Artikulationen sind mimisch-gestische Vergegenwärtigungen einer Handlung durch (Schau-) Spiel, welche ihre ästhetische Gestalt in der Form des Theaters erhalten. Es kann vermutet werden, daß die wissenschaftlichen Episteme sich aus proto-wissenschaftlichen sprachlich-diskursiven Artikulationen von Wissen entwickelt haben. Ästhetische Episteme hingegen bauen in wesentlichen Teilen auf narrativen, ikonischen und historionischen (auch musikalischen) epistemischen Artikulationen auf.
8. Epilog
In den vorangegangenen Kapiteln war ich bestrebt aufzuzeigen, wie vielfältig und unterschiedlich die in Wissenschaft (und selbstverständlich auch im Alltagshandeln) stillschweigend vorausgesetzten und selten explizierten oder gar hinterfragten Grundannahmen über eine ontologische Realität doch beschaffen sein können[70]. Das Spektrum reicht hierbei von einem naiven Realismus (intentio recta) einerseits, wie er beispielsweise im Alltagshandeln und in einigen unkritischen Naturwissenschaften postuliert wird, sowie einer idealistisch-solipsistischen Identitätsphilosophie andererseits, wie sie unter anderem bei Schelling, Fichte und Hegel herausgelesen werden könnte. Mir ging es unter anderem darum aufzuzeigen, wie notwendig eine Differenzierung zwischen Realität (ontologischer, extra-mentaler oder bewußtseinstranszendenter Entitäten) und Wirklichkeit (bewußtseins- oder erlebnisab-hängiger, bzw. kognitiv generierter Gegenstände), angesichts der fortschreitenden Kognitions- und Hirnforschung, sowie des generellen erkenntnistheoretischen Problems der Bedingungen, Möglich-keiten und Grenzen von Erkenntnis und Wissen, doch ist. Zusammenfassen ließe sich sagen, daß (fast) alle empirischen (wie auch spekulativen) Wissenschaften eine vom erkennenden Subjekt unabhängige (wie auch immer strukturierte) Realität postulieren (müssen), auf welche sie reagieren und über welche sie Aussagen und Prognosen zu treffen bestrebt sind. Jedoch sind sprachlich artikulierte Aussagen über das Wesen der Gegenständen oder der Dinge-an-sich unmöglich, möglich sind lediglich Aussagen darüber, wie sie uns als Erscheinung gegeben sind. Bereits Kant erkannte, daß nicht die Erkenntnis sich nach den Gegenständen richten (daß die klassische Metaphysik an synthetischen Urteilen apriori scheitern) müsse, sondern daß sich die Gegenstände nach unserer Erkenntniskompetenz richten müssen, und somit ein Wechsel vom ontologischen zum mentalistischen Paradigma (gleichsam einer kopernikanischen Wende) nötig sei. Unser Erkenntnisvermögen (Sinne, Verstand, Vernunft) nimmt Sinneseindrücke weder passiv hin, noch spiegelt es schlechthin das wieder, was der Fall oder wesentliches Merkmal eines Falles ist. Im Gegenteil, bei allen Perzeptions-leistungen sind unsere Vernunftvermögen aktiv gestaltend beteiligt, ergo erfahrungskonstituierend. Erfahrung ist also immer (sozial) präformiert bzw. vermittelt. Das gleiche gilt ebenso für die Bedeutungssemantik, welche immer nur als abhängig vom sprachlich-kulturellen Kontext denkbar ist.
Die Pluralität der Auffassungen darüber, wie weit nun unsere Kompetenz und Gültigkeit theoretischer Aussagen über die uns jeweils phänomenal gegebene Welt reicht, ist, wie wir gesehen haben, weit gefächert. Plausibel erscheint mir hierbei die Eingrenzung, daß die einem je konkreten Sachverhalt zugeordnete Bedeutung stets durch den jeweiligen kulturellen und vor allem sprachlich determinierten, für den Interpretanten stets signifikanten, gesellschaftlichen Kontext bedingt ist. Die Analyse von menschlichem Geist, Denken oder ähnlichen mentalen Prozessen ist nicht losgelöst von gesellschaftlichen strukturellen Voraussetzungen denkbar. Allein schon deshalb nicht, da sich die Wissenschaft notwendigerweise der Sprache bedienen muß, um Aussagen und Prognosen über untersuchte Gegebenheiten zu formulieren und somit immer in einem sozial präformierten Kontext agiert. Dies erstreckt sich bis auf Bereiche erkenntnistheoretischer Fragen und der abstrakten geistigen Reflexionen des Einzelnen (Wissenschaftlers), bei denen er sich immer (sub-) symbolhafter (sprachlicher) Zeichen bedienen muß (und auch gar nicht anders kann). Man könnte sagen, daß mit den explikatorischen Mitteln der Wissenschaftstheorie, d.h. den Mitteln des beweisenden Erklärens, die Frage nach der Realität bzw. Nichtrealität empirischer bzw. theoretischer Entitäten nicht beantwortbar ist, da deren Wissenschaftsnormen verhindern, daß die rückbezüglichen konstitutiven Leistungen des Begründens bzw. der Reflexion selbst zum Bestandteil der Theorie gemacht werden. Die einfache Gegenüberstellung von ontischer Realität und Bewußtsein gehört selbst lediglich einer Stufe des Bewußtseins an und ist nicht als Reflexion dessen zu interpretieren, was in unserer Rede über Gegenstände immer schon vorausgesetzt wird, welche niemals Realität als solche, sondern immer nur reflektierte Entitäten betrifft. Explizit in der Rede, welche sich auf den realistischen bzw. nichtrealistischen Status der Entitäten bezieht, sind Transzendentalien wie “Sein” und “Einheit” nicht durch eine semantische Interpretation der Referenz analysierbar, da sowohl die kausale Theorie der Referenz als auch die kausale Theorie der Bedeutung bereits das voraussetzen müssen, was erst im Rahmen der logisch-semantischen Explikation geklärt werden sollte. Das Hauptproblem innerhalb der Realismus-Antirealismus-Debatte besteht darin, daß die verwendeten klassifikatorischen Begriffe ihrerseits weder systematisch abgeleitet sind, noch geklärt wird, welche unthematischen Voraus-setzungen diese Klassifikationen selbst machen, kurz: welches vorreflexiv gebrauchte Hintergrund-wissen verwendet wird. Bezogen auf Beobachtbares und theoretische Entitäten bildet die Existenz-kategorie ein semantisches Kontinuum mit Bedeutungsverschiebungen der Transzendentalien Sein, Einheit, Identität im sich verändernden epistemisch-pragmatischen Kontext der Rede. Stehen die rederelativen unthematischen Prädikate nicht als stabilisierte semantische Einheiten in kontra-diktorischer Beziehung zueinander, kann das Klassifikationschema “Realismus vs. Antirealismus” nichts zur Explikation der sich ändernden Funktionen beitragen, in denen theoretische Terme in veränderten Kontexten zu nichttheoretischen werden können. Wissenschaftliche Erkenntnis ist immer nur transitiv und versucht mit den selben sprachlichen Mitteln, welche für die Begründung eingesetzt werden, auch die Voraussetzungen der Begründungsverfahren zu klären. Dabei können Trans-zendentalien nicht zirkelfrei expliziert werden und nicht als Prämissen in einem linearen Schlußverfahren fungieren.
Analysiert man nun Computer unter bedeutungs- und zeittheoretischen Aspekten, so läßt sich feststellen, daß sie kein semantisches Vermögen, auch nicht im Sinne einer konstanten Semantik, ergo auch keine kognitive Dimension besitzen. “Das menschliche Denken gründet auf einer dreistelligen zeitlichen Isomorphierelation zwischen Welt, Substrat und Sprache und entwickelt sich in der Zunahme von (symbolischen und subsymbolischen) Repräsentationen, die das kognitive >>In-der-Welt-Sein<< allererst ermöglichen. Nur so ist die Seele der Welt, die Zeit, nicht nur wirksam, sondern auch erfahrbar, und nur so entstehen Subjekte, die das Wesen der Welt, die Zeit, erkennen”[71]. KI-Systemen fehlt der Kognition begründende Kausalzusammenhang zwischen der Bedeutung einer Sprache und den internen Operationen der Problemlösung. Die Deskription eines Vorgangs als “Inferenz” setzt ein semantisches Vermögen des mit Symbolen operierenden Systems voraus, welches wiederum genetisch von bestimmten physikalischen und physiologischen Substratvoraussetzungen abhängig ist. Sowohl die symbolische als auch die neurobiologische Ebene kognitiver Kompetenz bedürfen hinsichtlich der Repäsentationsfunktion eines Verweisungszusammenhangs mit der externalen Welt, d.h. einer Differenz zwischen Repräsentat und Repräsentant. Der symbolischen Ebene ist dabei eine logische Autonomie inhärent, da sonst alles (nicht ausgedehnte, lediglich mit einer Lage ausgestattete) Nichtbeobachtbare nicht kognitiv zugänglich wäre und Geist auf einen präsymbolischen neurobiologischen Prozeß reduziert würde. Direkt neurophysiologisch abbildbar ist lediglich das Tatsächliche (in Abgrenzung vom Möglichen) und das sinnlich Erfaßbare. Da wesentliche Teile des menschlichen Denkens mit der Verwendung von symbolhafter Sprache verbunden ist, würde ihr Verlust dem Verlust des Denkens selbst gleichkommen. Außerhalb einer symbolhaften Darstellung unserer Welt bleibt die Imagination von künftigen, noch nicht eingetretenen Ereignissen, nicht denkbar. Die prinzipielle Offenheit ihres zukünftigen Eintreten kann keinen kausalen Einfluß auf unser Denken ausüben und bleibt somit angewiesen auf die Differenz von (existierendem) Zeichen und (nichtexistentem) Designat.
Den Sozialwissenschaften und der Philosophie kommt innerhalb der kognitionswissenschaftlichen Diskussion (hinsichtlich KI-Systeme) nun die Aufgabe und Herausforderung zu, unter Einbeziehung der technischen und neurophysiologischen Grundlagenforschungen und Forschungsergebnissen, Einfluß und Kontrolle auf den Entstehungs- und Gestaltungsprozeß zu üben, sofern sie sich nicht mit nachträglicher Sinnkritik bescheiden wollen. Sie dürfen nicht den Anschluß an den technischen Fortschritt und damit implizit der Selbstverständlichkeit des gesellschaftlichen Umgangs mit derselben verlieren, deren Auswirkungen bis in das Selbstverständnis und das Weltbild der Benutzer hinein reichen. Es gilt ihren Beitrag (nicht im Sinne instrumenteller, szientistischer, positivistisch-affirmativer oder gar herrschaftlicher Vernunft) zum Projekt des Verständnisses des menschlichen Geistes zu leisten und adäquate Kriterien zu entwickeln, welche der “Rettung” der Einmaligkeit der menschlichen Subjektivität dienen.
9. Bibliographie
- Bornet, Gérard; Die Bedeutung von “Sinn” und der Sinn von “Bedeutung”. Auf dem Weg zu einem gemeinsprachlichen Wörterbuch für formale Philosophie; Wien, 1996.
- Calvin, H.W.; Ojemann, G.A.; Einsicht ins Gehirn; München, 1995.
- D’Avis, Winfried; Können Computer denken? Eine bedeutungs- und zeittheoretische Analyse von KI-Maschinen; Frankfurt, 1994
- Descartes, René; Principia philosophica, übers. Von A. Buchenau; Hamburg; 1965.
- Descartes, René; Meditationes de prima philosophia, übers. u. hg. von A. Buchenau/L. Gäbe/H.G. Zekl; Hamburg, 1977.
- Düffel, Johann v.; Intentionalität als Absichtlichkeit. Erkenntnistheoretische Untersuchungen im Rahmen eines einheitlichen Grundverständnisses von Subjektivität; Stuttgart, 1991.
- Eccles, John C., Die Evolution des Gehirns. Die Erschaffung des Selbst; München, 1993.
- Edelmann, G.M.; Göttliche Luft, vernichtendes Feuer; München, 1995.
- Frege, Gottlob; “Über Sinn und Bedeutung”; in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100; 1892; S. 25-50.
- Fuchs-Heinritz, Werner et al. (1973); Lexikon zur Soziologie; Opladen 1995.
- Gadenne, Volker; Bewußtsein, Kognition und Gehirn. Einführung in die Psychologie des Bewußtseins; Bern, 1996.
- Hobbes, Th.; De corpore (Elementorum philophiae sectio prima); übers. Von M. Frischeinsen-Köhler; Hamburg, 1967.
- Hume, David; Ein Traktat über die menschliche Natur, Buch I; Hamburg, 1989.
- Husserl, Edmund; Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, Gesammelte Werke, Bd. X; Den Haag, 1966.
- James, William; The Principles Of Psychology; New York, 1890.
- Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, Bd. III + Bd. IV, in: Theorie-Werkausgabe Immanuel Kant, Werke in 12 Bänden; (Edit. Weischedel, Wilhelm); Frankfurt, 1968.
- Kluge, Friedrich; Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache; 23., erw. Aufl.; Berlin, 1999.
- Linschoten, J; Auf dem Weg zu einer phänomenologischen Psychologie; Berlin, 1961.
- Mead, George Herbert (1934); Geist, Identität und Gesellschaft. Aus der Sicht des Sozialbehaviorismus; Frankfurt 1995; GIG.
- Mead, George Herbert (1980); Philosophie der Sozialität. Aufsätze zur Erkenntnisanthro-pologie; Frankfurt/M. 1969; GA.
- Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen; (Edit. Lutz, Bernd); Stuttgart/Weimar, 1995.
- Metzler Philosophie Lexikon. Begriffe und Definitionen; (edit. Precht, Peter, et. al.); Stuttgart/ Weimar, 1999.
- Meyers großes Taschenlexikon; Meyers Lexikonredaktion (Hrsg.); Mannheim 1995.
- Putnam, Hilary; Die Bedeutung von “Bedeutung”; Frankfurt 1990.
- Putnam, Hilary.; How to be an Internal Realist and a Transcendal Idealist (at the same time); in: Sprache, Logik und Philosophie. Akten d. 4. Intern. Wittgenstein-Symp.; hg. v. R. Haller/W. Grasserl; Wien, 1982.
- Putnam, Hilary.; Wahrheit, Vernunft und Geschichte; Frankfurt, 1986.
- Roth, Gerhard; Das Gehirn und seine Wirklichkeit; Frankfurt, 1996.
- Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.), i. A. des Zentrum Philosophische Grundlagen der Wissenschaften; “Wirklichkeit und Wissen”, eine Ringvorlesung im Sommersemester 1991, Schriftenreihe Bd. 12; Bremen, 1991.
- Sandkühler, Hans Jörg; “Wirklichkeit und Wissen. Realismus, Antirealismus und Wirklichkeits-Konzeptionen in Philosophie und Wissenschaften”, Philosophie und Geschichte der Wissenschaften, Studien und Quellen; Frankfurt, 1992.
- Searle, John R.; Intentionalität. Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes; Frankfurt, 1996.
- Varela, F.; Der Mittlere Weg der Erkenntnis; Bern/München/Wien, 1992.
[...]
[1] Prechtl, Peter, et. al.; Metzler Philosophie Lexikon; Stuttgart, 1999, S. 285.
[2] Der 1950 von Turing entwickelte Test zur experimentellen Überprüfung von kognitiven Maschinenleistungen erwies sich bisher als ungenügend, da beispielsweise das Sprachprogramm PARRY die an es gestellten Anforderungen ohne weites zu erfüllen in der Lage ist. Die bei dem Versuch anwesenden Psychiater waren nicht in der Lage, bei dem zu bewertenden Dialog, einen Unterschied zwischen (psychotischem) Mensch und “intelligenter” Maschine auszumachen. Ein weiteres Beispiel ist das in den 70er Jahren entwickelte SHRDLU System, welches über eine natürlichsprachliche Dialogkomponente verfügt und mit einen “Hand-Eye”-Roboter gekoppelt ist. Auf eine sprachlich gestellte Aufforderung war dieses System nicht nur in der Lage eine entsprechende Handlung in Gang zu setzen, sondern es stellte sich heraus, daß dieses System zu metaspachlichen Rückfragen zum Sprachgebrauch des Dialogpartners in der Lage war. Besonders flexibel, kontextbezogen und mit einem komplexeren Referenzbereich operierend ist das HAM-ANS System, dessen Dialogsequenzen als Beleg für ein semantisches Vermögen in Anspruch genommen werden könnten, sollte man den behavioristischen Output-orientierten Maßstab als Kriterium dafür zugrunde legen.
[3] Bei all dem muß betont werden, daß nicht die Form bzw. Komplexität der Intelligenz die ausschlaggebende Rolle spielt, ob man einem System kognitiven Status einräumen muß oder nicht, als vielmehr die grundsätzliche Frage, ob überhaupt der Schritt vom reflexionslosen Dasein zu einer kognitiven Ebene vollzogen wurde. Dabei ist es unerheblich, ob gegen geltende Regeln verstoßen wird oder auch nicht (beispielsweise ob richtig oder falsch gedacht wurde).
[4] Aus pragmatistisch behavioristischer Sicht ist Sprache immer in einen gesellschaftlichen Kontext (sozialen Erfahrungs- und Verhaltensprozeß) eingebettet, da es nur zu bewußter Kommunikation – bewußter Übermittlung von Gesten – kommt, wenn Gesten zu Zeichen (Symbolen) werden, d.h. wenn sie für das sie setzende Individuum, wie auch für die auf sie Reagierenden eine bestimmte Bedeutung oder Signifikanz (Sinn), im Hinblick auf das darauf folgende Verhalten des sie setzenden Individuums, besitzen. Indem sie dem reagierenden Individuum als vorzeitigen Hinweis auf das darauf folgende Verhalten des ersten Individuums dienen, welches die Geste setzte, ermöglichen sie die gegenseitige Anpassung der verschiedenen Komponenten der sozialen Handlung. Signifikante Symbole – auf den höheren Ebenen der menschliche Entwicklung – unterscheiden sich von Gesten niedrigerer Entwicklungsstufen dadurch, daß die signifikanten Gesten einen Sinn, eine Bedeutung bzw. Signifikanz aufweisen und in der Erfahrung des Individuums bewußt sind. “Daß die Grundsubstanz oder der Komplex von Haltungen und Reaktionen, die jede gegebene gesellschaftliche Handlung oder Situation ausmachen, in die Erfahrung jedes von dieser Situation oder dieser Handlung betroffenen Individuums eingeschlossen sind (nämlich seine Haltungen gegenüber anderen Individuen, ihre Reaktionen auf seine Haltungen ihnen gegenüber, ihre Haltungen ihm gegenüber und seine Reaktionen auf diese Haltungen), macht praktisch eine Idee aus; zumindest aber ist dieses Eingeschlossensein in die Erfahrung die einzige Grundlage für ihr Auftreten oder ihre Existenz “im Geist” des jeweiligen Individuums.” (Mead; GIG; S.111). Durch die Beziehung der vokalen Geste zu einer solchen Aktionsreihe wird sie zu einem signifikanten Symbol. Eine solche organisierte Einstellung wird im allgemeinen eine Idee genannt; die Idee von dem, was wir sagen, begleitet unser gesamtes sinnvolles (significant) Sprechen und ist in unserem Bewußtsein evident. “Wo eine von einem Individuum geäußerte vokale Geste bei einem anderen Individuum zu einer Reaktion führt, können wir von ihr als dem Symbol dieser Handlung sprechen; wenn sie in dem, der sie äußert, die Tendenz zur gleichen Reaktion hervorruft, sprechen wir von einer signifikanten Geste.” (Mead; GA; S.94f.). Es ist eine Beziehung von der Art, daß das zweite Wesen auf die Geste des ersten als Hinweis oder Andeutung auf die Vollendung der jeweiligen Handlung reagiert: Sinn leitet sich somit aus der Reaktion ab und sollte nicht als ein Bewußtseinszustand angesehen werden. Man kann sagen, daß Objekte erst innerhalb des gesellschaftlichen Erfahrungsprozesses, durch Kommunikation und gegenseitige Anpassung des Verhaltens der einzelnen Individuen, die in diesen Prozeß eingeschaltet sind und diesen ablaufen lassen, geschaffen werden (nominalistische Position).
[5] Zeitlichkeit in dem Sinne, daß die Semantik von Begriffen sich im Laufe der Geschichte verändern kann und dieser Veränderung Rechnung getragen werden muß seitens des vermeintlich kognitiven Systems.
[6] Der Monismus ist eine Lehre, welche eine letzte Wesens-Einheit alles Seienden annimmt, welche seelisch-geistiger Art (spiritualistischer Monismus) oder materieller Art (materialistischer Dualismus) sein kann. Da sich nach dieser Betrachtungsweise alles Seiende aus einer letzen Einheit entwickelt oder entwickeln läßt, kann es auch wieder auf diese zurückgeführt werden. Dem naturalistischen Monismus zufolge, ist das Seelische den materiellen Grundbestandteilen mitgegeben und funktioniert nach mechanischen Gesetzen. Eine leichte Abwandlung dieser Ansicht bildet der energetische Monismus, der das gesamte geistige Leben als Transformation von Energie ansieht. Der neutrale Monismus angelsächsischer Philosophen (J. Dewey, W. James, B. Russell) nimmt einen der Materie und dem Geist zugrundeliegenden bzw. sie überschneidenden Weltstoff an, der in einer bestimmten Anordnung als geistig, in einer anderen als materiell bezeichnet wird.
[7] Cf.: Edelman, G.M.; Göttliche Luft, vernichtendes Feuer; München, 1995. Ihm zufolge ist Wahrnehmung immer Abstraktion (analog : individuum est ineffabile) und Assoziation, bedingt durch die Kartographierung der Wahrnehmungszentren in den jeweiligen Hirnarealen, welche für die je spezifische Wahrnehmungsleistung/-verarbeitung verantwortlich sind. Bei seiner Analyse der Sprachwahrnehmung kommt er zu dem Schluß, daß die Kompetenz der sprachlichen Unterscheidung von Subjekt und Objekt die Voraussetzung für ein “Bewußtsein höherer Ordnung” sei. Mit der Semantik gehe auch die Syntax (implizit die zeitliche Unterscheidung) einher. Seiner Auffassung nach, gibt es immer schon ein Informations-Vorverständnis, egal ob auf sub-symbolischer Ebene (d. Gene), oder auf symbolisch sprachlicher Ebene: es gibt keine tabula rasa, Bedeutung ist immer schon gesellschaftlich vermittelt. Man sieht, daß auch Edelman Probleme hat seine postulierte monistische Position stringent durchzuhalten, da er im Verlauf seiner Analyse nicht umhin kommt Kategorien wie Freiheit, geistige Materie oder doch eben Gesellschaft einzuführen um sein System zu stützen.
[8] Dieser Auffassung zufolge ist das Seiende auf zwei nicht voneinander ableitbare bzw. sich ausschließende Prinzipien oder Substanzen (z.B. Geist und Materie, Seele und Körper, Gut und Böse) zurückführbar. Der Platonische Dualismus unterscheidet zwischen Ideenwelt (Bereich des ewigen und vollkommenen Seins) und der Welt der sinnlichen Erfahrung, die kraft ihrer Teilhabe an jener sinnlichen existiere. Die irrtumsbehaftete Ebene der sinnlichen Wahrnehmung wird von jener der wahren Erkenntnis der Ideen abgegrenzt. Descartes‘ Substanzdualismus stellt dem materiellen, ausgedehnten Sein (res extensa) ein immaterielles, nicht ausgedehntes, bewußtes Sein (res cogitans) gegenüber. Hieraus geht dann auch der psycho-physische Leib-Seele-Dualismus Descartes‘ hervor, nach dem die Seele den menschlichen Körper steuert wie ein “Geist in der Maschine”. In der 3-Welten-Theorie Poppers hat der cartesianische Leib-Seele-Dualismus eine erkenntnistheoretisch fundierte Erneuerung erfahren. Nach Popper muß eine Welt 2 der psychischen Vorgänge angenommen werden, damit eine Vermittlung zwischen Welt 3 der logischen Gehalte und Theorien einerseits und Welt 1 der physischen Vorgänge überhaupt andererseits möglich ist.
[9] Vgl.: Eccles, John C., Die Evolution des Gehirns. Die Erschaffung des Selbst; München, 1993. J. Eccles und K. R. Popper unterscheiden drei Welten, welche alles Existierende und alle Erfahrungen erfassen: a) Welt 1 der physischen Gegenstände und Zustände (anorganisch, energetisch, biologisch-organisch, artefaktisch); b) Welt 2 der Bewußtseinszustände (impliziert subjektives Wissen, Erfahrung von Wahrnehmung, Denken, Gefühlen, Absichten, Erinnerungen, Träumen, kreativer Imagination), welche weder energetischer noch materieller Art ist; und c) Welt 3 des Wissens im objektiven Sinne (beinhaltet alle erbrachten kulturellen Leistungen, welche in materiellen Substraten codiert sind, sowie wissenschaftlich-theoretische Systeme). Zwischen Welt 1 und Welt 2 soll nun ein informationeller, aber kein energetischer Austausch stattfinden. Dies wirft nun zwei logische Folgeprobleme auf: 1). durch willentliche Vorgänge kommt es zu einer Aktivierung von Aktionspotentialen in den Neuronen und somit zu einer Freisetzung von Energie, deren Ursprung nicht logisch plausibel nachgewiesen werden kann. Diese Einwirkung/Wechselwirkung immaterieller Ereignisse auf die materielle Struktur des Gehirns in energetischer Hinsicht kann als eine Verletzung des I. Hauptsatzes der Thermodynamik angesehen werden, demzufolge Energie nicht verloren geht; 2). daran anschließend erweist sich die formulierte These der Energiefreiheit der Welt 2 als problematisch, da sie wiederum der Einsteinschen Relativitätstheorie widerspricht, der zufolge es keine energiefreien Bereich gibt.
[10] Semantik gehört neben Semiotik und Semiologie zur Zeichentheorie und ist eine empirische Teildisziplin der Sprachwissenschaft. Sie behandelt im Gegensatz zur Syntaktik, welche die interne Struktur sprachlicher und anderer Zeichensysteme untersucht, und Pragmatik, als Theorie der Zeichenverwendung, die verschiedenen Beziehungen zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Bei der Untersuchung sprachlicher Zeichen lassen sich zwei Ebenen unterscheiden: 1) die Zuordnung von außersprachlichen Sachverhalten, Gegenständen und Mengen zu den Ausdrücken einer bestimmten (entweder natürlichen oder formalen) Sprache. 2) Die Behandlung von damit verbundenen generellen Fragen nach dem Verhältnis zwischen Sprache, Denken und außersprachlicher Realität.
[11] Cf. Kluge, Friedrich; Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache; 23., erw. Aufl.; Berlin, 1999.
[12] Dies wirft natürlich die generelle Frage auf, ob es in der natürlichen Sprache überhaupt “echte” Synonyme gibt. Man könnte sie verneinen vom Standpunkt aus, wenn damit in jeder Hinsicht sinngleiche Ausdrücke gemeint wären, welche Sinngleichheit in gewisser Hinsicht nicht kategorisch ausschließen würden.
[13] Bornet, Gérard; Die Bedeutung von “Sinn” und der Sinn von “Bedeutung”. Auf dem Weg zu einem gemeinsprachlichen Wörterbuch für formale Philosophie; Wien, 1996.; S. 192.
[14] Frege, Gottlob; “Über Sinn und Bedeutung”; in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100; 1892; S. 25-50.
[15] Die Subjekt-Objekt-Spaltung ist die Bezeichnung für das Folgeproblem der bewußtseins-philosophischen Verabsolutierung der Subjekt-Objekt-Relation der Erkenntnis, der Annahme, daß Erfahrungserkenntnis ausschließlich als zweigliedrige Relation zwischen Erkenntnissubjekt und zu erkennendem Objekt zu verstehen sei. Erkenntnistheoretisch relevant ist das Problem der Subjekt-Objekt-Spaltung, insofern gültige Erkenntnis voraussetzt, die Kluft zwischen Subjekt und Objekt überwinden zu können. Im Rationalismus Descartes‘ hat die Subjekt-Objekt-Spaltung die quasi-ontologische Form eines Auseinander von selbstgewissem ego (res cogitans) und materieller Außenwelt (res extensa). Das Subjekt könne nur über seine eigene Existenz Gewißheit erlangen, wahre Erkenntnis der Außenwelt garantiere hingegen ein wahrhaftiger Gott. Die subjektphilosophische Verabsolutierung des Subjekt-Objekt-Schemas setzt sich in Kants Transzendentalphilosophie fort. Indem Kant in den Naturwissenschaften das Paradigma der Erkenntnis sieht und die für die Geistes- und Sozialwissen-schaften grundlegende kommunikative Subjekt-Subjekt-Relation ausblendet, muß er eine hinter der subjektiv konstituierten Erscheinungswelt liegende, unerkennbare Welt-an-sich annehmen, um objektive Erfahrung und gültige Erkenntnis denken zu können. Husserls transzendentale Phänomenologie hat den Widersinn des erkenntnistheoretischen Dualismus durch den Aufweis der Intentionalitätsstruktur des Bewußtseins aufzuheben versucht. Da Husserl den Geltungsboden für die Erkenntnis der Außenwelt in das reine Bewußtseinsleben eines einsamen ego verlegen will, erneuert sich bei ihm die Subjekt-Objekt-Spaltung zwischen einer kennbaren Welt-für-mich und einer unerkennbaren Welt-für-alle. Peirces sinnkritischer Realismus löst das Problem der Subjekt-Objekt-Spaltung auf, indem er die Vorstellung einer vermeintlich unerkennbaren Welt-an-sich in die regulative Idee eines für die unbegrenzte Forschergemeinschaft auf lange Sicht Erkennbaren transformiert. An Peirce knüpft die Transzendentalpragmatik (Apel) an, indem sie die, eine gemeinsame, sprachliche erschlossene Welt schon voraussetzende, Subjekt-Subjekt-Relation der sprachlichen Kommunikation als Sinnbasis der Subjekt-Objekt-Relation der Erkenntnis aufweist.
[16] Ein Beispiel dafür wäre ein synthetisches Urteil à la Kant, zusammengefaßt in dem Satz: “ 7+5=42-22”.
[17] Dies mag daran liegen, daß Frege der Tradition der Neukantianischen Erkenntnistheorie anhängt, welche die Logik in einen größeren Zusammenhang einbettet, in dem die Annahme eines objektiven Charakters dieser Werte geradezu eingefordert wird.
[18] Putnams soziolinguistische Hypothese besagt, daß jede Sprachgemeinschaft Ausdrücke verwendet, für die gilt, daß “die mit diesen Ausdrücken verknüpften Kriterien (...) jeweils nur eine Teilmenge der Menge aller Sprecher (kennt), die diesen Ausdruck beherrschen, und ihre Verwendung durch andere Sprecher beruht auf einer spezifischen Kooperation zwischen diesen und den Sprechern aus den jeweiligen Teilmengen” (Putnam, H.; Die Bedeutung von “Bedeutung”; Frankfurt 1990; S. 39).
[19] Man spricht hierbei auch von der “Extensions-Intensions-Ambiguität” des Bedeutungsbegriffs.
[20] Hinsichtlich dieser Eigenschaften kann man obligatorische von fakultativen unterscheiden.
[21] Von Absichten wird hier stets im Sinne ergehender und somit erfolgsdifferenter Absichten gesprochen (erfolgsterminologische Spezifikation).
[22] Düffel, Johann v.; Intentionalität als Absichtlichkeit. Erkenntnistheoretische Untersuchungen im Rahmen eines einheitlichen Grundverständnisses von Subjektivität; Stuttgart, 1991.
[23] Beispielsweise impliziert das Begehren des Steins des Weisen nicht die Existenz des Steins des Weisen. Düffel versucht diesen Mangel durch sein Konzept leistungsbezogener Absichtlichkeit zu retten, innerhalb dessen die Kontingenz erfolgorientierter Leistung gewährleistet ist. Ein Leistungsbezug liegt in jedem Fall einer Bestrebung qua Ausgehen darauf, eine Leistung zu erbringen, vor und ist von erfolgsdifferentem Status.
[24] Husserls Konzept des Noema weißt eine nur scheinbare Unabhängigkeit von der Wirklichkeit auf, da ein Noema auch dann vorliegt, wenn kein entsprechendes bewußtseintranszendierendes Objekt aufzufinden ist. Zum anderen ist die Noesis mittels eines solchen Noemas gerade auf ein solches Objekt gerichtet und nicht etwa diesem gegenüber indifferent.
[25] Nach Düffel impliziert diese Dreiteilung die Verselbständigung eines Momentes in der Subjektsphäre (gegen sich selbst), ergo eine Verdinglichung von Subjektivität.
[26] Linschoten, J; Auf dem Weg zu einer phänomenologischen Psychologie; Berlin, 1961.
[27] Gadenne, Volker; Bewußtsein, Kognition und Gehirn. Einführung in die Psychologie des Bewußtseins; Bern, 1996; S. 54.
[28] Searle, John R.; Intentionalität. Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes; Frankfurt, 1996; S. 28f..
[29] Es sei an dieser Stelle angemerkt, daß Kant “Erkenntnis” synonym mit “Urteil” verwand und nicht in der heute üblichen Bedeutung von “Leistung”. Dieser terminologische Unterschied ist von weitreichender Bedeutung: man kann “erkennen” entweder nur als ein Bestrebenswort und somit als ein Gattungsbegriff oder als ein Leistungswort und somit als einen genuinen Artbegriff handhaben, aber nicht beides. Die Gleichsetzung von “Erkenntnis” als Gattungsbegriff ist nicht fruchtbar, da sich Subjektivität nicht sinnvoll als “wahr” oder “falsch” qualifizieren läßt (Verdinglichung der Subjektivität). Auch würde dies bedeuten eine Gattung von Entitäten im Unterschied zu Subjektivität ansetzen.
[30] “Gegenstandsbewußtsein” bedeutet Bewußtsein als das Vergegenständlichen von etwas im Kontext der Wahrnehmung.
[31] Der historische Universalienstreit war ein mittelalterlicher Diskurs zwischen dem radikal scholastischen Realismus (“die Einzeldinge oder Individuen der Welt gehören auf natürliche Weise gewissen Äquivalenzklassen an, welche erkenntnissubjektunabhängig existieren”) und dem radikal scholastischen Nominalismus (“Klassifikationen der Einzeldinge unserer Welt stehen zur freien Disposition und entsprechende Prädikatausdrücke, welche Äquivalenzklassen ausdrücken sollen, bezeichnen tatsächlich nichts, d.h. Klassen oder Prädikate existieren überhaupt nicht”).
[32] Speziellere realistische Positionen werden häufig nach ihrem besonderen Gegenstandsbereich benannt: So besagt der sog. Wissenschaftsrealismus (“scientific realism”), konträr gegenüber den Auffassungen des wissenschafts-theoretischen Instrumentalismus, des logischen Positivismus und des wissenschaftshistorischen Relativismus, daß wissenschaftliche Theorien auf eine wahre und vollständige Beschreibung der Realität hin “konvergieren” (approximativ sich annähern) und ihre singulären Termini sich auf theorieunabhängige Gegenstände beziehen.
[33] Dem Reduktionismus zufolge gibt es keine wissensunabhängige Wirklichkeit, und die Disjunktion “Wirklichkeit und Wissen” ist inadäquat: Alle auf eine denkunabhängige Realität zielenden Hypothesen sind Konstruktionen menschlichen Wissens; diese ist in Sprache verfaßt, in der sich die perspektivischen Selektionen von Wirklichkeitssektoren – als Reduktion der Wirklichkeit realisieren. Insofern ist der wissenschaftliche Gegenstand kein wirklicher Gegenstand; die wissenschaftstheoretische “Wirklichkeit” ist nicht “die Realität”; die Wirklichkeit der “Außenwelt” ist das Ineinander von Dinglichkeit, Kognition und Sprache.
[34] Unter Ontologie (“Lehre vom Seiendem als solchem”) versteht man heute im allgemeinen eine Disziplin der Philosophie neben Logik, Erkenntnistheorie, Ethik oder Anthropologie. Allerdings ist ihr Rang “erste Philosophie” zu sein, sehr umstritten. Dennoch meint der Begriff Ontologie weder eine Disziplin nach eine Spezialtheorie über Sein und Seiendes im allgemeinen. Um ihn aber von seiner Wirkungsgeschichte abzuheben, muß er mit dem Begriff Metaphysik (d. Geistes) zusammengedacht werden, welcher dem Kardinalproblem der “Seinswirklichkeit” (Disjunktion zwischen universalem und absolutem Grund) verpflichtet ist.
[35] Epistémologie (griech. episteme: Wissen, Kenntnis, Wissenschaft; logos: Vernunft, Lehre) bezeichnet im engeren Sinn eine Wissenschaftstheorie, welche die Entwicklungen der Wissenschaften unter Berücksichtigung ihrer Geschichte zu thematisieren versucht. Sie thematisiert die logische Struktur des Wissens und des Glaubens, indem sie das Wissen einer Person nach drei Bedingungen bestimmt: a) Die als Wissen formulierte Aussage muß wahr sein; b) die Person muß von der Wahrheit überzeugt sein; c) sie muß für diese Überzeugung ausreichende und zwingende Gründe haben. Die traditionelle Erkenntnistheorie hat diese Fragen im Hinblick auf die Grundlage der Erkenntnis beantwortet: a) Der empiristische orientierte Standpunkt gibt dazu die Sinneserfahrung als Instanz an; b) die Position des Apriorismus gibt als Grundlage die Vernunft- und Verstandesprinzipien an, welche den Bezug auf die Sinneserfahrung erst durch die begriffliche Formung zu einer Erkenntnis machen. Eine namentliche Differenzierung zwischen Epistemologie und Erkenntnistheorie ist dann sinnvoll, wenn man die Aufgabe der Epistemologie dadurch bestimmt, die Erkenntnis ausschließlich hinsichtlich der Systeme von Propositionen und Regeln, nach denen empirisch gehaltvolle Aussagen gebildet und überprüft werden können, zu thematisieren.
[36] Hobbes, Th.; De corpore (Elementorum philophiae sectio prima); übers. Von M. Frischeinsen-Köhler, Hamburg, 1967.
[37] Influxus physicus bezeichnet die Beeinflussung der Seele durch den Leib und rekurriert auf die Wechselwirkung von Leib-Seele bzw. Körper-Geist (psychophysische Relation).
[38] Locke unterscheidet unter Rückgriff auf Descartes und Boyle primäre von sekundären Qualitäten. Primär sind solche Qualitäten, die ein Körper konstant beibehält und die nicht von ihm getrennt werden können. Dazu zählen Solidität, Ausdehnung, Gestalt, Bewegung oder Ruhe und Zahl. Sekundäre Qualitäten definiert er als Kräfte, welche ausgehend von den Primäreigenschaften der Dinge die Sinneswahrnehmung hervorrufen. Sie sind kausal von den primären abhängig, nur ihre Erscheinungsformen sind respektiv. Objektiv gegeben sind nur die Primärqualitäten.
[39] Leibniz entwickelt, entgegen der cartesianischen Reduktion auf die klaren und distinkten Ideen, eine ganze Skala von Graden der kognitiven Repräsentation; angefangen von der “cognitio obscura”, die noch unterhalb der Voraussetzungen des Erinnerungsvermögens liegt, bis hin zu den beiden höchsten Formen von “cognitio clara, distincta, adaequata”: der “cognitio symbolica”, die sich des mathematischen und logischen Symbolismus bedient, insofern es um zusammengesetzte, komplexe Begriffe geht und der “cognitio intuitiva”, die bei einfachen Begriffen gegeben ist.
[40] Vgl. Rheinwald, Rosemarie; Der Schluß auf die beste Erklärung und das Induktionsproblem. Votum zu Werner Diederich; in: Sandkühler, Hans Jörg; “Wirklichkeit und Wissen. Realismus, Antirealismus und Wirklichkeits-Konzeptionen in Philosophie und Wissenschaften”, Philosophie und Geschichte der Wissenschaften, Studien und Quellen; Frankfurt, 1992.
[41] Dies scheint mir nicht mit Humes-Theorem in Einklang bringbar zu sein, demnach es rational nicht zu rechtfertigen ist, von wiederholten Ereignissen unserer Erfahrung auf zukünftige, von denen wir noch keine Erfahrung besitzen, zu schließen. Die geschieht vielmehr aus einer psychologischen Motivation heraus: Gewohnheit bzw. gewohnheitsmäßige Gedankenver-knüpfungen führen zu der Feststellung regelmäßiger Zusammenhänge (induktiver Analogieschlüsse). Kausalverknüpfungen können daher nicht mit strenger Notwendigkeit behauptet werden.
[42] Dem Verifikationismus zufolge ist Wahrheit identisch mit einer Art Nachweisbarkeit (Positivismus) bzw. etwas ist genau dann wahr, wenn es aus der sogenannten idealen Theorie folgt (Peircescher Pragmatismus). Echte Konsens- oder Kohärenztheorie der Wahrheit ist mit Verifikationismus verbunden. Unter einer solchen wird eine Theorie verstanden, die Konsens bezüglich einer Hypothese oder deren Kohärenz mit anderen Hypothesen nicht nur als Indiz für Korrespondenz zwischen Hypothese und Realität versteht, wie das oft geschieht, sondern Wahrheit als identisch mit entsprechendem Konsens oder entsprechender Kohärenz versteht.
[43] Antiverifikationismus: Wahrheit ist nicht identisch mit einer Art von Nachweisbarkeit. Es kann z.B. der Fall sein, daß einiges wahr ist und wir es nicht nachweisen können; das Erkenntnissubjekt wäre somit zu einer gewissen Ignoranz verurteilt. Oder es kann der Fall sein, daß einiges verifizierbar ist, aber dennoch nicht wahr; damit wäre das Erkenntnissubjekt zum Irrtum verurteilt.
[44] Die Ideenlehre ist das zentrale Lehrstück der Philosophie Platons, das in der Annahme der Existenz besonderer, nicht-empirischer Gegenstände besteht. Der veränderlichen Welt der Erscheinungen stellt er die Ideen voran. Nur ihnen, die den unvollkommenen Gegenständen der Erscheinungswelt als unwandelbare Vorbilder und Ursachen dienen, wird wahre Realität zugesprochen: Während man im Bereich der sinnlichen Wahrnehmungen, der Abbilder, höchstens zu wahrer Meinung gelangen kann, gibt es im Bereich der Ideen, welche hierarchisch, mit der Idee des Guten an der Spitze geordnet sind, sicheres, allgemeingültiges Wissen.
[45] Descartes begriffstheoretische Untersuchungen führten zu der Unterscheidung dreier Klassen von einfachen Begriffen: a) die nicht durch Rekurs auf Erfahrung gewonnenen Begriffe (ideae innatae od. “angeborene Ideen”), b) die durch Erfahrung erworbenen Begriffe (ideae adventitiae), und c) künstliche Begriffe (ideae a me ipso factae). Von angeborenen Ideen spricht Descartes nicht in bezug auf aktuale Erkenntnisse, sondern in dem Sinne, daß der Intellekt imstande sein soll, sie prinzipiell unabhängig von der Erfahrung hervorzubringen.
[46] Dies trifft im Prinzip auf jede Theorie zu, die davon ausgeht, daß die Supervenienzbasis mentaler Zustände der Körper (meistens des Gehirns) des Individuums ist, dem sie zugeschrieben werden.
[47] Als Theorien stehen Idealismus und Realismus in einem komplementären Verhältnis. Eine solche komplementäre Auffassung vertritt Kant: Seinem transzendentalen Idealismus entspricht ein empirischer Realismus, insofern die Realität der Gegenstände unterschieden werden muß von der begrifflichen Struktur der Erscheinungen als Gegenstände der Erkenntnis. Desweiteren wird im Idealrealismus eine bloß relative, keine absolute, Vorrangstellung des einen vor dem anderen behauptet, so daß die Rolle des jeweils anderen in der Theorie angemessen berücksichtigt werden kann.
[48] Für den radikalen Konstruktivismus ist die Unterscheidung zwischen Realität (transphänomenaler Welt) und Wirklichkeit (phänomenaler Welt) grundlegend. Es gibt eine von jeder Wahrnehmung und jedem Bewußtsein unabhängige Realität, in welcher Menschen existieren. Gleichzeitig leben sie in einer (vom Gehirn generierten) phänomenalen Wirklichkeit, die in Umwelt, Körperwelt und Ich-Welt strukturiert ist. In dieser phänomenalen Welt kommen Gehirne vor, die wissenschaftlich untersucht werden können. Das Gehirn, welches die phänomenale Welt erzeugt, die Subjekte als ihre Wirklichkeit erfahren, ist allerdings nicht Teil dieser Wirklichkeit. Die Realität bringt die Wirklichkeit hervor, aber die Realität existiert nicht in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist die einzige, die für Subjekte existiert. Das reale Gehirn konstruiert die Wirklichkeit, in der wirkliche Umwelten, wirkliche Körper, wirkliche Gehirne vorkommen, die von wirklichen Neurobiologen untersucht werden. Das wahrgenommene Gehirn ist das wirkliche, nicht das reale Gehirn. Die Unterscheidung der Wirklichkeit in Umwelt, Körper und Ich-Welt ist hingegen eine Unterscheidung, die das objektive, nicht das wirkliche Gehirn trifft.
[49] Die Systemtheorie ist versucht wissenschaftliches Denken in Systembegriffen zu formulieren, wobei die Theoriebildung seit ihrer Entstehung Systembegriffe meist in Analogie zu nicht-sozialen Systemen (Mechanismus, Organizismus, Kybernetik) entwickelt hat. T. Parsons strukturell-funktionalistischer Theorieansatz suchte nach den Mustern, die der Verknüpfung von Handlungen zu Strukturen zugrunde liegen. Demnach sind funktionale Prozesse solche, welche der Erhaltung der Strukturen dienen. Sein Systembegriff stellt Gleichgewicht, Stabilität und Homoöstase ins Zentrum. Die Funktion des Systems wird im “AGIL-Schema” zusammengefaßt: Adaption (Anpassung), Goal-attachment (Bestimmung und Erreichung von Zielen), Integration und latent pattern-maintenance (Strukturbewährung, Spannungsregulierung). Parsons Bestimmung von Systemen als Differenz von Teilen zum Ganzen, hat als Folge die Frage nach dem Wandel und der Inkorporation ins System aufgeworfen. N. Luhmann versuchte einen Weg für die Beschreibung evolutionärer System-veränderungen zu öffnen durch seine Definition des Systems als Differenz zwischen Umwelt und System. Diese Idee findet Ausdruck in Vorstellungen von Selbstreferentialität und Autopoiesis (Selbsterschaffung/Selbsterhaltung) des Systems und seiner Elemente. Die Selbstbezogenheit sozialer Systeme rekurriert auf Begriffe wie Wiederholung oder Erwartung von Handlungen. Die Systeme müssen die “Anschlußfähigkeit” von Handlungen sicherstellen und deshalb ihre eigentlich Funktion der Selektion von möglichen Systementwicklungen und die Reduzierung des Angebots möglicher System-alternativen organisieren. Dies gelingt am besten durch Reproduktion anschlußfähiger Elemente. Autopoiesis wird damit zum Kern der fortgeschrittenen Systemtheorie. Durch die Einführung von Vorstellungen der Selbstreferentialität und Autopoiesis können jetzt Wandlungsprozesse systemtheoretisch erklärt werden. Dem System muß nicht länger – wie implizit bei Parsons – ein organisierendes Zentrum (Subjekt) zugeschrieben werden.
[50] Als stärkstes Argument für den Konstruktivismus kann die Tatsache angesehen werden, daß sekundäre Qualitäten (wie z.B. Farbe) nicht physikalisch gemessen (und somit in Folge auch nicht repräsentiert) werden können, da sie objektiv nicht vorliegen, sondern stets von den primären Qualitäten ontischer Wesensheiten abhängig sind, d.h. kausal aus ihnen folgen. Varela zufolge existiert Farbe nicht in einer bewußtseins-transzendenten Welt, sondern ausschließlich in unseren Köpfen. Die menschliche Farbwahrnehmung ist von kooperativen Vergleichsprozessen im Gehirn abhängig (z.B. nicht visuellen Formen der Wahrnehmung) und nicht monokausal von der rezipierten Wellenlänge. Sie ist nicht nur Reflexionsvermögen, da Farbmerkmale nicht auf entsprechende Merkmale des Reflexionsvermögens beziehbar sind, vielmehr kann Farbe als eine Form der Erfahrung angesehen werden, welche durch unser neuronales emergentes Netzwerk erzeugt wird. Farbe steht somit nicht für eine vorgegebene oder repräsentative sondern empirisch hervorgebrachte Kognitionssphäre. (Varela, F.; Der Mittlere Weg der Erkenntnis; Bern/München/Wien, 1992.
[51] Der psychophysische Parallelismus besagt, daß sich die Vorstellungen nach den Gegenständen richten.
[52] Gemeint ist eine irreduzible Variante psychologisch-philosophischen Denkens (i.e. Motiv, Handlung, Kommunikation, Persönlichkeit) und nicht eine bestimmte, etwa einem naiven Realismus verpflichtete Abbildvorstellung.
[53] Die Ablehnung jeglicher beobachterunabhängigen Existenz von irgend etwas (i.e. Materie, Energie, Ideen, Gott, Bewußtsein, Geist oder Realität) führt dazu, daß man zwei Begriffe von Objektivität unterscheiden muß: eine Objektivität, die voraussetzt, daß es einen vom Beobachter unabhängigen Bereich der Existenz, ein Universum, eine Realität gibt; und eine “Objektivität”, welche die möglichen Existenzbereiche als allein durch den Beobachter gesetzt ansieht: Damit hängt Existenz konstitutiv vom Beobachter ab.
[54] Ihre Position eines nichtreduktionistischen Physikalismus, versucht ausgehend von Aspekten und Argumenten aus Philosophie, Neurobiologie und Physik, die erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Bedingungen der kognitiven Neurobiologie zu analysieren und die Bedeutung der Ergebnisse für die philosophische Erkenntnistheorie fruchtbar zu machen. Cf. Gerhard Roth und Helmut Schwegler; Kognitive Referenz und Selbstreferentialität des Gehirns. Ein Beitrag zur Klärung des Verhältnisses zwischen Erkenntnistheorie und Hirnforschung; in: Hans Jörg Sandkühler, Wirklichkeit und Wissen. Realismus, Antirealismus und Wirklichkeits-Konzeptionen in Philosophie und Wissenschaften.; Frankfurt, 1992; sowie Roth, Gerhard; Das Gehirn und seine Wirklichkeit; Frankfurt, 1996.
[55] G.M. Edelman spricht hierbei auch von einer Kartographierung der Wahrnehmungszentren.
[56] Gerhard Roth und Helmut Schwegler; a.a.O. ; S. 110.
[57] Das Problem besteht darin, daß dies konsistenter Weise auch für die eigene phänomenale Welt des Neurobiologen gilt. Das, was in der Welt passiert, d.h. auch sein Experimente an Gehirnen, passiert ganz offenbar in seiner phänomenalen Welt und damit (da diese Welt ein Konstrukt seines Gehirns ist) in seinem Gehirn (sonst wäre seine Theorie falsch!). Wenn sie aber stimmt, dann untersucht er offenbar gar nicht, wie ein “objektiv vorhandenes” Gehirn mit seiner “objektiven” Umwelt interagiert, sondern er untersucht ein von seinem eigenen Gehirn generiertes Gehirn, das mit einer ebenso konstruierten Umwelt in imaginierter Weise interagiert. Auch ist die Möglichkeit gegeben, daß ich in meiner phänomenalen Welt meinen eigenen Körper und mein eigenes Gehirn betrachte. Diese sind, als Teil meiner phänomenalen Welt, dann ebenfalls Konstrukte meines Gehirns. Doch wie ist das möglich, wie kann mein Körper in meinem Gehirn stecken und wie kann mein Gehirn sich in meinem Gehirn befinden? Wie kann man sicher sein, daß nicht in dem konstruierten Gehirn wiederum eine phänomenale Welt existiert, in der es wiederum Körper und Gehirne gibt, welche wiederum usf...ad infinitum?
[58] Vgl. hierzu die äußerst interessanten Forschungs- und Versuchsergebnisse von Calvin und Ojemann, die einen detaillierten Einblick in die Funktionsprinzipien des menschlichen Gehirns eröffneten. Calvin, H.W.; Ojemann, G.A.; Einsicht ins Gehirn; München, 1995.
[59] Nach Roth und Schwegler ist dadurch auch die vom objektivistischen Standpunkt her unverständliche Tatsache erklärbar, daß sich auch empirische Wissenschaftler oft über Meßergebnisse uneins sind, da dahinter jeweils unterschiedliche Konstruktionen von Wirklichkeit stehen.
[60] Wolfgang Wildgen; Semantischer Realismus und Antirealismus in der Sprachtheorie; in: Hans Jörg Sandkühler; Wirklichkeit und Wissen. Realismus, Antirealismus und Wirklichkeits-Konzeptionen in Philosophie und Wissenschaften.; Frankfurt, 1992; S. 140.
[61] Dennett vertritt weiterhin die These, daß es keine semantischen Maschinen gibt, d.h. daß syntaktische Maschinen (und jedes physische System ist eo ipso eine syntaktische Maschine) semantische Maschinen immer nur partiell, niemals aber vollständig imitieren können. Dennett geht scheinbar davon aus, daß einer semantischen Maschine eine Fähigkeit oder Kompetenz zugeschrieben werden kann, von der aus prinzipiellen Gründen ausgeschlossen ist, daß ein physisches System ebenfalls über diese uneingeschränkt verfügen könnte. Er besteht darauf, daß intentionale Erklärungen auf einem Kompetenz- und nicht auf einem realistischen Performanzmodell basieren, welches physisch realisierbar wäre. Allerdings ist diese Annahme nicht sehr plausibel: sowohl das Selbstverständnis der intentionalen Alltagspsychologie als auch der kognitiven Psychologie ist ein performanztheoretisches, bei welchem nicht das intentionale Begriffssystem verlassen wird. Es gehört zu den interessantesten Aufgaben der intentionalen Psychologie, zu erkunden, wieweit der Bereich der Rationalität reicht und unter welchen Bedingungen Personen dazu neigen, falsche Überzeugungen zu erwerben, falsche Schlüsse zu ziehen oder irrational zu handeln.
[62] Hans Jörg Sandkühler – Epistemologischer Realismus und die Wirklichkeit des Wissens. Eine Verteidigung der Philosophie des Geistes gegen Naturalismus und Reduktionismus; in: Hans Jörg Sandkühler; Wirklichkeit und Wissen. Realismus, Antirealismus und Wirklichkeits-Konzeptionen in Philosophie und Wissenschaften.; Frankfurt, 1992; S. 189.
[63] Hierbei stellt sich nun wiederum die Frage nach der Relevanz von Empirie: Was ist Empirie im naturalistisch-reduktionistischen Diskurs? Wie verhalten sich diese Empirie und Theorien über die Wirklichkeit-Wissens-Beziehung zueinander?
[64] Die methodologisch motivierte Einführung des transzendentalen Apriorismus ist von starken Rationalitätsannahmen geleitet, welche auf die Sicherung der Synthesis der Erfahrung und auf einen epistemischen Egalitarismus zielen. Solche Annahmen besitzen einerseits eine philosophisch erfolgreiche Historie seit Galilei und Bacon und andererseits eine erprobte Nähe zum Erkenntnistypus der Naturwissenschaften und den aus ihnen entstandenen kritischen Wissenschaftsphilosophien.
[65] Gaston Bachelard obstruierte sich einem induktivistischen Empirismus, einem sich mit allen Mitteln des Alltagsverstands bescheidenden Rationalismus, einem Positivismus purer Faktizität und dem Evolutionismus einer die Wissensgeschichte linear und kumulativ beschreibenden Wissenschaftsgeschichte und –theorie. Seine Epistémologie vereint die Dialektizität und Diskontinuität der Wissens- und Wissenschaftsentwicklung, einen “rationalen Materialismus”, sowie die Annahme einer für die Dynamik und Objektivität der Wissenschaft notwendigen coupure épistémologique (eines epistemologischen Einschnitts in die Erfahrung) zwischen Alltags- und Wissenschaftswissen.
[66] Putnam, H.; Wahrheit, Vernunft und Geschichte; Frankfurt, 1986; S. 75.
[67] Putnam, H.; How to be an Internal Realist and a Transcendal Idealist (at the same time); in: Sprache, Logik und Philosophie. Akten d. 4. Intern. Wittgenstein-Symp.; hg. v. R. Haller/W. Grasserl; Wien, 1982; S. 94.
[68] Trotzdem muß sich die philosophische Epistemologie weiterhin die Frage nach den Invarianzen und möglichen Transformationsregeln bezüglich der Pluralität konzeptueller Schemata stellen, allein aus dem Grund, daß auch ein nicht-certistischer Rationalismus einer kohärenztheoretischen Wahrheitskonzeption bedarf. Und die empirische Kognitions-forschung muß ihr Forschungsprogramm auf die Gesamtheit der mentalen (einschließlich der intellektiven) Vermögen empirischer Subjekts ausweiten.
[69] Thomas Metscher – “Episteme”: Wissen als anthropologisches Datum. Grundsätze einer elementaren Epistemologie (Votum zu Hans Sandkühler); in: Hans Jörg Sandkühler; Wirklichkeit und Wissen. Realismus, Antirealismus und Wirklichkeits-Konzeptionen in Philosophie und Wissenschaften.; Frankfurt, 1992; S. 223.
[70] Aus den je verschiedenen onto-epistemologischen Grundannahmen welche in einem Paradigma zusammengefaßt werden (Entwurf eines wissenschaftsphilosophischen Prätheoriekonzeptes, mittels ontologischer, methodologischer und epistemo-logischer einschränkender Bedingungen (wissenschaftsleitende Normen oder Werte und metaphysische Prinzipien)) resultieren stringenter Weise jeweils unterschiedliche theoretische Forschungsansätze mit je signifikanten Perspektiven und Fragestellungen. In der Soziologie zeigt sich dies an der Pluralität der Theorieansätze: Interaktionismus, Phänomenologie; Ethnomethodologie, Konstruktivismus; Spiel- und Entscheidungstheorie; Systemtheorie; Wissenschaftstheorie des Kritischen Rationalismus; (dialektischer) Materialismus; Sozialbehaviorismus und Pragmatismus.
[71] D’Avis, Winfried; Können Computer denken? Eine bedeutungs- und zeittheoretische Analyse von KI-Maschinen; Frankfurt, 1994; S.358.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Muthig (Autor:in), 2000, Realität und Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6028
Kostenlos Autor werden



















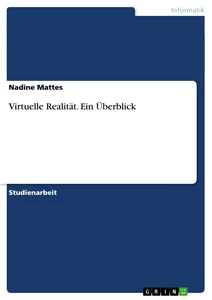



Kommentare