Leseprobe
Inhalt
0) Einleitung
1) Historischer Abriß
1.1) Erbkrank und unheilbar
1.2) Versorgt und verwahrt
1.3) Entpsychiatrisiert und individualisiert
1.4) Subventioniert und legalisiert
1.5) Therapiert und isoliert
1.6) Integriert und selbstbestimmt
2) Zentrale Leitbilder in der Behindertenarbeit
2.1) Das Normalisierungsprinzip
2.1.1) Normaler Tagesrhytmus
2.1.2) Normaler Wochenrhytmus
2.1.3) Normaler Jahresrhythmus
2.1.4) Normaler Lebenslauf
2.1.5) Respektierung von Bedürfnissen
2.1.6) Angemessener Kontakt zwischen den Geschlechtern
2.1.7) Normaler wirtschaftlicher Standart
2.1.8) Standards von Einrichtungen
2.2) Integration
2.3) Selbstbestimmtes Leben
2.3.1) Assistenzkonzept
2.3.2) Kundenmodell
2.3.3) Empowerment
2.3.4) Regiekompetenz
2.3.5) Self-Advocacy
2.3.6) Trialog
3) Metatheoretische Erwägungen
3.1) Erziehungswissenschaftliche Aspekte
3.2) Anthropologische Sichtweise
4) Praktische Überlegungen
4.1) Heimalltag und Realität
4.1.1) Beispiel Paul
4.1.2) Beispiel Inge
4.2) Perspektiven und Möglichkeiten der Umsetzung
5) Konsequenzen für das Selbstverständnis der Begleiter
6) Anhang
Literaturverzeichnis
0) Einleitung:
„Das Streben der Menschen nach Individuation und die damit einhergehende Forderung nach Gleichheit aller Menschen bildet eine der Grundlagen, auf denen unser demokratisches Gerechtigkeits-prinzip beruht. Der wesentliche Zweck des Gerechtigkeitsprinzips be-steht darin, den einzelnen vor mißbräuchlichen Übergriffen anderer zu schützen“ (WILKEN 1996, S. 41).
Daß ich das im folgenden beschriebene »Paradigma der Selbstbestimmung« auf Menschen mit geistiger Behinderung beziehe und beschränke, die in einem Heim leben, hat drei Gründe: Zum einen wegen des mitunter häufigen Bedarfs einer Anwaltschaft, bzw. Fürsprache und somit auch Einflusses durch den Betreuer eines geistig behinderten Menschen, zum anderen wegen der essentiellen psychologischen Bedeutung des ›Wohnens‹ im Leben eines Men-schen und zuletzt wegen meines nunmehr bald zehnjährigen Erfah-rungshintergrundes in der stationären Behindertenarbeit.
Der zwischen ›behinderten Menschen‹ und ›Behinderten‹ wechselnde Terminus hat keine inhaltliche Relevanz, soll hier ledig-lich die vielen Wortwiederholungen dezimieren.
„Die im Jahre 1994 vom Gesetzgeber beschlossene Erweite-rung des Grundgesetzes durch das Diskriminierungsverbot behinder-ter Menschen erinnerte uns erneut daran, daß auch Menschen mit einer Behinderung, auch wenn sie im Heim ›untergebracht sind‹, Träger von Grundrechten sind. [...] Durch GG Art. 2.1 ist nicht nur die Freiheit des nichtbehinderten und durchschnittlichen Bürgers ge-schützt, sondern auch und gerade die Freiheit des anderen, des Kranken, des behinderten Menschen, aber auch die Freiheit zum Anderssein“ (WOHLHÜTER 1996, S. 355).
Da der Mensch im Gegensatz zum Tier nicht über den ange-borenen Instinkt verfügt, sich eine ökologische Nische zu suchen, muß er sich etwas einfallen lassen, um sein Überleben zu sichern. Damit er mit sich und seiner Umwelt im Einklang leben kann, muß seinen Wohnbedürfnissen Rechnung getragen werden (vgl. FLADE 1987).
Gerade in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen muß dieser Erkenntnis eine besondere Bedeutung beigemessen werden, da diese meist nur begrenzt in der Lage sind, ihre Wohnung, bzw. ihre Wohngruppe selber zu gestalten oder auf die Abläufe und Struk-tur eines Heimbetriebes wesentlich Einfluß zu nehmen. Hier sind sie oftmals auf Gedeih und Verderb auf ihre Betreuer angewiesen.
Mit dem Begriff ›Wohnen‹ assoziieren wir Gefühle, wie Gebor-genheit, Ungezwungenheit, Alleinsein und Ruhe, oder Nähe zu ver-trauten Personen, aber auch Konflikte mit Nachbarn oder die resi-gnative Anpassung an nicht bedürfnisgerechte Wohnverhältnisse. Schließlich schafft sich der Mensch durch Bauen einer Behausung nicht nur einen Schutz vor Witterungseinflüssen, vielmehr hat er einen wichtigen und festen Bezugspunkt, von dem nach BOLLNOW (in a.a.O.) alle Wege eines Menschen ausgehen und wieder zu-rückführen, der die Lebensmitte und der Ort ist, an dem er wohnt und wo er zu Hause ist. Heimkehren können bedeutet, verwurzelt zu sein und hat einen elementaren Stellenwert im Leben eines Menschen.
„Unsere Wohnung bietet uns Schutz und Geborgenheit. Sie er-möglicht uns, allein zu sein oder mit anderen zusammenzuleben. Sie ist ein Stück unmittelbare Umwelt. Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sind [...] fast ausnahmslos auf stationäre Heimeinrichtungen angewiesen. Die Wohneinrichtung soll dem Men-schen mit Behinderung alles ermöglichen, was wir alle in unseren vier Wänden für selbstverständlich halten“ (DAS BAND 1998, S. 1).
Daß dieser fundamentalen Rolle des ›Wohnens‹ geistig behin-derter Menschen von den ›Milieu gestaltenden‹ Profis und Kosten-trägern nicht ausreichend Rechnung getragen wird, ist Grundlage und Gegenstand meiner Beanstandungen.
WOHLHÜTER schreibt, daß „eine innere Umstrukturierung und eine Abkehr von altem Betreuungsdenken notwendig sind, um den Menschen in diesen Einrichtungen Bedingungen zu schaffen, die dem näher zu kommen, was Wohnen in Selbstbestimmung bedeutet. [...] Ziel muß es sein, unter den Bedingungen eines Heimes dem par-tizipativen Grundrecht mehr Raum zu verschaffen. Behinderte Men-schen sollen mehr selbstbestimmen können und weniger fremdbe-stimmt sein“ (1996, S. 354 ff).
Bevor ich dem ›Paradigma der Selbstbestimmung‹ in seiner praktischen Konsequenz Gestalt verleihe (vgl. Kap. 4), wird im theo-retischen Teil (vgl. Kap. 3) der Versuch unternommen, metatheore-tische Grundlagen zu diskutieren, die dieses Paradigma legitimieren, bzw. ein Umdenken in der stationären Behindertenhilfe zwingend er-fordern. Um den historischen und fachlichen Hintergrund zu schaffen, werden erst (vgl. Kap. 2) relevante Leitbilder und Grundlagen der Be-hindertenhilfe erläutert und zuvor ein knapper historischer Abriß der jüngeren deutschen Entwicklung gegeben (vgl. Kap. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Bierdeckel der »Aktion Grundgesetz« am 5. Mai 1997 (Euro-päischer Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen).
1) Historischer Abriß
Die historische Entwicklung im Umgang mit geistig behinderten Menschen macht eine sich verändernde gesellschaftliche Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen deutlich. Wenngleich diese Haltung bereits mit der Ausbreitung und Anerkennung des Christen-tums weitgehend durch eine christliche Ethik geprägt und Fürsorge von Behinderten ein selbstverständlicher Akt der Nächstenliebe war, so stellt die Zeit des Nazionalsozialismus in Deutschland eine derart massive Zäsur dar, daß ihr Ende meines Erachtens den Beginn eines Neuanfangs markiert und deshalb hier in den Focus der Betrachtung gestellt werden soll.
In der deutschen Nachkriegsgeschichte galten in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen Handlungsansätze, die sich mit den Begriffen ›Verwahren‹ und ›Fördern‹ umreißen lassen (vgl. HÄHNER 1998a, S. 25).
Die Forderung nach einem selbstbestimmten Leben geistig be-hinderter Menschen ist neu und verunsichert zunächst, wie es bei ähnlich auffordernden Prinzipien in der Vergangenheit entsprechend war. In den 60er und 70er Jahren wurde Rehabilitation und Förde-rung statt Verwahrung gefordert, in den 70er und 80er Jahren Nor-malisierung statt Besonderung und in den 80er und 90 Jahren wurde die Forderung nach Integration laut (vgl. BRANDL 1996, S. 363).
Der im Folgenden behandelte Schlüsselbegriff der Selbstbe-stimmung hatte seinen Ursprung bereits Ende der 60er Jahre in der »Independent-Living-Bewegung«, einer Bürgerbewegung körperbe-hinderter Menschen in den USA. Hieraus entwickelte sich bezogen auf Menschen mit einer geistigen Behinderung die »People-First«-Bewegung (People first = Zuerst sind wir Menschen), deren Forde-rungen in Deutschland jedoch erst ab Mitte der 80er Jahre Einfluß auf die Arbeit mit geistig Behinderten zu nehmen begann (vgl. HÄHNER, 1998a, S. 37 ff)).
Obwohl die »Selbstbestimmt-leben«-Forderung kein grundsätz-lich neues oder revolutionäres Gedankengut enthält, kratzt sie wie kein anderer Paradigmawechsel ganz erheblich am Selbstverständ-nis der meisten Pädagogen und beginnt, deren bisherige Auffassung von Behinderung in Frage zu stellen.
Ein Blick in die deutsche (ehem. DDR ist nicht berücksichtigt) geschichtliche Entwicklung der Behindertenhilfe seit 1945 soll dies veranschaulichen.
1.1) Erbkrank und unheilbar
Das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« wurde 1933 von den Nationalsozialisten erlassen und legitimierte so die Zwangssterilisation von einigen hunderttausend Menschen.
Nach Kriegsbeginn sorgte Hitler durch einen Geheimerlaß für den »Gnadentod für unheilbar Kranke«, was die systematische Er-mordung Behinderter und psychisch Kranker in den Tötungsanstalten der Euthanasie, sowie die Tötung in psychiatrischen Einrichtungen durch Hunger, Überdosierung von Medikamenten und Nichtbehand-lung von Krankheiten beinhaltete (vgl. HÄHNER 1998a, S. 25 ff).
1.2) Versorgt und verwahrt
Nach dem Krieg wurden die geistig behinderten Menschen von teilweise gleichem Personal in den gleichen psychiatrischen Kran-kenhäusern betreut. Träger waren Wohlfahrtsverbände und Bundes-länder als Träger der psychiatrischen Krankenhäuser. Diese psych-iatrischen Krankenhäuser, Anstalten und Oligophrenenabteilungen waren in ihrer Struktur unverändert geblieben. Das Konzept war eine karitativ motivierte pflegerische Versorgung der behinderten Men-schen, wobei ›Behinderung‹ zwangsläufig die Diagnose ›Pflegefall‹ zur Folge hatte und somit zur Einweisung und Anstaltsunterbringung führte. In die Oligophrenenabteilungen der Psychiatrien eingewiese-ne Menschen mußten sich aufgrund dieser Etikettierung weitgehend im Bett aufhalten.
Die Unterbringung von geistig behinderten Menschen in Psy-chiatrien stellte nach dem Krieg die Normalität in Deutschland dar. THEUNISSEN bezeichnet das hier zu Grunde liegende Menschen-bild als »biologistisch-nihilistisch« (in HÄHNER 1998a, S. 26).
Aussagen wie »bildungsunfähig«, »total spielunfähig« oder »lernunfähig« weisen auf einen unveränderbar angesehenen fest-stehenden Defekt hin, der ein normalen menschlichen Lebenslauf und Selbstverwirklichung unmöglich macht. Vor diesem Hintergrund beschränkte sich die Betreuung der Menschen auf eine rein pfle-gerische Versorgung der ›Patienten‹ (vgl. a.a.O., S. 26 ff). Es ist festzustellen, daß viele der vermeintlichen Defekte und Auffällig-keiten bei Menschen mit geistiger Behinderung durch die Anstalts-unterbringung begründete auffällige Verhaltensweisen waren.
„Der Patient verschließt sich langsam immer mehr in sich selbst, wird energielos, abhängig, gleichgültig, träge, schmutzig, oft widerspenstig, regrediert auf infantile Verhaltensweisen, entwickelt starre Haltungen und stereotype Ticks, paßt sich einer extrem beschränkten und armseligen Lebensroutine an, aus der er nicht einmal mehr ausbrechen möchte. [...] Wenn man einem Insassen seine menschliche Würde nimmt, wird sein Verhalten unwürdig und unmenschlich, wenn er dauernder Bewachung, brutalen Freiheitsbe-schränkungen, Mißbrauchshaltungen und psychischen Gewalttätig-keiten ausgesetzt ist, wird sein Verhalten um so ärmer, würdeloser, feindseliger, verzweifelter und gewalttätiger“ (JERVIS zit. in HÄHNER 1998a, S. 27).
1.3) Entpsychiatrisiert und individualisiert
Die Psychiatrie-Enquête (Enquête = Untersuchung) einer Sach-verständigen-Kommission stellt im Jahre 1975 fest, „daß von einer Minderzahl eindeutig krankenhausbedürftiger geistig Behinderter ab-gesehen, das psychiatrische Krankenhaus für die Behandlung und Betreuung dieser Personengruppe nicht geeignet ist. Geistig Behin-derte bedürfen in erster Linie heilpädagogisch-sozialtherapeutischer Betreuung, die ihnen in der Regel in hierfür geeigneten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses angeboten werden sollte“. Die Bedin-gungen seien „elend“ und „zum Teil menschenunwürdig“. Fast 1/5 aller in psychiatrischen Einrichtungen Untergebrachten waren Men-schen mit einer geistigen Behinderung (vgl. TEUNISSEN in a.a.O.).
Die Empfehlung, Behinderteneinrichtungen außerhalb psychia-trischer Einrichtungen zu installieren wurde zuerst vom Landschafts-verband Rheinland (LVR) übernommen. Es wurden eigenständige Heime eingerichtet, die Forderung nach Dezentralisierung und dem Ausbau kleiner, gemeinwesenorientierter Hilfsangebote wurde ge-stellt (vgl. HÄHNER 1998a, S.27).
Am Beispiel des in den 80er Jahren in Bremen aufgelösten Klosters Blankenburg als psychiatrische Einrichtung, in der zirka 300 geistig und psychisch behinderte Menschen lebten, macht NIEHOFF deutlich, welche Teile der Arbeit, neben dem tatsächlichen Umzug, „die Entpsychiatrisierung umfaßte:
- Individualisierung der Betreuung der Bewohner;
- Rehistorisierung der Biographie der einzelnen durch
Gespräche über Kindheit und Jugend, Besuche in der Heimat
und der Angehörigen, Aufstöbern alter Photographien usw.;
- Strukturierung des Alltags mit Ruhe- und Entspannungs-
phasen;
- Anregung zur Eigentätigkeit;
- Erweiterung des Lebensraums;
- Reisen und Besuche in Bremen;
- Wohnungs- und Möbelsuche“ (in a.a.0., S. 28).
Nur durch das gemeinsame Vorgehen von Politik und Wissen-schaft mit den Praktikern wurde dieser Schritt der Enthospitalisierung möglich, was einen wesentlichen Beitrag zur Humanisierung der Ar-beit mit behinderten Menschen in der Bundesrepublik darstellte.
1.4) Subventioniert und legalisiert
Die 60er Jahre bezeichnet HÄHNER als die »Dekade des Auf-bruchs« (a.a.O.), in denen wichtige sozialpolitische Entscheidungen getroffen wurden. Im Jahre 1961 wurde das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) erlassen, in dem nach dem Subsidiaritätsprinzip der Vor-rang der freien Wohlfahrtspflege beim Ausbau und der Errichtung von Einrichtungen der Behindertenfürsorge festgesetzt wurde.
Die Elternverbände »Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind« und der »Verband für spastisch Gelähmte und andere Körper-behinderte« wurden Ende der 50er Jahre gegründet. Da in den 50er Jahren noch keine Kindergärten und Schulen für behinderte Kinder existierten, waren Eltern um die Gründung von Vereinen bemüht, die ihnen Entlastung verschafften.
Die 60er und 70er Jahre waren – auch dank des wirtschaft-lichen Aufschwunges – durch die Gründung vieler Förder-, Rehabili-tations- und Sondereinrichtungen gekennzeichnet. 1964 konnte man im ZDF zum ersten Mal die Sendung »Aktion Sorgenkind« sehen, in der durch eine publikumswirksame Mixtur aus Show, Quiz, Lotterie und karitativem Gedanken nicht unerhebliche Gelder in die Einrich-tungen der Behindertenhilfe flossen – im übrigen auch heute noch kein unwesentlicher Hilfefaktor. „Zementiert wurde dabei allerdings die gesellschaftliche Tendenz, den Umgang mit (und das heißt immer häufiger die Therapie von) behinderten Menschen außerhalb von Re-geleinrichtungen zu realisieren und speziellen Fachleuten zu übertra-gen. Aktion Sorgenkind gab damit dem gesellschaftlichen Umgang mit Behinderten keine eigenen neuen Impulse, sondern griff Entwick-lungen und Tendenzen auf und verstärkte bzw. verbreitete sie unterm Publikum“ (HEILER zit. in HÄHNER 1998a, S. 29).
Das von Eltenverbänden motivierte Durchsetzen des Rechts auf Schulbesuch von geistig behinderten Kindern wurde nicht zuletzt durch das vermehrte öffentliche Interesse forciert.
1.5) Therapiert und isoliert
Das Phänomen ›Geistige Behinderung‹ wurde zunehmend für die Wissenschaft interessant, so daß Mitte der 60er Jahre das vermehrte Interesse an einer neuen Fachdisziplin für die Schaffung des ersten Lehrstuhls für Geistigbehindertenpädagogik sorgte. Die Dominanz der Medizin wurde sukzessive durch den pädagogischen Umgang mit behinderten Menschen abgelöst. Von 1962 an erschien die Vierteljahreszeitschrift »Lebenshilfe«, die 1980 in die Fachzeit-schrift »Geistige Behinderung« umgewandelt wurde.
Ein »pädagogisch-optimistisches Menschenbild« ersetzt nach NIEHOFF (in HÄHNER 1998a, S. 30) das »biologistisch-nihilistische Menschenbild« (THEUNISSEN).
„Der Pessimismus um die Entwicklungsmöglichkeiten von Men-schen mit Behinderungen wich einer insgesamt optimistischen Auf-fassung. Menschen mit Behinderungen wurden nicht mehr verwahrt und gepflegt, man begann sie zu behandeln, zu fördern. Förderung wurde zum zentralen Begriff in der Behindertenpädagogik“ (HÄHNER a.a.0.).
Das entstehende Fördersystem beinhaltete WfBs, Sonder-schulen für geistig Behinderte, Sonderkindergärten, Frühförderstel-len, Wohnheime, behindertenspezifische Freizeit- und Sportangebo-te. Der behinderte Mensch wurde so von Fachleuten betreut, die unter dem Mantel des Förderns die Menschen mit Behinderung an die Welt der ›Normalen‹ anzupassen versuchten. 1974 ersetzt das Schwerbehindertengesetz das Schwerbeschädigtengesetz, so daß es sich auf alle Menschen mit Behinderungen anwenden läßt (vgl. a.a.O.).
Im Zuge des Aufschwunges und der Professionalisierung in Re-habilitation, Sonderpädagogik, Förderung und Therapie entwickelte sich ein stark expertengeprägtes Bild von Behinderung und zeigte im-mer deutlicher Auswüchse, die auf eine Entfremdung vom Menschen hinweisen.
„Die praktische Hilfe wird zur lebenspraktischen Förderung, die Kontaktaufnahme zur basalen Förderung, das Einkaufengehen zur sozialtherapeutischen Maßnahme. Der Begriff der »Förderkette«, al-so das Durchlaufen bestimmter Förderstufen, symbolisiert in beson-derer Weise dieses Denkmodell: Aufnahme und Akzeptanz in die ›normale‹ Gesellschaft erfolgt erst, wenn ein bestimmtes Maß an Hil-febedarf abgebaut und ein gesellschaftlich akzeptierter Grad an Selb-ständigkeit erreicht ist (Selbständigkeits-Förderung)“ (BRADL 1996, S. 369).
Bereits in den 70er Jahren wurde diese Problematik des Reha-bilitationsgedanken deutlich. „Man sprach von »Isolationskarrieren«, die mit dem Eintritt in die Frühförderung beginnen und über Sonder-kindergärten und Sonderschulen in Werkstätten für Behinderte mün-den“ (HÄHNER 1998a, S. 31).
1.6) Integriert und selbstbestimmt
Kennzeichnend für die beginnenden 80er Jahre war die Rück-nahme der Leistungen und Einschränkungen, da die Kassen sich leerten. 1981 lautete das deutsche Motto des internationalen Jahres der Behinderten »Einander Verstehen – Miteinander Leben«. Damit die Erfahrungen dieses Jahres auch genutzt werden konnten, wurde von der UNO 1983 – 1993 die »Dekade der Behinderten« ausgeru-fen.
Insgesamt wandelte sich das Selbstbewußtsein behinderter Menschen, vor allem der körperbehinderten. Geistig behinderte Men-schen bedurften zunächst der Anwaltschaft ihrer Eltern bzw. innova-tiv engagierter Profis so fand 1982 in Dortmund erstmals ein Treffen der »Eltern gegen Aussonderung« statt. Es wurde Kritik an den be-stehenden Sondereinrichtungen geübt, statt dessen Integration gefor-dert (vgl. a.a.O.).
Es findet eine Umorientierung im Denken statt; neben dem Be-griff der »Normalisierung« gewinnt der Faktor »Lebensqualität« an Bedeutung. Nach SPECK steht nicht mehr der behinderte Mensch al-lein im Brennpunkt der Betrachtung, sondern der „behinderte Mensch in seiner Lebenswelt“ (1998, S. 20).
„Vom Defizitwesen zum Dialogpartner“ verändert sich der geistig behinderte Mensch laut GOLL (in HÄHNER 1998a, S. 32) in der Wahrnehmung der Experten. Daß vermehrt vom ›Menschen mit geistiger Behinderung‹, statt vom ›Geistigbehinderten‹ gesprochen wird, ist Ausdruck einer neuen Sichtweise. Der geistig Behinderte wird als Mensch mit Bedürfnissen wahrgenommen und im Dialog als Individuum mit Fähigkeiten erlebt. Normalisierung scheint nicht mehr nur das Schaffen der Möglichkeiten zu meinen, die dem Behinderten ein dem Nichtbehinderten ähnliches Leben erlauben, vielmehr be-zeichnet es heute auch die „Normalisierung der Beziehungen und des Dialogs“ (vgl. a.a.O.).
Die Zunahme von mobil-ambulanten, ›offenen‹ Hilfen, Freizeit-clubs sowie Fortbildungsangeboten für geistig behinderte Menschen sind Merkmale eines anderen, sich weiter entwickelnden Bewußt-seins, das Individualität und Lebensgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung in den Mittelpunkt der Bemühungen stellt.
2) Zentrale Leitbilder in der Behindertenarbeit
Seit Beginn der Professionalisierung der Behindertenhilfe in Deutschland nach dem Krieg sahen sich Helfer wie Betroffene regel-mäßig mit neuen Leitbildern und Modellen konfrontiert, die die Arbeit mit behinderten Menschen in unterschiedlicher Intensität beeinfluß-ten.
Neue Prinzipien und Paradigmen besitzen Aufforderungscha-rakter, sind zunächst eher allgemein, problematisieren und stellen die bis dahin scheinbar bewährte Praxis immer ein bißchen in Frage (vgl. BRADL 1996, S. 363).
Manche einst revolutionären Ansätze sind mittlerweile längst etablierte Handlungsgrundsätze und aus der Praxis nicht mehr weg-zudenken. Im Folgenden sollen die für das Thema Selbstbestimmung relevanten Grundbegriffe erläutert und handlungspraktisch mit Inhalt gefüllt werden.
2.1) Das Normalisierungsprinzip
Das Normalisierungsprinzip entwickelte sich in Dänemark aus der Kritik, vornehmlich von Eltern geistig Behinderter, an der damals bestehenden Versorgungspraxis behinderter Menschen.
Es wurde in erster Linie die Auflösung großer Einrichtungen, die Wahrnehmung der Rechte behinderter Menschen und die Humani-sierung ihrer Lebensbedingungen gefordert. Diese Kritik führte 1959 zu dem ›Gesetz über die Fürsorge für geistig Behinderte‹, in dem der Gedanke der Normalisierung erstmals aufgegriffen wurde (vgl. THIMM 1994, S. 33 ff).
Diese erste Formulierung des Normalisierungsprinzips stammt von dem Dänen Bank Mikkelsen. So heißt es in dem bereits erwähn-ten Dänischen Gesetz zur Sozialfürsorge: „Normalisierung bedeutet hier als Leitziel, dem geistig behinderten Menschen ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen, ihm also normale – im Sinne von ty-pischen, den anderen Bürgern des Landes vergleichbare – Lebens-bedingungen zu verschaffen.“ Bank Mikkelsen war Jurist und Sozi-alpolitiker und wurde bei der Vorbereitung zur Reform der dänischen Sozialgesetzgebung auf die Mißstände in den großen stationären Einrichtungen für »Geisteskranke« aufmerksam. Diese Menschen lebten isoliert von der Gesellschaft. Ihre Lebensbedingungen wichen in eklatanter Weise von denen der anderen Gesellschaftsmitglieder ab, so daß in der Präambel vom „Gesetz über die Fürsorge für geistig Behinderte und andere besonders schwach Begabte“ die generelle Forderung erhoben wurde, daß „geistig behinderte Menschen ein Leben so normal wie möglich führen können“ (Dänisches Sozial-gesetz 1959).
Der Maßstab und die Forderung „ein Leben so normal wie mög-lich“ stellte die treibende Kraft der nun einsetzenden Reform der großen stationären Einrichtungen und ihrer schrittweisen Ersetzung durch kleinere Versorgungsinstitutionen dar. Dieser Gedanke der Normalisierung wurde zunächst in Schweden aufgegriffen, wo die ersten praktischen Versuche der Umsetzung erfolgten (vgl. THIMM 1994, S. 35).
Das Normalisierungsprinzip wird mißverstanden, wenn man lediglich die »Normalisierung der Behinderten« meint, vor dem Hin-tergrund der Vorstellung, daß der Mensch mit Behinderung selbst durch Verhalten und Erscheinung zur eigenen Stigmatisierung bei-trägt. Das Trainieren von Basisfunktionen, lebenspraktische Förde-rung sowie das Erlernen einfacher Umgangsformen sollte zur Norma-lisierung des behinderten Menschen beitragen (vgl. HÄHNER 1998a, S. 43).
Hinsichtlich der Normen einer Gesellschaft erfährt das Normali-sierungsprinzip bei dem Amerikaner Wolfensberger eine Weiterent-wicklung. Maßgebend sei, was normal, üblich oder typisch ist. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer Aufwertung der sozialen Rolle von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Grundsätzlich ist für ihn Normalisierung gleichzusetzen mit physischer und sozialer Integration (vgl. SPECK 1998, S. 411 ff).
Zwar nimmt die Erziehung zur Unauffälligkeit und zur Anglei-chung an die ›Normalen‹ innerhalb dieser Diskussion einen breiten Raum ein, jedoch kann Normalisierung nicht heißen, Menschen mit Behinderungen an die Gesellschaft anzupassen. Vielmehr muß die erschwerte Lebenslage Behinderter „zum Bestandteil sozialer Verant-wortung der Öffentlichkeit werden, das heißt, Gesellschaft muß die erschwerten Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen stärker als bisher zur Kenntnis nehmen und sich diesen anpassen“ (HÄHNER a.a.O.).
Selbstbestimmung zu ermöglichen, ist wesenhaft in der Norma-lisierung der Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behin-derung beinhaltet. Anhand von acht Merkmalen des Normalisierungs-prinzips soll hier diesem Zusammenhang nachgegangen werden.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dipl. Soz. Päd. Philip Schröder (Autor:in), 1999, Vom Prinzip der Normalisierung zum Paradigma der Selbstbestimmung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59754
Kostenlos Autor werden




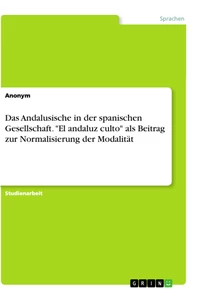
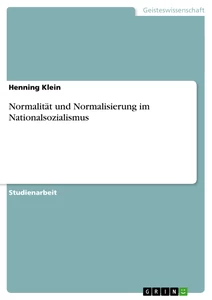
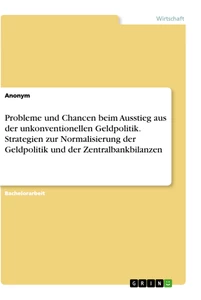


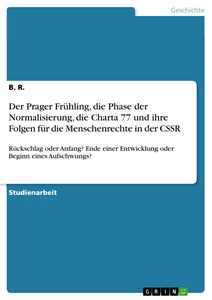




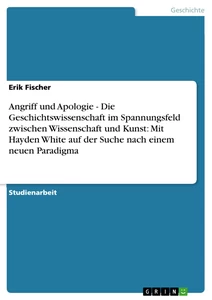




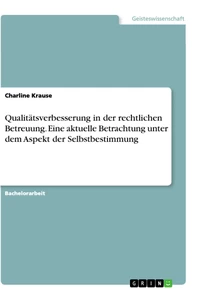
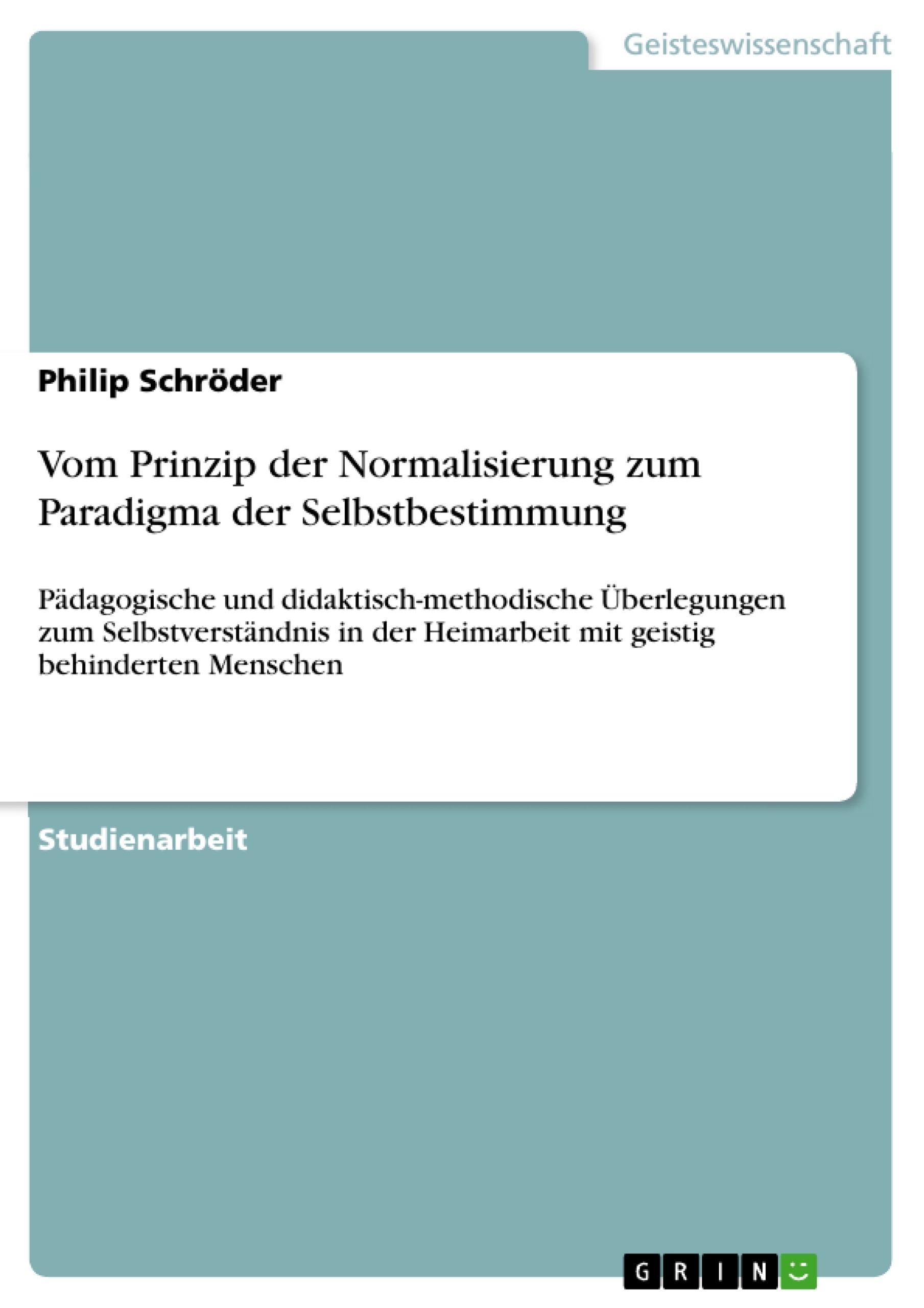

Kommentare