Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis / Abbildungsverzeichnis
Einleitung
I. Theoretische Entfaltung
A. Jugendliche und junge Erwachsene
1. Definitionen
2. Lebenslagen
2.1 Versorgungs – und Einkommensspielraum
2.2 Kontakt – und Kooperationsspielraum
2.3 Lern – und Erfahrungsspielraum
2.4 Muße – und Regenerationsspielraum
2.5 Dispositions- und Partizipationsspielraum
2.6 Psychische und physische Situation
B. Alkoholabhängigkeit
1. Begriffsbestimmung
2. Epidemiologie
3. Ursachen für Alkoholabhängigkeit
3.1 Entwicklungspsychologische Perspektive
3.2 Soziologische Perspektive
3.3 Neurobiologische Perspektive
3.4 Lebensweltorientierte Perspektive
3.5 Multifaktorieller Ansatz
3.6 Zusammenfassung
4. Verlauf und Bewältigung der Alkoholabhängigkeit
4.1 Verlaufsphasen nach Jellinek
4.2 Modell der Änderungsabsicht
4.3 Rückfall
5. Folgen von Alkoholkonsum und -abhängigkeit
5.1 Körperliche Folgeschäden
5.2 Soziale Folgen
5.3 Psychische Folgeschäden
6. Komorbidität
6.1 Psychische Störungen als Ursache für eine Sucht
6.2 Sucht als Ursache von psychische Störungen
6.3 Polytoxikomanie
C. Konzepte und Methoden
1. Konzepte
1.1 Begriffsbestimmung
1.2 Inhalte
1.3 Funktionen von Konzepten
2. Methoden
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Ordnungsversuch
II. Soziale Arbeit im Arbeitsfeld Sucht
A. Suchtkrankenhilfe
1. Historischer Hintergrund und aktuelle Strukturen
2. Abstinenzorientierter vs. Akzeptanzorientierter Arbeitsansatz
3. Hierarchie der Interventionsziele
B. Stationäre Versorgung junger Alkoholabhängiger
1. Entwöhnungseinrichtungen
1.1 Gesetzliche Grundlagen und Ziele
1.2 Aufgaben der Sozialen Arbeit
2. Zusammenfassung
C. Konzepte der Sozialen Arbeit mit jungen Alkoholabhängigen in der Praxis
1. Entwöhnungseinrichtung A
2. Entwöhnungseinrichtung B
3. Zusammenfassung und kritische Würdigung
D. Methoden der Sozialen Arbeit mit jungen Alkoholabhängigen
1. Case Management als Basismethode
1.1 Entwicklung
1.2 Die Grundlagen des Case Management
1.3 Ablauf des Case Managements
1.4 Case Management in der Suchtkrankenhilfe
2. Methodische Module im Case Management
2.1 Existenzsichernde Sozialarbeit
2.1.1. Schuldnerberatung
2.1.2. Hilfe bei Wohnungsproblemen
2.1.3. Bundesagentur für Arbeit
2.2 Motivierende Sozialarbeit
2.2.1. Der Begriff der ‚Motivation’
2.2.2. Motivation in der Therapie
2.3 Krisenintervention
2.3.1. Krise
2.3.2. Ablauf
3. Case Management in der Entwöhnungseinrichtung mit jungen Alkoholabhängigen
3.1 Erstkontakt
3.2 Aufnahme
3.3 Behandlung
3.4 Abschluss
3.5 Nachsorge
III. Ausblick
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Konzentrische Kreise des Netzwerkes
Abbildung 2: Altersverteilung der Behandelten in ambulanten und stationären Einrichtungen der Suchthilfe
Abbildung 3: Entwicklungsaufgaben und die Funktionen des Substanzkonsums
Abbildung 4: Trias der Entstehungsursachen der Drogenabhängigkeit
Abbildung 5: Verhältnis von Konzept, Methode und Technik
Abbildung 6: Zielhierarchie für die Behandlung von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit
Abbildung 7: Der Case Management Prozess
Abbildung 8: Das Waagemodell
Hinweis:
Der einfacheren Lesbarkeit wegen wird im gesamten folgenden Text die männliche Schreibweise benutzt. Diskriminierung des einen oder Bevorzugung des anderen Geschlechts sind damit nicht verbunden. Zum anderen wird der Begriff ‚Sozialarbeiter’ synonym mit dem Begriff des ‚Sozialpädagogen’ verwendet, ebenso die Begriffe ‚Klient’ und ‚Patient’.
Einleitung
Das einleitende Zitat von Hinte (2001) spricht eine der gegenwärtigen Debatten in der Sozialen Arbeit an: Sozialarbeiter „[…] sehen sich oft der vorwurfsvollen Frage ausgesetzt, was sie eigentlich für ihr Geld tun.“ (Galuske, 2005, 13) Diese Diskussion ist m. E. vor allem aufgrund des zunehmenden Kostendrucks, auf fast alle sozialen Einrichtungen, entstanden. Der Ruf der Kostenträger nach Qualitätsnachweisen und einer so genannten „evidence – based practise“ wird immer lauter. Folglich muss sich die Soziale Arbeit für ihr Handeln vor anderen Professionen rechtfertigen und sich dafür mit ihrer eigenen Identität beschäftigen. Einer Berliner Teilstudie zufolge neigen Sozialarbeiter, vor allem im Gesundheitswesen, zur Selbstabwertung. „Im Vergleich zu Ärzten und Pflegekräften fühlen sich Sozialarbeiter hinsichtlich der Grenzen ihrer Entscheidungs- und Verantwortungsbereiches sowie der Wirksamkeit ihrer Handlungen deutlich unsicherer. Zudem sind sie weniger stark mit der eigenen Berufsgruppe identifiziert.“ (Geißler- Piltz u.a., 2005, 20) Diese Tatsache kann nach Meinung der Autoren zu professionellen Verunsicherungen führen, weshalb sie klare Definitionen der Wissensbestände, der Methoden und der Zuständigkeiten der Sozialpädagogen fordern, um nicht als Hilfskräfte für Mediziner und Psychotherapeuten zu enden. (Geißler- Piltz u.a., 2005, 20) Das folgende Zitat von Terbuyken beschreibt dieses Spannungsverhältnis treffend: „Für die asymmetrische Beziehung zwischen Sozialarbeit und Medizin sind die Sozialarbeiter zum Teil selbst verantwortlich wegen ihrer Tendenz zur Selbstentwertung und auch aufgrund ihrer Chamäleonexistenz, der Anpassung an vorgegebene oder nur vermutete Rollen, Professionalitätsmuster, in Administrationen sowie in der Domäne der Medizin“ (Terbuyken zit. in Geißler- Piltz u.a., 2005, 19)
In dieser Diskussion wird m. E. die Notwendigkeit von professionellen und vor allem speziellen sozialarbeiterischen Konzepten und Methoden deutlich: Wenn die Soziale Arbeit den Anschluss an die anderen Professionen nicht verlieren will, muss sie einerseits nach innen und andererseits nach außen hin kommunikationsfähig sein. Kommunikationsfähig ist sie aber nur, wenn sie sich über ihren ‚Kern’, ihre Methoden und Techniken im Klaren ist und dies somit auch nach außen hin repräsentieren kann. Für Hinte (2001) zeichnet sich kompetentes Handeln durch die Verfügung über theoretisches Wissen und Methoden aus. (vgl. Hinte, 2001, 15) Nachdem es in der Sozialen Arbeit aber nicht die Methode gibt, fordert Galuske (1998), dass die Professionsanhänger über ein breites Methodenrepertoire verfügen, um nicht Gefahr zu laufen die Problemlagen der Klienten an die Methoden anzupassen. Natürlich gibt es kein „Rezept“, wann welche Methode wie eingesetzt werden kann. Hilfreich ist es trotzdem über ein breites Methodenspektrum zu verfügen und dieses auch zu beherrschen. Dabei sollen die Methoden den jeweiligen „[…] Personen, Problemen, Situationen und Arbeitsfeldern angemessen[…]“ sein, um in den unterschiedlichen Situationen des sozialarbeiterischen Alltags professionell handeln zu können. (Galuske, 1998, 50)
In dieser Arbeit soll nun ein kleiner Beitrag zur Professionalisierung geleistet werden: Es sollen anhand einer ausgewählten Zielgruppe exemplarisch Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit dargestellt werden. Ich möchte mich im Folgenden speziell mit Konzepten und Methoden der Sozialen Arbeit mit jungen Alkoholabhängigen beschäftigen, da erstens die Alkoholkonsumrate unter Jugendlichen in den letzten Jahren stark zugenommen hat und man zweitens „[…] – auch international – in der Literatur kaum Bezugnahme auf Behandlungsstrategien bzw. Behandlungsprogramme für jungendliche Alkoholiker […]“ (Preinsperger, 1996, 49) finden kann.
Zunächst sollen aber Begriffe wie ‚Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene’, „Alkoholabhängigkeit’, ‚Konzepte’ und ‚Methoden’ theoretisch bestimmt werden, um schließlich einen exemplarischen Ablauf einer ausgewählten Methode in der Praxis darzustellen.
I. Theoretische Entfaltung
A. Jugendliche und junge Erwachsene
1. Definitionen
In der Literatur sind viele verschiedene und unterschiedliche Definitionen von Jugendlichen oder Heranwachsenden und jungen Erwachsenen zu finden, deshalb wird hier nur eine kleine Auswahl vorgestellt:
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) unterscheidet Jugendliche, junge Volljährige und junge Erwachsene nach ihrem Alter. Laut § 7 KJHG ist ein Jugendlicher mindestens 14, aber noch nicht 18 Jahre alt, ein junger Volljähriger ist mindestens 18, aber noch nicht älter als 27 Jahre alt und ein junger Mensch ist, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. Friedrichs (2002) nimmt folgende Unterscheidung vor:
- Die 13- bis 17-jährige bilden die Jugendlichen im engeren Sinn,
- die 18- bis 20-jährigen sind die Heranwachsenden und
- die 21- bis 26-jährigen werden als junge Erwachsene bezeichnet
(vgl. Friedrichs, 2002, 133f)
Lenz (2000) ist der Meinung, dass eine Definition von ‚jugendlich’, ‚heranwachsend’ oder anderen Bezeichnungen „weder möglich, noch sinnvoll ist.“ (Lenz, 2000, 345) Stattdessen schlägt er eine „doppelt negative Abgrenzung von den beiden angrenzenden Lebensphasen“ vor. Zum einen ist ‚Jugendlicher’, wer nicht mehr Kind ist und zum anderen, wer noch nicht ‚Erwachsener’ ist. Diese Beschreibung alleine reicht für ihn aber zur Abgrenzung nicht aus. Die jeweiligen Statusübergänge müssen deshalb noch geklärt werden. Beim Übergang von Kind zum Jugendlichen ist die Geschlechtsreife ausschlaggebend, beim Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen, die Aufnahme einer dauerhaften Erwerbstätigkeit und die Heirat. Doch nachdem die Erwerbstätigkeit nicht zwangsläufig mit der Heirat, und umgekehrt, einhergeht, führt Lenz nun doch einen weiteren Begriff des „jungen Erwachsenen“ ein, mit dem er den unverheirateten Berufstätigen und den Verheirateten ohne Beruf bezeichnet. Allerdings ist auch bei diesem Definitionsversuch Kritik anzuführen, denn die Beschreibung vernachlässigt einige Faktoren: Frauen beginnen aufgrund von Schwangerschaften ihre Erwerbstätigkeit oftmals erst später als Männer, des Weiteren gibt es heutzutage immer mehr Menschen, die erst sehr spät oder überhaupt nicht heiraten, außerdem wird hierbei die Möglichkeit des „Hin- und Herwechseln zwischen Bildungs- und Berufssystem“ vernachlässigt. (Lenz, 2000, 245)
Für Schröder (2005) befindet sich die ‚Jugend’ in einem Auflöseprozess, denn es lässt sich zunehmend feststellen, dass die jugendtypischen Entwicklungsaufgaben nicht mehr nur in der Jugendphase bewältigt werden, sondern bis ins Erwachsenenalter mitgezogen werden. Ein klares Ende der Jugendphase ist somit nicht mehr erkennbar und kann von 18 bis über 30 Jahre reichen. In der Wissenschaft wird bereits von „Entstrukturierung“ oder „Defunktionalisierung“ gesprochen, denn ein allgemeiner und stabiler Weg durch die Jugendphase ist nicht mehr einheitlich feststellbar. (vgl. Schröder, 2005, 90)
Zu erkennen ist also eine relative Uneinigkeit der Autoren über die Abgrenzungen von Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter.
In den folgenden theoretischen Ausführungen möchte ich mich auf eine Altersdefinition festlegen und ‚junge Alkoholabhängige’ als Jugendliche in einem Alter von 13/14 Jahren bis hin zu einem Alter von 26/27 Jahren definieren.
Im nächsten Abschnitt soll nun der Blick auf die Lebenssituation der jungen Menschen geworfen werden und anhand des so genannten ‚Lebenslagenkonzeptes’ die Lebensbedingungen der Jugendlichen veranschaulicht werden.
2. Lebenslagen
Das Lebenslagenkonzept welches auf O. Neurath und G. Weisser, zurückgeht, kam bereits in den 20er – Jahren des letzen Jahrhunderts vor allem im Bereich von sozialpolitischen Diskussionen zum Einsatz. A. Amann und W.R. Wendt führten die Idee in den 80er – Jahren in die Soziale Arbeit ein. Das Lebenslagenkonzept in der Sozialen Arbeit dient nach Clemens (1994) vor allem dazu sozialarbeiterisches Handeln zu optimieren, indem es den Sozialarbeiter befähigen soll, zusammen mit dem Klienten durch die Beurteilung dessen Lage, effektive Hilfe zu erzielen. Wendt sieht Lebenslagen als den „objektiven Gegenstand sozialarbeiterischen Einsatzes.“ (Wendt, 1988, 83)
Nach Amann (1983) sind Lebenslagen „Konstellationen von äußeren Lebensbedingungen“, denen Menschen im Laufe ihres Lebens begegnen und aus denen kognitive und emotionale Deutungs- und Verarbeitungsmuster entstehen. Lebenslagen reagieren auf gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandel und verändern sich, womit der Begriff der Lebenslage dynamisch aufzufassen ist. „Menschen werden in Lebenslagen hineingeboren“, das bedeutet, dass sie nicht die Wahl zwischen bestimmten Lebensbedingungen haben und somit ihre „Start- und Entwicklungschancen“ bereits bei der Geburt festlegt sind. (Amann, 1983, 147) Der Begriff der Lebenslage beinhaltet nicht nur die Chancen, die ein Mensch in seinem weiteren Leben haben wird, sondern auch den „Spielraum, den der einzelne innerhalb dieser Verhältnisse […] zur Gestaltung seiner Existenz vorfindet und tatsächlich verwertet […]“. (Amann, 1983, 148)
Nahnsen sieht den Spielraum eines Menschen gesellschaftlich bedingt, denn „ Lebenslage (wird) begriffen als Spielraum, den die gesellschaftlichen Umstände des einzelnen zur Entfaltung und Befreiung seiner wichtigsten Interessen bieten.“ (Nahnsen zit. in Clemens, 1994, 144)
Nahnsen unterteilt die Spielräume in fünf verschiedene Dimensionen:
- Versorgungs- und Einkommensspielraum im „Umfang möglicher Versorgung mit Gütern und Diensten“
- Kontakt- und Kooperationsspielraum als Möglichkeit zur Pflege sozialer Kontakte und das Zusammenwirken mit anderen,
- Lern – und Erfahrungsspielraum in Bedingungen der Sozialisation, Internalisierung sozialer Normen, Bildungs- und Ausbildungsschicksale, Erfahrungen der Arbeitswelt, Grad beruflicher und räumlicher Mobilität
- Muße- und Regenerationsspielraum zur Kompensation der durch Arbeitsbedingungen, Wohnmilieu, Umwelt Existenzunsicherheit u.ä. hervorgerufene psycho- physischen Belastungen und
- Dispositionspielraum zur Mitentscheidung Einzelner in verschiedenen Lebensgebieten;
(Nahnsen zit. in Clemens, 1994, 145)
Im Folgenden soll nun nach diesen fünf Dimensionen die aktuelle Situation junger Menschen erfasst werden.
2.1. Versorgungs- und Einkommensspielraum
Nachdem das Einkommen eines Menschen ausschlaggebend ist für die Partizipation in verschiedenen Lebensbereichen, wie der Freizeit, kommt dieser Dimension eine wichtige Bedeutung zu, denn „mangelnde materielle Ressourcen erzeugen in vielen Lebensbereichen das Gefühl von mangelnder Steuerungsmöglichkeit.“ (Klug, 2003, 28)
Nachdem Jugendliche finanziell meist noch von ihren Eltern abhängig sind, entscheidet oftmals die Einkommenssituation der Eltern über deren finanziellen Spielraum. Sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass die Gruppe der Kinder und Jugendlichen am meisten von Armut bedroht ist. 1997 errechnete das Statistische Bundesamt, dass 2,8 Millionen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland in Armut leben, das heißt, dass jedes fünfte Kind und jeder fünfte Jugendliche bis 15 Jahren in Armut aufwächst. (vgl. Palentien, 2004, 193) Armut wird im Wesentlichen auf der Grundlage des verfügbaren, nach Haushaltsgrößen gewichteten Einkommens gemessen. (Ansen, 2006, 48) Die europäische Union geht von einer einheitlichen Armutsdefinition aus: Als arm gilt, wer in einem Haushalt lebt, dessen Äquivalenzeinkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens der gesamten Bevölkerung beträgt. (vgl. Statistisches Bundesamt, 2004, zit. in Ansen, 2006, 53)
Auch die soziale Ungleichheit in Deutschland wird immer größer: so existieren immer mehr Haushalte im Bereich der Armut bei gleichzeitigem Wachstum der Haushalte mit gehobenem Einkommen. (vgl. Palentien, 2004, 193) Somit ist der Versorgungs- und Einkommensspielraum der Kinder meist abhängig von dem der Eltern. Während der Schulzeit haben die meisten Kinder und Jugendlichen das Taschengeld als Einkommen und manchmal zusätzlich noch Nebeneinkünfte aus Nebenjobs. Zwar hat sich das durchschnittliche „Monatseinkommen“ der Jugendlichen im Vergleich zu den 50ern und 60ern des letzten Jahrhunderts enorm gesteigert, allerdings sind in dieser Zeit auch die Einkommen der Eltern und die Preise gestiegen. Mit Mit den steigenden Einkünften der Jugendlichen hat auch die Ausstattung mit Medien und mit anderen konsumtiven Gütern zugenommen und damit verbunden auch die Ansprüche.
Ferner spielt die Jugendarbeitslosigkeit eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit dem Versorgungs- und Einkommensspielraum, denn die „wachsende Arbeitslosigkeit bedroht die Jugendlichen nicht erst bei ihrem Eintritt in die Berufswelt, sondern greift über die Arbeitslosigkeit der Eltern schon früh in die kindliche und jugendliche Sozialisation ein.“ (Palentien, 2004, 193)
Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass Kinder von Besserverdienern, wie Beamten, eine viel höhere Chance haben einen höherqualifizierten Bildungsabschluss zu erreichen als Arbeiterkinder, was den Einfluss der finanziellen Situation der Eltern auf die Kinder verdeutlicht. Auch im Freizeit – und Konsumbereich ist der Einfluss deutlich zu sehen, denn die Ansprüche der Kinder an bestimmte Güter steigen, damit verbunden das Bedürfnis dem materiellen Status in der Peer Group zu genügen, was für die Kinder aus ärmeren Familien meist Ausgrenzung, Stigmatisierung und Rückzug zur Folge hat. Auch im familiären Bereich sind die Folgen von Armut zu spüren. Durch den wachsenden Druck in der Peer Group materiell „mithalten“ zu können und den finanziellen Beschränkungen der Elternseite, kommt es häufig zu Streit und Meinungsverschiedenheiten in der Familie, was wiederum Auswirkungen auf die schulischen Leistungen haben kann. (vgl. BMFSFJ, 2000, 146)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die finanzielle Situation der Familien in der Regel ausschlaggebend ist für den weiteren Lebensverlauf der Kinder. Klug (2003) beschreibt Armut als Ursache und Folge zugleich, so kann Armut Ursache für Erkrankungen und illegale Beschaffungswege als Folge des Scheiterns darstellen. Es entsteht ein „Teufelskreis aus moralischer (Selbst-)Verurteilung, Stigmatisierung und (Selbst-) Isolation.“ (Klug, 2003, 28)
2.2. Kontakt- und Kooperationsspielraum
Untersuchungen betonen immer wieder die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen für Menschen. Die Ausgestaltung sozialer Beziehungen ist unterschiedlich und individuell. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche geht in diesem Zusammenhang von einem Bild der „konzentrischen Kreise“ aus:
Abbildung 1: Konzentrische Kreise der Netzwerke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(erstellt nach BMFSFJ, 2002, 122)
Die jungen Menschen bewegen sich demnach innerhalb dieser Kreise, die einzelnen Netzwerke sind durchlässig „und die subjektive Bedeutung einzelner Kreise kann sich phasen- und momentweise verschieben.“ (BMFSFJ, 2002, 122) Mit steigendem Alter, steigt auch die Vielfältigkeit der sozialen Nahräume und die Anzahl der sozialen Netze.
Im Zentrum steht die Familie, in der die Jugendlichen soziale Beziehungen erleben, lernen wie man Konflikte löst und was es heißt Verantwortung zu übernehmen. Familie bedeutet für Viele Sicherheit und Geborgenheit, außerdem dienen die Eltern als Berater in wichtigen Lebensfragen. Der Bezug zur Familie ist einer der Wichtigsten für die jungen Menschen, denn immerhin betonen ca. 90% der Jugendlichen, dass Familie für sie eine positive Funktion und einen hohen Stellenwert hat. (vgl. BMFSFJ, 2002, 125) Doch durch stärkere Individualisierung und Ausdifferenzierung der Gesellschaft stehen Jugendliche vor immer unterschiedlicheren Lebensformen. Haushaltsformen wie allein erziehende Elternteile, Mehrgenerationenhaushalte, homosexuelle Lebensgemeinschaften, ‚patchwork – Familien’ und binationale Familien werden immer häufiger. Früher galt die Familie als ‚Versorgungsgemeinschaft’, heute wird sie allerdings eher „als Ressource, als emotionaler Rückhalt, als Ort von Verlässlichkeit, Treue, Häuslichkeit und Partnerschaft verstanden.“ (BMFSFJ, 2002, 125)
Neben der Familie sind die informellen Netzwerke zu finden, die für die Sozialisation der jungen Menschen eine große Rolle spielen. Sie sind Formen sozialer Beziehungen und Unterstützungsleistungen, „die in den „unmittelbaren“ Lebensbereichen der Jugendlichen verankert sind.“ (BMFSFJ, 2002, 127) Freundschaften stellen für Jugendliche eine Möglichkeit dar bei schwierigen Problemen Hilfestellungen zu bekommen. (vgl. BMFSFJ, 2002, 127) In der Peer Group finden die Jugendlichen während und nach dem Ablöseprozess vom Elternhaus neue Bezugspersonen. Organisierte Netze treten parallel zu informellen Netzwerken auf, das heißt, es gibt neben Familie und der Freunde auch Kontakte zu außerfamiliären Erziehungs- und Bildungsinstitutionen. So sind viele Jugendliche in Jugendverbänden oder in kommunale Freizeitangebote aktiv eingebunden.
Insgesamt ist also zu erkennen, dass „soziale Beziehungen ein unverzichtbarer Bestandteil eines gelingenden Alltagsmanagements“ sind, und je intensiver und unterstützender die einzelnen Netzwerke ausgestaltet sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns dieses Alltagsmanagements. (Klug, 2003, 34)
2.3. Lern – und Erfahrungsspielraum
In dieser Dimension werden (Aus-) Bildung, Arbeit und Sozialisation thematisiert, denn „die Lebenslage einer Person wird von ihren Möglichkeiten der Entfaltung und Realisierung ihrer Interessen geprägt, die durch Sozialisation, schulische und berufliche Bildung, Erfahrungen in der Arbeitswelt usw. mitbestimmt werden.“ (Klug, 2003, 28) Ausbildung und Erwerbsarbeit bieten nicht nur ökonomische Anreize, sondern sind maßgeblich an der Sozialisation „ (im) Hinblick auf die Identitätsbildung junger Menschen und ihre(r) Emanzipation zu einer eigenständigen Persönlichkeit“ beteiligt. (BMFSFJ, 2002, 166) Der Sozialisation in der Jugend kommt eine besondere Bedeutung zu, denn der wichtige Prozess des Übergangs von der Abhängigkeit der Eltern in ein eigenständiges Leben soll erfolgreich gemeistert werden. Die ständige Suche nach der eigenen Identität steht dabei im Mittelpunkt. Der Jugendliche muss die Frage „Wer bin ich, wer bin ich nicht?“ beantworten können, damit er schließlich eine sichere Identität entwickeln kann, um eine dauerhafte Integration in der Gemeinschaft sicherstellen zu können. Erikson sieht gelungene Sozialisation als Anpassungsprozess der Jugendlichen an die Umwelt. (vgl. Zimmermann, 2003, 179ff)
Nach Baethge u.a. (1989) nehmen Arbeit und Beruf bei der Suche nach der Identität eine zentrale Rolle ein, deshalb erscheint es als sehr wichtig, dass sich die jungen Menschen einen Beruf suchen, der ihnen entspricht und ihnen hilft ihre Identität zu finden. (Baethge u.a., 1989, 5) Allerdings sehen Experten einen alarmierenden Trend der
diesem Anspruch nicht gerecht werden kann, denn durch eine hohe Selektion im Schulwesen nach sozialer Lage, kulturellem Kapital der Familie, Region und sprachlicher Herkunft, ist jeder 10. Jugendliche, bei den über 20- Jährigen, ohne abgeschlossene Berufsausbildung wodurch die Chancen der Teilhabe am Arbeitsmarkt sinken. Ein weiteres Problem besteht darin, dass durch die mangelnden Ausbildungs- und Arbeitsplätze, junge Menschen oft gezwungen sind auf Ersatzberufe auszuweichen, die ihnen nicht die nötige Unterstützung zur Identitätsfindung gewährleisten können, was häufig Ausbildungsabbrüche und Arbeitsplatzwechsel zur Folge hat. (vgl. BMFSFJ, 2002, 167) Schröder (2005) formuliert die Situation noch schärfer, denn „ wer keinen Arbeits – oder Ausbildungsplatz ergattern kann, dem ist der Übergang von der Jugendphase in die Eigenständigkeit des Erwachsenenstatus verwehrt.“ (Schröder, 2005, 94) Allerdings können meiner Ansicht nach die geänderten Anforderungen an die Jugendlichen auch positive Auswirkungen für die Identitätsentwicklung darstellen. Wenn sie es nämlich schaffen, sich an die veränderten Bedingungen am Arbeitsmarkt anzupassen, beispielsweise über den zweiten Bildungsweg, dann würden sie bereits früh mit Problemsituationen konfrontiert und durch deren Bewältigung Selbstwirksamkeit erfahren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Beruf und die Erwerbsarbeit ein wichtiger Bestandteil der Identitätsfindung junger Menschen sind. Jugendliche stoßen aber zunehmend auf veränderte Bedingungen am Arbeitsmarkt, auf die sie reagieren müssen. Dies kann sich sowohl positiv als auch negativ auf ihre Sozialisation auswirken.
2.4. Muße- und Regenerationsspielraum
Freizeitverhalten stellt für Jugendliche eine wichtige Funktion für ihre Sozialisation dar, denn in der Freizeit „werden Status-, Identitäts- und Orientierungsprobleme besser gelöst als innerhalb der Familie.“ (Dürr/Trippmacher, 1988, 83) Freizeit bezieht sich generell auf die Aktivitäten außerhalb von Schule, Ausbildung und Beruf und soll vor allem selbst gewählt und von innen heraus motiviert sein, ansonsten hätte sie keinen ausgleichen Charakter den die Jugendlichen für ihre Regeneration benötigen. Freizeit kann unter anderem als Lernfeld für Jugendliche betrachtet werden, denn „diese Form der Sozialisation (wird) hauptsächlich durch Nachahmung im Gegensatz zum spontanen, reflektierten und rationalem Handeln geprägt […].“ (Dürr/Trippmacher, 1988, 83) Des Weiteren gilt Freizeit als Regenerationszeit um neue Kräfte für die Alltagsbewältigung sammeln zu können. Es stellt einen Ausgleich zu den physischen und psychischen Belastungen der jungen Menschen dar. Je mehr Belastungen vorhanden sind, desto größer sollte der Muße – und Regenerationsspielraum sein. Freizeit hat vor allem positive Wirkungen auf junge Menschen. Sie fördert die Stabilität der Person durch den ausgleichenden und gesundheitsfördernden Charakter für Psyche und Körper, sie fördert die soziale Integration und die sozialen Kontakte der Jugendlichen durch Aktivitäten in Vereinen oder sozialen Gruppen und sie beeinflusst die Identität, denn durch ständige soziale Vergleiche mit Anderen, lernen die Jugendlichen sich zu positionieren. (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, 106ff) Sinnvolle und vor allem regenerierende Freizeitgestaltung ist also ein wichtiges Element bei der Identitätsfindung der jungen Menschen. Problematisch könnte Freizeit dann werden, wenn die Jugendlichen ihren Ausgleich in Gruppen und Cliquen suchen, die zu abweichendem Verhalten führen, wie beispielsweise rechtsradikalen Gruppen oder Suchtmittel konsumierenden Cliquen. Diese negative Variante von Freizeitgestaltung wird damit erklärt, dass Jugendliche aus ihrem Kompensationsbedürfnis von Belastungen heraus ein Fluchtverhalten zeigen, um die Realität zu verdrängen. Freizeit kann also sowohl eine regenerative als auch kompensierende Funktion einnehmen. (vgl. Dürr/ Trippmacher, 1988, 86f) Doch wie sieht nun das konkrete Freizeitverhalten der jungen Menschen aus? Einer Studie zufolge haben Kinder und Jugendliche bis zu fünf Stunden am Tag zur freien Verfügung. (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, 107) ‚Musik hören’ gefolgt von ‚Freunde treffen’ steht generell bei den jungen Leuten an oberster Stelle der Freizeitaktivitäten. Zudem schauen viele Jugendliche Fernsehen, entspannen zu Hause durch Nichtstun, gehen auf Parties und in Kneipen, lesen Bücher, spielen Computerspiele und treiben Sport. (vgl. Lange, 1997, 93) In einer Studie von Wiesner und Silbereisen (1998), bei der Jugendliche zu ihrem Freizeitverhalten befragten wurden, wurde unter anderem festgestellt, dass männliche Jugendliche vermehrt deviantes und weibliche Jugendliche eher kreativ – gestaltendes Freizeitverhalten zeigen.
Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass Freizeit für Jugendliche und deren Identitätsfindung einen hohen Stellenwert hat. Allerdings kann sich ihr Freizeitverhalten sowohl positiv als auch negativ auswirken.
2.5. Dispositions- und Partizipationsspielraum
Kuhring (1999) sieht gelingende Partizipation „als direkte Beteiligung Jugendlicher an der Gestaltung ihrer Lebenswelt bei Planungen, Entscheidungen und Handlungen auf politischer und sozialer Ebene.“
(Kuhring, 1999, 346) Es geht dabei um die Möglichkeit auf bestimmte Lebensbereiche Einfluss nehmen zu können, Selbstwirksamkeit zu erfahren und um die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Zum einen kann dies auf der politischen Ebene festgestellt werden, also inwieweit können Jugendliche politisch Einfluss nehmen, oder auf der sozialen Ebene, also inwieweit kann die Person Einfluss auf ihr eigenes Leben ausüben, kann sich als selbstwirksam erleben und hat „die Fähigkeit, seine eigenen Angelegenheiten „managen“ zu können […]“. (Klug, 2003, 33)
Menschen haben in der Regel das Potential und die Fähigkeit zur Lebensbewältigung und – gestaltung. Der Handlungsspielraum der jungen Menschen erweitert sich mit zunehmendem Alter. In der Psychologie wird in diesem Zusammenhang von ‚locus of control’, Selbstwirksamkeit oder Kontroll – oder Kompetenzmeinung gesprochen. „Unter Kontrollmeinung versteht man, wie eine Person ihre Möglichkeiten einschätzt, innerhalb eines überblickbaren Lebensraumes bestimmte Ziele zu erreichen.“ (Grob/Jaschinski, 2003, 31) Die wichtigsten Entwicklungsbereiche für Jugendliche sind im Allgemeinen die Persönlichkeitsentwicklung, das physische Aussehen, die Wahl des zukünftigen Arbeitsplatzes, der Ausgang eines Konflikts mit den Eltern und die Aufnahme einer engen Freundschaft. Daran gekoppelt ist die Einschätzung der Jugendlichen über ihre Einflussmöglichkeit in diesen Bereichen. Nach Flammer et al. sehen 96% der Jugendlichen eine Einflussmöglichkeit bei der Aufnahme von engen Freundschaften, 90% bei ihrem physischen Aussehen, 90% bei der Wahl des Arbeitsplatzes, 90% bei dem Ausgang eines Konflikts mit den Eltern und 87% der Jugendlichen sahen bei der Persönlichkeitsentwicklung Einflussmöglichkeiten. Diese Einschätzungen können als „(Kontroll-) Optimismus“ der Jugendlichen gesehen werden. Außerdem ist festzustellen, dass sich die Einschätzungen des Einflusses mit zunehmendem Alter ändern, vor allem unter dem Gesichtspunkt der steigenden materiellen Ressourcen. (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, 31f) Auf politischer Ebene gibt es für Kinder und Jugendliche verschiedene Partizipationsmöglichkeiten, die sich in Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung aufteilen. So gibt es beispielsweise Jugendhäuser, Stadtteilarbeit und Jugendparlamente, in denen sich Jugendliche aktiv beteiligen können. (Zinser, 2005, 158) Die Einflussmöglichkeiten sind allerdings sehr individuell zu bewerten und hängen von verschiedenen Faktoren, wie dem Geschlecht, der psychischen und physischen Gesundheit, der Herkunft, dem Alter, der Schichtzugehörigkeit oder der Bildung ab, wodurch sich die Chancen der Teilhabe unterschiedlich gestalten. Es ist zunehmend festzustellen, dass Jugendliche heute die konventionellen Formen von politischer Partizipation, wie Wahlen oder politische Jugendorganisationen, ablehnen und sich eher in unkonventionellen Formen in ihrem direkten Umfeld beteiligen, wo die Hoffnung besteht noch etwas erreichen zu können. Dabei stehen Gemeinschaftssinn und Spaß an der Sache im Vordergrund. (vgl. Kuhring, 1999, 348f)
Abschließend lässt sich für diesen Spielraum sagen, dass die Teilhabe und Mitbestimmung eines Menschen in verschiedenen Lebensbereichen neben den anderen Spielräumen für ein gelingendes Alltagsmanagement ausschlaggebend ist.
Obwohl die fünf Spielräume nun bereits einen umfassenden Eindruck über die Situation von Jugendlichen geben, möchte ich noch eine weitere Dimension der psychischen und physischen Situation hinzufügen. Es werden zwar in den anderen Dimensionen die psychischen und physischen Zustände bereits umrissen, jedoch ist in der Jugendphase eine so gravierende Veränderung sowohl des Körpers, als auch der inneren Vorgänge zu beobachten dass ihnen noch gesondert Aufmerksamkeit geschenkt werden soll.
2.6. Psychische und physische Situation
Zunächst durchleben junge Menschen die Pubertät, die vor allem durch körperliche Veränderungen gekennzeichnet ist. Die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln sich, es kommt zu Wachstumsschüben und übermäßigen Ausschüttungen von Hormonen. Mit der Bewältigung dieser Veränderungen sind die Jugendlichen eine Zeit lang beschäftigt, die von der Phase der Adoleszenz begleitet wird, die als „die Zeit die junge Menschen brauchen, um sich mit der durch den pubertären Umbruch ausgelösten Situation psychisch zu arrangieren, um den neuen Körper „bewohnen“ zu lernen und um sich ihren jeweiligen Platz in der Gesellschaft zu suchen“ bezeichnet wird. (Schröder, 2005, 91)
Zu den körperlichen kommen die psychischen Veränderungen der Jugendlichen, wofür es verschiedene Konzepte gibt um diese Vorgänge zu beschreiben. Das Konzept der Entwicklungsaufgaben von Robert Havighurst ist eines der Bekanntesten zur Beschreibung der jugendtypischen Prozesse. Demnach hat jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens bestimmte Aufgaben zu bewältigen. Diese werden gelöst, um als vollwertiges Mitglied in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Wenn eine Aufgabe erfolgreich bewältigt worden ist, hilft dies der nachstehenden Aufgabenbewältigung. (vgl. Grob/Jaschinski, 2003, 22f) Die konkreten Entwicklungsaufgaben haben sich allerdings im Laufe der Zeit etwas verändert und so gehen Dreher und Dreher von „neuen Entwicklungsaufgaben“ aus. Die Aufnahme und der Aufbau von intimen Beziehungen, die Entwicklung der Identität und das Erarbeiten einer Zukunftsperspektive stellen die drei wichtigsten Aufgaben, die unter dem Deckmantel der Identitätsfindung stehen, dar. Die Entwicklung der Identität „beinhaltet ein bewusstes Verhältnis zu sich und der Umwelt zu gewinnen mit dem Resultat, sich in der vorgegebenen Kultur zu verorten.“ (Grob/Jaschinski, 2003, 29) Die Identität steht auch bei Erik H. Erikson im Mittelpunkt des Jugendalters. Er entwickelte eine psychosoziale Entwicklungstheorie, nach der es im Leben eines Menschen acht unterschiedliche Krisen gibt, die es zu bewältigen gilt. Die fünfte Krise und zwar die der ‚Identität versus Indentitätsdiffusion’, schreibt er dem allgemeinen Jugendalter zu. Das Ziel der Jugendphase besteht darin eine eigene Identität zu entwickeln und es nicht zu so genannten Identitätsverwirrungen kommen zu lassen, die „durch die Unfähigkeit, eine Rolle anzunehmen“ gekennzeichnet sind. (Erikson, 1970, 134) Die Voraussetzung für eine positive Auflösung dieser Krise ist die erfolgreiche Bewältigung der Vorausgegangenen.
Junge Menschen, denen es also gelingt den Konflikt der Adoleszenz erfolgreich aufzulösen, „konstituieren sich eine solide Selbstdefinition, bestehend aus selbst gewählten Werten und Zielen.“ (Berk, 2005, 564)
Im nächsten Abschnitt werde ich nun auf die Thematik der Alkoholabhängigkeit eingehen, speziell auf die Alkoholabhängigkeit bei jungen Menschen. Es soll auf Definitionen, Epidemiologie, Entstehungsbedingungen, Verlauf und Bewältigung, Folgen des Konsums und die Komorbidität eingegangen werden, um schließlich den Blick auf sozialarbeiterische Methoden für die Zielgruppe der jungen Alkoholabhängigen zu lenken.
B. Alkoholabhängigkeit
1. Begriffsbestimmung
Um den Begriff der Alkoholabhängigkeit zu bestimmen, sind verschiedene Herangehensweisen möglich. So lassen sich zunächst anhand der standardisierten Klassifikationssysteme ICD – 10 (International Classification of Disease der Weltgesundheitsorganisation WHO) oder DSM IV (Diagnostisches und statistisches Manual der American Psychiatric Association) Kriterien beschreiben, die eine Alkoholabhängigkeit definieren. Die Klassifikationssysteme geben ähnliche Kriterien vor und so müssen zusammengefasst mindestens drei der nachfolgenden Kriterien über eine bestimmte Zeit hinweg bestehen, um von einer Alkoholabhängigkeit sprechen zu können:
- Toleranzentwicklung und Dosissteigerung
- Entzugssymptome in konsumfreien Phasen
- Stärkerer Konsum als intendiert
- Wunsch, den Konsum zu reduzieren oder einzustellen
- Hoher Zeitaufwand zur Beschäftigung mit der Substanz
- Einschränkungen wichtiger beruflicher und Freizeitaktivitäten
- Anhaltender Konsum trotz wiederkehrender sozialer, psychischer oder körperlicher Probleme
(vgl. Sting/Blum, 2003, 28)
Zudem ist es wichtig zwischen Missbrauch und Abhängigkeit zu unterscheiden: In der ICD – 10 wird hierbei von „schädlichem Gebrauch“ gesprochen, im DSM - VI hingegen von „Missbrauch“. Auch die Kriterien, die für den Missbrauch sprechen sind in beiden Klassifikationssystemen unterschiedlich. So nennt das DSM - IV vier Kriterien für Alkoholmissbrauch, bei denen vor allem die psychosozialen Folgeschäden im Mittelpunkt stehen. Der schädliche Gebrauch, nach ICD – 10, hingegen kann nur beim Auftreten von erheblichen gesundheitlichen Schäden diagnostiziert werden.
Zur Diagnose der Abhängigkeit und des Missbrauchs gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Verfahren, wie standardisierte Interviews oder Fragebogenuntersuchungen. (vgl. Soyka, 1997, 12ff)
Tretter/Müller (2001) plädieren für eine Unterscheidung folgender Konsumformen in der Praxis:
a) (unproblematischer) Konsum
b) gefährlicher/riskanter Konsum, bei dem die Wahrscheinlichkeit des Eintreten eines Schadens hoch ist
c) schädlicher Konsum, bei dem bereits Schäden oder Störungen im körperlichen, seelischen und/ oder sozialen Bereich auftreten
d) Abhängigkeit, bei der die oben genannten Abhängigkeitskriterien zutreffen;
(Tretter/Müller, 2001, 24)
Zusätzlich zur Klassifikation der Alkholabhängigkeit lassen sich bestimmte Subtypen definieren. Auch hier gibt es unterschiedliche Konzepte, das bekannteste ist allerdings die ‚Trinkertypologie’ nach Jellinek. Er unterteilt Alkoholabhängige in folgende fünf verschiedene Typen:
Der α- Typ, den er als Problem-, Erleichterungs- und Konflikttrinker bezeichnet, bei dem nur eine psychische Abhängigkeit vorzufinden ist und der keinen Kontrollverlust erlebt, aber undiszipliniert mit zeitweiser Abstinenzfähigkeit trinkt. Der β – Typ, der Gelegenheitstrinker, bei dem weder eine psychische noch körperliche Abhängigkeit vorliegt und der Kontrolle über sein Trinkverhalten behält. Der γ – Typ, der als süchtiger Trinker bezeichnet wird, der zunächst psychisch und dann körperlich abhängig ist und die Kontrolle über sein Trinkverhalten verliert, aber phasenweise abstinent sein kann. Der δ – Typ, bei dem ein rauscharmer, aber kontinuierlicher Konsum vorzufinden ist, der zur physischen Abhängigkeit führt, der nicht abstinent sein kann aber Kontrolle über sein Trinkverhalten hat. Der letzte Typ, der ε – Typ wird als episodischer Trinker bezeichnet, bei ihm liegt eine psychische Abhängigkeit vor, er besitzt die Fähigkeit zur Abstinenz, aber verliert die Kontrolle über sein Trinkverhalten. (vgl. Soyka, 1997, 16) Allerdings wird der α und der β- Typ als „nicht süchtige Trinker“ definiert und nur die restlichen drei Typen als „süchtig“ klassifiziert. (vgl. Bornhäuser, 2001, 19)
Neben den Klassifikationen und der Typologie gibt es noch so genannte biologische und genetische Marker, bei deren Auftreten eine Alkoholabhängigkeit wahrscheinlich werden lassen. Auf diese Thematik soll hier aber nicht weiter eingegangen werden, da sie nicht weiter relevant ist für die folgenden Ausführungen dieser Arbeit.
Die Diagnose Alkoholabhängigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen erweist sich in der Praxis als kompliziert. Viele junge Menschen weisen zwar ein oder mehrere alkoholbezogene Symptome auf, jedoch kein voll ausgebildetes Alkoholsyndrom. Deshalb wird in diesem Alter häufiger von Alkoholmissbrauch gesprochen, allerdings schließen sich im DSM - IV Missbrauch und Abhängigkeit gegenseitig aus und so werden einige Jugendliche als „diagnostische Waisen“ bezeichnet. Eine bundesdeutsche Repräsentativstudie zeigt, dass die Abhängigkeitssymptomatik bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen häufig dem α – Typen nach Jellinek entspricht. Es besteht zwar eine psychische Abhängigkeit, aber keine physische. Wiederum andere klinische Studien belegen, dass es durchaus das „voll ausgebildete Krankheitsbild“ im jungen Alter gibt. (vgl. Bornhäuser, 2001, 19ff)
2. Epidemiologie
Die Epidemiologie beschäftigt sich im Allgemeinen vor allem mit der Erforschung der Verbreitung einer bestimmten Krankheit. Zunächst soll das allgemeine Alkoholkonsummuster der Deutschen betrachtet werden: Laut einer Studie von 1998 der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (im Folgenden: DHS) besteht bei 88,4% ein unproblematischen Konsum, bei 6,1% ein riskanter Konsum, 3,4% betreiben missbräuchlichen Konsum und bei 2,1% besteht eine Abhängigkeit. (vgl. Bergler u.a. , 2000, 11)
Nach Schätzungen des IFT Münchens (Institut für Therapieforschung) 2006 besteht bei 10,4 Millionen Menschen ein riskantes Konsumverhalten, bei 1,7 Millionen liegt bereits Missbrauch und bei ebenso vielen liegt eine Abhängigkeit vor. (vgl. DHS, 2006, 10)
Über die genaue Altersverteilung von Alkoholabhängigen gibt es nur wenige Studien: So untersuchte die deutsche Suchthilfestatistik von 2004 die ambulante und stationäre Suchthilfe in Deutschland. Aus den Ergebnissen der ambulanten Einrichtungen sind Folgende für diese Arbeit interessant: 58% der Patienten wurden wegen alkoholbezogener Hauptdiagnose behandelt, dagegen 20% wegen opiatbezogener und 11% wegen cannabisbezogener Hauptdiagnose. Die allgemeine Behandlungsdauer beträgt 23 – 43 Wochen, wobei 42% der alkoholbezogenen und nur 23% der opiatbezogenen Störungen ihre Behandlung planmäßig abschloss. Die Behandlung erfolgreich abgeschlossen haben 33% der Alkoholabhängigen, 16% der Opiatabhängigen und 22% der Cannabisabhängigen. Bei den stationären Einrichtungen wurden 81% mit alkoholbezogenen Störungen und nur 6% mit opiatbezogenen Störungen behandelt, dabei war die häufigste zusätzliche Einzeldiagnose neben der Hauptdiagnose eine Cannabisstörung. Die Behandlungsdauer beläuft sich zwischen drei und sechs Monaten, 74% der Alkoholabhängigen und 42% der Opiatabhängigen wurden planmäßig entlassen. In den stationären Einrichtungen wurden deutlich mehr Personen mit Abhängigkeiten von legalen Stoffen, als von illegalen Stoffen behandelt.
Bei Alter und Geschlecht sind große Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu beobachten, denn nahezu ¾ der Patienten sind männlich. Bei legalen Drogen liegt das Durchschnittsalter bei 44 Jahren, davon sind 71% zwischen 35 und 54 Jahren, bei illegalen Drogen ist der Wert deutlich niedriger und liegt bei einem Durchschnittsalter von 29 Jahren, wobei ¾ zwischen 20 und 34 Jahren alt sind.
Laut dem Jahrbuch Sucht 2006 der Deutschen Hauptsstelle gegen die Suchtgefahren sieht die Altersverteilung der Suchthilfepatienten wie folgt aus:
Abbildung 2: Altersverteilung der Behandelten in ambulanten und stationären Einrichtungen der Suchthilfe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(modifiziert nach DHS, 2006, 178)
An diesen Zahlen ist deutlich zu sehen, dass die jungen Alkoholabhängigen zumindest in ambulanten und stationären Suchthilfeeinrichtungen eine Minderheit darstellen gegenüber den anderen Altersgruppen. In den stationären Einrichtungen scheint es sogar keine Jugendlichen unter 15 Jahren zu geben. Warum das so ist, wird in der Studie leider nicht behandelt, aber meiner Ansicht nach mag das vielleicht daran liegen, dass in diesem Alter wirklich noch nicht von einer Abhängigkeit gesprochen werden kann.
3. Ursachen für Alkoholabhängigkeit
Nun geht es darum, herauszufinden warum Menschen, speziell junge Menschen, alkoholabhängig werden. Es bietet sich eine Reihe von Erklärungsansätzen an. Generell ist aber zu sagen, dass das Missbrauchs – und Abhängigkeitspotential einer Person von Substanzeigenschaften, situativen Bedingungen und personalen Faktoren abhängt. (vgl. Raithel, 2001, 135f) Deshalb wird auch in der Praxis meistens von bio- psycho- sozialen Ursachemodellen der Alkoholabhängigkeit ausgegangen, um keine Ebene zu vernachlässigen. In den folgenden Abschnitten sollen unterschiedliche Perspektiven einer Alkoholabhängigkeitsentstehung beleuchtet werden.
3.1. Entwicklungspsychologische Perspektive
Raithel (2004) versucht eine Ursachenbeschreibung des allgemeinen Substanzkonsums von Jugendlichen mit Hilfe der die Entwicklungspsychologie. Menschen haben im Laufe ihres Lebens verschiedene Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Das Jugendalter ist gekennzeichnet durch die Ablösung vom Elternhaus und der Suche nach der eigenen Identität. Die folgende Tabelle stellt die konkreten Entwicklungsaufgaben nach Dreher und Dreher den Funktionen des Substanzkonsums gegenüber.
Abbildung 3: Entwicklungsaufgaben und die Funktionen des Substanzkonsums
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(modifiziert nach Raithel, 2004, 183)
Diese Tabelle gibt einen Eindruck über die möglichen Ursachen von Alkoholkonsum. Damit ist aber nicht gesagt, dass dieser Konsum auch zur Alkoholabhängigkeit führen muss, denn „für die Mehrheit gilt Substanzkonsum […] als vorübergehende Begleiterscheinung der Jugendphase, in der Entwicklungsaufgaben bearbeitet und vorübergehende Entwicklungsprobleme bewältigt werden müssen.“ (Raithel, 2001, 139) Deshalb muss es noch andere Faktoren geben, die eine Abhängigkeit entwickeln lassen.
Tretter (2001) spricht von Risiko – und Schutzfaktoren die jeder Mensch besitzt und die die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Abhängigkeit beeinflussen. Mit einer einfachen Formel kann das Suchtrisiko bestimmt werden: Die Summe der Risikofaktoren minus die Summe der Schutzfaktoren ergibt das Suchtrisiko Raithel (2001) ergänzt diese Annahme und sieht in dem Substanzkonsum von Freunden oder Peers den stärksten und konsistentesten Risikofaktor. Dem gegenüber stehen die Schutzfaktoren, wie die Selbstsicherheit, Konsumangebote abzulehnen oder die Vorbildrolle der Eltern, die den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol vorleben. (vgl. Raithel, 2001, 139; Tretter, 2001, 36) Allerdings verharmlost Raithel (2004) den Alkoholkonsum im Jugendalter, denn „wenn die Jugendlichen ihre Ausbildung beenden und anfangen einer Erwerbsarbeit nachzugehen sowie eine Familie zu gründen (d.h. Rollenbewusstsein übernehmen) geht auch das Problemverhalten zurück.“(Raithel, 2004, 184) Dennoch muss es Faktoren geben, die eine Alkoholabhängigkeit im Jugendalter entstehen lassen. Die folgenden Abschnitte sollen die bisherigen Ausführungen ergänzen.
3.2. Soziologische Perspektive
Der Soziologe K. Hurrelmann spricht in seinem sozialisationstheoretischen Ansatz auch von Risikofaktoren, die eine Suchtentwicklung begünstigen können. Sollten sich im Laufe des Lebens die Risikofaktoren häufen oder in bestimmten Konstellationen auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit von Auffälligkeiten, Abweichungen und (Sucht-) Krankheiten höher. Durch die stärkere Ausdifferenzierung und Pluralisierung der Gesellschaft haben die jungen Menschen mehr Möglichkeiten zur Identitätsfindung, aber „die Jugendlichen müssen für die vermehrten sozialen Chancen auch einen ‚Preis’ zahlen, der gleichzusetzen ist mit erhöhtem Streß [sic] infolge des Risikos, einen individuell entworfenen Lebensplan nicht realisieren zu können.“ (Mansel/Hurrelmann, zit. in Loviscach, 1996, 47) Durch die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, der Familie, der Schule, dem Beruf bzw. der Ausbildung, der Peer Group und sich selbst ergeben sich die zu bewältigenden Probleme. Für die Bewältigung dieser Belastungen sind zwei Faktoren ausschlaggebend: die sozialen Ressourcen und die personalen Ressourcen. Es kommt also unter anderem auf die Verfügung über soziale Netzwerke, über gut funktionierende Beziehungen, über finanzielle Ressourcen und über Coping – Strategien an. So hängt Bewältigung und Nicht – Bewältigung vor allem von günstigen oder benachteiligten Lebens- und Sozialisationsbedingungen ab. Vor allem die steigenden Leistungs- und Qualifizierungsanforderungen, die an die Jugendlichen gestellt werden, um positive Erwerbsverläufe zu erzielen, sieht Hurrelmann als Risikofaktor. Die jungen Menschen stehen zunehmend unter dem gesellschaftlichen Druck eine qualifizierte Ausbildung zu absolvieren, bei gleichzeitigem Wissen um den schlechten Stand des Arbeitsmarktes. Des Weiteren haben die Jugendlichen Schwierigkeiten in einem pluralistischen Werte – und Normsystem ihre Identität zu entwickeln.
[...]
- Arbeit zitieren
- Isabelle Riedinger (Autor:in), 2006, Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit mit jungen Alkoholabhängigen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59753
Kostenlos Autor werden






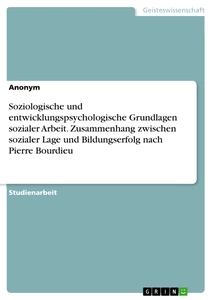


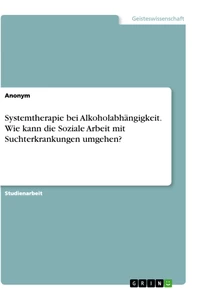





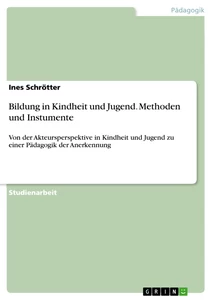




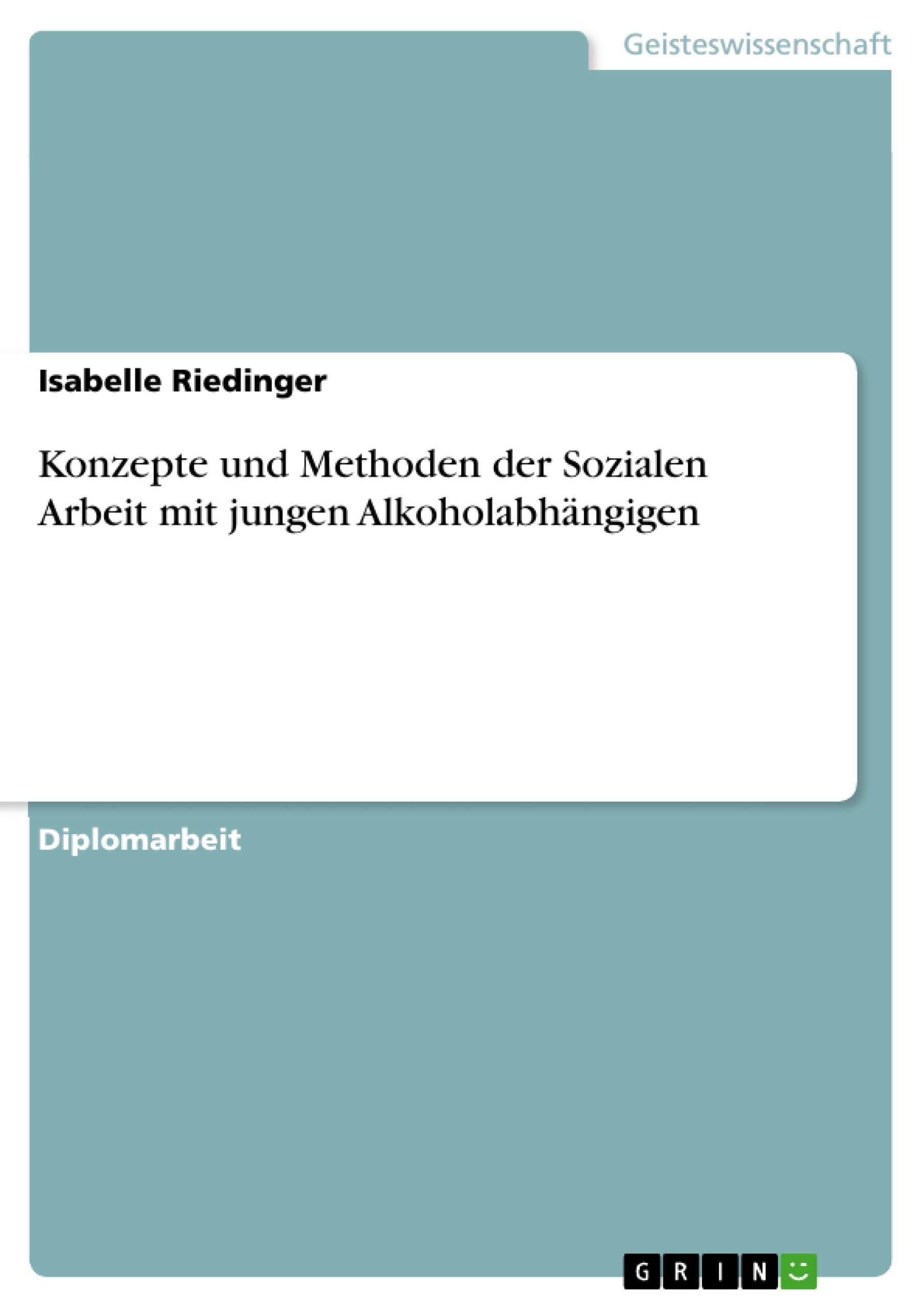

Kommentare