Leseprobe
Inhalt
Einleitung
Theoretische Grundlagen
1. Kontrollüberzeugungen
1.1 Begriffsbestimmungen
1.2 Verwandte Konstrukte
1.3 Konstruktentwicklung
1.3.1 Soziale Lerntheorie von Rotter
1.3.2 Konstruktdifferenzierungen
1.3.2.1 Passive und defensive Externalität
1.3.2.2 Konstruktdifferenzierung von Levenson
1.3.3 Konzept der Selbstwirksamkeit von Bandura
1.3.4 Handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit von Krampen
1.3.5 Bereichspezifische Kontrollüberzeugungen
1.4 Entwicklung von Kontrollüberzeugungen
1.4.1 Kontrollüberzeugungen und Sozialisation
1.4.2 Altersbedingte Veränderungen von Kontrollüberzeugungen
1.5 Messung von Kontrollüberzeugungen
1.6 Individuelle Unterschiede aufgrund von Kontrollüberzeugungen
1.7 Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit Informationssuche, akademischen Leistungen und selbstgesteuertem Lernen
1.7.1 Informationssuche
1.7.2 Verhalten und Ergebnisse in akademischen Leistungssituationen
1.7.3 Selbstgesteuertes Lernen
1.7.3.1 Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit selbstgesteuertem Lernen
1.7.3.2 Empirische Ergebnisse zu Kontrollüberzeugungen und selbstgesteuertem Lernen mit Computer
2. Das Medium Hypertext
2.1 Begriffsbestimmungen
2.2 Text und Hypertext
2.3 Geschichte von Hypertext
2.4 Anwendungsbereiche von Hypertext
2.5 Aufbau von Hypertext
2.5.1 Hypertext – Basis
2.5.2 Knoten
2.5.3 Links
2.5.4 Hypertext – Strukturen
2.6 Navigation in Hypertext
2.6.1 Browsing als hypertexttypisches Navigationsverhalten
2.6.2 Navigationsmuster
2.6.3 Navigationstypen
2.7 Hypertext als Lernmedium
2.7.1 Argumente für Hypertext
2.7.1.1 Kognitive Plausibilität
2.7.1.2 Multimedialität
2.7.1.3 Kognitive Flexibilität
2.7.1.4 Lernerkontrolle
2.7.1.5 Entdeckendes und inzidentielles Lernen
2.7.2 Argumente gegen Hypertext
2.7.2.1 Desorientierung
2.7.2.2 Kognitive Überlastung
2.8 Personeninterne Faktoren
2.8.1 Geschlecht
2.8.2 Fähigkeiten
2.8.3 Vorwissen, Erfahrungen und Einstellungen
2.8.3.1 Domänenspezifisches Vorwissen
2.8.3.2 Erfahrung im Umgang mit Computer und Hypertext
2.8.3.3 Hypertext – Literacy
2.8.3.4 Einstellungen zu Computer und Hypertext
2.8.4 Interesse und Motivation
2.8.4.1 Interesse
2.8.4.2 Motivation
2.8.5 Selbstwirksamkeit
2.8.6 Kontrollüberzeugungen
3. Resümee und Ausblick
4. Fragestellungen und Forschungshypothesen
4.1 Herleitung der Fragestellungen
4.2 Ableitung der psychologischen Hypothesen
4.2.1 Zu Auswirkungen von generalisierten Kontrollüberzeugungen auf die Bearbeitung von Hypertext
4.2.2 Zu Auswirkungen von bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen auf die Bearbeitung von Hypertext
4.2.3 Zu anderen Einflussfaktoren auf die Bearbeitung von Hypertext und ihren Zusammenhänge mit Kontrollüberzeugungen
4.2.3.1 Geschlechtsunterschiede
4.2.3.2 Fähigkeiten
4.2.3.3 Vorwissen, Erfahrungen und Einstellungen
4.2.3.4 Interesse und Motivation
4.2.3.5 Kompetenz- und Selbstwirksamkeitserwartungen
4.2.4 Zu unterschiedlichen Lernleistungen in Abhängigkeit von Kontrollüberzeugung und der Bearbeitung von Hypertext
4.3 Fragestellungen der explorativen Datenanalyse
Methode
5. Untersuchungsplan
5.1 Unabhängige Variablen
5.2 Abhängige Variablen
5.3 Weitere Variablen
6. Untersuchungsinstrumente
6.1 Erhebung von demografischen Daten
6.2 Erhebung von Schulnoten
6.3 Fragebogen Interesse
6.4 Leistungstests
6.4.1 Allgemeines zur ISA und der Vorgabe der Subtests
6.4.2 Merkfähigkeit (ISA – Waren merken)
6.4.3 Logisches Schließen – numerisch (ISA – Zahlenreihen fortsetzen)
6.4.4 Logisches Schließen – verbal (ISA – Beziehungen herstellen)
6.5 Erhebung von Erfahrung und Vorwissen
6.5.1 Informationsnetztechnisches Vorwissen
6.5.1.1 Computer- und Internet-bezogene Erfahrungen
6.5.1.2 Erfahrung im Umgang mit Hypertext
6.5.2 Domänenspezifisches Vorwissen
6.6 Einstellung zum Computer
6.7 Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen
6.7.1 Generalisierte Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK)
6.7.1.1 Allgemeines zum FKK
6.7.1.2 Online-Umsetzung des gekürzten FKK
6.7.2 Bereichspezifische Kontrollüberzeugungen (KUT)
6.7.2.1 Allgemeines zum KUT
6.7.2.2 Adaptierung der Kurzform des KUT für die Erfassung der hypertextspezifischen Kontrollüberzeugungen
6.8 Hypertext „Essen und Trinken im Mittelalter“
6.8.1 Zur Entstehung des Hypertextes
6.8.2 Beschreibung des Hypertextes
6.8.3 Zur technischen Umsetzung der Datenerfassung im Hypertext
6.9 Wissenstest zum Hypertext
6.9.1 Erstellung des Wissenstests
6.9.2 Zur Vorgabe des Wissenstest in der Untersuchung
6.10 Fragebogen zur Beurteilung des Hypertextes und seiner Bearbeitung
7. Untersuchungsdurchführung
8. Untersuchungsablauf
8.1 Erster Teil der Untersuchung
8.2 Zweiter Teil der Untersuchung
9. Beschreibung der Stichprobe
Ergebnisse
10. Teststatistische Analysen der Untersuchungsinstrumente
10.1 Gekürzter FKK (generalisierte Kontrollüberzeugungen)
10.2 Adaptierte KUT-Kurzform (hypertextspezifische Kontrollüberzeugungen)
10.3 ISA-Subtests
10.4 Fragebogen zur Erhebung des Interesses
10.5 Fragebogen zur Erhebung von Computer-, Internet- und Hypertexterfahrung
10.6 Fragebogen zur Computer-Einstellung
10.7 Fragebogen zur Einschätzung des Vorwissens
10.8 Fragebogen zur Beurteilung des Hypertextes und seiner Bearbeitung
10.9 Wissenstest nach der Hypertext-Bearbeitung
11. Deskriptive Datenanalyse
11.1 Zu den Ergebnissen der Leistungstests
11.2 Zum informationsnetztechnischen Vorwissen und der Erfahrung im Umgang mit Hypertext
11.3 Zur Einstellung zum Computer
11.4 Zu Interessen und Motivation
11.5 Zum domänenspezifischen Vorwissen
11.6 Zur Navigation durch den Hypertext
11.7 Zum Wissenstest nach der Hypertextbearbeitung
11.8 Zur Beurteilung des Hypertextes
11.9 Zu generalisierten Kompetenzerwartungen und Kontrollüberzeugungen
11.10 Zusammenhänge zwischen generalisierten Kompetenzerwartungen und Kontrollüberzeugungen und möglichen Einflussfaktoren auf die Bearbeitung des Hypertextes
11.10.1 Kontrollüberzeugungen und kognitive Fähigkeiten
11.10.2 Kontrollüberzeugungen und Erfahrung mit Hypertext
11.10.3 Kontrollüberzeugungen und Einstellung zum Computer
11.10.4 Kontrollüberzeugungen, Interesse und Motivation
12. Hypothesenprüfung
12.1 Zu den die Navigation beeinflussenden Variablen
12.1.1 Geschlecht
12.1.2 Kognitive Fähigkeiten
12.1.3 Domänenspezifisches Vorwissen
12.1.4 Erfahrung im Umgang mit Hypertext
12.1.5 Positive Einstellung zum Computer
12.1.6 Interesse
12.1.7 Motivation
12.1.8 Generalisierte Kompetenzerwartungen
12.1.9 Zusammenfassung der Ergebnisse zu den die Navigation beeinflussenden Variablen
12.2 Zum Einfluss der generalisierten Kontrollüberzeugungen auf die Bearbeitung des Hypertextes
12.2.1 Anzahl betrachteter Hypertextseiten
12.2.2 Anzahl der Seitenaufrufe
12.2.3 Bearbeitungszeit
12.2.4 Bearbeitungstiefe
12.3 Zum Einfluss der bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen auf die Bearbeitung des Hypertextes
12.3.1 Anzahl betrachteter Hypertextseiten
12.3.2 Anzahl der Seitenaufrufe
12.3.3 Bearbeitungszeit
12.3.4 Bearbeitungstiefe
12.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss von Kontrollüberzeugungen auf die Navigation im Hypertext
12.4 Zu den Einflussfaktoren auf den Wissenserwerb
12.4.1 Vorwissen
12.4.2 Navigation im Hypertext
12.4.3 Kontrollüberzeugungen
12.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Einflussfaktoren auf den Wissenserwerb
12.5 Zusammenfassung der Hypothesenprüfung
13. Weitere Ergebnisse
13.1 Clusteranalyse zur Navigation
13.1.1 Allgemeines zur Clusteranalyse
13.1.2 Beschreibung der Cluster hinsichtlich des Navigationsverhaltens
13.1.3 Analyse der Cluster in Hinblick auf die neben der Navigation untersuchten Variablen
13.1.3.1 Kontrollüberzeugungen
13.1.3.2 Kognitive Fähigkeiten
13.1.3.3 Aufgabenschwierigkeit
13.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Clusteranalyse
13.2 Weiterführende Analyse der Wissenstestergebnisse
13.2.1 Wissenstestrelevante Maße der Hypertextbearbeitung
13.2.2 Wissenstestbearbeitung von Personen in Clustern mit unterschiedlichem Navigationsverhalten
13.2.3 Lernleistung
13.2.3.1 Lernleistungsmaß (LLM)
13.2.3.2 Unterschiede in der Lernleistung aufgrund von Unterschieden in Personenmerkmalen und Navigationsverhalten
13.2.4 Zusammenfassung der weiterführenden Analyse der Wissenstestergebnisse
Diskussion
14. Ergebnisse der Untersuchung und ihre Diskussion im Kontext der bisherigen Forschung zu Kontrollüberzeugungen und Hypertext
14.1 Korrelative Ergebnisse
14.2 Auswirkungen von personeninternen Faktoren auf die Navigation
14.2.1 Personenvariablen ohne Einfluss auf die Navigation
14.2.1.1 Geschlecht
14.2.1.2 Informationsnetztechnisches Vorwissen
14.2.1.3 Domänenspezifisches Vorwissen
14.2.1.4 Interesse am Thema des Hypertextes, Motivation und Kompetenzerwartungen
14.2.2 Personenvariablen mit Einfluss auf die Navigation
14.2.2.1 Kognitive Fähigkeiten
14.2.2.2 Interesse an der Arbeit mit dem PC und positive Einstellung zum Computer
14.3 Die Bedeutung von Kontrollüberzeugungen
14.3.1 Erklärungsansätze für die Ergebnisse zu generalisierten und bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen
14.3.2 Einfluss von Kontrollüberzeugungen auf die Navigation im Hypertext
14.4 Einflussfaktoren auf den Wissenserwerb
14.4.1 Vorwissen
14.4.2 Navigation
14.4.3 Kontrollüberzeugungen
14.4.4 Erklärungsansätze für die Ergebnisse des Wissenstests
15. Reflexion: Kritikpunkte und Anregungen für zukünftige Untersuchungen
16. Implikationen für die Praxis
Zusammenfassung
Literatur
Anhang
A. Untersuchungsmaterialien
1. Teil 1 der Untersuchung
2. Teil 2 der Untersuchung
B. Tabellen
1. Testtheoretische Überprüfung der Untersuchungsinstrumente
2. Deskriptive Datenanalyse
3. Hypothesenprüfung
3.1 Einflussfaktoren auf die Navigation
3.2 Einfluss der generalisierten Kontrollüberzeugungen
3.3 Einfluss der bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen
3.4 Einflussfaktoren auf den Wissenstest
4. Weitere Ergebnisse
4.1 Clusteranalyse zur Navigation
4.2 Weiterführende Analyse der Wissenstestergebnisse
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen
Abbildung 2: Handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit
Abbildung 3: Hypothetische Konzeption der hierarchischen Struktur handlungs- theoretischer Persönlichkeitsvariablen
Abbildung 4: Veranschaulichung des Hypertext – Konzepts
Abbildung 5: Hypertext – Basis mit hybrider Organisationsstruktur
Abbildung 6: Wegformen beim Browsing
Abbildung 7: Kontrollüberzeugungen im Rahmen anderer Einflussfaktoren auf die Bearbeitung von Hypertext
Abbildung 8: Screenshot eines Hypertextknotens
Abbildung 9: Ablauf des ersten Untersuchungsteiles
Abbildung 10: Ablauf des zweiten Untersuchungsteiles
Abbildung 11: Verwendung des PC im Schulunterricht in anderen Fächern als Informatik
Abbildung 12: Unterschiedliche Sicht des Computers bei Mädchen und Burschen
Abbildung 13: Motive der SchülerInnen zur Teilnahme an der Untersuchung
Abbildung 14: Einschätzung des Vorwissens zu den einzelnen Hypertext-Kapiteln
Abbildung 15: Prozent im Mittel betrachteter Hypertextseiten pro Ebene und Prozentanteile der einzelnen Ebenen an der Gesamtbearbeitungszeit
Abbildung 16: Vergleich zwischen der Anzahl besuchter lerntestrelevantern Knoten und der Anzahl richtig beantworteter Wissenstestfragen
Abbildung 17: Beurteilung des Hypertextes
Abbildung 18: Vergleich Interesse am Mittelalter und Interessantheit des Hypertextes
Abbildung 19: Gruppierte Mediane der Skalen-Scores zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen
Abbildung 20: Bearbeitungstiefe in Abhängigkeit von unterschiedlich hoher generalisierter Internalität
Abbildung 21: Bearbeitungstiefe in Abhängigkeit von unterschiedlich hoher generalisierter Internalität und Assoziationsfähigkeit
Abbildung 22: Bearbeitungstiefe in Abhängigkeit von unterschiedlich hoher hypertextspezifischer Internalität
Abbildung 23: Bearbeitungstiefe in Abhängigkeit von unterschiedlich hoher hypertextspezifischer Internalität und Assoziationsfähigkeit
Abbildung 24: Mittlere Bearbeitungstiefen von bereichspezifisch Internalen und bereichspezifisch Externalen
Abbildung 25: Wissenstestleistungen in Abhängigkeit von unterschiedlich hohem Vorwissen
Abbildung 26: Auswirkungen von Navigationsparametern auf die Wissenstestergebnisse
Abbildung 27: Mittlere Werte der Navigationsvariablen in den fünf Clustern
Abbildung 28: Mittlere Werte für Navigation und Kontrollüberzeugungen in den fünf Clustern
Abbildung 29: Unterschiede in den Fähigkeiten zum logischen Schließen und zum Herstellen von Beziehungen zwischen den Clustern
Abbildung 30: Unterschiede in der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit zwischen den Clustern
Abbildung 31: Unterschiede zwischen den Clustern in Navigation, Kontroll- überzeugungen, kognitiven Fähigkeiten und Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit
Abbildung 32: Lernleistungen von Personen mit unterschiedlich ausgeprägter fatalistischer Externalität
Abbildung 33: Lernleistungen von Personen mit unterschiedlich ausgeprägter Fähigkeit zum Herstellen von Beziehungen
Abbildung 34: Lernleistungen von Personen mit unterschiedlich hohem Vorwissen
Abbildung 35: Lernleistungen von Personen mit unterschiedlich hohen Anzahlen von betrachteten Hypertextseiten und von Seitenaufrufen
Abbildung 36: Lernleistungen von Personen mit unterschiedlicher Clusterzugehörigkeit
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
Tabelle 2: Übersicht über Hypothesen, abhängige und unabhängige Variablen
Tabelle 3: Bedeutung hoher und niedriger Werte der Primärskalen des FKK
Tabelle 4: Itemauswahl für den gekürzten FKK
Tabelle 5: Seitenzahlen im Hypertext pro Kapitel und Ebene
Tabelle 6: Anzahl der Wissenstestfragen im Verhältnis zu den Seitenanzahlen in Kapiteln und Ebenen
Tabelle 7: TeilnehmerInnenzahlen, getrennt nach Fächern
Tabelle 8: Personenverteilung nach Schultypen
Tabelle 9: Reliabilitätstabelle für FKK-Skalen
Tabelle 10: Paralleltest nach Horn (1965) für KUT-Skalen
Tabelle 11: Reliabilitätstabelle für KUT-Skalen
Tabelle 12: Reliabilitätstabelle für ISA-Subtests
Tabelle 13: Konfidenzintervalle für STM, STMBMINB und STMBMAXB
Tabelle 14: Gruppen zur Ausprägung kognitiver Fähigkeiten
Tabelle 15: Gruppen zur Ausprägung des domänenspezifischen Vorwissens
Tabelle 16: Gruppen zur Ausprägung der Hypertexterfahrung
Tabelle 17: Gruppen zur Ausprägung der positiven Einstellung zum Computer
Tabelle 18: Gruppen zur Ausprägung des Interesses
Tabelle 19: Gruppen zur Ausprägung der Motivation
Tabelle 20: Gruppen zur Ausprägung der Kompetenzerwartung
Tabelle 21: Personenmerkmale und ihr Einfluss auf die Bearbeitung des Hypertextes
Tabelle 22: Generalisierte Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Anzahl betrachteter Hypertextseiten
Tabelle 23: Generalisierte Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Anzahl der Seitenaufrufe
Tabelle 24: Generalisierte Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Bearbeitungszeit des Hypertextes
Tabelle 25: Generalisierte Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Bearbeitungstiefe des Hypertextes
Tabelle 26: Auswirkungen von generalisierter Internalität und Assoziations- fähigkeit auf die Bearbeitungstiefe des Hypertextes
Tabelle 27: Hypertextspezifische Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Anzahl betrachteter Hypertextseiten
Tabelle 28: Hypertextspezifische Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Anzahl der Seitenaufrufe
Tabelle 29: Hypertextspezifische Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Bearbeitungszeit des Hypertextes
Tabelle 30: Hypertextspezifische Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Bearbeitungstiefe des Hypertextes
Tabelle 31: Auswirkungen von bereichspezifischer Internalität und Assoziationsfähigkeit auf die Bearbeitungstiefe des Hypertextes
Tabelle 32: Vergleich von bereichspezifisch Internalen und bereichspezifisch Externalen hinsichtlich der Bearbeitungstiefe des Hypertextes
Tabelle 33: Kontrollüberzeugungen und ihr Einfluss auf die Bearbeitung des Hypertextes
Tabelle 34: Auswirkungen von Vorwissen auf das Wissenstestergebnis
Tabelle 35: Gruppen zu den Navigationsvariablen
Tabelle 36: Einflussfaktoren auf den Wissenserwerb
Tabelle 37: Ergebnisse der Hypothesenprüfung im Überblick
Tabelle 38: Personenanzahlen in den fünf Clustern
Tabelle 39: Deskriptive Statistiken zu den wissenstestrelevanten Maßen der Hypertextbearbeitung
Tabelle 40: Faktorenanalysen zum FKK
Tabelle 41: Interkorrelationen der FKK-Skalenwerte
Tabelle 42: Faktorenanalyse zur KUT-Kurzform
Tabelle 43: Korrelationen KUT und FKK
Tabelle 44: Faktoren- und Reliabilitätsanalyse zum Fragebogen Interesse
Tabelle 45: Teststatistische Analysen zum Fragebogen für computer-, web- und hypertextbezogene Erfahrungen
Tabelle 46: Faktoren- und Reliabilitätsanalyse zum Fragebogen zur Computer-Einstellung
Tabelle 47: Faktoren- und Reliabilitätsanalyse zum Fragebogen Vorwissen
Tabelle 48: Faktoren- und Reliabilitätsanalyse zum Fragebogen zur Beurteilung des Hypertextes und seiner Bearbeitung
Tabelle 49: Reliabilitätsanalyse zum verkürzten Wissenstest
Tabelle 50: Reliabilitätstabelle für den Wissenstest
Tabelle 51: Ergebnisse und Bearbeitungszeiten für die ISA-Subtests
Tabelle 52: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest (ISA-Subtests)
Tabelle 53: Unterschiede in den ISA-Subtests zwischen Schultypen
Tabelle 54: Korrelationen ISA-Subtestergebnisse und Bearbeitungszeiten
Tabelle 55: Korrelationen ISA-Subtestergebnisse und Schulnoten
Tabelle 56: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest (Skalen PCERF und HTERF)
Tabelle 57: Ergebnisse zum informationnetztechnischen Vorwissen und der Erfahrung im Umgang mit Hypertext
Tabelle 58: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest (Skala PCEINST)
Tabelle 59: Ergebnisse zur positiven Einstellung gegenüber dem PC
Tabelle 60: Unterschiedliche Sicht des Computers bei Mädchen und Burschen
Tabelle 61: Korrelationen zwischen positiver Einstellung zum PC und Erfahrung mit PC und Hypertext
Tabelle 62: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest (Skalen MAINT, PCINT, INMOTI, EXMOTI)
Tabelle 63: Gruppierte Mediane und Perzentile zu den Motiven
Tabelle 64: Ergebnisse zu Interesse und Motivation
Tabelle 65: Einschätzung des Vorwissens zu den einzelnen Hypertext-Kapiteln
Tabelle 66: Ergebnisse zum domänenspezifischen Vorwissen
Tabelle 67: Ergebnisse zu den einzelnen Navigationsmaßen
Tabelle 68: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest (Navigationsmaße)
Tabelle 69: Ergebnisse des Wissenstests
Tabelle 70: Anzahlen besuchter wissenstestrelevanter Knoten und richtig beantworteter Wissenstestfragen
Tabelle 71: Bearbeitungszeiten des Wissenstests
Tabelle 72: Einschätzung des Wissenstestergebnisses
Tabelle 73: Korrelationen zum Wissenstest
Tabelle 74: Akzeptanz des Hypertextes
Tabelle 75: Schätzung des Hypertext-Umfangs
Tabelle 76: Beurteilung der Aufgabenschwierigkeit
Tabelle 77: Präferenzen Papier- vs. Computerversion des Textes
Tabelle 78: Ergebnisse zu Kontrollüberzeugungen (Gesamtstichprobe)
Tabelle 79: Ergebnisse zu Kontrollüberzeugungen (Mädchen und Burschen)
Tabelle 80: Geschlechtsunterschiede in Kontrollüberzeugungen
Tabelle 81: Korrelationen mit Kontrollüberzeugungen
Tabelle 82: Geschlechtsunterschiede im Navigationsverhalten (Hypothese NH1)
Tabelle 83: Deskriptive Statistiken und K-S Test zu Hypothese NH2
Tabelle 84: Fähigkeit zum logischen Schließen und Navigation (NH2)
Tabelle 85: Fähigkeit zur Herstellung von Beziehungen und Navigation (NH2)
Tabelle 86: Merkfähigkeit und Navigation (NH2)
Tabelle 87: Domänenspezifisches Vorwissen und Navigation (NH3)
Tabelle 88: Hypertexterfahrung und Navigation (NH4)
Tabelle 89: Positive Einstellung zum Computer und Navigation (NH5)
Tabelle 90: Interesse am Mittelalter und Navigation (NH6)
Tabelle 91: Interesse an PC-Arbeit und Navigation (NH6)
Tabelle 92: Intrinsische Motivation und Navigation (NH7)
Tabelle 93: Extrinsische Motivation und Navigation (NH7)
Tabelle 94: Generalisierte Kompetenzerwartungen und Navigation (NH8)
Tabelle 95: Personenanzahlen in den Vergleichsgruppen zu generalisierten Kontrollüberzeugungen (HH1)
Tabelle 96: Kolmogorov-Smirnow Anpassungstest für Navigationsparameter in den Vergleichsgruppen zu generalisierten Kontrollüberzeugungen
Tabelle 97: Einfaktorielle Varianzanalyse zum Einfluss der Internalität auf die Bearbeitungstiefe (HH1)
Tabelle 98: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest zur geplanten zweifaktoriellen Varianzanalyse zum Einfluss von generalisierter Internalität und Assoziationsfähigkeit auf die Bearbeitungstiefe (HH1)
Tabelle 99: Ergänzungen zur zweifachen Rangvarianzanalyse zum Einfluss von generalisierter Internalität und Assoziationsfähigkeit auf die Bearbeitungstiefe (HH1)
Tabelle 100: Personenanzahlen in den Vergleichsgruppen zu bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen (HH2)
Tabelle 101: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest für Navigationsparameter in den Vergleichsgruppen zu bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen (HH2)
Tabelle 102: Einfaktorielle Varianzanalyse zum Einfluss der bereich- spezifischen Internalität auf die Bearbeitungstiefe (HH2)
Tabelle 103: Ergänzungen zur zweifaktoriellen Varianzanalyse zum Einfluss von bereichspezifischer Internalität und Assoziationsfähigkeit auf die Bearbeitungstiefe (HH2)
Tabelle 104: Personenanzahlen in den Gruppen bereichspezifisch Internaler und bereichspezifisch Externaler und Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest für die Bearbeitungstiefe (HH2)
Tabelle 105: Einfluss des Vorwissens auf die Wissenstestergebnisse (NH9)
Tabelle 106: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest für LT_SUM in den Navigationsgruppen (NH10)
Tabelle 107: Anzahl betrachteter Hypertextseiten und Wissenstestergebnis (NH10)
Tabelle 108: Anzahl Seitenaufrufe und Wissenstestergebnis (NH10)
Tabelle 109: Bearbeitungszeit und Wissentestergebnis (NH10)
Tabelle 110: Bearbeitungstiefe und Wissenstestergebnis (NH10)
Tabelle 111: Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest für LT_SUM in den Kontrollüberzeugungsgruppen (HH3)
Tabelle 112: Generalisierte Internalität und Wissenstestergebnis (HH3)
Tabelle 113: Hypertextspezifische Internalität und Wissenstestergebnis (HH3)
Tabelle 114: Klassifizierungsergebnisse (Diskriminanzanalyse)
Tabelle 115: Deskriptive Statistiken und Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest für die Navigationsvariablen in den Clustern
Tabelle 116: Unterschiede zwischen den Clustern in der Anzahl betrachteter Hypertextseiten
Tabelle 117: Unterschiede zwischen den Clustern in der Anzahl der Seitenaufrufe
Tabelle 118: Unterschiede zwischen den Clustern in der Bearbeitungszeit des Hypertextes
Tabelle 119: Unterschiede zwischen den Clustern in der Bearbeitungstiefe des Hypertextes
Tabelle 120: Unterschiede zwischen den Clustern in domänenspezifischem Vorwissen, Hypertexterfahrung und Einstellung zum Computer
Tabelle 121: Unterschiede zwischen den Clustern in Interesse und Motivation
Tabelle 122: Unterschiede zwischen den Clustern in generalisierter Internalität, fatalistischer Externalität und hypertextspezifischer Externalität
Tabelle 123: Unterschiede zwischen den Clustern in sozialer Externalität
Tabelle 124: Unterschiede zwischen den Clustern in hypertextspezifischer Internalität
Tabelle 125: Unterschiede zwischen den Clustern in den kognitiven Fähigkeiten
Tabelle 126: Unterschiede zwischen den Clustern in der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit
Tabelle 127: Zu den wissenstestrelevanten Maßen der Hypertextbearbeitung in den fünf Navigations-Clustern
Tabelle 128: Unterschiede zwischen den Clustern in der Anzahl richtig beantworteter Wissenstestfragen von besuchten wissenstestrelevanten Hypertextseiten (BESANT)
Tabelle 129: Unterschiede zwischen den Clustern in der Anzahl richtig beantworteter Wissenstestfragen von nicht besuchten wissentestrelevanten Hypertextseiten (BESNOANT)
Tabelle 130: Unterschiede zwischen den Clustern in der Anzahl richtig beantworteter Wissenstestfragen von nicht besuchten wissensrelevanten Hypertextseiten (NOBESANT)
Tabelle 131: Unterschiede in den Clustern in der Anzahl falsch beantworteter Wissenstestfragen von nicht besuchten wissenstestrelevanten Hypertextseiten (NOBES)
Tabelle 132: Wissenstestscore, Summen von „Weiß-nicht“- und falschen Antworten bzw. Wissenstest-Bearbeitungszeit in den fünf Navigations-Clustern
Tabelle 133: Unterschiede zwischen den Clustern im Wissenstestscore (LT_SUM)
Tabelle 134: Unterschiede zwischen den Clustern in der Anzahl der „Weiß-nicht“-Antworten (LT_WN)
Tabelle 135: Unterschiede zwischen den Clustern in der Anzahl falsch beantworteter Wissenstestfragen (LT_FAL)
Tabelle 136: Unterschiede zwischen den Clustern in der Bearbeitungszeit des Wissenstests (LT-ZEIT)
Tabelle 137: Unterschiede in den Lernleistungen (LLM) von Mädchen und Burschen
Tabelle 138: Unterschiede in den Lernleistungen von Personen mit unterschiedlich hoher fatalistischer Externalität
Tabelle 139: Unterschiede in den Lernleistungen von Personen mit unterschiedlich hoher Assoziationsfähigkeit
Tabelle 140: Unterschiede in den Lernleistungen von Personen mit unterschiedlich hohem Vorwissen
Tabelle 141: Unterschiede in den Lernleistungen von Personen mit unterschiedlichen Anzahlen betrachteter Hypertextseiten und Seitenaufrufe
Tabelle 142: Unterschiede in den Lernleistungen von Personen mit unterschiedlicher Clusterzugehörigkeit
Tabelle 1: Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Wissenserwerb ist nicht denkbar ohne ein Kommunikationsmittel. Über Jahrtausende wurden wichtige Informationen niedergeschrieben, um sie nachfolgenden Generationen weitergeben zu können. Heute, im Zeitalter der rasanten Entwicklung neuer Informationstechnologien, stehen uns zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung, Wissen mittels technischer Medien zu tradieren. Ein solches Medium stellen Hypertexte dar, die durch eine netzwerkartige Globalstruktur charakterisiert sind. Der große Vorteil dieses Mediums wird darin gesehen, dass sich der Lerner nicht nach einem vom Autor vorgegebenen Textaufbau richten muss, wie dies bei linearen Texten oft der Fall ist, sondern er kann nach jeder Informationseinheit die Entscheidung treffen, auf welche Information er als nächstes zugreifen möchte (vgl. Gerdes, 1999; Unz, 2000; Tergan, 2002). Das bedeutet aber auch, dass der Lerner zwei Aufgaben gleichzeitig zu erledigen hat: die Aneignung von Wissen und die eigenständige Suche nach Information. Ob er diese Aufgabe erfolgreich bewältigen kann, hängt unter anderem davon ab, ob er den zur Verfügung stehenden Entscheidungsspielraum nützen kann. Selbstgesteuertes Lernen, welches durch Hypertexte möglich wird, kann man als Form komplexen Handelns verstehen, da es dessen drei Hauptmerkmale aufweist (Hacker, 1978; Volpert, 1983):
- Es ist zielorientiert, weil der Lerner eine Vorstellung braucht, welches Wissen er sich aneignen will.
- Es ist sequentiell hierarchisch organisiert, weil der Lerner Teilbereiche festlegen und Einzeloperationen nacheinander abarbeiten muss, um das Lernziel zu erreichen.
- Es ist über Feed-back Schleifen regulierbar, weil die mental repräsentierten Teilziele ständig mit der einlaufenden Information in Bezug auf das Lernen verglichen werden müssen.
Wenn selbstgesteuertes Lernen als Form komplexen Handels gesehen wird und beim Lernen mit Hypertext notwendig ist, erscheint es unabdingbar, den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen mit handlungsleitendem Charakter auf den Wissenserwerbprozess mit diesem Medium zu untersuchen, zumal der Umgang mit dem Computer im Allgemeinen und den neuen Medien im Besonderen immer mehr zu Schlüsselkompetenzen in unserem Bildungssystem werden. Als Handlungsüberzeugungen, die menschliches Tun beeinflussen, werden neben Handlungs- und Lageorientierung und Attributionsstilen Kontrollüberzeugungen beschrieben (Asendorpf, 1999). Diese sind einerseits als generalisierte Konstrukte konzipiert, die sich aufgrund vielfältiger Erlebnisse in unterschiedlichen Lebensbereichen herausbilden und damit zeitlich und intersituational relativ stabil sind. Andererseits verfügen Personen neben diesen globalen Überzeugungen auch über handlungsleitende Erwartungen, die bestimmte, enger umschriebene Lebensbereiche betreffen. Daher wird zwischen generalisierten und bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen unterschieden (vgl. Krampen, 1987; Beier, 1999).
Ziel dieser Studie ist es, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass unterschiedliche Ausprägungen von Kontrollüberzeugungen die Informationssuche von Personen in einem Hypertext und damit den Wissenserwerb mit diesem Medium beeinflussen. Der erste Teil der Arbeit ist Kontrollüberzeugungen gewidmet. Er gibt einen Überblick über die Entwicklung und Differenzierung dieses Konstrukts, interindividuelle Unterschiede aufgrund von Kontrollüberzeugungen und den aktuellen Stand der Forschung. Im zweiten Teil werden unter Bezugnahme auf einschlägige Ergebnisse der Hypertextforschung das Medium Hypertext charakterisiert und der Einfluss von verschiedenen Personenmerkmalen auf den Umgang bzw. den Wissenserwerb mit ihm beschrieben. Diese Daten bilden die Grundlage für die eigene Forschungsarbeit, in der die Einflüsse von Kontrollüberzeugungen und verschiedenen anderen Personenvariablen, die sich neben und mit ihnen auf die Navigation durch einen Hypertext und den Wissenserwerbsprozess mit diesem Medium auswirken, an GymnasiastInnen der 11. Schulstufe untersucht werden. Die folgenden Kapitel erläutern die zugrunde liegenden Fragestellungen, das Design und die Durchführung der Untersuchung. Den Abschluss bilden die Auswertung der einzelnen Ergebnisse und ihre Diskussion.
Theoretische Grundlagen
1. Kontrollüberzeugungen
Allgemeinen Ausführungen zum Begriff Kontrollüberzeugungen und verwandten Konstrukten folgt ein Überblick über den theoretischen Hintergrund zu diesem Konstrukt und dessen Entwicklung. Anschließend wird kurz auf Entstehung und Veränderung von Kontrollüberzeugungen eingegangen und ein Überblick über die Messung dieses Personenmerkmals gegeben. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Übersicht über die Unterschiede im Verhalten von Personen mit unterschiedlicher Merkmalsausprägung bzw. die Beschreibung von empirischen Ergebnissen aus drei Bereichen, die für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit maßgeblich erscheinen.
1.1 Begriffsbestimmungen
Die Kontrollüberzeugungen (= „locus of control of reinforcement“, Rotter, 1966), ein zentrales Konzept, wenn es um die Ausübung von Tätigkeiten geht, sind theoretisch in der Sozialen Lerntheorie von Rotter (siehe Kapitel 1.3.1, S. 31f.) verankert. Es handelt sich bei ihnen allgemein um Erwartungen bezüglich der Instanz, die von der Person als verantwortlich für Konsequenzen ihres Verhaltens angesehen wird. Je nachdem, ob diese Instanz als innerhalb oder außerhalb der Person liegend betrachtet wird, wird unterschieden zwischen
- internaler Kontrollüberzeugung: Die handelnde Person sieht sich selbst bzw. ihr Verhalten als Verursacher der entsprechenden Konsequenzen.
- externaler Kontrollüberzeugung: Die Person nimmt an, dass die Ergebnisse ihres Handelns von Faktoren wie Glück, Zufall, dem Einwirken von Personen mit mehr Macht und anderen externen Bedingungen bestimmt werden, die außerhalb ihrer eigenen Einflussmöglichkeiten liegen.
Rotter hat das Konstrukt eindimensional mit den beiden Polen Internalität und Externalität konzipiert und zu seiner Erfassung einen eigenen Fragebogen, den ROT-IE (1966) (Näheres zur Messung von Kontrollüberzeugungen siehe Kap. 1.5, S. 46f.) vorgelegt, der bis heute vielen Studien vor allem aus dem anglo-amerikanischen Raum zugrunde liegt. Faktorenanalytische Untersuchungen ließen aber bald Zweifel an der Eindimensionalität des Kontrollüberzeugung-Konzepts aufkommen (Überblicke dazu siehe Krampen, 1981; Krampen, 1982; Amelang & Bartussek, 2001), die zu einer Reihe von theoretisch-konzeptuellen Konstruktdifferenzierungen führten (siehe Kap. 1.3.2, S. 33f.).
Jede Situation enthält bestimmte Hinweisreize, die bei der Person Erwartungen über die Zusammenhänge zwischen Verhalten und damit erreichbaren Verhaltensfolgen auslösen. Unter Erwartung wird dabei die „subjektive Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmter Verstärker oder eine Gruppe von Verstärkern in einer bestimmten gegebenen Situation oder in bestimmten Situationen auftreten wird“ verstanden (Rotter, Chance & Phares, 1972, S. 24, zitiert nach Mielke, 1996, S. 186). Demnach wird unterschieden zwischen
- spezifischen Erwartungen: Sie sind entstanden aufgrund von Erfahrungen mit speziellen, eng umschriebenen Situationen, d. h. sie beziehen sich auf eben diese Situationen und sehr konkrete Verhaltensweisen.
- generalisierten Erwartungen: Sie sind entstanden aufgrund von Erfahrungen mit einer Vielzahl von speziellen Situationen, die aber über diese Situationen hinaus auf andere Situationen generalisiert wurden und vor allem in neuen Situationen, die von der Person nicht genau eingeschätzt werden können, zum Tragen kommen. Da diese „das Resumee aus den Erfahrungen“ einer Person (Mielke, 1996, S. 187) darstellen, sind sie zeitlich überdauernd und relativ stabil.
Unter der Annahme, dass sich Personen hinsichtlich ihrer generalisierten Erwartungen systematisch voneinander unterscheiden, lassen diese Unterschiede Vorhersagen auf das Verhalten in verschiedenen Situationen zu (Amelang & Bartussek, 2001). Die Determination der aktuellen Erwartung durch die generalisierten Kontrollüberzeugungen ist umso größer, je unbekannter oder vieldeutiger die Situation ist. Kennt die Person aber ihre Kontrollmöglichkeiten in der Situation aus vorhergehenden Erfahrungen sehr genau, dann überwiegen die aufgrund der speziellen Kenntnisse der Situation aktualisierten Erwartungen, d. h. die bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen (vgl. Rotter, 1966; Mielke, 1996; Amelang & Bartussek, 2001).
Für den Rotterschen Begriff „locus of control of reinforcement“ gibt es im Deutschen verschiedene Übersetzungen. Krampen (2000) nennt unter anderem die Bezeichnungen „Verstärkungskontrolle“ (Osselmann, 1976), „internale versus externale Kontrolle der Verhaltensverstärkungen“ (Keller, 1977), „Selbstverantwortlichkeit“ (Baumann-Frankenberger, 1979), „Ort der Steuerung“ (Haas, 1980) und „generalisierte Kontrollmeinung“ (Pfrang & Schenk, 1987) (zitiert nach Krampen, 2000, S. 110). Obwohl die deutsche Übersetzung von „locus of control“ mit „Kontrollüberzeugungen“ manchen als nicht sehr präzise erscheint (Amelang & Bartussek, 2001, S. 504), betrachtet Krampen sie als die treffendste und führt dafür folgende Argumente an (Krampen, 2000, S. 110):
- Der Begriff ist sprachlich prägnant und leicht kommunizierbar.
- Die Pluralform weist auf die konzeptuelle Mehrdimensionalität des Konstrukts hin.
- Es wird deutlich, dass subjektive Haltungen einer Person gemeint sind, die als Überzeugungen weitgehend generalisiert sind.
- Die situative Komponente der Kontrollierbarkeit ist weitgehend ausgeschaltet (nicht so z. B. beim Begriff „Kontrollwahrnehmung“).
- Normative Implikationen, wie z. B. beim Begriff „Selbstverantwortlichkeit“, und technische oder technologische Assoziationen, wie z. B. bei der Bezeichnung „Ort der Steuerung“, werden vermieden.
1.2 Verwandte Konstrukte
Kontrollüberzeugungen sind nicht nur im Rahmen der Sozialen Lerntheorie von Bedeutung, sondern stehen mit einer Vielzahl von Konzepten in Verbindung, die unter dem Oberbegriff Erwartungs-Wert-Theorien zusammengefasst werden können. Den umfassendsten Überblick über die Fülle an inhaltlichen und empirischen Beziehungen zwischen Kontrollüberzeugungen und verschiedenen Konstrukten aus Psychologie und Soziologie gibt Krampen (1982, S. 51ff.), der folgende Konzeptionen als mit Kontrollüberzeugungen verwandt beschreibt:
- attributionstheoretische Konzeptionen, wie Kausalattributionen, erlernte Hilflosigkeit, Glaube an eine gerechte Welt
- selbstbezogene Kognitionen, wie Selbstaufmerksamkeit, Selbstwirksamkeit, Engagement-Stil, Kontrollbewusstsein
- handlungstheoretische Konzepte, wie Handlungskontrolle, Kontrollmeinung, Kontrollkompetenz, Hoffnungslosigkeit
- lern- und motivationspsychologische Konzepte, wie Selbst- und Fremdkontrolle, Wirksamkeits- und Kontrollmotivation, persönliche Verursachung
- soziologische und sozialpsychologische Konzepte, wie Entfremdung und Machtlosigkeit
1.3 Konstruktentwicklung
1.3.1 Soziale Lerntheorie von Rotter
Die Theorie des sozialen Lernens von Rotter (1954) ist den Erwartungs-Wert-Theorien zuzurechnen und strebt eine Integration von Reiz-Reaktions- oder Verstärkungstheorien und Kognitiven oder Feldtheorien an (Rotter, 1975, S. 45). Übereinstimmend mit anderen Erwartungs-Wert-Modellen geht Rotter davon aus, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens von zwei Faktoren abhängt:
- von der Erwartung, dass dieses Verhalten zum Ziel, d. h. zum Erhalt eines angestrebten Verstärkers, führt und
- vom Wert, den die Person diesem Ziel, d. h. dem erwarteten Verstärker, beimisst.
Rotters Theorie umfasst vier Grundkonzepte: Verhaltenspotential („behavior potential“, BP), Erwartung („expectancy“, E), Verstärkungswert („reinforcement value“, RV) und die psychologische Situation, d. h. eine von der Person subjektiv wahrgenommene Situation, in der sie sich für eine bestimmte Verhaltensalternative entscheiden kann (Meyer, 1982, S. 63). Rotters grundlegende Formel BPBx,S1,Ra B= f (EBx,Ra,S1 B& RVBa,S1B) drückt Folgendes aus: „…the potential for behavior x to occur in situation 1, in relation to reinforcement a, is a function of the expectancy of the occurrence of reinforcement a following behaviour x, in situation 1, and the value of reinforcement a in situation 1” (Lefcourt, 1976, S. 32). Je mehr die Person also erwartet, dass in einer bestimmten Situation auf ein bestimmtes Verhalten ein bestimmter Verstärker folgt und je höher der Wert dieses Verstärkers für die Person ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Verhalten an den Tag legt. Verhaltensbestimmend sind demnach die kognitiven Variablen „Erwartung einer Verstärkung“ und „Verstärkungswert“ (Amelang & Bartussek, 2001, S. 503). Damit beinhaltet Rotters Theorie im Vergleich mit anderen Erwartungs-Wert-Modellen grundsätzlich nichts Neues.
Neu ist jedoch das nachträglich in die Theorie eingefügte Element der „internalen versus externalen Verstärkungskontrolle“ (= „internal versus external control of reinforcement“, Rotter, Seeman & Liverant, 1962; Rotter, 1966), das Rotter folgendermaßen beschreibt:
TWhen a reinforcement is perceived by the subject as following some action of his own but not being entirely contingent upon his action, then, in our culture, it is typically perceived as the result of luck, chance, fate, as under the control of powerful others, or as unpredictable because of the great complexity of the forces surrounding him. When the event is interpreted in this way by an individual, we have labelled this a belief in external control. If the person perceives that the event is contingent upon his own behaviour or his own relatively permanent characteristicsT, we have termed this a belief in internal control (Rotter, 1966, S. 1).
In Abhängigkeit von ihrer Lebensgeschichte unterscheiden sich Personen im Ausmaß, in dem sie den Erhalt von Verstärkung eigenen Handlungen zuschreiben. Diese von speziellen Situationen auf andere, als ähnlich empfundene Situationen generalisierten Erwartungen hinsichtlich der Kontrolle über den Erhalt von Verstärkern, d. h. über die Kausalbeziehungen zwischen eigenem Verhalten und dessen Konsequenzen, beeinflussen das Verhalten umso stärker, je neuartiger bzw. je undurchschaubarer eine Situation für die Person ist. Je mehr eine Situation aber als von Fähigkeiten oder vom Zufall bestimmt erscheint, umso weniger Einfluss haben die generalisierten Erwartungen bezüglich des „locus of control“ auf individuelle Verhaltensunterschiede (Rotter, 1966).
1.3.2 Konstruktdifferenzierungen
Im Rahmen seiner Handlungstheoretischen Persönlichkeitspsychologie beschreibt Krampen acht verschiedene Ansätze zur inhaltlichen Aufgliederung des Konstrukts Kontrollüberzeugungen (Krampen, 2000, S. 112ff.). Auf zwei von ihnen wird hier näher eingegangen, weil sie im Zusammenhang mit dieser Arbeit als relevant erscheinen.
1.3.2.1 Passive und defensive Externalität
Rotters Definition von internaler und externaler Kontrolle (siehe Kap. 1.3.1, S. 32) haben zur Vermutung geführt, dass es sich bei Kontrollüberzeugungen um ein typologisches Persönlichkeitskonstrukt mit den beiden Extremausprägungen internaler und externaler Locus of Control handle. Rotter widerspricht dieser Auffassung aber und betont, dass er weder eine Typologie noch eine bimodale Verteilung angenommen habe (Rotter, 1975, S. 45).
Untersuchungen mit dem ROT-IE zeigten, dass die ursprüngliche Annahme Rotters, external orientierte Personen würden sich generell eher passiv und unambitioniert verhalten, weil sie ja aufgrund der Überzeugung, die Kontrolle über Ereignisse in ihrem Leben liege außerhalb ihrer Einflussmöglichkeiten, gar keine Veranlassung zu aktivem bzw. ambitioniertem Verhalten hätten, revidiert werden musste. Während sich die als internal eingestuften Personen in wettbewerbsähnlichen Leistungssituationen in der Regel durchgehend erwartungskonform verhielten, konnten bei den als external eingestuften Personen immer wieder zwei Gruppen identifiziert werden: Externale, die erwartungsgemäßes Verhalten zeigten, und Externale, die sich ähnlich wie Internale verhielten. Dies führte zur Unterscheidung von passiver und defensiver Externalität (Rotter, 1975, S. 58). Krampen (1987, S. 44f.) charakterisiert Personen mit diesen Kontrollüberzeugungen folgendermaßen:
- Passiv-externale Personen führen bedeutende Ereignisse in ihrem Leben vor allem auf Zufall und Schicksal zurück und sind eher wenig wettbewerbsorientiert und ehrgeizig.
- Defensiv-externale Personen sind eher ehrgeizig und leistungsorientiert, haben aber geringe Erfolgserwartung, weil sie von ihrer Abhängigkeit von mächtigen anderen Personen überzeugt sind. In Leistungssituationen verhalten sie sich daher wie Internale, wobei ihnen ihre Externalität als Schutz vor Misserfolgen dient.
Ein von Rotter vermuteter Einfluss von Kultur bzw. Religion dergestalt, dass defensive Externalität eher mit protestantischer Ethik, passive Externalität eher mit fatalistischen Lebensauffassungen, wie z. B. im Islam oder fernöstlichen Religionen, zusammenhängen könnte, konnte nicht bestätigt werden (Krampen, 2000, S. 113).
1.3.2.2 Konstruktdifferenzierung von Levenson
Obwohl empirische Verteilungen von Messwerten in Untersuchungen mit dem ROT-IE und faktorenanalytische Befunde zu Rotters Fragebogen der Eindimensionalitäts-These widersprachen (Krampen, 1985), hielt Rotter an der Eindimensionalität des Locus-of-Control-Konstrukts fest und begründet dies folgendermaßen: „Several additional factors involved only a few items, and only a small degree of variance for each factor could be isolated. These additional factors, however, were not sufficiently reliable to suggest any clear-cut subscales within the test” (Rotter, 1966, S. 16).
Die Differenzierung des Kontrollüberzeugungen-Konstrukts in drei voneinander unabhängige, unipolare Dimensionen erfolgte durch Levenson (1972) im Zusammenhang mit der Entwicklung der IPC-Skalen. Sie unterscheidet zwischen:
- I – „Internal“, als die subjektiv bei der eigenen Person wahrgenommene Kontrolle über das eigene Leben und über Ereignisse und Verstärker in der personenspezifischen Umwelt,
- P – „Powerful others“, als Externalität, die durch ein subjektives Gefühl der Machtlosigkeit bedingt und durch ein Gefühl der sozialen Abhängigkeit von anderen, mächtigeren Personen geprägt ist,
- C – „Chance“, als Externalität, die durch Fatalismus und Skepsis bedingt ist, also durch die generalisierte Erwartungshaltung, dass die Welt unstrukturiert und ungeordnet sei bzw. dass das Leben und die Ereignisse in ihm von Schicksal, Glück, Pech und Zufall abhängig seien.
Levensons Konstruktdifferenzierung fand vor allem im deutschen Sprachraum Beachtung und liegt dem IPC-Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen von Krampen (1981) zugrunde.
1.3.3 Konzept der Selbstwirksamkeit von Bandura
Das Konzept der Selbstwirksamkeit (= self-efficacy) hat im Rahmen der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura (1977, 1986) zentrale Bedeutung. Selbstwirksamkeit ist definiert als Überzeugung einer Person, in einer bestimmten Situation eine bestimmte Leistung erbringen zu können. Dabei spielen tatsächlich vorhandene Fähigkeiten weniger Rolle als die subjektive Überzeugung der Person von ihren Fähigkeiten: Ist sie subjektiv überzeugt, dass ihr für ein erfolgreiches Handeln wesentliche Voraussetzungen fehlen, so wird sie eine Handlung nicht ausführen, auch wenn sie objektiv betrachtet sehr wohl die entsprechenden Fähigkeiten dazu hat:
TPerceived self-efficacy is defined as people’s judgements of their capabilities to organize and execute courses of action to attained designated types of performance. It is concerned not with the skills one has but with the judgements of what one can do with whatever skills one possesses (Bandura, 1986, S. 391T).
Bei Selbstwirksamkeitserwartungen handelt es sich wie bei den Kontrollüberzeugungen um selbstbezogene Kognitionen. Der Unterschied besteht darin, dass sich Kontrollüberzeugungen im Sinne von Rotters Locus-of-Control auf die für die Kontingenz oder Nichtkontingenz von Verhalten und nachfolgendem Verstärkererhalt verantwortliche Instanz beziehen, also Handlungs-Ergebnis-Erwartungen darstellen, während Selbstwirksamkeitserwartungen die subjektiven Überzeugungen der Person über ihre eigenen Fähigkeiten, mit einer gegebenen Problemsituation fertig zu werden, betreffen. Bandura (1977) unterscheidet daher zwischen Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen, die gemeinsam bestimmen, ob und wie ein bestimmtes Verhalten ausgeführt wird (vgl. Abb. 1, S. 36). Überzeugungen hinsichtlich des Locus-of-Control wirken sich in Abhängigkeit von der Ausprägung der Selbstwirksamkeitserwartung daher entweder positiv oder negativ auf das Verhalten aus: „Convictions that outcomes are determined by one’s own actions can be demoralizing or heartening, depending on the level of self-judged efficacy“ (Bandura, 1986, S. 413).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1. Unterschied zwischen Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen (nach Bandura, 1977, S. 193)
Selbstwirksamkeitserwartungen variieren hinsichtlich mehrerer Dimensionen, die in Leistungssituationen bedeutsam werden (Bandura, 1986, S. 396), und zwar hinsichtlich
- ihres Levels (d. h. sie sind abhängig von der Schwierigkeit verschiedener Aufgabenstellungen),
- ihrer Generalität (d. h. Personen können sich in einem spezifischen Bereich oder aber in vielen Bereichen als selbstwirksam empfinden),
- ihrer Stärke (d. h. schwache Selbstwirksamkeitsüberzeugungen können leichter durch gegenteilige Erfahrungen verändert werden als starke. Je höher die Stärke entsprechender Selbstwirksamkeitserwartungen, desto eher wählt die Person herausfordernde Aufgaben, desto mehr Ausdauer legt sie bei der Aufgabenbearbeitung an den Tag und desto eher wird sie die Aufgabe erfolgreich bewältigen können).
Die Beurteilung der eigenen Selbstwirksamkeit durch die Person hängt ab von folgenden vier Quellen, aus denen Selbstwirksamkeitserwartungen gespeist werden (Bandura, 1986, S. 399ff.):
- eigenen Erfahrungen: Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die aus authentischen Erlebnissen der Person über ihre eigenen Möglichkeiten herrühren, sind am stabilsten.
- stellvertretenden Erfahrungen: Selbstwirksamkeitsüberzeugungen können auch aus der Beobachtung von anderen Personen und ihrem Verhalten abgeleitet werden.
- Überzeugung / Überredung: Verbale Informationen von anderen können zumindest kurzfristig Selbstwirksamkeitserwartungen einer Person beeinflussen.
- emotionalen Zuständen: Negative Gefühle, wie z. B. Angst, und positive Gefühle, wie z. B. Freude, beeinflussen Selbstwirksamkeitserwartungen.
Bandura geht von einem Modell der triadischen Reziprozität aus, in dem kognitive und andere personeninterne Faktoren, Umwelt und Verhalten dynamisch und wechselseitig aufeinander einwirken.
1.3.4 Handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit von Krampen
Das Handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit (= HPP) stellt eine Weiterentwicklung und Differenzierung der Sozialen Lerntheorie von Rotter dar. Während sich Rotter eher auf eine Aufzählung verschiedener generalisierter Erwartungen beschränkt, versucht Krampen in seinem Modell Beziehungen zwischen generalisierten selbstbezogenen sowie situations- und bereichspezifischen Kognitionen, d. h. zwischen Persönlichkeitsvariablen im engeren Sinn (= Traits) und situationsabhängigen Personenmerkmalen (= States) zu bestimmen (Krampen, 1989, S. 8).
Grundlage dieses elaborierten Modells zur Vorhersage und Beschreibung von Handlungsintentionen und Handlungen, in dem situative und personale Faktoren einander wechselseitig beeinflussen, ist ein erweitertes Erwartungs-Wert-Modell, das der innere Bereich von Abbildung 2 (siehe S. 38 hellblau unterlegte Kästchen) repräsentiert und dessen basale Konstrukte subjektive Erwartungen und subjektive Bewertungen (= Valenzen) bilden. Krampen (1991) unterscheidet darin vier Arten von Erwartungen:
- Situations–Ereignis–Erwartung: Sie ist die subjektive Erwartung der Person, dass ein bestimmtes Ereignis in einer bestimmten Situation auftritt, ohne dass sie selbst dabei aktiv wird.
- Kompetenzerwartung (= Situations–Handlungs–Erwartung): Sie stellt die subjektive Erwartung der Person dar, dass ihr in einer bestimmten Situation mehrere Handlungsalternativen (bzw. zumindest eine Handlungsmöglichkeit) zur Verfügung stehen.
- Kontingenzerwartung (= Handlungs–Ergebnis–Erwartung): ist die subjektive Erwartung der Person, dass auf ihre Handlung bestimmte Ergebnisse folgen oder nicht.
- Instrumentalität (= Ergebnis–Folge–Erwartung): ist die subjektive Erwartung der Person, dass einem bestimmten Ergebnis bestimmte Konsequenzen folgen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2. Handlungstheoretisches Partialmodell der Persönlichkeit (HPP) nach Krampen (1991, S. 14)
Diese Erwartungen und die mit ihnen verbundenen Valenzen erlauben in Situationen, die der Person bekannt sind, bzw. in kognitiv gut strukturierbaren Situationen eine Beschreibung, Rekonstruktion und Vorhersage ihres Verhaltens. In einer Situation jedoch, die für die Person durch subjektive Neuheit und/oder Ambiguität gekennzeichnet ist, erfolgt hinsichtlich der Erwartungen und Valenzen ein Rückgriff auf die durch Erfahrung entstandenen Generalisierungen, die der äußere Bereich von Abbildung 2 (siehe S. 38 dunkelblau unterlegte Kästchen) darstellt.
Auf der Ebene der Generalisierungen unterscheidet Krampen (1991):
- Vertrauen (= generalisierte Situations–Ergebnis–Erwartungen)
- Selbstkonzept eigener Fähigkeiten (= generalisierte Situations–Handlungs– bzw. Kompetenzerwartungen)
- Kontrollüberzeugungen (= generalisierte Handlungs–Ergebnis– bzw. Kontingenzerwartungen)
- Konzeptualisierungsniveau (= generalisierte Ergebnis–Folge–Erwartungen bzw. Instrumentalitäten)
- Wertorientierungen und Lebensziele (= Generalisierungen der auf Handlungsergebnisse, Ereignisse und Folgen bezogenen situationsspezifischen Valenzen)
Die generalisierten Erwartungen können als situativ und zeitlich stabile Persönlichkeitsvariablen im Sinne von Traits aufgefasst werden, mit Hilfe derer Personen bzw. interindividuelle Unterschiede beschrieben werden können (Amelang & Bartussek, 2001, S. 510).
Um den Persönlichkeitsbereich generalisierter Erwartungshaltungen abzubilden, entwirft Krampen (1987) ein hierarchisches Strukturmodell, das strukturell, nicht aber inhaltlich dem Vorbild des hierarchischen Faktorenmodells von Eysenck (1953) folgt. In diesem stellt er die Beziehungen zwischen situationsspezifischen und in unterschiedlichem Ausmaß generalisierten Erwartungen dar (siehe Abb. 3, S. 40) (Krampen, 2000, S. 122f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3. Hypothetische Konzeption der hierarchischen Struktur handlungstheoretischer Persönlichkeitsvariablen (nach Krampen, 1991, S. 16)
Die unterste Ebene (= E 1 in Abb. 3) beinhaltet, in Analogie zu den „spezifischen Verhaltensweisen“ bei Eysenck, situationsspezifische Erwartungen und Handlungsziele. Von ihnen wird auf Ebene 2 (= E 2 in Abb. 3) generalisiert, d. h. auf Erwartungen, die sich situationsübergreifend auf einen bestimmten Lebens- oder Handlungsbereich beziehen (in Analogie zu Eysencks „habituellen Verhaltensweisen“). Während die Erwartungen auf Ebene 1 also ganz spezielle, eng umschriebene Situationen betreffen, betreffen die Erwartungen auf Ebene 2 bereits größere Bereiche. Hier sind z. B. bereichspezifische Kontrollüberzeugungen für Problemlösehandeln, für politisches Handeln oder für den Umgang mit Hypertexten einzuordnen. Auf Ebene 3 (= E 3 in Abb. 3) erfahren die bereichspezifischen Erwartungen eine weitere Generalisierung. Die Erwartungen auf dieser Ebene (vergleichbar mit Eysencks „Primärfaktoren“) beziehen sich nun nicht mehr auf einen bestimmten Handlungs- und Lebensbereich, sondern auf verschiedene bzw. mehrere. Das bedeutet, dass die generalisierten Erwartungen auf Ebene 3 als Persönlichkeitsmerkmale im engeren Sinn verstanden werden können. Hier sind z. B. generalisierte Kontrollüberzeugungen, wie Internalität, soziale und fatalistische Externalität, angeordnet. Die generalisierten Erwartungen auf Ebene 3 verbinden sich auf Ebene 4 (= E 4 in Abb. 3) zum „System handlungstheoretischer Persönlichkeitsvariablen“ (Krampen, 1991, S. 14). Ebene 4 ist strukturell mit Eysencks „Faktoren 2. Ordnung“ vergleichbar. Die Integration der verschiedensten Persönlichkeitsbereiche ergibt schließlich auf Ebene 5 „das molarste hypothetische Konstrukt der Persönlichkeitspsychologie – nämlich das Konstrukt der Persönlichkeit selbst“ (Krampen, 1991, S. 17), womit auch die Bezeichnung Partialmodell erklärt ist.
1.3.5 Bereichspezifische Kontrollüberzeugungen
Kontrollüberzeugungen im Sinne von Rotter sind über alle Lebensbereiche generalisierte Erwartungshaltungen, die sich aufgrund vielfältiger Erlebnisse in unterschiedlichen Bereichen herausgebildet haben und als zeitlich und intersituational stabil betrachtet werden. Es erscheint fraglich, ob und inwiefern ein so allgemeiner Ansatz valide Aussagen für eingegrenzte Bereiche zulässt. Da sich Lernerfahrungen in einzelnen Lebensbereichen hinsichtlich der erlebten Kontrollmöglichkeiten unterscheiden lassen, sind hinsichtlich dieser einzelnen Bereiche unterschiedliche Erwartungen, nämlich bereichspezifische Kontrollüberzeugungen, anzunehmen (Krampen, 1987; Beier, 1999). Modelle, die zwischen verschiedenen Generalisierungsebenen der Erwartungen unterscheiden, wie das in Kapitel 1.3.4 (S. 37ff.) vorgestellte HPP von Krampen (1987ff.), das situationsbezogene, lebensbereichspezifische und generalisierte Beschreibungsebenen umfasst, erscheinen daher für Aussagen über Verhalten und seinen Zusammenhang mit Kontrollüberzeugungen besser geeignet als globalere Modelle.
Mit einem differenzierten Modell wie dem Handlungstheoretischen Partialmodell der Persönlichkeit, in dem Kontrollüberzeugungen außerdem als voneinander weitgehend unabhängige Dimensionen betrachtet werden, ist es auch möglich zu erklären, warum sich spezifische Kontrollüberzeugungen von generalisierten Kontrollüberzeugungen deutlich unterscheiden können (Lohaus, 1992). Eine Person mit hoher generalisierter Internalität kann in einem bestimmten Lebensbereich hoch external sein. So kann z. B. ein hoch-internaler Studierender, der überzeugt ist, dass seine Ergebnisse bei Prüfungen von seinen eigenen Anstrengungen abhängen, dennoch für mündliche Prüfungen hohe externale Kontrollüberzeugungen haben und aufgrund von gemachten Erfahrungen davon überzeugt sein, dass sein Abschneiden hier in erster Linie vom Wohlwollen des Prüfers abhängt. Rotter (1966) und andere Theoretiker der Sozialen Lerntheorie, wie z. B. Lefcourt (1976) betonen zwar, dass neben generalisierten Erwartungen auch Situationsvariablen die Kontingenzwahrnehmung der Person beeinflussen: Je mehr Erfahrung eine Person mit einer Situation hat und je eindeutiger diese Situation für die Person ist, desto geringer ist der Einfluss der generalisierten Erwartungen hinsichtlich des Locus-of-Control (vgl. Kap. 1.3.1, S. 31f.). Den Versuch, bereichspezifische Kontroll-überzeugungen zu erheben, haben Rotter und seine Mitarbeiter aber wieder verworfen (Mielke, 1996).
Untersuchungen bereichspezifischer Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit politischem Verhalten (z. B. Krampen & Wünsche, 1985) oder mit Gesundheit und Krankheit (Überblick über verschiedene Untersuchungen zu krankheitsspezifischen Kontrollüberzeugungen bei Lohaus, 1992) haben ergeben, dass eine differenzierte Erfassung vor allem der externen Kontrollinstanzen notwendig ist, weil der Glaube an die eine oder andere Instanz wesentliche Konsequenzen für das Verhalten in diesem Lebensbereich hat. Wenn sich beispielsweise eine Person im politischen Bereich von mächtigen anderen kontrolliert fühlt oder politische Strukturen verantwortlich macht, dann wird sie sich möglicherweise anders politisch engagieren, als wenn für sie alles nur vom Zufall abhängt (Mielke, 1996, S. 189f.).
Ein relativ gut erforschter Lebensbereich im Bezug auf bereichspezifische Kontrollüberzeugungen ist Gesundheit und Krankheit. Krankheits- bzw. gesundheitsspezifische Kontrollüberzeugungen betreffen die Überzeugungen einer Person, inwieweit ihr Gesundheitszustand durch eigenes Handeln, durch fremdes Handeln (z. B. von Ärzten) oder durch Zufall bzw. Schicksal bestimmt ist. Hierbei hat sich gezeigt, dass bereichspezifische Kontrollüberzeugungen nicht statisch, sondern dynamisch und veränderlich aufzufassen sind: Die wahrgenommenen Kontrollmöglichkeiten können sich in verschiedenen Erkrankungsstadien verändern und nehmen damit modifizierenden Einfluss auf die Kontrollüberzeugungsmuster. Hat eine Person weder Informationen, noch eigene oder stellvertretende Erfahrungen hinsichtlich der Kontrollmöglichkeiten von Gesundheit und Krankheit, die zur Ausbildung bereichspezifischer Kontrollüberzeugungen führen, dann ist Übereinstimmung zwischen generalisierten und bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen zu erwarten (Lohaus, 1992)
In Untersuchungen von Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit dem Leistungsbereich konnte nachgewiesen werden, dass bereichspezifische Erwartungen hier ein besserer Prädiktor für Leistungsverhalten sind als generalisierte Erwartungen (Stipek & Weisz, 1982). Dies stimmt mit der Einschätzung von Rotter (1966) überein, der annimmt, dass vor allem in hochstrukturierten, akademischen Leistungssituationen bereichspezifische Kontrollüberzeugun-gen besser als in anderen Situationen Verhalten erklären können: „… internal-external control attitudes are obviously not generalized across the board, and in highly structured academic achievement situations there is probably more specifity determining response than in other situations“ (Rotter, 1966, S. 21).
1.4 Entwicklung von Kontrollüberzeugungen
Studien zur Entstehung und Entwicklung von Kontrollüberzeugungen lassen zwei Forschungsschwerpunkte erkennen:
- Einflüsse der familiären Sozialisation auf Kontrollüberzeugungen
- altersbedingte Veränderungen von Kontrollüberzeugungen
Da es sich bei den meisten Arbeiten um Querschnittuntersuchungen handelt, lassen die zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse keine eindeutigen Interpretationen zu (vgl. Stipek & Weisz, 1982; Krampen, 1985; Mielke, 1986; Amelang & Bartussek, 2001).
1.4.1 Kontrollüberzeugungen und Sozialisation
Während Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit familiärer Sozialisation relativ gut erforscht sind, liegen für andere Sozialisationsbereiche noch wenige Ergebnisse vor (Krampen, 1985).
Im Rahmen der familiären Erziehung steht hohe wahrgenommene Bewegungs- und Handlungsfreiheit des Kindes in Verbindung mit emotional positivem und über die Zeit hinweg konsistentem Erziehungsverhalten der Eltern im Zusammenhang mit Internalität (Krampen, 1982, S. 138-142). Untersuchungen von Schneewind (1989) haben ergeben, dass internale Eltern über ein emotional expressives, anregungsreiches und durch flexible Regelhandhabung gekennzeichnetes Familienklima berichten. Die Übertragung elterlicher Kontrollüberzeugungen auf Kinder konnte jedoch nur partiell, nämlich für Söhne, bestätigt werden. Kinder von Eltern, die Erziehung zur Selbstständigkeit als dominantes Erziehungsziel ansehen, zeigen eher internale Kontrollüberzeugung. Kinder, die bei ihren Eltern den Wunsch nach Konformität und sozial angepasstem Verhalten wahrnehmen bzw. die ihren familiären Hintergrund als wenig solidarisch und eher reglementierend erleben, äußern eher externale Kontrollüberzeugung. Mielke (1996) rät jedoch zu einer relativierenden Betrachtung dieser Ergebnisse, weil sie möglicherweise durch Drittvariablen, wie Geschlecht, Bildungshintergrund und soziale Schichtzugehörigkeit, konfundiert sein könnten (Mielke, 1996, S. 192).
In Untersuchungen von Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit schulischer Sozialisation zeigt sich, dass „mit Restriktivität einer Institution und dem als negativ erlebten institutionellen Klima die Externalität ansteigt“ (Krampen, 1987, S. 209). Hinsichtlich der beruflichen Sozialisation nimmt Krampen (1987) ein Variieren der Kontrollüberzeugungen in Abhängigkeit von der Strukturiertheit des Arbeitsplatzes und der Determiniertheit der Arbeitstätigkeiten sowie starke Effekte von beruflicher Diskriminierung und Arbeitslosigkeit auf die Entwicklung von Kontrollüberzeugungen an. Daneben vermutet er Auswirkungen von Ereignissen wie Krankheit und Hospitalisierung und weist in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung von Kontrollüber-zeugungen zur Bewältigung von kritischen Lebensereignissen hin.
1.4.2 Altersbedingte Veränderungen von Kontrollüberzeugungen
Studien zu altersbedingten Unterschieden in Kontrollüberzeugungen ergeben ein inkonsistentes Bild: So berichtet ca. die Hälfte der 75 von Krampen (1987) analysierten empirischen Arbeiten von einer Zunahme der Internalität mit steigendem Alter, die andere Hälfte dagegen von einer Abnahme. Stipek und Weisz (1982), die 33 einschlägige Arbeiten untersuchten, kommen zu ähnlichen Ergebnissen.
Die Hypothese vom Anstieg der Internalität mit zunehmendem Alter geht auf Lefcourt (1976) zurück, der die höheren Internalitätswerte mit der Zunahme der Fähigkeit, Ereignisse im Leben selbst zu steuern, und steigender Kompetenz hinsichtlich des Verschaffens von erwünschten Verstärkern erklärt. Die Hypothese von der Abnahme der Internalität mit steigendem Alter ist nach Mielke (1996) in Rahmen der Tradition von Piaget zu betrachten: Kinder überschätzen die Effektivität eigener Anstrengungen eher, d. h. sie haben internale Kontrollüberzeugung, mit zunehmendem Alter gelangen sie zu einer realitätsangemesseneren Einschätzung der eigenen Verhaltensmöglichkeiten, d. h. ihre externalen Kontrollüberzeugungen werden höher (Mielke, 1996, S. 191). Krampen (1987) vermutet, dass die höheren Internalitätswerte auch mit dem höheren Sprachentwicklungsstand zusammenhängen, und begründet dies mit den Ergebnissen einer Untersuchung von Gorsuch, Henighan und Barnard (1972), in der Kinder mit niedrigeren Werten in einem Sprachentwicklungstest auch deutlich niedrigere Internalitätswerte hatten (Krampen, 1987, S. 202).
Die kritische Prüfung verschiedener LOC-Skalen durch Stipek und Weisz (1982) ergab, dass einige Ergebnisse hinsichtlich der Veränderungen des Locus-of-Control mit dem Alter Artefakte aufgrund der Skalenkonstruktion sein könnten: Bei dichotomen Items neigen Personen mit Verständnisschwierigkeiten der Items zum Ja-Sagen (Stephen & Delys, 1973; Herzberger et al., 1979, zitiert nach Stipek & Weisz, 1982, S. 258). Mehrkategorielle Items erfordern Schlussfolgerungen aus hypothetischen Annahmen, die ein Kind erst nach dem Erreichen des Stadiums der formalen Operationen ziehen kann, und außerdem stellt die Auswahl von Antwortalternativen zu hypothetischen Situationen hohe Anforderungen an Vorstellungskraft, Aufmerksamkeit und Gedächtnis, womit jüngere Kinder überfordert sind (Crandall, Katkovsky & Crandall, 1965, zitiert nach Stipek & Weisz, 1982, S. 259). Bei Erwachsenen wiederum könnten nach Mielke (1996) Kohorten- und altersspezifische Effekte auf die Ergebnisse einwirken: Begriffe wie Selbstbestimmung und Entfremdung wurden zeitgeschichtlich unterschiedlich stark diskutiert, was sich auf wahrgenommene Kontrolle und damit auch auf Kontrollüberzeugungen ausgewirkt haben könnte (Mielke, 1996, S.192).
Um mögliche altersbedingte Veränderungen in Kontrollüberzeugungen aufklären zu können, werden für künftige Untersuchungen differenziertere Zugänge, wie z. B. die Unterscheidung von wahrgenommener Selbstkompetenz und wahrgenommener Kontingenz der Handlungsergebnisse (Stipek & Weisz, 1982; Mielke, 1996), und Längsschnittuntersuchungen empfohlen (Krampen, 1985).
1.5 Messung von Kontrollüberzeugungen
Kontrollüberzeugungen werden meist mit Fragebogenverfahren erfasst, die als „divergent (es gibt keine objektiv richtigen Antworten), direkt oder offen (also durchschaubar) und strukturiert (Antwortkategorien sind vorgegeben)“ klassifiziert werden können (Krampen, 1982, S. 98). Als mögliche andere Methoden nennt Krampen (1987) Interviews, Inhaltsanalysen autobiographischer Texte und semiprojektive Verfahren, wie z. B. Satz- oder Geschichte-Ergänzungstests.
Die Fragebogenverfahren können in vier Gruppen eingeteilt werden (Krampen, 1982; Krampen, 1987). Sie dienen der Erhebung von:
- eindimensionalen, generalisierten Kontrollüberzeugungen (z. B. der ROT-IE von Rotter, 1966)
- mehrdimensionalen, generalisierten Kontrollüberzeugungen (z. B. der FKK von Krampen, 1991, der in Kap. 6.7.1, S. 158ff., näher beschrieben wird)
- eindimensionalen, bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen
- mehrdimensionalen, bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen (z. B. der in Kap. 6.7.2, S. 162ff. beschriebene KUT von Beier, 1999)
Zahlreiche Verfahren erheben Kontrollüberzeugungen bei Erwachsenen: Krampen (1982) beschreibt 34 englisch-sprachige und 11 deutsch-sprachige Verfahren (Krampen, 1982, S. 100ff.). Daneben gibt es auch viele Verfahren für Kinder und Jugendliche, wie z. B. den Fragebogen von Nowicki und Strickland (1973), ein eindimensionales Verfahren zur Erhebung von generalisierten Kontrollüberzeugungen, und den IAR (= Academic Achievement Responsibility Scale) von Crandall, Katkovsky und Crandall (1965), mit dem für den Leistungsbereich eine getrennte Erfassung von Kontrollüberzeugungen für Erfolg und Misserfolg möglich ist (Mielke, 1996, S. 190).
Die Formate der Fragebogen spiegeln nach Stipek und Weisz (1982) die unterschiedlichen Annahmen über den Locus-of-Control:
- Dichotomes Antwortformat wird vor allem bei Modellen, in denen Kontrollüberzeugungen als über alle Situationen hinweg gleich bleibende, generalisierte Überzeugungen angesehen werden, eingesetzt. Es gibt hier nur einen Gesamt-Internalitäts-Externalitäts-Score.
- Mehrkategorielles Antwortformat findet dagegen vor allem bei Modellen, die annehmen, dass Kontrollüberzeugungen auch situationsspezifisch variiert werden, Verwendung. Hier gibt es meist mehrere Subscores.
Wie bei anderen Persönlichkeitsfragebogen sind bei der Erfassung von Kontrollüberzeugungen Einflüsse von Antwortworttendenzen, unter ihnen vor allem die Tendenz zu sozial erwünschten Antworten, aktueller Stimmung und subjektiver Iteminterpretation nicht auszuschließen. In der Literatur wird außerdem auf Reliabilitätsmängel vieler Kontrollüberzeugungsskalen hingewiesen, wobei bei bereichspezifischer Messung meist höhere Reliabilitäten erreicht werden (Krampen, 1987, S. 205).
1.6 Individuelle Unterschiede aufgrund von Kontrollüberzeugungen
Zahlreiche Untersuchungen – allein für den Zeitraum zwischen 1967 und 1986 finden sich über 5000 Einträge zum Schlagwort „internal locus of control“ in PsycInfo und Psyndex (Krampen, 1989, S. 3) – bringen Kontrollüberzeugungen mit nahezu jedem Bereich von menschlichem Erleben und Verhalten in Beziehung (Mielke, 1982, S. 34). Dass Kontrollüberzeugungen auch heute noch recht intensiv erforscht werden, beweisen 4862 Einträge in PsycInfo und 773 Einträge in Psyndex für den Zeitraum von 1987 bis 2004 (Stand vom Jänner 2005).
Strickland (1977) hat in ihrer Überblicksarbeit die wesentlichen Unterschiede zwischen Personen mit internaler und externaler Kontrollüberzeugung zusammengefasst. Diese Arbeit hat auch heute noch Gültigkeit, da die neuere Literatur diesbezüglich über nichts grundsätzlich Neues berichtet (Mielke, 1996). Nach Strickland (1977) betreffen die Unterschiede zwischen Internalen und Externalen folgende Bereiche:
- soziale Interaktionen / Beeinflussbarkeit: Internale scheinen persönliche und positive Beeinflussungsstrategien zu bevorzugen. Sie halten sich selbst für toleranter und werden von anderen mehr gemocht als Externale, die sich eher auf Sanktionsmittel und Druck verlassen, um sich durchzusetzen. Externale geben dem Druck anderer eher nach, vor allem wenn sie diese für Experten halten und wenn es um ihr eigenes Prestige geht, während Internale Einflussnahmen durch andere aktiv zurückweisen. Das könnte bedeuten, dass Internale möglicherweise Motivation von außen bzw. Hinweise zur Lösung von Aufgaben als eher überflüssig empfinden. Dafür sprechen Ergebnisse von Dixon (1973; zitiert nach Dixon & Cameron, 1976, S. 1316) und Wolk und DuCette (1974), die nachweisen konnten, dass Motivation von außen keine Auswirkungen auf die Lernleistungen von Internalen hat. Dem widersprechen jedoch die Ergebnisse von Crowne und Liverant (1963; zitiert nach Rotter, 1966, S. 23), die berichten, dass Internale dann Einflussnahmen von außen nachgeben, wenn sie einen Vorteil für sich darin sehen.
- Umgang mit Stress: Externale erleben Situationen häufiger als stressauslösend, schätzen dabei die subjektive Belastung als höher ein und zeigen generell höhere Neigung zu Angst bzw. Ängstlichkeit. Internale reagieren in Stresssituationen eher mit kognitiven Kontrollmechanismen, wie Selbstreflexion und Selbstmodifikation.
- Informationsaufnahme: Internale und Externale unterscheiden sich hinsichtlich der Inangriffnahme zielgerichteten Verhaltens. Internale suchen effektiver und effizienter nach relevanten Informationen, konzentrieren sich auf die für eine Aufgabe relevanten Hinweisreize, lassen sich nicht durch Erklärungen anderer Personen oder durch soziale Verstärker beirren, zeigen Autonomie bei der Aufgabenbewältigung und verlassen sich dabei auf ihre Fähigkeiten und eigenen Interpretationen.
- Leistungsverhalten: Internale zeigen Präferenz für herausfordernde Aufgaben, arbeiten intensiver und ausdauernder, suchen Leistungswettbewerb mit anderen und scheuen dabei auch negative Rückmeldungen nicht. Sie erbringen insgesamt bessere Leistungen als Externale und führen diese Ergebnisse in erster Linie auf eigene Fähigkeiten zurück. Werden sie am Fortkommen behindert, so reagieren sie eher ungeduldig bis feindselig.
Inhaltlich ähnliche Beschreibungen von Personen mit internalen oder externalen Kontrollüberzeugungen finden sich bei Phares (1976), Lefcourt (1976), Krampen (1982) und Jonassen und Grabowski (1993).
Derartige Gegenüberstellungen von internalen / externalen Eigenschaften und Verhalten könnten zur Annahme verleiten, dass eine bestimmte Ausprägung von Kontrollüberzeugungen erstrebenswert sei. Internalität wird offensichtlich günstiger bewertet, da sie mit verschiedenen Verhaltensweisen assoziiert wird, die als sozial erwünscht gelten, was auch eine vor allem bei Messungen mit Fragebogen, die Eindimensionalität des Konstrukts zugrunde legen, wie z. B. der ROT-IE, zu beobachtende Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten (vgl. z. B. Mielke, 1996) erklärt. Nach Krampen (2000) ist jedoch eine einseitige Bevorzugung der Internalität ebenso abzulehnen wie eine einseitige Ablehnung der Externalität, denn sowohl hohe Internalität als auch hohe Externalität sind mit extrem unrealistischen Erwartungen korreliert. Da extreme Internalität Selbstüberschätzung, Egoismus und Omnipotenzgefühle begünstigt und extreme Externalität Hilflosigkeit und Machtlosigkeitsgefühle bewirken kann, erscheint eine mittlere Ausprägung von Kontrollüberzeugungen am günstigsten (Krampen, 2000, S. 118).
Eine Reihe von Studien beschäftigt sich mit Geschlechtsunterschieden in Kontrollüberzeugungen. So beschreibt z. B. Rotter (1966) Frauen als externaler und auch Duke und Nowicki (1971) kommen zum Schluss, dass vor allem bei Männern Internalität mit besseren akademischen Leistungen, höherer sozialer Reife, unabhängigerem und selbst motiviertem Verhalten sowie höheren Anstrengungen zusammenhängt (Duke & Nowicki 1971, zitiert nach Nowicki & Strickland, 1973, S. 153). Eine Metaanalyse über 275 Studien zu Locus-of-Control und akademischen Leistungen von Findley und Cooper (1983) ergab insgesamt einen Zusammenhang zwischen höherer Internalität und höherer Leistung, der für Frauen niedriger als für Männer ausfiel. Die sehr geringen Korrelationen (für Frauen r = .11 und für Männer r = .20, Findley & Cooper, 1993, S. 423) sollten allerdings nicht überinterpretiert werden. Stipek und Weisz (1981) weisen darauf hin, dass solche Ergebnisse auch durch den Einfluss der Mediatorvariable „soziale Erwünschtheit“ bedingt sein könnten und illustrieren dies mit den Ergebnissen einer Untersuchung von Nowicki und Walter (1973), in der die signifikanten Zusammenhänge zwischen Internalität und guten Schulleistungen bei Mädchen mit niedrigen Werten in sozialer Erwünschtheit, nicht aber bei Mädchen mit hohen Werten in sozialer Erwünschtheit auftraten (Stipek & Weisz, 1981, S. 116). Aussagen über Geschlechtsunterschiede in Kontrollüberzeugungen sollten aufgrund der Befundlage daher mit Vorsicht getroffen werden, denn die entsprechenden Ergebnisse könnten durch diverse Konfundierungen verzerrt sein.
1.7 Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit Informationssuche, akademischen Leistungen und selbstgesteuertem Lernen
In diesem Kapitel werden Einflüsse bzw. Auswirkungen von Kontrollüberzeugungen in ausgewählten Bereichen, die in Zusammenhang mit Hypertext-Lernen (siehe Kap. 2.7, S. 98ff.) gebracht werden können, anhand verschiedener empirischer Ergebnisse besprochen.
1.7.1 Informationssuche
Da Internale als neugieriger, wissbegieriger und eher bereit, etwas über ihre Umgebung zu lernen, beschrieben werden (Lefcourt, 1982; zitiert nach Eiwan, 1998, S. 31), kann angenommen werden, dass sie sich hinsichtlich ihres Informationssuchverhaltens von Externalen unterscheiden. Eine Reihe von Studien widmet sich daher der Untersuchung von internalem und externalem Verhalten im Zusammenhang mit Informationssuche.
Bereits 1962 untersuchten Seeman und Evans zwei Gruppen von stationären Tuberkulose-Patienten mit gleichem sozioökonomischem Status und gleichen Spitalserfahrungen, aber Unterschieden in Internalität / Externalität, und stellten dabei fest, dass Internale über einen objektiv höheren Informationsstand bezüglich ihrer Krankheit verfügten. Auch vom Spitalspersonal wurden sie als informierter als ihre externalen Mitpatienten eingestuft, sie selbst aber waren weniger zufrieden mit dem Ausmaß an Informationen, die sie im Krankenhaus erhielten, als die Gruppe der externalen Patienten.
Eine zweite Untersuchung von Seeman (1963) beschäftigte sich mit Gedächtnisleistungen von Strafgefangenen. Dafür erhielten 120 Insassen einer Strafanstalt drei verschiedene Arten von Informationen, die sechs Wochen nach der Vorgabe der IE-Skala von Liverant (1959), einem Fragebogen mit 40 Forced-Choice-Items, die ähnlich wie der ROT-IE jeweils eine internale und eine externale Antwortalternative enthalten, mittels eines Wissenstests abgefragt wurden. Die Informationen enthielten Anleitungen zur erfolgreichen Beantragung von Straferlass bzw. Bewährungsfrist, Beschreibungen der aktuellen Situation in Gefängnissen und Auskünfte über Langzeitprogramme zur Reintegration bzw. über Arbeitsmöglichkeiten nach der Haftentlassung. Signifikante Zusammenhänge zwischen IE-Werten und Gedächtnisleistung zeigten sich nur hinsichtlich der ersten Art von Informationen: Die Häftlinge konnten sich am besten an Informationen über erfolgreiches Vorgehen für Straferlass bzw. Bewährung erinnern, und das umso besser, je internaler sie waren, wobei sich andere Variablen wie Alter, Intelligenz, soziale Herkunft und kriminelle Vorerfahrung nicht auf die Ergebnisse auswirkten. Seeman schließt daraus, dass sich Internale Informationen, die relevant zur Erreichung eines persönlichen Zieles sind, besser merken.
Während in diesen beiden Studien das Informationssuchverhalten von Ratern eingestuft wurde, beobachteten Davies und Phares (1967) die Informationssuche ihrer Probanden direkt und konnten damit die Erkenntnisse von Seeman und Evans erweitern. Sie konnten bei Internalen einen verstärkten Einsatz von Verhaltensweisen feststellen, die zu mehr Informationen führen. Die Teilnehmer an diesem Experiment sollten eine Person zur Änderung ihrer Einstellung dem Vietnamkrieg gegenüber bewegen. 42 nach dem ROT-IE internale und 42 externale Männer mit einer positiven Einstellung zum militärischen Einsatz der USA in Vietnam wurden zufällig einer von drei Versuchsbedingungen zugewiesen. In der Fähigkeitsbedingung wurde den Versuchspersonen mitgeteilt, die Einstellungsänderung der anderen Person hinge ausschließlich von ihrer Fähigkeit, andere zu überzeugen, ab. In der Zufallsbedingung sollte die Einstellungsänderung auf Zufall oder Glück basieren. In der Ambiguitätsbedingung wurden keine derartigen Informationen gegeben. In Übereinstimmung mit Rotters Annahme (1966), dass die Unterschiede zwischen Internalen und Externalen umso stärker hervortreten, je weniger erkenntlich ist, ob in einer Situation Fähigkeiten oder Zufall eine Rolle spiele, suchten Internale aktiver nach relevanten Informationen zur Bewältigung ihrer vermeintlichen Aufgabe, d. h. sie schrieben mehr Fragen über die Person, deren Einstellung sie ändern sollten, auf, die sie vom Versuchsleiter beantwortet haben wollten. Davies und Phares führen dieses Ergebnis auf die höhere generalisierte Erwartung bezüglich der Kontingenz zwischen eigenem Verhalten und Verstärkererhalt der Internalen zurück, die sie verstärkt Versuche zu einer effektiven Kontrolle ihrer Umwelt unternehmen lässt. Externale dagegen suchen weniger nach Informationen, weil sie zur Überzeugung neigen, weniger von eigenem Verhalten abhängig zu sein.
Moser und Moser (1973) konnten die Ergebnisse von Seeman und Evans (1962), Seeman (1963) und Davies und Phares (1967) einerseits bestätigen, andererseits dahingehend erweitern, dass sich im Rahmen eines Kartenexperiments mit unterschiedlichen Verstärkerplänen (25 %, 50 % und 75 % Verstärkung) Informationssuchverhalten nicht nur als Funktion von Kontrollüberzeugungen sondern auch von Erfolgs- bzw. Misserfolgserwartungen erwies. Die Versuchspersonen, 60 Strafgefangene, die nach ihren ROT-IE-Werten als hoch internal bzw. hoch external eingestuft worden waren, konnten für zusätzliche Informationen über die Karten in einem Kartenspiel Chips setzen und wurden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einer der drei Bedingungen beim Einschätzen der Kartensumme verstärkt. In der Bedingung mit dem geringsten Erfolg (25 %) holten Internale die meisten, in der Bedingung mit dem höchsten Erfolg (75 %) die wenigsten Informationen ein. Moser und Moser schließen daraus Folgendes: Bei höherer Unsicherheit versuchen Internale die Kontrolle zu erhöhen, indem sie mehr Informationen einholen. Ein hoher Grad an Erfolg dagegen führt bei Internalen zu einer Abnahme der Intensität des Informationssuchverhaltens. Ist also die Informationssuche ein Kriterium z. B. für ein Lernergebnis, so müssen Internale und Externale unterschiedlich behandelt werden, was den Verstärkererhalt betrifft: Externale brauchen eher mehr Verstärkung, Internale eher weniger. Informationssuchaufgaben mit sehr geringen Anforderungen erscheinen daher für Internale eher ungeeignet.
Ein ähnliches Experiment wie Davies und Phares (1967) führten Williams und Stack (1972) durch. Es ging außerdem um eine Überprüfung der Ergebnisse mehrerer Studien, die einen Zusammenhang zwischen Externalität und Zugehörigkeit zur farbigen Bevölkerung Amerikas ergeben hatten. Wiederum suchten Internale mehr nach Informationen. Weiters konnten Williams und Stack beobachten, dass Externale dann zu internalem Verhalten neigen, wenn die Aufgabe mit einer angemessenen Erfolgserwartung und relativ hohem Verstärkerwert assoziiert ist. Damit konnte auch nachgewiesen werden, dass situative Gegebenheiten den Einfluss generalisierter Kontrollüberzeugungen moderieren. Unterschiede in Kontrollüberzeugungen und Informationssuchverhalten aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit konnten nicht bestätigt werden.
Ebenfalls auf Davies und Phares (1967) baut eine Untersuchung von Weiner und Daughtry (1975) auf, in der sie 182 Psychologie-Studentinnen den ROT-IE vorgaben, um danach die 45 Studentinnen mit den höchsten Werten (= Externale) und die 45 mit den niedrigsten Werten (= Internale) zufällig drei Bedingungen mit unterschiedlichem Ausmaß an Kontrolle (stark vs. moderat vs. schwach) zuzuweisen. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, Einschätzungen über den beruflichen Erfolg einer Zielperson, über die sie je nach Versuchsbedingung ein bestimmtes Ausmaß an Zusatzinformationen in Form von Informationskarten einholen konnten, abzugeben. In der Bedingung mit moderater Kontrolle, in der die Studentinnen keine Information darüber bekommen hatten, wovon die Richtigkeit ihrer Einschätzungen abhängig sei, forderten Internale mehr Karten an als Externale, während sich in den beiden anderen Bedingungen keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen ergaben. Damit konnte bestätigt werden, dass sich Internale und Externale hinsichtlich ihres Informationssuchverhaltens in uneindeutigen Situationen unterscheiden.
Prociuk und Breen (1977) untersuchten den Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen und Informationssuche in einer akademischen Situation. 76 Psychologie-StudentInnen der Universität von Manitoba wurden am Beginn des Semesters aufgrund ihrer ROT-IE-Werte in zwei Gruppen (Internale vs. Externale) geteilt. Am Ende des Semesters sollten zwei Prüfungen abgelegt und eine schriftliche Arbeit verfasst werden, zu deren Vorbereitung die TeilnehmerInnen Fragen erhielten. Sie wurden ermuntert, während des Semesters die Assistenten zu konsultieren, um Hinweise auf Literatur und Antworten auf allgemeine Fragen zu erhalten. Als Maß für das Informationssuchverhalten diente die Anzahl der Konsultationen. Um zu untersuchen, ob Internale Informationen effektiver nutzen als Externale, wurden die Abschlussnoten beider Gruppen verglichen. Hinsichtlich der Anzahl der Konsultationen unterschieden sich Internale und Externale hochsignifikant voneinander, die Abschlussnoten zeigten eher schwache Zusammenhänge mit dem Locus-of-Control.
Eine neuere Studie zu Informationssuchverhalten und Kontrollüberzeugungen stammt von Fernandes und Schaumburg (2002). Hier sollte untersucht werden, ob Kontrollüberzeugungen den Erfolg bei Recherchen im Internet beeinflussen. Die generalisierten Kontrollüberzeugungen der 30 TeilnehmerInnen wurden mit dem FKK (Krampen, 1991) erhoben, zur Erfassung bereichsspezifischer Kontrollüberzeugungen, nämlich der Kontrollüberzeugungen im Umgang mit Suchmaschinen, wurde eine adaptierte Version des KUT (Beier, 1999) vorgegeben. Ein erwarteter Einfluss der Kontrollüberzeugungen auf Indikatoren für den Sucherfolg (Lösungsanzahl, Fehleranzahl, Persistenz) ließ sich nicht nachweisen. Die bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen korrelierten aber mit der Bewertung des eigenen Suchverhaltens durch die TeilnehmerInnen und mit der investierten Anstrengung. Die Autorinnen schlagen vor, Suchmaschinen im Internet so zu gestalten, dass den Benutzern die Möglichkeit geboten wird, ein ihnen entsprechendes Design auszuwählen: Externalen sollte ein einfacheres Interface (= Benutzeroberfläche) zur Verfügung gestellt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass unterschiedlich ausgeprägte Kontrollüberzeugungen das Informationssuchverhalten von Personen beeinflussen können. Internale suchen offensichtlich aktiver und gezielter nach Informationen zur Lösung von gestellten Aufgaben und sind wahrscheinlich auch imstande, die gefundenen Informationen kompetenter auszuwerten. Den Grund hierfür vermuten Amelang und Bartussek (2001) in der Erwartung der Internalen, Konsequenzen des eigenen Verhaltens selbst steuern zu können.
1.7.2 Verhalten und Ergebnisse in akademischen Leistungssituationen
Sehr viele empirische Studien (siehe Überblicke bei Bar-Tal & Bar-Zohar, 1977; Findley & Cooper, 1983; Jonassen & Grabowski, 1993) widmen sich der Untersuchung von Kontrollüberzeugungen und ihres Einflusses auf Lernen und Lernergebnisse. Es scheint, dass Kontrollüberzeugungen nicht direkt auf das Lernen, sondern indirekt über die Erwartung des Lerners von Erfolg/Misserfolg und die daraus resultierende Leistungsmotivation wirken (Jonassen & Grabowsi, 1993).
Im Allgemeinen erzielen Internale in akademischen Leistungssituationen bessere Ergebnisse: 31 von 36 im Literaturüberblick von Bar-Tal & Bar-Zohar (1977) besprochene Studien und 192 von 275 Untersuchungen aus der Metaanalyse von Findley & Cooper (1983) bestätigen dies. Das bessere Abschneiden der Internalen führen Bar-Tal und Bar-Zohar (1977) einerseits zurück auf deutlich unterschiedliche Motivationsstile von Internalen und Externalen in aufgabenbezogenen Situationen (Internale zeigen mehr Initiative, verstärkte Anstrengungsbereitschaft und höheres Durchhaltevermögen) und auf Unterschiede in kognitiven Reaktionen (Internale konzentrieren sich mehr auf Informationen, die für die Bewältigung einer Aufgabe relevant sind, und nutzen diese Informationen auch effizienter als Externale). Als weitere Gründe werden die höhere Bereitschaft zum Belohnungsaufschub der Internalen (Strickland, 1972; zitiert nach Nowicki & Strickland, 1973, S. 153) und eine positivere Einstellung zum Lernen (Ramanaiah, Ribich & Schmeck, 1975; zitiert nach Jonassen & Grabowski, 1993, S. 357) genannt.
In einer neueren Untersuchung von Perry, Hladkyj, Pekrun und Pelletier (2001) konnten die Ergebnisse dieser älteren Studien weitgehend bestätigt werden. 498 Psychologie-StudentInnen einer kanadischen Universität bearbeiteten zu Beginn und am Ende des Semesters einen Fragebogen zu bereichspezifischen Kontrollüberzeugungen, d. h. zu Kontrollüberzeugungen in akademischen Leistungssituationen. Daneben wurde eine Reihe weiterer Variablen erhoben, wie kursbezogene Attributionen, Ängstlichkeit, Langeweile, intrinsische Motivation, kognitive und metakognitive Strategien und zu mehreren Zeitpunkten während des Semesters auch die Noten der TeilnehmerInnen. Internale strengten sich mehr an, empfanden weniger Angst, setzten öfter metakognitive Selbstüberwachungsstrategien ein, berichteten über ein höheres Ausmaß an Kontrolle über ihr Leben im Allgemeinen und erbrachten zu allen Zeitpunkten bessere Leistungen.
Inwiefern die besseren akademischen Leistungen Internaler auf höhere Intelligenz zurückzuführen sein könnten, ist eher unklar. In einigen Studien blieb der Zusammenhang zwischen internaler Kontrollüberzeugung und hohem Leistungsscore nach dem Herauspartialisieren des Einflusses der Intelligenz erhalten (Stipek & Weisz, 1981, S. 116), in anderen Studien wie z. B. bei Boor (1973; zitiert nach Bar-Tal & Bar-Zohar, 1977, S. 189) wurde er schwächer.
Schulnoten weisen häufig einen stärkeren Zusammenhang mit Locus-of-Control-Maßen auf als die Scores von standardisierten Leistungstests (McGhee & Crandall, 1968; Nowicki & Segal, 1974; Messer, 1977; zitiert nach Stipek & Weisz, 1981, S. 115). Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass Schulnoten Faktoren wie Anstrengung, Ausdauer, Eigeninitiative, also Merkmale, die direkt die Antworten in Kontrollüberzeugungsfragebogen beeinflussen, spiegeln, während Leistungstests dies nur indirekt tun, indem sie Fähigkeiten messen, deren Erwerbung Anstrengung, Ausdauer, etc. erfordert (Stipek & Weisz, 1981). Studien zeigen, dass Internale häufig bessere Noten haben als Externale (Nowicki & Roundtree, 1971; zitiert nach Nowicki & Strickland, 1973, S. 153). Stipek und Weisz (1981) warnen aber vor der oft vorschnell getroffenen Interpretation solcher Zusammenhänge, die meist nichts über die Wirkungsrichtung aussagen. Es ist vorstellbar, dass nicht die höhere Internalität für bessere Noten verantwortlich ist, sondern dass umgekehrt gute Leistungen auf die Kontrollüberzeugungen wirken. Kinder übernehmen eher Verantwortung für Erfolge als für Misserfolge. Das könnte bedeuten, dass z. B. ein Schüler seine guten Leistungen auf seine Fähigkeiten zurückführt und in der Folge höhere Internalität entwickelt, während ein anderer Schüler mit schlechten Noten diese mit äußeren Umständen erklärt und damit letztlich für kommende Situationen zu höherer Externalität gelangt (Stipek & Weisz, 1981, S. 116). Da es sich bei Schulnoten um Lehrerurteile handelt, kann eine Konfundierung mit anderen Variablen, wie Lehrererwartung, Sympathie, physischen Schülermerkmalen, etc. nicht ausgeschlossen werden (Findley & Cooper, 1983, S. 426).
1.7.3 Selbstgesteuertes Lernen
1.7.3.1 Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit
selbstgesteuertem Lernen
Während in traditionellen schulischen Lehr-Lern-Situationen Zeit und Ort des Lernens festgelegt sind und die Auswahl und Bereitstellung der für die Wissensvermittlung notwendigen Informationsquellen durch den Lehrer erfolgt, der den Lernfortschritt des Lerners überwacht, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit und Motivation trifft und dem Lerner Rückmeldung über seine Lernfortschritte gibt, übernimmt beim selbstgesteuerten Lernen der Lerner viele dieser Aufgaben selbst und kann damit auf die einzelnen Teilprozesse seines Lernens stärker Einfluss nehmen und den Lernprozess insgesamt in höherem Ausmaß steuern.
Nach verschiedenen Modellen zum selbstgesteuerten Lernen, wie z. B. dem Drei-Phasen-Modell von Schiefele und Pekrun (1996, zitiert nach Krapp & Weidenmann, 2001, S. 212), kann selbstgesteuertes Lernen in folgende Abschnitte gegliedert werden:
- Planung: Vor dem eigentlichen Lernvorgang steckt sich der Lerner zunächst ein Ziel für sein Lernen, das in Teilziele aufgegliedert wird. Der Lerner legt fest, welche Lernschritte in welcher Reihenfolge unternommen werden müssen, um am Ende des Lernprozesses das Lernziel erreicht zu haben.
- Durchführung: In dieser Phase setzt der Lerner die einzelnen Teilziele in Lernhandlungen um und überwacht sie fortlaufend. D. h. es kommt zu kontinuierlichen Vergleichen zwischen Ist und Soll, sodass gegebenenfalls Modifikationen bzw. Anpassungen vorgenommen werden können.
- Bewertung: Am Ende des Lernvorganges überprüft der Lerner, ob er sein Lernziel erreicht hat.
Damit weist selbstgesteuertes Lernen drei wesentliche Merkmale komplexen Handelns auf: Es ist zielgerichtet, hierarchisch-sequentiell organisiert und wird über Feedbackschleifen reguliert (Hacker, 1978; Volpert, 1983). Fasst man selbstgesteuertes Lernen als eine Form von Handeln auf, dann ist zu erwarten, dass Handlungsüberzeugungen, und als solche können Kompetenzerwartungen und Kontrollüberzeugungen betrachtet werden (Asendorpf, 1999, S. 204ff.), eine wichtige Rolle dabei spielen. Einige Studien bestätigen, dass Internale bessere Leistungen erbringen, wenn sie selbstgesteuert lernen bzw. sich den Lernstoff selbst strukturieren können, Externale dagegen besser unter von einem Lehrer kontrollierten Bedingungen lernen (Daniels & Stevens, 1976; Hickey, 1980; zitiert nach Jonassen & Grabowski, 1993, S. 359).
Neben äußeren Bedingungen, wie z. B. Merkmalen der Lernumgebung bzw. der Lernsituation, sind für selbstgesteuertes Lernen auch innere Faktoren, wie kognitive, metakognitive, motivationale, volitionale und emotionale Komponenten, bedeutsam. Das integrative Modell selbstgesteuerten Lernens von Pintrich und Garcia (1993), im dem das informationsverarbeitende Modell der Kognition und eine sozial-kognitive Sicht der Motivation miteinander verbunden werden, beschreibt Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugungen als zentrale Elemente der Erwartung des Lerners. Beide steuern nicht nur die Auswahl von Lernaufgaben, sondern sind in erster Linie für Ausdauer und Anstrengung des Lerners bei der Aufgabenbearbeitung verantwortlich.
Nach Jonassen und Grabowski (1993) sind nicht alle Lehr- und Lernformen gleich gut für Internale und Externale geeignet. Während Internale eher Lehr-Lern-Situationen brauchen, die es ihnen gestatten, ihre Lernprozesse selbst zu gestalten bzw. Lernumfang und Tempo selbst zu wählen, und in denen sie mit Problemstellungen konfrontiert werden, für deren Lösung sie relevante Informationen selbst auswählen und anwenden müssen, profitieren Externale eher von einem hoch-strukturierten Unterricht, in dem sie auf wichtige Informationen hingewiesen werden und viel Verstärkung von außen erhalten.
1.7.3.2. Empirische Ergebnisse zu Kontrollüberzeugungen und selbstgesteuertem Lernen mit Computer
Im Rahmen des computerunterstützten Lernens kommen Lernmaterialien zum Einsatz, die reichhaltige Interaktionsmöglichkeiten bieten, sich in besonderem Maß für selbstgesteuertes Lernen eignen und daher internalen Lerner entgegenkommen sollten. Studien zum computerunterstützten Lernen, in deren Rahmen auch Kontrollüberzeugungen erhoben werden, gehen meist davon aus, dass Internale bei hoher LernerkontrolleTP[1] PT bessere Lernleistungen erbringen, Externale dagegen bei hoher ProgrammkontrolleP1P. Die Ergebnisse sprechen dann aber eher dafür, dass Kontrollüberzeugungen zwar einen Einfluss auf Auswahl und Verarbeitung von Informationen in komplexen Lernsituationen haben, dass das Ausmaß an Kontrolle, das ein Lernprogramm dem Lernenden gewährt, jedoch von untergeordneter Bedeutung sein dürfte (z. B. Klein & Felder, 1990; Gray, 1989; Santiago & Okey, 1992; Eiwan, 1998).
Gray (1989) untersuchte den Einfluss von Kontrollüberzeugungen und Lernerkontrolle auf die Lernleistungen mit einem Computerprogramm über Strategien zur Reduzierung von Armut an 80 StudentInnen eines Einführungskurses in Soziologie. Unter der Bedingung „schwache Kontrolle“ hatten die TeilnehmerInnen keine Möglichkeit in die Abfolge der Informationen einzugreifen, unter der Bedingung „starke Kontrolle“ konnte die Auswahl der Informationen selbst gesteuert und auch zu bereits bearbeiteten Inhalten zurückgekehrt werden. Die TeilnehmerInnen, deren Kontrollüberzeugungen mit dem ROT-IE erhoben worden waren, erhielten eine Suchaufgabe, d. h. es mussten Antworten zu zehn auf Papier vorgegebenen Fragen im Programm gefunden werden, und eine Merkaufgabe, d. h. nach dem Programm mussten zehn Fragen zum Programminhalt beantwortet werden. Bei der Suchaufgabe schnitten die internalen TeilnehmerInnen in beiden Bedingungen besser ab als die externalen, was dafür spricht, dass Internale beim Auffinden von Informationen überlegen sind (vgl. Kap. 1.7.1, S. 50ff.). Je höher die Personen in ihren Internalitätswerten, desto schlechter waren ihre Suchleistungen unter Programmkontrolle. Ein geringes Maß an Selbststeuerung dürfte somit für Internale eher ungünstig sein.
Wie sich die Art von Kontrolle über eine Lernsituation, die Fähigkeiten und die Kontrollüberzeugungen auf Leistung und Selbstvertrauen des Lernenden bzw. wie Kontrollüberzeugungen mit Fähigkeiten und Selbstvertrauen zusammenhängen, wurde von Klein und Felder (1990) an 75 amerikanischen SchülerInnen der siebenten Schulstufe, die eine Computerlektion über Werbung bearbeiteten, untersucht. Zur Erhebung der Kontrollüberzeugungen kam dabei der IAR von Crandall et al. (1965) zum Einsatz. Wiederum erbrachten Internale, unabhängig von Lerner- oder Programmkontrolle, bessere Posttestleistungen. Die internalen SchülerInnen hatten generell höhere Werte im Selbstvertrauen, am höchsten waren diese Werte unter der Lernerkontrollbedingung. Außerdem konnte ein positiver Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen, Selbstvertrauen und Leistung festgestellt werden, woraus Klein und Felder schließen, dass sich die Erwartung, eine Lernsituation kontrollieren zu können, positiv auf Motivation und Lernergebnis auswirken.
Santiago und Okey (1992) verglichen drei Arten von Anweisungen (adaptiv vs. evaluativ vs. direktiv) und deren Auswirkungen auf 75 Lehramts-StudentInnen der Universität von Georgia mit unterschiedlichen Kontrollüberzeugungen. Nach Erhebung der Internalität/Externalität der ProbandInnen mit dem ROT-IE und einem Vorwissenstest, musste ein computerbasiertes Lernmodul über Pädagogische Psychologie bearbeitet werden. Auch in dieser Untersuchung erzielten die internalen TeilnehmerInnen in allen drei Bedingungen die besten Posttestergebnisse, was Santiago und Okey darauf zurückführen, dass Internale relevante Informationen besser wahrnehmen und integrieren können als Externale. Im Unterschied zu Externalen beurteilten Internale das Lernprogramm als unterhaltsam und leicht, was die Autoren mit unterschiedlicher Motivation von Internalen und Externalen erklären.
In ihrer in Kap. 2.8.4.2 (S. 120f.) näher beschriebenen Studie zum Einfluss von Kontrollüberzeugungen (erhoben mit dem FKK von Krampen, 1991) und verschiedenen anderen Variablen auf Lernergebnisse beim computerunterstützten Lernen, setzte Eiwan (1998) zwei Versionen eines Lernprogramms zu Neuropsychologie ein: eine interaktive und eine lineare. Eiwan hatte erwartet, dass Hoch-Internale in der interaktiven, Hoch-Externale in der linearen Version bessere Lerntestergebnisse erzielen würden. Unabhängig von der Programmversion erbrachten aber sowohl hoch Internale als auch Personen mit hoher sozialer Externalität bessere Lernleistungen. Das überraschend gute Abschneiden der Personen mit hohen Werten in sozialer Externalität führt Eiwan auf die Bedeutsamkeit des Themas für das Studium der ProbandInnen zurück, die zu einer erhöhten extrinsischen Motivation führte, wodurch die Kontrollüberzeugungen nicht in der erwarteten Form wirksam wurden. Man könnte dieses Ergebnis aber wohl auch nach Rotter (1966) mit defensiver Externalität (vgl. Kap. 1.3.2.1, S. 33f.) erklären.
Zu den neuen Medien, die selbstgesteuertes Lernen fördern, zählen nicht nur Computer-Lernprogramme, sondern auch Hypertexte bzw. Hypermedia-Lernumgebungen, die im folgenden Kapitel beschrieben werden.
2. Das Medium Hypertext
In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Hypertext erläutert und von verwandten Begriffen abgegrenzt. Einer Gegenüberstellung von Hypertext und traditionellem Lineartext folgt ein kurzer Abriss der Geschichte dieses „neuen“ Mediums. Unter Zugrundelegung des Rahmenmodells zur Beschreibung von Hypertext von Gall & Hannafin (1994) werden danach ausgewählte, für die vorliegende Untersuchung relevante Makro- und Mikrostrukuren von Hypertext beschrieben. Ein weiteres Unterkapitel ist der Navigation durch Hypertext gewidmet. Anschließend werden Argumente für und gegen den Einsatz von Hypertext als Lernmedium referiert und Personenmerkmale, die beim Wissenserwerb mit Hypertext, empirischen Ergebnissen zufolge, insofern eine Rolle spielen, als sie Navigation und/oder Lernprozesse beeinflussen können, behandelt. Das Kapitel schließt mit zusammenfassenden Überlegungen über die Bedeutung der Kontrollüberzeugung im Rahmen des Wissenserwerbs mit Hypertext.
2.1 Begriffsbestimmungen
Fragt man den Begriff „Hypertext“ in einem der Online-Lexika ab, so erhält man in etwa genauso viele Erklärungen, wie man Lexika konsultiert hat. Die Definitionen reichen z. B. von nicht-linearer Organisationsform von heterogenen Objekten (WikipediaTP[2] PT), über Methode, Informationen zu präsentieren (EncartaTP[3] PT) bis zu speziellem Textformat (Online-Lexikon der DatenkommunikationTP[4] PT). Die Meinungen darüber, was Hypertext ist, gehen offensichtlich auseinander.
Auch in der einschlägigen Fachliteratur gibt es bis dato keine einheitliche, allgemein gültige Definition für Hypertext. Während die einen Definitionsansätze systemzentriert die charakteristische Hypertext-Struktur hervorheben und Hypertext als „Verknüpfung von Textdokumenten durch hierarchische Relationen und/oder Verweisstrukturen“ (Schnupp, 1992, S. 15; zitiert nach Blumstengel, 1998, S. 72) bezeichnen, orientieren sich andere eher an der Nutzung von Hypertext und nehmen damit eine userzentrierte Position ein, wie z. B. Nielsen, der Hypertext folgendermaßen definiert: „Hypertext is nonsequential; There is no single order that determines the sequence in which the text is to be read.“ (Nielsen, 1990, S. 1)
Eine didaktisch gelungen erscheinende Darstellung dessen, was Hypertext ist, bietet Gerdes (1997) in grafischer Form (S. 7):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
T Abbildung 4 T. Veranschaulichung des Hypertext-Konzepts (Gerdes, 1997, S. 7)
Aus der Abbildung wird ein Merkmal von Hypertext, über das in den unterschiedlichen Definitionsvorschlägen Konsens herrscht, deutlich: Hypertext besteht aus Knoten (= atomare Informationseinheiten) und Links (= Verknüpfungen).
Enthalten die Knoten nicht nur Texte oder einfache Schwarz-Weiß-Grafiken, sondern auch farbige Bilder, Videos, Animationen, gesprochene Sprache, Töne, Geräusche, Musik, etc. dann spricht man häufig von Hypermedia. Manche Autoren, wie z. B. Unz (2000) bezeichnen Hypermedia als multimedialen Hypertext (S. 24). Die beiden Begriffe Hypertext und Hypermedia werden vielfach aber auch synonym verwendet (Altun, 2000).
Hypertexte bzw. Hypermedia sind nur computerbasiert sinnvoll. Der Zugriff auf die einzelnen Informationseinheiten erfolgt über eine direkt manipulierbare grafische Benutzeroberfläche. Der User bewegt sich dabei entlang der Verbindungen, z. B. durch Anklicken entsprechender Links mit der Maus, in der Regel nicht-linear durch das Informationswerk, die sogenannte Hypertextbasis, die auch als Hyperdokument bezeichnet wird. Ein wesentliches Merkmal von Hypertext ist damit die Aktivität, die vom User bei der Er- bzw. Bearbeitung gefordert wird: „Only when users interactively take control of a set of dynamic links among units of information does a system get to be a hypertext“ (Nielsen, 1990, S. 10).
Der Begriff Hypertext-System bezeichnet „alle Software-Hilfsmittel, mit denen Hypertexte erstellt, verwaltet und genutzt“ werden können (Gerdes, 1997, S. 138). Ein solches Software-Hilfsmittel zur Nutzung von Hypertext ist z. B. der Internet Explorer, eines zu Erstellung und Verwaltung von Hypertext ist z. B. Frontpage. Vielfach stellen Hypertext-Autoren ihre Texte aber ohne derartige Hilfsmittel her und schreiben ihre Quelltexte direkt in HTML (= Hypertext Markup Language).
Als Abschluss dieser ersten Charakterisierung von Hypertext sei die von Unz in Anlehnung an Schulmeister (1996) und Nielsen (1990) formulierte Definition des Begriffs Hypertext wiedergegeben:
„Hypertext bezeichnet die computergestützte Integration von Daten in einem Netz aus Informationsknoten und Links. Hypertext wird als generischer Name für nicht-lineare Informationssysteme benutzt, auch wenn das System nicht-textgebundene Informationen enthält. Damit akzentuiert der Begriff Hypertext die strukturellen Aspekte, das Konstruktionsprinzip“ (Unz, 2000, S. 24).
2.2 Text und Hypertext
Was Hypertext ausmacht, kann vermutlich am besten dadurch beschrieben werden, dass man ihn mit herkömmlichem Lineartext vergleicht.
Als Hauptunterschied der beiden Textsorten wird in der Literatur sehr häufig die Linearität bzw. Nicht-Linearität herausgestrichen. Traditionelle Texte, wie z. B. Bücher verfügen demnach über einen linearen Aufbau, d. h. es gibt eine bestimmte, festgelegte Reihenfolge, in der die einzelnen Textteile zu lesen sind. Das lineare Abfolgemuster linguistischer Einheiten, die in einem Konjunktionsverhältnis zueinander stehen, wird als Syntagma bezeichnet. Hypertext dagegen ist nicht-sequentiell aufgebaut. Aufgrund seiner netzwerkartigen Globalstruktur aus Informationsblöcken und Verknüpfungen gibt er keine feste Leseabfolge der einzelnen Teile vor, sondern erlaubt es dem Leser, seinen individuellen Weg durch den Textraum zu wählen. Dieses Abfolgemuster bezeichnet Freisler (1994) als das „Hypertagma“ (S. 38). Da dieses Abfolgemuster aber letztlich immer linear sein wird, verweist Freisler die oft beschworene „nichtlineare Leseerfahrung“, die Hypertext ermöglichen soll, in das Reich des Mythos (Freisler, 1994, S. 38).
Und auch die Struktur eines Hypertextes muss nicht notwendigerweise immer nicht-linear sein: In einem sogenannten linearen Hypertext sind die einzelnen Knoten so miteinander verknüpft, dass der Leser von einem zum nächsten weiter schreitet. Andererseits können auch traditionelle Lineartexte nicht-lineare Strukturen wie z. B. Fußnoten und/oder Querverweise enthalten. Auch Lexika, Wörterbücher und andere Referenzwerke, Conklin bezeichnet diese Textsorten als „manuelle Hypertexte“ (= „manual hypertexts“) (Conklin, 1987, S. 20), geben dem Leser keine festgelegte Reihenfolge vor. Bei entsprechendem Vorwissen werden selbst Lehrbücher nicht Seite für Seite von Anfang bis Ende durchgelesen, sondern der Lerner trifft eine seinen Bedürfnissen und seinem aktuellen Kenntnisstand entsprechende Auswahl einzelner Textteile und überspringt andere. Gerade bei papierbasierten Fachtexten ist nicht-lineares Lesen häufig eine sehr geeignete Methode, um aus einer Fülle von Informationen das Benötigte herauszufiltern. In vielen Zeitschriften ist ein gewisser Trend zur Entlinearisierung zu beobachten: Anstelle eines längeren Fließtextes findet sich hier oft ein kürzerer „Kerntext“, der zur Vertiefung durch separate Tabellen, weiterführende Kommentare, Beispiele, etc. ergänzt wird (Blumstengel, 1998, S. 72).
Die Grenzen zwischen Text und Hypertext sind also insofern fließend, als Text in bestimmtem Ausmaß nicht-lineare und Hypertext lineare Strukturen enthalten kann (Kuhlen, 1991, S. 27). Gemeinhin wird aber doch traditionellem Lineartext eine eher monohierarchische Globalstruktur zugeschrieben, bei der zwischen den einzelnen Textteilen eher unidirektionale 1:1 Beziehungen bestehen, während Hypertext eine eher netzwerkartige Globalstruktur aufweist, in der eher bidirektionale m:n Beziehungen zwischen den Knoten bestehen, was bedeutet, dass im Prinzip in Hypertext beliebig viele Pfade von einem Knoten ausgehen und beliebig viele Pfade zu einem Knoten hinführen können (Kuhlen, 1991; Freisler, 1994).
In traditionellem Text wird das Thema meist dahingehend entfaltet, dass von einer zentralen Struktur hierarchisch untergeordnete Textteile abhängen. Abschweifungen werden vermieden, viele Fußnoten sind die Ausnahme, weil sie den Lesefluss bzw. das Verständnis stören. In Hypertext erfolgt die Themenentfaltung meist in verschiedenen, voneinander unabhängigen Strukturen. Die einzelnen Textteile hängen prinzipiell nicht voneinander ab, Abschweifungen und Fußnoten sind die Regel. Nicht von ungefähr bezeichnet Nielson Hypertext daher als „generalized footnote“ (Nielsen, 1995, S. 2).
Während in traditionellem Text die Gesamtkohärenz ein sehr wesentliches Merkmal darstellt, existieren in Hypertext zwar verschiedene kohärente Hypertagmen, die Gesamtkohärenz jedoch nur in eingeschränktem Ausmaß als eine Art „roter Faden“, der die einzelnen Textelemente zusammenhält.
Traditionelle Papiertexte weisen durch die Verwendung von Schrift und Bild zur Wissensrepräsentation in der Regel einen geringeren Synästhetisierungsgrad auf als Hypertexte, in denen zusätzlich zu diesen gängigen Symbolsystemen auch Animationen, Filme, Töne, Geräusche, gesprochene Sprache und dergleichen Verwendung finden.
Aus medienhistorischer Sicht charakterisiert Freisler (1994) traditionellen Text als technisch und pädagogisch voll ausgereiftes Kommunikationsmedium, dessen soziale Akzeptanz in allen gesellschaftlichen Bereichen sehr groß ist. Hypertext beschreibt er als ein „Medium im Inkunabelstatus“TP[5] PT, das noch auf einen speziellen Bereich der Informationsübermittlung beschränkt ist, dem aber steigende Akzeptanz in breiten Bevölkerungskreisen entgegengebracht wird. (Freisler, 1994, S. 39).
2.3 Geschichte von Hypertext
Betrachtet man die Nichtlinearität als wichtigstes Merkmal von Hypertext, dann ist Hypertext fast so alt wie die abendländische Schriftentwicklung, denn die Entlinearisierung der „scriptura continua“ beginnt im 8. Jahrhundert in den Skriptorien Englands und Irlands mit der Einführung der Wortabstände (Freisler, 1994).
Erste Versuche, nichtlineare Textzusammenhänge zu realisieren, stellen die sogenannten „Leseräder“ des 17. Jahrhunderts dar. Das erste Exemplar wurde 1588 von Agostino Ramelli (1531 – 1608) entworfen: Es sah aus wie ein Wasserrad, dessen Schaufeln aber an Stelle von Wasser Bücher transportierten, zwischen denen man beim Lesen durch Drehen des Rades hin- und her springen konnte. Diese Technologie soll, Freisler (1994) zufolge, Bush als Vorbild für sein MEMEX gedient haben.
Vannevar Bush (1890 – 1974), wissenschaftlicher Berater von Präsident Roosevelt im Zweiten Weltkrieg, gilt allgemein als Vater der Hypertextidee. Er beschreibt 1945 das von ihm erdachte, jedoch nie realisierte Informationssystem MEMEX (= Memory Extender) als „a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility” (BushTP[6] PT, 1945, S. 102). Jeder Wissenschaftler sollte seine Materialien auf MEMEX speichern, um der Allgemeinheit Zugriff darauf zu ermöglichen. Bush schlug aber nicht nur eine neue Methode zur Speicherung und zum Abruf von Informationen vor, sondern nannte auch drei vollkommen neue Hilfsmittel zur Interaktion mit Texten: assoziative Indizes (oder Links), Pfade, die diese Links miteinander verbinden, und Netzwerke, die aus solchen Pfaden bestehen. Damit hat Bush die drei Hauptelemente eines flexiblen Textes, der für die individuellen Bedürfnisse jedes individuellen Lesers offen ist, beschrieben (Barnes, 1994).
In abgewandelter Form wurden die Überlegungen von Bush 1962 von Douglas C. Engelbart, dem Erfinder der Computer-Maus, wieder aufgegriffen. Im Rahmen des Projekts „Augment“, in dem er und seine Mitarbeiter am Stanford-Research-Institute (SRI) sich das Ziel gesetzt hatten, Computertools zur Erweiterung der menschlichen Kapazität und Erhöhung der Produktivität zu entwickeln, wurde das oN-Line System NLS geschaffen, eine Art „Journal“, in das die Augment Mitarbeiter alle Arbeitspapiere, Berichte und Memos speichern und durch Querverweise mit anderen Arbeiten verbinden konnten (Beißwenger & Storrer, 2002).
Der Terminus Hypertext für nicht-lineare Texte, die auf Computerbildschirm gelesen und geschrieben werden, wurde von Ted Nelson an der Brown University in Providence geprägt (Blumstengel, 1998). Nelsons „Xanadu“ gilt heute als erster „richtiger“ Hypertext (Unz, 2000). Xanadu war konzipiert als universelle Hypertextbasis, in die die gesamte Weltliteratur gespeichert und durch Links miteinander verbunden werden sollte. Ein einmal in dieses Hyperarchiv eingespeicherte Dokument sollte niemals wieder gelöscht werden, wodurch sämtliche Informationsquellen in multiplen Versionen allen Menschen zugänglich sein sollten. In dieser von Nelson geplanten Form wurde das Xanadu-Docuverse zwar nicht realisiert, ein Teil davon besteht aber seit der Einstellung des Projekts 1992 bis heute. Genauere Informationen zu Xanadu stehen online unter http://xanadu.com/ (2004-08-10) zur Verfügung.
Das erste funktionierende Hypertext-System der Geschichte war das 1967 von Andries van Dam, Ted Nelson und anderenCC[gp1] ebenfalls an der Brown University entwickelte Hypertext Editing System. Ursprünglich für die Erstellung von Lehrmaterialien für den Literaturkundeunterricht gedacht, wurde es später an das Houston Manned Spacecraft Center verkauft, wo es zur Dokumentation der Apollo Missionen eingesetzt wurde (Blumstengel, 1998).
Den Durchbruch für die Hypertext-Technologie bedeutete 1987 das System HyperCard von Bill Atkinson, das beim Kauf eines Apple-Computers von Macintosh gratis mitgeliefert wurde und mit dem jedermann dank der sehr einfachen Programmiersprache HyperTalk eigene Hypertexte erstellen konnte. Schulmeister ist der Meinung, dass keine andere Software zuvor „derart bedeutsamen Einfluss auf den Einsatz von Computern“ hatte. (Schulmeister, 1996, S. 211).
Das heute weltweit bekannteste und größte Hypertext-/Hypermedia System ist das WWW (= World Wide Web).
In dieser kleinen Auswahl soll das von Hermann Maurer und seinen Kollegen in den frühen 90er Jahren an der Universität Graz entwickelte Hypertext-/Hypermedia System Hyper-G, das mittlerweile unter dem Namen Hyperwave kommerziell vertrieben wird, nicht unerwähnt bleiben. Es wird in mancher Hinsicht als dem WWW überlegen angesehen, weil die Informationen über Start und Ziel aller Links nicht in die Knoten integriert sind, sondern in spezialisierten Strukturen verwaltet werden, was die auf Webseiten allgegenwärtigen „broken links“ (= Verknüpfungen, deren Zielknoten nicht mehr existiert) verhindert, und weil es außerdem, im Unterschied zum WWW, die einfache Entwicklung und Verwaltung mehrsprachiger Dokumente erlaubt (Blumstengel, 1998). Über die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Hyperwave informiert die Webseite http://www.hyperwave.at/d/ (2004-08-10).
Die aktuelle Situation von Hypertext-/Hypermedia Systemen charakterisiert Schulmeister (1996) folgendermaßen: „Immer noch werden neue Hypertext-Systeme entwickelt, teils für experimentelle Zwecke, teils mit speziellen Funktionserweiterungen für kooperatives Arbeiten und Schreiben, teils aber auch mit exotischen Abwandlungen der Standard-Funktionen“ (Schulmeister, 1996, S. 212).
2.4 Anwendungsbereiche von Hypertext
Hypertext war ursprünglich konzipiert, um die Informationssuche in umfangreichen Datenbanken zu erleichtern (vgl. Bush, 1945). Aufgrund technischer Weiterentwicklung und des massiven Preisverfalls für Computer wurden die Anwendungsbereiche aber immer vielfältiger, sodass Hypertext heute in nahezu allen Bereichen des Lebens zu finden ist (vgl. Inhalte des WWW).
Um zu entscheiden, ob sich eine Anwendung für den Einsatz von Hypertext eignet, empfiehlt Shneiderman (1989) die Beachtung der „three golden rules of hypertext“ (Nielson, 1995, S. 43):
- Die in Frage kommende Information hat einen großen Umfang und besteht aus einzelnen Teilen.
- Diese einzelnen Teile stehen in Beziehung zueinander.
- Der Nutzer braucht zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein kleines Segment der Gesamtinformation.
Wissenschaft
Hypertexte eignen sich nicht nur als reine Informationssysteme, um allgemeine Informationen z. B. über eine Universität und ihr Studienangebot zur Verfügung zu stellen, sondern auch zur wissenschaftlichen Dokumentation von Forschungsergebnissen und deren Präsentation im Internet. Ein Beispiel dafür stellt die Dissertation von Blumstengel (1998)TP[7] PT dar, die in ihrer ursprünglichen Form als Hypertext geschrieben und auch online veröffentlicht wurde.
Aus- und Weiterbildung
Vor allem die Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiges Einsatzgebiet für Hypertext. Obwohl empirische Ergebnisse keine eindeutigen Aussagen zulassen, wird gemeinhin angenommen, dass ein Einsatz von Hypertext im Unterricht die Motivation der Lerner fördert, weil er entdeckendes und selbst gesteuertes Lernen erlaubtCC[gp2] . Im Schulunterricht werden meist Hypertexte, die um eine instruktionale Komponente (z. B. einen vorgegebenen Pfad, integrierte Tests und Verständnisfragen mit entsprechendem Feedback) erweitert sind, in Form von Lern-CDs, die es mittlerweile für fast alle Unterrichtsfächer gibt, eingesetzt. Hypertexte können natürlich auch zum Selbststudium genutzt werden (vgl. Kuhlen, 1991). Die Grenzen zwischen Bildung und Unterhaltung sind bei den entsprechenden Anwendungen oft fließend, was das Schlagwort „Edutainment“ verdeutlicht (vgl. Blumstengel, 1998, S. 92).
Wirtschaft
Viele Unternehmen bedienen sich der Hypertext-Technologie, um sich selbst und ihre Produkte weltweit im Internet zu präsentieren. Hypertext wird häufig eingesetzt, um hohe Druckkosten für optisch ansprechende Kataloge zu sparen und um Interessenten durch entsprechende Querverweise auf andere Produktdarstellungen, die sie interessieren könnten, zum Kauf zu animieren. Hypertext kann auch als Werkzeug für Büroorganisation eingesetzt werden, um täglich im Betrieb anfallende Dokumente zu vernetzen. Mit Hilfe bestimmten Anwendungen, die unter anderem auch Hypertext-Strukturen verwenden, können Teams über räumliche und zeitliche Distanzen hinweg kollaborativ und kooperativ arbeiten, und auch in der Mitarbeiterschulung wird Hypertext vermehrt eingesetzt (vgl. Blumstengel, 1998).
Kultur
Für klassische lineare Literaturformen erscheint Hypertext wenig geeignet: „As long as you are just reading a novel with a single stream of action, you are much better of reading a printed book.” (Nielson, 1995, S. 120). Für Lyrik ist die Hypertextform dagegen sehr wohl vorstellbar.
Als Ergänzung zu traditionellen Literaturformen hat sich in den letzten Jahren eine weltweite Cyberliteratur entwickelt, die Autoren unabhängig von Verlegern macht und vielfach auch den Leser zum aktiven Mitgestalter werden lässt, die aber auch etwas sehr Flüchtiges und Ungreifbares sein kann, da man nie weiß, ob die Texte am nächsten Tag auch noch online sein werden. Ein Beispiel für Cyberliteratur, die Hypertext-Technologie verwendet, ist „Blue Suburban Skies“, das derzeit am Institut für Medienwissenschaft der Universität Trier entsteht. Unter http://www.uni-trier.de/uni/fb2/medien/leben/cyberfiction/index.html (2004-08-10) kann jedermann, nach Voranmeldung per Email an die Verantwortlichen, an der Gestaltung dieses Werks mitwirken.
In Museen und Ausstellungen findet man immer häufiger sogenannte POIs (= point of information), Computerterminals, an denen die Besucher mit Hilfe von Hypertext-Technologie zusätzliche Hintergrundinformationen zu einzelnen Ausstellungsstücken abrufen können.
Unterhaltung
In diesem Bereich wird die Vermischung von Information und Unterhaltung (= Infotainment) besonders deutlich, wenn man die zahlreichen Hypertext-Angebote im Internet zu Themen wie Reisen, Natur, Autos, Kochen, etc. betrachtet. Die hypertextuelle Aufbereitung ermöglicht dem User einerseits den gezielten Zugriff auf konkrete, ihn interessierende Informationen, andererseits ein unterhaltsames Durchforsten des Informationsangebots zu einem bestimmten „Modethema“. Auch viele Spiele auf CD machen sich Hypertext-Technologie zu Nutze (vgl. Blumstengel, 1998).
2.5 Aufbau von Hypertext
In Anlehnung an das Architekturmodell von Cambell und Goodman beschreibt Nielson (1995, S. 131ff.) folgende drei Schichten, aus denen Hypertext besteht:
- Datenbankschicht („database level“): Auf dieser Ebene, die die Basis eines Hypertextes darstellt, sind die verschiedenen Datentypen gespeichert.
- abstrakte Hypertext-Maschine („hypertext abstract machine“): Hier erfolgt die Definition von Knoten und Links bzw. die Festlegung ihrer Formate.
- Benutzerschnittstelle („presentation level“): Sie stellt den „Ort der Kommunikation zwischen User und System“ (Marchionini & Shneiderman, 1988, S. 73) dar, d. h. hier interagiert der Hypertext-Leser mit dem System: Auf dieser Ebene wird festgelegt, welche Kommandos und Manipulationsmöglichkeiten dem User zur Verfügung stehen.
2.5.1 Hypertext-Basis
Die Wissensbasis eines Hypertexts ist mehr als eine bloße Sammlung von Fakten, denn sie bietet meist nicht nur eine Fülle von Informationen in unterschiedlichen Formen (z. B. Texte, Grafiken, Bilder, etc.), sondern auch entsprechende Strukturen, d. h. die einzelnen Informationen werden in einen größeren Kontext eingebettet.
Nach Gall und Hannafin (1994) kann diese Datenbasis hinsichtlich ihrer Breite, ihrer Tiefe, ihrer Homogenität und des Grades der Verbundenheit der in ihr enthaltenen Informationen beschrieben werden:
- Breite: Ähnlich wie eine Enzyklopädie enthält eine Datenbasis mit hoher Breite mannigfaltige Informationen. Eine Datenbasis mit niedriger Breite dagegen fokussiert auf eine beschränkte Anzahl von Themen.
- Tiefe: Hohe Tiefe liegt vor, wenn sich die Datenbasis auf wenige Themen beschränkt, diese aber sehr ins Detail gehend behandelt. Bei geringer Tiefe werden die einzelnen Themenbereiche nur wenig elaboriert.
Gewählte Breite und Tiefe einer Datenbasis sollten sich immer an der Zielgruppe des Hypertextes und deren Bedürfnissen orientieren.
- Homogenität: Die in einer homogenen Datenbasis gespeicherten Materialien weisen einen hohen Grad an Ähnlichkeit auf, eine inhomogene Datenbasis hingegen hat eher den Charakter eines Notizblocks, d. h. sie enthält sehr unterschiedliche Datenquellen (z. B. Texte, Abbildungen, Karten, etc.)
- Verbundenheit: In einem lose verbundenen System muss der User die einzelnen Informationen selbst verbinden. Ein stark verbundenes System hält viele Assoziationen zwischen den unterschiedlichen Informationsteilen bereit, denen der User auf seinem Weg durch den Hypertext folgen kann.
2.5.2 Knoten
Was in einem traditionellen Text Kapitel, Subkapitel und/oder einzelne Textabschnitte, das sind in Hypertext die sogenannten Knoten („nodes“). Sie werden definiert als „die grundlegenden, atomaren Einheiten der Informationsspeicherung“ (Tergan, 2002, S. 110) bzw. „informationelle Einheiten“ (Kuhlen, 1991, S. 80). Ihre Funktion ist es, den User mit „phenomena“ zu beliefern (Perkins, 1991, zitiert nach Gall & Hannafin, 1994, S. 216).
Gall und Hannafin (1994) unterscheiden zwischen Präsentationsknoten und Interaktionsknoten. Erstere enthalten, wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, eine Präsentation der Information. Diese kann statisch (z. B. Text, Bild, Grafik) oder dynamisch (z. B. Animation, Musik, Tonsequenz) sein. Interaktionsknoten enthalten darüber hinaus auch eine Anweisung, wie die Information verwendet wird. Der User hat hier die Möglichkeit, den Inhalt zu manipulieren (z. B. Objekte verschieben, Fragen beantworten, Grafiken zeichnen).
Die Größe eines Knotens wird als Granularität (= Korngröße) bezeichnet und kann von einigen, wenigen Worten bis zu komplexen Dokumenten reichen. Die Wahl einer geeigneten Knotengröße ist abhängig von Art, Zweck und Gesamtumfang der präsentierten Informationen. Im Allgemeinen wird empfohlen, eine gewisse Größe (z. B. 100 Zeilen bei Shneiderman, Kreitzberg & Berk, 1991, zitiert nach Gerdes, 1999, S. 198) nicht zu überschreiten, da bei sehr großen Knoten spezifische Eigenschaften und Vorteile von Hypertext verloren gehen: Der User hat nicht mehr das Gefühl, die Reihenfolge der Informationseinheiten selbst steuern zu können (Unz, 2000). Sehr kleine Knoten wiederum bewirken eine starke Atomisierung und Dekontextualisierung, wodurch das Verstehen des Textzusammenhangs behindert bzw. eventuell sogar unmöglich gemacht werden kann. Entsprechend den Beschränkungen des menschlichen Kurzzeitgedächtnisses wird eine Anzahl von ca. sieben Elementen (= Chunks) pro Knoten als wünschenswert erachtet (Kuhlen, 1991), wobei es allerdings von Zielgruppe und Anwendungsbereich abhängt, was ein Chunk ist: Ein- und derselbe Inhalt kann bei niedrigem Vorwissen aus vielen Chunks bestehen, bei hohem Vorwissen dagegen nur aus einem (Gerdes, 1999, S. 198).
Aus dem Umstand, dass in einem Hypertext nicht auf die in traditionellen Texten üblichen kohäsiven Gestaltungsmittel über die Grenzen von Einheiten hinweg (z. B. Formulierungen wie „wie oben gezeigt…“, „wie aus dem bereits Besprochenen hervorgeht…“ und dergleichen) zurückgegriffen werden kann, ergibt sich die Forderung nach kohäsiver Geschlossenheit der einzelnen Knoten. Das bedeutet, dass ein Knoten so gestaltet werden muss, dass er in kohäsiver Hinsicht autonom ist und auch entsprechend autonom rezipiert werden kann. Kohäsive Geschlossenheit eines Knotens gewährleistet, dass von anderen Knoten auf ihn referenziert werden kann, ohne dass das Verständnis des Gesamt-Hypertextes darunter leidet (Kuhlen, 1991). Im Sinne der kohäsiven Geschlossenheit erscheint es daher sinnvoll, bei der Erstellung eines Hypertextes keinen traditionellen (linearen) Text als Grundlage zu verwenden. Die notwendige Entlinearisierung eines sequentiellen Basistextes führt häufig dazu, dass die einzelnen Knoten nicht über ausreichende kohäsive Geschlossenheit verfügen. Aus diesem Grund wurde der in dieser Untersuchung verwendete Hypertext als Hypertext geschrieben und nicht einfach durch Adaptierung eines bereits vorhandenen Lineartextes erstellt.
Auf der Benutzeroberfläche erfolgt die Darstellung des Inhalts eines Knotens in der Regel in einem Fenster auf dem Bildschirm. Da dieses Fenster maximal so groß sein kann wie der Bildschirm, lässt sich ein umfangreicherer Text nicht simultan anzeigen. Diesem „Problem“ kann grundsätzlich auf zwei Arten begegnet werden. Die eine Möglichkeit ist es, den Text auf mehrere Knoten zu verteilen, die linear miteinander verknüpft werden und auf die der User durch bildschirmweises Blättern (= paging) zugreifen kann. Da bei dieser Methode eine weitere Fragmentierung des Textes notwendig ist, kann das Verständnis des Zusammenhangs darunter leiden. Eine zweite Möglichkeit ist es, den Text in einen einzigen Knoten zu stellen. Der User muss nun scrollen (= zeilenweises Auf- und Abschieben des Textes mittels des Rollbalkens am Bildschirmrand), wodurch das Auffinden einer bestimmten Information im Text erschwert sein kann. Manche Systeme (z. B. Intermedia) erlauben die simultane Anzeige beliebig vieler Knoten in überlappenden Fenstern auf dem Bildschirm (Gerdes, 1999, S.198). Diese Möglichkeit erscheint jedoch bedenklich, weil sie zu beträchtlicher Verwirrung des Lesers führen kann.
2.5.3 Links
Links stellen vermutlich das wichtigste Element von Hypertext dar, denn „Verknüpfungen erwecken Hypertext erst zum Leben“ (Kuhlen, 1991, S. 102). Sie setzen die einzelnen Knoten zueinander in Beziehung und erlauben dem User die Navigation durch das Informationsnetz.
Jeder Link verfügt über einen Ausgangspunkt, den Quellanker, der immer genau bestimmt ist, und einen Zielpunkt, den Zielanker, der entweder ein anderer Knoten, eine bestimmte Stelle im selben Knoten oder ein Objekt außerhalb des Hypertexts (z. B. eine Webseite im Internet) sein kann.
In der Literatur gibt es eine Vielzahl von Taxonomien zur Typisierung von Links, Triggs (1983) allein unterscheidet z. B. 75 verschiedene Arten (Schulmeister, 1996, S. 234; dort auch eine Übersicht über andere Taxonomien). Grundsätzlich gibt es nach Kuhlen (1991) zwei Möglichkeiten, Knoten zu verbinden: mit referentiellen Links, die auf assoziativen Beziehungen beruhen, ohne dass diese Beziehung spezifiziert wird, und mit typisierten Links, die explizit semantische oder pragmatische Beziehungen zwischen den Knoten wiedergeben. Die meisten in Hypertext vorkommenden Links sind referentielle Verknüpfungen, die die einzelnen Knoten miteinander verketten und damit assoziatives Navigieren durch die Hypertext-Basis erlauben. Da ihre Bedeutung durch den Hypertext-Autor nicht genau beschrieben wird, bezeichnet man sie auch als „implizite Links“ (Blumstengel, 1998, S. 80).
Nach Platzierung und Darstellung können nach Kuhlen (1991), wie bereits angedeutet, drei Arten der Verknüpfung unterschieden werden:
- Bei interhypertextuellen Verknüpfungen liegen Ausgangs- und Zielpunkt auf verschiedenen Knoten.
- Intrahypertextuelle Links haben Quell- und Zielanker in ein- und demselben Knoten. Diese Art der Verlinkung wird meistens dann gewählt, wenn der Inhalt eines Knotens größer ist als eine Bildschirmseite.
- Liegt der Ausgangpunkt des Links innerhalb der Hypertext-Basis, der Zielpunkt jedoch in einem externen Objekt, wie z. B. einer anderen Hypertext-Basis, so spricht man von extrahypertextueller Verknüpfung.
Nach ihrer Gerichtetheit unterscheidet man zwischen unidirektionalen und bidirektionalen Verknüpfungen. Ein unidirektionaler Link kann nur in einer Richtung, nämlich vom Quell- zum Zielanker, verfolgt werden, ein birektionaler Link dagegen in beide Richtungen.
Gerdes (1997) unterscheidet Links außerdem hinsichtlich ihrer Globalität und Lokalität. Bei globalen Ankern sind Ausgangs- und/oder Zielpunkt ein ganzer Knoten, bei lokalen Ankern eine bestimmte Stelle innerhalb eines Knotens, meist ein speziell markiertes Wort. Daraus ergeben sich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
Bei Blumstengel (1998) findet sich darüber hinaus die Unterscheidung von statischen und dynamischen Links. Statische Links werden vom Hypertext-Autor vorgegeben, sind fest im System gespeichert und stellen derzeit die typische Linkform in Hypertext dar. Neuere Systeme können z. B. aufgrund von bestimmten Benutzeraktivitäten zur Laufzeit Links generieren. Solche dynamischen Links entstehen, indem das System Informationen über Knoten, die bereits aufgerufen worden sind, verarbeitet und auswertet und dem Benutzer Vorschläge unterbreitet, welche Knoten für ihn noch relevant sein könnten. Wegen des erhöhten Rechenaufwands, der (noch) aufwändigen Implementierung und des fehlenden semantischen Verständnisses des Systems finden dynamische Links, wenn überhaupt dann meist nur als Ergänzung zu statischen Links Verwendung.
Die Anzeige von Links auf der Benutzeroberfläche kann entweder in Form von speziell gekennzeichneten Wörtern im Text selbst erfolgen (= embedded links) oder in Form von ikonischen Schaltflächen (= Buttons oder Knöpfen) vom Text getrennt. Eingebettete Links heben sich in der Regel durch Farbe und/oder Unterstreichung vom Text ab bzw. lenken die Aufmerksamkeit des Users auf sich, indem sie beim Überfahren mit der Maus ihre Farbe verändern (= Hover-Effekt). Meist ändert auch ein einmal angeklickter Link seine Farbe, um dem User bei einem neuerlichen Aufruf des betreffenden Knotens zu signalisieren, dass er die entsprechende Seite schon betrachtet hat. Dadurch soll einer möglichen Desorientierung des Users vorgebeugt werden. In manchen Hypertext-Systemen gibt es „unsichtbare“ Linkanzeigen. d. h. das sogenannte „hotword“ zeigt dem User erst beim Überfahren mit der Maus durch Veränderung des Cursors den Link an. Irler und Barbieri beschreiben diese Art der Linkdarstellung als vorteilhaft, weil dabei der Lesefluss nicht durch Hervorhebungen unnötig beeinflusst werde (Irler & Barbieri, 1990, zitiiert nach Gerdes, 1999, S. 202). Dem muss man jedoch entgegenhalten, dass eine derartige Linkanzeige zu einem Übersehen von möglicherweise relevanten Informationen führen kann. Die Darstellung von Links in Form von Buttons, z. B. in einer Leiste am unteren Bildschirmrand, oder in einem eigenen Menu hat den Vorteil, dass dadurch unkontrolliertes, chaotisches Navigieren vermieden werden kann, andererseits aber auch den Nachteil, dass dadurch die Bereitschaft des Users, Links im Text selber zu folgen, reduziert werden könnte (Gerdes, 1999).
2.5.4 Hypertext – Strukturen
Die Struktur eines Hypertextes wird bestimmt durch die zwischen den Knoten bestehenden Verknüpfungen. Welche Knoten dabei über welche Links nach welchen Mustern miteinander verbunden werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem darzustellenden Sachverhalt, der angestrebten Komplexität des Hypertextes, der Form der Nutzung, der Zielgruppe und ihren Bedürfnissen (Gerdes, 1999). Je nach Wahl der Struktur wird dem User mehr oder weniger Kontrolle über die Auswahl seines Weges durch den Hypertextkorpus gewährt.
In Abhängigkeit davon, ob die Verbindungen zwischen den Knoten nach einem bestimmten Schema angeordnet sind oder nicht, unterscheidet man strukturierte und unstrukturierte Hypertexte. Letztere basieren ausschließlich auf referentiellen Verknüpfungen und stellen somit eine lose Sammlung von Einzeltexten dar, die durch Querverweise miteinander verbunden sind (Gloor, 1990). Strukturierte Hypertexte hingegen gründen auf semantischen oder pragmatischen Organisationsprinzipien.
Gerdes (1997) nimmt drei strukturelle Grundmuster an und unterscheidet danach zwischen linearen, hierarchischen und vernetzten Hypertexten.
- Linear strukturierte Hypertexte sind herkömmlichen Papiertexten am ähnlichsten, weil sich der Leser in ihnen wie in einem Buch von einer Seite zur nächsten bewegt, wozu er Vorwärts- bzw. Rückwärts-Buttons benutzt. In dieser einfachsten aller Hypertext-Topologien hat jeder Knoten genau einen „Eltern-Knoten“ (= „parent“) und einen „Kind-Knoten“ (= „child“) (Parunak, 1989, S. 45). Ein linear aufgebauter Hypertext gestattet dem User nur wenig Freiheit: Die einzige Wahlmöglichkeit, die er hat, ist es, entweder auf die nächste Seite weiter- oder auf die vorherige Seite zurück zu navigieren. Lineare Strukturen sind jedoch geeignet, wenn es darum geht, im Sinne einer sogenannten geführten Unterweisung (= Guided Tour) in neue Sachverhalte einzuführen oder vorstrukturierte Informationen zu vermitteln (Tergan, 2002).
- In hierarchisch strukturiertem Hypertext sind die Knoten in Form eines Baums angeordnet. Am Startknoten, auch „Wurzelknoten“ (= „root“) oder „Waise“ (= „orphan“) (Parunak, 1989, S. 46), dem einzigen Knoten im gesamten Hypertext, der keinem „Eltern-Knoten“ zugeordnet ist, steigt der User in den Text ein. Eine hierarchische Struktur überlässt dem User mehr Kontrolle: An diversen Entscheidungspunkten kann er durch entsprechende Linkauswahl seine Lesereihenfolge selbst bestimmten. Da es in einem streng hierarchisch aufgebauten Hypertext jedoch keine Querverbindungen zwischen den Knoten auf einer Ebene gibt, wird die Freiheit in der Auswahl der interessierenden Knoten wiederum beschränkt. In der Praxis wird der streng hierarchische Aufbau eines Hypertexts dieses Typs jedoch oft dadurch aufgelockert, dass gelegentlich an geeigneten Textstellen Querverbindungen zwischen zwei Knoten auf einer Ebene gesetzt werden. Mehr Navigationsfreiheit bedeutet in einer hierarchischen Struktur auch die Verwendung von „repeated nodes“ (Panero, 1995, zitiert nach Sturm, 2002, S. 30): Hierbei kann von mehreren übergeordneten Knoten auf einen bestimmten Knoten in einer tieferen Ebene direkt zugegriffen werden.
- In einer vernetzten Hypertext-Struktur können von jedem Knoten aus Querverweise auf beliebig viele andere Knoten gegeben werden. Damit überlässt diese Strukturform dem User ein hohes Maß an Kontrolle und das höchste Ausmaß an Entscheidungsfreiheit bei der Knotenauswahl. Daraus können aber auch zum Teil beträchtliche Orientierungsprobleme entstehen (Gloor, 1990). Das kann vor allem dann passieren, wenn dem User nicht ausreichend hypertextspezifische Navigationsmittel, wie z. B. grafische Übersichten, zur Verfügung stehen. Netz-Strukturen sind geeignet, vielfältige semantischer Beziehungen zwischen Knoteninhalten zu präsentieren (Tergan, 2002).
Eine weitere in der Literatur erwähnte Hypertext-Struktur stellt das sogenannte Grid (= Gitter) dar, das auch als Matrixstruktur bezeichnet wird. Diese Strukturform bietet mindestens zwei orthogonale Sichtweisen an (Blumstengel, 1998, S. 78). Grids sind prinzipiell linear strukturiert, bestehen jedoch aus mehreren Ebenen und erlauben somit eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung durch den Text, zusätzlich aber auch den Zugriff auf unmittelbar darüber oder darunter liegende Ebenen. Matrixstrukturen eignen sich für Bereiche, in denen bestimmte Aspekte in verschiedenen Dimensionen verglichen werden sollen (Parunak, 1989).
Als Spezialform der hierarchischen Struktur kann die sternförmige Hypertext-Struktur bezeichnet werden. Hier wird ein zentraler Knoten, der das zentrale Konzept des Hypertexts enthält, mit untergeordneten Knoten, die dieses Konzept näher definieren oder erklären, verbunden (Jonassen, 1986; zitiert nach Gall & Hannafin, 1994, S. 218). Kiosk-Systeme, die z. B. Produktbeschreibungen enthalten, verwenden diese Struktur häufig (Schulmeister, 1996).
Die ringförmige Struktur stellt eine Spezialform der linearen Hypertext-Struktur dar. Ähnlich wie bei der linearen Struktur kann man auch hier nur von einem Knoten zum nächsten weitergehen, jedoch ist dabei häufig keine Richtung vorgegeben, wodurch ein Einstieg in den Hypertext an verschiedenen Stellen möglich ist. Start- und Endknoten sind identisch (Parunak, 1989).
In „reiner“ Form kommen die beschriebenen Strukturen in der Praxis eher selten vor, die meisten Hypertexte, vor allem solche mit größerem Umfang, kombinieren unterschiedliche Strukturformen miteinander, sodass z. B. ein überwiegend netzartig gestalteter Hypertext auch hierarchische und lineare Bestandteile aufweist. Solche Mischformen werden als „gemischt-strukturierte Hypertexte“ (McDonald und Stevenson, 1995, zitiert nach Sturm, 2002, S 50) bezeichnet. Es wird vermutet, dass diese Strukturform möglicherweise einen optimalen Mix aus Direktion und Freiheit für den User darstellt. Abbildung 5 zeigt das Schema eines solchen Hypertextes „mit hybrider Organisationsform“ (Tergan, 2002, S. 103), in dem eine Netz-Struktur (1) mit einer Matrixstruktur (2) und einer hierarchischen Struktur (3) verknüpft wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5. Hypertextbasis mit hybrider Organisationsstruktur (nach Tergan, 2002, S. 103)
2.6 Navigation in Hypertext
Wie auf die einzelnen Informationen in einem Hypertext zugegriffen wird, hängt unter anderem ab von der Struktur des Hypertexts und den zur Verfügung stehenden Navigations- und Orientierungshilfen, wie z. B. grafischen Übersichten, Fisheye-Views (= spezielle Inhaltsverzeichnisse, in denen die zum aktuellen Betrachtungspunkt nahe Umgebung detailliert, weiter entfernt liegende Objekte dagegen überblicksmäßiger dargestellt werden), Backtracking (= spezielle Funktion, die den User zum zuletzt besuchten Knoten zurückführt), Breadcrumbs (= Markierung bereits aufgesuchter Knoten), Lesezeichenfunktionen, usw. (vgl. Kuhlen, 1991; Gerdes, 1999), von der Art der Aufgabenstellung (vgl. Marchionini & Shneiderman, 1988; Marchionini, 1995) und den Intentionen, die der User verfolgt. Der Informationszugriff kann gezielt, ungezielt oder zufällig erfolgen (Unz, 2000).
Tergan (2002) unterscheidet dabei drei grundlegende Formen:
- gezielte Suche mittels Schlüsselbegriffen und Suchalgorithmen: Dabei können ähnlich, wie in einer traditionellen Datenbank, bestimmte Begriffe in eine Suchmaschine eingegeben und mit Hilfe von Booleschen Operatoren miteinander verknüpft oder von einem Index aus abgerufen werden. Voraussetzung für diese Form des Informationszugriffs ist natürlich, dass der entsprechende Hypertext auch die dafür notwendigen Tools bereitstellt bzw. dass der User auch weiß, wonach er suchen soll und/oder kann.
- Verfolgen von Pfaden: Hierbei folgt der User einem vorab definierten Pfad, den der Autor des Hypertextes durch sequentielle Verknüpfung bestimmter Knoten festgelegt hat. Diese Form des Informationszugriffs eignet sich besonders für User mit geringem Vorwissen zu einem bestimmten Thema und wird daher besonders gern in Lernprogrammen in Form von Guided Tours (= geführte Unterweisung) eingesetzt (Gerdes, 1999).
- Browsing: Diese für Hypertext typischste Form des Informationszugriffs ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der User durch Verfolgen der Links von Knoten zu Knoten bewegt. Im Unterschied zu den beiden anderen Formen des Informationszugriffs wird dem User ein hohes Maß an eigener Kontrolle zugestanden.
Da Browsing vom User ständig Entscheidungen darüber verlangt, welcher Knoten als nächster aufgerufen werden soll, kommen hier vermutlich bestimmte Personenmerkmale wie z. B. Kontrollüberzeugungen und Kompetenzerwartungen besonders zum Tragen.
Für die Beschreibung des Navigationsverhaltens können das „Ausmaß an unternommener Exploration“ und das „Ausmaß an Redundanz“ als Kennwerte der Besuchshäufigkeit von Knoten herangezogen werden. Diese beiden Indizes wurden von Canter, Rivers und Storrs zwar bereits 1985 entwickelt, erweisen sich aber auch heute noch als hilfreich zur Untersuchung des Wahlverhaltens in Informationsnetzen (Astleitner, 1997, S. 70).
- Das „Ausmaß an unternommener Exploration“ (NV : NT = „nodes visited“ : „nodes total“, Canter et al., 1985, S. 95) bezieht die Anzahl der aufgerufenen Knoten auf die Gesamtzahl der verhandenen Knoten. Ein Wert nahe 1 zeigt eine umfassende Exploration des Hypertextes an. Da in die Berechnung dieser Kennzahl die Bearbeitungszeit nicht einfließt, sind keinerlei Rückschlüsse darauf möglich, ob der Inhalt des Hypertextes auch tatsächlich gelesen und nicht bloß durchgeklickt wurde.
- Das „Ausmaß an Redundanz“ (NV : NS = „nodes visited“ : „total number of visits to nodes“, Canter et al., 1985, S. 96) setzt die Anzahl der besuchten Knoten zur Gesamtzahl der Knotenaufrufe in Beziehung. Je höher dieser Quotient, der ebenfalls nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann, desto weniger häufig wurden ein- und dieselben Knoten mehrmals aufgerufen.
2.6.1 Browsing als hypertexttypisches Navigationsverhalten
Der Begriff Browsing leitet sich ab vom Englischen „to browse“ mit der Grundbedeutung „äsen, weiden“ und der übertragenen Bedeutung bzw. in Verbindung mit den Präpositionen „in“ oder „through“ „durchblättern“ (vgl. Cassells Wörterbuch). Im Sinne von „sich informieren“ und „schmökern“ (Kuhlen, 1991, S. 126) hat sich „Browsing“ oder eingedeutschtes „Browsen“ als Fachbegriff im deutschsprachigen Raum durchgesetzt und wird meist synonym zu Navigieren verwendet (Gerdes, 1997). Gelegentlich findet man Browsen als Oberbegriff von Navigieren (z. B. bei Marchionini, 1995) oder Navigation als Oberbegriff, je nach dem Hilfsmittel, mit dem auf die Information zugegriffen wird (z. B. bei Kuhlen, 1991)
Nach Marchionini (1988) ist Browsen etwas sehr Aktives und wird vor allem dann eingesetzt, wenn ein Informationssystem wie z. B. ein Hypertext durch seine Links dazu ermuntert. Marchionini und Shneiderman (1988) definieren Browsing als eine explorative Informationssuchstrategie, die auf zufälligem Entdecken (= „serendipity“TP[8] PT) beruht und besonders geeignet ist zur Erforschung neuer Bereiche bzw. für nicht genau definierte Problemstellungen.
Carmel, Crawford & Chen (1992) beschreiben Browsing als „the art of not knowing what one wants until one finds it“ (S. 866), d. h. die Person hat kein bestimmtes Suchziel definiert, sondern geht mit eher vagen Vorstellungen an den Hypertext heran, wodurch ihr Wissenserwerbsprozess den Charakter eines Herauspickens (= „cherrypicking“) und Auswählens von als nützlich erachteten Informationen erhält.
Demgegenüber unterscheidet Kuhlen (1991, S. 129ff.) zwischen gerichtetem Browsen, dem sehr wohl ein bestimmtes Ziel zugrunde liegt, und ungerichtetem Browsen, vier Arten von Browsing:
- gerichtetes Browsing mit Mitnahmeeffekt: Der User verfolgt beim Durchblättern eines Hypertextes, als „vorselektierter Menge“ an Informationen zu einem bestimmten Bereich, ein vorher definiertes Ziel und nimmt dabei zusätzliche, thematisch verwandte Informationen auf.
- gerichtetes Browsing mit Serendipity-Effekt: Auch hierbei verfolgt der User bei seiner Durchsicht des Hypertextes ein bestimmtes Ziel, wird von diesem aber durch verschiedene interessante Informationen abgelenkt, sodass er darüber sein ursprüngliches Ziel aus den Augen verliert. Diese Art des Browsens ist am Anfang gerichtet, wird aber in der Folge eher frei assoziierend.
- ungerichtetes Browsing: Hierbei verfolgt der User kein bestimmtes Ziel. Er ist sich zwar bewusst, dass er Informationen benötigt, weiß aber nicht genau, welche.
- assoziatives Browsing: Auch hier verfolgt der User kein bestimmtes Ziel, sondern lässt sich vom Informationsangebot treiben und baut so lange Assoziationsketten auf, bis kein weiterer Anreiz mehr zur Verfolgung angebotener Links besteht. Da beim assoziativen Browsen häufig nicht mehr an den Ausgangspunkt einer Assoziationskette zurückgefunden wird, kann es in einen Zustand der Desorientierung münden.
Eine ähnliche Unterscheidung treffen Cove und Walsh (1988) in ihrem dreistufigen Browsing - Modell. Sie differenzieren zwischen suchendem Browsen (= „search browsing“), einem gerichteten Browsen mit bekanntem Ziel, allgemeinem Browsen (= „general purpose browsing“), bei dem ein Informationsraum erforscht wird, der mit angenommener hoher Wahrscheinlichkeit interessierende Aspekte enthält, und zufälligem Browsen (= „serendipity browsing“), als ungerichteter Form, bei dem die Auffindung allfälliger nützlicher Informationen einem glücklichen Zufall überlassen ist (Cove & Walsh, 1988, zitiert nach Unz, 2000, S. 35).
Carmel et al. (1992) sehen den Unterschied zwischen Browsing- und Suchstrategien darin, dass Erstere jederzeit unterbrochen oder abgebrochen werden können, Letztere im Idealfall erst mit der Auffindung des Suchziels beendet sind. Als weitere Formen des Browsens konnten sie in einer Untersuchung mit einem Hypertext über den Vietnamkrieg review-browse (Überprüfen, Wiederaufsuchen von Informationen) identifizieren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Integration der gefundenen Informationen ins mentale Modell des Users angestrebt wird. Zu diesem Zweck werden bereits besuchte Seiten zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen, um die betreffenden Informationen nochmals zu lesen. S can-browse (Abtasten des Informationsraums) kommt einem Abklopfen der einzelnen Hypertext-Knoten nach interessanten Inhalten gleich. Die dabei angesteuerten bzw. gelesenen Informationen werden jedoch einer Integration ins mentale Modell für nicht wert befunden und daher auch nicht wieder aufgerufen, sondern es wird weiter gebrowst, um andere interessante Inhalte zu finden (Carmel et al., 1994, S. 876f.).
Welche Browsing-Strategie eingesetzt wird, hängt nach Marchionini (1989, 1995) stark von der Art der Aufgabenstellung ab: Für geschlossene Aufgaben mit einem spezifischen Ziel, z. B. einer Frage, auf die eine konkrete Antwort gesucht und gefunden werden kann, eignet sich suchendes oder zielgerichtetes Browsen, für offene Aufgabenstellungen mit eher allgemeinen Zielen, wie z. B. dem Sammeln von Informationen zu einem bestimmten Thema, dagegen erweisen sich zielgerichtetes und zufälliges Browsing als effektiver (Unz, 2000, S. 36).
Die beim Browsen erfolgende Bewegung von Knoten zu Knoten kann in zweierlei Hinsicht beschrieben werden:
- hinsichtlich ihrer Richtung als Vorwärtsbewegung beim Suchen nach neuen Informationen bzw. beim Öffnen von noch nicht besuchten Knoten oder als Rückwärtsbewegung zum Wiederfinden von bereits bekannten Informationen in bereits besuchten Knoten und
- hinsichtlich ihrer Distanz als Bewegung in Schritten von einem Knoten auf einen direkt mit diesem verbundenen oder als Bewegung in Sprüngen von einem Knoten zu einem nicht direkt mit diesem verbundenen (Thüring, Hannemann & Haake, 1995).
Die Strategie, von einem Knoten auf den nächstgelegenen zu springen, vergleichen Gall und Hannafin (1994) mit einem Spaziergang. Diese Vorgangsweise erscheint insofern als vorteilhaft, als hierbei auf jede mit einem bestimmten Knoteninhalt assoziierte Information zugegriffen wird. Sie kann sich jedoch auch als mühsam und ineffizient erweisen kann und vor allem dann mit großem Aufwand verbunden sein, wenn nach einer bestimmten Information gesucht wird, die auf einem weiter entfernten Knoten liegt. Beim Sprung über größere Distanzen, von Gall und Hannafin mit einer Bus- bzw. Taxifahrt verglichen, sollte der User abschätzen können, ob so ein Sprung für ihn in irgendeiner Weise zielführend ist, denn es kann dabei zur Desorientierung kommen, wenn nicht mehr an den Ausgangspunkt zurückgefunden wird (Gall & Hannafin, 1994, S. 213ff.).
Gerdes (1997) weist darauf hin, dass diverse Klassifikationsschemata für Browsing nicht ganz problemlos auf Lernkontexte übertragbar sind, da es beim Lernen weniger um die Auffindung bestimmter Informationen geht, sondern mehr um die Aneignung und das Verstehen der Gesamtheit der in einer Hypertext-Basis enthaltenen Informationen. Außerdem merkt sie an, dass Lernen bei vielen der beschriebenen Browsingformen nur in inzidentieller Form, „sozusagen als Nebenprodukt der gezielten Informationssuche“ auftrete (Gerdes, 1997, S. 31). Gall und Hannafin sind der Ansicht, Browsing ermögliche ein hohes Maß an selbstgesteuertem Lernen, weisen aber auch darauf hin, dass gerade Browsing zum Übersehen bzw. zum Nichterkennen der Relevanz wichtiger Inhalte führen kann (Gall & Hannafin, 1994). Da beim Browsen die Informationen eher oberflächlich aufgenommen werden, ist die Behaltensleistung oft relativ gering (Park & Hannafin, 1993, zitiert nach Gall & Hannafin, 1994, S. 219). Das zeigte auch eine Untersuchung von Shute (1993), in der Personen mit hoch explorativem Navigationsverhalten die schlechtesten Lernergebnisse erzielten (Shute, 1993, zitiert nach Dillon & Gabbard, 1998, S 343). Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Jonassen & Wang (1993): Reines Browsen durch einen Hypertext bewirkt keine Verarbeitung der Informationen, die tief genug wäre, um zu bedeutsamem Lernen zu führen (S. 6).
2.6.2 Navigationsmuster
Eine sehr brauchbare Erfassungsmethode für die Navigationsentscheidungen, die ein User während seiner Hypertext-Bearbeitung trifft, ist die Analyse der Logfiles (= vom System erstellte Protokolle über Zeitpunkte und Art der vom User geöffneten Hypertextknoten). Logfiles geben nicht nur Aufschluss darüber, welche Inhalte wann und wie lange bearbeitet wurden, sondern erlauben auch die nachträgliche Rekonstruktion seines Weges durch den Hypertext und eröffnen damit eine Möglichkeit, unterschiedliche Navigationsleistungen von Usern zu erklären. Da Logfiles kontinuierlich und vom User unbemerkt mitgeschrieben werden, bleibt im Unterschied zu anderen Methoden, wie z. B. Lautem Denken oder Videoaufzeichnung, die Hypertextbearbeitung davon unbeeinflusst, weil vom User keine Aufmerksamkeit gefordert wird (vgl. Barab, Bowdish & Lawless, 1997). Eine weitere Methode zur Erfassung der Navigation stellt die nachträgliche Befragung des Users dar. Da es sich hierbei aber um Erinnerungsdaten handelt und Personen vermutlich nicht über komplexe oder automatisierte kognitive Aktivtäten berichten können, sollte diese Methode eher vermieden werden (Unz, 2000, S. 84).
Canter et al. (1985) vergleichen die Navigation eines Users durch Hypertext mit den verschiedenen Wegen, die eine Person im Laufe eines Tages zurücklegt. Ausgangs- und Endpunkt dieses Weges ist das Zuhause, dazwischen werden verschiedene Orte (z. B. Büro, Gasthaus, Einkaufszentrum) besucht, wobei sich der Weg oft auch überkreuzt oder wiederholt. Jeder Ort auf diesem Weg ist einem Hypertextknoten vergleichbar, die Strecken dazwischen den Links. In Anlehnung an diese Metapher unterscheiden die Autoren nun vier verschiedene Wegformen:
- Ein Ring beginnt und endet auf ein- und demselben Knoten, kein anderer Knoten wird zweimal besucht.
- Eine Spezialform des Rings stellt ein Loop (= Überschlag, Schleife) dar, der über nur wenige Knoten führt.
- Sind Anfang- und Endknoten nicht identisch und wird auch kein Knoten zweimal besucht, so spricht man von einem Pfad.
- Als weitere Spezialform des Rings kann der sogenannte Spike (= Dorn, Stachel) bezeichnet werden, bei dem jeder Knoten zweimal besucht wird: einmal auf dem Hin- und einmal auf dem Rückweg. Diese Form ist vor allem in hierarchisch strukturierten Hypertexten zu finden.
Welche dieser einzelnen Formen bei der Bearbeitung eines Hypertexts in welcher Art kombiniert werden, hängt ab von der Struktur des Hypertexts bzw. von der Navigationsstrategie des Users: Beim Browsen weist das Navigationsmuster eher wenige große Ringe und viele Loops auf, beim Suchen dagegen eher lange Spikes mit wenigen Loops. Abbildung 6 zeigt Beispiele dieser beiden Navigationsmuster mit Ring (1), Loop (2) und Spike (3), demonstriert aber gleichzeitig auch ein Problem solcher Einteilungen: Die Kategorien sind oft nicht eindeutig genug, es kann zu Überschneidungen kommen, manches wird eher willkürlich zugeordnet und vieles kann sich als Artefakt erweisen, das sich aus der Art des Hypertextes ergibt (Unz, 2000, S. 84f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6. Wegformen beim Browsing (links) und beim Suchen (rechts)
(nach Canter et al., 1985, S. 100)
Anderson-Inman, Horney, Chen und Lewin (1994) unterscheiden zwischen Lesemustern und Lernmustern. Erstere treten eher zu Beginn der Hypertextbearbeitung auf, wenn der User versucht, sich einen Überblick über den Gesamttext zu verschaffen. Seine Interaktion mit dem Hypertext beschränkt sich in dieser Phase eher auf Durchklicken der einzelnen Knoten. Lernmuster sind dadurch gekennzeichnet, dass ausgewählte Knoten ausreichend lang betrachtet werden, um den Inhalt lernen zu können, dass auf einzelne Knoten wiederholt zugegriffen wird, um den Text nochmals zu studieren, und dass diverse unterstützende Angebote, wie z. B. Worterklärungen, genutzt werden (Anderson-Inman et al., 1994, S. 283). Dabei werden allerdings individuell unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und/oder –strategien nicht berücksichtigt.
Nach Beishuizen, Stoutjesdijk und van Putten (1994) kennzeichnen kurze Pfade eher oberflächlicheres, lange Pfade dagegen eher tieferes Verarbeiten der Informationen (Beishuizen et al., 1994, S. 76). Hierzu muss angemerkt werden, dass Pfadlängen natürlich auch stark von den strukturellen Gegebenheiten im betreffenden Hypertext beeinflusst werden.
Stanton und Baber (1992) teilen die Navigationsmuster nach hierarchischen Kriterien ein in top-down (hierarchisch höhere Knoten werden zuerst besucht), sequentiell (Aufruf der Knoten nach dem Layout auf dem Überblicksbildschirm) und elaborativ (Zick-Zack Bewegungen von höheren Knoten zu niedrigeren und retour) (Stanton & Baber, 1992, S. 163). Auch diese Kategorisierung erscheint nicht für alle Arten von Hypertext gleichermaßen geeignet.
Neuere Untersuchungen (vgl. z. B. Gerdes, 1997; Unz, 2000) verwenden zur Erfassung von Pfadmustern graphentheoretische Maße, wodurch die Navigationsmuster in verschiedenen Hypertexten mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen vergleichbar werden. Richtung und Distanz, die nach Thüring et al. (1995) wesentlichen Aspekte der Navigation, können mit graphentheoretischen Maßen wiedergegeben werden. Allerdings aggregieren solche Maße Daten, wodurch der ursprüngliche Datenraum komprimiert wird. So sind keine Aussagen über Phasen oder längere Sequenzen als Zweierschritte möglich (Unz, 2000, S. 94).
2.6.3 Navigationstypen
Neben der Beschreibung von Navigationsmustern finden sich in der Literatur Versuche, mit Hilfe von bestimmten Variablen wie Anzahl besuchter Knoten, Bearbeitungszeit, Bearbeitungstiefe (vgl. z. B. Lawless & Kulikowich, 1996; Barab et al., 1997), Häufigkeit der Nutzung von Zusatzangeboten wie z. B. Videos, Wortlisten, etc. (vgl. z. B. Anderson-Inman et al., 1996, Lawless & Kulikowich, 1996, Barab et al., 1997, McGregor, 1999) Leser und/oder Lerner eines Hypertextes mit möglichst ähnlichen Werten in den entsprechenden Variablen Clustern zuzuordnen und damit Navigationstypen zu identifizieren. Zur näheren Beschreibung der gefundenen Cluster können die Häufigkeiten der ausgewählten Navigationsvariablen und Scores für die Lösung einer Informationssuchaufgabe oder eines der Hypertextbearbeitung folgenden Wissenstests mit verschiedenen externen Variablen, wie z. B. Vorwissen und Interesse (Lawless & Kulikowich, 1996), Selbstwirksamkeit (Barab, et al., 1997), Kontrollüberzeugungen (McGregor, 1999), in Beziehung gesetzt werden, um so Aufschluss über den Zusammenhang zwischen Navigationsleistung und unterschiedlichen Personen- und Aufgabenmerkmalen zu erhalten.
Anderson-Inman, et al. (1996) untersuchten an einer Reihe von als Hypertext aufbereiteten Kurzgeschichten mit Hilfe von Vokabel- und Verständnistests, Nacherzählungen und eigenen Textproduktionen Lesestrategien und Textverständnis von über 600 amerikanischen SchülerInnen der Schulstufen sechs bis acht. Aus Zeit und Abfolge der durchgeführten Interaktionen mit dem Hypertext wurden Leseprofile erstellt. Dabei ließen sich drei Typen von Hypertext-Lesern erkennen (S. 284):
- „Book - lovers“ (= BücherfreundeTP[9] PT) gaben an, Bücher Texten am Computer vorzuziehen, und tendierten zu einer linearen Bearbeitung, bei der sie eher an der Oberfläche des Hypertextes blieben. Unterstützende Zusatzangebote, wie z. B. Worterklärungen, wurden eher am Anfang der Bearbeitungszeit aufgerufen, in späteren Phasen dagegen immer seltener. Schwierigere Details der Kurzgeschichten, wie z. B. ein überraschendes Ende, wurden nicht verstanden.
- „Studiers” (= Lerner) waren dem Lesen von Texten am PC gegenüber sehr positiv eingestellt, nutzten verschiedene Arten von Zusatzangeboten und beschäftigten sich ernsthaft mit dem Inhalt der Kurzgeschichten, den sie sehr detailliert nacherzählen konnten, was auf eine tiefer gehende Bearbeitung des Hypertextes schließen lässt.
- „Resource - junkies“ (= Hilfsmittel - Süchtige) standen dem Lesen von Texten am PC ebenfalls sehr positiv gegenüber, gaben als Begründung dafür aber das Vorhandensein von diversen Hilfsmitteln an, nach denen sie gezielt suchten, um sie in kurzen Intervallen wiederholt aufzurufen, ohne dabei den Text auf dem entsprechenden Knoten zu lesen. Die im Unterschied zu den anderen Gruppen niedrigsten Leistungsscores zeigten, dass sich diese User nicht ernsthaft mit den Kurzgeschichten auseinandergesetzt hatten.
Lawless und Kulikowich (1996) gaben 42 Studenten einer Einführungsvorlesung zur Bildungspsychologie einen Hypertext über verschiedene Themen der Allgemeinen Psychologie (z. B. Behaviorismus, Kognition, Wahrnehmung) vor und erfassten neben verschiedenen Navigationsvariablen wie Gesamtbearbeitungszeit, Anzahl der aufgerufenen Knoten und Aufruf von erklärenden Videosequenzen auch Vorwissen und Interesse ihrer ProbandInnen. Die Clusteranalyse der Navigationsvariablen ergab drei verschiedene Profile (S. 394)
- „Knowledge - seekers“ (= Wissen-Suchende) hielten sich vor allem auf Knoten mit wichtigen Basisinformationen auf, nutzten Querverbindungen zwischen den verschiedenen im Hypertext dargestellten Konzepten und dokumentierten durch das beste Wissenstestergebnis der drei Gruppen eine optimale Hypertextbearbeitung. Das gute Abschneiden im Behaltenstest könnte allerdings mit einem entsprechenden Vorwissen zusammenhängen, denn diese Personen hatten auch die besten Ergebnisse im Pre-Test (Lawless & Kulikowich, 1996, Tabelle 4, S. 396).
- „Feature - explorers“ (= System-Erforscher) verbrachten die meiste Zeit damit, unterschiedliche Navigationstools auszuprobieren. Am Inhalt der Texte erschienen sie dagegen weniger interessiert, worauf ihre schlechten Ergebnisse im Behaltenstest schließen lassen.
- „Apathetic hypertext - users“ (= apathische Hypertext-User) verbrachten die kürzeste Zeit im Hypertext, betrachteten nur wenige Knoten und nutzen nur wenige Hilfsmittel bzw. Zusatzangebote. Sie schienen weder am Inhalt der Knoten noch am Hypertext selbst interessiert und erzielten die schlechtesten Wissenstestscores.
Barab et al. (1997) verwendeten in ihrer Untersuchung an 66 angehenden Studenten ein Hypertext-System, das auf bis zu sieben Ebenen Informationen in Form von Texten, Tonsequenzen, Grafiken und Videos über die vielfältigen Serviceleistungen einer Universität im Nordosten der USA enthielt und eine Netzstruktur aufwies. Die ProbandInnen mussten darin nach Antworten auf Fragen des studentischen Alltags (z. B. Procedere der Prüfungsanmeldung) suchen. Es wurden vier unterschiedliche Navigationstypen identifiziert (S. 33ff.):
- „Model - users“ entsprachen mit den wenigsten Seitenaufrufen und kürzesten Bearbeitungszeiten am besten dem von den Autoren erstellten Modell für eine effiziente Bewältigung der gestellten Aufgaben. Sie arbeiteten zielgerichtet, d. h. sie waren bemüht, die Aufgaben zu erledigen, ohne sich dabei von den verschiedenen Angeboten des Systems und seinem Inhalt ablenken zu lassen.
- „Disenchanted volunteers“ (= enttäuschte Freiwillige) scheinen nicht nach aufgabenbezogenen Inhalten gesucht zu haben. Die geringe Zahl besuchter Seiten, die sehr kurze Gesamtbearbeitungszeit und das sehr schlechte Informationssuchergebnis deuten an, dass weder Hypertextinhalt noch Aufgabenstellung das Interesse dieser Personen geweckt haben.
- „Feature - explorers“ öffneten die meisten Knoten, riefen im Unterschied zu allen anderen Typen sämtliche Hilfsbildschirme auf, betrachteten die meisten Filme, hatten aber ebenfalls sehr schlechte Ergebnisse. Damit bearbeiteten diese Personen den Hypertext offensichtlich nicht im Sinne der Aufgabenstellung, sondern mit dem Ziel, möglichst viele „Sensationen“ in ihm zu finden.
- „Cyber - cartographers“ drangen von allen vier Typen am tiefsten in das System vor, d. h. sie wählten einen Themenbereich aus und erforschten diesen bis in die untersten Ebenen. Sie betrachteten dabei zwar nur wenige Seiten, nahmen sich für deren Bearbeitung jedoch viel Zeit. Ihre im Vergleich zu den Modell-Usern schlechten Informationssuchergebnisse erklären die Autoren damit, dass diese Personen vermutlich nicht in erster Linie nach der Lösung der Aufgabe suchten, sondern einen bestimmten Hypertextbereich ganz genau erforschen wollten.
Ein Vergleich der vier Cluster mit den individuellen Ausprägungen der hypertextspezifischen Selbstwirksamkeit, die mit vier von Barab et al. (1997) entwickelten, fünf - kategoriellen Items (Cronbach - Alpha = .84) (S. 28) erhoben worden war, ergab signifikante Unterschiede zwischen den Personengruppen hinsichtlich der Selbstwirksamkeit (Kruskal - Wallis Test: cP2P = 9.23, df = 3, p < ,05), wobei Feature-Explorer (n = 7) die niedrigsten (M = 3.43) und Cyber-Kartographen (n = 22) die höchsten (M = 4.15) mittleren Selbstwirksam-keitswerte aufwiesen (S. 37).
Ähnliche Navigationstypen wie in den bereits beschriebenen Studien identifizierte auch McGregor (1999) in einer Untersuchung an SchülerInnen der siebenten und elften Schulstufe, in der die Navigation durch Videoaufzeichnung des Klickverhaltens der Personen erfasst wurde. Die ProbandInnen mussten in einem Hypertext über Biotope Informationen sammeln, ihr Vorgehen laut kommentieren und im Anschluss an die Hypertext-Bearbeitung eine Concept Map (= nachträglich von der Person gezeichnete Darstellung der Hypertext-Struktur) erstellen, um ihr Verständnis der über- und untergeordneten Strukturen des Systems unter Beweis zu stellen. Aus den Video- und Tonbandprotokollen wurden als Navigationsvariablen Gesamtbearbeitungszeit, Anzahl und durchschnittliche Betrachtungszeit der aufgerufenen Knoten erschlossen. Mit Hilfe einer Clusteranalyse identifizierte McGregor folgende Navigationstypen (S. 196ff.):
- „Sequential studiers“ (= sequentiell Lernende) bewegten sich langsam und auf sequentielle Art durch das System und klickten dabei auf den einzelnen Knoten alle verfügbaren Links entweder von oben nach unten oder von links nach rechts an. Ihre Aufmerksamkeit verteilten sie in etwa gleichmäßig auf alle besuchten Knoten. Sie lasen alle Texte und verfolgten damit offensichtlich das Ziel, die angebotenen Materialien möglichst vollständig zu bearbeiten. In ihren Concept Maps konnten diese Personen zwar die hierarchische Struktur des Hypertexts wiedergeben, ihre Zeichnungen zeigten jedoch nur wenige Querverbindungen zwischen den Inhalten an.
- „Video viewers“ (= Video-Betrachter) waren dagegen vornehmlich an jenen Knoten interessiert, die Bewegungs- oder Tonsequenzen enthielten und verbrachten ca. 83 % der Gesamtbearbeitungszeit auf ihnen. Alle anderen dargebotenen Informationen klickten sie nur kurz an, Texte lasen sie dabei eher nicht. Dass diese Personen die Verbindungen zwischen den Inhalten nicht erfasst hatten, zeigten ihre sehr einfach gestalteten Concept Maps, die auf eine sehr oberflächliche Informationsverarbeitung schließen ließen.
- „Concept connecters“ (= Hersteller von konzeptuellen Verbindungen) wählten selektiv und gezielt einzelne Knoten aus und folgten von diesen aus Querverbindungen zu konzeptuell verwandten Knoten. Die Kommentare der Personen ließen darauf schließen, dass sie versuchten, Verbindungen zu bereits Bekanntem herzustellen, und um eine Integration der neuen Informationen in ihr Vorwissen bemüht waren. Die Concept Maps dieser Gruppe spiegelten ein Vordringen in die tiefsten Schichten des Hypertextes.
Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Navigationstyp und Kontrollüberzeugungen der ProbandInnen, die mit der LOC-Skala von Nowicki und Strickland (1973) erhoben worden waren, ergab, dass sich in der Gruppe der „concept connecters“ (n = 3) nur Personen mit internaler Kontrollüberzeugung, in der Gruppe der „sequentiell studiers“ (n = 3) dagegen nur Personen mit externaler Kontrollüberzeugung befanden (McGregor, 1999, S. 201). Die Ergebnisse dieser Studie erscheinen jedoch aufgrund des sehr kleinen Stichprobenumfangs von nur zehn Personen und der angewandten Methode der nachträglichen Transkription der Videoaufzeichnungen in Logfiles in eher fragwürdigem Licht.
Aufgrund unterschiedlicher Hypertext-Strukturen, Aufgabenstellungen und erhobener Navigationsvariablen sind die Ergebnisse der referierten Studien vermutlich nur eingeschränkt vergleichbar. Dennoch fallen gewisse Gemeinsamkeiten im Navigationsverhalten auf: In jeder der besprochenen Untersuchungen wurde z. B. eine Personengruppe identifiziert, die in erster Linie an den diversen Features und weniger am Inhalt des Hypertextes interessiert erschien und deren Hypertextbearbeitung durch Suche und Nutzung der entsprechenden Angebote charakterisiert ist. Auf dieses Phänomen weisen auch Barab et al. (1997) hin, die in diesem Zusammenhang eine nähere Erforschung von möglicherweise dafür verantwortlichen Personenvariablen wie Motivation und Interesse empfehlen (S. 38).
2.7 Hypertext als Lernmedium
Allgemeine Erwartungen in die Wirksamkeit von Hypertext als Lernmedium gründen sich vor allem auf die Möglichkeit einer vernetzten Repräsentation multicodaler und multimodaler Informationen und des flexiblen, lernerorientierten Zugriffs darauf (Tergan, 2002, S. 105). CC[gp3] Hypertext erleichtert zwei Teilprozesse des Lernens, nämlich Selektion und Organisation von Informationen. Er präsentiert sich dem Lerner aufgrund seiner Beschaffenheit als flexible Informationsquelle, die er seinem aktuellen Informationsbedürfnis bzw. der jeweiligen Aufgabenstellung entsprechend auf unterschiedliche Arten und seinem individuellen Arbeitstempo gemäß nutzen kann (Unz, 2000). Als die wesentlichsten Probleme, die beim Lernen mit Hypertext auftreten können, werden in der Literatur immer wieder Desorientierung und kognitive Überlastung genannt (vgl. z. B. Conklin, 1987; Kuhlen, 1991; Unz, 2000; Tergan, 2002; Blömeke, 2003).
2.7.1 Argumente für Hypertext
2.7.1.1 Kognitive Plausibilität
Ein informationsvermittelndes System gilt dann als „kognitiv plausibel“, wenn von der Repräsentation des Wissens in ihm zur Repräsentation des Wissens im Rezipienten möglichst wenige Umformungsprozesse notwendig sind (Freisler, 1994, S. 43).
Die netzwerkartige Informationsrepräsentation in Hypertext würde der Annahme von der kognitiven Plausibilität zufolge den Wissenserwerb erleichtern, weil sie den assoziativen und schemabasierten Strukturen des menschlichen Gedächtnisses vergleichbar sei und somit vom Lerner, ohne Umweg über die bei papierbasierten Lineartexten notwendige Delinearisierung, mehr oder weniger einfach und direkt in seine eigenen kognitiven Strukturen integriert werden könne (Jonassen, 1986, 1988; Marchionini, 1988; Kuhlen, 1991; Ford & Chen, 2000).
Empirische Befunde haben dies jedoch bislang nicht unterstützen können (Dillon & Gabbard, 1998; Tergan 2002), denn es muss angenommen werden, dass die Art der mentalen Repräsentationen der Knoten in semantischen Netzwerken wesentlich komplizierter ist als bei Hypertext (Rouet, Levonen, Dillon & Spiro, 1996; Blumstengel, 1998). Natürliche Netze sind im Unterschied zu Hypertext-Netzen mehrdimensionaler, da die Verknüpfungen in ihnen auf und zwischen allen Ebenen existieren, und dynamischer, d. h. sie verändern sich mit der Zeit bzw. verfügen über die Eigenschaften des Metawissens und des Vergessens (Freisler, 1994). Eine Gleichsetzung der Hypertextstruktur mit den komplexen Strukturen im menschlichen Gedächtnis erscheint somit als unzulässig. Das Argument der kognitiven Plausibilität von Hypertext sollte daher besonders kritisch hinterfragt (siehe Gerdes, 1997, S. 56ff.) und eher den „pädagogischen Mythen“ über Hypertext zugerechnet werden (Schulmeister, 1996, S. 245).
2.7.1.2 Multimedialität
In Hypertext können Texte, Bilder, Tonsequenzen, etc. miteinander in einem Knoten kombiniert werden. Diese Verwendung unterschiedlicher Codierungsformen bedeutet ein gleichzeitiges Ansprechen mehrerer Sinnesmodalitäten. Der Theorie der dualen Codierung und der Theorie von der Hemisphärenspezifität des Gehirns zufolge wirkt sich das positiv auf das Verstehen der so dargestellten Sachverhalte aus, was zu einer besseren Verankerung und leichteren Abrufbarkeit der gelernten Inhalte führt (Barnes, 1994; Anderon, 1996; Tergan, 2002). Für das Fremdsprachenlernen z. B. konnten Plass, Chun, Mayer und Leutner (2003) dies empirisch nachweisen. In einer Untersuchung, in der politische Texte über das geteilte Deutschland gelernt werden mussten, erzielte die Studentengruppe, der der Lernstoff als multimedialer Hypertext vorgelegt wurde, die besten Ergebnisse im nachfolgenden Wissenstest (Retterer, 1991, zitiert nach Hasebrook, 1995, S. 96).
Andere Befunde zeigen aber, dass der multimediale Charakter von Hypertext nicht notwendigerweise höhere Lernwirksamkeit bedeuten muss. Auffällige Gestaltungsmerkmale lenken die Aufmerksamkeit von Lernern nämlich zum Teil so stark, dass es zur Bildung falscher mentaler Modelle kommen kann (Lowe, 1996, zitiert nach Blömeke, 2003). Die Verarbeitung multipler Codierungsformen erfordert außerdem einen kognitiven Zusatzaufwand vom Lerner, was vor allem bei geringem Vorwissen dazu führen kann, dass potenzielle lernfördernde Effekte nicht zum Tragen kommen können (Tergan, 2002). Eine gleichzeitige Präsentation von z. B. textueller und gesprochener Information kann daher nach dem Redundanzprinzip (= „redundancy principle“, Mayer und Moreno, 2000, zitiert nach Blömeke, 2003, S. 63) auch zur Überforderung der Verarbeitungskapazität des Lerners führen. Mehrere Studien zum Navigationsverhalten (siehe Kapitel 2.6.3.)CC[gp4] haben ergeben, dass multimediale Features die Navigation durch Hypertext massiv beeinflussen und das sogenannte „art museum phenonmenon“ (Carmel et al, S. 865) bewirken können: Der User verbringt zwar viel Zeit im Hypertext-System, lernt aber nichts. Bei Webseiten, die mit vielfältigen Hypermedia-Elementen ausgestattet sind, bewirkt diese Komplexität eher Verwirrung beim User (Wang & Beasley, 2002). Der Einsatz von Bild, Ton und dergleichen sollte daher wohlüberlegt und sparsam erfolgen, um diese „engaging details“ (= Elemente, die den Lerner dazu bewegen sollen, sich aktiv mit dem Inhalt auseinanderzusetzen) nicht zu „seductive details“ (= Elemente, die für den Lerner so attraktiv sind, dass sie ihn von der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff abhalten) (Wade, Schraw, Buxton & Hayes, 1993, zitiert nach Barab et al., 1997, S. 38) werden zu lassen.
Eine aus lerntheoretischer Sicht günstige Gestaltung eines Hypertextes kann möglicherweise dennoch nicht zu einem erwünschten Lernergebnis führen. Das passiert vor allem dann, wenn aufgrund der ansprechenden Gestaltung ein Lerninhalt als so leicht verständlich wahrgenommen wird, dass dem Lerner eine tiefere Auseinandersetzung damit als nicht notwendig erscheint und er der „illusion of knowing“ (Blömeke, 2003, S. 70) erliegt.
2.7.1.3 Kognitive Flexibilität
Ein weiteres Argument für die Eignung von Hypertext als Lernmedium ergibt sich aus der Kognitiven Flexibilitätstheorie (Spiro & Jehng, 1990; Spiro, Collins, Thota & Feltovich, 2003), die sich mit dem Wissenserwerb in komplexen und wenig strukturierten Bereichen auseinandersetzt. In fortgeschrittenen Stadien des Wissenserwerbs sieht sich der Lernende mit Inhalten von hoher Komplexität konfrontiert. Ihre Bewältigung erfordert kognitive Flexibilität, d. h. die Fähigkeit zur spontanen Rekonstruktion des eigenen Wissens auf viele Arten in adaptiver Antwort auf sich ständig ändernde Anforderungen innerhalb von Situationen und über Situationen hinweg (Spiro & Jehng, S. 165). Dafür braucht es Lernumgebungen, die den Lerner mit der Komplexität und Irregularität von Sachverhalten vertraut machen, Übervereinfachungen vermeiden und Konzepte in verschiedenen Kontexten unter verschiedenen Zielsetzungen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Hypertexte, deren Design diesem sogenannten „criss-crossed landscape approach“ (Spiro et al., 2003, S. 6) entspricht, sollen multidirektionales und multiperspektivisches Lernen ermöglichen und gewährleisten, dass das auf solche Art erworbene facettenreiche Wissen flexibel angewandt werden kann. Anhand eines Prototypen, der Aspekte der multithematischen Struktur des Films „Citizen Kane“ von Orson Welles lehrte, beschrieben Spiro und Jehng (1990) die Eignung eines nach den Forderungen der Kognitiven Flexibilitätstheorie konstruierten Hypertextes für komplexes Lernen. Eine nachfolgende empirische Untersuchung mit einem Hypertext über den Einfluss von Technologie auf Gesellschaft und Kultur des 20. Jahrhunderts ergab bessere Leistungen der Versuchsgruppe bei Transferaufgaben. Hinsichtlich des Behaltens von Faktenwissen war jedoch die Kontrollgruppe überlegen (Jacobson & Spiro, 1995).
2.7.1.4 Lernerkontrolle
Eines der klassischen Argumente für Hypertext als Lernmedium ist das hohe Ausmaß an Lernerkontrolle, das er ermöglicht. Unter Lernerkontrolle versteht man den Grad, in dem ein Lerner seinen Lernprozess selbst steuern kann (Milheim & Azbell, 1988, zitiert nach Wang & Beasley, 2002, S. 75), d. h. inwieweit ihm selbst die Kontrolle über Lerngeschwindigkeit, Selektion und Sequenzierung der Lerninhalte überlassen ist (Reigeluth & Stein, 1983, zitiert nach Wang & Beasley, 2002, S. 75) Im Unterschied zu anderen Lernmedien, wie z. B. herkömmlichen Computer-Lernprogrammen, bietet Hypertext in der Regel diesbezüglich wesentlich mehr Optionen, ist offener und weniger direktiv und ermöglicht damit selbstgesteuertes Lernen (vgl. Gall & Hannafin, 1994; Gerdes, 1999). Damit erscheint eine wesentliche Forderung der konstruktivistisch orientierten Instruktionspsychologie erfüllt: Es sollen Lernbedingungen geschaffen werden, in denen der Lernstoff nicht in fixfertiger Form vorgegeben und passiv rezipiert wird, sondern der Lerner soll die Möglichkeit erhalten, aktiv Bedeutung zu konstruieren (Schulmeister, 1996).
Obwohl die Ergebnisse vieler empirischer Studien ein widersprüchliches Bild bieten, was darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die Effektivität des Lernens nicht allein vom Grad der Lernerkontrolle abhängt, sondern verschiedene andere personeninterne und externe Faktoren, wie Lernertyp und Lernbedingungen, eine Rolle spielen (Wang & Beasley, 2002), wird Lernerkontrolle allgemein dennoch als sehr wichtig für effektives Lernen erachtet (Dillon & Gabbard, 1998). Es wird angenommen, dass sie nicht nur zu besseren Lernergebnissen, höherer Kompetenz und schnellerem Lernen führen kann, sondern auch zu einer positiveren Einstellung dem Lerngegenstand gegenüber. Dadurch, dass der Lerner mehr Selbstbestimmtheit erlebt, wird seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung gestärkt, was sich auf sein künftiges Lernen günstig auswirkt (Lawless & Brown, 1997). Lernumgebungen, in denen ein Lerner aufgrund von Lernerkontrolle Autonomie erlebt, bewirken eine Steigerung der intrinsischen Motivation, der Kreativität und des Selbstvertrauens. Die Erfahrung von weniger Druck und Anspannung als in sehr direktiven Lernumgebungen wirkt sich letztlich auch positiv auf seine psychische und physische Gesundheit aus (Deci & Ryan, 1987).
Lernerkontrolle bedeutet, dass der Lerner aktiv handelnd in das Lerngeschehen einbezogen wird, sich als selbstverantwortlicher Initiator von Veränderungen in seiner Lernumgebung erlebt und dabei, unter der Voraussetzung von Interesse am Lerngegenstand, einem hohen subjektiven Wert, den dieser Lerngegenstand für die Person darstellt, und der Überzeugung, sein Handeln und die zugehörigen Umgebungsbedingungen kontrollieren zu können bzw. über entsprechende Kompetenz zu verfügen, in so hohem Maß in die Lernsituation involviert werden kann, dass Flow-Erleben, ein Gefühl des völligen Absorbiertwerdens und Aufgehens im Handlungsablauf, möglich wird (Mandl & Hron, 1989; Konrad, 1993). Eine Untersuchung der Gründe, warum sich Jugendliche mit Computern beschäftigen, ergab übereinstimmend mit den Kerngedanken des Flow-Konzepts, einen engen Zusammenhang zwischen Zeitaufwand, Interesse und Anstrengung am PC mit Kontrollwahrnehmung und tätigkeitszentrierten Anreizen und zeigte, dass Kontrollüberzeugungen und Kompentenzerwartungen eng mit der „Freude am Tun“ im Sinne der Flow-Theorie verbunden sind (Konrad, 1993). Dass Lernen mit Hypermedia bei Personen positive affektive Zustände auslösen kann, konnten Konradt, Filip und Hoffmann (2003) nachweisen: Ca. ein Viertel ihrer 66 ProbandInnen gab nach der einstündigen Bearbeitung eines Hypermedia-Lernprogramms über Management by Objectives (= Managementkonzept, das die Zielsetzungstheorie anwendet) an, Flow erlebt zu haben. Die positive Stimmung korrelierte außerdem mit höheren Wissensergebnissen.
Der Ausspruch „leave them alone and they will learn on their own“ (Merrill, 1990, zitiert nach Grabowski & Small, 1997, S. 161) hat sich in zahlreichen Untersuchungen jedoch als Trugschluss erwiesen, denn nicht alle Personen können gleich gut mit Hypertext lernen. Um die als Folge der höheren Lernerkontrolle beim Wissenserwerb mit Hypertext laufend notwendigen Entscheidungen treffen zu können, braucht der Lerner die Fähigkeit, sein Navigationsverhalten zu strukturieren und selbstgesteuert durchzuführen (Ford & Chen, 2000). Vor allem Lernende mit geringem Vorwissen (vgl. Marchionini & Shneiderman, 1988; Dillon & Gabbard, 1998; Wang & Beasley, 2002), aber auch Personen, die nicht über effektive Strategien bzw. ausreichende Selbstregulationskompetenz verfügen (Steinberg, 1989, zitiert nach Barab et al., 1997, S. 25), können dabei überfordert sein. Außerdem sollte bedacht werden: Je mehr Freiheit eine Lernumgebung einem Lerner lässt, desto größer wird auch seine Freiheit, sich nicht besonders beim Lernen zu engagieren (Salomon, Perkins & Globerson, zitiert nach Barab et al., 1997, S. 25).
2.7.1.5 Entdeckendes und inzidentielles Lernen
Wird in der Literatur gelegentlich zwischen „entdeckendem Lernen“ und „explorativem Lernen“ unterschieden (vgl. Gerdes, 1997, S. 53), so meinen beide Begriffe im Grunde dasselbe. Die Bezeichnung „exploratives Lernen“ legt den Fokus eher auf den Weg, die Bezeichnung „entdeckendes Lernen“ eher auf das Ergebnis. Entdeckendes Lernen kann nach Heller (1990) vor allem in Lernumgebungen wie Hypertext erfolgen, wo dem Lerner eine Fülle an Möglichkeiten zur selbstkontrollierten Exploration von Alternativen und Ergebnissen geboten wird, die ihn bislang noch nicht erkannte Zusammenhänge wahrnehmen und verstehen lassen. Hypertextknoten und ihre Links haben hohen auffordernden Charakter, denn sie verlocken geradezu zum Anklicken und damit zum Erforschen der Hypertextbasis. Im Zuge der Exploration, die ein Aktiverwerden des Lernenden als z. B. die Bearbeitung eines traditionellen Lehrbuches erfordert, wird Wissen angesammelt, das dem Lerner einerseits hilft, die aktuelle Aufgabenstellung zu bewältigen, das andererseits aber auch neue Fragen aufwerfen kann, zu deren Beantwortung weiteres Erforschen des Netzwerkes notwendig wird. Dieser selbst-perpetuierende Prozess wird durch Interesse bzw. Neugierde in Gang gehalten (vgl. Kuhlen, 1991). Dass das aktive Erarbeiten eines Lernstoffs mit positiveren Gefühlen verbunden ist und dass ein Lerninhalt, der aktiv erarbeitet wurde, besser behalten werden kann, ist pädagogisches Allgemeinwissen (vgl. Unz, 2000).
Bei der Verfolgung von interessant erscheinenden Links stößt der Lerner häufig aber nicht nur auf Inhalte, die er zur Lösung der aktuellen Aufgabe benötigt. Vor allem in Hypertexten mit größerem Umfang wird ein Lernender so manche Information finden, nach der er ursprünglich gar nicht gesucht hat, die ihm aber dennoch merkenswert erscheint. Heller definiert diese Form des eher zufälligen Lernes als ungeplantes Lernen, das in einer Lernumgebung stattfindet, die eigentlich andere explizit festgelegte Lernziele unterstützen soll (Heller, 1990, S. 434).
Da Hypertext eine elaborierte Präsentation von Konzepten und ihren Beziehungen zueinander erlaubt, dürfte er in besonderem Maße für inzidentielles Lernen geeignet sein (Jones, 1989). Auch Gall und Hannafin (1994) vermuten, dass Hypertexte eher für entdeckendes und inzidentielles als für ergebnisorientiertes Lernen geeignet sind, weisen aber darauf hin, dass es unklar ist, ob das am Hypertext per se liegt oder am Umstand, dass Hypertext für direktives Lernen noch nicht erfolgreich adaptiert werden konnte (S. 224).
Ob entdeckend und/oder inzidentiell gelernt werden kann, hängt aber nicht nur vom Lernmedium ab, sondern auch von der Person des Lerners. Heller (1990) nimmt an, dass sich entdeckendes Lernen vor allem für Personen mit wenig Lernangst und der Fähigkeit zur Selbststeuerung ihrer Lernprozesse eignet. Dixon und Cameron (1975) konnten nachweisen, dass hochmotivierte Personen bei inzidentiellen Lernaufgaben bessere Ergebnisse erbringen, vermutete Zusammenhänge mit dem LOC (= „locus of control“, Kontrollüberzeugungen) konnten dagegen nicht bestätigt werden. Wolk und DuCette (1974) untersuchten in zwei Studien den Zusammenhang zwischen Kontrollüberzeugungen und inzidentiellem Lernen: Die Personen mussten vordergründig Texte nach Schreibfehlern durchsuchen, erfasst wurde aber, wie viel sie vom Inhalt des Textes behalten hatten. Nach dem ROT-IE als internal Eingestufte zeigten sich bei diesen inzidentiellen Lernaufgaben den Externalen überlegen. Auch bei Dollinger (2000) erzielten in einer von drei Studien zum LOC und inzidentiellem Lernen internale Studenten – zur Erfassung des LOC wurde hier die IPC-Skala von Levenson eingesetzt – bessere Ergebnisse: In einem Wissenstest, in dem neben Inhalten der Persönlichkeitspsychologie auch lernstoffirrelevante Details, wie Kurszeiten, Sprechstundentermine und Einzelheiten des Prüfungsprocedere abgefragt wurden, lagen die Scores der internalen ProbandInnen signifikant über denen der externalen.
2.7.2 Argumente gegen Hypertext
2.7.2.1 Desorientierung
Orientierungsprobleme können in Hypertext in zweifacher Hinsicht auftreten: bezogen auf die Navigation als „getting lost in space“ (Conklin, 1987, S. 38) und/oder als konzeptuelle Desorientierung und zeigen sich in einem zu hohen Tempo beim Durchgehen des Hypertextes, in unsystematischer Bearbeitung der Inhalte und einer „Flucht in Details“, bei der wesentliche Zusammenhänge aus den Augen verloren werden (Blömeke, 2003, S. 72).
Lost in Hyperspace:
Diese hypertextspezifische Form der Desorientierung äußert sich nach Unz (2000, S. 39) und Gerdes (1999, S. 204) unter anderem darin, dass der User nicht mehr weiß
- wo genau im Hypertext er sich gerade befindet,
- wie er zu einer bestimmten Information gelangen kann, von der er weiß oder vermutet, dass sie im Hypertext enthalten ist,
- wie er zu einer bestimmten Stelle im Hypertext zurückfinden soll,
und tritt vor allem dann auf, wenn ein Hypertext sehr umfangreich ist, eine komplexe Struktur aufweist und seine Bearbeitung durch den User mehr durch assoziatives als durch zielorientiertes Vorgehen gekennzeichnet ist (vgl. z. B. Tergan, 2002). Ursachen dafür können aber auch das Fehlen entsprechender Navigationstools, eine unzureichende Aufklärung des Users über ihm zur Verfügung stehende Navigationshilfen oder Unkenntnis ihrer Bedienung sein (Dünser, 2000). Dem User ist es damit nicht möglich, eine adäquate mentale Repräsentation von der Organisationsstruktur des Hypertextes auszubilden, was sein Informationssuch- bzw. Lernergebnis vermutlich massiv beeinträchtigen wird. Als wichtiges Indiz für das Auftreten von Desorientierung betrachten Möller & Müller-Kalthoff (2000) Fehleinschätzungen des Hypertext-Umfangs durch den Leser. Während Altun (2000) die Meinung vertritt, dass Lost in Hyperspace in Wirklichkeit gar kein so großes Problem darstelle, weil als häufigste Navigationshilfe ohnehin der Back-Button des Browsers verwendet werde (S. 49), ist Unz (2000) der Ansicht, ein geringes Ausmaß an Desorientierung habe auch Vorteile, weil es neugierig mache und damit das explorative Verhalten fördere (S. 40).
Konzeptuelle Desorientierung
Mangelndes Vorwissen und/oder fehlende Hinweise auf die Relevanz bestimmter Inhalte für die jeweilige Aufgabenstellung können die kognitive Orientierung des Lerners innerhalb der im Hypertext dargestellten Sachstruktur erschweren. Vor allem im Zuge des assoziativen Browsings kann es dazu kommen, dass die semantische Bedeutung der aufgesuchten Informationen nicht erkannt wird oder dass semantische Beziehungen zwischen Knoten unklar bleiben, sodass der User keine klare Vorstellung davon hat, auf welche Knoten er als nächstes zugreifen soll. Dadurch ist er in der Folge nicht in der Lage, die gelesenen Informationen in seine Wissensstruktur zu integrieren bzw. eine kohärente Wissensrepräsentation aufzubauen (Tergan, 2002).
2.7.2.2 Kognitive Überlastung
Effektives Lernen mit Hypertext erfordert im Unterschied zur Bearbeitung eines Lineartextes auf Papier zusätzlichen mentalen Aufwand: Der Lernende muss sich merken, welche Knoten er schon gelesen hat und wie er dorthin gekommen ist, um sie gegebenenfalls ein weiteres Mal zu besuchen, er muss Links, die zu anderen ihm wichtig erscheinenden Informationen führen, und ihre Positionen im Gedächtnis behalten, um ihnen zu einem späteren Zeitpunkt folgen zu können, und schließlich muss er diverse Navigationstools und ihre Funktionen geistig präsent halten. Daneben müssen Navigationsentscheidungen getroffen und Knoteninhalte aufgenommen werden. Diese simultanen Aufgaben erfordern erhöhte Gedächtniskapazität, Konzentration und Fähigkeiten zur metakognitiven Kontrolle und können zu kognitiver Überbelastung („cognitive overhead“, Conklin, 1987, S. 40) führen, die eine tiefere Informationsverarbeitung verhindert und mit der eigentlichen Anforderung, wie dem Auffinden und Lernen von Informationen, interferiert (Gerdes, 1999; Unz, 2000; Tergan, 2002). Nahezu paradox erscheint dabei, dass gerade jene Features, die den User beim Wissenserwerb mit Hypertext unterstützen sollen, wie Navigationshilfen und multimediale Elemente, häufig eine Quelle von kognitiver Überlast darstellen und damit die Gefahr bergen, Hypertext für manche Personen zu „Hyperchaos“ werden zu lassen (Marchionini, 1988, S. 10).
2.8 Personeninterne Einflussfaktoren
Um die Rolle von Hypertext im Zusammenhang mit Wissenserwerb erklären zu können, wurden verschiedene strukturelle Rahmenmodelle, z. B. von Gall und Hannafin (1994), Marchionini (1995) und Unz (2000), entwickelt, in denen Komponenten beschrieben und unterschiedlich gewichtet werden, die die Bearbeitung von Hypertext beeinflussen. Gemeinsam ist diesen Modellen, dass neben externen Faktoren, wie Merkmalen des Hypertexts, der Aufgabe und der Lernsituation, den internen Faktoren, wie z. B. Fähigkeiten, Wissen, Interesse und Einstellungen, die auf komplexe Weise zusammenhängen, zentrale Bedeutung zugesprochen wird, da der Lernende aufgrund dieser Merkmale seine Navigation durch Hypertext und damit seinen Wissenserwerbsprozess individuell steuert und gestaltet.
2.8.1 Geschlecht
Eine Reihe von Studien untersucht neben verschiedenen anderen Einflussfaktoren, ob sich Männer und Frauen im Umgang mit Hypertext bzw. Hyper- und Multimedia unterscheiden. Die zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse führen Unz und Hesse (1999) darauf zurück, dass das Geschlecht meist mit bedeutenderen Faktoren, wie z. B. Computererfahrung, konfundiert ist. Die Tatsache, dass Computer und Internet und mit ihnen auch Hypertext mehr und mehr zentrale und periphere Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens durchdringen, wirft natürlich auch die Frage auf, inwiefern die Ergebnisse zu Geschlechtsunterschieden von Studien, die vor einigen Jahren durchgeführt wurden, in Folge sehr kurzer Halbwertszeiten der gewonnenen Erkenntnisse heute überhaupt noch aktuell sind.
Beasley und Vila (1992) gaben über 100 StudentInnen eines Einführungskurses in Computerwissenschaften eine multimediale Unterrichtseinheit zum Thema Multimedia-Technologie vor und erfassten dabei, wann und zu welchen Knoten gewechselt wurde. Die ProbandInnen konnten diese Einheit entweder linear oder in Form von Modulen, über die mittels einer grafischen Übersicht zugegriffen werden konnte, bearbeiten. Die Analyse der Beziehung zwischen Navigationsverhalten und Geschlecht zeigte für Frauen eine linearere Vorgangsweise, während Männer eher zu einer explorativen Annäherung an das Lernmaterial neigten. Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass dieses signifikante Ergebnis (F = 3.12, p = .0803) offensichtlich darauf zurückzuführen ist, dass die Autoren eine relative hohe Irrtumswahrscheinlichkeit von a = .10 annahmen, was sie mit einer Empfehlung von Borg und Gall (1989) für explorative Studien begründeten (S. 213).
Auch Qiu (1993a) konnte signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern nachweisen. 61 Studenten der Informatik und Bibliothekswissenschaft mussten in einem umfangreichen Hypertext über Hypertext allgemeine Informationen und Antworten auf spezielle Fragen (z. B. über Arten von Links und optimale Knotengrößen) mittels Schlagwörter oder Browsen suchen. Männer bedienten sich dabei signifikant mehr der Schlagwortsuche, während Frauen die Aufgaben durch Browsen lösten und dabei einzelne Knoten signifikant öfter aufriefen (cP2P = 365.50, p < .01) (S. 422). Eine zweite von Qiu (1993b) durchgeführte Untersuchung konnte dieses Ergebnis nicht replizieren: An Stelle erwarteter signifikanter Haupteffekte des Geschlechts traten Wechselwirkungseffekte zwischen Geschlecht und Sucherfahrung auf.
Small und Grabowski (1992) konnten in ihrer Untersuchung an nur 12 Personen, die einen Hypertext über die Präsidentenwahlen von 1988 in den USA lernen mussten, keinen Einfluss des Geschlechts ihrer ProbandInnen auf den Umgang und die Art des Lernens mit dem System nachweisen.
An einer ebenfalls sehr kleinen Stichprobe von 18 StudentInnen eines Einführungskurses zum Einsatz vom PC im Unterricht untersuchten Reed und Oughton (1997) lineare und nicht-lineare Navigation in einem Hypermedia-System über Kunst, Musik, Naturwissenschaften, Literatur, Geschichte und Sport im Amerika der 60er Jahre. Die Gesamtbearbeitungszeit des Hypertexts durch die Personen wurde dabei in drei gleich große Abschnitte geteilt, um zu überprüfen, ob und wie sich das Navigationsverhalten mit der Zeit verändert. Im ersten Zeitintervall navigierten Frauen linearer als Männer (T = 2.207, p = .05), in späteren Intervallen trat dieser Unterschied nicht mehr zu Tage (S. 46).
Die Ergebnisse einer Metaanalyse von Whitley (1997), die sich zwar nicht speziell mit Hypertext, sondern mit der Computernutzung insgesamt beschäftigt, können vermutlich auf den Umgang mit Hypertext übertragen werden, weil Hypertext ja letztlich nur auf dem Computer realisierbar ist. Der Vergleich von 82 Studien aus den USA und Canada zu Geschlechtsunterschieden in computerbezogenen Einstellungen und computerbezogenem Verhalten ergab, dass Frauen dem PC gegenüber weniger positiv eingestellt sind, sich weniger für Computer interessieren, diese weniger nutzen und daher über geringere Vorerfahrung verfügen. Außerdem haben Frauen weniger Vertrauen in ihre Fähigkeiten am PC (Whitley, 1997; zitiert nach Dickhäuser, 2001, S. 18).
2.8.2 Fähigkeiten
Da fast jede menschliche Aktivität von Intelligenz beeinflusst wird, ist dies auch für die Bearbeitung eines Hypertextes zu erwarten. Dillon und Gabbard (1998) ziehen aus den Ergebnissen von 25 Studien zum Lernen mit Hypertext den Schluss, dass Intelligenz bei den meisten Aufgabenstellungen der beste Prädiktor für Leistung ist. So erwiesen sich z. B. in der Untersuchung von Recker und Pirolli (1995, zitiert nach Dillon & Gabbard, 1998, S. 339) in der mittels eines Hypertextes die Programmiersprache Lisp erlernt werden sollte, jene Lerner, die über hohe kognitive Fähigkeiten verfügten, anderen als überlegen. Dillon und Gabbard nehmen an, dass Lerner mit niedrigeren kognitiven Fähigkeiten in dieser Untersuchung durch die höhere Lernerkontrolle überfordert waren. Dennoch erachten sie Hypertext auch für Personen mit weniger hohem kognitivem Leistungsvermögen als vorteilhaft, wenn ihnen durch ein entsprechendes Design zusätzliche Hilfestellungen angeboten werden. Generell vermuten sie aber doch, dass Lerner mit höheren Fähigkeiten immer bessere Leistungen erbringen werden, egal welchen Lernmediums sie sich bedienen (Dillon & Gabbard, 1998, S. 344).
Die Bedeutung von logischem Schließen, das vermutlich das Erkennen von Zusammenhängen und Treffen von Auswahlentscheidungen unterstützt, ist für den Wissenserwerb in computergestützten Informationssystemen seit langem bekannt (Marchionini, 1995, S. 62), im Zusammenhang mit Hypertext fand diese Fähigkeit in den empirischen Studien bislang wenig Beachtung (Unz, 2000, S. 63).
Eine Metaanalyse von Chen und Rada (1996) zu 23 experimentellen Studien über Hypertext zeigte uneinheitliche Ergebnisse hinsichtlich des Raumvorstellungsvermögens: Während in einer Untersuchung von Vincente und Williges (1988; zitiert nach Chen & Rada, 1996, S. 129) Personen mit hohem Raumvorstellungsvermögen die gestellten Aufgaben schneller bewältigen konnten, wirkte sich bei Leidig (1992; zitiert nach Chen & Rada, 1996, S. 130) das Raumvorstellungsvermögen nicht auf die Güte der Leistungen aus, gute RaumvorstellerInnen beurteilten jedoch den dargebotenen Hypertext positiver. Campagnoni und Ehrlich (1989; zitiert nach Chen & Rada, 1996, S. 130) stellten fest, dass Personen mit gutem Visualisierungsvermögen das in ihrer Untersuchung ständig oberhalb des Hypertext sichtbare Inhaltsverzeichnis weniger nutzten, und schließen daraus, dass gutes Visualisierungsvermögen das Erlernen der Hypertextstruktur erleichtere. Hohes Raumvorstellungsvermögen, aktiver Lernstil und internale Kontrollüberzeugung werden in der Metaanalyse von Chen und Rada (1996) als aktive kognitive Merkmale zusammengefasst. Eine erwartete Auswirkung dieser Variable auf die in den einzelnen Studien erhobenen Effektivitäts- und Effizienzmaße konnte allerdings nicht bestätigt werden.
Inwiefern höhere verbale Fähigkeiten bessere Ergebnisse bei der Bearbeitung von Hypertext bedingen, erscheint unklar. Plass, Chun, Mayer und Leutner (2003) konnten im Rahmen ihrer Untersuchung an 152 englischsprachigen Studenten an drei amerikanischen Universitäten über die Auswirkungen von visuellen und verbalen Worterklärung beim Lernen eines fremdsprachigen Hypertexts auf Textverständnis und Vokabellernleistung zwar einen empirischen Beweis dafür erbringen, dass höhere verbale Fähigkeiten beim Hypertext-Lernen zu besseren Verständnisleistungen führen, bei Reynold und Danserau (1990; zitiert nach Unz & Hesse, 1999, S. 283) beeinflussten verbale Fähigkeiten die Interaktion mit Hypertext jedoch nicht. Auch bei Westerman, Davies, Glendon, Stammers und Matthews (1995) hatten unterschiedlich hohe verbale Fähigkeiten keinen Einfluss auf die Bearbeitung von Hypertexten mit unterschiedlichen Strukturen. In dieser experimentellen Studie, in der zwei Personengruppen (18-24Jährige vs. 45-57Jährige) in linear, hierarchisch und vernetzt strukturierten Hypertexten mit Hilfe eines eigenen Menus oder von Links nach Informationen über tropische Fische suchen mussten, wobei die Zeitdauer bis zum Finden der Lösungen und die Anzahl der richtigen Antworten erfasst und als Maß für die Navigation das Verhältnis von angeklickten Links und für die Lösung der Aufgabe optimaler Linkanzahl berechnet wurde, lösten Personen mit besserer Merkfähigkeit und höheren Werten im logischen Schließen die gestellten Aufgaben schneller. Ältere Personen arbeiteten zwar langsamer, unterschieden sich aber nur hinsichtlich der verbalen Fähigkeiten, die sich jedoch, wie bereits erwähnt nicht auf die Leistungen auswirkten, von den jüngeren. Hinsichtlich der unterschiedlichen Hypertextstrukturen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Personengruppen.
Für selbstständiges Lernen sind nach Simons (1992, S. 254) folgende Fähigkeiten notwendig: Der Lernende muss das Lernen selbst vorbereiten, die erforderlichen Lernschritte ausführen, sein Lernen überwachen und kontrollieren, sich selbst Rückmeldungen über seine Fortschritte geben und auswerten, sich motivieren und die Aufmerksamkeit während des Lernprozesses aufrechterhalten können. Metakognitive und selbstregulative Fähigkeiten ermöglichen Reflexion und Kontrolle der eigenen Denkprozesse und den gezielten Einsatz von kognitiven Strategien, sind aber nicht bei allen Menschen gleich gut ausgeprägt (McKnight, Dillon & Richardson, 1990, S. 288). Zimmerman und Martinez-Pons (1990) untersuchten an SchülerInnen der 5. bis 8. Schulstufe einer Begabten- und einer Regelschule in New York die Verwendung von insgesamt 14 Strategien des selbstgesteuerten Lernens, darunter den Einsatz von Strategien zur Zielsetzung, Organisation, Strukturierung und Optimierung der Informationssuche, und konnten dabei den Nachweis für einen Zusammenhang von höheren intellektuellen Fähigkeiten mit vermehrtem Einsatz solcher Strategien erbringen. Höhere Begabung ging überdies mit höherer Selbstwirksamkeit (r = .59) einher (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990, S. 57).
2.8.3 Vorwissen, Erfahrung und Einstellungen
Hinsichtlich des Vorwissens einer Person wird in der Literatur unterschieden zwischen Vorwissen über das im Hypertext behandelte Thema (= fachinhaltliches bzw. domänenspezifisches Vorwissen) und Vorkenntnissen im Umgang mit dem Medium Hypertext (= informationsnetztechnisches Vorwissen).
2.8.3.1 Domänenspezifisches Vorwissen
Vorwissen ist eine wesentliche Bedingung des Verstehensprozesses, denn ein Leser/Lerner wird einen Text nicht sinnvoll verarbeiten können, wenn er nicht über adäquate Wissensstrukturen bzw. Schemata für den Inhalt dieses Textes verfügt (Ballstaedt, Mandl, Schnotz & Tergan, 1981). Schemata sind strukturierte Netzwerke des Vorwissens. Sie enthalten einerseits jene Verbindungen, die zu einem bestimmten Thema bereits hergestellt wurden, andererseits aber auch Lücken, d. h. fehlendes Wissen (Norman, 1982, zitiert nach Gall & Hannafin, 1994, S. 221). Bei Personen mit Vorwissen ist der Wissensbedarf a priori definiert, sie können daher leichter schemabestimmte Auswahlen treffen. Die themabezogenen Schemata erleichtern die Integration des neuen Wissens und dienen als Strukturhilfe beim Erinnern. Kein Vorwissen dagegen bedeutet, dass Schemata zur inhaltlichen Organisation des Lernens fehlen. Der Weg, den eine Person ohne oder mit geringem Vorwissen durch einen Hypertext nimmt, bleibt der Anreizstruktur der Lernumgebung und/oder dem Zufall überlassen. Dabei werden in erster Linie Strukturvorgaben wie Menus oder Weiter-Buttons genutzt, Links im Text werden eher nicht wahrgenommen (Brenstein, 1996).
Lerner mit geringem Vorwissen brauchen Strukturierungshilfen. Möller und Müller-Kalthoff (2000) untersuchten an einer Stichprobe von 56 Studenten den Zusammenhang zwischen domänenspezifischen Vorwissen und dem Vorhandensein von Strukturinformationen bzw. deren Auswirkungen auf die Lernleistung mit einem hierarchisch strukturierten Hypertext über Gedächtnispsychologie. Personen mit niedrigem Vorwissen erwarben mehr Faktenwissen als Personen mit hohem Vorwissen, wenn ihnen eine Navigationsübersicht zur Verfügung stand. Zu viele Navigationshilfen und Wahlmöglichkeiten können bei Personen mit niedrigem Vorwissen aber auch zu Orientierungs- und Lernproblemen führen (Shin, Schallert & Savenye, 1994).
Während sich bei geringem Vorwissen das primäre Bemühen darauf richtet, die lineare Argumentationsabfolge eines Hypertextes zu verstehen, ist eine Person mit hohem Vorwissen in Stande, die Wichtigkeit einzelner Textteile abzuschätzen und Knoteninhalte semantisch zu verknüpfen (Blömeke, 2003). Je mehr Vorwissen eine Person hat, desto mehr beinhaltet ihr Lernprozess die Suche nach noch unbekannten Inhalten (Gerdes, 1999). Das könnte aber auch bedeuten, dass insgesamt weniger Material durchgearbeitet wird, weil der Lerner aufgrund seines Vorwissens sehr selektiv vorgeht und nur jene Bereiche auswählt, die seinen Wissenslücken entsprechen (Brenstein, 1996). Die Ergebnisse von Hasebrook und Glowalla (1995) scheinen dies zu bestätigen: Personen mit hohem Vorwissen „springen“ mehr durch einen Hypertext, während Personen mit niedrigem Vorwissen zum „Blättern“ tendieren (Hasebrook, 1995). Allerdings ergab eine Untersuchung von Small und Grabowsi (1992), dass Personen mit hohem Vorwissen nicht nach unbekannten Inhalten suchten, sondern vielmehr jene Inhalte aufriefen, die einen hohen Bekanntheitsgrad hatten.
Dass die Befundlage zum Navigationsverhalten von Personen mit unterschiedlichem domänenspezifischem Vorwissen eher uneindeutig ist, zeigen zwei weitere Studien: Während bei McGregor (1999) Lerner mit höherem Vorwissen ein zielbewussteres Navigationsverhalten an den Tag legten und dabei ihre Zeit variabler auf verschiedene informative Knoten verteilten, konnten Calisir und Gurel (2003) keine Unterschiede im Navigationsverhalten nachweisen. Sie untersuchten an 30 Studenten der Technischen Universität Istanbul den Einfluss von Hypertextstruktur und Vorwissen auf Leseverständnis, Navigation und wahrgenommene Kontrolle und verwendeten in ihren drei Untersuchungsbedingungen einen Hypertext über Produktivitätsmanagement mit linearer, hierarchischer und gemischter Struktur. Die Probanden hatten die Aufgabe, in 40 Minuten möglichst viel vom Text zu lesen, um danach Fragen zum Textverständnis und zur wahrgenommenen Kontrolle zu beantworten. Personen mit Vorwissen erbrachten in der linearen und der hierarchischen Bedingung bessere Verständnisleistungen, Personen ohne Vorwissen schnitten in der linearen Bedingung wesentlich schlechter ab als mit dem hierarchisch-strukturierten Hypertext. Die Autoren schließen daraus, dass eine hierarchische Struktur für Personen ohne Vorwissen am geeignetsten ist, weil sie klaren Einblick in die Organisationsstruktur des Lernstoffs ermöglicht. Die Erwartung, dass in der gemischten Struktur die wahrgenommene Kontrolle am höchsten sei, bestätigte sich nicht.
2.8.3.2 Erfahrung im Umgang mit Computer und Hypertext
Dem Information-Retrieval-Modell von Marchionini und Shneiderman (1988) zufolge hängt erfolgreiches Auffinden von Informationen in einem Hypertext nicht nur von der Aufgabenstellung und dem System selbst ab, sondern auch vom mentalen Modell, der kognitiven Repräsentation der Entitäten und ihrer Relationen, die der User aufgrund seines Umgangs mit Hypertext ausbildet. Im Laufe der Zeit sammelt ein User verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Informationsnetzen und entwickelt dabei Strategien, die er in neuen Situationen, also bei ihm noch unbekannten Hypertexten anwendet. Personen mit geringer Erfahrung haben weniger mentale Modelle zur Verfügung als Hypertexterfahrene. Deshalb sollte ein Hypertext-Interface so gestaltet sein, dass es einen Neuling weder verwirrt noch frustriert, sondern Erfolgserlebnisse ermöglicht. Führen erste Erfahrungen mit Hypertext zu uneindeutigen mentalen Modellen, so sind nicht nur Schwierigkeiten des Users beim künftigen Gebrauch dieses speziellen Hypertextes zu erwarten. Es können negative Einstellungen entstehen, die den User weitere Erfahrungen mit dem Medium Hypertext vermeiden lassen.
Zunehmende Erfahrung mit Hypertext bewirkt eine Veränderung des Navigationsverhaltens: Während sich Anfänger bei der Navigation an vorgegebenen Strukturen orientieren, nehmen Geübte direktere Wege zur gesuchten Information (Leventhal, 1997). Auch Kim (2001) konnte nachweisen, dass Personen mit höherer Erfahrung bei der Bearbeitung eines Hypertextes mehr „springen“. Bei Personen mit wenig oder keiner Erfahrung zeigen sich außerdem Auswirkungen der kognitiven Stile auf das Navigationsverhaltens: Feldabhängige brauchen mehr Zeit, rufen mehr Knoten auf und gehen öfter zur Startseite zurück. Ein unterschiedliches Ausmaß an Erfahrung mit Computern und Hypertexten wirkte sich auch bei Reed und Oughton (1997) auf die Navigation aus: Personen, die angaben, den Computer vor allem zum Schreiben zu nutzen, zeigten eher lineare, Hypertexterfahrene dagegen durchgehend nicht-lineare Navigationsmuster.
2.8.3.3 Hypertext-Literacy
Nach der Theorie zur Beziehung von Medien, Kognition und Lernen von Salomon (1994) übt jedes Medium, das bestimmte Symbolsysteme verwendet, spezifische Effekte darauf aus, wie Wissen extrahiert und Bedeutungen konstruiert werden. Symbolsysteme, d. h. die Art und Weise, wie die Informationen strukturiert und präsentiert werden, unterscheiden sich voneinander hinsichtlich des Ausmaßes an Verarbeitung, das sie erfordern, und durch die Art der mentalen Prozesse, die sie ansprechen. Da aus Büchern erworbenes Wissen über Textstrukturen nicht unbedingt auf Hypertext angewandt werden kann, stellt Unz (2000) die Frage, ob man für den Umgang mit Hypertext eine bestimmte Art von Kompetenz braucht.
Anderson-Inman et al. (1994) beschreiben als die drei Komponenten der Hypertext-Literacy traditionelle Lesefertigkeiten, Computer-Fertigkeiten und Hypertext-Fertigkeiten. Letztere stellen drei Anforderungen für den Hypertextleser dar:
- Er muss die Struktur des Hypertexts verstehen können, um ein mentales Abbild der dargebotenen Informationen zu entwickeln und um zu verstehen, wie die einzelnen Informationsteile zusammenhängen. Ist er ungeübt im Umgang mit Hypertextstrukturen, so verschwendet er Zeit mit Blättern und der Suche nach schon gelesenen Knoten.
- Er muss Sinn und Zweck der Hilfestellungen erkennen und seine Ressourcenabrufe überwachen können, d. h. Hilfestellungen bei Bedarf nutzen und die dabei gefundene Information in sein bisheriges Wissen integrieren.
- Er muss die Fähigkeit zum „mehrphasigen Lesen“ haben, d. h. er muss immer wieder Entscheidungen treffen, was er lesen bzw. nochmals lesen will. Durch seinen Aufbau unterstützt Hypertext das mehrphasige Lesen eines Lerntextes, wobei es zur Integration zusätzlicher Aspekte kommen kann, die beim ersten Lesen übersehen oder nicht richtig verstanden worden sind.
Barnes (1994) hebt die Fähigkeit zur Assoziation, als eine besondere Voraussetzung zum Lernen mit einem assoziativen Informationsnetz, besonders hervor. Wie Unz (2000) ist sie der Ansicht, dass hohe Leseerfahrung mit herkömmlichem Text nicht heißen muss, dass der User auch mit einem Hypertext gut zurechtkommt. So zeigte sich in der Studie von Barnes, dass Lerner in einem Textbuch zurückblättern, um eine unklare Passage nochmals zu lesen. Beim Lesen von Hypertext dagegen wird meist weitergegangen, auch wenn etwas nicht auf Anhieb verstanden wurde. Hat eine Person aber einmal Erfahrung im Umgang mit Hypertext gesammelt, so kann er zu einem wertvollen Lernmittel werden (Barnes, 1994, S. 29f.)
2.8.3.4 Einstellungen zu Computer und Hypertext
Dickhäuser (2001) schlägt in Anlehnung an Whitley (1997) vor, den Einstellungsbegriff im Zusammenhang mit computerbezogenem Verhalten (= „computer attitudes“) breiter zu fassen als in der sozialpsychologischen Einstellungsdefinition und auch Meinungen und Überzeugungen gegenüber Computern, wie z. B. die Wahrnehmung des PC als nützliches Werkzeug, einzubeziehen (S. 12). Da Hypertext nur auf dem Computer realisierbar ist, beeinflussen computerbezogene Einstellungen vermutlich auch den Umgang mit diesem Medium. Die Einstellung einer Person zu einem Medium wirkt sich auf ihr Informationssuchverhalten aus (Durrance, 1989, zitiert nach Unz, 2000, S. 60), daher sind für Personen mit positiver oder negativer Einstellung zu Hypertext unterschiedliche Auswirkungen auf das Navigationsverhalten und damit auf den Wissenserwerb zu erwarten.
Ein Ziel der Untersuchung von Wang und Beasley (2002) war die Klärung der Frage, ob der Faktor Hypermedia-Präferenz das Lernen in einer webbasierten Lernumgebung beeinflusst und welche Rolle dabei ein unterschiedliches Ausmaß an Lernerkontrolle spielt. 81 TeilnehmerInnen eines Computerkurses an der Universität von Taiwan bearbeiteten in zwei Gruppen eine eigens erstellte Online-Lektion über „Amerikanische Einkaufstraßen“. Da die ProbandInnen dieses Thema in einer Vorerhebung selbst ausgewählt hatten, kann für alle gleich hohes Interesse vorausgesetzt werden. In der Versuchsbedingung (geleitete Lernerkontrolle) stand den TeilnehmerInnen ein Glossar zur Verfügung, über das Erklärungen zu unbekannten Wörtern und Phrasen abgerufen werden konnten, in der Kontrollbedingung (ungeleitete Lernerkontrolle) war kein derartiges Hilfsmittel vorgesehen. Beide Gruppen konnten Lerngeschwindigkeit, Reihenfolge der Inhalte und Art der Präsentation des Lernmaterials selbst bestimmen. Die Leistungen im nachfolgenden Wissenstest wurden zwar nicht direkt von der Einstellung der TeilnehmerInnen zu Hypermedia beeinflusst, es zeigten sich aber signifikante Wechselwirkungen zwischen Hypermedia-Präferenz und Lernerkontrolle: Unter geleiteter Lernerkontrolle erzielten Personen mit niedriger Hypermedia-Präferenz bessere Leistungen. Für Personen mit hoher Hypermedia-Präferenz hatte die Art der Lernerkontrolle keine Auswirkungen auf das Lernergebnis. Die Autoren schlagen daher für Lerner, die dem Hypertext-Lernen eher negativ gegenüber stehen, Hypertexte mit höherer Systemkontrolle vor, um die Erreichung des Lernzieles zu gewährleisten.
Eine Studie von Konrad (1993), in der tätigkeitszentrierte Anreize der Beschäftigung mit Computern und Kontrollüberzeugungen von Jugendlichen erforscht wurden, zeigte eine enge Verflechtung von Handlungsbefindlichkeit und Kontrolle. Positivere Einstellungen zum Computer und Freude am Arbeiten mit ihm gehen einher mit höherer Erwartung zur Ergebniswirksamkeit eigenen Handelns. Wenn eine Person Wirksamkeit der eigenen Aktivität wahrnimmt, dann hat der Tätigkeitsvollzug hohen Anreizwert für sie. Die beim Ausüben der Tätigkeit entstehenden positiven Gefühle bewirken eine häufigere Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, wodurch die Person mehr Erfahrung und höhere Kompetenz im Umgang mit dem Computer erwirbt. Eine empirische Untersuchung, inwieweit diese Zusammenhänge für die Beschäftigung mit Hypertext wirksam werden, steht noch aus.
2.8.4 Interesse und Motivation
Wie bereits an den Ausführungen über Erfahrung und Einstellungen zu erkennen ist, können die einzelnen Personenvariablen nicht immer streng voneinander getrennt werden, weil sie einander gegenseitig beeinflussen. Ähnliches gilt auch für Interesse und Motivation, die ihrerseits meist durch die bereits beschriebenen und noch zu beschreibende Personenfaktoren konfundiert sind (vgl. Brenstein, 1996).
2.8.4.1 TInteressTe
Gemäß der Person–Gegenstands–Theorie des Interesses von Schiefele, Krapp und Prenzel (1986) ist Interesse die besondere „Relation zwischen Person und Gegenstand“ (Schiefele & Prenzel, 1991, S. 820; zitiert nach Eiwan, 1998, S. 22). Diese Beziehung ist charakterisiert durch
- kognitive Merkmale: Das Wissen einer Person über den Interessensgegenstand und seine Handlungsmöglichkeiten zeichnet sich durch hohe Komplexivität aus.
- emotionale Merkmale: Der Interessensgegenstand und die damit verbundenen Handlungen werden mit positiven Gefühlen assoziiert.
- wertbezogene Merkmale: Interessensgegenstand und Interessenshandlungen nehmen in der individuellen und subjektiven Wertehierarchie eine herausragende Position ein.
Krapp (1992) unterscheidet zwischen
- individuellem oder persönlichem Interesse, der speziellen Vorliebe einer Person für ein bestimmtes Wissens- oder Handlungsgebiet, und
- situationalem Interesse oder Interessantheit: Auslöser ist ein Merkmal, das nicht im Lerngegenstand selbst, sondern in der Lernumgebung liegt
Dabei ist situationales Interesse nicht von persönlichem Interesse abhängig: So kann z. B. die didaktisch geschickte Aufbereitung eines Lernstoffes in einem Unterrichtsfach, das einen Schüler persönlich nicht interessiert, dennoch sein Interesse wecken und eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Lernstoff bewirken.
Beide Arten von Interesse wirken sich auf Lernen und Leistung aus. Höheres Interesse führt zu einer längeren und intensiveren Auseinandersetzung mit dem Lernstoff, zu einer vertiefter Verarbeitung der Lerninhalte und damit zu besserem Verständnis. Pintrich und deGroot (1990) beschreiben einen starken Einfluss von Interesse auf Ausmaß und Ergebnis selbstgesteuerten Lernens (zitiert nach Krapp, 1992, S. 760).
Eng verbunden ist Interesse auch mit einer lernwirksamen motivationalen Orientierung. So konnte z. B. empirisch nachgewiesen werden, dass Studierende mit ausgeprägtem Interesse für ihr Studienfach höhere Werte auf Skalen erzielen, die intrinsische Motivation und/oder Autonomie messen (Krapp & Winteler, 1992; zitiert nach Krapp, 1992, S. 759).
2.8.4.2 Motivation
Die Motivation eines Lerners, Informationen zu suchen und Wissen daraus zu erwerben, ist ein entscheidendes Element im Lernprozess (vgl. Lawless & Kulikowich, 1996). Laut Erwartungs-Wert-Theorie hängt die Anstrengung einer Person ab von der Erwartung einer positiven Leistungserbringung und dem Wert, den die Bewältigung der Aufgabe für sie darstellt. Dass daneben aber auch noch andere Faktoren von Bedeutung sind, drücken Friedrich und Mandl (1992) mit der Formel „Skill and Will“ aus: Der Lernprozess wird auch davon beeinflusst, ob die Person sich fähig fühlt, mit dem Medium umzugehen, und außerdem spielen positive Attributionen und selbstwertdienliche Vorstellungen eine Rolle (Friedrich & Mandl, 1992, S. 25).
Nach dem ARCS-Modell von Keller (1987), das sehr gut auf Hypertextlernen angewandt werden kann (vgl. Small & Grabowski, 1992), beeinflussen vier Faktoren die Lernmotivation:
- Aufmerksamkeit („attention“), d. h. Neugier und Interesse müssen geweckt und aufrechterhalten werden. Hypertext leistet dies aufgrund seiner durch multimediale Gestaltungsmöglichkeiten ansprechenden Form bzw. durch die Linkstruktur, die zum Anklicken einlädt und es dem Lerner ermöglicht, aktiv zu werden.
- Relevanz („relevance“) bedeutet, dass der Lerninhalt den Bedürfnissen des Lerners entsprechen muss.
- Konfidenz („confidence“): Der Lerner muss Vertrauen haben, erfolgreich sein zu können. Hier spielen vermutlich die Kontrollüberzeugungen herein.
- Zufriedenheit („satisfaction“), d. h. Lernerfahrung bzw. Lernergebnis müssen für den Lerner befriedigend sein.
Je stärker die Motivation in jedem dieser Bereiche, desto erfolgreicher werden Informationssuche und Lernen mit dem betreffenden Hypertext sein.
Im Allgemeinen werden zwei Arten der Motivation unterschieden:
- Intrinsische Motivation ist definiert als „Motivation, sich einer Tätigkeit um ihrer selbst zu widmen“ (Zimbardo, 1992, S. 378). Das bedeutet, dass die entsprechende Tätigkeit aus Interesse bzw. Freude am Tun ausgeübt wird.
- Extrinsische Motivation ist definiert als „Motivation, sich einer Tätigkeit der Konsequenzen wegen und weniger um ihrer selbst willen zu widmen“ (Zimbardo, 1992, S. 378). Die entsprechende Tätigkeit wird ausgeführt, weil man sich Belohnungen erwartet bzw. negative Konsequenzen vermeiden möchte.
Brenstein (1996) beschreibt den Einfluss von motivationalen und emotionalen Faktoren auf die Bearbeitung von Hypertext und unterscheidet dabei zwischen zwei Arten von Strategien, die zu unterschiedlichem Navigationsverhalten und Auswirkungen auf den Wissenserwerb führen.
- Oberflächenstrategisches Vorgehen ist demnach gekennzeichnet durch extrinsische Motivation, Angst vor Versagen und geringer Selbstwirksamkeitserwartung. Das Navigationsverhalten lässt erkennen, dass die Person offensichtlich nur wenig Interesse für eine Exploration des Hypertextinhalts aufbringt. Daher wird vertiefenden Erklärungen auch nur wenig Beachtung geschenkt. Da der Lernende nicht in tiefere Ebenen des Hypertexts vordringt, bleiben ihm viele Zusammenhänge verborgen. Die Navigationsmuster zeigen zwar ein gewisses Ausmaß an explorativem Vorgehen, es bleibt aber an der Oberfläche und lässt häufig auch auf Desorientierung schließen. So kommt es allenfalls zu einer unreflektierten Übernahme von Detailwissen, dem jedoch ein übergeordneter Rahmen, in den die Informationen integriert werden könnten, fehlt.
- Tiefenstrategisches Vorgehen dagegen weist auf intrinsische Motivation, Interesse am Lerngegenstand und hohe Selbstwirksamkeitserwartung hin. Der Lerner verfügt offensichtlich über hohe Selbststeuerungskompetenz. Er informiert sich zuerst über die Aufgabenstellung, orientiert sich gegebenenfalls mit Hilfe vorhandener Übersichten und wählt danach bewusst, gezielt und selektiv jene Informationen aus, die der Aufgabenstellung und seinen Interessen entsprechen. Da intrinsische Motivation zu gründlicherer Erarbeitung führt als extrinsische Motivation, zeigt seine Navigation einen hohen Durchdringungsgrad der relevanten Informationseinheiten. Seine Navigationsmuster spiegeln ein systematisches, nonlineares Vorgehen, das einer hierarchischen Ordnung und inneren Logik folgt. Dadurch ist es dem Lernenden möglich, Zusammenhänge zu erfassen und ein adäquates mentales Modell zu entwickeln.
[...]
TP[1] PT Nähere Ausführungen zu Lerner- und Programmkontrolle siehe Kapitel 2.7.1.4, S. 101-104.
TP[2] PT Wikipedia ist eine mehrsprachige, frei zugängliche Online-Enzyklopädie, die von der amerikanischen Wikimedia Foundation 2001 ins Leben gerufen wurde und deren deutsche Version derzeit etwa 126.000 Stichwörter umfasst. Da jeder Internetznutzer Einträge machen bzw. bestehende verändern kann, ist die Qualität der Beiträge nicht immer zweifelsfrei. Abrufbar unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite (2004-08-03)
TP[3] PT Microsoft Encarta ist ein Multimedia-Lexikon mit über 50.000 Einträgen. Die kostenpflichtige Online-Version ist abrufbar unter: dhttp://de.encarta.msn.com/ (2004-08-03)
TP[4] PT Dieses Online-Lexikon wurde von Patrick Seidler, einem Studenten an der Universität
Kassel, zusammengestellt und ist abrufbar unter:
http://www.uni-kassel.de/~seidler/lexikon.html (2004-08-03).
TP[5] PT Inkunabel von latein. „incunabula“ = Windeln, Wiege. Als Inkunabeln oder Wiegen- und Frühdrucke bezeichnet man in der Buchwissenschaft Druckwerke aus der Frühzeit des Buchdrucks bis 1500, die oft noch einen experimentellen drucktechnischen und typographischen Zustand aufweisen.
TP[6] PT Ein Nachdruck dieses Artikels ist als PDF-File abrufbar unter: http://www.linse.uni-essen.de/pdf_extern/publikationen/bush.pdf (2004-08-10).
TP[7] PT http://dsor.upb.de/de/forschung/publikationen/blumstengel-diss/main_index_titel.html
(2004-08-10)
TP[8] PT „Serendipity“ stellt ein Kompositum aus dem englischen „serene“ (= heiter) und „pity“ (= ein Grund zum Bedauern) dar und bezeichnet die zufällige Beobachtung von etwas, das ursprünglich nicht Ziel der Exploration war, das sich aber bei genauerer Analyse als neue und überraschende Entdeckung erweist.
TP[9] PT Diese und die folgenden deutschen Bezeichnungen für verschiedene Navigationstypen sind Übersetzungen der Verfasserin. Selbst erklärende englische Termini bleiben unübersetzt.
[...]
[gp1]Jahreszahl suchen
[gp2]entsprechende Zitate suchen und herschreiben!
[gp3]Hier noch Diverses aus Unz einfügen!
[gp4]Kapitel-nummerierung an Endversion anpassen!
- Arbeit zitieren
- MMag. Margarete Poekl (Autor:in), 2005, Einfluss von Kontrollüberzeugungen auf die Navigation in Hypertext und den Wissenserwerb, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59708
Kostenlos Autor werden









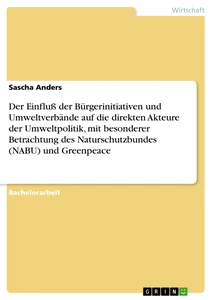










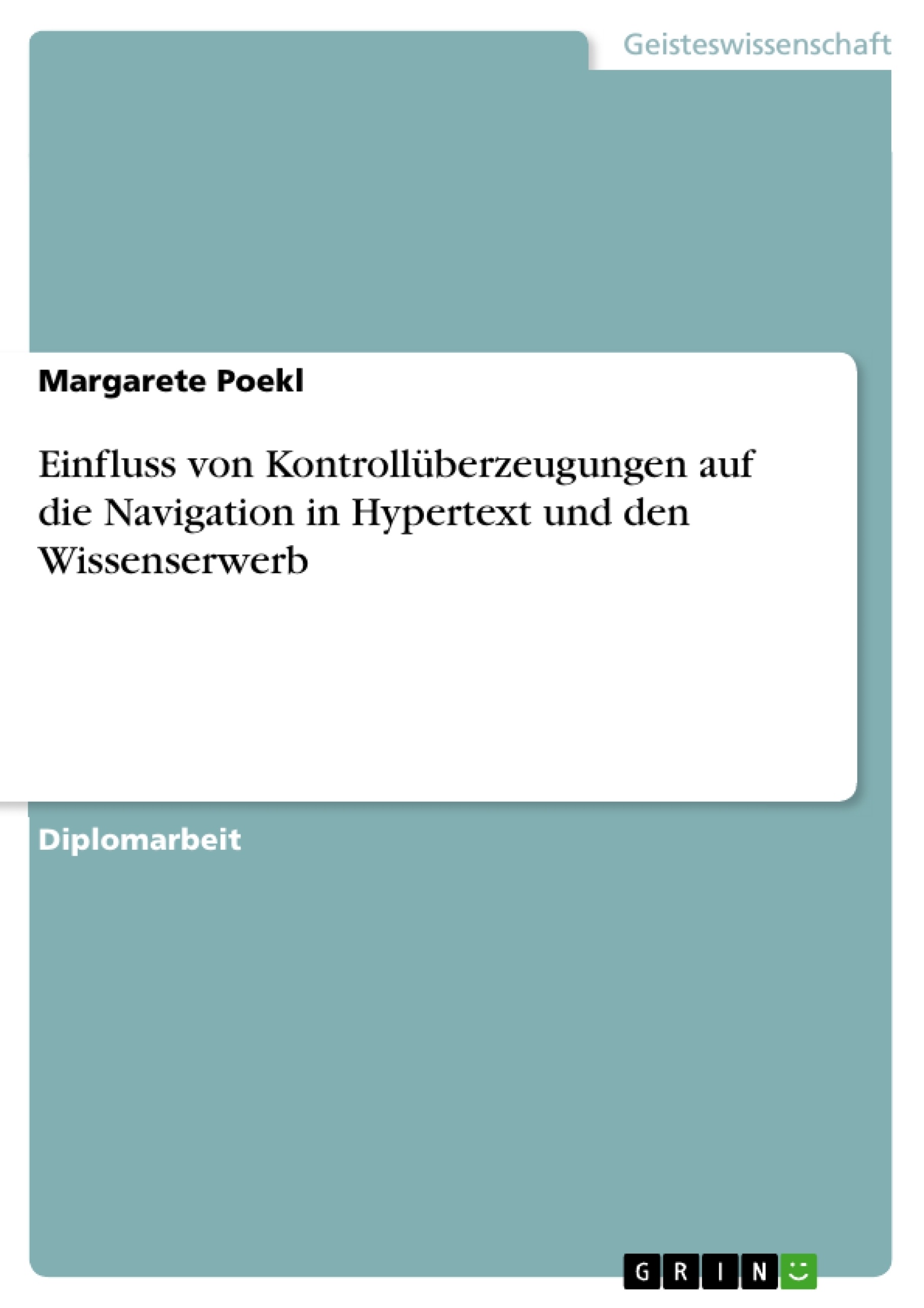

Kommentare