Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Umgang mit Heterogenität in Deutschland
2.1 Exklusion
2.2 Segregation6
2.3 Integration7
2.4 Inklusion_10
2.4.1 Definition von Inklusion
2.4.2 Die Entwicklung zur Inklusion und rechtliche Verankerungen
2.4.3 Inklusion in Abgrenzung zur Integration
2.5 Zwischenfazit zur Inklusion
3 Das deutsche Schulsystem
3.1 Die Schulstruktur
3.2 Aufgaben und Funktionen von Schule
3.3 Die aktuelle Bildungspolitik
3.4 Zwischenfazit zum deutschen Schulsystem
4 Inklusion im deutschen Schulsystem
4.1 Auswirkungen der Bildungspolitik auf die Umsetzung von Inklusion
4.1.1 Die Behindertenrechtskonvention als Motor der Inklusion
4.1.2 Bildungsqualität vs. Sparpolitik?
4.2 Die Umsetzung von Inklusion auf der Ebene des Bildungssystems
4.2.1 Die Diskussion um die Schulstruktur
4.2.1.1 Mehrgliedrigkeit und Zugang des deutschen Bildungswesens
4.2.1.2 Der Umgang mit der Förderschule
4.2.2 Aufgaben und Funktionen von Schule
4.2.3 Die Ressourcenverteilung
4.3 Die Umsetzung von Inklusion auf der Ebene des Unterrichts
4.3.1 Die Frage nach einem inklusiven Curriculum
4.3.2 Die Bedeutung des Leistungsprinzips
4.4 Die Umsetzung von Inklusion auf der Ebene der Person
4.4.1 Die Rolle der Lehrer und Sonderpädagogen
4.4.2 Veränderungen für die Schüler
4.5 Der Index für Inklusion als Umsetzungshilfe für Schulen
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Diskussion um Inklusion an deutschen Schulen nimmt seit Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention (BRK) im Jahr 2009 bemerkenswerte Dimensionen an (vgl. Heimlich/ Kahlert 2012, S. 10). Die Thematisierung des Umgangs mit Heterogenität in der Gesellschaft ist allerdings nicht neu. Sie schließt sich an die in der Integrationsphase angestoßenen Veränderungsprozesse seit den 1970er Jahren an. (vgl. Werning 2010, S. 1) Die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudien, insbesondere von PISA im Jahr 2000, richteten die Aufmerksamkeit unter anderem verstärkt auf Bildungsungleichheiten. Diese lösten Reflexionen über die Situation benachteiligter Schüler aus und führten zu einer sozialen Öffnung des Schulsystems. (vgl. Krüger et al. 2009, S. 329) Mit der Ratifizierung der BRK verpflichtete sich Deutschland schließlich zu einer Bildungsreform auf allen Ebenen, welche die Gestaltung eines inklusiven Schulsystems zum Ziel hat (vgl. Heimlich 2012a, S. 13).
Der Inklusionsbegriff ruft aufgrund seiner häufig beliebigen und irreführenden Verwendung allerdings Irritationen um seine Bedeutung hervor (vgl. Köpfer 2012, S. 3), die zunächst einmal geklärt werden müssen, um ein neues Bildungssystem auf dieser Grundlage zu gestalten. Ziel von Inklusion ist die uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen an den Angeboten der Gesellschaft (vgl. Amrhein 2011, S. 15). Mit Bezug auf Bildung wird der gleichberechtigte Zugang zum allgemeinen Schulsystem für jeden Schüler unabhängig seiner Voraussetzungen gefordert (vgl. Seitz/ Finnern/ Korff/ Scheidt 2012, S. 9). In fachwissenschaftlichen Kreisen wird meist die positive Wirkung inklusiver Beschulung betont. Über die Umsetzung des Inklusionskonzepts herrscht jedoch weitgehend Uneinigkeit. (vgl. Bruns 2008, S. 6) Die Brisanz dieser Thematik für die Gesellschaft wird in Zeitungsartikeln deutlich. Schlagzeilen wie „Soll mein Kind mit Behinderten lernen?“ (Felten 2014), „Inklusion an deutschen Schulen. 'Diese Unsicherheit schürt Ängste'“ (Schneeberger 2013) und „Inklusion: Alle einschließen, wollen wir das?“ (Geyer 2014) geben einen guten Einblick in die Unsicherheit hinsichtlich des Umgangs mit den geforderten Veränderungen.
Die Unsicherheit der Gesellschaft und die Uneinigkeit über die Umsetzung aufgreifend, ist es Ziel dieser Arbeit, zu untersuchen, ob die Umsetzung von Inklusion an deutschen Schulen möglich ist und unter welchen Voraussetzungen. Hierzu werden anhand fachwissenschaftlicher Literatur sowohl Chancen als auch Barrieren für die Umsetzung des Inklusionskonzepts herausgearbeitet. Die Fragestellung lautet entsprechend: „Inwiefern sind die wesentlichen Merkmale des Inklusionskonzepts mit denen des deutschen Schulsystems vereinbar?“ Die Ergebnisse werden abschließend dahingehend ausgewertet, ob Inklusion an deutschen Schulen eine Vision oder Utopie darstellt. Vision wird dabei in Anlehnung an Brei als „Anschauung der Zukunft mit den noch nicht realisierten, aber bereits realisierbar bzw. wirklich erscheinenden Möglichkeiten“ (Brei 2004, S. 28) verstanden. Utopie beschreibt hingegen „die denkbaren, aber noch nicht realisierbaren und noch unwirklichen Möglichkeiten“ (ebd.).
Zur Beantwortung der Fragestellung ist die vorliegende Arbeit in drei Bereiche gegliedert. Der erste Teil befasst sich mit dem Umgang mit Heterogenität in der deutschen Gesellschaft. Nach einer Beschreibung der Entwicklung hin zur Inklusion, in der wichtige Begriffe erläutert werden, von denen Inklusion abzugrenzen ist, folgt eine Definition des Inklusionskonzepts. Anschließend wird auf dessen rechtliche Verankerung eingegangen und der Unterschied zur Integration herausgestellt, da diese beiden Konzepte häufig nicht klar voneinander getrennt werden und zu Verwirrungen über den Inklusionsbegriff beitragen. In einem Zwischenfazit werden zum Schluss deutlich gewordene Entwicklungen aufgezeigt. Der Umgang mit Heterogenität in der Gesellschaft wird am Beispiel von Behinderungen dargelegt, da nicht jeder Aspekt von Heterogenität thematisiert werden kann und Menschen mit Behinderungen als am stärksten von Exklusion bedrohte Randgruppe in Deutschland im Fokus der Inklusionsbemühungen stehen (vgl. Hinz 2005, S. 14f.).
Der zweite Bereich beinhaltet eine Auseinandersetzung mit dem traditionellen deutschen Schulsystem. Zunächst wird die Schulstruktur erläutert, um dann auf die Aufgaben und Funktionen von Schulen einzugehen und einen Einblick in die aktuelle Bildungspolitik zu geben. Im zweiten Zwischenfazit wird schließlich auf gegensätzliche Tendenzen und Ziele im Bildungswesen hingewiesen. Im Zentrum der Ausführungen steht die öffentliche Schule, da die Berücksichtigung der Konzepte von Alternativschulen den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.
Der dritte Bereich führt zum Zweck der Beantwortung der Fragestellung die Ergebnisse der beiden ersten Teile zusammen und untersucht, inwiefern Inklusion im deutschen Schulsystem auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden kann. Zunächst werden durch eine Analyse der BRK und dem Zwiespalt zwischen Bildungsqualität und Sparpolitik die Auswirkungen der Bildungspolitik auf die Entwicklung inklusiver Schulen betrachtet. Daraufhin stehen die drei Ebenen Bildungssystem, Unterricht und Person im Fokus. Auf der Ebene des Systems werden die Schulstruktur, die Aufgaben und Funktionen von Schule sowie die Ressourcenverteilung aus einer inklusiven Perspektive heraus untersucht. Im Rahmen der Ebene des Unterrichts folgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Gestaltung eines inklusiven Curriculums und der Bedeutung von Leistung. Die Analyse der Ebene der Person hinterfragt die Rolle der Lehrer und Sonderpädagogen sowie die Veränderungen für die Schüler als Adressaten der schulischen Inklusion. Zum Schluss erfolgt eine Vorstellung des Index für Inklusion als ein Hilfsmittel für die Umsetzung des Inklusionskonzepts an Einzelschulen.
Im Fazit werden schließlich die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und bezüglich der Fragestellung ausgewertet.
Für einen besseren Lesefluss wird in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Weibliche Personen werden dabei immer mit eingeschlossen.
2 Der Umgang mit Heterogenität in Deutschland
Für eine intensive Auseinandersetzung mit der Fragestellung dieser Master Thesis ist es unerlässlich, einige für den Kontext wichtige Begriffe zu klären. Dies gilt insbesondere wegen der in der Einleitung erwähnten, unklaren Bedeutung des Inklusionsbegriffs.
Inklusion ist keine spontane Erscheinungsform, die nun in Politik, Wissenschaft und Praxis hitzige Diskussionen auslöst. Der Umgang mit Heterogenität in der Gesellschaft nahm in Deutschland über die Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Formen an. Diese Entwicklung aufzuzeigen und entlang dieses historischen Abrisses die einzelnen Etappen auch begrifflich zu definieren sowie herauszuarbeiten, ob Inklusion der logische Schritt innerhalb eines linearen Prozesses darstellt, ist Aufgabe dieses Kapitels.
2.1 Exklusion
Der Begriff „Exklusion“ stammt von dem lateinischen Verb „excludere“ ab und bedeutet übersetzt „ausschließen, abschneiden, hindern“. Dabei können Individuen aktiv andere ausgrenzen oder passiv selbst ausgegrenzt werden. Der Terminus wird in verschiedenen Wissenschaften aufgegriffen. (vgl. Terfloth 2013) Diese Arbeit orientiert sich insbesondere an den Definitionen bzw. begrifflichen Annäherungen der Allgemeinen Pädagogik und der Sonderpädagogik sowie der Soziologie. Da es sich bei der Exklusion um ein sehr komplexes Konstrukt handelt, ist es den verschiedenen Wissenschaften bisher jedoch nicht gelungen, eine einheitliche Definition zu finden, sondern lediglich verschiedene Aspekte bzw. Argumentationslinien zu erarbeiten (vgl. ebd.).
Kronauer beschreibt die Sicht der soziologischen Systemtheorie, wonach Exklusion „nicht ein historisch erzeugtes (und somit der Möglichkeit nach auch überwindbares) Problem in der Geschichte >>moderner<< Gesellschaften, sondern eine Funktionsbedingung dieser Gesellschaften selbst“ (Kronauer 2010a, S. 30) darstellt. In der Konsequenz benötigen soziale Systeme Exklusion, um funktionieren zu können.
Herdt führt diesen Gedanken weiter aus, indem er die Funktionsweise sozialer Systeme erklärt. Sie bestehen aus Beziehungen zwischen Elementen, in der Regel Menschen, die sich von denen anderer Elemente unterscheiden. Alles außerhalb des Systems nennt sich Umwelt und wird durch eine Systemgrenze, welche über Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit entscheidet, vom System separiert. Erst diese Selektionsprozesse, die der Abgrenzung von allem anderen dienen, geben dem sozialen System eine Systemidentität und damit einen Sinn. Außerdem stellen sie einen Schutz der spezifischen, z.B. ökonomischen oder affektuellen, Leistungen des Systems dar. (vgl. Herdt 1996/97, S. 5f., 26)
Aufgrund dieser sozialen Selektionsprozesse und ihrer Resultate, wie ein Mangel an sozialen Beziehungen, wird Exklusion normalerweise negativ erlebt (vgl. Terfloth 2013). Allerdings kann je nach Situation ein Ausschluss von Personen auch neutral bewertet werden, wenn z.B. kein Interesse an einer Zugehörigkeit besteht, oder sogar positiv wie im Fall von Kinderarbeit (vgl. Kronauer 2010b, S. 25). Herdt unterscheidet dabei zwischen freiwilligen Exklusionen, bei denen sich bewusst für das Nicht-Dazugehören entschieden wird, und unfreiwilligen Exklusionen, wenn trotz Wunsch des Betroffenen Ausschluss aus bzw. keine Aufnahme in ein soziales System erfolgt (vgl. Herdt 1996/97, S. 23f.). Erst wenn auf der Grundlage von Macht soziale Teilhabechancen und in der Folge auch die Lebensqualität ausgeschlossener Personen gemindert werden, gelten Exklusionsprozesse als prekär (vgl. Kronauer 2010b, S. 25). Es wird deutlich, dass Exklusionen abhängig von ihrem Kontext und ihren Folgen bewertet werden. Können sie ethisch, moralisch und rechtlich legitimiert werden, so sind sie sozial akzeptiert. Die Ausgrenzung einer Person wird bspw. anerkannt, wenn diese zuvor gegen die systemeigenen Normen verstoßen hat, wie im Falle eines Verbrechens. (vgl. Herdt 1996/97, S. 28)
Exklusion ist den vorhergehenden Ausführungen entsprechend ein Thema, das nicht nur Randgruppen, wie Arme oder Behinderte, tangiert, sondern jeden in der Gesellschaft. Da allen Personen dadurch soziale Leistungen und Rechte in unterschiedlich hohem Maße zustehen, stellt Exklusion insbesondere heutzutage ein Ungleichverhältnis innerhalb der Gesellschaft dar. Es muss daher eher von einer Ausgrenzung in der Gesellschaft und weniger aus der Gesellschaft gesprochen werden. (vgl. Terfloth 2013)
Aus soziologischer Perspektive ist Exklusion zwar kein historisch gewachsenes Problem, das zeitnah behoben werden kann, sondern „vielmehr eine Regelmäßigkeit in der Operationsweise von Sozialsystemen [...] und [...] eine Grundbedingung moderner Gesellschaften“ (ebd.). Aus Sicht der Sonderpädagogik kann hingegen sehr wohl eine Entwicklung bezüglich Teilhabechancen und professioneller Begleitung von behinderten Menschen verzeichnet werden (vgl. ebd.).
Bürli fasste diese Entwicklungsphasen 1997 in einem Stufenmodell zusammen. Die erste Stufe bildet die Exklusion, gefolgt von Segregation bzw. Separation, Integration und schließlich Inklusion, welche in den nachfolgenden Unterkapiteln sukzessive vorgestellt werden. Wocken ergänzte 2010 dieses Modell um eine weitere Stufe, indem er die Extinktion der Exklusion voransetzte. Der Begriff „Extinktion“ bedeutet „Auslöschung“ und bezieht sich auf alle Zeiten, in denen Behinderte keine Rechte hatten und systematisch getötet wurden, wie z.B. im Rahmen der Euthanasie im Nationalsozialismus. In der Stufe der Exklusion wurde behinderten Menschen zumindest gemäß der Menschenwürde das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zugestanden, sodass sie nicht mehr getötet werden durften. Allerdings wurden behinderte Kinder als bildungsunfähig angesehen, weshalb ca. 90% von ihnen noch bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf keine Schule gehen durften. (vgl. Wocken 2010, S. 1f.) Stattdessen wurden sie in medizinischen und pflegerischen Anstalten untergebracht, wo man sie als Patienten verstand und entsprechend ihrer Defizite behandelte bzw. therapierte (vgl. Veber 2010, S. 51f.).
Ungeachtet dessen, dass ein Fortschritt hinsichtlich der Werte zu erkennen ist, plädiert Wocken dafür, die Stufen „nicht als historische Abfolge, wohl aber als eine gestufte Werthierarchie zu verstehen“ (Wocken 2010, S. 3). Auf jeder Ebene, auch auf den unteren, wurden Werte realisiert und damit eine wertzuschätzende Arbeit geleistet (vgl. ebd.). Tabelle 1 veranschaulicht die einzelnen Stufen und die mit ihnen erreichten Rechte, welche in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert werden.
Tabelle 1: Qualitätsstufen der Behindertenpolitik und -pädagogik (ebd., S. 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2 Segregation
Die Segregation stellt die nächste Stufe im Modell der Entwicklungsphasen nach Bürli dar. Der Begriff „Segregation“ stammt von dem lateinischen Wort „segregatio“ ab und bedeutet übersetzt „Trennung“. Er wird in der Soziologie dafür verwendet, die Trennung von zwei oder mehr Personengruppen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Merkmale zu beschreiben. Dabei kann es sich unter anderem um ihre Religion, Schichtzugehörigkeit oder ihren Migrationshintergrund handeln. (vgl. Dudenverlag 2013, Stichwort Segregation) Im Kontext dieses Kapitels wird das Merkmal „Behinderung“ fokussiert und in den Kontext von Bildungszugängen gesetzt.
Der Terminus „Segregation“ wird häufig synonym mit dem Begriff „Separation“ verwendet. Obwohl sich die beiden Termini sehr ähneln, sind sie einzelnen Autoren zufolge nicht identisch. „Separation“ stammt von dem lateinischen Nomen „separatio“ ab, welches „Absonderung“ bedeutet und somit ein Synonym für Trennung darstellt (vgl. Dudenverlag 2013, Stichwort Separation). In einem Detail sind die beiden Begriffe jedoch laut einiger Autoren zu differenzieren: Während „Separation“ im Sinne von Absonderungen von Personengruppen entsprechend eines oder mehrerer spezifischer Merkmale verwendet werde, meine man mit „Segregation“ zusätzlich noch deren räumliche Trennung. Das heißt, Behinderte und Nichtbehinderte würden nicht nur in getrennten Klassen unterrichtet werden, sondern sogar in unterschiedlichen Stadtteilen, wobei Behinderte eher am Stadtrand oder in ländlichen Gegenden untergebracht würden. (vgl. Textor 2012, S. 1; Deutsches Institut für Urbanistik 2006) Da Separation immer auch in der Segregation enthalten ist und eine Verteilung auf unterschiedliche Schulen ebenfalls eine räumliche Trennung darstellt, werden in dieser Arbeit, der Mehrheit entsprechend, beide Termini synonym benutzt.
Wie anhand von Tabelle 1 zu erkennen ist, erlangten Behinderte in der Stufe der Separation das Recht auf Bildung, welches einen großen Fortschritt für sie darstellte. Mit dem Errichten spezieller „Hilfsschulen“, die jeweils auf eine bestimmte Art der Behinderung spezialisiert waren, wurde ihnen erstmals in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Zugang zu Bildung ermöglicht. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde schließlich auch die Schulpflicht für behinderte Kinder gesetzlich verankert und das Sonderschulwesen kontinuierlich ausgebaut, vorrangig an Stadtgrenzen und auf dem Land, um sie von der Öffentlichkeit nach Möglichkeit abzuschirmen. (vgl. Textor 2012, S. 1) Dort wurden sie nicht mehr als Patienten, sondern als Klienten wahrgenommen und von spezialisierten Sonderschullehrern durch entwicklungspsychologische und verhaltenstherapeutische Ansätze gefördert (vgl. Veber 2010, S. 51f.). Auf diese Weise waren die behinderten Kinder und Jugendlichen zwar „nicht mehr vom Schulwesen exkludiert, aber im Schulwesen separiert“ (Sander 2006).
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Zwei-Schulen-Theorie“, wonach behinderte Kinder in Sonderschulen und nichtbehinderte, also „normale“ Kinder in Regelschulen unterrichtet werden (vgl. Wocken 2010, S. 1). Doch es wurde nicht nur zwischen diesen beiden Schulsystemen unterschieden, wie Hinz betont. Generell entwickelte sich in Deutschland ein sehr weit ausdifferenziertes Schulwesen. Die Regelschule spaltet sich bis heute noch auf in Gymnasium, Real- und Hauptschule. Die Schüler werden gemäß ihrer Leistungen, aber PISA zufolge auch ihrem sozialen Milieu entsprechend, auf die drei Zweige verteilt, wobei das Gymnasium das Maß für Normalität verkörpert. Mit jeder Abweichung von der Norm, werden die Schüler eine Ebene tiefer einsortiert. Am Ende steht das Sonderschulwesen, welches in sich auch noch einmal in Schulen für Sinnesgeschädigte, Lernbehinderte, Geistigbehinderte und letztendlich für Schwerst- und Mehrfachbehinderte untergliedert ist. Auch für mehrfachbegabte Schüler, so wurde gelegentlich diskutiert, sollte es eine eigene Nische geben. (vgl. Hinz 2005, S. 11; Boban/ Hinz 2004, S. 5)
2.3 Integration
Der Begriff „Integration“ entspringt dem lateinischen Wort „integratio“ und heißt übersetzt „Wiederherstellung eines Ganzen“. Bildungssprachlich wird er darüber hinaus im Sinne von Vervollständigung und Einbeziehung bzw. Eingliederung in ein größeres Ganzes verwendet. Aus soziologischer Perspektive beinhaltet „Integration“ die Vereinigung von Individuen und einzelnen Gruppen zu einer gesellschaftlichen sowie kulturellen Unität. (vgl. Dudenverlag 2013, Stichwort Integration) Es geht folglich darum, dass Minoritäten in ein System von Mayoritäten eingebundern werden (vgl. Becker/ Mulot/ Wolf 1997, S. 492).
Integration bildet die vierte Stufe des erweiterten Entwicklungsmodells von Bürli und entstand in den 1960er Jahren im Rahmen der Neuen Sozialen Bewegungen, die unter anderem die Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft verlangten (vgl. Wocken 2010, S. 1; Sander 2006; Textor 2012, S. 2). Nach Feuser umfasst Integration die bedingungslose Teilhabe an allen Angeboten der Erziehung und des Unterrichts. Dabei darf jedes Kind bzw. jeder Jugendliche gemäß seiner individuellen Fähigkeiten sowie Fertigkeiten lernen und wird in erforderlichem Maße unterstützt. Im kooperativen Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung spielen weder die Art noch der Schweregrad einer Behinderung eine Rolle. (vgl. Feuser 1996, S. 28) Behinderten Kindern und Jugendlichen wird nun dementsprechend zusätzlich zu den bereits erworbenen Rechten das Recht auf Gemeinsamkeit und Teilhabe zugestanden. Auf internationaler Ebene verbesserte insbesondere die UNO durch zahlreiche Deklarationen die Rechtslage behinderter Menschen. Sie setzte sich für Chancengleichheit, Recht auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ein. Sonderschulen seien nur gerechtfertigt, wenn die Regelschule noch kein adäquates Angebot bieten könne. (vgl. Bürli 2003, S. 2) Die neu erworbenen Rechte drücken sich im Bereich der Bildung demnach durch die Öffnung der Regelschulen für die Betroffenen aus (vgl. Wocken 2010, S. 1).
Es handelt sich in der Praxis allerdings nur um eine eingeschränkte Öffnung, denn die Integration eines behinderten Schülers an eine allgemeine Schule hängt von bestimmten Konstellationen ab, die darüber entscheiden, ob und wie viele der bisher separierten Schüler aufgenommen werden können. Maßgeblich für das Urteil sind entgegen der Idee von Integration Faktoren wie der Grad der Behinderung und die Möglichkeit einer sonderpädagogischen Unterstützung für diejenigen. (vgl. Hinz 2005, S. 11f.) Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Sonderschul- und Regelschullehrern stellt somit erstmalig für den gelingenden gemeinsamen Unterricht eine strukturelle Voraussetzung dar (vgl. Sander 2006). Die integrative Beschulung ist außerdem durch ihre Hochschwelligkeit gekennzeichnet, da diese von den Eltern beantragt werden muss, in der Hoffnung, dass dieser stattgegeben wird. Hierfür muss zuvor von (sonder)pädagogischen Experten die „Integrationsfähigkeit“ des behinderten Kindes attestiert werden. (vgl. Wocken 2010, S. 3)
Die behinderten und die nichtbehinderten Schüler werden zwar nun nicht mehr separiert, sondern auch teilweise gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Erstere sind aber nach wie vor „als >>behindert<< diagnostiziert und etikettiert und unterscheiden sich von der Gruppe der nichtbehinderten, normalen Kinder. Die >>Zwei-Schulen-Theorie<< wird abgelöst durch die >>Zwei-Gruppen-Theorie<< “ (ebd., S. 1). Diese zwei Gruppen existieren also nicht gleichberechtigt und ebenbürtig nebeneinander, sondern es herrscht eine Dominanz der „normalen“ Mehrheit gegenüber einer „nicht normalen“ Minderheit, die eher eine Randgruppe innerhalb des sozialen Systems Schule darstellen. In einem derart aufgebauten System sehen sich die Integrierten jedoch weiterhin mit tradierten, diskriminierenden Umgangsstrategien konfrontiert, indem sie entweder ignoriert oder positiv diskriminiert werden. Das heißt, sie werden durch die spezifische Unterstützung, die sie erhalten, als jemand Bedürftiges und damit als „nicht normal“ bewertet. (vgl. Hinz 2005, S. 11f.) Die Zwei-Gruppen-Theorie trägt dazu bei, „dass im Alltagsverständnis Differenz dominant bleibt, auch wenn sie institutionell nicht mehr zu Trennungen und Abweichungen führt“ (ebd., S. 12).
Hinz sieht dabei in Anlehnung an Feuser die Gefahr einer „Schäferhundepädagogik“, nach der behinderte Schüler in einer separaten Gruppe mit einem Sonderschullehrer zu einem Thema, das die nichtbehinderten Schüler mit dem Regelschullehrer bearbeiten, auch etwas beschäftigt werden (vgl. ebd.; Schwager 2005, S. 250). Feuser spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Integration längst eine modernisierte Form der Segregation angenommen hat (vgl. Feuser 2000, S. 37). Wocken unterstützt diese These durch seine Anmerkung, dass Integration unter einem Ressourcen- und Professionsvorbehalt steht. Unter den gegebenen Voraussetzungen seien die heilpädagogischen Standards nicht aufrecht zu erhalten, weshalb aus fachlicher Perspektive nur eine Teilintegration möglich sei. (vgl. Wocken 2010, S. 2)
Entsprechend der Ausführungen von Wocken, dass im Rahmen jeder Stufe des Entwicklungsmodells neue respektable Werte verwirklicht werden, kann für die Phase der Integration festgehalten werden, dass durch die Aufhebung der räumlichen Trennung die Grenzen der Normalität etwas aufgeweicht wurden, auch wenn Behinderte immer noch eine Besonderheit darstellen. (vgl. Feyerer 2009)
2.4 Inklusion
Der Leitgedanke der Inklusion bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit und muss daher ausführlich erläutert werden. Damit die Fragestellung, ob Inklusion und das deutsche Schulsystem in ihren Grundzügen kompatibel sind, beantwortet werden kann, sind folgende Aspekte wichtig zu klären: Zunächst muss der Begriff konkretisiert werden, damit das Konzept der Inklusion in seinen grundlegenden Merkmalen verstanden wird. Anschließend folgt eine Darstellung der rechtlichen Verankerung von Inklusion, um zu verdeutlichen, wie sie entstand und auf welcher Basis die Umsetzung dieses Leitgedankens beruht. Zum Schluss ist eine Gegenüberstellung der beiden Termini „Integration“ und „Inklusion“ nötig, da sie häufig synonym und damit nicht korrekt verwendet werden.
2.4.1 Definition von Inklusion
Der Terminus „Inklusion“ lässt sich von dem lateinischen Verb „includere“ herleiten, welcher übersetzt entweder „Einschließung, Einsperrung“ oder „Versperrung, Verengung“ bedeutet. In beiden Fällen kommt eine Unfreiwilligkeit zum Ausdruck. Aus soziologischer Perspektive heißt das, dass die Umwelt darüber entscheidet, ein Element zu vereinnahmen, unabhängig vom Willen des Elements. Im Kontext von Naturwissenschaften, wo der Begriff „Inklusion“ zunächst Anwendung fand und sich auf Objekte bezog, passte dieses Verständnis in der Regel. (vgl. Herdt 1996/97, S. 11) In den 1970er Jahren wurde er im US-amerikanischen Raum schließlich auf soziale Zusammenhänge und damit auf Subjekte übertragen. In dieser Verwendung wurde „Inklusion“ später zum internationalen Standardbegriff, der erst sehr spät auch in Deutschland ankam. (vgl. Hinz 2010, S. 1f.) Individuen sind im Gegensatz zu den Beobachtungsobjekten der Naturwissenschaften allerdings handelnde Wesen mit einem Willen, weshalb Inklusion in sozialen Kontexten sowohl das freiwillige als auch das unfreiwillige Umfassen eines Individuums in ein soziales System bedeuten kann (vgl. Herdt 1996/97, S. 11). Dabei sind die Individuen Luhmann zufolge entweder voll in soziale Systeme inkludiert oder gar nicht, denn eine graduelle Inklusion sei nicht möglich (vgl. Terfloth 2013).
Aus pädagogischer Sicht handelt es sich bei Inklusion, wie auch bei den vorgestellten Vorstufen davon, um „eine Form des gesellschaftlichen Umgangs mit der Verschiedenheit von Menschen“ (Amrhein 2011, S. 15). Im Gegensatz zu den Vorläufern nimmt Inklusion jedoch alle Menschen als Individuen in den Blick und nicht nur spezifische Gruppen. Ziel ist es, die Teilhabe jedes Einzelnen an gesellschaftlichen Strukturen gleichermaßen zu ermöglichen, indem Barrieren abgebaut werden. Das heißt, der Mensch muss sich nicht mehr dem System anpassen, sondern das System dem Menschen. (vgl. ebd.) Dem Inklusionskonzept liegt daher das Recht auf Selbstbestimmung und Gleichheit zu Grunde, welches damit unter anderem auch für behinderte Schüler gilt. Sie erreichen mit Inklusion schließlich die fünfte Stufe im erweiterten Entwicklungsmodell nach Bürli, wie Tabelle 1 veranschaulicht. (vgl. Wocken 2010, S. 2f.)
Hinz erarbeitete vier konzeptionelle Eckpfeiler der Inklusion. Der erste Pfeiler besteht aus der positiven Einstellung gegenüber Heterogenität und Vielfalt. Sie werden als Chance und nicht als Belastung wahrgenommen. Hieraus lässt sich gleichzeitig eine Ablehnung von homogenen Gruppen und von leistungsbezogenen Maßstäben, die für alle in gleicher Weise gelten, ableiten. Der zweite Pfeiler konzentriert sich auf alle Dimensionen von Heterogenität. Es werden nicht nur spezifische Gruppen in den Blick genommen, wie bspw. Behinderte. Stattdessen steht jedes Individuum mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen im Fokus, unabhängig von z.B. körperlichen, sozialen, ethnischen oder intellektuellen Merkmalen. Die „Zwei-Gruppen-Theorie“, welche die Welt in entgegengesetzte Kategorien, wie Mann – Frau, Deutscher – Ausländer, behindert – nichtbehindert, etc. aufteilt, wird aufgegeben zugunsten der Befürwortung von Heterogenität und Vielfalt. Entsprechend des dritten Pfeilers orientiert sich Inklusion an Bürgerrechtsbewegungen mit dem Ziel, gesellschaftliche Marginalisierungen und Diskriminierungen abzubauen. Der vierte Pfeiler beschreibt die Vision einer inklusiven Gesellschaft. (vgl. Hinz 2010, S. 1f.; Amrhein 2011, S. 15; Sulzer 2013, S. 14f.)
Tony Booth weist diesbezüglich laut Amrhein darauf hin, dass es für eine Vielzahl von Menschen eine große Herausforderung darstellt, sich mit allen Formen der Diskriminierung gleichzeitig auseinanderzusetzen. Haltungen, Einstellungen und Werte verändern sich innerhalb einer Gesellschaft nur sehr langsam, weshalb Inklusion als ein niemals endender Prozess gesehen werden muss. (vgl. Amrhein 2011, S. 15f.)
Inklusion wirkt nach Booth auf drei Ebenen. Die erste Ebene bezieht sich auf die Teilhabe von Personen. Es geht darum, allen Menschen unabhängig ihrer Voraussetzungen die Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten zu ermöglichen. Da auf dieser Ebene die Menschen im Vordergrund stehen und damit auch ihre Förderbedarfe, passiert es gemäß der Erfahrungen aus der Integration schnell, dass sie auf diese reduziert werden. Aus diesem Grund bildet die zweite Ebene eine wichtige Ergänzung, nämlich der Blick auf die Systeme, z.B. Schulen. Sie sind im Sinne der Inklusion dazu verpflichtet, die ihnen innewohnenden Barrieren abzubauen und einen adäquaten Umgang mit Heterogenität zu finden. Die dritte Ebene beinhaltet die Reflexion und Umsetzung inklusiver Werte wie Gleichheit, Partizipation und Nachhaltigkeit sowie zwischenmenschliche Tugenden wie Mitgefühl oder Ehrlichkeit in der Gesellschaft. (vgl. Hinz 2010, S. 2)
Mit Bezug auf Bildung bedeutet Inklusion, dass alle Individuen die Chance haben, an der Kommunikation und den Leistungen des Systems Schule teilzuhaben. Den Zugang zu Erziehung und Bildung erhalten sie über ihre soziale Rolle als Schüler und nicht etwa über Noten. (vgl. Seitz et al. 2012, S. 9) Damit wird „allen Menschen ein selbstverständlicher und gleichberechtigter Zugang zu Bildungsinstitutionen und Bildungsangeboten gewährt“ (Köpfer 2012, S. 1). Sander weist auf die Bedeutung des Schulsystems mit Hinsicht auf die gesellschaftliche Etablierung von Inklusion hin, da alle Menschen aufgrund der Schulpflicht diese Institution mindestens zehn Jahre lang besuchen müssen und somit frühzeitig und langfristig erreicht werden (vgl. Sander 2006).
2.4.2 Die Entwicklung zur Inklusion und rechtliche Verankerungen
Wie bereits angedeutet, war der Begriff „Inklusion“ im US-amerikanischen Raum in den 1970er Jahren bereits gebräuchlich. International erlangte er insbesondere durch die 1994 stattfindende World Conference on Special Needs Education der UNESCO an Bedeutung. Die Ergebnisse wurden in der Salamanca-Erklärung 1994 festgehalten, in der durchgängig von „inclusion“ gesprochen wird. In Deutschland wurde dieser Begriff allerdings fälschlicherweise mit „Integration“ übersetzt, was zu einer Verwischung der Grenzen von Integration und Inklusion beitrug und somit zu einer inhaltlichen Unschärfe des Inklusionsbegriffs. In der Salamanca-Erklärung wird bereits der breite Ansatz von Inklusion klar, der weit über die Integration von Behinderten hinausgeht und stattdessen die gesellschaftliche Teilhabe von allen Kindern bzw. Jugendlichen, gleich welcher pädagogischer Bedürfnisse, anstrebt. (vgl. ebd.) Dies wird deutlich durch das Leitprinzip, welches besagt, „dass Schulen alle Kinder [Hervorhebung im Original], unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen“ (UNESCO 1994, S. 4). Schulen werden dabei in die Pflicht genommen, entsprechend einer kindzentrierten Pädagogik, die den Lernprozess mit den individuellen Bedürfnissen des Schülers abstimmt, alle Lernenden zum Erfolg zu führen. Sonderschulen sollen modifiziert werden, indem sie die Funktion von Trainings- sowie Ressourcenzentren übernehmen und nur noch in Ausnahmefällen Schüler aufnehmen, deren Bedürfnissen Regelschulen nicht gerecht werden können. Außerdem wird in der Salamanca-Erklärung die Bedeutung eines inklusiven Schulsystems für die Etablierung von inklusiven Werten in der Gesellschaft hervorgehoben. (vgl. ebd., S. 4ff.; Bruns 2008, S. 10)
Auf der Ebene der EU hat der Rat der europäischen Union einen Beschluss verabschiedet, bei dem die Umsetzung von Chancengleichheit und die Optimierung der Lebensqualität für behinderte Menschen als Ziele formuliert werden. Diese sollen durch Zugang zu allgemeinen Schulen mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung und generell gesellschaftlicher Teilhabe erreicht werden. Hierzu wurde ebenfalls ein Leitfaden für empfehlenswerte Praktiken entwickelt. (vgl. Bürli 2003, S. 3f.; Bruns 2008, S. 11) Dieser Beschluss, die Charta von Luxemburg von 1996, befasst sich entsprechend überwiegend mit der gleichen Thematik wie die Salamanca-Erklärung. Begrifflich ist hier jedoch bezogen auf Deutschland ein Fortschritt zu erkennen. Der Terminus „Inklusion“ findet weiterhin nur in der englischsprachigen Fassung Verwendung. Der Titel „ Die Schule für alle und jeden“ lässt allerdings schon ein über Integration hinausgehendes Verständnis erahnen. (vgl. Sander 2006)
Mit Bezug auf Deutschland wurde 1994 von der Kultusministerkonferenz (KMK) eine „Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland“ veröffentlicht. Dort wird festgehalten, dass die „Bildung behinderter junger Menschen (…) verstärkt als gemeinsame Aufgabe für grundsätzlich alle Schulen anzustreben“ (Kultusministerkonferenz 1994, S. 3; Bruns 2008, S. 11) sei. Aus der Formulierung geht hervor, dass noch Integration als Ziel gesetzt wurde. Die Schüler sollen gemeinsam erzogen und unterrichtet werden mit der Einschränkung, dass die „notwendige Qualität und der erforderliche Umfang der Fördermaßnahmen gesichert“ (Kultusministerkonferenz 1994, S. 3; Bruns 2008, S. 12) sein muss.
Erst Anfang des 21. Jahrhunderts gewann der Inklusionsbegriff in Deutschland verstärkt an Bedeutung. Den Auslöser bildete dabei die PISA-Studie im Jahr 2000. Während Deutschland ein schlechtes Ergebnis erzielte, war Kanada sehr erfolgreich. Es bewies, dass sich Inklusion sehr gut mit einer leistungsfähigen Bildungsstruktur vereinen lässt und stellt damit ein Vorbild für inklusive Bildung dar. Dieses Ereignis förderte in Deutschland einen terminologischen Diskurs, der dazu führte, den englischen Begriff „inclusion“ mit dem deutschen Begriff „Inklusion“ zu übersetzen. (vgl. Köpfer 2012, S. 2)
Die UN-BRK von 2006 bildet für Deutschland einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Inklusion. Durch ihre Unterzeichnung nahm die Diskussion um Inklusion ein kaum denkbares Ausmaß an, obwohl „es bei der Behindertenrechtskonvention nicht um besondere Rechte für eine besondere Gruppe von Menschen geht, sondern lediglich darum, dass allgemeine Rechte für eine spezifische Gruppe nochmals betont und konkretisiert werden“ (Hinz 2013). Sie ist in Deutschland seit 2009 gültig (vgl. Seitz et al. 2012, S. 11). In der BRK wird den Ländern eine Reform der Bildungspolitik vorgeschrieben. Diese bezieht sich wie auch in vorherigen Beschlüssen unter anderem auf die Einbindung von behinderten Schülern in Regelschulen, aber darüber hinaus auch auf das kollektive Lernen. Abhängig von den individuellen Bedürfnissen verfolgen die Schüler demnach teilweise gleiche und teilweise unterschiedliche Ziele. (vgl. Oelkers 2012, S. 33) Ähnlich wie bei der Salamanca-Erklärung wurde der englische Begriff „inclusion“ im Deutschen allerdings noch fälschlicherweise mit „Integration“ übersetzt (vgl. Köpfer 2012, S. 2).
2010 publizierte die KMK ein Arbeitsblatt, in dem das Ziel festgelegt wurde, inklusive Bildung zu verwirklichen. Inhaltlich wurde auf die Schulpflicht für Behinderte und Nichtbehinderte verwiesen sowie auf die Umgestaltung der schulischen Rahmenbedingungen, damit auch Schüler mit Behinderungen ein Höchstmaß an persönlicher Entfaltung und gleichberechtigter Teilhabe erreichen können. Außerdem wird festgestellt, dass die BRK keine Angaben über die Gliederung des Schulsystems macht. Oelkers kritisiert, dass dieses Arbeitsblatt keine wirkliche Neuerung darstellt. Die allgemeine Schulpflicht lasse sich nach wie vor mit dem Sonderschulsystem vereinen und die Forderungen müssen nicht zu einen konkreten Zeitpunkt, sondern lediglich perspektivisch, erfüllt sein. (vgl. Oelkers 2012, S. 33ff.)
Weitere rechtliche Grundlagen, die im Zusammenhang mit Inklusion in der BRD eine Rolle spielen, sind das in Art. 3, Abs. 3 GG verankerte Antidiskriminierungsrecht, das neunte Sozialgesetzbuch, in dem unter anderem Aspekte der Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben festgelegt sind (SGB IX), und schließlich die Schulgesetze der einzelnen Länder (vgl. Bruns 2008, S. 12).
Wie aus der rechtlichen Entwicklung sowie aus der Definition von Inklusion hervorgeht, werden Menschen mit Behinderungen nicht mehr als Klienten betrachtet, wie es noch während der Phase der Segregation und teilweise auch in der Phase der Integration der Fall war. Sie werden im Rahmen der Inklusion als Bürger wahrgenommen, die wie die Menschen in ihrer Umwelt übliche Wohnungen, Betriebe und Schulen in Anspruch nehmen und individuelle Unterstützung erhalten. Probleme mit der gesellschaftlichen Teilhabe werden daher in den Umweltverhältnissen und nicht mehr in der Person gesucht. (vgl. Veber 2010, S. 51f.)
2.4.3 Inklusion in Abgrenzung zur Integration
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits angedeutet, dass der Begriff der Inklusion häufig nicht trennscharf von dem der Integration verwendet wird. Ebenso wird Inklusion Hinz zufolge konzeptionell oft mit De-Segregation, also einer bloßen Nicht-Aussonderung verwechselt. (vgl. Hinz 2013)
Gründe dafür sind zum einen in der verstärkten Diskussion um den Inklusionsbegriff seit der UN-BRK zu finden. Dadurch verkam das innovative Konzept zum Modebegriff, der verwendet wurde, um sich als fortschrittlich zu präsentieren. Je mehr Inklusion in das Bewusstsein der Menschen rückte, desto mehr wurden die typischen Reaktionen auf Innovationsprozesse gezeigt: Ignoranz, Auflehnung, aggressive Abwehr oder Umformung bzw. Anpassung des Konzepts an das bereits Bekannte. Seltener wird das Neue jedoch als Chance erlebt, was sich anhand der Gesetzmäßigkeiten von Systemen erklären lässt, die sich nach Möglichkeit nicht ändern wollen. (vgl. ebd.)
In Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zum Thema Inklusion kristallisiert Sander drei verschiedene Bedeutungen heraus. Einerseits wird, wie bereits erläutert, Inklusion als Synonym für Integration genutzt, um aktuell und gebildet zu wirken. In diesem Kontext stellt Inklusion keine Innovation dar. Andere verstehen Inklusion als eine von fehlerhaften Umsetzungen befreite Integration. Diese Interpretation ist bereits ein Fortschritt für die Integration von Menschen mit und ohne Behinderung, da sie sich von der reinen Addition zuvor separierter Schüler in Regelklassen mit sonderpädagogischer Hilfe abgrenzt. Im Fokus steht die Akzeptanz von Heterogenität in den Klassen. Erst die dritte Bedeutung bildet jedoch ein neues Konzept. Inklusion gilt demnach als erweiterte und optimierte Integration. Differenz wird nicht länger als störend, sondern als natürlich empfunden. Jeder Schüler soll individuelle Unterstützung entsprechend seiner pädagogischen Bedürfnisse durch die kooperierenden Lehrkräfte erfahren. Die Aufmerksamkeit wird daher nicht mehr auf Behinderungen beschränkt. (vgl. Sander 2006) Köpfer betont, dass das Problem der Vielfältigkeit von Inklusionsbedeutungen international besteht. Die Besonderheit in Deutschland kennzeichnet sich durch die unscharfe Grenze zwischen Integration und Inklusion. (vgl. Köpfer 2012, S. 3) Hinz erklärt die unterschiedliche Akzentuierung von Inklusion in den jeweiligen Nationen anhand der aktuellen kulturellen Situation einer Gesellschaft. Die am stärksten von Exklusion und Diskriminierung gefährdeten Randgruppen werden bei Inklusion jeweils verstärkt in den Fokus genommen. In Deutschland sind dies z.B. Behinderte, in Indien Frauen und in Südafrika stehen die verschiedenen Rassen im Mittelpunkt von Inklusionsbemühungen. (vgl. Hinz 2005, S. 14f.)
Hinz betont weiterhin, dass auch unterschiedliche Integrationsverständnisse existieren. Je nachdem von welcher Bedeutung ausgegangen wird, kann Inklusion eine kleine Akzentverschiebung bis hin zu einem paradigmatischen Wechsel darstellen. (vgl. ebd., S. 14) Um jedoch eine Vorstellung davon zu gewinnen, welche Unterschiede sich für die Praxis ergeben, je nachdem welchem Konzept man folgt, entwickelte er eine Tabelle, welche die wichtigsten Kernelemente der beiden Leitideen gegenüberstellt (siehe Tabelle 2). Diese gibt einen guten Überblick und wurde von einigen Autoren aufgegriffen, so bspw. auch von Amrhein (vgl. Amrhein 2011, S. 20).
Diese Tabelle veranschaulicht, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen der Integration entsprechend der Zwei-Gruppen-Theorie sehr stark in behindert und nichtbehindert eingeteilt werden. Es ist Ziel, den behinderten Schülern den Zugang zu allgemeinen Schulen zu ermöglichen. (vgl. Hinz 2002, S. 359) Da Integration einen individuumszentrierten Ansatz verfolgt, werden sie gemäß ihrer Art von Behinderung im Unterricht und auf institutioneller Ebene speziell gefördert, indem Förderpläne und individuelle Curricula entwickelt und der Schule für Kinder mit Etikettierung Ressourcen bereit gestellt werden (vgl. ebd.). Es handelt sich dabei um einen Auftrag der Sonderpädagogik. Die Unterstützung eines Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt durch einen Sonderpädagogen in der Klasse, welcher zugleich eine Kontrollinstanz für die Integration darstellt. Auf diese Weise weitet sich die Sonderpädagogik auf die Schulen aus und besteht neben der Schulpädagogik. (vgl. ebd.)
Tabelle 2: Praxis der Integration und der Inklusion
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Praxis für Inklusion liegt hingegen die Theorie einer heterogenen Lerngruppe sowie ein systemischer Ansatz zu Grunde. Da jeder Schüler individuelle Stärken und Schwächen hat, wird nicht mehr nach bestimmten Gruppen unterschieden. Deshalb werden alle Kinder und Jugendliche ganz selbstverständlich an einer allgemeinen Schule unterrichtet und für alle gilt das gleiche System, was mit einer Veränderung des Selbstverständnisses der Schule einhergeht. (vgl. ebd., S. 357, 359) Individuelle Curricula gibt es in der inklusiven Schule für alle und nicht mehr nur für Einzelne. Statt der Institution werden bei der Inklusion besonders die emotionale, soziale und unterrichtliche Ebene beachtet. Daher werden auch nicht nur einzelne Schüler gefördert, sondern ein gemeinsames und individuelles Lernen für alle gewährleistet. (vgl. ebd., S. 358f.) Die Praxis der Inklusion ist Auftrag der Schulpädagogik, da alle Kinder als „normal“ gelten. Sonderpädagogen werden als Unterstützung für die Klassen und Schulen geholt. Sie gehören zum Team, lösen Probleme in Kooperation mit der Lehrkraft und beteiligen sich an Reflexion und Planung, wenn es bspw. um die Zukunft eines Schülers geht. Sonder- und Schulpädagogik verändern sich dementsprechend und verschmelzen miteinander. (vgl. ebd., S. 359)
Hinz fasst in seinem nachfolgenden Zitat die verschiedenen Zielsetzungen gut zusammen:
Die Integrationspädagogik versucht, aus sonderpädagogischer Warte individuumsbezogen die Einbeziehung ihrer Klientel mit sonderpädagogischem Förderbedarf, je nach individueller Schädigung, mit personenbezogener Ressourcenausstattung, spezieller Förderung und primärer eigener Zuständigkeit voranzubringen, während die Inklusionspraxis mit schulpädagogischem Ausgangspunkt und systemischem Ansatz alle Schüler an einer gemeinsamen Schule für alle teilhaben und individuell wie gemeinsam lernen lassen und dies mit systembezogener Ressourcenausstattung und allen beteiligten Berufsgruppen vorantreiben will (ebd., S. 359f.).
Es besteht allerdings die Gefahr, dass das Integrationskonzept mitsamt seinen Errungenschaften durch die Abgrenzung zur Inklusion abgewertet wird (vgl. Amrhein 2011, S. 20). Eine Abwertung der Integration ist Hinz zufolge jedoch keineswegs beabsichtigt, „vielmehr handelt es sich im Gegenteil um den Versuch, den Ansatz der Integration in seinem Bezugsrahmen aufrechtzuerhalten, als sinnvoll und legitim herauszustellen und damit zu unterstützen“ (Hinz 2013).
2.5 Zwischenfazit zur Inklusion
Betrachtet man die gesellschaftliche Entwicklung im Umgang mit Heterogenität, wie sie Abbildung 1 noch einmal zusammenfassend darstellt, so kann man mit Hinblick auf Inklusion verschiedene Rückschlüsse ziehen.
Zum einen bildet Inklusion inhaltlich gesehen den nächsten logischen Schritt auf dem linearen Weg von der Exklusion über die Segregation und die Integration. Bei der Exklusion existiert noch eine Abspaltung der in Abbildung 1 grün präsentierten „richtigen“ Menschen von den schwarz dargestellten „falschen“ Menschen zwischen denen eine scheinbar unüberwindbare Mauer aufgebaut wurde. In der Phase der Segregation gibt es immer noch eine „grüne Normalität“, aber den vorher Exkludierten wird der Zugang zu gesellschaftlichen Systemen zugestanden, wenn auch nur räumlich separiert von den anderen. Die von der „Normalität“ Abweichenden werden in Institutionen je nach Grad ihrer Abweichung sortiert. Die blauen Sternchen stehen für Mehrfachbegabte, die einigen Diskussionen zufolge auch ggf. separiert werden sollen. In der Phase der Integration wird nach wie vor in „grüne Normalität“ und „Andersfarbige“ unterschieden. Je nachdem wie hoch ihr Grad der Abweichung von der Normalität ist, können sie in eine „normale“ Gruppe einbezogen werden oder nicht. Die Integrierten stellen allerdings eher Randgruppen dar und bedürfen besonderer Unterstützung. In der Inklusion wird die Wahrnehmung einer „grünen Normalität“ zugunsten einer farb- und formheterogenen Gruppe aufgegeben. Alle sind von Anfang an Teil des Ganzen und keiner gehört mehr einer Randgruppe an. Die durchgestrichenen Pfeile symbolisieren zudem, dass es keine Marginalisierung und Aussonderung mehr gibt. (vgl. Hinz 2005, S. 10ff.) Es sei ferner noch einmal darauf hingewiesen, dass sich Inklusion nicht nur auf Behinderte bezieht, auch wenn auf ihnen ein besonderer Fokus in Deutschland liegt, sondern auf alle Menschen gleich ihrer Fähigkeiten und Bedarfe (vgl. ebd., S. 14).
Abbildung 1: Von der Exklusion zur Inklusion
Exklusion Segregation Integration Inklusion
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(ebd., S. 11f.)
Gesellschaftlich marginalisierte Randgruppen erhalten von Stufe zu Stufe mehr Rechte und werden immer mehr Teil der als „normal“ erlebten Gemeinschaft. Dies bestätigt Wockens Aussage, dass jede Phase wertzuschätzen sei, da sie einen wichtigen Beitrag zur gesamten Entwicklung leistet (vgl. Wocken 2010, S. 3). Daher ist es ihm auch wichtig zu betonen, dass durch Inklusion die Vorstufen wie Integration nicht abgewertet werden dürfen (vgl. ebd.; Amrhein, S. 20f.). Dennoch bezeichnet er Inklusion als den „Olymp der Entwicklung“ (Wocken 2010, S. 2), wonach nichts mehr käme. Einige Autoren wie Hinz, Sander und Amrhein sehen Inklusion hingegen nur als eine Übergangsphase. Am Ende des Weges steht ihrer Ansicht nach die Phase der Allgemeinen Pädagogik. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass Vielfalt und Heterogenität nicht mehr außergewöhnlich sind. Inklusion wird im Alltag gelebt und nicht mehr thematisiert. Aus diesem Grund braucht es weder einen speziellen Begriff noch ein Konzept oder einen Experten. (vgl. Hinz 2005, S. 12; Amrhein 2011, S. 11)
Zum anderen ist mit Rückblick auf den Ursprung des Begriffs Inklusion und der rechtlichen Entwicklung auf internationaler Ebene ein Zugzwang für Deutschland zu erkennen. Wie erläutert wurde, kommt das Konzept der Inklusion ursprünglich aus dem US-amerikanischen Sprachraum, entwickelte sich dann zum internationalen Standardbegriff und gelangte erst danach nach Deutschland. (vgl. Hinz 2010, S. 1f.) Auch rechtlich betrachtet reagierte Deutschland stets auf internationale Beschlüsse, wie die Salamanca-Erklärung oder die UN-BRK (vgl. Hinz 2013; Sander 2006).
Im Rahmen der Globalisierung ist es für Deutschland essentiell, sich aktuellen internationalen Entwicklungsprozessen anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es handelt sich dabei um zahlreiche Prozesse auf verschiedenen Ebenen, weshalb Globalisierung als sehr komplex und dynamisch zu beschreiben ist. Aufgrund dieser Komplexität ist es auch bisher nicht möglich gewesen, Globalisierung einheitlich zu definieren. Auf die einzelnen Ebenen und Prozesse einzugehen würde zu weit führen (bei weiterführendem Interesse siehe Lee 2010, S. 165ff.). Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Globalisierung für den Bildungssektor eine große Rolle spielt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die KMK betonen bspw., dass Globalisierung eine grundlegende Rahmenbedingung für die Bildung in Deutschland darstellt. (vgl. Lee 2010, S. 165) Auch Ellger-Rüttgardt erklärt bestätigend, dass entgegen des deutschen Bildungsföderalismus „die bundesrepublikanische Bildungspolitik zunehmend zentralistische Züge annimmt, hervorgerufen durch die immer stärker werdende Verflechtung in internationale Bezüge und ablesbar an der KMK-Vereinbarung (2005) über nationale Bildungsstandards“ (Ellger-Rüttgardt 2008, S. 442).
Es wurde zwar deutlich, dass Inklusion aus zweierlei Hinsicht den nächsten logischen Schritt für Deutschland darstellt, dennoch gibt es auch kritische Stimmen. So ist Kronauer zufolge, eine soziale Inklusion immer gefährdet und fragil. Er begründet dies mit der „prekären Verbindung zwischen sozialen Rechten und Vollbeschäftigung. Bereits aus Finanzierungsgründen sind Wohlfahrtsstaaten auf eine hohe Erwerbsbeteiligung angewiesen“ (Kronauer 2010b, S. 33). Er führt weiter aus, dass in der Vergangenheit schon einige Nationen eine Lösung für dieses Problem gesucht haben, jedoch ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Vollbeschäftigung kann nicht garantiert, sondern nur durch Zinsen, Steuern sowie öffentliche Ausgaben beeinflusst werden. (vgl. ebd., S. 33f.)
Weitere Kritikpunkte werden von Kastl aufgeführt. Er bezeichnet Inklusion als „Teilhabe-total“ und bewertet sie als totalitär. Eine vollständige Teilhabe ohne Voraussetzungen gebe es in modernen Gesellschaften aus gutem Grund nicht. Sie würde soziale Teilhabe entwerten und das Ende jeder Individualität bedeuten. (vgl. Kastl 2014, S. 2) Herdt bestätigt diese Kritik, indem er das Partikularisieren als Merkmal von Inklusion herauskristallisiert. „Ein Dazugehören, eine Mitgliedschaft in einem sozialen System kann sich nur dann manifest ausdrücken, wenn ebenso manifest klar wird, wer nicht dazugehört“ (Herdt 1996/97, S. 21). Dies gilt für alle sozialen (Teil-)Systeme, von der Familie über Vereine, Schulklassen oder Betriebe (vgl. Kastl 2014, S. 2).
Weiterhin berichtigt Kastl, dass Inklusion kein Menschenrecht sei. Einige Menschenrechte trügen inklusive Aspekte in sich, aber ein rechtlich verankerter Zugang zu allen gesellschaftlichen Prozessen existiere nicht. Nur bezüglich spezieller, konkret benannter Systeme oder Ressourcen, wie Bildung oder Wahlen, gebe es ein einklagbares Recht. (vgl. ebd., S. 3) Insbesondere mit Bezug auf den gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung stellt er einen Widerspruch fest. „Auf der einen Seite wird angeblich voraussetzungslose Wertschätzung von Vielfalt und totaler Teilhabe propagiert. Auf der anderen Seite werden im Bildungs- und Beschäftigungssystem Leistungsnormen wie selten zuvor auf die Spitze getrieben“ (ebd.). Als Beispiele dienen ihm der Wandel von der Input- zur Output- bzw. Kompetenzorientierung sowie der medialen Idealisierung schöner und leistungsfähiger Körper. Insgesamt betrachtet hält er Inklusion für eine Utopie, die begleitet ist von vielen Widersprüchen und struktureller Unaufrichtigkeit. (vgl. ebd., S. 4)
Unabhängig von allen Pros und Kontras, die der Leitgedanke Inklusion mit sich bringt, kann für das gegenwärtige deutsche Bildungssystem festgehalten werden, dass es sich in der Praxis noch lange nicht in der Phase der Inklusion befindet. Die Segregation ist in Deutschland nach wie vor dominierend. 2009 wurden noch 80% der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Förderschulen unterrichtet. In den meisten Bundesländern findet jedoch allmählich der Übergang zur Integration statt und in einzelnen Ausnahmeschulen werden sogar schon Ansätze einer inklusiven Praxis durchgeführt. (vgl. Amrhein 2011, S. 17; Hinz 2005, S. 12)
Wie das deutsche Schulsystem im Allgemeinen aufgebaut ist, welche Funktionen es erfüllt und welchen Entwicklungen es unterliegt, wird im folgenden Kapitel behandelt.
3 Das deutsche Schulsystem
Die Fragestellung dieser Arbeit, inwiefern Inklusion und das deutsche Schulsystem vereinbar sind, enthält zwei Komponenten. Das Konzept der Inklusion wurde bereits ausführlich im vorangegangenen Kapitel erläutert. Die andere Komponente ist das deutsche Schulsystem. Um die Fragestellung beantworten zu können, müssen beide in ihren Grundzügen erschlossen sein. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein kurzer historischer Einblick gegeben, wie sich das deutsche Schulsystem entwickelte und wie es gegenwärtig aufgebaut ist. Außerdem werden die Aufgaben und Funktionen von Schulen in Deutschland sowie aktuelle bildungspolitische Einflüsse aufgezeigt.
3.1 Die Schulstruktur
Das Schulsystem wird im föderalistischen Deutschland von 16 Länderparlamenten geleitet und bildet die größte Organisation im öffentlichen Dienst. Auf internationaler Ebene passt sich Deutschland stets den aktuellen Entwicklungen im Bereich Qualität an. Lediglich seine Schulstruktur hat es im Gegensatz zur großen Mehrheit der anderen Länder beibehalten und stellt damit zusammen mit Österreich und Teilen der Schweiz eine Ausnahme dar. (vgl. von Saldern 2009, S. 69)
Für Deutschland lässt sich diese Situation zum einen dadurch erklären, dass sie sich zu Zeiten des Nationalsozialismus vom Ausland isolierten und entsprechend nicht mehr im zuvor ausgebauten internationalen Austausch standen. Zum anderen herrschte nach dem zweiten Weltkrieg der „Wunsch nach Restauration vermeintlich bewährter Ideale und Strukturen der Vor-Nazizeit“ (Ellger-Rüttgardt 2012, S. 62) bei gleichzeitiger „Verdrängung und Tabuisierung des Geschehenen“ (ebd.), weshalb insbesondere auf die Personen und Strukturen der Weimarer Republik zurückgegriffen wurde (vgl. ebd.). Die Besatzungsmächte, insbesondere die Amerikaner, wollten das deutsche Bildungssystem nach dem Vorbild internationaler Schulstrukturen reformieren. Letztendlich scheiterte dieses Vorhaben jedoch an der Zerstückelung Nachkriegsdeutschlands, dem Misstrauen und der Angst der Deutschen vor Verlust des deutschen Geistes (vgl. Rubner 2008, S. 22) sowie letztendlich wegen des Kalten Kriegs, wodurch Bildungsfragen an Bedeutung verloren. Lediglich in der sowjetischen Besatzungszone wurde das Modell der Alliierten bis zur Wiedervereinigung von DDR und BRD übernommen. (vgl. von Saldern 2009, S. 70)
Das zuvor bildungspolitisch fortschrittliche Deutschland, das 1717 als preußischer Staat vor den anderen mitteleuropäischen Großmächten die Volksschulpflicht einführte (vgl. Rubner 2008, S. 18), um 1810 die Humboldtschen Bildungsreformen durchführte (vgl. Ellger-Rüttgardt 2012, S. 34) und die führende internationale Position in der Heilpädagogik inne hatte (vgl. ebd., S. 62), griff somit wieder auf seine altbewährten Traditionen zurück.
Das seit 1920 mit der Gründung der Grundschule in Deutschland bestehende sogenannte Gabelungssystem kennzeichnet sich dadurch aus, dass nach einer gemeinsamen Grundschulzeit die Schüler auf verschiedene Bildungsgänge verteilt werden. Während früher zwischen Volksschule, Realschule und Gymnasium unterschieden wurde (vgl. von Saldern 2009, S. 70), sind die Bildungsgänge mittlerweile sehr ausdifferenziert und komplex, wie Abbildung 2 veranschaulicht.
Je nach Bundesland gestaltet sich die Schulstruktur etwas anders. Allen gemeinsam ist zum einen die Kombination von informellem Lernen sowie non-formaler und formaler Bildung. Auch wenn es zu diesen Begriffen keine einheitliche Definition gibt, so kann grob unterschieden werden, dass formale Bildung in den Hauptsystemen der Bildungseinrichtungen, z.B. Schulen, stattfindet und bezogen auf Ziele, Zeiten sowie Förderungen organisiert und strukturiert verläuft. (vgl. Amtmann 2012, S. 58) Am Ende erhält man eine Zertifizierung (vgl. Baumbast/ Hofmann-van de Poll/ Lüders 2012, S. 16). Non-formale Bildung ist meist weniger strukturiert, vollzieht sich nicht in diesen Bildungseinrichtungen und führt daher auch in der Regel zu keiner Zertifizierung (vgl. Amtmann 2012, S. 58; Baumbast et al. 2012, S. 17). Informelles Lernen ist alltäglich, unbewusst und deshalb auch nicht strukturiert. Es kann überall stattfinden und gilt als älteste Form des Lernens. (vgl. Amtmann 2012, S. 58f.; Baumbast et al. 2012, S. 20)
[...]
- Arbeit zitieren
- Nadine Schall (Autor:in), 2015, Inklusion an Schulen: Vision oder Utopie? Chancen und Barrieren eines inklusiven Schulsystems in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594066
Kostenlos Autor werden




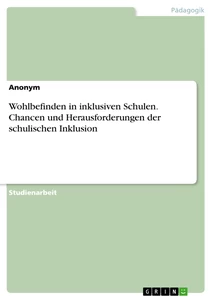





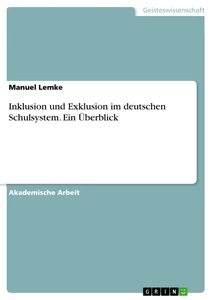






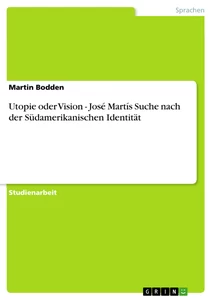


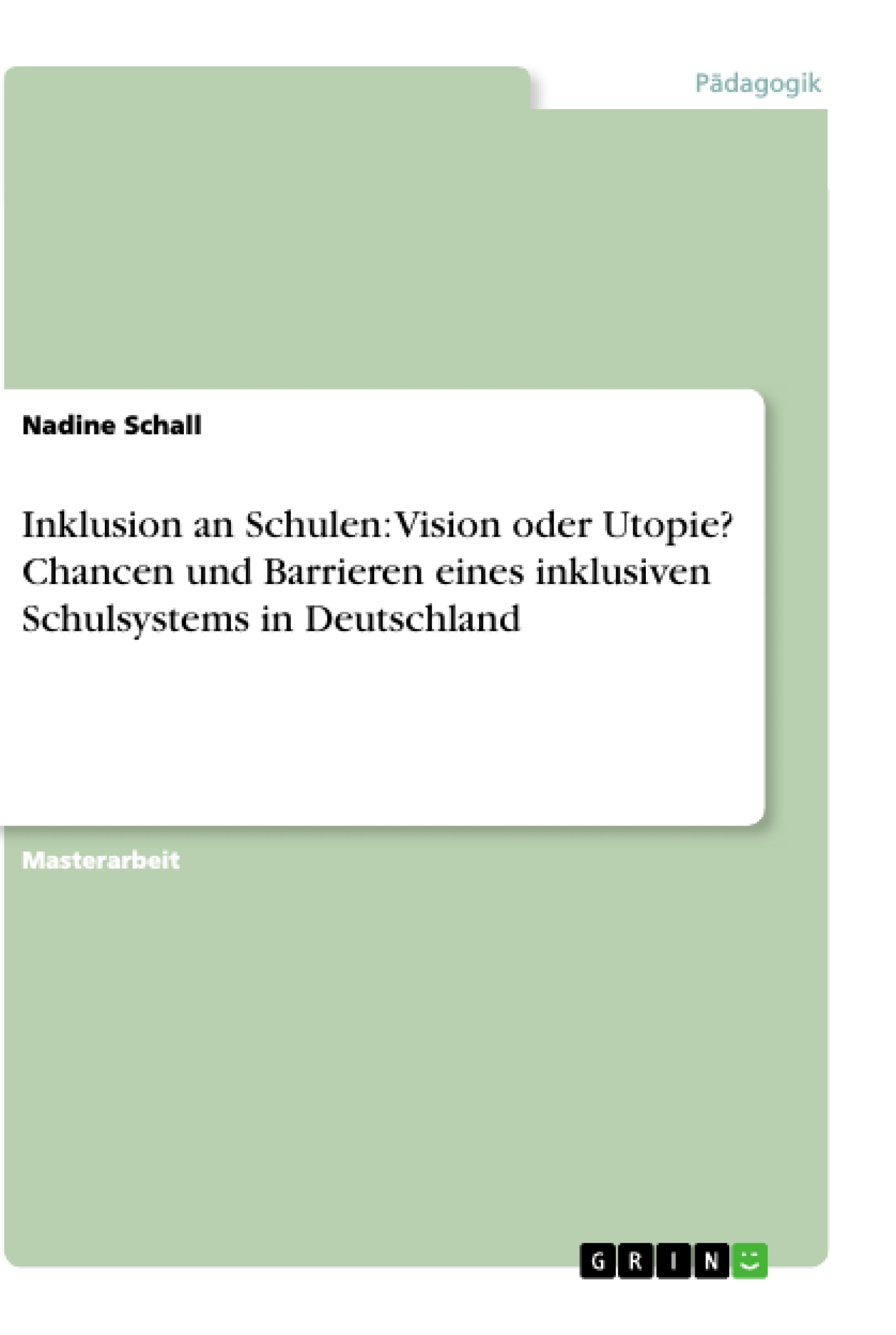

Kommentare