Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Positionen zur Beziehung des Menschen zum Tod
2.1 Thomas Hobbes
2.2 Sigmund Freud
2.3 Georges Bataille
2.4 Alexandre Kojeve
2.5 Elias Canetti
3. Die Medialisierung des Todes
4. Der Tod und Computerspiele
5. Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Als vernunftbegabtes Wesen ist es das Schicksal des Menschen, seine inneren Triebe beherrschen und somit potenziell aufkeimende (Ur-)Instinkte befehligen zu können. Anders als Tiere unterliegt der Mensch nicht (ausschließlich) den natürlichen Affekten. Und doch sucht er offensichtlich einen Weg, den Atavismus des Tötens ausleben oder zumindest betrachten zu können. Aber warum ist das so? Sollte der Mensch nicht eher meiden, was ihn - früher oder später - auslöschen wird?
Es gibt Menschen, die sich der bewussten Auseinandersetzung mit dem (eigenen) Tod dezidiert entziehen, doch die Mehrheit konfrontiert sich tagtäglich mit ihm: Sei es im Alltag (Beruf, Familie), im Glauben (der Ursprung des Todes bildet das Fundament jeder Schöpfungsgeschichte)1, Institutionen der Kultur (z.B. Museen) oder den Medien. Hier kommt es mittlerweile zu einer schieren Inflationierung, einer „Medialisierung des Todes“2. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das menschliche Verhältnis zum Tod im Laufe der Jahrhunderte ein changierendes ist. Natürlich ist es nicht zuletzt die Historie, die die Auseinandersetzung mit dem Tod gewissermaßen aufdrängt. Zu Zeiten von Kriegen oder Seuchen mehr als zu solchen des Wohlstandes. Umso verblüffender scheint es, dass gerade heute, betrachtet man das moderne Europa und die damit korrespondierende Prosperität auf der Grundlage von Frieden und sozialstaatlichen Maßnahmen, die Auseinandersetzung mit und Omnipräsenz des Todes nicht abflaut. Und diese Ambiguität äußert sich nicht zum ersten Mal: Nirgends artikulierte sie sich deutlicher und anschaulicher als in der gleichzeitigen Todesverdrängung und Todessehnsucht der deutschen Bevölkerung zu Beginn des Ersten Weltkriegs.3
Seit dem 19 Jahrhundert findet das Sterben nicht mehr im unmittelbaren Stammes- oder Familienkreis statt. Der Fortschritt der Medizin und die Einrichtung von sozialstaatlichen Institutionen verlagert das Sterben in Krankenhäuser oder Heime. Der Tod wird somit ein Stück weit aus dem Alltag verdrängt, der Fokus richtet sich auf das Leben als solches, zumal ein Leben nach dem Tod durch die voranschreitende Säkularisierung immer mehr in Frage gestellt wird.4
Erlebbar ist heute eine eigenartige Entwicklung: die Thematisierung des Todes (vorrangig durch die Medien) bei gleichzeitiger Verdrängung. Es drängt sich die Frage auf, ob es sich vielleicht nicht lediglich um eine Scheinthematisierung handelt. Denn obgleich auf medialer Ebene das Thema Tod unaufhörlich seine Bahnen zieht (TV-Dramen und Krimis, dramatische Nachrichtenberichterstattungen), wird nur sehr selten das Sterben oder der Tod, beispielsweise in Talkshows als Plattform des öffentlichen Diskurses, konkret in den Fokus vorgenommen. Nicht ohne Grund: Immerhin fliehen viele Rezipienten gerade in die Mediennutzung, um sich von den belastenden Themen des Alltags zu befreien.5 Um eine paradoxe Form dieser Flucht - den Eskapismus in sogenannten „Killerspielen“ oder „Egoshootern“ als Teil des Uses-and-Gratification-Ansatzes - wird der zweite Teil dieser Arbeit handeln. Zuvor jedoch wird, angesiedelt zwischen Todesdrang und Machtgefühl, die menschliche Beziehung zum Tod ein Stück weit thematisiert werden. Hier soll ein kleiner anthropologischer Querschnitt vorgebracht werden. Anhand einschlägiger Positionen wird sich der erste Teil der Arbeit um das menschliche Todesbewusstsein und den Umgang damit drehen. Mit Hobbes, Freud, Bataille, Kojeve und Canetti werden verschiedene Positionen der Geisteswissenschaften zum Thema Tod vorgebracht. Schließlich, nach diesem theoretisch geprägten Abschnitt, rückt dann der heutige (mediale) Umgang mit dem Tod in den Vordergrund. Denn durch die Menschheitsgeschichte hindurch begleitet uns ein Verhältnis zum Tode, das man salopp als Zuschauereffekt bezeichnet: Ergriffen von einer Art „heiligem Schauer“6 - seelisches manifestiert sich in einer körperlichen Reaktion - sind wir fasziniert und zugleich abgeschreckt von dem Anblick einer tödlichen Katastrophe. Während wir noch schaulustig auf das Ereignis gaffen, durchzieht uns der nicht abwegige Gedanke „Es hätte auch mich treffen können.“ Damit nicht genug: Wir suchen gar die Gefahr von waghalsigen Unternehmungen (Fallschirmsprünge, Bungee-Jumping und Drogen-Trips haben Hochkonjunktur), sie verleihen uns die Form von Kick, der nur im Angesicht des Todes seine Wirkung zu entfalten vermag.
2. Positionen zur Beziehung des Menschen zum Tod
Laut Deutschem Grundgesetz endet das Leben mit dem Hirntod. Diese Feststellung erfordert eine Positionierung, eine Bewertung. Menschen bewerten immer, sie können gar nicht anders. Also bewerten sie auch den Tod und setzen sich auf diese Weise zu ihm ins Verhältnis. Allerdings erfolgt die Bewertung entlang von Kultur, Gesellschaftsstruktur und Ökonomie. Zudem stellt sich die Frage, zu wessen Tod sich in Beziehung gesetzt wird. Dem eigenen? Dem eines Freundes oder Verwandten? Eines Mitglieds der Gesellschaft? Einer Gruppe? Je nachdem, um wessen Tod es sich handelt, werden andere Einstellungen eingenommen. Aber auch die Form des Todes spielt eine Rolle. Handelt es sich um einen natürlichen oder unnatürlichen Tod? Erfolgte er nach langer Krankheit oder durch einen Unfall? Die Bewertungen sind geprägt durch die sozialen Kriterien wie Schicht, Alter, Ethnie und Ge- schlecht.7 Im folgenden Abschnitt werden verschiedene kritische Positionen zum Tod vorgestellt.
2.1 Thomas Hobbes
1651 erscheint mit dem Leviathan eine Schrift, die das politische Denken der Neuzeit maßgeblich beeinflusst. Vor dem Hintergrund der englischen Konfessionskriege meint sein Autor, Thomas Hobbes, in der allumgreifenden Angst vor dem Tod den Ursprung der Staatenbildung zu erkennen. Vor einem staatlichen Vertragsschluss, der einen obersten Souverän an die Spitze befehligt, herrsche ein gewaltsamer Naturzustand. Kein positives, nur natürliches Recht bestimme diese Ausgangssituation. Alle gegen alle, homo homini lupus. Von Natur aus sei der Mensch ein böses Wesen, das seinem Nachbarn nichts gönne und ihm gleichermaßen ständig misstrauen müsse.8 Immerhin: in dieser Ausgangslage geht Hobbes von einer Gleichheit aller Menschen (auch die Schwachen können die Starken mittels List übertölpeln) aus und spricht jedem Individuum Freiheit - als ein natürliches Recht - zu. Allerdings führe die eigene Auslebung der Freiheit häufig in den Eingriff in die Freiheit eines Mitmenschen. Der Trieb nach einem angenehmen Leben erfolge dabei zumeist mittels Machtakkumulation. Um die Macht über andere zu haben sei ein Eingriff in deren Freiheit unausweichlich.9 Erst aus der Furcht der Freiheitsberaubung und dem Drang zur Selbsterhaltung heraus erkenne der Mensch, als triebgesteuertes aber zur Vernunft begabtes Wesen, dass ein sicheres Leben nur möglich sei, wenn vertraglich geregelte Gebote das Zusammenleben mitbestimmen. Aus der Anarchie, einem kriegerischen Ursprung, entstehe somit die Gemeinschaft. Fehlgeleitete würde so zu herrschender Gewalt. Unter einer Art sterblichen Gott, dem Leviathan, subsummierten sich die Menschen - aus Furcht, nicht aus Nächstenliebe. Dieser Souverän, als eine Art unbeteiligter Dritter, garantiere Schutz, sei Quell des Lebens und oberster Richter, stelle das Leben seiner Untertanen im Angesicht des Todes sicher.10 Vernünftiges Gesetz, im Gegensatz zum natürlichen Recht auf Selbsterhaltung und Selbstverteidigung, bedürfe der Staatsgewalt, die dessen Einhaltung überwache und notfalls sanktioniere. Im Körper des Souveräns entstehe eine Art Körperschaft des Sozialen.11
Hobbes gelingt mit dieser Vorstellung eine Anthropologie fernab von religiösen Einflüssen und Jenseitsgedanken. Denn die Annahme einer unsterblichen Seele ist bei seiner Herleitung des Zusammenlebens obsolet. Für Hobbes stellt der Tod die absolute Grenze da, ist ein Mensch tot, ist er für die Gesellschaft irrelevant. Sofern es einen allmächtigen Gott gebe, so könne er Tote auferstehen lassen. Da dies aber nicht eintrete, stelle der Tod eine natürliche Grenze dar. Die Furcht vor dieser absoluten Nichtigkeit treibe den Menschen schließlich zur Selbsterhaltung und damit auch zur Befolgung der animalischen Überlebenstriebe. Durch „die Geburt des Staates aus dem Geiste der Gewalt“12 erhebe sich der Mensch quasi über die Todesangst, dämme sie ein. Am Anfang der Ordnung stehe die Todeserfahrung. Sie kann nicht mittels Jenseitsvorstellungen kompensiert werden, nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.
Nur aus der Angst voreinander kommt es, laut Hobbes, also überhaupt erst zur Vergesellschaftung, erfolgt eine Kultivierung. Wenn Wolfgang Sofsky behauptet: „Stets ist die Gewalt das Prius“13,bringt der Autor und Soziologe einen lohnenden Gedanken ins Spiel. Wenn es Gewalt, auch in Form von Mord ist, worauf die menschliche Organisation in Staaten und Gesellschaften laut Hobbes und Sofsky baut, erscheint die These, dass der Mensch die Gewalt in einer Form benötigt, gar nicht so abwegig. Immerhin ist sie, laut Hobbes, bereits im Naturzustand fest in ihm verankert.
2.2 Sigmund Freud
Ähnlich wie Hobbes geht der Begründer der Psychoanalyse-Sigmund Freud -von einem gewaltgeprägten Naturzustand aus. Auch Freud meint, dass soziale und kulturelle Ursprünge der Gewalt entsprängen. In Totem und Tabu, einer kulturtheoretischen Schrift zur psychischen Verfassung der Gesellschaft, erschienen ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs, beschreibt er die Grundzüge der modernen Gesellschaft auf Grundlage ihrer primitiven Vorformen. Im darwinistischen Fahrwasser und unter der Rezeption Ernst Haeckels, der eine Parallele zwischen Phylogenese und Ontogenese von Lebewesens zu erkennen glaubt, meint Freud, in der Entwicklung des einzelnen Individuums seine ganze Gattung repräsentiert zu sehen.14 In der traumatischen „Urszene der Kultur“, so Freud, töten die vom Vater ausgestoßenen Söhne diesen und verspeisen ihn. Anschließend werden sie von Reue ergriffen und inszenieren den Vater als Gott. In Freuds Vorstellung ist also ein Mord der Ausgangspunkt für die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft.15
Das Todesbewusstsein äußerst sich bei Freud vor allem anhand des Gefühlskonfliktes, der sich bei Verlusterfahrungen einstellt. Die „Leiche der geliebten Per- son“16 sei es, die eine innere Dichotomie eröffne und so ein Spannungsfeld zwischen Leben und Sterben generiere. Denn der Mensch müsse dabei „[...] die Erfahrung machen, daß man auch selbst sterben könne, und sein ganzes Wesen empörte sich gegen dieses Zugeständnis; jeder dieser Lieben war ja doch ein Stück seines eigenen geliebten Ichs. Anderseits war ihm ein solcher Tod doch auch recht, denn in jeder der geliebten Personen stak auch ein Stück Fremdheit. Das Gesetz der Gefühlsambivalenz, das heute noch unsere Gefühlsbeziehungen zu den von uns geliebtesten Personen beherrscht, galt in Urzeiten gewiß noch uneingeschränkter. Somit waren diese geliebten Verstorbenen doch auch Fremde und Feinde gewesen, die einen Anteil von feindseligen Gefühlen bei ihm hervorgerufen hatten.“17
Einerseits führe also der Tod einer geliebten Person zu einer Identifikation mit diesem Schicksal, andererseits schleiche sich, laut Freud, dass Gefühl der Unvorstellbarkeit des eigenen Todes ein. Der Tod würde dementsprechend einer verursachenden, unkontrollierbaren Macht zugeordnet, die nicht jeden auf die gleiche Art und Weise treffen müsse. Freud spricht von dem „doch rechten“ Tod der geleibten Person. Aus der daraus resultierenden Reue entspringt für Freud, anders als für Hobbes, eine Form der Jenseitsvorstellung. „An der Leiche der geliebten Person ersann er die Geister, und sein Schuldbewußtsein ob der Befriedigung, die der Trauer beigemengt war, bewirkte, daß diese erstgeschaffenen Geister böse Dämonen wurden, vor denen man sich ängstigen mußte.“18
In der Reminiszenz an den Toten, die mit diesem nicht gestorben war, bildete sich, Freud zufolge, die Annahme anderer Existenzformen nach dem Tod. Mit dieser Absicherung des Seelenheils des Verstorbenen wurde gleichzeitig ein Garant für die eigene Zukunftssicherheit gewährleistet.19 1920 erscheint mit Jenseits des Lustprinzips eine bis heute umstrittene Schrift. Freud betrachtet hier das Leben unter dem ständigen Einfluss von Lebens- und Todestrieben, die beide zur Wiederherstellung des „Ausgangszustandes“20 drängen. „[.] es war der erste Trieb gegeben, der, zum Leblosen zurückzukehren.“21
Anders als bei Hobbes dient der biologische Trieb des Menschen bei Freud nicht ausschließlich der Selbsterhaltung. Vielmehr verwiesen sowohl Lebens- (Eros) als auch Todestrieb (Thanatos) auf die Rückkehr zum organischen Zustand. Über den Umweg der hervorgebrachten Kultur (Sublimierung als (unbewusste) Umwandlung der libidinösen Triebe) stünde der Lebenstrieb geradezu im Dienste des Todestriebs.22 Es wird die Diskussionswürdigkeit dieser freudschen These deutlich, wenn er schreibt:
„[...] daß der lebende Organismus sich auf das energischeste gegen Einwirkungen (Gefahren) sträubt, die ihm dazu verhelfen könnten, sein Lebensziel auf kurzem Wege (durch Kurzschluß sozusagen) zu erreichen, aber dies Verhalten charakterisiert eben ein rein triebhaftes im Gegensatz zu einem intelligenten Stre- ben.“23
Hier könnte man Freud sophistisch vorhalten, dass sich der von ihm beschriebene Todestrieb ja gerade als Mittel zum Zweck - id est, dem Leben - akkumuliert und nicht, wie Freud meint, auf die Vervollständigung des organischen Zustandes verweist.
Unabhängig von dem fragwürdigen Dualismus erscheint eine andere These Freuds weitaus stimmiger. In Das Unbehagen in der Natur aus dem Jahr 1930 konstatiert der Analytiker, dass die fortschreitende Beherrschung der Natur als eine Form der Menschenbeherrschung betrachtet werden müsse. Nach den Wirren des Ersten Weltkriegs und den aufsteigenden nationalsozialistischen Bewegungen weiß Freud sehr wohl um die Fähigkeit der Menschen, einander auszurotten. Dies erzeugt für ihn eine allumgreifende Angststimmung.24
2.3 Georges Bataille
Während für Freud Mord und Inzest die stärksten menschlichen Gelüste, zugleich aber Tabus darstellen, äußert sich das Tabu beim französischen Schriftsteller und Philosoph Georges Bataille (1897-1962) in Form des Heiligen. So beschreibt er anhand von Urreligionen die Polarität von Tabu und Übertretung - Schrecken und Anziehung der Lebenskontinuität. Unter der Einheit des Wechsels versteht er das Heilige. Zwar hätten die monotheistischen Religionen diesen Dualismus aufgebrochen, doch das Tabu sei noch immer an das Heilige gebunden; in Form der Unverletzlichkeit und Verehrung des einen Gottes. Die Sünde wäre somit in das Reich des Teufels eingeordnet worden, die Übertretung würde mit Unheiligkeit gebrandmarkt. Ein heiliges Tabu fiele in den „modernen“ Religionen (Judentum, Christentum, Islam) somit gänzlich weg. Worauf Bataille hinaus will ist, dass gerade das Tabu ein wesentlicher und nicht eigentlich „unheiliger“ Bestandteil der Erotik ist. Denn die Übertretung übe notabene eine gewisse Anziehung aus, die sich in der Erotik manifestiere.25
„Es gibt nicht eine einzige Art von Widerwillen, in der ich nicht eine Affinität zum Verlangen erkenne. Der Schrecken vermischt sich zwar nie mit der Anziehung: aber wenn er sie nicht aufhalten, nicht zerstören kann, verstärkt der Schrecken die Anziehung.“26
1957 betrachtet Bataille in L'Erotisme das Leben als dialektische Oszillation zwischen einer Kontinuität und Diskontinuität. Die Selbsterhaltung als eine Form der Diskontinuität gegenüber der Kontinuität des dahinschwindenden Lebens. Ähnlich wie Freud, der Lebens- und Todestrieb als Antagonisten gegenüberstellt, ist es für Bataille das Mühsal der Aufrechterhaltung der diskontinuierlichen Selbsterhaltung gegenüber der Zurückführung in die „organische“27 Kontinuität. Das Übergreifen der Kontinuität auf die Diskontinuität findet Bataille im Tod und der Sexualität wieder. Das bedeutet, dass Leben an sich ist für Bataille ohne die Kontinuität der Lebensvorgänge gar nicht möglich. Unter dieser Betrachtung erscheint Batailles Argumentation gar biologisch. Schrecken und Anziehung der Kontinuität, das betrachtet er denn auch als das entscheidende Moment des Übergangs vom Tier zum Menschen. Bataille formuliert es als das Todesbewusstsein.28
[...]
1 Vgl. Leander Scholz: Symbolisierung des Todes. In: Einführung in die Kulturwissenschaft. Hrsg. von Maye, Harun/Scholz, Leander. München. Wilhelm Fink 2011, S. 240.
2 Klaus Feldmann: Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanatologie im Überblick. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften GWV Fachverlage GmbH, 2010. S. 100.
3 Vgl. ebd., S. 60.
4 Vgl. ebd., S. 59.
5 Vgl. Elihu Katz, David Foulkes: On the Use of Mass Media as “Escape”: Clarification of a Concept . In: The Public Opinion Quarterly . Vol. 26, Nr. 3, 1962, S. 377-388.
6 Vgl. Konrad Lorenz: Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. 25. Auflage. München: dtv Verlagsgesellschaft. 2007, S. 242.
7 Vgl. Feldmann: Tod und Gesellschaft. (wie Anmerkung 2, S. 86).
8 Thomas Hobbes: Leviathan oder Die Materie. Form und Macht eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwesens. Hrsg. von Hermann Klenner. Hamburg: Meiner 1996, S. 107ff.
9 Vgl. ebd.
10 Vgl. ebd., S. 141 ff.
11 Vgl. ebd., S 146 ff.
12 Burkhardt Wolf: Die Codierung von Gewalt. In: Einführung in die Kulturwissenschaft. Hrsg. von Harun Maye/Leander Scholz. München: Wilhelm Fink 2011, S. 85.
13 Wolfgang Sofsky: Traktat über die Gewalt. Frankfurt/M.: Fischerverlag 2005, S. 7.
14 Vgl. Stefan Höppner: Der Vatermord als Urszene der Kultur. Mit „Totem und Tabu“ beginnt eine neue Ausgabe von Sigmund Freuds Werken. Online abrufbar unter: https://literaturkritik.de/id/18754 (03.12.19).
15 Vgl. ebd.
16 Sigmund Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod. In.: Das Unbehagen in der Kultur, und andere kulturtheoretische Schriften. Hrsg. v. Ilse Grubrich-Simitis, Frankfurt/M: Fischerverlag 1994, S. 133-161 (hier: S. 153154).
17 Ebd., S. 153
18 Ebd., S. 155.
19 Vgl. ebd.
20 Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips. In: Das Ich und das Es. Metapsychologische Schriften. Hrsg. v. Ilse Grubrich-Simitis, Frankfurt/M.: Fischerverlag 2003, S 191-249 (hier: S. 223).
21 Ebd.
22 Vgl. ebd., S. 248.
23 Ebd., S. 224.
24 Freud: Das Unbehagen in der Kultur. Studienausg. Bd.9. Frankfurt/M: Fischerverlag 1969, S. 191.
25 Traugott König: Philosoph der Verschwendung. Das aufklärerische Werk von Georges Bataille. In: Zeit online. 04. März 1977. Online abrufbar unter: https://www.zeit.de/1977/11/philosoph-der-verschwendung/kom- plettansicht (05.12.19).
26 Georges Bataille: Das obszöne Werk. Die Geschichte des Auges. Reinbek bei Hamburg 1982, S. 49ff.
27 Vgl. König: Philosoph der Verschwendung. (wie Anmerkung 25).
28 Vgl. Feldmann: Tod und Gesellschaft (wie Anmerkung 2, S. 240).
- Arbeit zitieren
- Felicitas Ziebarth (Autor:in), 2020, Zwischen Todestrieb und Machtgefühl, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593670
Kostenlos Autor werden







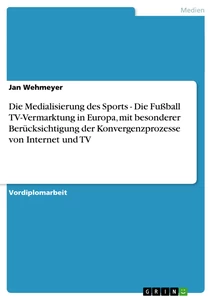




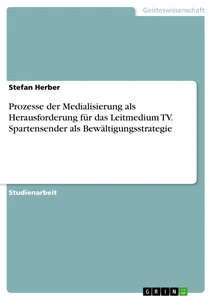









Kommentare