Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung
2 Dina – eine (Bildungs-)Biografie
3 Schule – Lernen und Sozialisation
3.1 Wann was wie (und ob) gelernt wird
3.2 Wie Schule (auch) wirkt
4 Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung
4.1 Verortung im Bildungssystem
4.2 Der Schulversuch
4.2.1 Zielsetzung der Schulform
4.2.2 Rahmenbedingungen
4.2.3 Zielgruppe und Sozialstruktur
5 Bedingungen Jugendlicher zur Schulzeit und der mittleren Jugend
5.1 Schule heute
5.2 Die Jugendphase - aus sozialwissenschaftlicher und weiteren Perspektiven
5.3 Die Übergangssituation erster Schwelle - ihre Bedingungen, Risiken und Chancen
5.4 Spezielle Bedingungen in der Versuchsschulform
5.4.1 Lern- und Scheiter-Erfahrungen
5.4.2 Stigmata und Diskriminierung
5.4.3 Migrationserfahrungen
5.4.4 Milieu
5.4.5 Peergroups
6 Theoretische Grundlagen
6.1 Das Konzept der Lebensbewältigung
6.2 Der Empowerment-Ansatz
7 Auftrag und Handlungsrahmen der Schulsozialarbeit
7.1 Bedingungen der Schulsozialarbeit im Jahr
7.2 Allgemeine Aufträge von Schulsozialarbeit
7.3 Aufgaben und Aufträge im Kontext der BÜA
8 Fazit
9 Methodische Anregungen zur Konzeptionsentwicklung
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Im Schuljahr 2020/2021 kommt auf die Berufsbildenden Schulen in Hessen eine neue Schulform zu, an deren Erprobung bisher nur einzelne, wenige Schulen beteiligt waren. Das vorausgegangene Pi-lotprojekt wurde mit relativer Eile umgesetzt (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 5) und dann aber mit erheblichem wissenschaftlichem Aufwand begleitet. Auch der nachfolgende Schulversuch wurde ebenfalls noch durch die TU Darmstadt und Herrn Prof. Dr. Ralf Tenberg betreut. Aus dem Kreis der beteiligten Kolleginnen und Kollegen gab es sowohl ernüchternde, neutrale als auch en-gagiert-optimistische Rückmeldungen. Als irritierend fiel bei der Verfolgung des Versuchs immer die Rolle der sozialpädagogischen Fachkräfte auf, deren Einsatz gleich zu Beginn – in der Evaluation des Pilotprojektes – als unerlässlich und noch zu gering ausgewiesen wurde (vgl. Tenberg und Berg-mann 2017, S. 38). Im eigentlichen Schulversuch war von der Sozialpädagogik plötzlich kaum noch die Rede; in offiziellen Flyern des Kultusministeriums fanden sich Verlautbarungen dazu erst gar nicht mehr (Speier 2017). Nach neuester Veröffentlichung im Januar dieses Jahres wird wieder ein verschwindend kleiner Stellenanteil (vgl. Becker 2017, S. 7) für die Schulsozialarbeit in der neuen Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA) ausgewiesen. Eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge ist dann für die Betreuung von 80 Jugendlichen aus prekären Lebenslagen und mit unsicheren beruflichen Perspektiven zuständig, wobei doch als oberstes Ziel die Kompetenzförde-rung für die Ausbildungsreife und die rasche Überleitung in die berufliche Erstausbildung ange-strebt sind – ganz unabhängig von den Wünschen, Träumen und Zielen der jungen Menschen. Ein sozialpädagogisches Konzept, welches dieses Konstrukt tragfähig macht, sofern dies aus berufsethi-scher Sicht mitgetragen werden könnte, muss an jeder Schule selbstständig entwickelt werden. Es drängt sich die Frage auf, ob es damit getan sein kann, Kompetenzen zu fördern, berufliche Orien-tierung zu bieten und bei den Bewerbungen zu helfen. Vor allem, wo es zumindest ähnliche Kon-zepte an den abgebenden Schulen doch auch gibt. Aber warum gelangten diese jungen Menschen nicht in Ausbildung? Und wollten sie dort überhaupt hin?
Die vorliegende Arbeit klärt, soweit das abschließend möglich ist, die Leitfrage: Welche Bedingun-gen m ü ssen innerhalb des Schulsystems und der neuen Schulform geschaffen werden bzw. wel-che Bedingungen des Schulsystems m ü ssen ver ä ndert werden, damit junge Menschen ohne oder mit Hauptschulabschluss in der B Ü A ihre pers ö nlichen, beruflichen Ziele entwickeln und errei-chen k ö nnen? Dabei wird unterstellt, dass das inhaltliche Konzept der BÜA neuesten Erkenntnissen zu Didaktik und Methodik beruflicher Bildung genügt. In den Blick geraten dadurch die Lebensbe-dingungen der jungen Menschen zuhause und in der Schule, die die persönliche Entwicklung und Entfaltung und das formelle Lernen in Schule möglich machen, behindern oder gänzlich verhindern.
Ziel ist die Ableitung von Konzeptionsgrundlagen in Form von Handlungsempfehlungen an die sozi-alpädagogischen Fachkräfte in Kombination mit einer kleinen methodischen Anregung, die als Ent-wicklungsgrundstein gesehen werden kann.
Gleichzeitig darf nicht verschleiert werden, dass ein Grundkonzept, welches in den einzelnen Schu-len womöglich auf Basis der Handlungsempfehlungen entwickelt werden kann, zwar etliche Schü-lerinnen und Schüler adressiert, die exakte Ausgestaltung aber der Freiheit des Aushandlungspro-zesses mit den Individuen unterliegt. Es soll deutlich werden, dass die Sozialpädagoginnen und So-zialpädagogen zuletzt immer mit den speziellen Einzelfällen und ihren Bildungsbiografien und mi-lieu-geprägten Normen und Werten zu tun haben. Die Soziale Arbeit arbeitet mit Menschen sozial. Das heißt, dass keine allgemeinverbindlichen Lösungen entwickelt werden können, die dann für alle Zeit für alle Lernenden dieser und jener Schule oder Schulform zutreffen. Um dies in den Fokus zu rücken und den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, sich auch emotional auf die adres-sierten Personen der Ausarbeitung einzulassen, ist der Arbeit die Bildungsbiografie der Schülerin Dina vorgeschaltet.
Um die Erkenntnisse aber dann von der rein emotionalen Ebene auf eine breite wissenschaftliche Basis zu stellen, erfolgt im ersten Teil der Arbeit die Betrachtung der Umwelt, in welcher der Schul-versuch durchgeführt wird. Zuerst werden neurobiologisch-psychologische Erkenntnisse zusam-mengetragen, die eine Aussage dazu treffen sollen, unter welchen psychologischen Bedingungen überhaupt (formell) gelernt wird und wann nicht. Im Anschluss werden die Sozialisationsfunktionen der Schule allgemein dargelegt und Pilotprojekt und Schulversuch selbst vorgestellt, um eine indi-viduelle Verortung zuzulassen. Auch die Vorstellungskraft bezüglich der äußeren Rahmenbedingun-gen soll dadurch gestärkt werden. Gleichsam können Chancen und Grenzen antizipiert werden. Bei der Erläuterung zum Schulversuch werden die Zielsetzung (durch das Kultusministerium), die un-terrichtlichen und praktischen Rahmenbedingungen, sowie die Zielgruppe und Sozialstruktur mit-hilfe der Zusammenführung mehrerer wissenschaftlicher Erhebungen dargestellt.
Im nächsten Schritt soll die Lebenswelt der Adressatengruppe vertieft analysiert werden. So wird ein Blick auf die aktuellen Bedingungen von Schule und Unterricht geworfen und die Jugendphase auch in Abgrenzung zur Jugend anderer Generationen dargelegt. Von besonderer Bedeutung ist für die jungen Menschen – wenn auch zu etwas unterschiedlichen Zeitpunkten – der Übergang soge-nannter erster Schwelle, von der Schule in die berufliche Erstausbildung. In diesem Abschnitt soll der Frage nachgespürt werden, warum so wenige Jugendliche in Ausbildung kommen und wo die Unterschiede dieser Bedingungen zu denen noch vor wenigen Jahrzehnten liegen.
Besonders relevant sind dann die individuellen Aspekte der Lernenden, die die BÜA besuchen wer-den. Unter Zuhilfenahme der Auswertungen der Vorläuferschulen können statistisch relativ genau Sozialstruktur und Hintergründe zu den Jugendlichen erfasst werden. So finden sich im Kapitel 5.4 Informationen zu Lern- und Scheiter-Erfahrungen im bisherigen Schulleben, Stigmata und Diskrimi-nierung, Migrationserfahrungen, dem Milieu und den peergroups. So wird schon ein relativ umfas-sendes Bild von möglichen Bedingungen vieler Schülerinnen und Schüler gezeichnet.
Zur theoretischen Untermauerung werden in den darauffolgenden Abschnitten 6.1 und 6.2 sowohl das Bewältigungskonzept nach Böhnisch als auch der Empowerment-Ansatz nach Herriger vorge-stellt und die für die Adressatengruppe relevanten Aspekte auf deren Ausgangslagen hin transfe-riert.
Zur folgenden Auftragsklärung werden die aktuellen Arbeitsbedingungen der Schulsozialarbeit (auch im Vergleich zur Historie) beleuchtet und allgemeine Handlungsaufträge formuliert. Erst im letzten Schritt können spezielle Aufgaben und Aufträge für die Schulsozialarbeit und der BÜA auf Basis der bekanntgewordenen Ausgangslagen und Rahmenbedingungen abgesteckt werden. Auch auf übergeordnete, ggf. selbst initiierte Aufgaben und Aufträge sozialer Arbeit im Kontext dieses Schulversuchs wird eingegangen werden.
Drei Aspekte, die am Rande in Erscheinung treten, können vor allem aufgrund der Umfangsbe-schränkung der Arbeit nicht intensiver behandelt werden. So müssen Gender-Aspekte auf einer oberflächlicheren Ebene bleiben, wenngleich König et al. (vgl. 2011, S. 414) hier durchaus Unter-schiede in Leistungsvertrauen und Selbstbild benennen können. Trotzdem bleiben die genderab-hängigen Notenunterschiede marginal, weshalb auf die Vertiefung dieses Themas verzichtet wurde.
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben didaktisch-methodische Vertiefungen, weil diese den Fachdidak-tiken und ihren aktuellen Forschungsergebnissen überlassen werden sollen – insbesondere auch deshalb, weil eine Herangehensweise über Didaktik und Methodik alle Lernenden in Deutschland beträfe und für die Problemlagen der Adressatengruppe von geringerer Bedeutung zu sein scheint.
So wird auch die aktuelle Resilienzforschung nicht in einer möglicherweise auch interessanten Tiefe und Breite behandelt. Die Ähnlichkeiten und Schnittmengen mit dem Empowerment-Ansatz haben mich dazu veranlasst, eine Entscheidung zugunsten des besser erforschten Empowerments nach Herriger zu treffen und nicht noch weitere Themengebiete zu eröffnen, vor allem da die vorliegende Arbeit ohnehin schon einige Themenbereiche eröffnet und Bezugsdisziplinen streift, um die The-matik ausreichend gründlich erfassen zu können.
„ Ziel ist, Sch ü lerinnen und Sch ü lern schon nach einem Jahr den Wechsel in die duale Berufsausbildung und die ausbildungsbegleitende Erlangung eines Haupt- oder mittle-ren Schulabschlusses zu erm ö glichen. “ (Hessisches Kultusministerium)
Als Dina Ihr Zeugnis der 8. Klasse in der Hand hält, ist mit einem endgültigen, unumstößlichen Paukenschlag klar: Der Quali ist nicht zu erreichen. Sie kann nicht auf eine Realschule gehen. Sie muss arbeiten. Auch für Mama und Papa und die anderen drei Mädchen zuhause. Ihre beiden Schwestern und ihre Cousine Samalé, die auf der Flucht ihren Vater, Dinas Onkel, und ihre Mutter, Tante Meryed, verloren hatte.
Irgendetwas ist schiefgelaufen. Erst hat alles so gut ausgesehen. Der neue junge Deutschlehrer hatte sich richtig Mühe gegeben und ihr immer viele Hilfen mitgebracht. Deutsch ist eine schwere Sprache. Das war einer der ers-ten Sätze, die Dina gelernt hatte. Nicht, dass das Teil der Sprachförderung in der InteA Klasse gewesen wäre. Aber diesen Satz sagten einfach immer viele Leute. Der Mann beim Arbeitsamt, der nur die Schultern gezuckt hatte, als ihr Vater gefragt hat, wie er in Deutschland arbeiten könne. Als Flüchtling ohne geklärten Aufenthaltsstatus wohl erst mal gar nicht. Der Amtsarzt sagte es, als er versuchte mit Mzgen über die Kinder zu sprechen. Ihre Mutter sah inzwischen aus wie 63, nicht mehr wie 43. Aber ohne die Fotos aus dem letzten Sommer, die zuhause im zerbombten Haus geblieben waren, würde ihr das ohnehin niemand glauben. Mzgen war dünn geworden auf der Flucht, ihre Haut fahl und ihre Augen müde. Ihre Schwester war tot und in Deutschland ist es kalt. Um mit ihrer Familie hier herkommen zu können, hatte sie mit dem Mann von dem kleinen Bus irgendetwas gemacht. Dina will es nicht wissen. Die deutschen Mädchen in der neuen Klasse, besonders die mit den rot gefärbten Haaren und den T-Shirts, wo man den Bauchnabel sehen kann, wer weiß, was die so macht. Immerzu fragt sie, warum Dina das Kopftuch trägt. Ich will es, sagt Dina immer und die Lehrerin sagt dann: „Lasst sie jetzt endlich. Sie lernt das bestimmt noch.“ Neben der neuen Klasse gibt es auch ein Büro, da ist eine Frau, die Dina hilft die Fahrkarten für sich und Mihila zu beantragen, obwohl sie das für Mihila eigentlich nicht darf. Das muss die Grundschule machen. Aber da gibt es niemanden, der das macht.
„ Einer hat irgend-wie immer Hunger. Auch wenn sie essen, die Kleinen, scheint es nie ge-nug zu sein, um die Seele satt zu ma-chen. “
„ Wie ist das eigent-lich, wenn ich hier dann einen Beruf lerne. Darf ich den dann ü berhaupt machen? “
„ Mihila wollte fra-gen ‚ Mama, was machst du, wo gehst du hin? ‘ , aber ihr Vater schlug ihr auf den Mund be-vor das erste Wort heraus war. “
„ Im Wohnheim lebt ein Junge, der sagt immer, hier laufen alle nackt rum. Ich lache dann immer, aber er hat irgend-wie recht. “
„Ihr könnt, wenn ihr nix findet, in die BÜA gehen und in die Metalltechnik hineinschnuppern oder auch was über Hauswirtschaft lernen. Das können besonders die Mädchen gut gebrauchen“, sagt der Lehrer. Und Dina kreuzt Wirtschaft an, für alle Fälle. Sie will Rechtsanwältin werden und für ihren Cousin Hamsa kämpfen, der nicht hierbleiben durfte. Der soll mal schön zu-hause euer Land verteidigen, so wie wir das hier früher auch gemacht ha-ben, hat der Nachbar gesagt und nicht gewunken.
Dina freundet sich mit Dilek an. Das passt so gut. Dileks Familie lebt schon so lange hier, lange vor Dileks Geburt. Ihr Vater hat hier als junger Mann bei Opel Arbeit gefunden und ist gleich dageblieben. Dileks Bruder Mesut hat im-mer Zigaretten dabei. Dina raucht jetzt auch ab und zu mit Dilek und Mesut und sie ist in Wahrheit schon fast 19. Deshalb nimmt sie Mesuts Bier am kleinen Wartehaus beim Bus und hat gar kein schlechtes Gewissen. Mit 18 darf man das hier schon lange.
„ Hamsa ist gro ß und d ü nn und ein Apotheker. Hier w ä re er das nicht geblieben. “
„ Ich glaube, Mesut will mich heiraten. Meine zur ü ckhal-tende Art gef ä llt ihm und ich bin keine deutsche Schlampe, hat er gesagt. “
Beim Beratungsgespräch mit dem Lehrer ist der erst mal ganz begeistert. „Du hast dich ganz schön integriert! Nur die Jessy kannst du nicht leiden, was? … Aber mit den neuen Freunden und dem Mesut sind deine Leistungen ganz schön in den Keller gegangen. Du musst schon mal wieder mehr tun, wenn du eine Ausbildung bekommen willst! Für die Rechtsanwältin reicht das jedenfalls nicht. Aber das macht doch auch nichts. Wäre vielleicht so-wieso ein bisschen viel auf einmal, oder?“
Mihila ist in der Schule ausgelacht worden. Wegen den Kleidern. Dina geht nicht mehr zur Schule. Sie arbeitet jetzt viel bei Penny. Die Familie braucht das Geld. Manchmal bringt sie ihrer Mutter Blumen mit. Dann lächelt sie. Manchmal sieht sie Jenny mit den roten Haaren. Jenny ist schwanger. Von Mesut. Aber das ist jetzt egal. Am Montag ist die Anhörung, dann wissen sie, ob sie hierbleiben können. In die neue Schule kann sie gehen, wenn sie hier-bleiben dürfen. Dina will nachhause.
„ Für das erste Praktikum habe ich 24 Briefe ge-schickt. Das war sehr teuer. Am Schluss war ich bei Penny. Ich habe Regale aufgefüllt und Geld daf ü r bekom-men. “
„ Aber wo ist das ei-gentlich? “
Der Lehrer kauft auch bei Penny ein. Immer wenn er Dina sieht, fragt er, wa-rum sie nicht mehr komme. Ob es wegen Mesut wäre. Dilek würde das be-stimmt verstehen. „Ich verstehe nicht“ sagt Dina und er denkt, sie meine ihn.
„Naja, auf der BÜA wird alles anders! Das wird schon!“ sagt er freundlich und winkt zum Abschied, als er auf sein Fahrrad steigt.
Als Dina Mesut einmal gefragt hatte, ob Herr Schleyer arm ist, hatte der nur gelacht. „Der fährt nur zum Spaß mit dem Fahrrad. Weil er’s kann“ hatte er dann gesagt. Was Mesut kann, weiß sie jetzt, denkt Dina.
„ Ich meine aber al-les hier. “
Ja. Anders. “
„ Aber was kann ich eigentlich? “
3 Schule – Lernen und Sozialisation
Bevor eine spezielle Schulform, eingebettet in einem kleinen, speziellen System der beruflichen Bil-dung im Detail betrachtet werden kann, soll an dieser Stelle zunächst etwas Allgemeines zum Ler-nen in allen Schulformen deutlich gemacht werden. Denn die aktuellen Erkenntnisse, wie Jugendli-che überhaupt lernen (können) und wann sie es im Kontext formeller Bildung tun und nicht tun, hat längst nicht bis in alle Schulformen und Bildungskonzepte Eingang gefunden, wenngleich das Inte-resse daran doch der Kern schulischen Handelns sein müsste. So soll der folgende Abschnitt gewis-sermaßen als Wissensgrundlage für alle an Bildung Beteiligten dienen und als Basis für die Betrach-tung spezieller Situationen, Zielgruppen, Beteiligten und Bedingungen dieser Arbeit fungieren.
3.1 Wann was wie (und ob) gelernt wird
Gerhard Roth, promovierter Philosoph und Biologe, ist Professor für Entwicklungsneurobiologie der Universität Bremen und hat aus seiner Perspektive heraus deutlich gemacht, dass es bislang keine schulrelevante Forschung in der Hirnforschung gebe, wohl aber Erkenntnisse, die in Zusammenar-beit mit Psychologinnen und Psychologen entstanden. Diese seien für die Bedingungen erfolgrei-chen Lehrens und Lernen von großer Bedeutung und behandeln u. a. die Bedeutung von Vorwissen, Aufmerksamkeit und Motivation, das Verhältnis von lehrerzentriertem und schülerorientiertem Unterricht, Aspekte von Intelligenz, Fleiß und Wiederholung, aber auch der Stoffdarbietung sowie den Rahmenbedingungen des Kurzzeitgedächtnisses, vor allem aber die Frage der Lehrerpersön-lichkeit und des vertrauensvollen Verhältnisses der am Lernprozess beteiligten (vgl. Roth 2015, S. 414, S. 11).
Roth beschreibt als für das Lernen in Schulen, also die Erlangung formaler Bildung, notwendige Vo-raussetzungen auf Seite der Lernenden kognitive und soziale Offenheit, Neugier, Gewissenhaf-tigkeit, Verträglichkeit, eine gute Impulskontrolle. Er begründet dies damit, dass dies notwendige Eigenschaften sind, die eine gute Stressverarbeitung und Selbstberuhigung sowie Bindungen er-möglichen. Darüber hinaus sind dann auch eine hohe Motivierbarkeit und die Fähigkeit gegeben, Gegebenheiten und Herausforderungen realistisch einzuschätzen und Risiken zu erkennen. Dadurch könnten Lernende sich selbst realistisch etwas zutrauen, sich nicht selbst über- oder un-terschätzen und müssten keine großen Versagensängste entwickeln (vgl. Roth 2015, S. 339). All diese Merkmale benötigen Roth zufolge der Unterstützung durch die Schule und die dortigen Ak-teure (ebd. S. 340). Abhängig ist die Ausprägung dieser Merkmale maßgeblich von den psychosozi-alen Verhältnissen der Herkunftsfamilie, besonders entwickelt in den frühkindlichen Jahren (ebd.).
Roth geht speziell auf die Aspekte der Zielorientierung und Selbstmotivation sowie auf Anstren-gungsbereitschaft, Ausdauer und Fleiß ein. Unter dem Aspekt der Zielorientierung macht er deut-lich, dass für das Lernen in der Schule ein klar definiertes, erreichbares Ziel notwendig ist, sowie die Fähigkeit ablenkende Momente abzuwehren und unter realistischer Selbsteinschätzung ausrei-chend Ausdauer aufzubringen (vgl. Roth 2015, S. 340–341). Nachgewiesen ist inzwischen eindeutig, dass nichts gelernt wird, was nicht mit einer gewissen Anstrengung einhergegangen ist. Eine ge-wisse Herausforderung ist dem Lernerfolg also dienlich, zu starker Stress hingegen, wodurch Ver-sagensängste initiiert und etabliert werden können, wirkt kontraproduktiv. Der Einschätzung des Lernniveaus obliegt also große Verantwortung (ebd., S. 341–342).
Ebenso wichtig ist ein dem Gehirn angemessener Unterricht, welcher es den Lernenden möglich macht, die Zeitspannen, in denen Aufmerksamkeit und Konzentration möglich sind, gewinnbrin-gend einzusetzen (vgl. Roth 2015, S. 344–345). Weitere Aspekte zum Unterricht selbst, was also eine geeignete Didaktik und Methodik angeht, werden aufgrund des Fokus der vorliegenden Arbeit vernachlässigt und sollen in detailreichen Ausführungen den Fachdidaktiken überlassen bleiben; besteht doch zur betrachteten Schulform BÜA und der Zielgruppe der dort lernenden zumindest ein dringender Verdacht, dass die zum Teil demotivierenden Bildungsverläufe der jungen Men-schen wenig mit der Art und Weise des eigentlichen Unterrichts zu tun haben1.
Roth (2015, S. 333–338) beschreibt auch auf Seiten der Lehrkräfte unabdingbare Voraussetzungen, die das Lernen in der Schule ermöglichten, bzw. deren Mangel Lernen behindern oder sogar ver-hindern kann. So unterstreicht Roth noch einmal die ‚Hattie Studie‘ (vgl. Roth 2015, S. 333), nach welcher 30 - 40 % des Lehr- und Lernerfolgs [unter den Kriterien Hatties] durch die Lehrerpers ö n-lichkeit ausgemacht werden (Hattie 2018). Roth unterstützt vor allem Glaubwürdigkeit, Kompe-tenz, Feingefühl und Kritikfähigkeit der Lehrenden als notwendige Faktoren (Hattie 2018; vgl. Roth 2015, S. 333–338). Auch Hüther bezieht sich in seinen Thesen auf eine Kultur von gegenseitiger Anerkennung, Wertschätzung und Ermutigung als notwendige Basis für das gemeinsame Lernen und den Lernerfolg (vgl. Hüther 2016, S. 159–160).
Während zunächst allgemein für das Lernen förderliche Aspekte oder notwendige Faktoren be-schrieben wurden, soll nun auch der Blick auf einen wichtigen, vielleicht sogar den wichtigsten lern-behindernden oder sogar lernverhindernden Faktor – die Angst – gelegt werden.
Angst, wie sie junge Menschen an Schulen aus unterschiedlichen Gründen hie und da oder leider auch chronisch entwickeln oder erleben, hemmt kreative Prozesse und vor allem verhindert die Angst das, was beim Lernen so wichtig ist: das Verknüpfen des Gelernten mit bereits bekannten Inhalten, um die neue Kenntnis insgesamt anzuwenden und auf andere Situationen transferieren zu können (vgl. Spitzer 2003, S. 161). Gleichzeitig kann Angst auch vor einer neutralen – also objek-tiv ungefährlichen Sache – wie Mathematikunterricht usw. erlernt und tief verinnerlicht werden. So führt die Angst allein dann schon zu körperlichen Reaktionen, die sonst nur beim Eintreten einer Gefahr ausgelöst werden: schnellerer Puls, höherer Blutdruck, verstärkte Muskelspannung (vgl. Spitzer 2003, S. 163). Diese körperlichen Auswirkungen waren bislang in der Menschheitsgeschichte für eine ernste Gefahrensituation von großer Wichtigkeit. Sie versetzten den Körper in einen Modus, in welchem er blitzschnell zwischen „fight or flight“ entscheiden und das Gewählte ausführen konnte. Eine überlebenswichtige Strategie (vgl. Spitzer 2003, S. 163–164). Im Kontext der Schule etabliert sich durch Angst ggf. aber ein kognitiver Stil von schneller Ausführung einfacher, erlernter Routinen, was in Prüfungs- und Klassenarbeitssituationen und im Unterricht allgemein dazu führt, dass kreative Lösungen nicht gefunden, Erkenntnisse nicht verinnerlicht werden können (vgl. Spit-zer 2003, S. 164). Auch die Entfaltung von Neugier, Lernbegierde, Interesse und Potentialen ist nur angstfrei möglich, sodass unter beängstigenden Umständen auch keine Talente entwickelt und In-teressen geweckt werden können (vgl. Hüther 2016, S. 159–160).
3.2 Wie Schule (auch) wirkt
Ohne weitere Absichten hat Schule schon allein dadurch eine homogenisierende Wirkung, weil sie junge Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft zusammenwirft, dadurch Vergleichsmöglich-keiten eröffnet und einen gewissen Konformitätsdruck erzeugt (vgl. Koller 2017, S. 133–134), z. B. auch durch das Verhindern von abweichendem Verhalten oder der Ermöglichung, sich darüber lus-tig zu machen (vgl. Koller 2017, S. 136). Der Begriff des „heimlichen Lehrplans“ hat sich dafür etab-liert, auszudrücken, dass sich neben dem Lehrstoff aus den Rahmenlehrplänen durchaus eine ganze Reihe anderer Normen und Werte finden lassen, die in der Schule mit dem Zweck vermittelt werden sozialen Zusammenhalt zu erzeugen und die Reproduktion der Gesellschaft sicher zu stellen (vgl. Koller 2017, S. 136–137). Diese am Beispiel formulierte Sicht auf Sozialisation bezieht sich vor allem auf die Anfänge der Sozialisationstheorie nach Durkheim im frühen bzw. ausgehenden 20. Jahrhun-dert. Im Verlauf der Zeit haben sich auch Pierre Bourdieu, Talcott Parsons, George Herbert Mead, Jürgen Habermas und sehr ausführlich Niklas Luhmann mit dem Sozialisationsbegriff auseinander-gesetzt, um nur einige zu nennen, und ihn jeweils anders ausgelegt. Bourdieu gilt unter ihnen als besonders radikal. Er legte die Soziologie als Wissenschaft der sozialen Tatsachen im Sinne einer empirischen Forschung und deskriptiven, aber besonders kritischen Analyse gesellschaftlicher Ver-hältnisse aus (vgl. Koller 2017, S. 139).b In der aktuellen Literatur z. B. aus dem Jahr 2016 beschreiben Hurrelmann und Quenzel die Sozia-lisationsfunktion der Schule als besonders vielfältig und einflussreich, Luhman beschreibt sie konk-ret als „Teilsystem der modernen Gesellschaft“ (Luhmann 1994, S. 24), obwohl dies vom Organisa-tionszweck her als reine Bildungseinrichtung gar nicht so gedacht sei (vgl. Hurrelmann und Quenzel 2016, S. 116). Gründe für die große Einflussnahme auf die Sozialisation junger Menschen liefern die Autoren in der zeitgeschichtlichen Veränderung von Schule. Habe sie damals nur wenigen aus dem Bürgertum für kurze Zeit offen gestanden, so sei die Schule in neuester Zeit einerseits zeitlich aus-geweitet worden und andererseits für alle Kinder und Jugendlichen verpflichtend, wobei der Ver-bleib im Schulsystem unabhängig von der Schulpflicht teils bis zum 30. Lebensjahr reiche (vgl. Hur-relmann und Quenzel 2016, S. 115). Die Sozialisationsaufgaben, die einst durch Familie und Ver-wandtschaft wahrgenommen worden waren, werden heute vielfach durch die relativ viel in der Schule verbrachte Lebenszeit ersetzt. Hier werden Intellekt, Emotion und Verhalten dauerhaft be-einflusst und die Jugendlichen auf das Leistungsprinzip unserer Gesellschaft eingestimmt (ebd.). Neben den formal fachlichen Lerninhalten – dem sichtbaren Lehrplan (vgl. Ecarius, Köbel et al. 2011, S. 105) – werden über das informale soziale Geschehen sozialisatorische Wirkungen entfaltet; Schule ist zum Ort sozialen Lernens geworden (vgl. Hurrelmann und Quenzel 2016, S. 115–116). Die Autoren bedienen sich ebenfalls des Begriffs des „heimlichen Lehrplans“ und erklären ihrerseits, dass informale, unterschwellige und versteckte Regeln und Rituale etliche Anknüpfungspunkte für soziale Erfahrungen bieten. Die Jugendlichen lernten, sich zu präsentieren und durchzusetzen, so-ziale Regeln auszuhandeln und umzusetzen und eben auch mit Diskriminierung und/oder Enttäu-schung umzugehen. Auf der anderen Seite können auch Anerkennung und Erfolg erlebt werden (vgl. Hurrelmann und Quenzel 2016, S. 116). Kritisch muss hier jedoch angemerkt werden, dass Schule ggf. nicht allen sozialisatorischen Aufgaben, wie sie früher der Familie oblagen, tatsächlich nachkommen kann. So weist Hurrelmann darauf hin, dass Schulen einerseits zwar Schlüsselqualifi-kationen vermittelten, häufig aber nicht auf die spezifischen Alltagsanforderungen eines selbstbe-stimmten Lebens vorbereiten. Diese Begrenzung wird der Aufsplittung der Lerninhalte in verschie-dene, unabhängig voneinander existierende Fächer und den eher lehrergesteuerten Lern- und Ar-beitsprozessen zugeschrieben (vgl. Hurrelmann 2010, S. 204–205). Darüber hinaus muss auch klar benannt werden, dass es nicht die eine einzige Verhaltensweise oder das eine Regelset gibt, nach welchem sich Lehrkräfte (oder gar alle Lehrkräfte verhalten [können]), um einen sozialisatorisch möglichst günstigen Einfluss auf die Entwicklung der Lernenden zu nehmen. In Schule gibt es ein institutionalisiertes Kontinuum von erlaubten und nicht zulässigen Handlungen, in welchem sich die Akteure relativ frei bewegen können. Unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Verfasstheit der Schule, den schulkulturellen Entwürfen und der individuellen Ausgestaltung der persönlichen Be-ziehungen untereinander entfalten sich deshalb stets unterschiedliche Sozialisationserfahrungen (vgl. Hummrich und Kramer 2017, S. 181–182).
4 Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung
4.1 Verortung im Bildungssystem
Möchte man den Schulversuch BÜA strukturell und organisatorisch mit all den verbundenen Res-sourcen, Ressourceneinschränkungen, Freiheiten und rechtlichen Vorgaben einordnen, muss zu-nächst ein Blick auf das Berufsbildungssystem geworfen werden. Als Schwierigkeit erweist sich da-bei, dass es DAS Berufsbildungssystem aufgrund des Föderalismus in Deutschland so nicht gibt. Je-des Bundesland organisiert und strukturiert die Berufsbildung inklusive der Bestandteile der Be-rufsvorbereitung, einem großen Teil des Übergangssystems2, selbst und findet eigene Bezeichnun-gen, die es noch schwerer machen, sich zu orientieren und anderen – Eltern, Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen – Orientierung zu geben (vgl. Enggruber 2018, S. 165). So sprechen wir in Hessen – dort ist der Schulversuch BÜA angesiedelt – vom Berufsbildungssystem und den Beruflichen Schulen, während es in der sonstigen Bundesrepublik z. B. Berufsbildende Schulen, Berufskollegs usw. heißt.
Unter dem Dach des Übergangssystems findet sich in Hessen – aber nicht nur hier – eine unerwar-tete Vielfalt unterschiedlicher Bildungsgänge, darunter z. B. die Berufsvor- und Berufsgrundbildung, die Berufsschulen für die duale Ausbildung, (höhere) und andere Berufsfachschulen, die zur mittle-ren Reife oder zu einem vollschulischen Berufsabschluss führen (können), einjährige Berufsfach-schulen aufbauend auf dem Mittleren Bildungsabschluss, die zu keinem weiteren Abschluss führen, sowie Fachoberschulen (zur Erlangung der allgemeinen Fachhochschulreife), Fachschulen (z. B. Er-zieherinnen- und Erzieherfachschulen) bis hin zum beruflichen Gymnasium, welches zur Allgemei-nen Hochschulreife führt und gleichzeitig eine berufliche Vorbildung bietet (vgl. Enggruber 2018, S. 166–167).
Die berufsvorbereitenden Bildungsgänge an Beruflichen Schulen in Hessen, die ganz oder teilweise durch den Schulversuch BÜA ersetzt werden (sollten), sind die Bildungsgänge zur Berufsvorberei-tung (BzB) für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, inklusive des dort angesiedelten ESF-finan-zierten Programms PuSchB - Praxis und Schule (Hessisches Kultusministerium 2013a) für Schülerin-nen und Schüler ohne Hauptschulabschluss mit erheblichen Lern- und Leistungsrückständen, die Zweijährige Berufsfachschule zum mittleren Abschluss (BFS), welche auf dem Hauptschulab-schluss aufbaut, sowie zunächst die Einjährige Höhere Berufsfachschule, welche auf dem Mittle-ren Bildungsabschluss aufbaut (Hessisches Kultusministerium) und zuletzt aber ersatzlos gestri-chen wurde3. Verbindendes Element all dieser Bildungsgänge des Übergangssystems ist als über-greifende Zielsetzung: die Vermittlung beruflicher Orientierung und/oder Grundbildung, die För-derung der Allgemeinbildung bis hin zur Erlangung eines (höheren oder besseren) Schulabschlus-ses sowie die Stärkung der allgemeinen Lebenskompetenz (vgl. Enggruber 2018, S. 166).
Bei der Modernisierung des Übergangssystems in Hessen wurde zunächst die „Gestufte Berufsfach-schule“ innerhalb eines Pilotprojektes von 2013 – 2017 erprobt (vgl. Hessisches Kultusministerium 2013b, S. 3–4). Die Ergebnisse der Studie führten zur Aufnahme eines Schulversuchs zur Erprobung der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA), wodurch die ehemalige Zweijährige Be-rufsfachschule sowie die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BZB) und zunächst auch die Ein-jährige Berufsfachschule (genannt Höhere Handelsschule) abgelöst wurden (vgl. Tenberg und Berg-mann 2017, S. 38). Die Ergebnisse des Pilotprojektes, sofern sie für die Thematik vorliegender Arbeit relevant sind, sowie die Rahmenbedingungen des Schulversuchs BÜA sollen im folgenden Abschnitt dargestellt werden.
4.2 Der Schulversuch
Ohne zu weit ausholen zu wollen, soll an dieser Stelle ein kurzer Blick auf den Bildungsbegriff der Gegenwart ermöglicht werden, da dieser sich in ständiger Diskussion befindet und die jeweilige Auslegung des Begriffs den Zusammenhang damit erklärt, welchem Zweck Schulformen – beson-ders in der Berufsbildung – zurzeit unterworfen werden (können). Dabei wird auf Wolfgang Klafki Bezug genommen, welcher auf Pädagogik, Lehrerbildung und Unterricht bislang besonders großen Einfluss genommen hat.
Relativ frisch erscheint also die Auffassung Klafkis vom Bildungsbegriff unserer Zeit aus dem Jahr 1996, welche sich einem Bildungsverständnis anschließt, das eine gesellschaftspolitische Aufgabe wahrnimmt, nämlich alle Menschen bei der Erlangung von Selbstbestimmungsfähigkeit und der Entfaltung ihrer individuellen Möglichkeiten zu unterstützen (vgl. Klafki 1996, S. 45). Dies schließt das Hinterfragen von tradierten Herrschaftsverhältnissen oder Besitz mit ein (vgl. Klafki 1996, S. 46). Wolfgang Klafki greift klassische Bildungstheorien (wie die Perspektiven Wilhelm von Hum-boldts aus dem Zeitalter des Neuhumanismus an der Wende zum 19. Jahrhundert) kritisch auf und passt sie in ihren wesentlichen Merkmalen an die Gegenwartsverhältnisse und ihre Zukunftsfähig-keit hin an. So habe die Reflexion der politischen Seite des Bildungsbegriffs im Hinblick auf Men-schenbildung noch nicht ausgereicht. Außerdem sei das Bildungsverständnis klassischer Bildungs-theoretiker unter dem Fokus einer rein männlichen Zielgruppe gedacht worden, sodass auch die Philosophie von Gleichwertigkeit von Mann und Frau, die im gleichen Zeitraum entstanden ist, nicht hinlänglich entfaltet worden sei (vgl. Klafki 1996, S. 48).
Vor diesem Hintergrund skizziert Klafki die „Grundzüge eines zeitgemäßen und zukunftsoffenen Bildungsbegriffs“ wie folgt (vgl. Klafki 1996, S. 49):
Bildung und Gesellschaft. Folgt man der These, dass Gesellschaft von Menschen gemacht wird und damit veränderbar ist, kommen der Bildungstheorie und -praxis Klafki zufolge nicht nur die Aufgabe zu, gesellschaftliche Verhältnisse zu berücksichtigen und eine Reaktion darauf zu ermöglichen, son-dern auch sie zu reflektieren und zu gestalten im Hinblick auf zukünftige Lebensverhältnisse und Entwicklungsmöglichkeiten kommender Generationen. (vgl. Klafki 1996, 50 f.) Ein entsprechendes Bildungskonzept kann sich also nicht nur den Bedarfen des (damaligen) Industriezeitalters unter-werfen, sondern muss die Herausforderungen durch eine Weiterentwicklung (hin zum aktuellen Informationszeitalter) und dessen kritische Beurteilung ermöglichen (vgl. Klafki 1996, S. 51).
Bildung als Zusammenhang von drei Grundf ä higkeiten: Bildung soll, Klafki zufolge, als ein indivi-duell erarbeiteter und persönlich verantworteter Zusammenhang die Fähigkeit zur Selbstbestim-mung, Mitbestimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit vereinen (vgl. Klafki 1996, S. 52).
Allgemeinbildung. Bildung als allgemeine Bildung wird, folgt man Klafkis Perspektive, durch drei Aspekte bestimmt. So soll Allgemeinbildung tatsächlich allen zugänglich sein und gegen gesell-schaftlich hervorgerufene Ungleichheit der Entwicklungschancen wirken, was eine inhaltliche und organisatorische Demokratisierung der Bildung bzw. der Bildungsverwaltung nach sich zieht. Klafki nennt vor allem den Abbau von Selektionsfaktoren, Verwirklichung einer zehnjährigen Schulpflicht und der Ausbau von der vier- zur sechsjährigen Grundschule als Grundpfeiler dieser Bemühungen. Ebenso können die Einführung integrierter Gesamtschulen, intensivierte Förder- und Orientie-rungsstufen und die Stärkung des Kernunterrichts angeführt werden. Zusätzlich steht der Abbau schichtspezifischer Ausgangsbedingungen in Klafkis Fokus. (vgl. Klafki 1996, S. 53–55). Bildung soll darüber hinaus die Aneignung der die ganze Menschheit betreffenden Fragen und Problemlagen in der Gegenwart und Zukunft ermöglichen und dabei auf geschichtliche Erkenntnisse zurückgreifen (vgl. Klafki 1996, S. 53). Die so vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse sollen ein Bewusstsein für zentrale Menschheitsprobleme schaffen, helfen die eigene Mitverantwortlichkeit zu erkennen und motivieren sich an deren Bewältigung aktiv zu beteiligen (vgl. Klafki 1996, 56 - 61). Klafki beschreibt folgende epochal typische Schl ü sselprobleme wie Frieden, Umwelt, Ungleichheit, „neue“ Medien sowie Liebe und Sexualität als Themen in einem neuen Allgemeinbildungskonzept aufgrund ihrer gesamtgesellschaftlichen bzw. globalen Bedeutung, was die Notwendigkeit der eigenen Urteilsfä-higkeit unterstreicht. Legt man dieses Allgemeinbildungsverständnis zugrunde, geht damit die Er-langung sogenannter Schlüsselkompetenzen einher, die Klafki als überfachliche Kompetenzen für notwendig erachtet, um sich anderen, noch unbekannten Problemlagen stellen zu können (vgl. Klafki 1996, S. 61–63). Kritikfähigkeit, Argumentationsfähigkeit und Empathiefähigkeit sowie die Bereitschaft dazu, alle zu leisten, nennt Klafki als notwendige Komponenten einer solchen über-fachlichen Allgemeinbildung. Zusätzlich betont er die Fähigkeit vernetzenden Denkens in Anbe-tracht der (damalig) aktuellen Gesellschaftsstrukturen und ihrer vielfältigen Verflechtungen (vgl. Klafki 1996, S. 63–66). Konsequenterweise spricht Klafki die Kontraproduktivität der in 45-Minuten-Taktung stattfindenden Fächerunterrichte an, welche i. d. R. isoliert voneinander konzipiert und konsumiert werden. So favorisiert Klafki Exemplarik im Lehren und Lernen, Methodenorientierung, Handlungsorientierung und die Verknüpfung von Fachinhalt und sozialem Lernen (vgl. Klafki 1996, S. 67–69). Zuletzt muss Allgemeinbildung die freie Entfaltung der individuellen Persönlichkeit ge-währleisten und deshalb eine vielseitige Grundbildung in allen „menschlichen Interessen und Fä-higkeiten“ (Klafki 1996, S. 54) bieten. (So z. B. Körper, Geist bzw. Kognition, Handwerk, Technik, Hauswirtschaft, Sozialverhalten bzw. Beziehungs-leben, Ästhetik, Gestaltung und Urteilsfähigkeit sowie Ethik und Politik.) Es sollen Zugänge geschaffen werden zur Ausbildung eines menschlichen Selbstverständnisses und einem Verständnis der Welt. Klafki z ä hlt in diesem Zusammenhang auch eine berufliche Grundbildung und die Berufswahlberatung bzw. berufliche Orientierung zu den notwendigen Bausteinen allgemeiner Bildung (vgl. Klafki 1996, S. 69–70).
Unterstützt wird diese These durchaus von jenen, die Horkheimer und von Humboldt entgegenhal-ten, dass ihre (sich sehr ähnelnden) Auffassungen von Bildung zum Selbstzweck eher ein schönes Ideal, aber einfach nicht mehr zeitgemäß seien (vgl. Koller 2017, S. 94). So spricht zum Beispiel von Humboldt davon, dass Bildung nicht erfolgen soll, um beruflichen oder gesellschaftlichen Ansprü-chen gerecht zu werden, sondern zum Selbstzweck, um die eigene Individualität zu finden (vgl. Dör-pinghaus und Uphoff 2015, S. 77). Horkheimer beschreibt, ganz ähnlich wie von Humboldt, dass Bildung die Erfüllung der eigenen Bestimmung sei und eine umfassende Entfaltung menschlicher Kräfte (vgl. Koller 2017, S. 96). Demgegenüber steht nun die Auffassung der Kritiker, dass Bildung längst ein Instrument geworden sei, das den Bildungsstatus verwende, damit sich Gebildete von weniger Gebildeten abgrenzen, ja sogar abheben können (vgl. Koller 2017, S. 94). Horkheimers und von Humboldts Bildungsideal vertusche genau diese Tatsache und trüge dadurch sogar zur Verfes-tigung der Herrschaftsverhältnisse bei, so Koller (vgl. Koller 2017, S. 94).
So bleibt das Ringen um den Bildungsbegriff damals wie heute vor allem fokussiert auf die Frage: Bildung zum Selbstzweck oder um funktionierende Teile der Arbeitsgesellschaft zu produzieren? Aktuell lässt sich, ungeachtet dessen, der Einfluss der Marktwirtschaft auf das Bildungs- und insbe-sondere natürlich das Berufsbildungssystem nicht leugnen. So äußern sich die Initiative für Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), beide mehr als wirt-schaftsnah zu bezeichnen, regelmäßig über marktwirtschaftliche Anforderungen an Lehrpläne usw. Zum Beispiel im Artikel „Schulkinder lernen zu wenig über Geld“ (Initiative Neue Soziale Marktwirt-schaft 2019). Auch Dobischat und Schurgatz (2015, S. 55) attestieren dem Ausbildungssystem eine massive Marktsteuerung, aufgrund dessen Anteile von Jugendlichen systematisch exkludiert wür-den.
Vor diesem Hintergrund ist das von 2013 bis 2017 durchgeführte Pilotprojekt zur Modernisierung der Berufsfachschule als eine „Gestufte Berufsfachschule“ und in der Folge der Schulversuch „BÜA“ zu betrachten und ggf. auch in seiner Zielsetzung zu bewerten.
4.2.1 Zielsetzung der Schulform
Die zentrale Intention des Projektes war es, den „Warteschleifen-Effekt“ der bisherigen Zweijähri-gen Berufsfachschule zu reduzieren und möglichst viele junge Menschen ohne die vorherige Erlan-gung der Mittleren Reife in Ausbildung zu bringen (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 4). Schwer-punkt in der ersten Stufe des Projekts war demzufolge die berufliche Orientierung und die Ausbil-dungsvorbereitung. Bereits während dieses Jahres oder direkt im Anschluss sollte für die meisten der jungen Menschen der Übergang in die Berufsausbildung vollzogen worden sein (ebd.) Zur Per-spektive gehörte auch die Erlangung der Mittleren Reife während der Ausbildung (ebd.) Das Ziel, die jungen Menschen „ausbildungsreif“ zu machen, spiegelte sich unter anderem im Einsatz einer überfachlichen Kompetenzmatrix, welche die von den Betrieben benannten und den Lehrkräften antizipierten überfachlichen Kompetenzdefizite transparent machen und zu deren Förderung bei-tragen sollte (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 9). Das Instrument wurde im ersten Jahr des Versuchs von einem Lehrkräfteteam entwickelt, weiterentwickelt und an allen drei Pilotschulen verwendet (ebd.)
Im gesamten Abschlussbericht des Pilotversuchs ist nur vereinzelt vom Einsatz Sozialpädagogischer Fachkräfte die Rede. So finden sich in den Abschlussberichten von zwei der drei teilnehmenden Schulen Hinweise darauf, dass Sozialpädagoginnen und -pädagogen mit zwei Wochenstunden in den Klassen eingesetzt waren. Eine Schule weist darauf hin, dass der Einsatz von solchen Fachkräf-ten aus ihrer Sicht unerlässlich sei, weil diese Fähigkeiten und Verbindungen im Hinblick auf die Erlangung überfachlicher Kompetenzen, aber auch für Beratung und Betreuung einbringen könn-ten, welche ‚normale‘ Lehrkräfte nur bedingt leisten könnten (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 28).
Bezeichnend ist, dass die Aufgaben und Tätigkeiten der Sozialpädagoginnen und -pädagogen an keiner Stelle konkretisiert sind und auch in der Auswertung vom November 2017 nur auf einem Diagramm aus der Perspektive der Lehrkräfte die sozialpädagogische Unterstützung thematisiert wird (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 66).
Auch im sich anschließenden Schulversuch BÜA bleibt der Fokus auf der Verwertbarkeit für die Ar-beitswelt. So wird in den Allgemeinen Informationen zum Schulversuch (teils abermals) Folgendes vorgestellt (Tenberg 2017b, S. 2-3):
- „Individuelle Förderung in den Kernfächern des allgemeinbildenden Unterrichts“
- „Einteilung der Jugendlichen in Leistungsstufen“
- „Praktische, berufstypische Erfahrungen in unterschiedliche Schwerpunkte (Branchen)“
- „ Ressourcen und Potentiale kennenlernen “
- „Berufliche Selbstwirksamkeit erfahren“
- Fundierte, aber realistische Berufswahlentscheidung treffen (vgl. Tenberg 2017b, S. 2-3)
- „ Berufliche Identit ä t entwickeln “
- Hinführung zur Dualen Berufsausbildung durch integrierte Betriebsphasen (vgl. Tenberg 2017b, S. 3)
- “…stärker für die duale Ausbildung motiviert werden“
- Betreuung beim Praktikum durch Lehrkr ä fte (vgl. Tenberg 2017b, S. 3)
- mögliche Freistellung von der Schule zugunsten eines Langzeitpraktikums bei Abschluss eines Vor-Ausbildungsvertrages (vgl. Tenberg 2017b, S. 3)
- Erleichterung des Übergangs in die Ausbildung (vgl. Tenberg 2017b, S. 3)
- Langsames Gewöhnen an das Arbeitsleben (vgl. Tenberg 2017b, S. 3)
Beachtenswert ist, dass einzelne Zielvorgaben (fettgedruckt) deutlich sozialpädagogische Aspekte beinhalten, wenn nicht sogar eindeutig dem sozialpädagogischen Aufgabenspektrum der Schulso-zialarbeit zuzuordnen sind, dieser aber nicht zugeschrieben oder stattdessen Lehrkräften zugeord-net werden. Auch die bereits erwähnte mangelnde Ausdifferenzierung der sozialpädagogischen Aufgaben im Pilotbericht und im Schulversuch treten gerade in Abgrenzung zur vorangegangen aufgezählten Zielsetzung noch einmal als besonders fraglich in den Vordergrund.
Darüber hinaus muss an dieser Stelle bereits eine entscheidende Thematik angesprochen werden, die grundsätzlich im Kapitel 5.3 noch einmal explizit aufgeworfen und im Kapitel 7.2 abschließend diskutiert werden wird. Es soll vorab deutlich gemacht werden, dass bisher lediglich die Zielsetzun-gen der Schulform aus ihrer eigenen, auch systembedingten Perspektive betrachtet wurden, wel-che - so kann es der Kapiteleinführung entnommen werden - nicht ohne den Zusammenhang zu Marktwirtschaft und Bildungspolitik betrachtet werden können. Offen bleibt bislang, ob die Schü-lerinnen und Schüler der neuen Schulform ebenso die Verwertbarkeit ihrer Arbeitskraft, den frü-hestmöglichen Übergang in die Ausbildung und die Ausdehnung ihrer überfachlichen Kompeten-zen für die zukünftige Teilnahme an der Erwerbsarbeit im Sinn haben, wenn sie nach erlangtem oder nicht erlangtem Hauptschulabschluss ihre Bildungsbiografie möglicherweise auch aus Mangel an Alternativen an der Berufsfachschule für den Übergang in Ausbildung fortsetzen dürfen, können oder müssen. Dieser Frage wird im Kapitel 6 „Auftrag und Handlungsrahmen der Schulsozialarbeit“ auch vor dem Hintergrund berufsethischer Aspekte noch einmal konkret nachgegangen.
Zunächst sollen jedoch die Rahmenbedingungen, mit welchen sich Lernende, Lehrkräfte, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter im Rahmen der BÜA auseinandersetzen müssen, erläutert werden, damit Möglichkeiten und Grenzen auch vor dem Hintergrund der Arbeits-, Lern- und Lebensbedingungen aller Akteure in der Schulform nach-vollziehbar werden.
4.2.2 Rahmenbedingungen
Der Schulversuch BÜA umfasst zwei Schuljahre, wobei die Intention nach wie vor der Übergang in eine duale Ausbildung, vorzugsweise bereits nach dem ersten Jahr (Stufe I) ist. In diesem ersten Jahr lernen die maximal 16 Jugendlichen pro Klasse eine Bandbreite an beruflichen Fachrichtungen in dem zwölf Unterrichtsstunden umfassenden, fachpraktischen Unterricht kennen. Die Förderung der Allgemeinbildung tritt zugunsten dieser Stunden und denen des Profilgruppenunterrichts zu-rück (vgl. Tenberg 2017a, S. 4). Für den sogenannten Profilgruppenunterricht stehen vier Wochen-stunden zur Verfügung. In kleinen Gruppen sollen die Lernenden, begleitet von Lehrkräften, in in-dividuellen Gesprächen mithilfe überfachlicher Kompetenzraster bei der Entwicklung und Reflexion ihrer persönlichen Stärken unterstützt werden. Darüber hinaus dient der Profilgruppenunter-richt der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen, dem Bewerben und der Beratung bei persönlichen oder schulischen Problemen durch Lehrkräfte sowie der beruflichen Orientierung (vgl. Tenberg 2017a, S. 4–5). Im zweiten Jahr (Stufe II) liegt der Fokus der Schulform nun doch auf dem Erwerb der Mittleren Reife. Die Reduktion des Profilgruppenunterrichts von vier auf zwei Stunden und des fachpraktischen Unterrichts von zwölf auf sieben Stunden ermöglicht die Ver-dopplung des Unterrichts in den allgemeinbildenden Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Eng-lisch (vgl. Hessisches Kultusministerium 2019, S. 4). Der fachpraktische Unterricht findet nun nur noch in einem selbst gewählten Schwerpunkt statt und soll den Jugendlichen gegenüber Abgän-gern allgemeinbildender Schulen einen Vorteil im Bewerbungsverfahren verschaffen (ebd. S. 14).
Weder in den allgemeinen Informationen zum Schulversuch (Tenberg 2017a) noch in der öffentli-chen Broschüre des Hessischen Kultusministeriums (Speier 2017) wird etwas über eine sozialpäda-gogische Begleitung oder Unterstützung geäußert. In der Aktualisierung der Schulform, für die Schulleiterinnen und Schulleiter des Kultusbereichs Hessen als Sonderheft ‚BÜA 2.0‘ (Hessisches Kultusministerium 2019) veröffentlicht, werden jedoch 0,2 Stellen Sozialpädagogik je Profilgruppe ausgewiesen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat in ihrer Zeitschrift ‚insider‘ der Fachgruppe Berufsbildende Schule Hessen deutlich darauf hingewiesen, dass dies grundsätz-lich deutlich zu wenig ist, denn so wäre eine sozialpädagogische Fachkraft Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin für und Begleitung von 80 Jugendlichen (vgl. Becker 2017, S. 7). Kritik formuliert Becker u. a. auch an der in der Regel befristeten Anstellung der sozialpädagogischen Fachkräfte bei (teilweise mehreren) Trägern (gleichzeitig), die nur zum Teil der Tarifbindung unterliegen. Dies seien einerseits prekäre Arbeitsverhältnisse an sich und andererseits konterkarierten diese den im Schulversuch als wesentlich beschriebenen Erfolgsfaktor: die Kontinuität bei den Bezugspersonen der Jugendlichen (vgl. Becker 2017, S. 7).
Die Klassengemeinschaft, die ebenso als Motivations- und Erfolgsfaktor wirken kann, ließe sich, so Becker (vgl. 2017, S. 6), aufgrund der Leistungsdifferenzierung in den Hauptfächern nur schwer gestalten. Darüber hinaus fänden unumgängliche Trennungen der Jugendlichen im fachpraktischen Unterricht statt. Hier müsse die Gruppenstärke aus Gründen des Unfallschutzes in den Werkstätten weiter reduziert werden. Zuletzt fänden weitere Trennungen der Klassengemeinschaft aufgrund der Neigungen zur Bildung der Profilgruppen statt. So verbringen die Jugendlichen in der BÜA deut-lich mehr Zeit in wechselnden Gruppen als in ihrer eigentlichen Klasse, was ebenso erschwerende Auswirkungen auf die Beziehungsarbeit zwischen Klassenleitungen und ihren Klassen habe (vgl. Becker 2017, S. 6).
4.2.3 Zielgruppe und Sozialstruktur
Zielgruppe der BÜA nach neuester Fassung sind nunmehr Jugendliche mit Hauptschulabschluss, ohne Hauptschulabschluss, mit qualifizierendem Hauptschulabschluss und mit sonderpädagogi-schem Förderbedarf, wenn sie bei Schulbeginn noch nicht 18 Jahre alt sind und keinen Ausbildungs-platz haben. Die Jugendlichen mit Mittlerer Reife sind in der aktuellen Fassung vom Dezember 2019 in der BÜA nicht mehr vorgesehen (vgl. Hessisches Kultusministerium 2019, S. 2), allerdings wird es die Schulform, in der diese Zielgruppe das Übergangssystem bislang besucht hat, die Einjährige Höhere Berufsfachschule, ab dem Jahr 2021 nicht mehr geben. Schulabgänger mit Mittlerer Reife und einem Notenbild, das für die Aufnahme an einer Fachoberschule4 nicht ausreichend ist, müs-sen sich direkt bei den Agenturen für Arbeit melden und werden dort weiterberaten.
Um die Adressatengruppe aber mit ihrem sozio-ökonomischen Hintergrund, ihren Schulabschlüs-sen und weiteren wesentlichen Einflussfaktoren, wie Migrationserfahrungen u. a. zu erfassen, kann sich auf die wissenschaftliche Begleitung des Pilotprojektes (Tenberg und Bergmann 2017) gestützt werden, die mit einigem empirischen Aufwand erhobene Daten zusammengefasst hat, die auch für den Schulversuch gelten können. Im Pilotprojekt war die Schulform der Einjährigen Höheren Diese Schulform gehört nicht zum klassischen Übergangssystem, denn der Abschluss führt zur allgemeinen Fachhochschulreife. Erfah-rungsgemäß nutzen viele Jugendliche die FOS trotzdem als Moratorium, wenn sie noch nicht genau wissen, in welche Berufsrichtung sie einmal gehen möchten und/oder wenn sie noch überhaupt keine berufliche Perspektive entwickeln konnten.
Handelsschule, die zuletzt aus dem Schulversuch wieder herausgenommen wurde, noch nicht ver-treten, sodass die Merkmale der Jugendlichen denen der im kommenden Schuljahr startenden BÜA-Klassen weitgehend ähneln müssten. Darüber hinaus liegen statistische Erhebungen und Un-tersuchungen zu Klassen der Zweijährigen Berufsfachschule von Aydin-Canpolat (Aydın-Canpolat 2018) vor, auf die ebenfalls zurückgegriffen werden kann, weil diese Schulform durch die BÜA er-setzt werden wird. Untersuchungen der BÜA im Schulversuch ab dem Schuljahr 2020/2021 können natürlich noch nicht vorliegen, sodass die folgenden Betrachtungen zur Adressatengruppe auf die zusammengetragenen Erhebungen der beiden genannten Quellen gestützt werden.
Die systematische und kriteriengestützte Erfassung der Sozialstruktur des Pilotprojektes von Ten-berg und Bergmann umfasste zu Beginn jedes Schuljahres eine Befragung aller Lernenden hinsicht-lich ihrer physiologischen Basisdaten, bisheriger Schulabschlüsse, persönlicher Lebensverhältnisse und Perspektiven sowie zum Migrationshintergrund (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 12). Zum Geschlecht der Jugendlichen kommen Tenberg und Bergmann zu dem Ergebnis, dass die Schüler-gruppen abhängig vom angebotenen Schwerpunkt der Schule (Technik, Gesundheit und Soziales oder Wirtschaft) eher anders zusammengesetzt sind. Im Bereich Technik finden sich ca. 90 % junge Männer, in Gesundheit und Soziales ca. 80 % junge Frauen, während in Wirtschaft das Verhältnis in etwa ausgeglichen ist (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 12).
Hinsichtlich der erlangten Schulabschlüsse kann festgestellt werden, dass die Lernenden mehrheit-lich einen qualifizierenden Hauptschulabschluss (qHSA) erlangt haben. Der Anteil des qHSA liegt bei 42 – 79 % - abhängig von der Schule und dem Jahr. Danach folgen der Hauptschulabschluss (HSA), sowie Lernende ohne Abschluss. mit jeweils absteigendem Anteil (vgl. Tenberg und Berg-mann 2017, S. 12).
In der Betrachtung des Migrationshintergrundes beruft sich die wissenschaftliche Begleitung zu-nächst auf die Definition des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die einen Migrationshin-tergrund dann feststellt, wenn eine Person selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Dieser Definition folgend, liegt der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Pilotprojekt mit 45 – 66 % überdurchschnittlich hoch im bundesdeut-schen Vergleich.
Dieser läge bei Hauptschulabsolventinnen und -absolventen bei ca. 25 % (vgl. Tenberg und Berg-mann 2017, S. 12). Für die weiteren Betrachtungen erscheint es an dieser Stelle noch sinnvoll, auf die Zusammensetzung der Klassen im Übergangssystem insgesamt zu schauen, werden doch wenigstens drei der Schulformen durch die BÜA abgelöst. So hat Gönül Aydin-Canpolat aus den Anga-ben des Statistischen Bundesamts für das Schuljahr 2011/2012 beispielhaft den Anteil ‚ausländi-scher Schülerinnen und Schüler‘ in den jeweiligen Schulformen zusammengestellt (vgl. Aydın-Can-polat 2018, S. 26–27). In Hessen stellt sich die Zusammensetzung im Schuljahr 2011/2012 wie folgt dar:
Betrachtet man nun das Berufsvor-bereitungsjahr, das Berufsgrundbil-dungsjahr und die Berufsfachschule in vorliegendem Diagramm, welche noch vor den starken Fluchtbewe-gungen 2015 erfasst wurden, pas-sen die Angaben mit im Durch-schnitt ca. 25 %. Im Schulversuch, in dem die Migrationsbewegungen aufgrund der Syrienkrise ca. ab dem Jahr 2015, sicher auch anteilsmäßig Eingang finden werden, erscheint die von Tenberg und Bergmann festgestellte Zahl der Lernenden mit Migrationshintergrund von 45 – 66 % realistisch (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 12).
Abbildung 1 Anteil ausl ä ndischer Lernender nach Schulformen in Hessen 2011/2012 (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tenberg und Bergmann befassen sich unter dem Begriff des ‚Sozialkapitals‘ mit den Ressourcen, die Lernende des Pilotprojektes im Hinblick auf den Bildungsstand der Eltern, das Familien-Einkom-men und die Wohnsituation haben (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 12–14). So beschreiben sie den Bildungsstand der Eltern wie folgt: Auffällig häufig (12 – 18 %) haben die Eltern der Jugend-lichen keinen Schulabschluss. Der Bundesdurchschnitt liegt zum Zeitpunkt der Erhebung bei nur 4,2 % (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 13). Gleichzeitig liegt der Anteil der Eltern mit Hoch-schulzugangsberechtigung im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 37 % mit nur 7 – 16 % deut-lich niedriger. 20 – 36 % der Väter verfügen über keinen Berufsabschluss; 28 – 45 % der Mütter betrifft dies ebenso (ebd. S. 13). In Bezug auf die Wohnsituation stellen Tenberg und Bergmann fest, dass 29 – 42 % der Jugendlichen in ihrem Leben bereits mindestens drei Mal den Wohnort gewechselt haben, was die Autoren auch auf mangelnde Kontinuität in der Berufstätigkeit der El-tern zurückführen (vgl. 2017, S. 13). Diese Wohnortswechsel sind für die Jugendlichen mit regel mäßigen Brüchen im persönlichen Umfeld – also den peerbezogenen und den schulischen Struktu-ren verbunden (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 13). Bezogen auf die Verteilung von zeitlichen und finanziellen Ressourcen lässt sich feststellen, dass ca. 45 % der Jugendlichen des Pilotprojektes Geschwister haben, während es im Bundesdurchschnitt 11 – 20 % Einzelkinder gibt (ebd.).
Die Autorengruppe fasst die Ergebnisse der vier Jahre langen Erhebung zusammen und beschreibt die Lernenden des Projektes als überwiegend aus sozial schwachem Elternhaus (vgl. Tenberg und Bergmann 2017, S. 13). Auch König et al. (vgl. 2011, S. 138–139) beschreiben auf Basis zweier Pa-nelstichproben den zusammengefassten Bildungs- und Berufsstatus der Eltern von Hauptschüle-rinnen und Hauptschülern der 7., 8. und 9. Klasse als signifikant niedrig. Aydin-Canpolat bezieht sich in seinen Untersuchungen auf prekäre Bildungsverläufe in Berufsvorbereitungs- und Berufs-grundbildungsklassen und attestiert eine Verschiebung der Lernenden mit Migrationshintergrund von den allgemeinbildenden Schulen hin zum Übergangssystem an berufsbildenden Schulen (vgl. Aydın-Canpolat 2018, S. 29).
Im nächsten Schritt soll nach der reinen Merkmalsbetrachtung der Adressatengruppe gefragt wer-den, unter welchen Bedingungen diese Schülerinnen und Schüler ihre Zeit heute in der Schule ver-bringen, wie sie ihre Jugend (er-)leben und mit welchen Herausforderungen sie es speziell am ihnen bevorstehenden Übergang in die Berufs- und Arbeitswelt zu tun haben werden.
[...]
1 Tipp zum Weiterlesen: Gerhard Roth, Bildung braucht Persönlichkeit, Überarb. und erw. Aufl. 2015, Klett-Cotta, Kapitel 12 „Bessere Schule, bessere Bildung“, Hirngerechter Unterricht: S. 342 – 357, ISBN: 9783608980554
2 Übergangssystem: Der nationale Bildungsbericht definiert das Übergangssystem als alle Maßnahmen und Bildungsgänge, die unter-halb einer qualifizierten Berufsausbildung anzusiedeln sind. Zum Beispiel die Berufsfachschulen (ohne Berufsabschluss) und alle berufs-vorbereitenden Bildungsgänge.
3 Schülerinnen und Schüler mit Mittlerer Reife, die keine Zugangsberechtigung zur Fachoberschule (Noten in den Hauptfächern 3-3-4) haben, finden an Beruflichen Schulen (und auch an allgemeinbildenden Schulen, da der Abschluss ja bereits erlangt wurde) nun keine Schulform mehr, die sie aufnehmen könnte, solange sie keinen Berufsausbildungsvertrag haben. Diese Schülergruppe wird zukünftig direkt an die Bundesagentur für Arbeit vermittelt werden!
4 Diese Schulform gehört nicht zum klassischen Übergangssystem, denn der Abschluss führt zur allgemeinen Fachhochschulreife. Erfahrungsgemäß nutzen viele Jugendliche die FOS trotzdem als Moratorium, wenn sie noch nicht genau wissen, in welche Berufsrichtung sie einmal gehen möchten und/oder wenn sie noch überhaupt keine berufliche Perspektive entwickeln konnten.
- Arbeit zitieren
- Maike Gehlert-Orth (Autor:in), 2020, Die Berufsfachschule zum Übergang in eine Ausbildung aus sozialpädagogischer Perspektive. Welche Bedingungen entscheiden über das Gelingen der neuen Schulform?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593649
Kostenlos Autor werden












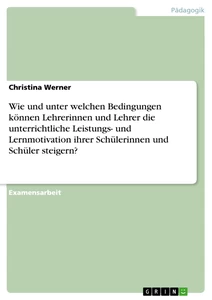







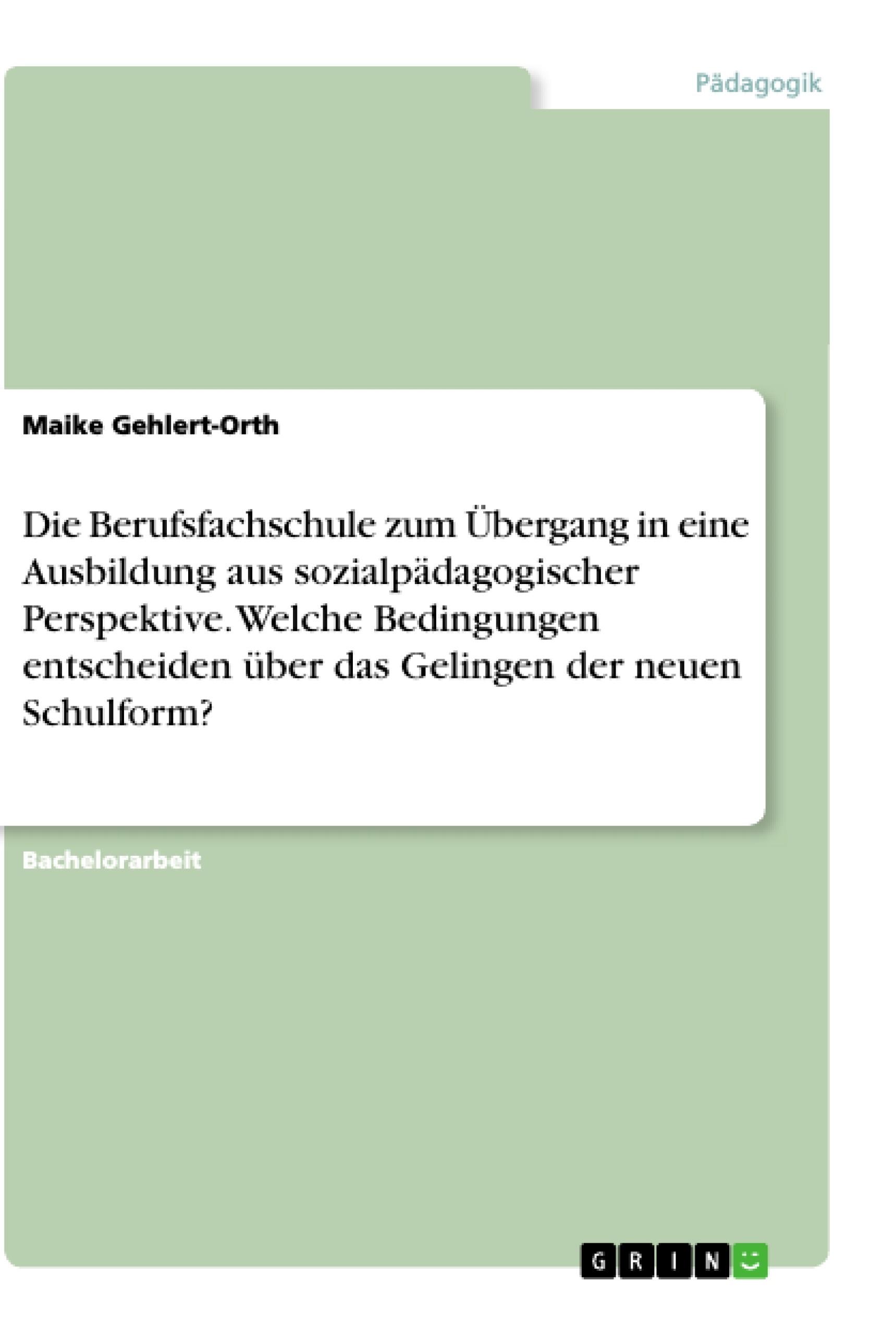

Kommentare