Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wertewandel
3. Theoretische Grundlagen der Motivation
3.1. Begriffliche Abgrenzung
3.2. Inhaltstheorien
3.3. Prozesstheorien
4. Unternehmenskultur
4.1 Abgrenzung zu verwandten Begriffen
4.1.1 Unternehmensphilosophie
4.1.2 Unternehmensethik
4.1.3 Corporate Identity/Unternehmensidentität
4.2 Elemente einer Unternehmenskultur
4.3 Ausprägungen der Unternehmenskultur
4.3.1 Starke und schwache Unternehmenskulturen
4.3.2 Subkulturen
4.4 Funktionen und Träger der Unternehmenskultur
4.4.1 Originäre Funktionen
4.4.2 Derivative Funktionen
4.4.3 Träger
4.5 Entwicklung einer kulturellen Identität
4.6 Unternehmenskultur als motivationaler Faktor
5. Anreizsysteme zur Steigerung der Mitarbeitermotivation
5.1 Führung und Führungsstil
5.2 Führen durch Zielvereinbarungen
5.3 Personalentwicklung
5.4 Materiellen Anreize und betriebliche Fürsorge
5.5 Gestaltung der Arbeitszeit
5.6 Sonstige Anreize
6. Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung Nr. 1: Veränderte Rahmenbedingungen in der Unternehmensumwelt
Abbildung Nr. 2: Traditionelle und neue Werte
Abbildung Nr. 3: Einfaches Motivationsmodell
Abbildung Nr. 4: Die Bedürfnispyramide von Maslow
Abbildung Nr. 5: Das Alderfer Modell
Abbildung Nr. 6: Vergleich zwischen einer traditionellen Motivationstheorie und Herzbergs Theorie
Abbildung Nr. 7: Das Motivationsmodell von Porter/Lawler
Abbildung Nr. 8: Das Zusammenwirken von Unternehmensphilosophie und Unternehmenspolitik
Abbildung Nr. 9: Corporate Identity
Abbildung Nr. 10: Das Modell von Schein
Abbildung Nr. 11: Systematischer Bezugsrahmen für die Gestaltung von Anreizsystemen
Abbildung Nr. 12: Ziele betrieblicher Vermögensbildungen
Abbildung Nr. 13: Mögliche Formen der Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter
Abbildung Nr. 14: Formen der Erfolgsbeteiligung
1. Einleitung
Die Unternehmenskultur wurde in den USA zuerst Anfang der 80er Jahre vor dem Hintergrund untersucht, dass sich die japanischen Konkurrenz sowohl auf dem Weltmarkt wie auch auf dem amerikanischen Binnenmarkt erheblich bemerkbar machte. Betriebssoziologen begannen die Erfolgsgründe japanischer Unternehmen zu untersuchen, die unter anderen in unterschiedlichen Formen der Unternehmensorganisation sowie der Personalführung und -kontrolle zu liegen schienen. Die starke emotionale Anbindung der Beschäftigten an das Unternehmen in Japan erweckte die Frage, ob und wie eine Übertragung auf deutsche Unternehmen möglich ist, damit die Motivation und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen erhöht werden kann. Zudem wurde der Bedeutung aller Beschäftigten für den Unternehmenserfolg vermehrt Beachtung geschenkt.
Basierend auf dem Bewusstseins- und Wertewandel wurde den Unternehmen deutlich, dass althergebachte, bislang erfolgreiche rationale Managementsysteme bzw. -methoden, die ihnen in der Vergangenheit Wettbewerbsvorteile verschafften, zunehmend ausgereizt waren oder zu leicht von anderen Mitbewerbern kopiert werden konnten, so dass sie keinen Vorteil mehr darstellten. Entsprechend war nur ein Teil des Unternehmenserfolges auf quantitative Faktoren, der andere Teil war auf qualitative, kulturelle Faktoren zurückführen.
Peter und Waterman stellten in ihrer Untersuchung „Auf der Suche nach Spitzenleistung“ einen Zusammenhang zwischen der Kultur eines Unternehmens und seinem Erfolg im Markt her. Sie setzten den traditionellen, quantitativen Einflussfaktoren wie Organisations-, Planungs- und Kontrollsystemen menschenbezogene, qualitative Faktoren wie Motivation, Qualitätsbewusstsein (wird innerhalb dieser Arbeit nicht behandelt) und Eigenverantwortung entgegen und schrieben diesen Faktoren den größeren Einfluss auf den Unternehmenserfolg zu.
Unternehmen verknüpfen ihre Erfolge gerne mit dem Verpflichtetsein auf bestimmte Werte, wie z.B. optimale Kundenbetreuung, angemessene Rentabilität, Schutz der Umwelt, bei gleichzeitiger Betrachtung einer hohen Mitarbeiterorientierung. Auf diese Weise kann ein spezifisches Wertegerüst entstehen und verfestigt werden. In diesen Unternehmen wird, bezogen auf das Wertegerüst, oftmals funktionalistisch unter der Annahme gedacht, dass sich diejenigen Unternehmen in einer Zeit höchster Wettbewerbsintensität durchsetzen werden, in denen Wertvorstellungen vorherrschen, die sich an den ständig ändernden Marktbedingungen ausrichten und damit innerhalb des Unternehmens die richtigen Entscheidungen treffen.
Entschieden früher Technologie und Produkte über den Unternehmenserfolg, so ist es heute mehr denn je die menschliche Arbeitsleistung. Mit der Unternehmenskultur wird eine Wirkungskraft definiert, die das Verhalten der in Unternehmen arbeitenden Menschen durch den Gesamterfolg in grundlegender Weise beschreibt. Sie bezieht die Mitarbeiter mit ihren Werten, Normen und Ressourcen als Erklärungsfaktor für den Erfolg und Misserfolg des Unternehmens ein. Die sogenannten „Human Resources“ bilden zunehmend den wettbewerbsentscheidenden Unterschied zwischen den Unternehmen. Der Motivierungsfrage kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Motivation ist der Beweggrund eines bestimmten, zielgerichteten Handelns. Finden die Mitarbeiter ihre persönlichen Ziel- und Wertvorstellungen in der Unternehmenskultur wieder, so hat dies eine motivierende Wirkung. Sie identifizieren sich mit dem Unternehmen und können ein Wir-Gefühl entwickeln.
Mit diesem Beziehungsgeflecht zwischen Unternehmenskultur und Motivation sowie deren Einflussfaktoren gesellschaftlicher Wandel und veränderte Rahmenbedingungen beschäftigt sich diese Arbeit.
In Kapitel 2 wird der Wandel innerhalb der Gesellschaft kurz aufgezeigt. Außerdem wird auf die Veränderungen des Wettbewerbs, der Technologie und der Konkurrenz aufgrund der Globalisierung der Märkte eingegangen. Der Wandel in der Gesellschaft zieht auch einen Wandel in der Art und Weise nach sich, Mitarbeiter zu motivieren. Bevor jedoch die Auswirkung der Unternehmenskultur auf die Motivation der Mitarbeiter dargestellt werden kann, ist zuerst eine Beschäftigung mit der Motivation notwendig. In Kapitel 3 werden die für diese Arbeit als wichtig angesehenen Motivationstheorien aufgezeigt, um in Kapitel 4 und 5 einen Rückgriff auf die Theorien beispielsweise von Maslow, Herzberg und Alderfers sowie Adams und Vroom zu ermöglichen.
Kapitel 4 klärt über das Verständnis, die Elemente und die Funktionen einer Unternehmenskultur auf und die Art und Weise der Vermittlung. Es wird ein Modell zur Erfassung der Unternehmenskultur dargestellt. Außerdem soll die Motivationsfunktion der Unternehmenskultur auf die Mitarbeiter aufgezeigt werden, um die motivationsfördernde Wirkung auf die Mitarbeiter zu verdeutlichen.
Zum Abschluss dieser Arbeit werden in Kapitel 5 ausgewählte Anreize erklärt, die die motivierende Wirkung der Unternehmenskultur auf die Mitarbeiter unterstützen. Besonders hervorgehoben werden die Anreize Führung und Personalentwicklung, die eine wichtige Funktion in Bezug auf die Unternehmenskultur und die Motivation der Mitarbeiter haben.
2. Wertewandel
Innerhalb dieses Kapitels soll zuerst auf die Veränderungen der Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, innerhalb eines Unternehmens, dann auf die Veränderungen der Werte in der Gesellschaft und der Individuen eingegangen werden. Es soll nur ein kurzer Überblick aufgezeigt werden, um zu verdeutlichen, welche Auswirkungen der Wandel auf die Mitarbeiter und die Unternehmen hat.
Veränderung der Wettbewerbssituation
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Wettbewerbssituation durch einen Wandel in den Rahmenbedingungen für viele Unternehmen entscheidend verändert. In Literatur und Praxis wird deshalb seit geraumer Zeit intensiv über Veränderungen wichtiger Wettbewerbsparameter und ihrer ökonomischen Folgen nachgedacht. Der Wandel lässt sich in strukturelle, technologische und gesellschaftliche Veränderungen in der Unternehmensumwelt differenzieren. Abbildung 1 verdeutlicht diesen Zusammenhang.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung Nr. 1: Veränderte Rahmenbedingungen in der Unternehmensumwelt
Quelle: In Anlehnung an Meier 1997, S. 23
Die Veränderung der Markt- und Umweltbedingungen ist der Auslöser für einen Paradigmenwechsel in der industriellen Produktion. Gleichfalls ist eine tiefgreifende Veränderung in den Güter-, Arbeits-, und Informationsmärkten zu erkennen. Durch das Nutzen neuer Kommunikationsnetze erfolgt ein weltweiter Zugang zu den Märkten, die früher schwer erreichbar waren. Eine Intensivierung des Wettbewerbes ergibt sich durch das Eintreten neuer Wettbewerber in ehemals geschlossene Märkte (vgl. Picot/Reichenwald/Wiegand 1996, S. 2). Damit die Unternehmen dem internationalen Wettbewerb gewachsen sind, müssen sie neue innovative Produkte für zukünftige Märkte entwickeln.
Die neuen Informationstechnologien verstärken den Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt. Einerseits ist der Anspruch der Kunden angestiegen, andererseits sind diese weniger bereit, das organisatorische Problem der Koordination, wie z.B. lange Lieferzeiten oder Schnittstellenprobleme Prozessen, z.B. durch erhöhte Preise, zu tragen (vgl. Picot/Reichen-wald/Wiegand 1996, S. 4). Das gesamte Unternehmensgeschehen wird verstärkt auf den Kunden und seine Bedürfnisse ausgerichtet (vgl. Beyer/Fehr/Nutzinger 1995, S. 15). Die Qualitätsansprüche der Kunden haben sich geändert. Diese bedingen neue Verfahrensweisen und innerbetriebliche Produktionsprozesse zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Da sich die Ansprüche der Konsumenten verändert haben, stellt dies den Grund für das Entstehen neuer Güter und Dienstleistungen jeglicher Art dar. Damit ist auch eine Erneuerung der Arbeits- und Führungssysteme verbunden (vgl. Beyer/Fehr/Nutzinger 1995, S. 15).
Die unternehmensbezogenen Ziele:
- Kosten,
- Qualität,
- Zeit (Entwicklungs- und Lieferzeit),
- Flexibilität
erhalten aufgrund der veränderten Wettbewerbsbedingungen eine grundsätzliche Neubewertung. Zeit und Flexibilität stellen gerade in sehr turbulenten Märkten entscheidende Faktoren im Wettbewerb dar, denn die Unternehmen müssen schnell und mit geringen Kosten auf die veränderte Nachfrage reagieren (vgl. Picot/Reichwald/Wigand 1996, S. 4).
Technischer Wandel
In den Volkswirtschaften der Industrieländer finden gegenwärtig massive technologische und strukturelle Wandlungen statt. Neue Technologien werden in immer kürzeren Abständen eingeführt. Die mikrocomputergestützten Maschinensysteme, Industrieroboter, CAD, CAM sowie andere Techniken und Verfahren sind aus der industrielle Produktion nicht mehr wegzudenken. Auch der Dienstleistungsbereich wird verstärkt durch neue Technologien durchdrungen, z.B. Telekommunikation oder Finanzdienstleistungen im Internet. Der technologische Wandel übt direkten und indirekten Einfluss auf die Arbeitswelt aus. Er ist als Herausforderung für die Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter zu sehen. Somit sind auch die Arbeitsplätze von den technischen und organisatorischen Veränderungen betroffen (vgl. Meyer-Dohm 1987, S. 41f). Arbeiter benötigen eine Höherqualifizierung und somit besteht die Möglichkeit des Ansteigens ihres sozialen Ansehens. Höhere Qualifizierung bedeutet höheres Einkommen. Dies zeigt sich in dem steigenden Konsumverhalten der Mitarbeiter.
Neben einem qualifizierten Wissen und einer fachlichen Ausbildung sind die sogenannten Schlüsselqualifikationen der Arbeitnehmer für die Unternehmen immer entscheidender (vgl. Mike-Horke 1991, S. 162). Darunter fallen allgemeine Befähigungen von Erwerbstätigen, wie Lernbereitschaft, Problembewusstsein, Kooperationsfähigkeit und analytisches Denken (vgl. Meyer-Dohm 1987, S. 92). Im Bereich der Schlüsselqualifikationen wird auch oft von „sozialer Kompetenz” gesprochen. Es handelt sich hierbei um die Fähigkeit eines Mitarbeiters, sich mit seinen Kollegen kommunikativ auszutauschen und die Fähigkeit, auf diese einzugehen. Die Teamarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der technische Wandel bringt auch die existenzielle Gefährdung durch den Arbeitsplatzverlust mit sich (vgl. Mike-Horke 1991, S. 172f).
Wandel in Arbeitswelt und Gesellschaft
Überlagert wird die vorher dargestellte Entwicklung von einem tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt. Er vollzieht sich in Deutschland seit den 60er Jahren und findet weltweite Parallelen, zumindest in den hochentwickelten Industriegesellschaften. Konkret drückt sich dieser Wandel in der Arbeitswelt durch eine zunehmende Ablehnung von Unterforderung, Verpflichtung und reiner Arbeitsausführung ohne eigene Handlungsspielräume aus. Dies hat bereits in den 70er Jahren dazu geführt, dass neue Formen der Arbeitsorganisation in den Industriebetrieben etabliert wurden, die eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Sinne erweiteter Handlungsspielräume erwirken sollten. Somit waren die 70er und 80er Jahre durch die relative Sicherheit des Arbeitsplatzes und des relativen materiellen Wohlstands geprägt.
Die Aktivitäten entfalteten jedoch keine nachhaltige Wirkung: unzählbare Modelle setzten sich für die Humanisierung der Arbeit in den Unternehmen ein, aber versagten an einem verminderten Verständnis des Wirtschaftlichkeitsdenkens. Innerhalb der Gesellschaft zeigt sich der Wandel durch eine verwandelte Haltung bezüglich der Ressourcen und der Umwelt sowie in der Verwendung der Technologiepotentiale (vgl. Picot/Reichwald/Wigand 1996, S. 4).
Wertewandel:
Der Begriff des Wertewandels befasst sich mit der Veränderung geltender Werte. Im Laufe der Zeit mit zunehmenden Wohlstand und wachsenden Anspruchs- und Bildungsniveau haben sich die Bedürfnisse der Arbeitnehmer geändert.
In den 50er und Anfang der 60er Jahren war die Wertorientierung relativ stabil, denn Selbständigkeit und Gehorsam besaßen eine hohe Bedeutung und galten als präferiertes Ziel. In den 60er und Anfang der 70er kam es dann zu einem drastischen Wandel. Dieses erfolgte durch das Auflösen bestehender Wertstrukturen und wurde durch Diskussionen bezüglich der „antiautoritären“ Erziehung noch verstärkt. Mitte der 70er Jahre schritt der Wertewandel bezogen auf die Arbeitsmoral weiter. Parallel dazu begann eine öffentliche Diskussion mit breiter Resonanz über die Wertestrukturen in Deutschland.
Seit einigen Jahrzehnten ist eine weitere Umorientierung der Werte zu beobachten. Dies führt dazu, dass Unternehmen über ihre Unternehmenskultur nachdenken. Sie fragen sich, ob die aktuell vorherrschenden Werte im Unternehmen, die das Unternehmen erfolgreich gemacht haben, überholt sind und folglich zur Sicherung des Unternehmenserfolgs erneuert werden müssen. Die Gesellschaft erkennt immer deutlicher, dass die Probleme der Gegenwart mit den Rezepten der Vergangenheit nicht mehr zu lösen sind. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt eine Gegenüberstellung der traditionellen und der neuen Werte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung Nr. 2: Traditionelle und neue Werte
Quelle: In Anlehnung an Gretschmann 1992, S. 303
Aus Abbildung 2 geht eine Tendenz zu mehr Entscheidungsfreiheit der Mitarbeiter und zur Teamarbeit hervor. Außerdem sind Individualisierung und Flexibilisierung als neue Werte hinzugekommen. Jeder Mitarbeiter hat unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, Werte und Motive. Diesen soll durch die individuellere Gestaltung der Arbeit, Anreize zur Leistung und zur Steigerung der Motivation nachgekommen werden.
Verschiedene Gruppen innerhalb der Bevölkerung prägen in sehr unterschiedlichem Ausmaß den Wertewandel. Demnach kann der Wertewandel keinem Individuum oder keiner Gruppe allein zugeschrieben werden. Aufgrund dessen wurden eingehende Wertanalysen durchgeführt. Die Auswertung der Daten zeigt, dass der Wandel der Wertorientierung insbesondere von einer jüngeren und überdurchschnittlich gebildeten Bevölkerungsgruppe getragen wird. Dagegen präferiert die ältere Bevölkerung die materialistischen Werte (vgl. Rosenstiel 1987, S. 45). Jedoch haben für den größten Teil der Bevölkerung traditionelle Werte an Bedeutung verloren. Die gesicherte Befriedigung der Grundbedürfnisse führt zu einer Wertverschiebung in die postmaterialistische Richtung.
Es wird allerdings nicht von einem Verfall der Werte gesprochen, sondern von einem Wandel der Werte (vgl. Lattmann 1990, S. 139). In diesem Zusammenhang kann man auch von einer Wertverschiebung sprechen. Die neuen Werte gewinnen für die berufliche Tätigkeit immer mehr an Bedeutung. Zugleich wird ihr Potential für Qualität, Flexibilität und Rationalisierung des Arbeitshandelns entdeckt.
Der allgemeine Wertewandel und speziell der Wandel der Einstellungen der Mitarbeiter zeigen sich auch in einer zunehmenden Freizeitorientierung (vgl. Meier 1997, S. 206). Im Gegensatz zu der früheren Ansicht, dass die Arbeit das Leben ist, bestimmt die Arbeit heute nur bedingt das Leben. Die Freizeit bietet die Möglichkeit, soziale Beziehungen zu pflegen und Erfahrungen außerhalb des Berufslebens zu sammeln sowie andere arbeitsunabhängige Aktivitäten auszuüben (vgl. Mike-Horke 1991, S. 174).
Im Unternehmen äußert sich der Wertewandel in einer Veränderung der Arbeitsorganisation durch den vermehrten Einsatz von Teamarbeit. Innerhalb eines Teams haben die Mitarbeiter die selben Zielvorstellungen, Werte und Normen. Teams können in allen Hierarchieebenen eingesetzt werden. Somit können auch Mitarbeiter unterschiedlicher Hierarchieebenen zu einem Team zusammengefasst werden und gleichberechtigt miteinander arbeiten und an Entscheidungen sowie an der Lösungsfindung beteiligt sein. Dies entspricht dem wachsenden Bedürfnis der Persönlichkeitsentfaltung (vgl. Gretschmann 1992, S. 303). Der Mitarbeiter möchte seine Persönlichkeit in die Arbeit mit einbringen. Er möchte Freude bei seiner Arbeit durch abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten z.B. durch Jobrotation haben (vgl. Hagemann 1990, S. 50), die Möglichkeit besitzen, den Ablauf selbst mitzubestimmen und sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlen (vgl. Hagemann 1990, S. 21).
Wenn zur interessanten Arbeit noch die Aufmerksamkeit des Vorgesetzten kommt, können die gleichen Einstellungen und inneren Haltungen erreicht werden, wie bei Mitarbeitern, die der oberen Hierarchieebene angehören (vgl. Hagemann 1990, S. 50). Es zeigt sich, dass die Verhaltensweisen der Vorgesetzten eine wichtig sind. Auf ein gutes Betriebsklima legt jeder Arbeitnehmer Wert, denn wenn dieses nicht stimmt, kommt Unzufriedenheit auf und der Wunsch, seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Unter dem Betriebsklima wird die Betriebsatmosphäre verstanden, d.h. der in der Betriebsstätte herrschende Geist, in dem sich zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen der Arbeitnehmer gegenüber dem gesamten Unternehmen widerspiegeln (vgl. Korndörfer 1989, S. 246).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Unternehmen den sich ändernden Rahmenbedingungen und Wertestrukturen stellen müssen und in ihre Organisationen und Prozesse implementieren müssen. Dies gilt insbesondere für die Einstellungen ihrer Mitarbeiter und deren Auswirkungen auf die Leistungserbringung. Damit verbunden muss auch die Kultur eines Unternehmen so „flexibel“ sein, dass sie sich auf die jeweiligen Veränderungen der Rahmenbedingungen anpassen kann. Die hier dargestellten wechselnden Rahmenbedingungen sind also die Auslöser für grundlegende innerbetriebliche Veränderungen.
3. Theoretische Grundlagen der Motivation
Die Verwendung der in diesem Kapitel aufgeführten Motivationstheorien bildet zum Einen die Grundlage zur Erläuterung der Motivationsfunktion der Unternehmenskultur, zum Anderen werden anhand der gewonnenen Erkenntnisse dieser Theorien Anreizsysteme für die Mitarbeiter gebildet. Diese wiederum haben ergänzende Funktionsweisen bei der Motivationsfunktion der Unternehmenskultur.
3.1 Begriffliche Abgrenzungen
„Die Beschäftigung mit motivationalen Phänomenen und die Frage nach ihrer Funktion in der Gesamtheit des psychischen Geschehens bzw. nach ihrem Einfluss auf das Erleben und Verhalten eines Individuums ist unbestritten eine Domäne psychologischer Forschung und Praxis“ (Keller 1981, S. 17). Die Psychologie möchte die Basis von Motiven aufdecken, und verwendet die Motivation zur Erläuterung von Verhalten und Erleben.
Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen zu den Begriffen Motive und Motivation. Im alltäglichen Sprachgebrauch und teilweise auch in wissenschaftlichen Ansätzen erfolgt die Verwendung der Begriffe Motiv und Motivation synonym (vgl. Keller 1981, S. 23). Viele Autoren nehmen eine Differenzierung zwischen diese Begriffen vor. (vgl. Weinert, 1975, S. 15).
Eine Unterscheidung zwischen Motiv und Motivation wird innerhalb dieser Arbeit vorgenommen. Die Begriffe Motiv und Motivation leisten einen wichtigen Beitrag zum verbesserten Verständnis der Motivierung.
Unter einem Motiv wird eine verhältnismäßig beständige Verhaltenstendenz, die unabhängig von der Situation ist verstanden (vgl. Keller 1981, S. 24). Motive sind demzufolge Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten, das von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Es handelt sich um eine zielgerichtete Größe. Der Mensch weiß einerseits, dass er einen Mangelzustand empfindet, andererseits auch, wie sein Ziel auszusehen hat.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung Nr. 3: Einfaches Motivationsmodell
Quelle: vgl. Staehle 1991 S. 148
Bedürfnisse werden als Energiespeicher und Auslösungsmechanismen der Verhaltensstruktur eines arbeitenden Individuums angesehen. Ein Bedürfnisdefizit (= Bedürfnismangel), das zu einem bestimmten Zeitpunkt von Individuen empfunden wird, soll demnach einen Suchprozess auslösen, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt, ein Bedürfnisdefizit (Bedürfnismangel) im Menschen aufkommt und er dieses beseitigen möchte (vgl. Weinert 1998, S.142). Bedürfnisse werden meist aufgrund des jeweiligen kulturellen Einflusses spezifischer (vgl. Fakesch 1991, S.17).
In der Literatur werden die Begriffe Motive und Bedürfnisse oft synonym verwendet. Dies soll in dieser Arbeit nicht erfolgen. Die Bedürfnisse sind den Motiven vorgelagert, da sie einen generellen Mangel darstellen, der den Menschen in eine allgemeine Handlungsbereitschaft versetzt (vgl. Staehle 1991, S.148). Neben einem Bedürfnis ist eine bestimmte Erwartung an ein Motiv geknüpft (vgl. Keller 1990, S. 105-106). Ein Bedürfnis muss nicht unbedingt zu einem Motiv führen, jedoch muss ein Motiv immer auf einem Bedürfnis beruhen (vgl. Fakesch 1991, S. 18).
Es handelt sich um eine inhaltliche Klassifizierung der angestrebten Zielzustände. Diese haben sich beim Menschen im Laufe seiner Sozialisation als verhältnismäßig beständige „Wertdispositionen“ herauskristallisiert. Bei gegebener Situationsbedingung wird dann ein Motiv aus einem Motivbündel des Menschen aktiviert, bis das gewünschte Ziel erreicht wird (bzw. ein als befriedigend angesehenes Anspruchsniveau erreicht wird). Motive werden durch Anreize wie Geld, Arbeitsinhalt, soziale Kontakte innerhalb einer Gruppe usw. aktiviert, da sie nicht sichtbar sind (vgl. Staehle 1991, S. 148).
Das Motiv und der Anreiz sind eng aufeinander bezogen und komplementär. Situative Anreize kennzeichnen Motivziele, die individuell unterschiedlich gewichtet werden. Die Wirksamkeit der Anreize ergibt sich erst aus den entsprechenden Wertungspositionen der Individuen. „Die Anreize erhalten nur dann verhaltenswirksamen Aufforderungscharakter, wenn sie als solches wahrgenommen und kognitiv verarbeitet werden. Person und situative Gegebenheiten stehen dabei im Verhältnis psychologischer Wechselseitigkeit (Staehle 1991, S. 148).“ Auf Anreize und Formen von Anreizen, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, wird in Kapitel 5 näher eingegangen. Die Motive, die durch die Anreize aktiviert wurden, führen zur Motivation (vgl. Fakesch, S. 18).
Motivation ist ein komplexer und vielseitiger Begriff. In dieser Arbeit wird der Begriff Motivation als Beweggrund eines bestimmten, zielgerichteten menschlichen Handelns definiert (vgl. Schinnerl 1980, S. 407). Die Motivation entsteht durch die Interaktion von Mensch und Situation und ist der Grund für das menschliche Verhalten. Sie beinhaltet alle Komponenten, die ein zielgerichtetes Verhalten verursachen (vgl. Fakesch 1991, S. 19). Um Motivation von Motiven abzugrenzen, ist zu sagen: Motivation ist das Zusammenspiel mehrerer Motive als Ursache konkreten Verhaltens (vgl. Lattmann 1990, S. 106). Die Unternehmen sind der Ansicht, dass Motivation von Mitarbeitern eine immer größere Rolle spielen wird. Wiederholt auftretende Fehler während der Arbeit werden auf mangelnde Motivation zurückgeführt. In den Augen nahezu aller Führungskräfte hat Motivation eine positive Assoziation auf den Mitarbeiter (vgl. Reinhard 1991, S. 13).
In die Literatur wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Unter intrinsischer Motivation ist zu verstehen, dass ein Mitarbeiter seine Arbeit um ihrer selbst Willen ausführt. Von extrinsischer Motivation wird gesprochen, wenn ein Mitarbeiter seine Arbeit aufgrund monetärer Anreize (z.B. Gehalt, Tantiemen usw.) ausführt. Dies ist jedoch nur eine analytische Trennung, denn in der Realität treten beide gemeinsam auf. Aus Managementsicht liegt der Hauptansatzpunkt für den Einsatz von Maßnahmen zur zielgerichteten Beeinflussung bei der intrinsischen Motivation (vgl. Staehle 1991, S. 200).
Innerhalb dieser Arbeit werden die Begriffe Motivation und Arbeitsmotivation synonym verwendet. Arbeitsmotivation beschreibt solche physischen Zustände, die bei der Auseinandersetzung mit Arbeitsaufgaben dafür sorgen, dass die arbeitende Person die für die Aufgabenbewältigung gesetzten Ziele mit mehr oder weniger großem Nachdruck anstrebt (Kleinbeck 1987, S. 434).“ Der Begriff Arbeitsmotivation liefert in diesem Zusammenhang auch die Erklärung für die Entstehung von Zielsetzungen, für die Zieldauer, über die eine Zielsetzung aufrecht erhalten bleibt sowie für die Art und Weise, wie Ziele in Handlungen umgesetzt werden (vgl. Häcker/Kleinbeck 1995, S. 113). Hierauf wird in Kapitel 5.2 näher eingegangen.
Der aktive Teil der Motivation ist die Motivierung. Während die Motivation nur den momentanen Zustand beschreibt, so beinhaltet die Motivierung den aktiven Part, der zur Motivation des Mitarbeiters führen soll. Es soll ein positiver Einfluss auf die Arbeitsbereitschaft der Mitarbeiter herstellt und ausgeübt werden. Mitarbeitermotivation kann mit folgendem Bedeutungsumfang beschrieben werden (vgl. Reinhard 1991, S. 17):
1. Jemanden mit Motiven auszustatten, die er vorher nicht hatte;
2. Jemanden an seinen Motiven „abholen“ und so Möglichkeiten zur Realisierung bieten;
3. Verhaltensweisen mit subjektiver Bedeutung/Wichtigkeit aufladen;
4. Begeisterung entfalten.
Sowohl die Forschung, als auch die Unternehmensleitung, möchten Erkenntnisse darüber gewinnen, warum der Mitarbeiter täglich seine Arbeitsaufgabe verrichtet, sich an seinem Arbeitsplatz einfindet usw. (vgl. Weinert 1998, S. 141). Das Begreifen der Arbeitsmotivation macht es möglich zu erkennen, weshalb das Individuum bestimmte Ziele erreichen möchte und dafür Energie, Kraft und das notwendige Verhalten aufweist.
Motivationsprozesse sind zielgerichtet und weisen Anziehungskraft auf. Ist das Ziel erreicht, kann das Bedürfnisdefizit ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Welcher Größe dieses entspricht, hängt von Einstellungen, Werten und positiven/negativen Erfahrungen einer Person ab (vgl. Weinert 1998, S. 142).
Die Arbeitsmotivation hat auch Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit einer Person. Die Arbeitszufriedenheit beeinflusst die Bewertung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsergebnisse und deren Folgen (vgl. Häcker/Kleinbeck 1995, S. 114). In dieser Arbeit soll jedoch auf die theoretischen Hintergründe der Arbeitzufriedenheit nicht eingegangen werden. Es soll nur gesagt werden, dass die Arbeitszufriedenheit das höchste Ziel der Mitarbeiter ist, welches durch die Motivation erreicht werden soll.
Motive sind nicht direkt beobachtbar, daher muss zur Erklärung auf Motivationstheorien zurückgegriffen werden. Eine Motivationstheorie muss, wenn sie das Verhalten des Menschen bei der Arbeit erklären soll, Variablen wie Bemühung, Fähigkeit, Erwartung, Werte, bereits gemachte Erfahrungen usw. berücksichtigen (vgl. Weinert 1998, S.141-142). Wichtige Motivationsaspekte am Arbeitsplatz, die in einer Motivationstheorie der Arbeitsorganisation vorhanden sein müssen, sind (Weinert 1998, S. 142):
(1) die Anregung menschlicher Aktivitäten,
(2) die Richtung des Verhaltens,
(3) die Stärke der Reaktion und der Bemühungen und
(4) die Fortdauer des Arbeitsverhaltens über einen gewissen, begrenzten Zeitraum.
Die nachfolgend aufgezeigten Theorien werden in der Literatur und in dieser Arbeit in zwei Gruppen unterteilt. Es wird zwischen Inhalts- und Prozesstheorien unterschieden. Inhaltstheorien untersuchen, welche speziellen Faktoren den Menschen zur Arbeit motivieren bzw. beschäftigen sich mit Art und Inhalt von Bedürfnissen (vgl. Weinert 1998, S. 143). Im Gegensatz dazu befassen sich die Prozesstheorien mit dem Ablauf von Motivationsvorgängen und ihren Auswirkungen auf das menschliche Verhalten (vgl. Meier 1997, S. 98). Als erstes werden die Inhaltstheorien erläutert, anschließend wird auf die Prozesstheorien eingegangen.
3.2 Inhaltstheorien
Die Bedürfnishierarchie von Maslow
Bis heute gehört das 1954 entwickelte Maslowsche Modell der Bedürfnishierarchie zu den
bekanntesten und populärsten Modellen der humanistischen Motivationstheorien und nimmt eine wichtige Stellung in der Organisationspsychologie ein. Maslow geht davon aus, dass alle Menschen eine Reihe von Bedürfnissen haben, die sich stufenweise von existentiellen physiologischen Bedürfnissen bis hin zur Selbstverwirklichung entfalten (vgl. Greif/Holling/Nicholson 1995, S. 5). Die folgende Abbildung 4 zeigt die Anordnung der Bedürfnisse auf.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Physiologische Bedürfnisse
Abbildung Nr. 4: Die Bedürfnispyramide von Maslow,
Quelle: In Anlehnung an Rosenstiel/Molt/Rüttinger 1995, S. 217
Diese fünf Bedürfnisklassen aus Abbildung 4 werden kurz charakterisiert (vgl. Berthel 1995, S. 21):
1. Die physiologischen Bedürfnisse (Essen, Trinken, Kleidung und Wohnung)
2. Die Sicherheitsbedürfnisse (Schutz vor nicht vorhersehbaren Ereignissen im Leben wie Krankheit, Bedrohung, Existenznot)
3. Die sozialen Bedürfnisse (Zuneigung, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Freundschaft, befriedigende soziale Beziehungen)
4. Das Achtungsbedürfnis (Wunsch nach Anerkennung, Achtung, Selbstwertschätzung, Status)
5. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung (Streben nach Unabhängigkeit, Streben nach persönlicher Entfaltung ).
Der Aufbau in Form einer Pyramide zeigt zum einen, dass die unteren Bedürfnisse im Entwicklungsprozess früher sichtbar werden und zum anderen, dass ihre Bedeutungen physiologisch bestimmend sind und sie deshalb weniger individuell sind bzw. eine geringere soziale Ausdrucksvarianz haben (vgl. Schreyögg 1999, S. 218). Maslow bezeichnet die Stufen eins bis vier als Defizitbedürfnisse und das fünfte als Wachstumsbedürfnis (vgl. Meier 1997, S. 100).
- Das Defizitbedürfnis:
Der Mensch versucht unbefriedigte Bedürfnisse zu befriedigen. Sobald ein Bedürfnis befriedigt ist, wirkt es nicht mehr motivierend. Durch veränderte Lebensbedingungen (Krieg, Arbeitslosigkeit usw.) können Bedürfnisse, die zuvor befriedigt waren, wieder unbefriedigt scheinen und erneut eine handlungsmotivierende Wirkung besitzen (vgl. Schreyögg 1999, S. 218).
- Das Wachstumsbedürfnis:
Der Mensch verhält sich grundsätzlich in der Weise, dass er durch das hierarchisch niedrigste unbefriedigte Bedürfnis motiviert wird. Es liegt in seiner Natur, dass zuerst die physiologischen Bedürfnisse erfüllt werden, die anschließend keinen Handlungsanreiz mehr bieten (d.h. sie motivieren nicht mehr). Daraufhin treten die nächsthöheren Bedürfnisse in Erscheinung (siehe vorherige Abbildung) und möchten befriedigt werden. Physiologische Bedürfnisse wie Durst, Hunger usw. treten immer wieder beim Menschen auf (Deprivationszyklen). Wird hier von einer Befriedigung der Bedürfnisse gesprochen, gilt es die dauerhafte Befriedigung sicherzustellen, und nicht nur die momentane Sättigung. Ein positiver Verlauf dieses Prozesses geht bis zum Bedürfnis zur Selbstverwirklichung, wobei dies nie vollständig befriedigt werden kann. Hier findet eine Abkehrung von der Sättigungsthese statt (vgl. Schreyögg 1999, S. 218).
Die Problematik der empirischen Theorieüberprüfung liegt darin, dass die Motive nicht exakt beschrieben sind und keine genauen Meßmethoden entwickelt wurden, um aus der Menge der Motive die einzelnen herauszufiltern und deren Stärke zu messen. Außerdem gehen aus Maslows Theorie keine Angaben über die Gestaltung und Wirkung von Werten hervor (vgl. Drumm 1995, S. 375).
Das Maslowsche Modell hat trotz seiner geringen empirischen Unterstützung durch seine Plausibilität eine Auswirkung auf die soziale Praxis. Die Organisationen sind zunehmend bereit, Hierarchien abzubauen und den Mitgliedern der Organisation Handlungsspielraum einzuräumen, damit diese die Chance haben, sich bei der Arbeit zu entfalten. Die programmatischen Aussagen Maslows gelten hierzu zum Teil direkt oder indirekt als Grundlage (vgl. Rosenstiel/Molt/Rüttinger 1995, S. 218-219).
Das ERG-Modell von Alderfer
Alderfer vertritt die Meinung, ,,dass die Theorie der Bedürfnishierarchie von Maslow nicht auf die Mitarbeiter in einer Organisation anwendbar ist (vgl. Weinert1998, S. 147), wobei das Modell von Maslow allerdings als Grundlage seiner Ideen dient. Alderfer vereinfacht und reduziert die Anzahl der Stufen der Bedürfnisse auf drei, denn er ist der Meinung, dass sich die Stufen Sicherheits-, Zugehörigkeits- und Wertschätzungsbedürfnis überschneiden und verändert es bezüglich der Annahmen der intrapsychologischen Prozesse (vgl. Rosenstiel/Molt/Rüttinger 1995, S. 219). Nach Alderfer existieren drei Bedürfnisstufen:
1. E = existence Needs/Existenzbedürfnisse:
Sie sollen das Überleben sichern (Bedürfnis nach Wohnung, Versicherung für Alter und Arbeitslosigkeit)
2. R = relatedness Needs/Beziehungsbedürfnis:
Hierunter fallen Bedürfnisse, die sich mit den zwischenmenschlichen Kontakten befassen (Bedürfnis nach Anerkennung)
3. G = growth Needs/Wachstumsbedürfnisse:
Darunter fallen die Bedürfnisse, die sich auf die Wünsche des Einzelnen beziehen (sich selbst zu verwirklichen, unabhängig zu sein und Selbstvertrauen zu haben) (vgl. Berthel 1995, S. 24).
Abbildung 5 stellt den Prozess der Bedürfnisbefriedigung dar. Wird ein Bedürfnis befriedigt, dann wird zum nächsthöheren fortgeschritten. Wenn ein höheres Bedürfnis nicht befriedigt werden kann, wird das darunter liegende reaktiviert. Allerdings ist anzumerken, dass die ERG-Theorie nur teilweise die Schwächen von Maslows Ansatz aufhebt. Auf Werte und Grundeinstellungen wird nicht eingegangen und es wird nicht deutlich, dass Menschen bei unterschiedlichen Motivationshintergründen gleich Handeln (vgl. Meier 1997, S. 104).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung Nr. 5: Das Alderfer Modell
Quelle: In Anlehnung an Weinert 1998, S. 149
Die ERG-Theorie stellt eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Maslowschen Modells dar, jedoch wurde ihr nie die allgemeine Beachtung geschenkt, wie der Bedürfnispyramide von Maslow (vgl. Rosenstiel/Molt/Rüttinger 1995, S. 220).
Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg
Die Zwei-Faktoren-Theorie entstand aufgrund empirischer Erhebungen von Herzberg. Hierbei handelt es sich um einen Erklärungsansatz der Arbeitszufriedenheit (vgl. Berthel 1995, S. 25). Herzberg unterteilt bei allen Individuen zwei Faktoren der Arbeitszufriedenheit:
1. Hygienefaktoren:
Dies sind Faktoren, die Unzufriedenheit verhindern, aber nicht zu einer Zufriedenheit führen (vgl. Staehle 1991, S. 205f.). Damit sind Arbeitsbedingungen gemeint, die beim Menschen Unzufriedenheit auslösen, wenn sie nicht vorhanden sind. Darunter fallen z.B. Bezahlung Arbeitsplatzsicherheit, interpersonelle Beziehungen zwischen Untergebenen und Vorgesetzten, Art und Qualität der Führung, Unternehmenspolitik und -verwaltung, physische Arbeitsbedingungen usw.
2. Motivatoren:
Diese Faktoren bewirken Arbeitszufriedenheit (vgl. Berthel 1995, S. 25) Das sind z.B.: Leistungserfolg, Anerkennung, Verantwortung, interessante Arbeitsinhalte, berufliche Perspektive, Entfaltungsmöglichkeit usw.
Die Wirkung der Einflussfaktoren kann so ausgelegt werden, dass beim Vorhandensein von Frustratoren bzw. Hygienefaktoren der Mitarbeiter im Unternehmen verweilt und Motivatoren ihn zu Leistung bzw. Leistungssteigerung antreiben (vgl. Drumm 1995, S. 378). Die Arbeitszufriedenheit wird nicht als ein eindimensionales Konzept gesehen, sondern als zweidimensionales. Die Dimensionen werden unterteilt in: “Arbeitszufriedenheit (AZ) - Nicht-Arbeitszufriedenheit (N-AZ)“ und “Arbeitsunzufriedenheit (AUZ) - Nicht-Arbeitsunzufriedenheit (N-AUZ) (vgl. Berthel 1995, S.26).“
Wird dieses Modell nun mit der Bedürfnispyramide von Maslow verglichen (verdeutlicht in Abbildung 6), dann stehen die Hygienefaktoren für die Grundbedürfnisse. Demgegenüber stehen die Motivatoren für Bedürfnisse höherer Ordnung (der Arbeitnehmer sucht Autonomie, Eigenverantwortung usw. in seiner Arbeit). Die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg wird zu einer hierarchischen Motivationstheorie mit zwei Ebenen, der Prozess- und der Handlungsebene (1. Suche nach den Hygienefaktoren, 2. Suche nach den Motivatoren) (vgl. Weinert 1998, S. 150).
Arbeits- Nicht-Arbeits-
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung Nr. 6: Vergleich zwischen einer traditionellen Motivationstheorie und Herzbergs Theorie
Quelle: vgl. Weinert 1998, S. 151
Einige Kritikpunkte werden in der Literatur jedoch genannt:
- mangelnder methodischer Unterbau (vgl. Meier 1997, S. 106),
- „Übersimplifizierung des Herzbergischen Konstrukts der Motivation“ (Weinert 1998, S. 152),
- Unterteilung in die Klassen Zufriedenheit und Unzufriedenheit,
- Arbeitszufriedenheit in ihrer Gesamtheit wird nicht gemessen (vgl. Weinert 1998, S. 152),
- Motivatoren und Hygienefaktoren können je nach Situationsbedingung unterschied- liche Wirkungen aufweisen, außerdem werden keine Situationsvariablen berück sichtigt,
- Werthaltungen werden nicht beachtet (vgl. Drumm 1995, S. 378).
Seine Untersuchungsergebnisse werden als Begründung für die Einführung von Job-Enlargement- und Job-Enrichment-Maßnahmen sowie für Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit aufgeführt (vgl. Berthel 1995, S. 26). Herzbergs Aussagen dienen zur Erläuterung von alltäglichen Situationen, trotz nicht vorhandener Validität (vgl. Staehle 1991, S. 207). Er zeigt neue Gesichtspunkte der Mitarbeitermotivation auf. Das Interesse wird auf die Arbeit selbst und auf die Arbeitsinhalte gelenkt. Die Hygienefaktoren sollen eliminiert werden, da sie zwar Arbeitsunzufriedenheit verhindern, aber nicht Arbeitszufriedenheit erzeugen. Diese wird durch Motivatoren erreicht; sie treten in den Mittelpunkt der Betrachtung.
McClellands Theorie der gelernten Bedürfnisse/ der Leistungsmotivation
Diese Theorie hat einen engen Bezug zu den psychologischen Lernkonzepten (vgl. Weinert 1998, S. 153). McClelland entwickelte die Inhaltstheorie in mehreren Schritten (vgl. Drumm 1995, S. 379). Er erklärt menschliches Verhalten aus dem Zusammenspiel des Strebens nach Leistung, Macht, Zugehörigkeit und Vermeidung (vgl. Scholz 1994, S. 424f.). Die meisten Bedürfnisse sind nicht angeboren, sondern werden erlernt. Dieser Lernprozess beginnt im jüngsten Kindesalter und wirkt sich auch im späteren Verhalten bzw. Arbeitsverhalten aus (vgl. Weinert 1998, S. 153).
Das Modell baut in seinen wesentlichen Teilen auf den Arbeiten von Murray auf. Aus dessen Katalog der Bedürfnisse verwendete McClelland die drei folgenden aus:
- Leistungsstreben (need for achievement)
- Soziales Streben (need for affiliation)
- Machtstreben (need for power),
da er diese für die Erklärung der menschlichen Motivation als wichtig ansah (vgl. Staehle 1991, S. 208). Es wird von einem Erwartungs-Valenz-Modell gesprochen werden, da Erwartungen hinsichtlich der Gewichtung von Zielen und über Vermutungen der Anstrengungen geschaffen werden (vgl. Staehle 1991, S. 210).
Arbeitsverhalten ist das Ergebnis aus:
1. Höhe der Motivation,
2. Valenz oder Verlockung eines Anreizes,
3. Erwartung, dass ein bestimmtes Verhalten durch Belohnung zur Erhaltung eines Anreizes führt.
Somit lässt sich folgendes Motivationsmodell aufzeigen (vgl. McClelland/Koestner/Wein-berger 1989):
Ts= Ms*Ps*Is
Ts= Tendenz einer Person.
Ms= Höhe des Schlüsselmotivs.
Ps= persönliche Abhängigkeit des Erfolges.
Is= Valenz dieses Erfolges/Belohnung
McClelland stellte sich nun die Frage, warum die Leistungsmotivation bei den Menschen unterschiedlich zum Ausdruck kommt, obwohl alle ein gewisses Maß an den drei Grundbedürfnissen (Macht-, Sozial- und Leistungsstreben) besitzen. Bei Untersuchungen hoch motivierter Mitarbeiter stellte er fest, dass diese folgende Charakteristika aufweisen:
- Sie gehen ein Risiko nur ein, wenn es überschaubar ist,
- Bevorzugt werden Aufgaben mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, bei denen der Ein- satz von Eigenkreativität sowie Eigeninitiative verlangt wird,
- Sie konzentrieren sich auf die Arbeit selbst,
- Sie erwarten ein Feedback,
- Intrinsische Motivation liegt vor, d.h. motiviert wird durch die Arbeit selbst.
Entscheidend für die Höhe der Leistungsmotivation ist das jeweilige Anspruchsniveau der Menschen. Dieses ist abhängig von den bereits erfolgten positiven und negativen Erfahrungen. Es konnten Unterschiede in der Erwartungsstruktur erfolgsmotivierter und misserfolgsmotivierter Individuen aufgedeckt. Der Mensch vergleicht seine Erwartungen durchgehend mit der Realität (vgl. Staehle 1991, S. 210).
Eine Führungskraft muss die Schlüsselmotive ansprechen, damit ein gewünschtes Verhalten bei den Mitarbeitern erfolgt (vgl. Weinert 1998, S. 156). Der Kern ist, dass ein guter Vorgesetzter seinem Mitarbeiter das Gefühl geben muss, dass er eigene Macht besitzt. Er bezieht diesen bei Zielvereinbarungen und Entscheidungen mit ein. Die Mitarbeiter haben somit die Möglichkeit, selbständig in ihrem Aufgabenbereich zu handeln und zu entscheiden.
Die Ansichten von McClelland über die Mitarbeiterführung und Gestaltung der Organisation sind allgemein und wenig operational (vgl. Scholz 1994, S 427f.). Somit besitzt seine Theorie inhaltliche Lücken, denn beispielsweise ist Macht nicht das einzige Motiv, welches zum Handeln anregt. Aus dieser Theorie lassen sich daher nur begrenzt Maßnahmen für die individuelle Motivation der Mitarbeiter ableiten (vgl. Drumm, 1995, S. 381-382).
McClelland´s Theorie verdeutlicht, dass Leistungsstreben und Macht wichtige Motivationsgrößen sind und bei der Gestaltung von Maßnahmen zur Motivation und Führung von Mitarbeitern unbedingt berücksichtigt werden müssen (vgl. Meier 1997, S.109). Dieser Gedanke wird in Kapitel 5.2 ausführlich behandelt.
Letztendlich erfolgt durch die Inhaltstheorien eine Klassifizierung der Bedürfnisse bei allen aufgeführten Modellen. Die einzelnen Autoren vertreten unterschiedliche Meinungen über das Auftreten, sowie über die Befriedigung der Bedürfnisse. Die aufgezeigten Theorien versuchen, das Arbeitsverhalten des Individuums zu erklären, allerdings mit unterschiedlichen Annahmen und Perspektiven. Somit ist es schwierig, eine einzelne Theorie zur Erklärung des Arbeitsverhaltens heranzuziehen (vgl. Weinert 1998, S. 156). Eine umfassende Erläuterung bringt keine der Theorien hervor.
Die Inhaltstheorien geben Denkanstösse, welches Motiv für welches Verhalten verantwortlich sein könnte, aber sie geben keine Auskunft darüber, wie ein bestimmtes Verhalten entsteht, d.h. welche kognitiven Prozesse hinsichtlich der Motivation im Menschen ablaufen (vgl. Staehle 1991, S. 211). Aus den Inhaltstheorien lassen sich grundsätzlich inhaltliche Gestaltungsempfehlungen für Anreizsysteme ableiten. Z.B. erlangen in Zeiten wirtschaftlicher Rezession, Bedürfnisse nach einem sicheren Arbeitsplatz vermehrt an Bedeutung.
3.2 Prozesstheorien
Der wichtigste Unterschied zu den Inhaltstheorien besteht darin, dass die Prozesstheorien die kognitiven Gesichtspunkte im menschlichen Handeln hervorheben und voraussetzen, dass der Mensch kognitive Erwartungen hinsichtlich des zu erreichenden Ziels hat (vgl. Weinert 1998, S. 157). Der Mensch handelt folglich nur dann, wenn dieses Handeln einen Wert für ihn besitzt.
Die VIE -Theorie von Vroom
Vroom (1964) entwickelte eine Instrumentalitätentheorie (s. u.), die als Grundmodell aller neueren Prozesstheorien der Motivation gilt. Das Vroomsche Modell basiert auf der Weg-Ziel-Theorie. Diese ist somit eine psychologisch orientierte, ökonomische Entscheidungstheorie. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass der Mensch immer die Alternative wählt, die ihm den größtmöglichen Nutzen bietet. Diese Theorie beruht auf der empirischen Beobachtung, dass die Leistung vom Menschen nur dann angestrebt wird, wenn er damit ein erwünschtes Ziel erreichen kann (vgl. Staehle 1991, S. 212f.). Die Leistungsmotivation eines Menschen hängt dabei von den situativen Bedingungen und der Wahrnehmung des verhältnismäßigen Nutzens der Leistung für die eigene Zielerreichung ab. Diese aufgezeigte Mittel-Zweck-Verbindung wird in den Prozesstheorien als Instrumentalität bezeichnet (vgl. Staehle 1991, S. 213). Die Kernelemente Vrooms Theorie sind:
1. Valenz (Wertigkeit):
Vroom versteht darunter den wahrgenommen Wert eines Handlungsergebnisses oder einer Handlungsfolge im Sinne einer positiven oder negativen affektiven Einstellung. Ergebnisse mit positiver Valenz werden vom Menschen angesteuert, negativen will er ausweichen (vgl. Berthel 1995, S.27). Individuen interessiert die Valenz des Ergebnisses, bevor sie die Arbeitshandlung beginnen. Die Valenz zeigt die Höhe des individuellen Verlangens bezüglich des Endergebnisses (vgl. Weinert 1998, S. 158). Bei den Ergebnissen wird unterschieden zwischen Ergebnissen der 1. Ebene (z.B. Belohnung für ein bestimmtes Leistungsverhalten = Bezahlung) und Ergebnissen der 2. Ebene (das sind Bedürfnisse oder Ziele z.B. nach Anerkennung) (vgl. Staehle 1991, S. 213).
2. Instrumentalität:
Diese drückt die Verbindung von Handlungsergebnis und Handlungsfolge aus. Sie ist die bereits erwähnte Mittel-Zweck-Beziehung (vgl. Staehle 1991, S. 213).
3. Erwartung:
Hierunter wird die subjektive wahrgenommene Wahrscheinlichkeit verstanden, dass eine Handlung zum gewünschten Ziel (Ergebnis) führt (vgl. Berthel 1995, S. 27).
Das Modell verdeutlicht, dass ein Verbinden von Belohnung (Geld) mit einem erwünschten Verhalten (Leistung) nicht ausreicht, damit das gewollte Verhalten auch eintritt. Bezahlung kann erwünscht sein. Kommt jedoch Unvorhergesehenes auf, wie Müdigkeit oder Ablehnung in der Gruppe, dann reicht dies zur Leistungsmotivation nicht aus (vgl. Berthel 1995, S. 28).
Die Motivation eines Menschen, seine Ziele zu erreichen, ist die Funktion von:
1. „seiner Erwartung, dass als Ergebnis seines Verhaltens ein bestimmtes Resultat erreicht werden wird, und
2. von der Valenz, die dieses Ergebnis für ihn hat (Weinert 1998, S. 160).“
Vrooms Motivationsmodell bietet für die Praxis der Organisationsprozesse eine verständliche Erklärung über das Arbeitsverhalten von Arbeitnehmern (vgl. Weinert 1998, S. 160). Es erklärt den Auswahlprozess des Handelns und bietet Vorhersagen darüber, welche alternativen Muster des Arbeitsverhaltens gewählt werden. Außerdem zeigt es die Varianz des Mitarbeiterverhaltens an der Arbeitsstätte auf (vgl. Weinert 1998, S. 160f.).
Die Grundannahmen konnten in empirischen Untersuchungen bestätigt werden (vgl. Neuberger 1974, S. 91f.). Allerdings erweist sich die Operationalisierung der einzelnen Variablen als problematisch (vgl. Berthel 1995, S. 28). Die praktische Anwendung auf der Stufe ausführender Tätigkeit ist demnach schwierig, da aufgrund der Valenz und der Erwartung des Mitarbeiter kaum Alternativen zur Auswahl stehen. Das Vroomsche Modell kann seine volle Erklärungskraft nicht entfalten, da es Wahlmöglichkeiten voraussetzt. In den meisten Arbeitssituationen aber sind Verhaltensalternativen sehr reduziert (vgl. Staehle 1991, S. 217). Besonders fraglich sind die zugrunde gelegte Rationalität, die Mittel-Zweck-Beziehung und die immer geltende Nutzenmaximierung. Außerdem wird nicht deutlich, inwieweit die aufgezeigten Prozesse für alle Menschen gültig sind (vgl. Berthel 1995, S. 28).
Das Modell hat große Popularität erlangt und stellt die Grundlage für weiterführende Modell dar. Die wichtigste Erkenntnis liegt darin, dass Menschen Ziele unterschiedlich werten und differenziert über instrumentelle Relationen und Wahrscheinlichkeiten urteilen (vgl. Scholz 1994, S. 436). Für die Entwicklung von Motivations- und Führungsmaßnahmen reicht es nicht, Mitarbeitern interessante Anreize zu bieten, um sie zu motivieren, ein bestimmtes Verhalten zu erbringen. Den Mitarbeitern müssen Wege (Instrumentalität) eröffnet werden, die ihnen sinnvoll für die Zielerreichung erscheinen (vgl. Scholz 1994, S. 436).
Das Modell bietet eine Grundlage für die Gestaltung des Anreizes „Führung durch Zielvereinbarung“ (s. Kap. 5.2). Außerdem wird der Zusammenhang zwischen Leistung und Geld aufgezeigt, was bei der Gestaltung von Anreizen in Kapitel 5.4 einfließt.
[...]
- Arbeit zitieren
- Tanja Gerstenlauer (Autor:in), 2001, Unternehmenskultur und Motivation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59
Kostenlos Autor werden
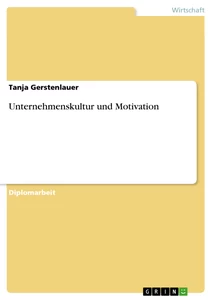

















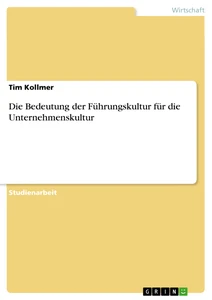

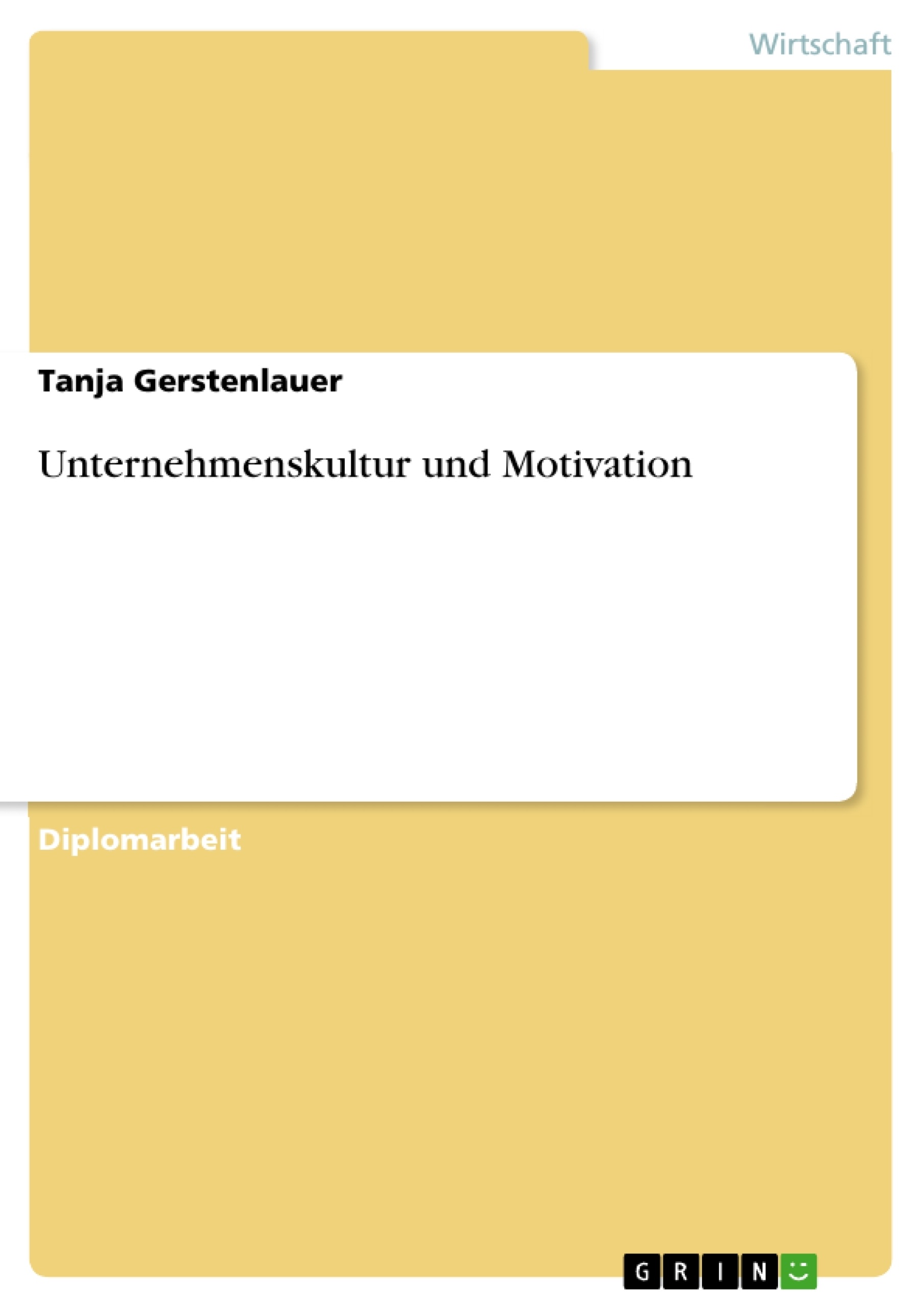

Kommentare