Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Teil
1. Normales Leben
2. Was eine Institution ausmacht
Warum es überhaupt Heime gibt
Das Heim (die Institution) als Anstalt
Von grausigen Gläsern und Tassen
3. Ablauforientierte vs. Bewohnerorientierte Pflege
Altenpflege als Erfüllen von Arbeitsabläufen
Altenarbeit als Fließbandarbeit
„keine Zeit haben“ als Metapher für die Verselbständigung von Arbeitsabläufen
Je größer das Heim, desto stärker der Funktionalitätsdruck
Ablauforientierung als Schutzmechanismus fürs Personal
II. Teil
4. Zur Funktion der Sachwalterschaft
Wenn Schaden vom Betroffenen abgewendet werden muß
5. Gegenmaßnahmen
Heimanwaltschaft
Eine Ausbildung des Personals, die auf die Individualität des alten Menschen ausgerichtet ist
6. Schluss
Anhang
Bundesgesetz vom 2. Feber 1983 über die Sachwalterschaft für behinderte Personen
Diese Arbeit ist
Fr. Frick Maria
aus Innsbruck-Hötting gewidmet,
die ihren letzten Lebensabschnitt im Heim verbringen mußte, damit das öffentliche Interesse gewahrt bleibt. Ihr Schicksal hat mich zu wichtigen Erkenntnissen geführt.
I. Teil
Das Thema meiner Projektarbeit liegt nahe am Thema des Hauptprojektes „Institutionalisierung und normales Leben“. Also welche Auswirkungen hat das Phänomen der Institution als Solcher auf das Leben in ebendieser? Ist normales Leben darin möglich ? In Diskussionen zum Projektthema kam öfters auch die Frage auf: Ist normales Leben überhaupt wünschenswert? Oder eigentlich so schrecklich, daß „normales“ Leben gar nicht als wünschenswertes Ziel anzustreben ist?
Das alles und noch anderes mehr sind sehr grundsätzliche Fragen, von deren Beantwortung das Woraufhin unserer Heime wesentlich abhängt.
Für mein Thema soll nun zunächst (und zwar in der Form der Behandlung von Einwänden zu dieser Forderung) in einem ersten Kapitel die Frage geklärt werden, was unter „normalem“ Leben verstanden werden soll; danach soll dann die Frage der Institutionaliserung behandelt werden
1. Normales Leben
1. Einwand: Normales Leben ist pfui
„Wenn ich mir anschau, wie die Leut leben, was sie für einen Stress haben, und daheim dann, wie sie mit dem Bier vor dem Fernseher sitzen, das ist normal, das ist wie die Leut heute leben; so toll ist das nicht, dass wir das im Heim auch noch haben müssen“. So oder ähnlich lauten viele der Einwände, die ich zum Thema „normales Leben“ zu hören bekommen habe.
Dieser Einwand bezieht sich auf die Lebensgewohnheiten der Mehrheit und lehnt von daher das Normalitätsprinzip ab. Der Einwand setzt weiters voraus, daß es Aufgabe der Heime sei, sich um die Lebensgewohheiten der darin Lebenden zu kümmern, und da wolle man nicht die schlechten Gewohnheiten der Mehrheit zum Maßstab setzen.
Das ist jedoch genau der Punkt, an dem der vorgebrachte Einwand zurückzuweisen ist.
Unter der Voraussetzung, daß man ein Heim nicht als Internat mit zu erziehenden alten Menschen betrachtet, kann es nicht als Aufgabe des Heimes gesehen werden, gewissermaßen erzieherisch auf die Lebensgewohnheiten der darin Lebenden einzuwirken. Würde es doch bedeuten, sich zum Kolonialherrn über den alten Menschen zu erheben, dem es zusteht, die Lebensgewohnheiten dieses Menschen zu beurteilen, zu gestatten oder zu verbieten.
Dieser Einwand ist also nicht nur abzuweisen, sondern vielmehr offenbart er sogar die erste Falle, nämlich daß plötzlich jemand da ist und sich aufschwingt, über meine Lebensgewohnheiten zu urteilen, ich also nicht mehr Herr im eigenen Haus bin.
Vielmehr muß es darum gehen, einen Rahmen zu schaffen, in dem der/die Einzelne eine möglichst große Kontinuität wahren kann, das heißt, möglichst viel von dem übernehmen kann, was sein/ihr Leben bisher ausgemacht hat – unabhängig davon, ob man das toll findet oder nicht.
Die Forderung, „normales“ Leben zu ermöglichen, hat also nichts damit zu tun, die „normalen“ Lebensgewohnheiten der Mehrheit zum Maßstab zu erheben, sondern diese Forderung zielt auf etwas ganz anderes ab, auf eigenbestimmte Lebensgewohnheiten:
Wer bestimmt, wie ich leben soll ? Muß ich leben, wie jemand anderer mir vorgibt oder kann ich nach eigenen Maßstäben darüber entscheiden. Es geht also um „normale“ Entscheidungsfindung; ich entscheide selber, wie ich auf die Anforderungen der Umgebung reagiere, die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden bleibt bei mir selber.
Der Verlust dieser „normalen“ Entscheidungsfindung wird in der Psychologie als eine der Quellen der Depression gesehen: als „erlernte Hilflosigkeit“ (Seligman), als festsitzende Überzeugung, das eigene Leben nicht mehr „kontrollieren“, beeinflussen zu können.
2. Einwand: Auch im normalen Alltagsleben müssen wir uns Regelungen unterwerfen
„Menschen immer und überall Regelungen unterworfen sind, ohne die ein Zusammenleben unmöglich ist. Leute, die nicht im Heim leben können auch nicht tun, was ihnen gerade vorkommt, sondern müssen auf andere, und seien es die anderen Familienmitglieder Rücksicht nehmen. Zur Normalität gehört eben dazu, dass es immer und überall Beschränkungen gibt“.
Dieser Einwand geht davon aus, daß eigenbestimmt leben bedeutet, tun und lassen zu können was man mag.
Natürlich ist richtig, daß die eigene Freiheit dort endet, wo die des anderen anfängt; natürlich ist richtig, daß Zusammenleben im Alltagsleben immer ein sich abstimmen auf die Bedürfnisse der anderen bedeutet, daß die Welt sich nicht um mich allein dreht. All das soll in keinster Weise bestritten werden.
Im Gegenteil.
Es ist in der Alltagserfahrung oft ein Ringen um das Finden einer gemeinsamen Ordnung feststellbar; sich anzupassen und angepasst werden sind Bestandteil eines aktiven und wechselseitigen Prozesses und nur selten entsteht das subjektive Gefühl, dass der Vorgang der Anpassung ein einseitiger Vorgang ist.
Und das ist genau der Punkt um den es dabei geht.
Wenn gewisse Grunderfordernisse einer gemeinsamen Ordnung sichergestellt werden müssen, ist die Frage zu stellen, ob es sich dabei um ein gemeinsames Suchen einer solchen Ordnung handelt, oder ob diese Ordnung (zum Beispiel ein Tagesablauf im Heim) einseitig vorgegeben ist.
Beispiel:
Wenn in einem Haus um 11 Uhr zu Mittag gegessen wird und Frau Muster will aber erst um 14 Uhr essen – was geschieht dann ? Findet sich eine Lösung, ihr diese Gewohnheit zu belassen ? Es soll hier betont wäre, daß es ein grobes Mißverständnis wäre anzunehmen, normales Leben im Heim zu wollen würde bedeuten, sich den Wünschen der darin Lebenden anzupassen und etwa für Frau Muster um 14 Uhr extra zu kochen. Das entspricht tatsächlich nicht unserer Alltagserfahrung. Diese besagt, dass wir vor die Herausforderung gestellt sind, auf einen unliebsamen Umstand aktiv zu reagieren; die Vor- und Nachteile der einen Lösung abzuwägen gegen jene der anderen Lösung und so schließlich zu einer eigenbestimmten Entscheidung zu kommen.
In unserem Beispiel geht es also darum Frau Muster die Herausforderung zu belassen: Will sie lieber mit den anderen essen oder lieber um 14 Uhr ganz allein essen ? Will sie das Essen lieber frisch haben, oder um 14 Uhr in der Mikrowelle aufgewärmt ? –
Der entscheidende Punkt ist also, daß es an Frau Muster selber liegt, welche Einschränkungen sie in Kauf nehmen will und welche nicht, das heißt, es ist ihr die reale Wahlmöglichkeit belassen – und wie immer ihre Entscheidung ausfallen wird, es ist ihre eigenbestimmte Entscheidung.
Dieser 2. Einwand führt also zu einer näheren Bestimmung dessen, was eigenbestimmtes Leben bedeutet: nämlich jemandem die Wahlmöglichkeit zu belassen, ihn / sie vor die Herausforderung zu stellen, am Finden einer gemeinsamen Ordnung aktiv teilnehmen zu können.
3. Einwand: Dadurch daß die Leute pflegebedürftig sind, hört sich das normale Leben von selber auf
„Die meisten Leute kommen ja heute pflegebedürftig ins Heim, da sind sie froh daß sie überhaupt versorgt sind; die Pflegebedürftigkeit selber ist ja schon kein normaler Zustand, wären die Menschen die zu uns kommen nicht hilflos, so wären sie nicht hier“.
Dieser Einwand ist schwerwiegend, da er sicherlich vieles ganz richtig sieht: daß nämlich der Umstand pflegebedürftig zu sein, einen großen Einschnitt ins bisherige Leben bedeutet, daß es nicht mehr so ist wie es früher war, daß sich das bisherige Leben nicht mehr so ohne weiteres fortsetzen läßt.
Wird dadurch die Forderung nach einem normalen Leben sinnlos ?
Genau hier setzt die Kritik an diesem Einwand an, daß nämlich Pflegebedürftigkeit als statischer unveränderlicher Zustand betrachtet wird an dem es nichts zu rütteln gibt. Und das wiederum entspricht in keinster Weise meiner Heimerfahrung. Ich habe sehr alte Menschen erlebt, die sehr schwer pflegebedürftig waren und trotzdem wieder hoch gekommen sind und andere, die es nicht mehr geschafft haben, obwohl sie objektiv gesehen nicht so beeinträchtigt waren.
Daß heißt, daß die Entwicklung von Pflegebedürftigkeit sehr wohl etwas damit zu tun hat, mit welcher Erwartungshaltung, mit welcher Unterstellung wir an den einzelnen Pflegebedürftigen herantreten.
Erwarten wir von ihm, daß er / sie sich halt jetzt einzufügen hat ins Los der Pflegebedürftigkeit, daß er / sie mit diesem Umstand alles eigene Leben fahren läßt und sich freudig einordnet ins fremdbestimmte Leben – oder unterstellen wir ihm/ihr, daß er/sie ja sicherlich wieder hoch kommen wird um dann wieder anzuknüpfen an das bisherige.
4. Einwand: Wo kämen wir denn da hin !
„Wie soll denn ein Betrieb funktionieren, wenn alle Leute Extrawürste anmelden; das geht sich ja vom Ablauf dann alles nicht mehr aus; oder es wird so teuer daß es sich keiner mehr leisten kann“.
Dieser Einwand ist sicherlich der vordergründigste von allen hier vorgebrachten (Zur Ehrenrettung der Tiroler Heime muß vorgebracht werden, daß in den vielen Häusern in denen sich die Leitung um eine Qualitätsverbesserung bemüht dieser Einwand selten geworden ist). Er geht am leichtesten von der Zunge und ist gleichzeitig für mein Thema der dankbarste. Und zwar deshalb weil er am deutlichsten entlarvt, was eine Institution ausmacht. Im Vordergrund steht die Funktionalität des Gesamtgefüges, dem sich die Individualität des Einzelnen unterzuordnen hat. Das reibungslose Funktionieren der Abläufe ist wichtiger als der Blick auf den einzelnen Bewohner.
Im Folgenden sollen nun kurz die charakteristischen Merkmale von Institutionen kurz dargestellt werden:
2. Was eine Institution ausmacht
Warum es überhaupt Heime gibt
Frägt man danach, was denn das Charakteristische einer Institution sei, woran man sie denn überhaupt zu erkennen vermag, so lohnt der Blick auf die Frage, wieso es denn überhaupt Heime („Institutionen“) gibt.
Eine erste Antwort darauf lautet: Es gibt in der Gesellschaft Gruppen von Menschen, die nicht in der Lage (oder vielleicht auch nicht Willens) sind, sich in das Gefüge unserer Zivilisation einzuordnen oder denen eine solche Einordnung erst beigebracht werden soll (wie das etwa bei Kindern über die Sozialisationsagentur „Schule“ der Fall ist); Menschen also, deren Lebensablauf wieder einer öffentlich akzeptierten Norm dessen, wie Alltagsleben zu geschehen hat, angenähert werden sollen; mit anderen Worten, es geht darum, es geht um die Kolonialisierung der privaten Lebenswelten, mit dem Ziel, sie einer sozial akzeptierten Norm angemessenen Lebens einzuordnen. Durch den Aspekt der Verteidigung und Bekräftigung sozialer Normen hat dieses Ziel für das Leben einer Gesellschaft eine wichtige identitätsstiftende Funktion und zu diesem Zweck werden für solche klar abgegrenzten Personengruppen Institutionen errichtet.
Ein Beispiel:
Es soll hier der Platz sein, das traurige Schicksal der Frau Frick Maria als besonders prägnantes Beispiel für das oben eher theoretisch beschriebene anzuführen:
Die alte, zwar gebrechliche aber doch noch selbständige Frau lebt allein in ihrem Haus in der Schneeburggasse; sie ist sicherlich nicht mehr in der Lage alle ihre Angelegenheiten alleine zu bestreiten und sicherlich zeigt sie dadurch auch gewisse Verwahrlosungstendenzen; sie wird aber ambulant mit dem wichtigsten versorgt und sie fühlt sich durchaus zufrieden in ihrem Haus. Da geschieht es, daß es den Verantwortlichen des Sozialsprengels vorkommt, die alte Frau sei zwar kein richtiger Pflegefall, aber man könne die Frau doch nicht mehr weiter in ihrem Hause lassen, sie würde verwahrlosen, am Ende sich noch weh tun.
Die Frau muß ins Heim! Wir können es nicht mehr verantworten!
Die Frau wehrt sich mit Händen und Füssen gegen die Vertreibung aus ihrem Haus und die Aussiedlung ins Heim – es nützt ihr nichts. Die Möglichkeit der Verwahrlosung ist sozial nicht verträglich, nicht vereinbar mit unseren öffentlich akzeptierten Lebensvorstellungen – die gesellschaftliche Norm muß aufs äußerste verteidigt werden.
Der armen Frau, die also zum Zweck der Verteidigung einer öffentlichen Norm aus ihrer privaten Lebenswelt herausgerissen wurde, ist das ganze gar nicht gut bekommen und hat bei ihr zu einer massiven Dekompensation geführt; nach einem Monat im Heim ist ihre Widerstandskraft erloschen und sie ist verstorben.
Klar wird hier, daß es bei der Motivation der Sprengelverantwortlichen nicht um das Wohl der Frau gegangen ist, sondern um das Wohl des öffentlichen Interesses, nämlich die soziale Norm zu wahren, niemanden verwahrlosen zu lassen – und koste es auch sein Leben. Eine Aussage wie „wir können es nicht verantworten“ heißt also übersetzt: wir können es vor der Öffentlichkeit nicht verantworten – es vor der betroffenen Frau zu verantworten ist dabei offensichtlich nicht relevant. Es ist wichtiger, die gesellschaftliche Norm zu wahren als dem, der davon abweicht ein Recht auf Anderssein zuzugestehen[1].
Eine zweite Antwort auf die Frage warum es überhaupt Heime gibt lautet, weil durch eine Zusammenfassung ganzer Personengruppen die gesellschaftliche Zielsetzung besser erreicht werden kann. Es ist praktischer von der Abwicklung her und – so zumindest die Theorie – es ist auch kostengünstiger; es muß nicht für jeden alles extra gemacht werden, sondern es genügt der gleiche Arbeitsgang für viele Personen.
Und genau die Verbindung beider Antworten ist es, was die Institution zur Institution, das Heim zum Heim macht. Die Möglichkeit öffentlich geforderte Vergesellschaftungs- und Versorgungsleistungen möglichst effizient zu erbringen macht die Institution „Heim“ so interessant.
Das Heim (die Institution) als Anstalt
“Anstalten”, die in sich mehr oder weniger abgeschlossene Systeme bilden, wo also die “Insassen” kaum Kontakt zur Außenwelt haben, in denen die Verregulierung des täglichen Lebens besonders deutlich ausgeprägt ist, indem alle Bedürfnisse der darin lebenden Menschen vorgeplant sind, sind von Goffman (1973) als „Totale Institutionen” beschrieben worden. In diesen Anstalten findet sich meist ein eigenartiger Zwiespalt: Sie dienen
“die meiste Zeit über als bloße Aufbewahrungslager für die Insassen, aber ... sie stellen sich der Öffentlichkeit gegenüber für gewöhnlich als rationale Organisationen dar, die in jeder Hinsicht bewußt als effektive Apparate zur Hervorbringung einiger offiziell anerkannter und gebilligter Ziele eingerichtet wurden. ... wird häufig als offizielles Ziel die Besserung der Insassen im Sinn einer bestimmten idealen Norm angegeben. Dieser Widerspruch zwischen dem, was die Institution tut, und dem, was sie offiziell als ihre Tätigkeit angeben muß, bildet den grundlegenden Kontext für die tägliche Aktivität des Personals” (Goffman 1973, 78).
Goffman beschreibt sie als
“soziale Zwitter, einerseits Wohn- und Lebensgemeinsachft, andererseits als formale Organisation ... Jede dieser Anstalten ist ein natürliches Experiment, welches beweist, was mit dem Ich des Menschen angestellt werden kann” (Goffman 1973, 23).
Die De-Individuierung der Menschen in der Institution, also die Reduktion der Heimbewohner auf bestimmte vorgeplante Versorgungsaspekte, geht einher mit der Herstellung des Machtgefälles zwischen Pflegling und Pfleger; in einer Interviewpassage (das Interview wurde durchgeführt im Rahmen meiner Diplomarbeit im Fach Psychologie[2] ) mit einer Pflegeperson wird das sehr schön deutlich:
ich mag Fights ... jemanden, der sich mit Händen und Füßen um sich schlagend gegen irgend etwas wehrt, wo's dann halt voll lustig wird; also ich mein, ich find's lustig; aber wie gesagt, so lange das möglich ist, daß ich jemand anders reinschicke und nicht gezwungenermaßen da hingehen muß, und das ist eigentlich nie der Fall
Was ist da lustig dran, wenn jemand so
I like it, ich weiß nicht, ich komm von der C., deswegen [Gelächter]
So, was weiß ich, ich denk, die Fr. Q. oder so
Ja mei, da spielt halt das Recht des Stärkeren mit eine Rolle, würd ich mal behaupten; meine Rolle als Autorität oder was ich da ausleben kann; keine Ahnung, aber es macht Spaß
So deine Macht, die du über die Leute
Ja, im Prinzip schon, ich lach halt darüber; aber so in die Richtung geht das sicher, Machtgefühl oder irgend so was
Daß du da am längeren Ast sitzt
Ja eben; nicht daß ich das bösartig meine, aber ich find es trotzdem lustig, je mehr jemand schlägert ... und ab und zu einmal ein bißchen gewalttätig werden
Wie meinst du das
Ja z.b. halt O. und Q.: ich mein, ich könnt die natürlich auch zart und liebenswürdig ausziehen, aber bei denen kommst du eh nicht mehr durch in keinster Weise, kommt mir halt vor und ich glaub, und ich glaub, da werd ich ein bißchen brutal
Was heißt da brutal
Ja ich mein, ich könnt natürlich auch ganz liebenswürdig der die Bluse ausziehen, schön langsam und vorsichtig und da und man kann halt auch die Leute einfach aus der Bluse rauszerren und das passiert mir dann ab und zu
Die von Goffman beschriebenen Anstalten sind gekennzeichnet durch ein starkes Straf- bzw. Aussonderungsbedürfnis (Gefängnis, KZ, psychiatrische Klinik, ...) von Seiten des Personals; die Brechung des Willens der Insassen als etwas, das als Mittel der sozialen Kontrolle bewußt gewollt wird, die totale Unterwerfung als Ziel, das erreicht werden soll.
Goffman unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Arten “Totaler Institutionen”. Waisenhäuser, Altenheime, Internate, Klöster, psychiatrische Kliniken, Gefängnisse und KZ laufen für ihn alle unter der gleichen Kategorie. Dadurch wird einerseits der Blick für die Vergleichbarkeit der erzielten Effekte geschärft; auf der anderen Seite werden dadurch auch Unterschiede verwischt. Es macht m. E. einen Unterschied, ob die Entpersönlichung der Individuen bewußt angestrebt wird, oder ob sie “passiert”; vielleicht sogar gegen den Willen derer, die sie betreiben.
In dieser Hinsicht besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem, was Goffman beschrieben hat und dem, was sich in unseren heutigen Institutionen, vor allem auch den Alten- und Pflegeheimen zeigt. Bewußte Demütigungszeremonien wie dort beschrieben, sind hier kaum zu finden. Die Entpersönlichung der Menschen im Heim wird hier nicht bewußt angestrebt, aber als unvermeidlich in Kauf genommen. Bewußte Unterwerfungsabsicht (wie von Goffman beschrieben) und institutionelle Ablauforientierung scheinen also zu vergleichbaren Effekten zu führen.
Der Umstand, daß das Personal sich sofort nach dem Eintritt eines neuen Insassen über diesen hermacht, wird von Goffman mit Zuschreibungsprozessen in Zusammenhang gebracht:
“Das Interpretationsschema der totalen Institution kommt, sobald der Insasse eintritt, automatisch in Gang, da das Personal der Ansicht ist, daß der Eintritt als solcher ein sichtbarer Beweis dafür ist, daß der Betreffende zu dem Personenkreis gehört, für den die Institution eingerichtet wurde ... Wäre er kein Verräter, Krimineller oder Geisteskranker - warum wäre er dann hier?” (Goffman 1973, 87).
Bezogen auf ein Altenheim: Allein schon der Eintritt eines Menschen ins Heim bedeutet die Depotenzierung des Neueingetretenen. Sein Eintritt wird als Beweis dafür angesehen, daß er nicht mehr imstande ist, Verantwortung für sich selber zu übernehmen, daß er versorgt werden muß („wärst du nicht hilflos, so wärst du nicht hier“); und diese Unterstellung nährt die zweifelhafte Vorstellung, daß seine Unterwerfung unter die dafür vorgesehenen Alltagsroutinen, die “Kolonialisierung seiner Lebenswelt” (Habermas 1981) genau das ist, was zu seinem Besten notwendig sei. Daß das zu den ersten Dingen gehört, die neue Mitarbeiter lernen wird an der folgenden - in Dialogform wiedergegebenen - Interviewpassage (mit einer Pflegeperson, die zum Interviewzeitpunkt erst kurz in der Altenpflege tätig war) deutlich:
... am Anfang - hab ich mich der D. gegenüber anders verhalten als wie jetzt; weil da hab ich mir gedacht: das ist eine alte Frau und ich bin so ein junger Hupfer und ich kann nicht D. zu ihr sagen und komm, tu das; also irgendwie hab ich mir da schon schwer getan, daß ich ihr irgend etwas anschaffe, weil ich mir gedacht habe, ma, wie komme ich dazu. Aber jetzt, jetzt geht es gut. Und irgendwie will sie es auch und braucht sie es, daß man ihr einfach sagt, was sie tun soll
Mhm, da ist kein Problem dabei
Jetzt nicht mehr, nein, aber am Anfang schon, aber da mehr noch bei denen, die sich ausgekannt haben
Versteh ich dich richtig, daß du da so eine Entwicklung von deinem, von dem wie du da herinnen bist, wie du dich zu den Leuten verhältst, daß du da so eine Entwicklung irgendwie auch stattgefunden hat, vom Anfang bis jetzt so
Mhm
Und wie würdest du die beschreiben, die Entwicklung
Ah - ich habe eine dickere Haut gekriegt
Was heißt dickere Haut
Ich nehm mir viel nicht mehr so zu Herzen
Zum Beispiel
Wenn ich angeschrieen werde oder so; also am Anfang da hab ich schon - öps; oder es hat mich echt irgendwie berührt oder fertig gemacht sogar und jetzt nicht mehr. Oder - eben das, was ich jetzt gesagt habe; ich mein, ich hab schon auch noch Respekt vor den älteren Leuten, aber ich kann mich jetzt durchsetzen.
Was bedeutet das Wenn ich etwas tu, was eine nicht will; am Anfang hab ich gedacht, nein die will das nicht, dann darf ich das auch nicht tun; aber jetzt weiß ich aber, daß ich es tun muß und daß es gut ist und
Zum Beispiel was für Sachen
Zum Beispiel am Anfang wenn sich eine: ich wasch mich da nicht und ich wasch mich nicht und ich will nicht und sie greifen mich nicht an; dann hab ich sie nicht gewaschen dort, z.b. intim oder so oder unter den Achseln oder nicht das Leiberl ausziehen, aber jetzt sage ich: sie müssen sich waschen und sie ziehen sich jetzt das Leiberl aus; jetzt geht das halt schon
Und wie würdest du das charakterisieren so diese Entwicklung; ist das etwas, das zu diesem Beruf dazu gehört oder wie würdest du da sagen dazu
Ja - ich weiß nicht
Findest du es jetzt mittlerweile normal, daß du einfach so
Daß ich einem Menschen, der 5-mal älter ist als ich etwas anschaffe
Von grausigen Gläsern und Tassen
Ein weiteres typisches Kennzeichen von Institutionen ist das Vorhandensein von zweierlei Mitgliedsarten. Solche Mitglieder die darin leben und solche, denen in irgendeiner Weise eine Versorgungsfunktion für die darin Lebenden zukommt. Im allgemeinen legt die zweite Gruppe strikten Wert darauf, sich von der ersten zu unterscheiden, nicht mit ihnen verwechselt zu werden, sich abzuheben.
Ein typisches Beispiel für die große Bedeutung dieses Unterschieds stellt das bei Pflegern häufig anzutreffende Phänomen dar, für sich selber andere Tassen zu verwenden als für die Bewohner verwendet wird, oder auch andere Toiletten zu benützen als die Bewohner.
Man könnte hier einwenden: „Jaja, ist ja aber auch wirklich grausig, aus der gleichen Tasse zu trinken, aus der Frau Muster schon einmal getrunken hat“.
Analysiert man eine solche Aussage auf ihren Gehalt, so stellt sich folgende Frage:
Werden die Tassen nicht ordentlich und gründlich abgewaschen ?
Wenn die Tasse doch ordentlich gereinigt sein sollte – welchen Grund sollte es geben, sie nicht auch für sich selbst zu verwenden.
Ist die Tasse tatsächlich grausig (weil man sie vielleicht gar nicht mehr sauberkriegt), dann ist es einleuchtend, sie nicht mehr zu verwenden. Aber: warum sollte dann Mitbewohnern zugemutet werden, Tassen und Gläser zu verwenden, die dem Personal zu grausig sind?
3. Ablauforientierte vs. Bewohnerorientierte Pflege
Zur Einordnung dieses Kapitels sei nochmals Goffman zitiert:
Dieser Widerspruch zwischen dem was die Institution tut, und dem was sie offiziell als ihre Tätigkeit angeben muß, bildet den grundlegenden Kontext für die tägliche Aktivität des Personals (Goffman 1973, 78)
Generell kommt dem Personal in Institutionen eine besondere Bedeutung zu. In welchem Ausmaß gelingt es dem Personal, die Institutionsdynamik zu mildern bzw. in welchem Ausmaß wird diese Dynamik noch verstärkt.
In der bereits erwähnten Untersuchung konnten zwei einander gegenüberstehende Auffassungen vom Pflegeberuf herausgefiltert werden, die sich genau in diesem Punkt voneinander unterscheiden: die eine, die Altenarbeit vor allem als Erfüllen von vorgegebenen Arbeitsabläufen sieht (sich damit an der Vorgabe der Institution orientiert) und die andere, die stark an den Bedürfnissen der Bewohner ausgerichtet ist.
Im Folgenden soll diese Unterscheidung – auch an einigen Interviewbeispielen – kurz dargestellt werden.
Altenpflege als Erfüllen von Arbeitsabläufen
Die täglichen Arbeitsabläufe in denen Altenarbeit stattzufinden hat, werden oftmals als enges zeitliches Korsett erlebt, in dem die Menschlichkeit des Menschen unterzugehen droht. Dabei können zwei Aspekte voneinander unterschieden werden:
Da ist einmal die Frage, als wie starr das vorgegebene Schema erlebt wird, d.h. in welchem Ausmaß auf besondere Umstände reagiert werden kann, welche Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung dieses Schemas vorgestellt werden. Und zum anderen - als Folge davon - welcher Zeitdruck entsteht durch die Vorgabe dieses Ablaufschemas.
Das wird auch daran deutlich, daß die Kritik am starren zeitlichen Korsett oft jene Kollegen abbekommen, die das tägliche Ablaufschema allzu bereitwillig zu übernehmen scheinen. Ihnen wird unterstellt, das Erfüllen der täglich vorgegebenen Abläufe zum Selbstzweck werden zu lassen.
ich hab aber auch Erfahrungen gemacht, daß wirklich viele Mitarbeiter einfach hineingehen, den Tagesablauf einfach gestalten da, und einfach die Arbeiten machen, aber ohne Gefühl und ohne nix; also wo der Bewohner gar nicht im Mittelpunkt steht, sondern einfach daß die Arbeit getan ist zur Genüge ...für die ist es nicht so wichtig, was der alte Mensch so braucht, sondern für die ist einfach der Arbeitsablauf wichtig, daß das einfach getan ist, aber nicht mehr ... und je früher man fertig ist, desto feiner ist es
während meiner Zeit, während ich arbeite, sind wir so eingeteilt, daß uns das sehr schwierig vorkommt, wenn jetzt jemand stirbt, daß wir dabei sitzen können, weil's zeitlich einfach einen Plan gibt, wie alles ablaufen soll
daß ich eben leben kann bis zum Schluß, und nicht bis zu dem Moment, wo ich auf Hilfe angewiesen bin oder ins Altersheim komm und dann werd ich gelebt, weil dann gibt's halt um 12 das Essen und dann den Kaffee und dann ist das, es soll nicht so sein, daß der Bewohner in eine fix strukturierte Umgebung kommt, wo alles dann so abläuft und er sich zu fügen hat, daß er dort sein Leben so zu leben hat, wie's dort erwünscht ist, sondern, daß das eben umgekehrt läuft, daß die Betreuer den so betreuen, wie er das braucht und wie er das immer gemacht hat
wenn das Zwischenmenschliche mir nicht gelingt oder eben so wenig Zeit ist, es gelingt mir einfach auch nicht, oder ich bin selber nicht gut drauf, nachher glaub ich, würd sich's für mich bald einmal aufhören, sicher ... weil dann nur mehr ein mechanischer Ablauf überbleibt
denen ist wichtig, daß alles ganz sauber ist; daß er ganz genau gewaschen ist, daß das Bett sauber ist, der Boden sauber ist, daß alles pünktlich im Ablauf ist; diese Einstellung hab ich nicht so sehr, mir ist das gleich, ob der jetzt ein paar Tage später gebadet wird oder nicht
auch die Zeit, daß ich erfahr, was sie eigentlich will von uns; weil ich sag zu ihr: Ja, Fr. N., auf's Klo; nein; Möchtest du eine Zigarette; nein, nein, nein; und nachher tu ich gar nicht mehr lang; nachher kann ich dir nicht helfen, Fr. N.; und wenn ich mehr Zeit hätte, dann könnte ich mehr auf sie eingehen ... immer im Hinterkopf, ich muß weiter machen, und dann gehen die Glocken; da bleibt mir dann nicht die Zeit daß ich bei ihr länger hocken bleiben kann
Es macht jedenfalls einen Unterschied ob gefordert wird, man müsse sich für dies oder jenes Zeit nehmen, oder ob beklagt wird, für dies oder jenes keine Zeit zu haben. Besonders klar kommt dieser Unterschied im Vergleich der beiden folgenden Ausschnitte zum Ausdruck:
[...]
[1] Man könnte hier einwenden, daß eine förderliche Umwelt die Entwicklung und Entfaltung eines Menschen beträchtlich befördern könnte und auf diese Weise auch sein Wohlbefinden mehr erhöhen könnte, als er es im verwahrlosten Zustand hat. – Dieser Einwand hat etwas für sich, stimmt aber nur dann, wenn der Betroffene diese förderliche Umwelt auch als solche erkennt und interpretiert und nicht als gegen sich gerichtet empfindet. Im erwähnten Beispiel war das offensichtlich nicht der Fall – und so nützt die bestgemeinte förderliche Umwelt nichts, wenn eine Person diese nicht als förderlich wahrzunehmen imstande ist.
[2] Hofbauer R.(1997), Eine Erhebung der Alltagstheorien von Altenarbeit und des Belastungserlebens beim Pflegepersonal eines Altenheimes. Diplomarbeit eingereicht am Institut für Psychologie der naturwissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
- Arbeit zitieren
- Roland Hofbauer (Autor:in), 2001, Wärst du nicht hilflos, so wärst du nicht hier - Zur Schwierigkeit eigenbestimmten Lebens im Heim, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5886
Kostenlos Autor werden


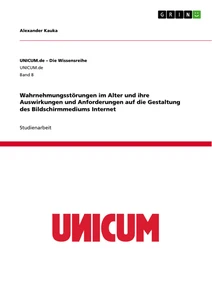


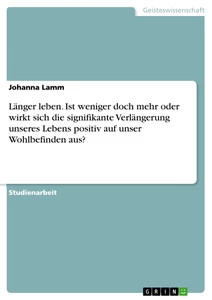










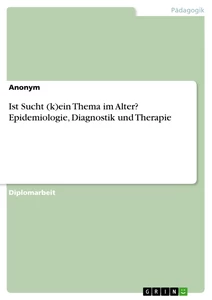



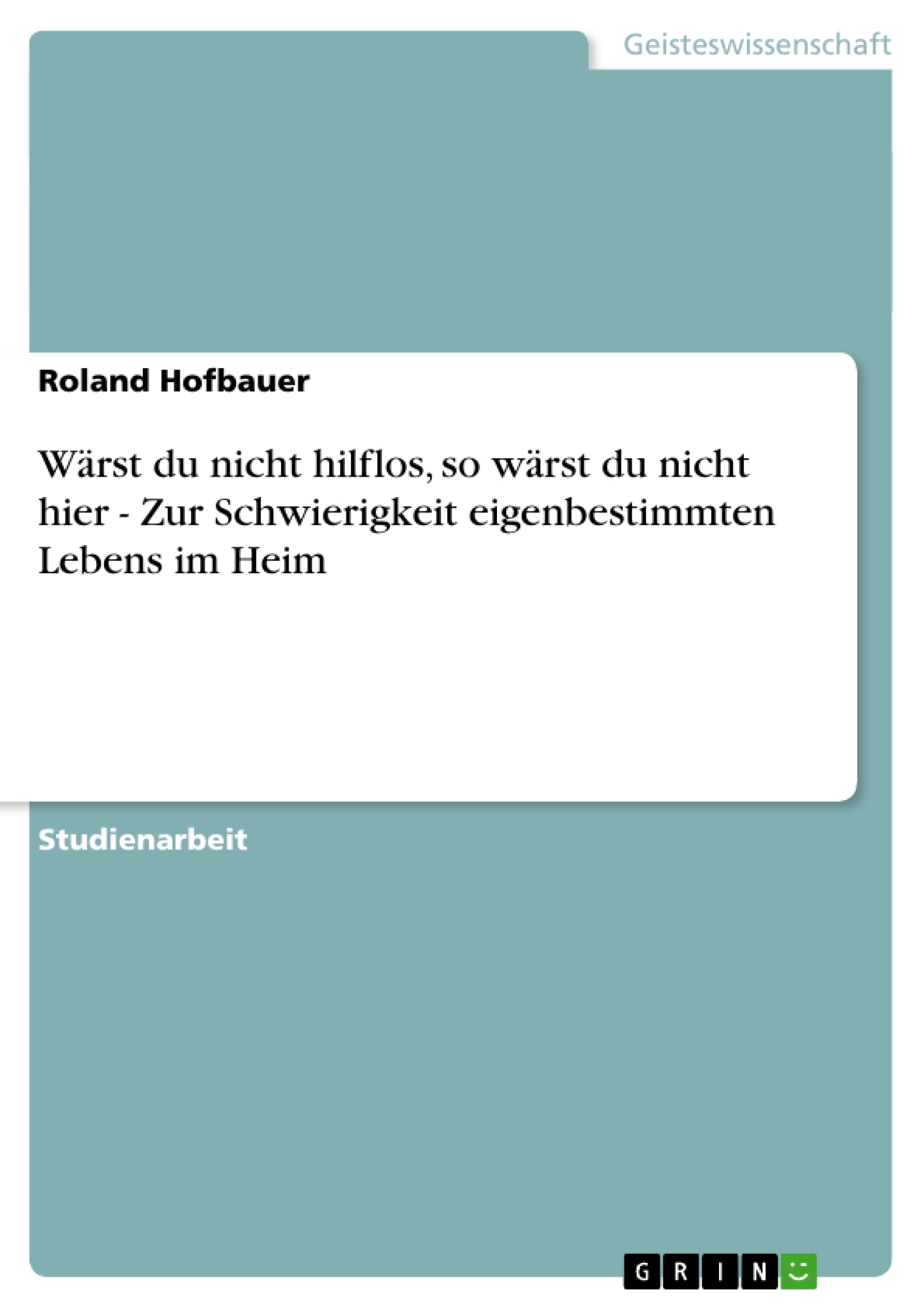

Kommentare