Leseprobe
Inhalt
0 Einleitung
1 Begriffsbestimmungen
1.1 Subliminale Wahrnehmung
1.2 Klassische Konditionierung
1.3 Einstellung und Einstellungsbildung
2 Unbewußte Prozesse: Empirische Befunde und Theorien
2.1 Historie
2.2 Unbewußte Konditionierungsphänomene
2.3 Unbewußte Evaluationsprozesse
2.4 Kritik
3 Die Experimente von Krosnick et al. (1992)
3.1 Subliminale Konditionierung von Einstellungen?
3.2 Kritik
4 Konzeption der vorliegenden Untersuchung
4.1 Konzept und Zielstellung
4.2 Hypothesen
4.3 Medium Video
4.4 Bildmaterial
4.5 Filmmaterial
5 Voruntersuchung
5.1 Versuchsplan
5.2 Durchführung
5.3 Ergebnisse
6 Hauptuntersuchung
6.1 Versuchsplan
6.2 Versuchspersonen
6.3 Durchführung
6.4 Fragebogen und Material
7 Ergebnisse
7.1 Hypothesengeleitete Datenanalyse
7.1 Explorative Datenanalyse
8 Diskussion
9 Ausblick
Literatur
Anhang
0 Einleitung
„Bloß nicht darüber nachdenken“ ist ein Artikel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22.04.1998 überschrieben, in dem über eine neue Strategie zum Nachweis unbewußter Wahrnehmungen berichtet wird (Lenzen, 1998). In dieser Überschrift schwingt eine seit der Entwicklung psychoanalytischer Theorien existierende Angst vor dem Unbewußten mit. Besondere Nahrung erhielt die Scheu vor dem Unterbewußtsein als Mitte der fünfziger Jahre ein Psychologe und Werbefachmann namens James Vicary (1957) behauptete, er hätte in einem Experiment subliminale (unterschwellige) Botschaften in einem Kinofilm untergebracht, mit denen er direkt das Unbewußte ansprechen könne. Die Botschaften, die er verwendete, bestanden jeweils aus zwei Worten: Drink Coke und Eat Popcorn. Der Erfolg dieser Vorgehensweise soll darin bestanden haben, daß der Cola- und Popcornkonsum in dem Kino erheblich angestiegen sein soll. Dieses Experiment löste einen Sturm der Entrüstung aus. Der Publizist Vance Packard wurde durch dieses angebliche Experiment animiert, sein Buch The Hidden Persuaders zu schreiben (Die geheimen Verführer, dt. 1957), in dem er die Manipulation der Bürger durch die Werbung anprangert. Die Bezeichnung ‘angebliches Experiment’ wurde deshalb so gewählt, weil bis heute unklar ist, wie diese Untersuchung abgelaufen sein soll, bzw. ob sie überhaupt jemals stattgefunden hat. Vicary gab immer nur sehr vage Informationen preis. Später widerrief er unter dem Druck der Öffentlichkeit, diesen Versuch jemals durchgeführt zu haben und erklärte, es habe sich allein um eine Werbekampagne gehandelt, um Tachistoskope zu verkaufen. Aus heutiger Sicht ist dies wohl der wahre Hintergrund dieser Geschichte (vgl. Moore, 1992; Pratkanis, 1992). Doch auch Hans Thomae wies bereits 1959 darauf hin, daß die Wirkung unterschwelliger Werbung überschätzt werde und die von Vicary behaupteten Wirkmechanismen wohl eher in den Bereich des Glaubens als den des Wissens gehören. Trotzdem warnte er zugleich davor, die unterschwellige Werbung weiterzuentwickeln, da durchaus Möglichkeiten bestehen könnten, daß unbewußte Wahrnehmungen unsere Haltung gegenüber Einstellungsobjekten beeinflussen. Er forderte deshalb die Einhaltung ethischer Prinzipien beim Umgang mit der Forschung in diesem Bereich (Thomae, 1959).
Was blieb, war der Mythos der unterschwelligen Werbung und die Angst vor unbewußter Manipulation. In der Folgezeit bemühte sich die psychologische Forschung in erster Linie um den Nachweis, daß solche unbewußten Prozesse nicht existieren (dürfen). Skeptische Forscher negierten die Auffassung, daß unbewußte Wahrnehmungen einen Einfluß auf unsere kognitiven und affektiven Reaktionen haben könnten. Der zur Blüte gekommene Behaviorismus mit seiner Ablehnung gegenüber der Annahme kognitiver Prozesse und die an kybernetischen Modellen orientierte kognitive Psychologie der fünfziger und sechziger Jahre sorgten dafür, daß die Erforschung unbewußter Phänomene an Bedeutung verlor. Seit Anfang der achtziger Jahre erlebt die Erforschung unbewußter Prozesse nun eine Renaissance. Neue, weniger angreifbare Methoden sorgen für einen ungeahnten Aufschwung dieser Forschungsrichtung.
Daß auch heute noch Worte wie unbewußt oder unterschwellig angstauslösend wirken, zeigt sich am eingangs aufgeführten FAZ-Artikel. Hier wird nach wie vor die Manipulation unbewußter Wahrnehmung als gefährlich eingestuft, da man sich ihrer Wirkung nicht entziehen könne (Lenzen, 1998). Ist unbewußte Wahrnehmung aber tatsächlich mehr als bloße Vorbereitung und Erleichterung von bewußter Informationsverarbeitung, so wie es die meisten Forscher heute sehen? Oder gibt es Effekte unterschwelliger Wahrnehmungen, die darüber hinaus gehen und möglicherweise so komplexe Gegebenheiten - wie sie Einstellungen darstellen - beeinflussen können? Eine Untersuchung von Krosnick, Betz, Jussim & Lynn (1992) beantwortete diese Frage mit einem klaren Ja. In ihrer Studie koppelten sie die Diaprojektionen einer Frau mit extrem kurz eingeblendeten, stark positive oder negative Emotionen auslösenden Bildern. Der Erfolg dieser Prozedur bestand in Einstellungsunterschieden gegenüber der Zielperson zwischen den Probanden, welche positive und den Probanden, die negative Einblendungen dargeboten bekommen hatten.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, den von Krosnick et al. (1992) berichteten Effekt zu replizieren und damit auch eine Antwort auf die Frage zu finden, ob unbewußte Wahrnehmungen einen nicht kontrollierbaren und damit manipulativen Effekt auf unsere Einstellungen ausüben können. Zusätzlich soll innerhalb dieser Diplomarbeit ergründet werden, inwieweit der Mechanismus der klassischen Konditionierung für den von Krosnick et al. berichteten Einstellungseffekt verantwortlich zu machen ist. Um diesen Fragen nachzugehen, wird ein neues Darbietungsmedium verwendet, welches bislang in diesem Forschungsbereich noch nicht zur Anwendung kam: Video.
Im ersten Kapitel dieser Diplomarbeit werden die Begriffe subliminale Wahrnehmung, klassische Konditionierung, Einstellung und Einstellungsbildung definiert und erläutert. Besondere Beachtung gebührt hier der Definition von Subliminalität, da unterschiedliche Auffassungen zur Reichweite und Bedeutung dieses Begriffs existieren. Das nachfolgende Kapitel befaßt sich näher mit den empirischen Befunden und der Theorienbildung zu den Phänomenen unbewußter Prozesse. In Kapitel 3 wird gesondert auf die Studie von Krosnick et al. (1992) eingegangen. Nach der Darstellung dieser Untersuchung folgt eine kritische Stellungnahme zu ihren Ergebnissen. Im 4. Kapitel wird die dieser Arbeit zugrunde liegende empirische Untersuchung vorgestellt. Das Konzept und die Ziele der Diplomarbeit werden erläutert. Bestandteil dieses Kapitels sind auch die Formulierung der Forschungshypothesen sowie eine Beschreibung des gesamten technischen Materials, welches in der Untersuchung Verwendung gefunden hat. Darauf folgt eine Schilderung des Vorversuchs und seiner Ergebnisse. Kapitel 6 beschreibt Design und Ablauf der Hauptuntersuchung. Hier wird auch auf Struktur und Umfang der erhobenen Stichprobe eingegangen und der verwendete Fragebogen erklärt. Anschließend werden die Ergebnisse der empirischen Arbeit ausführlich dargestellt. Im 8. Kapitel werden dann die vorliegenden Befunde diskutiert und - soweit möglich - in den Forschungsstand integriert. Abschließend folgt ein Ausblick auf die weitere Forschung und ihre Möglichkeiten.
1 Begriffsbestimmungen
Diese Arbeit soll mit einer Beschreibung der für sie relevanten Begriffe begonnen werden. Wenden wir uns zunächst der subliminalen Wahrnehmung zu. Die Fachwelt ist sich seit jeher uneins, was unter diesem Begriff zusammenzufassen ist und was nicht. So existiert eine Vielzahl sich widersprechender Definitionen (s. Perrig, Wippich & Perrig-Chiello, 1993). Die in dieser Studie angewandte Definition wird im folgenden Abschnitt erklärt und begründet. Nachfolgend soll auf den Mechanismus der klassischen Konditionierung und auf die noch immer bestehende Debatte über Kontingenzbewußtheit und Lernerfolg eingegangen werden. Das Kapitel schließt mit Beschreibungen zu den Begriffen der Einstellung und der Einstellungsbildung.
1.1 Subliminale Wahrnehmung
Der Begriff der subliminalen Wahrnehmung bringt eine Reihe von Problemen mit sich. Seitdem diese Bezeichnung geprägt wurde, ist sich die psychologische Forschungsgemeinschaft über die Existenz dieses Phänomens und über den Bedeutungsumfang des Begriffs uneinig (Perrig et al., 1993). Der Begriff ‘subliminal’ geht auf das Lateinische sub limen - was soviel bedeutet wie ‘unter der Schwelle’ - zurück. Es läßt sich heute allerdings nicht mehr rekonstruieren, wer den Begriff geprägt hat. Es waren wohl Pierce und Jastrow (1884, nach Kihlstrom, Barnhardt & Tataryn, 1992a), die das erste psychologische Experiment, das sich mit subliminaler Wahrnehmung beschäftigte, durchgeführt haben. Ziel des Experimentes war es, den von Fechner (1966, Erstausgabe 1860) geprägten psychophysikalischen Schwellenbegriff in Frage zu stellen. Fechner (1966, Erstausgabe 1860) ging davon aus, daß absolute Wahrnehmungsschwellen existieren. Unterhalb dieser experimentell feststellbaren Schwellen soll demnach bei allen Sinnen keine Wahrnehmungsleistung mehr möglich sein, da die physikalische Energie des Reizes nicht mehr ausreicht, um eine Sinnesempfindung hervorzurufen. Diese Schwellen sind subjektiver Natur, d.h. daß Menschen sich in ihren Wahrnehmungsschwellen unterscheiden können. Die individuelle absolute Schwelle einer Reizart läßt sich durch Reizentdeckungsaufgaben feststellen. Dabei wird die absolute Schwelle willkürlich als die Reizstärke operational definiert, bei welcher in der Hälfte der Fälle ein sensorisches Signal entdeckt wird.
Pierce und Jastrow (1884, nach Kihlstrom, Barnhardt & Tataryn, 1992a) initiierten nun ein Gewichtsdiskriminationsexperiment, welches die Forscher an sich selbst vornahmen. Die Aufgabe der beiden Probanden bestand darin, zwischen verschiedenen nah beieinander liegenden Gewichten zu unterscheiden und für jedes abgegebene Urteil die Sicherheit der Einschätzung auf einer Ratingskala anzugeben. Damit wurde also eine Unterschiedsschwelle bestimmt. Die Einschätzung des Gewichtes erfolgte nur anhand der beiden Urteile schwerer oder leichter. War nun der subjektiv empfundene Unterschied nicht mehr wahrnehmbar, so blieb den Probanden zum einen nur noch das Urteil 0 auf der Sicherheitsskala, welches für reines Raten stand, und zum anderen die erzwungene Entscheidung für eines der beiden Gewichtsurteile. Bei der Auswertung stellten Pierce und Jastrow (1884, nach Kihlstrom et al., 1992a) fest, daß ein großer Teil der vermeintlich geratenen Gewichtsurteile trotzdem richtig ausgefallen waren. Die subjektiv geratenen Einschätzungen des Gewichts waren weit über Zufallsniveau korrekt. Dies veranlaßte die Autoren, unbewußte Wahrnehmungen für diesen Effekt verantwortlich zu machen. Da die unbewußt wahrgenommenen Gewichtsunterschiede unterhalb der subjektiven Wahrnehmungsschwelle lagen, spricht man auch von unterschwelliger, eben subliminaler Wahrnehmung.
In der Folgezeit wurden nun zwei Wahrnehmungsschwellen postuliert: Eine Schwelle, die bewußt wahrnehmbare und unterschwellig wahrnehmbare Reize trennt - diese Schwelle wird im Folgenden auch als subjektive Wahrnehmungsschwelle bezeichnet - sowie eine Grenze, die unterschwellig wahrnehmbare von psychophysikalisch nicht erfassbaren Stimuli trennt (physikalische Wahrnehmungsschwelle)(Kihlstrom et al., 1992a). Zwischen physikalisch unmöglich wahrnehmbaren Reizen und bewußt wahrnehmbaren Reizen besteht demnach eine Art Fenster, in dem Reize wahrgenommen werden können, ohne daß dies dem Rezipienten bewußt wird. Die Begriffe unbewußt, unterschwellig und subliminal werden im Folgenden synonym verwandt. Subliminale Wahrnehmung läßt sich also folgendermaßen definieren:
Hat ein im Aufmerksamkeitsfokus dargebotener, aber subjektiv nicht wahrgenommener Stimulus Auswirkungen auf die Informationsverarbeitung und möglicherweise auf das Verhalten einer Person, läßt sich dieser Prozeß als subliminale Wahrnehmung auffassen, wenn die Reizintensität hierbei unterhalb der subjektiven Wahrnehmungsschwelle lag.
Diese Definition reserviert den Begriff subliminal ausschließlich für jene Reize, die in den Bereich zwischen subjektiver Wahrnehmungsschwelle und pyhsikalischer Wahrnehmungsschwelle fallen. Das Konzept der subliminalen Wahrnehmung wurde von vielen Seiten angefeindet. Die scheinbar kontraintuitive Verbindung des Begriffs der Wahrnehmung dem Terminus unbewußt stellt wohl das größte Problem dar. Ist doch gerade die Wahrnehmung in unserem Alltagsverständnis ein höchst bewußter Vorgang. Ja stellt Bewußtsein nicht gerade eine notwendige Bedingung für unsere Wahrnehmung dar (zum Begriff des Bewußtseins vgl. Graumann, 1966)? Die Forschungsarbeiten zur unterschwelligen Wahrnehmung scheinen dies zu verneinen. Dieses Paradoxon beschäftigt auch Kihlstrom et al. (1992a). Die Autoren halten den Begriff der Subliminalität für nicht haltbar, da er einen fragwürdigen Schwellenbegriff impliziert:
If the threshold is the point at which the observer cannot detect the presence of a stimulus ... at better than chance levels, then we have two candidate thresholds - one represented by observers’ phenomenal reports, the other represented by their guesses. If we accept the phenomenal reports as the standard for threshold setting , ..., then the guessing behavior gives evidence of „subliminal“ perception. But if we accept any discriminative behavior as the standard for threshold setting, ..., then evidence for „subliminal“ perception perforce disappears (S. 19-20).
Zusätzlich führen Kihlstrom und seine Mitarbeiter (1992a) an, daß ein Teil der Experimente, welche Subliminalität zu beweisen suchten, eindeutig mit Reizen arbeiteten, die über den subjektiven Reizschwellen der Probanden lagen und trotzdem nicht bewußt wahrgenommen wurden. Unbewußte Informationsverarbeitung kann also auch dann stattfinden, wenn Reize dargeboten werden, die nicht unterhalb der subjektiven Wahrnehmungsschwelle liegen. Mangelnde Aufmerksamkeit kann z.B. ebenso dazu führen, daß ein Reiz nicht bewußt wahrgenommen wird, obwohl er durchaus bewußt wahrnehmbar gewesen wäre, wenn er im Aufmerksamkeitsfokus des Rezipienten gelegen hätte. Demnach ist es nicht notwendig, unbewußte Wahrnehmungen auf den Bereich unterhalb der subjektiven Wahrnehmungsschwelle zu begrenzen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Holender (1986) in seiner Kritik an dem Konzept der unterschwelligen Wahrnehmung. Die Bezeichnung subliminale Wahrnehmung scheint also in die Irre zu führen. Aus diesem Grund schlagen Kihlstrom et al. (1992a), in Anlehnung an die Gedächtnisforschung, den Begriff der subliminalen Wahrnehmung durch den Terminus der impliziten Wahrnehmung zu ersetzen. Auch andere Forscher leisten ihren Beitrag zum Begriffskarussell bezüglich der unbewußten Wahrnehmung. So sprechen Murphy und Zajonc (1993) und auch Hammerl und Grabitz (1997) statt von subliminaler nur noch von suboptimaler Reizdarbietung. Merikle und Daneman (1998) verwenden nur noch die Bezeichnung unbewußte Wahrnehmung. Trotz unterschiedlicher Bezeichnungen meinen alle genannten Autoren dasselbe Phänomen:
Ein dargebotener, aber subjektiv nicht wahrgenommener Stimulus zeigt Auswirkungen auf die Informationsverarbeitung oder auf das Verhalten einer Person, ohne daß sich diese des Einflusses bewußt wird.
Diese Definition entspricht, abzüglich der anscheinend überflüssigen und wissenschaftlich fraglichen Annahme einer subjektiven und einer objektiven Wahrnehmungsschwelle, der bereits oben angeführten älteren Definition zur subliminalen Wahrnehmung. Die Dissoziation von berichtetem Erleben und beobachtetem Verhalten soll hier ausreichen, um Prozesse als unbewußt oder subliminal zu bezeichnen. In dieser Arbeit wollen wir also für das Phänomen unbewußter Wahrnehmungen trotzdem den Begriff der subliminalen Wahrnehmung beibehalten, ohne aber - wie noch zuvor - gleichzeitig von der Existenz einer subjektiven Wahrnehmungsschwelle auszugehen. Alle Stimuli, die nicht bewußt wahrgenommen wurden, ob sie nun unterhalb einer möglichen subjektiven Wahrnehmungsschwelle liegen, oder ob sie potentiell wahrnehmbar wären, werden demnach in dieser Arbeit als subliminal bezeichnet. Auch De Houwer, Hendrickx und Baeyens (1997) verwenden in ihrer Arbeit weiterhin den Terminus subliminal für extrem kurz dargebotene Stimuli. Diese Vorgehensweise scheint uns angebracht, um in der Tradition des Begriffes für nicht bewußte Prozesse zu bleiben. Viele Begriffe haben im Laufe der Zeit ihren Bedeutungsumfang verändert bzw. weiterentwickelt, ohne an Inhalt zu verlieren. Im Gegenteil - ein Begriff mit Geschichte geht wie eine gute Theorie gestärkt aus Bedeutungsänderungen hervor. Aus diesem Grund wollen wir an dem Begriff subliminal im Sinne von unbewußt, implizit oder suboptimal festhalten, ganz ohne Anführungszeichen (vgl. De Houwer et al., 1997) oder andere Einschränkungen.
Weiterhin scheint es uns wichtig, den hier verwendeten Begriff des Unbewußten von ähnlich lautenden Konzepten der Psychoanalyse abzugrenzen. Kihlstrom, Barnhardt und Tataryn (1992b) gelingt es, die unterschiedlichen Auffassungen von unbewußten Prozessen, welche die Psychoanalyse und die moderne kognitive Psychologie voneinander trennen, beispielhaft zu veranschaulichen:
The psychological unconscious documented by latter-day scientific psychology is quite different from what Sigmund Freud and his colleagues had in mind in fin de siecle vienna. Their unconscious was hot and wet; it seethed with lust and anger; it was hallucinatory, primitive, and irrational. The unconscious of contemporary psychology is kinder and gentler than that and more reality bound and rational, even if it is not entirely cold and dry (S. 788).
In Kapitel 2 werden wir uns noch eingehend mit unbewußten Prozessen beschäftigen. Hier sollen verschiedene Konzepte und Theorien sowie die Befunde ihrer empirischen Umsetzungen erläutert werden.
Eine gute Darstellung der terminologischen Probleme beim Begriff der subliminalen Wahrnehmung findet sich bei Franke (1967) und Brand (1976). Eine gute Übersicht über das gesamte Forschungsgebiet unbewußter Prozesse läßt sich in den Monographien von Bornstein und Pittman (1992) und Perrig et al. (1993) nachlesen.
1.2 Klassische Konditionierung
Beschäftigt man sich mit klassischer Konditionierung, stößt man unweigerlich auf den Namen Iwan Petrowich Pawlow (1849-1936). Der Vertreter der russischen Reflexologie setzte sich am Anfang seiner Karriere mit der Tätigkeit der Verdauungsdrüsen auseinander und widmete sich dann dem Studium des psychischen Einflusses auf die Magen und Speicheldrüsen. Die Entdeckungen, die er dort machte, ließen ihn zu einem der Väter der modernen Lernpsychologie werden. Die Erkenntnisse des Nobelpreisträgers zu den bedingten Reflexen haben auch nach über 100 Jahren nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Der Leser wird mit dem berühmten Pawlowschen Hund vertraut sein, so daß Pawlows Konditionierungsparadigma hier wohl keiner weiteren Erläuterung bedarf. Es soll daher auch nur eine kurze Einführung in die klassische Konditionierung gegeben werden.
Ein Ziel der vorliegenden Studie ist die Erforschung der Frage, ob die Effekte unbewußter Wahrnehmungen auf klassisches Konditionieren zurückzuführen sind. Wenden wir uns also direkt der Definition von klassischer Konditionierung zu, so wie dieser Begriff in dieser Arbeit im Weiteren verwendet werden soll:
Die klassische Konditionierung ist eine Form des Lernens, bei der der Organismus eine neue Assoziation zwischen zwei Reizen (Stimuli) lernt - einem neutralen und einem, der bereits eine Reflexreaktion auslöst. Als Ergebnis der Konditionierung löst der ehemals neutrale Reiz eine neue Reflexreaktion aus, die oftmals der ursprünglichen Reaktion ähnlich ist (Zimbardo, 1992, S. 230).
Eine abstraktere aber genauere Definition liefern Bredenkamp und Wippich (1977):
Die klassische Konditionierung ist eine experimentelle Prozedur, bei der ein neutraler Reiz (NS) und ein unkonditionierter Reiz (US), der die unkonditionierte Reaktion (UR) auslöst, sooft zusammen dargeboten werden, bis der neutrale Reiz allein eine der UR ähnliche Reaktion (konditionierte Reaktion: CR) auslöst; vor dem Experiment ist dies nicht der Fall gewesen. UR und CR sind meistens nicht identische Reaktionen; dieser Tatbestand wird aufgedeckt, wenn quantitative Merkmale der UR und CR, etwa ihre Latenzzeiten oder Amplituden, miteinander verglichen werden (S. 28; In der Originalarbeit wurden nur die in Klammern gesetzten Kürzel verwendet; die ausgeschriebenen Begriffe wurden vom Verfasser der besseren Verständlichkeit halber eingefügt).
Im letzten Zitat wird die klassische Konditionierung als „experimentelle Prozedur“ bezeichnet. Zugleich handelt es sich bei der klassischen Konditionierung um einen grundlegenden Lernmechanismus aller Organismen. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden nur noch die von Bredenkamp und Wippich (1977) verwendeten Kürzel (NS=neutraler Stimulus, CS=konditionierter Stimulus, US=unkonditionierter Stimulus, UR=unkonditionierte Reaktion, CR=konditionierte Reaktion) für die einzelnen Termini der klassischen Konditionierung verwendet.
Aus Pawlows Experimenten lassen sich einige empirische Beziehungen ableiten, welche als Grundbegriffe des Reiz-Reaktions-Lernens anzusehen sind (vgl. Pawlow, 1927, 1973):
Kontiguität von US und CS
Die Möglichkeiten, in denen US und CS räumlich und zeitlich zusammen auftreten können (Kontiguität), werden von Bredenkamp und Wippich (1977) in vier Konditionierungsarten unterteilt: 1. Simultane Konditionierung: CS und US beginnen und enden gleichzeitig. 2. Verzögerte Konditionierung: Der CS beginnt, der US setzt später ein, beide enden aber ungefähr gemeinsam. 3. Konditionierung eines Spurenreflexes: Der CS tritt separat auf, nach einiger Zeit folgt erst der allein auftretende US. 4 . Rückwirkende Konditionierung: Der US tritt auf und endet, unmittelbar danach folgt der CS.
Bekräftigung (reinforcement)
Der Erwerb einer bedingten Reaktion (CR) ist gekoppelt an das wiederholte gemeinsame Auftreten der beiden Reize US und CS. Die bedingte Reaktion wird um so stärker, je häufiger die Reize zusammen aufgetreten sind.
Löschung (extinction)
Bricht man die Bekräftigung ab, d.h. wird der CS mehrmalig ohne den US dargeboten, schwächt dies die assoziative Verbindung und damit auch die CR. Dieser Abbau kann zum vollständigen Verschwinden der CR führen.
Spontanerholung (spontaneous recovery)
Oftmals läßt sich nach der eigentlichen Löschung der bedingten Reaktion das plötzliche Wiederaufflammen der CR beobachten, ohne daß eine neuerliche Bekräftigungsphase stattgefunden hat; dieses Phänomen wird als Spontanerholung bezeichnet.
Generalisierung und Differenzierung
Zwei weitere Erscheinungen, welche Pawlow als zentralnervöse Erregungs- und Hemmungsprozesse beschreibt, sollen noch kurz Erwähnung finden. Ein konditionierter Reflex (CR) wird manchmal nicht nur von seinem ursprünglich auslösenden CS hervorgerufen, sondern auch andere zufällig auftretende Reize, die dem CS nicht einmal besonders ähnlich sein müssen, können zur Auslösung der CR führen. Dieser Vorgang wird als Generalisierung bezeichnet. Es existiert auch ein dem entgegengesetzter Prozeß, der als Differenzierung oder Diskrimination bezeichnet wird. Folgt auf zwei sehr ähnliche Reize nur auf einen der US, d.h. nur einer der Reize wird bekräftigt, so wird nach einigen Wiederholungen und anfänglichen Fluktuationen nur noch auf den bekräftigten Reiz mit einer CR reagiert.
Bedingte (konditionierte) Reaktionen höherer Ordnung
Löst ein CS1 nach mehrmaligem kontingentem Auftreten mit einem US eine CR aus, so kann durch gemeinsame Darbietung von CS1 mit einem anderen neutralen Reiz CS2 eine bedingte Reaktion zweiter Ordnung auf den CS2 ausgelöst werden, die der ersten CR ähnelt. So lassen sich ganze Ketten von einzelnen bedingten Reaktionen erzeugen. Diese bedingten Reaktionen höherer Ordnung sind wahrscheinlich beim Menschen häufiger anzutreffen, als bei Tieren (Edelmann, 1993).
Damit sind die wichtigsten Grundlagen für das Verstehen der klassischen Konditionierung beschrieben worden. Natürlich konnte in diesem Rahmen nur eine kurze und vereinfachende Darstellung geliefert werden; für einen ausführlichen Überblick empfiehlt sich die Lektüre von Hilgard und Bower (1975) oder Bredenkamp und Wippich (1977).
Kommen wir nun zu einer bislang unentschiedenen wissenschaftlichen Debatte, welche für diese Untersuchung von großer Bedeutung ist. Der Streitpunkt der Parteien besteht in der Annahme bzw. Ablehnung des Standpunktes, daß für eine erfolgreiche klassische Konditionierung die Einsicht des Lernenden in die Kontingenz der Reize erforderlich ist. D.h. entweder lernt man die Assoziation zweier Reize nur dann, wenn einem das gemeinsame Auftreten der Stimuli bewußt wird, oder man lernt diese Assoziation, obwohl einem die Kontiguität der Reize nicht bewußt wurde. Ging man in der Anfangszeit der Lernpsychologie noch davon aus, „daß es sich bei der klassischen Konditionierung um einen simplen, mechanistisch ablaufenden, reflexartigen Vorgang handele (Hammerl & Grabitz, 1993a, S. 199)“, so hat sich auch in der Konditionierungsliteratur nach der ‘kognitiven Wende’ das Bild geändert (vgl. Hammerl, 1991). Eine Reihe von Autoren bestätigten experimentell, daß eine erfolgreiche Konditionierung autonomer Reaktionen im Versuchslabor die Einsicht der Versuchspersonen in die vom Experimentator angelegten Stimuluskombinationen voraussetzt (vgl. z.B. Page, 1969; Dawson & Schell, 1987; Allen & Janiszewski, 1989). Dem gegenüber stehen aber Befunde aus dem Bereich des evaluativen Konditionierens. Dieser relativ neue Konditionierungsbegriff meint ein Paradigma zur Konditionierung von Einstellungen, Bewertungen oder Werthaltungen (Hammerl & Grabitz, 1993a). In Abschnitt 2.3 soll dieser Themenbereich eingehend behandelt werden. Als klassisches evaluatives Konditionierungsparadigma gilt das Experiment von Staats und Staats (1958). Die Forscher demonstrierten, daß nach der gemeinsamen Darbietung von Nationalitätsbezeichnungen (als NS) und valenzbesetzten Wörtern (als US) die ursprünglich neutralen Reize positiver bzw. negativer bewertet wurden (siehe auch Abschnitt 1.3). Dieser Effekt trat auf, obwohl den Versuchspersonen eine systematische Beziehung zwischen CS und US nicht aufgefallen war. In neuerer Zeit gibt es weitere Unterstützung für diese Befunde aus den 50er Jahren. In den Experimenten von Levey und Martin (1987), Baeyens, Eeln und van den Bergh (1990) und Hammerl und Grabitz (1993b), welche alle unter dem Etikett evaluatives Konditionieren laufen, wurden ohne die Einsicht der Probanden in die Kontiguität der Reize Lernerfolge erzielt. Hammerl und Grabitz (1993a) kommen angesichts dieser Ergebnisse zu dem Schluß:
Bei den Experimenten zur evaluativen Konditionierung zeigt sich wiederholt, daß die Einsicht in die Stimulus-Kontingenzen nicht schädlich ist, aber auf keinen Fall eine notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Konditionierung darstellt (S. 200).
Inwieweit sich klassisches und evaluatives Konditionieren voneinander unterscheiden, oder ob es sich um Phänomene gleicher Herkunft handelt, soll allerdings zu einem späteren Zeitpunkt besprochen werden (siehe Abschnitt 2.3).
Ein anderes Beispiel für Konditionierungserfolge ohne Kontingenzeinsicht stellen Experimente dar, die mit subliminalen Stimuli als US arbeiten. In den Studien von Paula Niedenthal (1990) und Krosnick et al. (1992) wurden die US so extrem kurz dargeboten, daß die Probanden die Stimuli nicht bewußt wahrnehmen konnten. Ohne bewußte Wahrnehmung der Reize kann aber per definitionem keine Einsicht in die Kontingenz der Reize entstehen. Trotzdem waren eindeutige Lernerfolge - in diesen Fällen als Einstellungsverschiebungen - nachweisbar. Beide Studien werden im weiteren Verlauf der Arbeit noch näher erläutert.
Einen guten Überblick über die Debatte zum unbewußten Lernen, auch über die klassische Konditionierung hinaus, erhält man bei Hammerl und Grabitz (1993a). Auch die Lektüre der Hoffman-Markowitsch-Debatte in der Psychologischen Rundschau gibt detaillierte Einblicke in den Forschungsstand (Hoffmann, 1993a, 1993b, 1994; Markowitsch, 1993; weitere Kommentare: Hammerl und Grabitz, 1994; Kleine-Horst, 1994).
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung könnten einen Einfluß auf die Debatte um notwendiges oder überflüssiges Kontingenzbewußtsein beim klassischen Konditionieren ausüben. Bestätigen die Befunde die aufgestellten Forschungshypothesen, so wäre eine klassische Konditionierung auch ohne Bewußtsein und damit auch notwendigerweise ohne Einsicht in die Kontingenz erfolgreich gewesen. Damit würde die Ansicht gestützt, daß Bewußtheit der Kontingenz keine notwendige Voraussetzung für erfolgreiches klassisches Konditionieren darstellt.
1.3 Einstellung und Einstellungsbildung
In der Sozialpsychologie existieren zahlreiche unterschiedliche Definitionen zum Einstellungsbegriff. Die Vielfalt der Definitionen läßt sich grob in zwei Gruppen unterteilen. Zum einen wurden Dreikomponentenmodelle entworfen, welche den affektiven, den kognitiven und den konativen Anteil einer Einstellung unterscheiden (z.B. Rosenberg & Hovland, 1960; Eagly & Chaiken, 1993). Einen anderen Weg beschreiten eindimensionale Definitionen. Sie gehen davon aus, daß die affektive Komponente der „einzig relevante Indikator für die bewertende Natur der Einstellung“ (Stahlberg & Frey, 1997, S. 221) ist (z.B. Allport, 1935; Fishbein & Ajzen, 1975; Petty &Cacioppo, 1981, 1986). Als Beispiel für einen Ansatz mit drei Komponenten sei die Definition von Eagly und Chaiken (1993) genannt:
Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor ... Evaluating refers to all classes of evaluative responding, whether overt or covert, cognitive, affective or behavioral (S. 1).
Die eindimensionale Sicht des Einstellungsbegriffs sei durch die Definitionen von Allport (1935) und Petty und Cacioppo (1981) illustriert:
Attitudes are individual mental processes which determine both the actual and potential responses of each person in a social world. Since an attitude is always directed toward some object it may be defined as „a state of mind of the individual toward a value (Allport, 1935, S. 6).
Attitude is a „degree of affect“ for an object or a value (Allport, 1935, S. 10).
The term attitude should be used to refer to a general, enduring positive or negative feeling about some person, object or issue (Petty & Cacioppo, 1981, S. 7).
Die Ansätze, die nur den affektiven Anteil als Ausdruck der Einstellung für bedeutsam halten, unterscheiden zwischen Einstellung (engl. attitude) und Meinung (engl. belief). Der Begriff der Meinung umfaßt alle nicht bewertenden Informationen, die eine Person über ein Objekt in ihrem Gedächtnis gespeichert hat. Einstellungen hingegen repräsentieren den Affekt, der beim realen oder mentalen Kontakt mit einem Einstellungsobjekt hervorgerufen wird (Stahlberg & Frey, 1997).
Empirische Befunde stützen sowohl das Dreikomponentenmodell als auch das eindimensionale Modell der Einstellung, und eine Entscheidung im Streit der konkurrierenden Ansätze ist bislang nicht absehbar. Die Dimensionalität einer Einstellung scheint aber vom Einstellungsobjekt selbst abzuhängen: Komplexe Meinungen mit intensivem Kontakt zum Objekt bedingen mehrdimensionale Einstellungen, simple Meinungsmuster mit geringem Kontakt konvergieren mit eindimensionalen - affektiven - Bewertungen. Darüber hinaus spielen auch noch die einstellungsbildende Person, ihre kognitive Komplexität und ihre Ambiguitätstoleranz eine Rolle (vgl. Klauer, 1991; Stahlberg & Frey, 1997).
Klauer (1991) stellt aufgrund der Ergebnisse seiner Doktorarbeit ein eigenes Modell des Bewertungsprozesses vor:
Zentrale Annahme des Modells ist, daß sowohl Bewertungen als auch relevante Detailinformationen abgerufen werden, daß aber beide Informationsarten für die Urteilsfindung unterschiedliche Funktionen einnehmen. Die Bewertungen des Zielobjekts und der Zieldimension werden auf Konsistenz geprüft und führen damit zu einem affektiven „Vorurteil“, das, formal gesehen, die Rolle einer A-Priori-Hypothese einnimmt. Die relevante, gedächtnismäßig verfügbare Detailinformation wird, ... , gegen die A-Priori-Hypothese abgewogen. Anders gewendet wird die A-Priori-Hypothese anhand der verfügbaren Detailinformationen geprüft und gegebenenfalls korrigiert oder beibehalten. Es resultiert eine A-Posteriori-Hypothese, in der affektive Einflüsse über die A-Priori-Hypothese indirekt eingehen. Das Urteil erfolgt aufgrund der A-Posteriori-Hypothese (S. 102).
Zusätzlich wird in dem Modell angenommen, daß affektive Informationen salienter sind als kognitive, so daß Affekte schneller abgerufen werden können, als dies bei kognitiven Daten der Fall ist (Klauer, 1991). Zajonc (1980) bestätigt experimentell, daß affektive Daten eher abgerufen werden als kognitive Informationen. Der Abruf affektiver Informationen erfolgt nach Shiffrin und Schneider (1977) sogar automatisch. Bei Klauer (1991) ergeben sich Hinweise auf eine automatische Extraktion affektiver Konsistenz, welche spontan und unausweichlich erfolgt. Dieser automatisch aktivierte Prozeß entwickelte sich unabhängig von deskriptiven Informationen, was nach dem Autor auf zwei unabhängige Systeme hindeutet, eines für die Verarbeitung affektiver Informationen und eines für semantische Datenverarbeitung. Dieses Zwei-Prozeß-Modell vereint also den vorgeschalteten, automatisch ablaufenden, evaluativen und affektiven Prozeß mit einem nachfolgenden, kontrollierenden, kognitiven Prozeß. Klauer (1991) kommt zu dem Schluß, daß die Annahme eines Zusammenhangs zwischen kognitiven und affektiven Komponenten einer Einstellung überflüssig wird, da die Annahme, daß kognitive Urteile von affektiven Verzerrungen überlagert werden, ausreiche.
Doch wie kommen Menschen zu ihren Einstellungen? Wie erwirbt man die affektive Haltung gegenüber einem Einstellungsobjekt? Auch hierzu liegt eine Vielzahl von Theorien vor. Es werden verschiedene Prozesse angenommen, die zum Aufbau einer Einstellung führen. Allerdings herrscht ein Konsens darüber, daß Einstellungen in unterschiedlicher Weise erlernbar sind (Stroebe & Jonas, 1997). Da die klassische Konditionierung von Einstellungen im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, wollen wir uns auf diesen Prozeß der Einstellungsbildung konzentrieren. Von Staats und Staats (1958) stammt das wohl bekannteste Experiment zur klassischen Konditionierung von Einstellungen. Wie im vorigen Abschnitt bereits berichtet, präsentierten die Forscher visuell verschiedene Nationalitätsbezeichnungen als NS. Gleichzeitig erfolgte die akustische Darbietung von positiven oder negativen Worten als US. Den Probanden wurde mitgeteilt, daß man herausfinden wolle, ob die Versuchspersonen in der Lage seien, akustische und visuelle Reize getrennt zu erlernen. In der einen Gruppe wurde die Bezeichnung Niederländisch mit positiv bewerteten, in der anderen wurde die Bezeichnung Schwedisch mit negativ bewerteten Wörtern zusammen dargeboten. Als die Probanden später diese Bezeichnungen in Semantischen Differentialen zu bewerten hatten, wurde Niederländisch positiver bewertet als Schwedisch. Die Probanden hatten die positiven oder negativen Affekte, welche durch die Wörter ausgelöst wurden, mit den Nationalitätsbezeichnungen verknüpft. So wurde eine Assoziation von Affekt und CS im Gedächtnis etabliert. In weiteren Experimenten wurde die klassische Konditionierbarkeit von Einstellungen ebenfalls nachgewiesen (z.B. Berkowitz & Knurek, 1969; Zanna, Kiesler & Pilkonis, 1970; Kuykendall & Keating, 1990).
Doch die Befunde dieser Experimente wurden auch angezweifelt. Die Kritik an diesen Studien steht im engen Zusammenhang mit der Debatte zur Notwendigkeit des Kontingenzbewußtseins, welche im vorangegangenen Abschnitt angeschnitten wurde. Die Argumentation, warum klassische Konditionierung keine Wirkung auf Einstellungen haben dürfe, ist die gleiche. Besonders die Studie von Staats und Staats (1958) wird von Page (1969) angegriffen. Er wirft den Autoren vor, daß die Versuchspersonen die Kontingenz und damit den Zusammenhang der Reize durchschaut hätten und so durch demand characteristics lediglich die Antworten gegeben hätten, die man von ihnen erwartet hatte. Page (1969) replizierte die Studie von Staats und Staats (1958) und erhob zusätzlich in einem Fragebogen, inwieweit die Probanden das Ziel der Untersuchung durchschauten und so in Richtung der Erwartungen der Forscher antworteten. Er kam zu dem Ergebnis, daß die beobachteten Konditionierungseffekte allein durch demand characteristics erklärbar seien. Die Ergebnisse der Studie von Berkowitz und Knurek (1969) sowie der bereits angeführten Arbeiten von Niedenthal (1990) und Krosnick et al. (1992) lassen sich aber kaum auf demand characteristics zurückführen (s.o). Die Mehrheit der bisherigen Ergebnisse spricht zwar für die klassische Konditionierbarkeit von Einstellungen, es wurden aber bislang auch ebenso viele methodische Mängel aufgedeckt. Wir werden uns noch einmal in Kapitel 3 bei der ausführlichen Besprechung der Experimente von Krosnick et al. (1992) eingehend diesem Problem widmen.
Ziel dieser Arbeit ist es, bei den teilnehmenden Versuchspersonen durch ein klassisches Konditionierungs-Paradigma Einstellungen zu etablieren, welche ohne die experimentelle Manipulation nicht in dieser Art aufgetreten wären. Da - wie in der Studie von Krosnick et al. (1992) - mit nicht bewußt wahrnehmbaren US gearbeitet wird, sollte auch hier die Kritik von Page (1969) wirkungslos bleiben. Fallen die Ergebnisse in der vorhergesagten Weise aus, so wäre ein weiterer Beweis für die klassische Konditionierbarkeit von Einstellungen erbracht.
Gute Einblicke in den Bereich der Einstellungsforschung geben die einschlägigen Kapitel der sozialpsychologischen Lehrbücher von Wyer und Srull (1994), Tesser (1995) und Stroebe, Hewstone und Stephenson (1997).
2 Unbewußte Prozesse: Empirische Befunde und Theorien
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung möglicher Einflüsse von unbewußten visuellen Wahrnehmungen auf die soziale Einstellungsbildung. Dieses Kapitel beschäftigt sich in erster Linie mit der Frage, ob unbewußte Wahrnehmungsprozesse existieren und wie sie sich nachweisen lassen. Darüber hinaus ist natürlich von besonderem Interesse, wie nichtbewußte Wahrnehmungsphänomene zu erklären sind, d.h. welche grundlegenden und bekannten psychologischen Mechanismen für diese Erscheinungen verantwortlich zu machen sind. Wie bereits in Abschnitt 1.1 bemerkt, geht die verbreitete Verwendung des Begriffs des Unbewußten in der kognitiven Psychologie heutiger Zeit keineswegs mit einheitlichen Vorstellungen oder Definitionen zu diesem Phänomen einher. Das folgende Kapitel soll einen Einblick in die unterschiedlichen Standpunkte in diesem Forschungsbereich geben.
In dieser Arbeit soll auf die Darstellung sogenannter impliziter Gedächtnisprozesse verzichtet werden, obwohl sicher einige Berührungs- und Schnittpunkte vorhanden wären. Eine halbwegs verständliche Bezugnahme zu dieser umfangreichen Teildisziplin ist in diesem engen Rahmen aber leider nicht möglich. Die Monographie von Graf und Masson (1993) gibt eine gute Einsicht in den Bereich der impliziten Gedächtnisforschung.
2.1 Historie
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts stellten Sigmund Freud und William James unabhängig voneinander die Existenz unbewußter Informationsverarbeitungsprozesse fest (Perrig et al., 1993). Freud kam nach Beobachtungen an psychisch Kranken zu dem Schluß, daß unbewußte seelische Prozesse unsere Erinnerungen oder unsere bewußten Handlungen beeinflussen. Das Unterbewußte Freuds stellt eine Instanz dar, welche sich aus verdrängten Erinnerungen und Vorstellungen aus der Kindheit zusammensetzt. Die Annahmen von William James zur unbewußten Informationsverarbeitung unterscheiden sich von denen Freuds. James geht von zwei unterscheidbaren Gedächtnisprozessen aus. Er postuliert ein primäres (bewußtes) und ein sekundäres (unbewußtes) Gedächtnis. Auf das primäre System haben wir unmittelbaren Zugriff; hier können Daten mühelos abgerufen werden. Das sekundäre System hingegen erlaubt uns den Zugriff auf die dort abgelegten Daten nicht oder nur unter erschwerten und mühevollen Bedingungen (Perrig et al., 1993).
Perrig et al. (1993) erkennen drei Hauptströmungen, die sich mit der Erforschung unbewußter Prozesse auseinandergesetzt haben:
1.) Studien, die durch Freud oder James initiiert oder beeinflußt wurden, dienten dem Nachweis nicht bewußter Vorgänge, die unser Verhalten beeinflussen sollen. Als Indikator für unbewußte Wahrnehmung galt das Raten oberhalb des Zufallsniveaus.
2.) Die Behavioristen der dreißiger Jahre versuchten sich an dem Nachweis, daß das Bewußtsein und damit auch notwendigerweise unbewußte Prozesse überflüssige Konzepte seien. Sie beschäftigten sich hauptsächlich mit unbewußtem Lernen. Mit der kognitiven Wende verloren sich diese Ansätze.
3.) Nun treten kognitionspsychologische Studien in den Vordergrund. Unbewußtes Denken und Handeln werden zum Gegenstand der Forschung. In unterschiedlichen Paradigmen hält die Forschungslust am Unbewußten bis heute an.
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts wollen wir zwei der frühen Untersuchungen und eine ihrer Folgeuntersuchungen aus dem Bereich unbewußter Prozesse vorstellen. In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werden dann weitere Studien, welche in den letzten 50 Jahren unternommen wurden, beschrieben.
Zu den frühesten Studien über unbewußte Wahrnehmungsprozesse gehört die in Abschnitt 1.1 ausführlich beschriebene Arbeit von Pierce und Jastrow (1884, nach Kihlstrom et al., 1992a). Die Ergebnisse dieser Studie blieben aber vor allem in heutiger Zeit nicht unkritisiert. Merikle und Reingold (1992) weisen darauf hin, daß die subjektive Beurteilung, ob geraten wurde oder nicht, nicht ausreicht, um tatsächlich empirisch sicherzustellen, ob echtes Raten ohne jede Beteiligung bewußter Prozesse vorliegt. Die subjektive Einschätzung des eigenen Rateverhaltens ist also nicht exhausiv und somit kein zulässiger Indikator für unbewußte Prozesse. Kihlstrom et al. (1992a) bemerken noch zusätzlich, daß Antworttendenzen der Probanden, nämlich die Absicht unbewußte Prozesse nachzuweisen, die Ergebnisse beeinflußt haben können, da es sich um einen Selbstversuch von Pierce und Jastrow handelte.
Ein weiteres interessantes Phänomen wird von Poetzl (1917, nach Perrig et al. 1993) berichtet: Er beobachtete, daß z. B. bei Patienten mit Läsionen im visuellen Kortex unbewußt wahrgenommene Reize nach einiger Zeit wieder im Gedächtnis auftauchten (Erst sehr viel später wurde dieser Effekt, der als blindes Sehen bezeichnet wird, eingehend von Weiskrantz, Warrington, Sanders und Marshall (1974) untersucht). Dieses - von ihm mehrfach beobachtete - Phänomen nannte er law of exclusion. Er versuchte, diese Erscheinungen auch bei normalen Versuchspersonen experimentell nachzuweisen. Hierzu wurde 24 Probanden ein Farbfoto der Tempelruinen von Theben für 10 ms dargeboten. Im Anschluß an die Darbietung wurden die Versuchspersonen befragt, was sie gesehen haben. Außerdem wurden sie aufgefordert, alle Träume der folgenden Nächte aufzuzeichnen. Hierbei zeigte sich nun, daß in den Träumen Bildfragmente auftauchten, welche in der Befragung nach der Darbietung nicht genannt worden waren. Diese Erscheinung wurde später als Poetzl-Effekt bezeichnet. Poetzl erklärte diesen Effekt mit der begrenzten Kapazität unserer Wahrnehmung und der nahezu unbegrenzten Fähigkeiten zur Assimilation und assoziativen Speicherung, welche sich aber dem Bewußtsein entziehen. Von der Wahrnehmung werden aktiv solche Objekte ausgeschlossen, welche für die Psyche des Rezipienten eine Bedrohung darstellen. Dieses Konzept läßt sich auch als perzeptuelle Abwehr (s.u.) oder psychogene Blindheit auffassen (Perrig et al., 1993).
Der Poetzl-Effekt wurde mehrfach repliziert. In Folgeuntersuchungen ging es in erster Linie um die Frage, ob der Effekt subjekt- oder stimulusdeterminiert ist. Subjektdeterminiertheit meint in diesem Zusammenhang, daß selektive Informationsverarbeitungsprozesse des Wahrnehmenden den Effekt verursachen (perzeptuelle Abwehr). Von Stimulusdeterminiertheit spricht man, wenn der Reiz im physikalischen Sinne zu schnell oder zu kurz dargeboten wurde, um bis in das Bewußtsein vorzudringen (Perrig et al. 1993). Laut Dixon (1981) läßt sich aus den vorliegenden Untersuchungen schließen, daß der Effekt subjektabhängig ist und nicht durch die Art der Stimulusdarbietung determiniert wird.
In einer Studie von Shevrin und Fisher (1967) wurden Probanden kurz vor dem Schlafengehen Bilderrätsel oder ein Leerbild für 6 ms präsentiert. Die Versuchspersonen wurden dann direkt nach REM- und nach Non-REM-Phasen geweckt und aufgefordert, eventuelle Trauminhalte zu berichten und anschließend frei zu assoziieren. Es zeigte sich zwar kein Effekt bei den Trauminhalten, aber dafür unterschieden sich die Assoziationen nach den verschiedenen Schlafphasen. Nach den REM-Phasen erfolgten signifikant mehr phonetische Assoziationen zum gesamten Bilderrätsel; nach Non-REM-Phasen zeigten sich dagegen mehr prozeßhaft konzeptuelle Assoziationen zu einzelnen Bestandteilen des dargestellten Bilderrätsels. Die Autoren sehen in den Ergebnissen ihrer Arbeit eine Bestätigung des Poetzl-Effekts, da eine weitere Verarbeitung nicht bewußt wahrnehmbarer Informationen im Schlaf nachgewiesen wurde. Perrig et al. (1993) bemerken zum Poetzl-Effekt, daß zwar einzelne Arbeiten aus diesem Bereich sicherlich zu kritisieren sind, daß viele Ergebnisse „in ihrer Stimmigkeit aber beeindruckend und in hohem Maße suggestiv“ (S.184) ausfallen.
2.2 Unbewußte Konditionierungsphänomene
Der Forschungsgegenstand des unbewußten Konditionierens läßt sich in mehrere Gruppen unterteilen. Es sollen im Folgenden einige exemplarische Untersuchungsbeispiele aus den Bereichen klassischer und instrumenteller Konditionierung sowie des Begriffslernens gegeben werden. Eine gesonderte Behandlung erfahren die Untersuchungen zur Subception-Hypothese. Sie werden am Ende des Abschnitts vorgestellt.
Eine ausführliche Darstellung zu diesem Thema des unbewußten Lernens findet sich bei Koeppler (1972) oder als etwas aktuellere Übersicht bei Perrig et al. (1993).
Unbewußte klassische Konditionierung
Die von den Behavioristen vertretene Auffassung, daß die Konditionierung von autonomen Reaktionen als Beweis für unbewußtes Lernen tauge, basiert auf einer Gleichstellung der Begriffe bewußt mit willkürlich und absichtlich sowie unbewußt mit unwillkürlich und absichtslos. Diese Gleichstellung ist aber nicht unproblematisch, da es in einigen Experimenten gelang, unwillkürliche Reaktionen unter willkürliche Kontrolle zu bringen. Unwillkürliche motorische Reaktionen sind durchaus bewußt erfahrbar und beschreibbar. Außerdem scheint nicht jede Reaktion auf bewußt erfahrene Reize tatsächlich auch willkürlicher Natur zu sein (Perrig et al., 1993).
Die Frage nach der Notwendigkeit des Kontingenzbewußtseins beim Lernen wurde bereits in Abschnitt 1.2 diskutiert. Perrig et al. (1993) berichten eine Reihe von relativ alten Experimenten, in denen versucht wurde, nonverbale Reaktionen durch subliminale Stimuli zu beeinflussen. Die Ergebnisse der von ihm beschriebenen Studien fallen sehr unterschiedlich aus. In einigen Untersuchungen gelang die Konditionierung autonomer Reaktionen (Pupillenreflex, psychogalvanische Hautreaktion, Speichelreaktion) mit großem Erfolg, in anderen Studien blieben die Versuche, subliminale Reize und autonome Reaktionen zu assoziieren, ohne jedes Ergebnis. Diese Resultate tragen zu einer Entscheidung der Debatte daher nur wenig bei (Perrig et al., 1993). Ein anderer Hinweis auf die Wirksamkeit unbewußter klassischer Konditionierung stammt von Roll und Smith (1972). Ihnen gelang es, narkotisierten Ratten eine Aversion gegen einen bestimmten Geschmack anzukonditionieren. Da hier durch die Narkose jegliche bewußte Wahrnehmung ausgeschaltet wurde, ist das Ergebnis nur durch unbewußte Lernprozesse zu erklären. Eine Wiederholung der Geschmacksaversions-Konditionierung bei narkotisierten Ratten gelang Garcia (1991). Die Studien, welche sich mit unbewußtem klassischen Konditionieren auseinandersetzen, sind insgesamt nicht gerade zahlreich zu nennen. Jedoch gerade in neuerer Zeit liefern einige Untersuchungen zum Konzept des evaluativen Konditionierens, auf die wir im folgenden Abschnitt eingehen werden, weitere Beweise für die Existenz unbewußter klassischer Konditionierungsprozesse.
Unbewußte instrumentelle Konditionierung
Die hier beschriebenen Studien arbeiten nicht mit subliminalen Stimuli, sondern hier werden US und CS bewußt wahrnehmbar dargeboten. Einzig die Beziehung zwischen den Stimuli soll von den Probanden unbemerkt bleiben. Thorndike (1932) geht davon aus, daß verbales Lernen ohne Einsicht möglich ist. Er beschreibt Experimente, in denen Versuchspersonen Lernerfolge zeigten, obwohl sie keine Einsicht in das Verstärkerprinzip zeigten. In einem Experiment von Thorndike und Rock (1934) belohnte oder bestrafte der Versuchsleiter bestimmte Verhaltensweisen der Versuchspersonen. Die Probanden wurden nach Wortdarbietungen aufgefordert, Assoziationen zu bilden; dabei wurden gewünschte Assoziationen mit der Bemerkung richtig belohnt, unerwünschte mit falsch bestraft. Die verstärkten Kopplungen wurden im Gegensatz zu den nicht verstärkten graduell ansteigend wiederholt. Die so entstandenen Lernkurven der Probanden zeigten ebenfalls ein graduelles Ansteigen der Lernleistung. D.h. den Versuchspersonen gelang es zunehmend besser, die gewünschten Assoziationen zu produzieren. Thorndike und Rock (1934) werteten dies als Hinweis auf unbewußtes Lernen, da Einsicht in den Verstärkungsplan zu einem unmittelbaren Anstieg der Lernkurven geführt hätte. Dieser Sprung in den Kurven war aber nicht beobachtet worden. Später konnte allerdings nachgewiesen werden, daß in einem Teil der Untersuchungen mit diesem Paradigma auch nach der Einweihung der Versuchspersonen in die zugrunde gelegten Beziehungen kein direkter Anstieg der Lernkurve zu verzeichnen war. Der Faktor Aufgabenschwierigkeit scheint allerdings einen ebenso großen Einfluß wie die Einsicht auf das plötzliche Ansteigen der Lernkurve zu haben (Perrig et al., 1993).
In einer metaanalytischen Studie von Krasner (1958) werden 31 Untersuchungen bewertet, welche sich mit der Verstärkung bestimmter verbaler Äußerungen ohne Wissen der Probanden beschäftigen. Er kommt zu dem Schluß, daß die Mehrzahl der Probanden keine Einsicht in den Verstärkungsplan besessen hat. Obwohl also die Probanden nicht angeben konnten, welche Antworten verstärkt wurden, lernten sie dennoch, die belohnten verbalen Äußerungen zu bevorzugen. Den Studien wurde allerdings vorgeworfen, daß unzureichende Explorationstechniken und ungeeignete Kriterien zur Erfassung der Einsicht der Probanden für die Ergebnisse verantwortlich sein könnten. In Folgeexperimenten, in denen diese Kritik berücksichtigt wurde, waren nahezu alle Probanden in der Lage, innerhalb kurzer Zeit die Beziehung von Äußerung und Verstärkung zu durchschauen, so daß die Lernkurve überhaupt erst dann anstieg, wenn die Probanden Einsicht bekundeten (Perrig et al., 1993). Die Experimente zum unbewußten instrumentellen Konditionieren tragen also auch nur wenig zur Entscheidung bei, ob unbewußt gelernt werden kann. Für Perrig und seine Mitarbeiter (1993) ist klar,
daß beim instrumentellen Konditionieren ähnlich wie beim klassischen Konditionieren die Annahme eines unbewußten Lernens sehr kontrovers diskutiert werden kann und somit unzureichend fundiert ist (S. 64).
Unbewußte Begriffsbildung
Die Begriffsbildung wird in der Denkpsychologie zu den höheren Lernarten gezählt. Eine Beeinflussung durch unbewußte Prozesse scheint hier viel weniger vorstellbar als bei den bereits beschriebenen Konditionierungsarten. Dennoch wurde eine Reihe von Experimenten durchgeführt, um dem Problem der unbewußten Begriffsbildung nachzugehen. Bereits Hull (1920) geht davon aus, daß Begriffe ohne Einsicht gebildet werden können; diese Art von Begriffen nannte er intuitive Begriffe. Ein überzeugendes Experiment stammt von Rommetveit (1960). Er ließ Schüler als Versuchspersonen an einer Art Glücksradspiel teilnehmen. Erschien im Radausschnitt eine ‘gute’ Figur, wurde der Proband mit 7 Öre belohnt, bei ‘schlechten’ Figuren verlor er hingegen den zuvor gemachten Einsatz von 2 Öre. Die Figuren unterschieden sich nur wenig voneinander. Bei der einen Hälfte der Versuchspersonen wurden rundere Formen verstärkt, bei der anderen die eckigeren Figuren. Nach einer bestimmten Anzahl an Durchgängen mußten die Versuchspersonen die zuletzt im Radausschnitt gezeigte Figur aus einem Set von vorgegebenen Figuren nach mehreren Ähnlichkeitskriterien (ähnlichste, zweitähnlichste, usw.) heraussuchen. Konnte diese Aufgabe von der Versuchsperson gelöst werden, wurde das Spiel unterbrochen, und die Versuchsperson wurde aufgefordert, mit eigenen Worten gute und schlechte Figuren zu beschreiben, zu zeichnen und Karten, auf denen diese Figuren abgebildet waren, zu gruppieren. Das überraschende Ergebnis der Untersuchung war, daß die Schüler bereits überzufällig häufig zwischen guten und schlechten Figuren unterscheiden konnten, noch bevor sie die relevanten Merkmale der Figuren erfaßt hatten. Rommetveit schloß daraus, daß die Versuchspersonen einen funktionalen Begriff erworben hatten, bevor sie die der Kategorisierung zugrundeliegenden Merkmale erkannten. Dieses Experiment wird von Koeppler (1972) dahingehend kritisiert, daß Einsicht in die geometrischen Unterschiede überhaupt nicht nötig sei, um Unterscheidungen zu treffen. Ein eindeutiger Nachweis unbewußter Begriffsbildung konnte auch in anderen Experimenten bislang nicht erbracht werden (Koeppler, 1972; Perrig et al., 1993).
Die Subception-Hypothese
Der Begriff Subception geht auf McCleary und Lazarus (1949) zurück. Er bezeichnet einen Vorgang, bei dem Probanden Unterscheidungsleistungen erbringen, ohne jedoch eine rationale Begründung für diese Leistung angeben zu können. In diesem Fall sollen nicht-verbale Reaktionen, wie z.B. die psychogalvanische Hautreaktion, bessere Indikatoren für gewisse Informationsverarbeitungsprozesse darstellen als die verbale Aussage der Versuchsperson.
Differenziert die nicht-verbale Reaktion besser, als es der Zufallserwartung entspricht, während die verbale Antwort falsch ist, wird von Subception gesprochen“ (Perrig et al., 1993, S. 68).
Es besteht also auch hier die klassische Dissoziation zwischen berichtetem Erleben der Probanden und beobachtetem Verhalten. Ein Experiment von Lazarus und McCleary (1951) soll zur Verbildlichung des Phänomens beitragen. In einer Aquisitionsphase wurden 10 sinnlose Silben gleichhäufig für 1 s dargeboten. Die eine Hälfte der Silben wurde mit leichten Elektroschocks gekoppelt, die andere Hälfte blieb ohne Konsequenzen für die Probanden. Diese Prozedur wurde so lange durchgeführt, bis die geschockten Silben stabil eine höhere psychogalvanische Hautreaktion auslösten als die nicht geschockten Silben. Die eine Hälfte der Silben wurde also aversiv klassisch konditioniert. In der Testphase wurden die Silben mit fünf verschieden Darbietungszeiten ohne Schocks präsentiert. Die Expositionszeiten wurden so variiert, daß bei kürzester Darbietungsdauer die Silben nicht erkannt wurden und bei der längsten Präsentation nahezu alle Silben identifiziert werden konnten. Das Hauptresultat bestand darin, daß die Schocksilben signifikant höhere psychogalvanische Hautreaktionen auslösten als die Non-Schocksilben, ohne daß die Probanden angeben konnten, welche Art von Silbe präsentiert worden war. Es liegt also scheinbar eine unbewußte Entscheidungsbasis zugrunde, welche sich der bewußten Wahrnehmung entzieht. Die Erklärung dieser Phänomene steht im engen Zusammenhang mit dem Konzept des perceptual defense (Bruner & Postman, 1947). Hiernach bestehen für unangenehme Objekte höhere Erfassungsschwellen als für neutrale Gegenstände. Zwei konkurrierende Ansätze streiten um die Erklärung des Subception-Phänomens: Das Zwei-Prozeß-Modell (Lazarus & McCleary, 1951) geht davon aus, daß ein kritischer Reiz, der noch nicht bewußt wahrgenommen wurde, durch einen subliminalen Wahrnehmungsprozeß erfaßt wird, der dann einen Abwehrvorgang auslöst. Der Abwehrmechanismus äußert sich dann in einer Erhöhung der bewußten Erfassungsschwelle für den kritischen Stimulus. Auf der anderen Seite steht ein Ein-Prozeß-Modell (Eriksen, 1956), welches nur von einem einzigen Wahrnehmungsprozeß ausgeht. Hier wird auf den Anteil unbewußter Wahrnehmungen verzichtet. Es wird davon ausgegangen, daß ein Teil der kritischen Informationen ins Bewußtsein gelangt und daß dort erst die Reaktionen darauf beeinflußt werden. Die Studien zum Ein-Prozeß-Modell werden auch unter dem Stichwort partielle Informationshypothese geführt. Laut Perrig et al. (1993) unterstützen die Mehrzahl der Folgeuntersuchungen das Ein-Prozeß-Modell. Die Ergebnisse von Spence und Holland (1962) lassen sich aber nicht mit der partiellen Informationshypothese erklären. Die Autoren überprüften, ob die Reaktionen der Versuchspersonen durch die Bedeutung oder durch Fragmente der Struktur eines Wortes determiniert werden. Sie präsentierten daher einer Versuchsgruppe das Wort cheese so kurz, daß es von einem blank stimulus (weißes Feld) nicht zu unterscheiden war. Einer weiteren Gruppe wurde das Wort supraliminal dargeboten. Die Kontrollgruppe saß mit dem Rücken zur Projektionsfläche, sie bekam also überhaupt kein Wort präsentiert. Anschließend wurde allen Versuchspersonen eine Wortliste vorgelesen, welche Worte mit unterschiedlich starker Assoziationsstärke zum Zielwort und Worte mit ähnlicher oder verschiedener graphemischer Struktur beinhaltete. Die Probanden sollten sich diese Worte einprägen und später niederschreiben. Die Ergebnisse von Spence und Holland widersprechen klar dem Ein-Prozeß-Modell: Die subliminale Gruppe erinnerte signifikant mehr Käse-Assoziationen als Kontrollwörter. In den beiden anderen Gruppen fehlte dieser Unterschied. Offenbar wurde nur die Bedeutung des Zielwortes subliminal wahrgenommen. Die Hypothese, daß die Wortbedeutung und nicht die Wortstruktur entscheidend für das Wiedererinnern ist, wurde also bestätigt. Nach der partiellen Informationshypothese hätte die subliminale Gruppe mehr graphemisch ähnliche Worte wiedererinnern müssen, dies war aber nicht der Fall. Die Autoren sehen diese Resultate auch als Bestätigung der Annahme Freuds, daß bewußte und unbewußte Denkprozesse qualitativ verschieden sind.
Die Forschung muß sich augenscheinlich mit sehr widersprüchlichen Ergebnissen zum unbewußten Lernen auseinandersetzen. Es gelang anscheinend bis heute weder der eindeutige Beweis noch die eindeutige Widerlegung unbewußter Lernprozesse.
2.3 Unbewußte Evaluationsprozesse
In diesem Abschnitt wollen wir uns auf das recht umfangreiche Forschungsgebiet unbewußter Evaluationsprozesse konzentrieren. Hierzu müssen die Befunde verschiedener Teildisziplinen der Psychologie zusammengetragen und in ein einheitliches Vokabular überführt werden. Unbewußte Evaluationsprozesse sollen dabei als affektive Bewertungsprozesse im Sinne von präferierenden oder hedonistischen Urteilen (angenehm-unangenehm, gut-schlecht) verstanden werden. Es werden die experimentellen Anordnungen der evaluativen Konditionierung, des unbewußten affektiven Primings, der bloßen Darbietung (mere-exposure) und der automatischen Evaluation dargestellt. Am Ende dieses Abschnitts soll noch kurz die möglichen Funktionen der Phänomene eingegangen werden.
Weiterführende Informationen erhält der interessierte Leser in den Übersichten von Bargh (1994) und Hammerl und Grabitz (1997).
Evaluative Konditionierung
Obwohl das bereits in Abschnitt 1.3 beschriebene Experiment von Staats und Staats (1958) heute als das erste evaluative Konditionierungsexperiment angesehen wird (Hammerl & Grabitz, 1993a), lassen sich die ersten Experimente, welche explizit in das Gebiet der evaluativen Konditionierung fallen, nur 10-12 Jahre zurückdatieren.
In diesem also relativ neuen Forschungsbereich lassen sich zwei unterschiedliche Auffassungen zur Verwendung des Begriffs der evaluativen Konditionierung unterscheiden: Hammerl und Grabitz (1993a) verstehen darunter die „Konditionierung von Einstellungen, Bewertungen oder Werthaltungen“ (S.200). Gemeint ist damit ein Paradigma, in dem
[...]
- Arbeit zitieren
- Dr. rer. nat. Boris Quednow (Autor:in), 1999, Subliminale Wahrnehmung und Einstellungsbildung: Sind Einstellungen subliminal klassisch konditionierbar?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5849
Kostenlos Autor werden



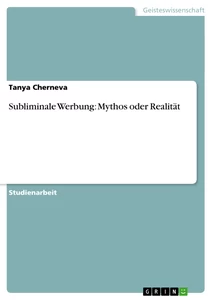



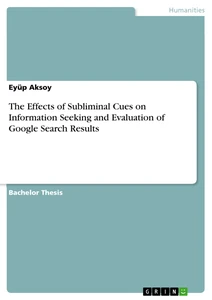












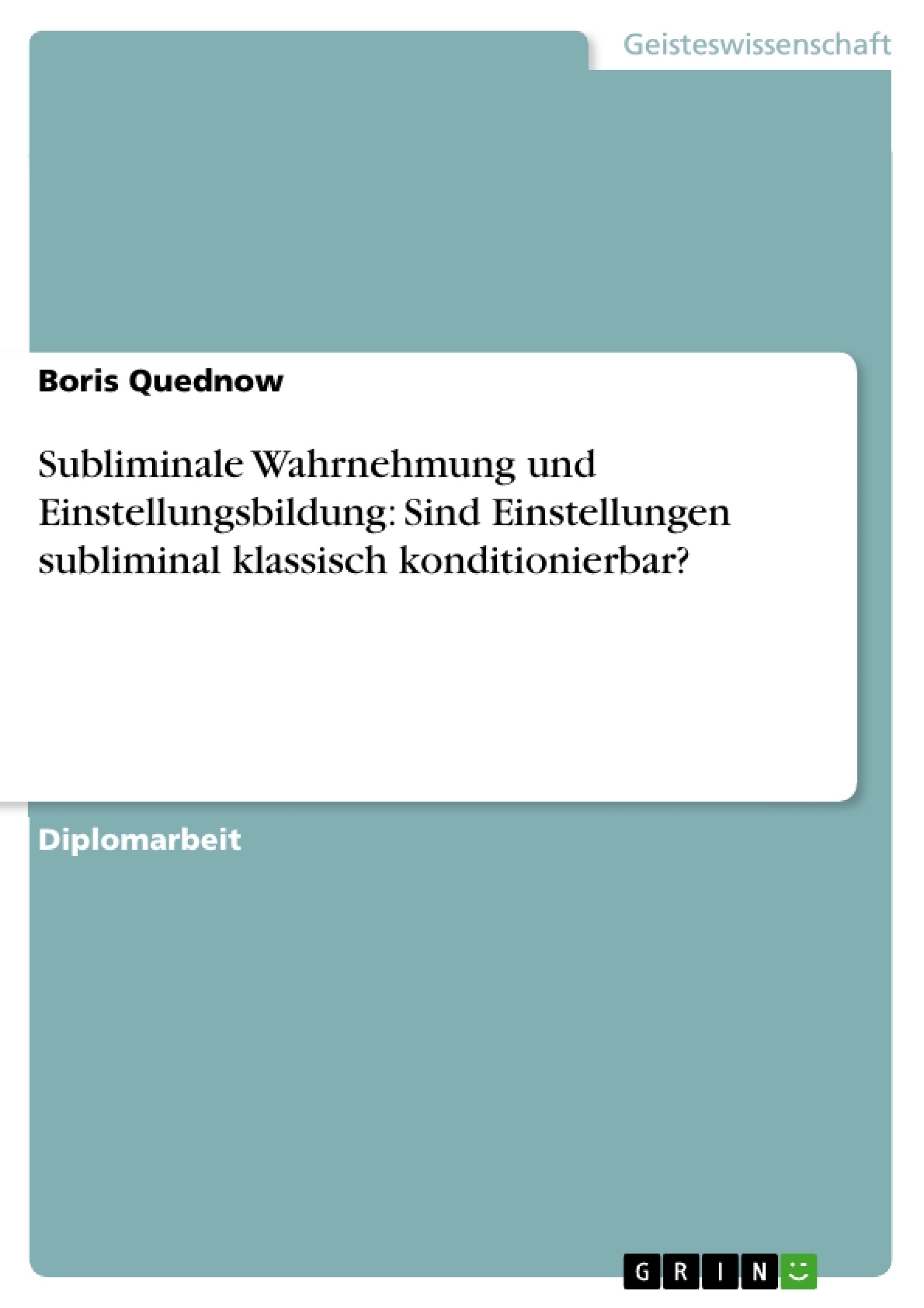

Kommentare