Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2.Interkulturelle Kommunikation
2.1. Entwicklung des symbolisch-interpretativen Kulturbegriffs
2.1.1. Kulturwissenschaften als interdisziplinäres Feld
2.1.2. Das Kulturverständnis dieser Arbeit
2.2. Perspektiven zur Kommunikation
2.2.1. Von der mechanistischen zur symbolisch-interpretativen Perspektive
2.2.2. Das Kommunikationsverständnis dieser Arbeit
2.3. Interkulturelle Kommunikation
2.3.1. Entwicklung der interkulturellen Kommunikationsforschung
2.3.2. Abgrenzung des Forschungsfeldes
2.3.2.1. Interkulturelle Kommunikation
2.3.2.2. Cross-Cultural Communication
2.3.2.3. International/Comparative Mass Communication
2.3.3. Zur Besonderheit interkultureller Kommunikation
2.3.3.1. Interkulturalität zwischen sozialen Gruppen
2.3.3.2. Zum fließenden Übergang zwischen Intra- und Interkulturalität
2.3.3.3. Die Problematik interkultureller Kommunikation
2.3.4.Ein Organisationsmodell interkultureller Kommunikation
2.4. Zwischenfazit
3. Der kommunikative Kontext im internationalen Unternehmen
3.1. Exkurs: Interpersonale Kommunikation im Unternehmen
3.2. Der Einfluss von Nationalkultur auf Unternehmenskultur
3.2.1. Nationalkulturelle Wertedimensionen
3.2.2. Unternehmenskultur
3.2.3. Deutsche und spanische Unternehmenskulturtypen
3.2.3.1. Spanische Unternehmen als Familien-Kultur
3.2.3.2. Deutsche Unternehmen als Eiffelturm-Kultur
3.3. Zwischenfazit
4. Reibungsfelder und Chancen der Fremdverständigung
4.1. Empirischer Forschungsstand
4.2. Probleme interkultureller Kommunikation
4.2.1. Stereotype
4.2.2. Ethnozentrismus
4.2.3. Sprache
4.2.4. Kommunikativer Stil
4.2.5. Nonverbale Kommunikation
4.3. Anpassung während des beruflichen Auslandsaufenthalts
4.3.1. Kulturschock
4.3.2. Akkulturation
4.3.3. Stressbewältigung als Funktion des Akkulturationsprozesses
4.3.4. Akkulturationsstrategien
4.4. Interkulturelle Kompetenz
4.4.1. Dimensionen interkultureller Kompetenz
4.4.2. Affektive Strukturdimension
4.4.3. Kognitive Strukturdimension
4.4.4. Konative Strukturdimension
4.5. Interkultur als Ausgestaltung organisierten Kulturkontakts
4.6. Zwischenfazit und Implikationen für die empirische Untersuchung
5. Methodik
5.1. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
5.1.1. Die Probanden
5.1.2. Die Aufenthaltsdauer der Probanden
5.1.3. Die Notwendigkeit der spanischen Perspektive
5.2. Forschungsinteresse und forschungsleitende Fragen
5.3. Methodisches Design
5.3.1. Teil1: Critical Incident Technique
5.3.2. Teil 2: Problemzentrierte Fragen mit explorativem Charakter
5.3.3. Zum Problem qualitativer Methodik
5.4. Operationalisierung des Leitfadens
5.5. Pretest
6. Befragung deutscher Sojourners in Spanien
6.1. Auswahl der Interviewpartner
6.2. Vorgehensweise bei der Datenerhebung
6.3. Datenaufbereitung und Auswertungsverfahren
7. Auswertung der Interviews
7.1. Problemerkennungszusammenhang
7.1.1. Kulturspezifische Probleme
7.1.2. Kulturuniverselle Probleme
7.1.2.1. Kulturuniverselle Probleme in Gruppe A
7.1.2.2. Kulturuniverselle Probleme in Gruppe B
7.1.2.3. Kulturuniverselle Probleme im Gruppenvergleich
7.2. Lösungszusammenhang
7.2.1. Interkulturelle Kompetenzen in Gruppe A
7.2.2. Interkulturelle Kompetenzen in Gruppe B
7.2.3. Lösungszusammenhang im Gruppenvergleich
7.3. Akkulturationsstrategien
7.3.1. Einzelanalysen
7.3.2. Akkulturationsstrategien und Aufenthaltsdauer
7.3.3. Akkulturationsstrategie und interkulturelle Kompetenz
7.3.4. Moderierende Kontextfaktoren der Akkulturation
7.4. Interkultur
7.4.1. Interkultur in Gruppe A
7.4.2. Interkultur in Gruppe B
7.5. Integrationsunterstützende Maßnahmen durch die Unternehmen
7.6. Zusammenfassung der Ergebnisse
8. Abschließende Diskussion
8.1. Theoretische Implikationen
8.2. Forschungspragmatische Konsequenzen
8.3. Anregungen für die Praxis
8.4. Schlusswort
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Übersicht digitaler Anhang
Literaturverzeichnis
Material Interviews
1. Einleitung
Die fortschreitende Internationalisierung der Wirtschaft bedingt, dass Menschen vermehrt in globalen Zusammenhängen arbeiten und viele zumindest einen Abschnitt ihres Arbeitslebens im Ausland verbringen. Sie agieren dort an einer direkten Schnittstelle zwischen ihrer Heimatkultur und der Kultur des Gastlandes. Im ergebnis- und leistungsorientierten Wirtschaftskontext treten Unterschiede zwischen Nationalkulturen besonders deutlich zu Tage. Oft wird jedoch angenommen, dass Menschen verschiedener Länder konvergente Verhaltensweisen und ähnliche Vorstellungen von Werten, Normen und Regeln entwickeln, wenn sie für dasselbe Unternehmen arbeiten. Ihr kultureller Hintergrund – sei er nationaler, religiöser oder ethnischer Natur – findet dabei auf strategischer Ebene wenig Beachtung. Dies führt oftmals zu beträchtlichen Problemen, die der optimalen Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Wege stehen. Die Erkenntnis, dass interkulturell kompetentes Handeln bei Mitarbeitern gefördert werden sollte, setzt sich leider nur unzureichend im internationalen Management durch (vgl. Bergemann/Bergemann 2004: 35). Dort dominieren weiterhin Funktionsbereiche wie Strategisches Management, Finanzen und Controlling, die mit dem diffusen – und noch schlechter messbaren - Konzept der Interkulturalität wenig anfangen können (vgl. Meyer 2004: 121). Meist stehen hier organisatorische, technologische und strukturelle Fragen im Mittelpunkt. Kultur spielt nur dort eine Rolle, wo es um eine strategische Anpassung an lokale Märkte und Kunden verschiedener Kulturen geht.
Diverse Studien haben hingegen gezeigt, dass eine kultursensitive Betrachtungsweise des unternehmensinternen Kontextes durchaus ihre Berechtigung hat, da Arbeitnehmer und Führungskräfte ihren kulturellen Hintergrund mit zum Arbeitsplatz bringen (vgl. Adler 2002: 67f.). Im Bereich der unternehmensinternen, interkulturellen Kommunikation können diverse kommunikative Störungen und Fehlperzeptionen auftreten, die einen erfolgreichen Dialog erschweren, zu gravierenden Missverständnissen führen und die Effizienz sinken lassen. Dabei begegnen im Ausland arbeitende, kulturfremde Mitarbeiter[1] Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und im sozialen Bereich:
„Dazu gehören Kulturschock, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz mit den Standards einer andersartigen Umwelt, Isolation, Heimweh, Unterschiede im Gesundheitswesen, Schule, Küche, Sprache, Bräuche, Rollenerwartungen, Lebenshaltungskosten etc.“ (Deller 2003: 284)
Die Herausforderungen eines Auslandseinsatzes sind so groß, dass nach Schätzungen ca. 20-50% der weltweit entsandten Expatriates frühzeitig ihren Auslandsaufenthalt abbrechen (vgl. Ward 2001: 184). Je geringer die kulturelle Distanz zum Zielland ist, desto mehr werden Aspekte der interkulturellen Vorbereitung und Begleitung vernachlässigt. Während Expatriates auf eine Entsendung in kulturferne Länder wie Indien, China und Japan gründlich vorbereitet werden, werden entsprechende Maßnahmen bei einer Entsendung im europäischen Raum nicht als notwendig erachtet. Es wird davon ausgegangen, dass die kulturellen Unterschiede so gering sind, dass Sprachtrainings für eine Vorbereitung genügen. (Vgl. Kumbruck & Derboven 2005: 26) In vielen Fällen sehen sich kulturfremde Mitarbeiter jedoch auch innerhalb Europas mit dem ‚Sprung ins kalte Wasser“ konfrontiert und müssen sich mit den vorgefundenen Bedingungen teils unter großen Schwierigkeiten und ohne nennenswerte Unterstützung arrangieren.
An dieser Stelle setzt das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit an, das den Sojourner als Person in den Mittelpunkt rückt und ergründen möchte, mit welchen Problemen er in einem ausländischen Arbeitsumfeld konfrontiert wird. Im Rahmen einer Auswahl der beteiligten Länder wurde als Herkunftsland Deutschland ausgewählt, da ein Beitrag zu dem hier noch lückenhaften empirischen Forschungsstand geleistet werden soll. Als Zielland wurde aus folgenden Gründen Spanien gewählt: 1) Es existiert eine rege wirtschaftliche Kooperation zwischen Deutschland und Spanien, die in den letzten Jahren ein stabiles Wachstum verzeichnete (vgl. CCAPE 2004: 7). 2) Die wirtschaftliche Kraft Spaniens nimmt stetig zu und hat das Land mittlerweile zu einem wichtigen, strategischen Handelspartner Deutschlands gemacht. 3) Spanien gehört dem europäischen, homogenisierten Wirtschaftsraum an. Dort werden (außer dem Baskischen) indogermanische Sprachen gesprochen und die Bevölkerung ist überwiegend christlich (katholisch). Trotz dieser Ähnlichkeiten zu Deutschland weist Spanien andersartige national- und unternehmenskulturelle Charakteristika auf (vgl. Trompenaars 1993, Lewis 2000). 3) Es gibt zahlreiche Studien, die zu diesem Thema Länder wie England oder Frankreich (vgl. Helmolt 1994, Fischer 1996) untersucht haben. Zu Spanien hingegen sind keine vergleichbaren Studien bekannt.
In der vorliegenden Arbeit soll ergründet werden, wie in Spanien tätige Deutsche ihr Kommunikationsverhalten in interkulturellen Interaktionssituationen einschätzen und wie sich ihre Anpassung an das Aufnahmeland gestaltet. Auf welche Missverständnisse und kommunikativen Probleme stoßen sie anfänglich und wie gehen sie damit um? In welche kulturell bedingten Fallen tappen sie im alltäglichen Umgang mit ihren spanischen Kollegen? Wie gestaltet sich ihr Lernprozess, damit sie innerhalb ihrer multikulturellen Arbeitsgruppen angemessener und effektiver handeln und kommunizieren können? Entscheiden ihre interkulturellen Kompetenzen darüber, ob sie sich im neuen soziokulturellen Umfeld eingliedern oder absondern? Diese Arbeit will überprüfen, ob sich die Erkenntnisse der Fachliteratur zu den Zusammenhängen zwischen interkultureller Kompetenz und Anpassungsverhalten auf diese spezifische Konstellation übertragen lassen. Ferner soll explorativ das Bewusstsein der untersuchten Unternehmen für diese Problematik ergründet werden. Welche Maßnahmen werden zur Integrationsunterstützung angeboten und wo besteht noch Nachholbedarf in der Auslandspersonalarbeit?
Der theoretische Teil dieser Arbeit gliedert sich in drei Bereiche, die jeweils unterschiedliche Bereiche der interkulturellen Thematik beleuchten. Zunächst erfolgt in Kap. 2 eine Gegenstandsbestimmung des Begriffs der interkulturellen Kommunikation. In Kap. 3 wird dann auf den Kontext der Untersuchung eingegangen. Hier werden nationalkulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Spaniern ebenso behandelt wie der unternehmenskulturelle Hintergrund, vor dem berufliche Kommunikation stattfindet. Kap. 4 beschäftigt sich mit dem zentralen Interesse dieser Arbeit. Hier werden Themen wie interkulturelle Probleme, kulturelle Anpassung und interkulturelle Kompetenz systematisch aufgearbeitet, die das theoretische Handwerkszeug der nachfolgenden empirischen Untersuchung bilden. Im empirischen Teil werden zunächst die Merkmale der Untersuchung dargestellt. Dies beinhaltet die Beschreibung und Diskussion des gewählten Forschungsdesigns (Kap. 5) wie auch der Untersuchungsgruppe (Kap. 6). Im Anschluss werden dann die Ergebnisse der Interviewanalyse vorgestellt (Kap. 7) und zu den theoretischen Erkenntnissen in Beziehung gesetzt (Kap.8).
Schließlich sei angemerkt, dass aus Gründen der Einfachheit und der besseren Lesbarkeit in dieser Arbeit die männliche Schreibform gewählt wurde, welche die weibliche selbstverständlich mit einschließt.
2.Interkulturelle Kommunikation
In diesem Kapitel wird der Begriff der interkulturellen Kommunikation erläutert. Um sich diesem diffusen Konzept anzunähern, empfiehlt es sich, den Begriff in seine Bestandteile zu zerlegen. Zunächst soll dem wissenschaftlichen Kulturverständnis nachgegangen und seine theoretische Entwicklung nachvollzogen werden, um ein grundlegendes Kulturverständnis für diese Arbeit zu definieren (vgl. Kap. 2.1.). Im nächsten Schritt werden verschiedene theoretische Perspektiven zur Funktionsweise von Kommunikation dargestellt und deren Anwendung in dieser Arbeit diskutiert (vgl. 2.2.). Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird dann der Sonderfall der interkulturellen Kommunikation eingehend betrachtet.
2.1. Entwicklung des symbolisch-interpretativen Kulturbegriffs
Der Begriff ‚Kultur“ kommt vom lateinischen colere = bebauen, bestellen, pflegen (vgl. Alvesson/Berg 1992: 76) und meint prinzipiell die Art und Weise, wie Menschen gemeinsam ihr Leben unter religiösen, pädagogischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Gesichtspunkten gestalten (vgl. Maletzke 1996: 15). Es waren dann auch die Römer, die zum ersten Mal von cultura animi, der Kultivierung der Seele sprachen (vgl. Fornäs 1995: 135). Der Begriff wird im 17. Jahrhundert wieder aufgegriffen, wo die ‚Kultur“ der ‚Natur“ gegenüber gestellt wird (vgl. Ort 2003: 19). Nach diesem Verständnis gilt es, mit der ‚Kultur“ die ‚Natur“ zu bearbeiten und zu zähmen. Der Philosoph Immanuel Kant bindet den Kulturbegriff an die ‚Bildung“ und grenzt ihn so vom französisch-aristokratischen Verständnis der ‚Zivilisation“ ab. Damit legt die Aufklärung den Grundstein für das enge, ästhetische Kulturkonzept des deutschen Idealismus (vgl. ebd.: 21), wie es auch vom deutschen Bildungsbürgertum ab dem 18. Jahrhundert gebraucht wird (vgl. Fornäs 1995: 135). Zur Kultur gehören demnach nur besonders wertvolle, der Hoch- oder Elitekultur angehörige Produkte. Diese Definition von Kultur beeinflusst heutzutage staatliche Kulturreglements, Einrichtungen wie den Kulturjournalismus und künstlerische Disziplinen (vgl. ebd.). Zu kritisieren ist an diesem Verständnis, dass es zu eng greift, sich zu sehr an existenten Kunstformen orientiert und die Populärkultur sowie andere kulturelle Praktiken unberücksichtigt lässt (vgl. Maletzke 1996: 15f.).
Das moderne Kulturverständnis hat seine Wurzeln in der Kulturanthropologie, die sich als erste wissenschaftliche Disziplin mit dem Kulturbegriff als Objektbereich befasst (vgl. Fleischer 2001: 23). Sie wird von Franz Boas in den 1920er Jahren begründet, der sie von der biologischen und physischen Anthropologie abgrenzt (vgl. Bachmann-Medick 2003: 87). Es geht ihm darum, fremdkulturelle Zusammenhänge zu verstehen anstatt anthropologische Universalerkenntnisse über das Menschsein festzuhalten. Durch teilnehmende Beobachtung im Feld kann kulturelle Praxis jetzt in ihrem Kontext gesehen werden (vgl. ebd.), was zum Kulturrelativismus[2] führt und durch die Sapir-Whorf-These[3] empirisch untermauert wird. Der Kulturrelativismus widerspricht sich allerdings selbst, da seine Grundthese Allgemeingültigkeit in Anspruch nimmt, was nach seinen eigenen Regeln nicht zulässig ist (vgl. Müller 1998: 41). Trotzdem legt er den Grundstein für einen „kritischen Umgang mit Urteilsbildungen über ‚andere’“ (ebd.) und wirft ein neues, kritisches Licht auf Kolonialismus und ethnische Diskriminierung (vgl. ebd.).
In den 1950er Jahren wird das ethnographische Kulturkonzept der Kulturanthropologie systematisch von Kroeber und Kluckhohn (1952) ausgearbeitet (vgl. Bachmann-Medick 2003: 88). Sie untersuchen und kategorisieren 164 Kulturdefinitionen und kommen dabei zu folgendem Schluss:
„Kultur besteht aus – expliziten und impliziten – Mustern von und für Verhalten, erworben und übermittelt durch Symbole; sie bilden die unterscheidenden Leistungen menschlicher Gruppen, einschließlich deren Verkörperung in Artefakten; der wesentliche Kern von Kultur besteht aus traditionellen (das heißt historisch gewonnenen und ausgewählten) Ideen und besonders den ihnen beigelegten Werten; Kultursysteme können einerseits als Ergebnis von Handeln, andererseits als konditionierende Elemente ferneren Handelns betrachtet werden.“ (Kroeber/Kluckhohn 1952: 181; zit. n. Fleischer 2001: 24f.)
Die Analyse von Kulturbegriffen bei Kroeber und Kluckhohn zeigt auf, dass viele der untersuchten Definitionen charakteristische Merkmale des modernen Kulturbegriffs anführen. Dieser vereint ergologische (ergon, griechisch = Werk), soziative (soziale, verbindende, integrative) und temporal-historische Konzepte (vgl. Straub/Thomas 2003: 36) und geht davon aus, dass Kultur symbolische Realität besitzt (vgl. Mauritz 1996: 17). Somit rücken nicht-messbare Muster, Normen und Standards in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses, das vormals durch die Untersuchung von sichtbaren Kulturartefakten und Verhaltensweisen geprägt war (vgl. Fornäs 1995: 136).
Da sich die klassische Kulturanthropologie v.a. mit der Erforschung von Stammesgesellschaften bzw. Face-to-face -Gesellschaften beschäftigte, neigte sie lange dazu, eine soziale Gemeinschaft als Kultur an sich zu verstehen. Daran knüpft sich die Vorstellung, eine Kultur sei eine abgrenzbare und homogene Einheit. Dies muss jedoch bezweifelt werden, wie insbesondere der fortschreitende Globalisierungsprozess zeigt: Er hat zahlreiche Überschneidungen herbeigeführt, aus denen kulturellen Mischformen[4], ethnischen Wechselwirkungen (vgl. Bachmann-Medick 2003: 88, 95) und „transnationalen Diasporen“ (Brandstetter et. al. 2004: 86) entstanden sind.
Ein erweitertes Kulturverständnis muss diesen Vermischungsprozessen Rechnung tragen und ist insbesondere dann bedeutungsvoll, wenn man sich der Kulturvielfalt einer modernen Großgesellschaft zuwendet. Zwei Erkenntnisse sind hierbei besonders hervorzuheben:
1. Verschiedene soziale Schichten, Organisationen, Institutionen etc. – kurz: Gesellschaftliche Teilsysteme oder Teilkollektive – haben unterschiedliche kulturelle Ausprägungen, die berücksichtigt werden müssen. Teilgruppen einer Gesellschaft verfügen demnach über eigene Subkulturen, die ihre eigenen subkulturspezifischen Merkmale aufweisen, sich aber gleichzeitig in die übergeordnete Gesamtkultur integrieren. Eine Person gehört dabei mehreren Subkulturen gleichzeitig an, je nachdem, welche gesellschaftlichen Rollen sie innehat. (Vgl. Maletzke 1996: 17)
2. Die sozialen und kulturellen Merkmale einer Gesellschaft müssen getrennt voneinander gesehen werden. Nach Geertz (1973) handelt es sich bei Kultur um ein „geordnetes Bedeutungs- und Symbolsystem“, in dessen Rahmen soziale Interaktion stattfindet. (Vgl. Fornäs 1995: 136). Diese Unterscheidung wird bei Parsons wie folgt beschrieben
„The social-system focus is on the conditions involved in the interaction of actual human individuals who constitute concrete collectivities with determinate membership. The cultural-system focus, on the other hand, is on ‘patterns’ of meaning, e.g., of values, of norms, organized knowledge and beliefs, of expressive ‚form’“ (Parsons 1965: 34)
Kultur besitzt daher eine zentrale Orientierungsfunktion für soziales Handeln. Dieses Verständnis fußt auf einem semiotischen Kulturkonzept, das Kultur als „selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe“ begreift. Die kultursemiotisch angelegte, interpretative Kulturanthropologie strebt die Interpretation von Symbolen[5] in ihrem spezifischen kulturellen Rahmen an, um daraus latente Bedeutungsstrukturen zu erschließen (vgl. Behrendt/Kirrstetter 2002). Diese Bedeutungsstrukturen bilden ein historisch überliefertes System, mit dessen Hilfe „Menschen ihre Erfahrungen interpretieren können und sich bei ihren Handlungen leiten lassen“ (Mauritz 1996: 16).
Der in der klassischen Kulturanthropologie auf Ethnien und ihre Charakteristika begrenzte Kulturbegriff musste also erweitert werden, um den vielfältigen, sinnstiftenden Strömungen moderner Gesellschaften gerecht zu werden. Bei der Erweiterung des ethnischen Kulturverständnisses sind die Cultural Studies federführend, die „Kultur auf Kollektive jeder Art“ (Hansen 2000: 238) beziehen. Sie beschäftigen sich insbesondere mit sozialen, religiösen und regionalen Kollektiven und betrachten auch Generations- oder Geschlechtergruppen (vgl. ebd.: 237).
2.1.1. Kulturwissenschaften als interdisziplinäres Feld
Neben der Kulturanthropologie haben sich viele andere Wissenschaftsbereiche diesem Thema zugewandt. Die Erforschung von Kultur ist sei geraumer Zeit zu einem der zentralen Gegenstände in den Humanwissenschaften avanciert (vgl. Wierzbicka 1997: 1). Sie wird von einem fruchtbaren, interdisziplinären Diskurs genährt, der sich u.a. über die Cultural Studies, Soziologie und Kommunikationswissenschaften, kulturvergleichende Psychologie und Linguistik, sowie Wirtschafts- und Rechtswissenschaften erstreckt (vgl. Hansen 2000: 362). An dieser Stelle soll lediglich stichwortartig auf die Disziplinen eingegangen werden, die für diese Arbeit relevant sind.
Die interkulturelle Kommunikationswissenschaft verbindet den Kulturbegriff der Anthropologie mit psychologischen Theorieansätzen, um Face-to-face -Kommunikation und massenmediale Kommunikation zwischen Menschen verschiedener Kulturen zu untersuchen. In den USA ist Intercultural Communication seit Mitte der 80er Jahre als eigene Wissenschaft etabliert (vgl. Kap. 2.3.1.), die einen Großteil der theoretischen Ansätze zu diesem Thema generiert hat. (Vgl. Latorre 2004: 32, Schreiber 1990: 13ff.)
Die kulturvergleichende Psychologie hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf Basis anderer psychologischer Disziplinen wie bspw. der Sozialpsychologie oder Persönlichkeitspsychologie und ihrer Subdisziplinen wie der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie Grundlagenforschung zu betreiben, spezielle Fragen herauszugreifen und sie „in einer neuartigen, für ihr Anliegen charakteristischen Weise zu beantworten“ (Straub/Thomas 2003: 32). Sie bringt psychische Differenzen mit kulturellen Unterschieden in Zusammenhang: Dabei gilt Kultur als integraler Bestandteil psychischer Strukturen, Funktionen und Prozesse und nicht als externer, determinierender Faktor. Kultur und Psyche bedingen sich gegenseitig und somit ist jedes Verhalten zwangsläufig kultureller Prägung (vgl. ebd.: 52). Mittels komparativer – also ländervergleichender – Forschung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Erleben, Denken, Fühlen, Wollen, Verhalten und Handeln von Menschen aus verschiedenen Kulturen untersucht (vgl. ebd.: 32).
In der Linguistik wird der Frage nachgegangen, welchen kulturellen Einfluss die Symbolwelt der Sprache auf soziale Gemeinschaften hat. Es wird angenommen, „[that] there is a very close link between the life of a society and the lexicon of the language spoken by it“ (Wierzbicka 1997: 1). Diese Disziplin geht davon aus, dass durch Wörter Bedeutungen übermittelt werden, die an den kulturellen Hintergrund des Sprechers gebunden sind. Deshalb sind Bedeutungssysteme spezifisch für eine bestimmte Kultur und geben Aufschluss über ihre Symbolwelt. (Vgl. Müller-Jacquier 1991: 42)
Die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich erst seit Ende der 50er Jahre mit Kultur und spalten sich bei ihrer Betrachtung in eine (traditionalistische) naturwissenschaftliche und eine (neue) geisteswissenschaftliche Fraktion auf. Die geisteswissenschaftliche Richtung nimmt Abstand vom Objektivitätsideal dieser Disziplin:
„Mit dieser Einbeziehung der Kultur in die Betriebswirtschaftslehre entsteht ein deutlicher Paradigmenwechsel, der die Betriebswirtschaftslehre aus ihrer reduktionistischen, quasi naturwissenschaftlichen Orientierung herausholt, um sie statt dessen einzubinden in die Komplexität, Vielfalt und auch in das Konfliktpotential unterschiedlicher Kultursysteme.“ (Meissner 1997: 11)
Dabei nutzen die Wirtschaftswissenschaften den Kulturgegenstand, um neue Erkenntnisse in den Bereichen Human Resources, internationales Marketing und interkulturelles Management zu erlangen Es geht ihnen dabei einerseits darum, den Effekt von Landeskulturen auf Unternehmen zu ermitteln und andererseits Unternehmenskulturen zu verstehen. (Vgl. Müller/Gelbrich 2004: 35ff.)
2.1.2. Das Kulturverständnis dieser Arbeit
Die aufgerührten Wissenschaftszweige zeigen zum Teil erhebliche Unterschiede in ihrer Auffassung von Kultur, da sie sich dem komplexen Konstrukt von unterschiedlichen Seiten her annähern. Auf eine interdisziplinäre Diskussion dieser verschiedenen Diskurse soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht näher eingegangen werden. Stattdessen wird hier eine idealistisch-organische Kulturperspektive[6] im Sinne der symbolischen Kulturanthropologie adaptiert, da sie einen sinnvollen Ausgangspunkt für weitere theoretische Überlegungen zur interkulturellen Kommunikation darstellt: Sie gesteht der symbolischen Dimension kultureller Wirklichkeiten eine zentrale Rolle zu und widmet dem Sprach- und Kommunikationsvermögen des Menschen besondere Aufmerksamkeit (vgl. Fischer 1996: 28). Aus diesem Grund besitzt sie ein großes heuristisches Potential für das Verständnis interkultureller Interaktionsproblematik. Fornäs beschreibt die symbolisch-interpretative Kulturperspektive mit den folgenden Zeilen:
„Culture is a web of flows, multiplying, converging and crossing. Some of the interconnecting whirls of culture are clearly visible on the surface, others are hidden deep below. Some are strong and irresistible, others local and temporary. They flow in various directions and intersect at different levels. Above all, they are polyphonic, resulting from complex intersubjective processes of communication rather than directly from objective external nature or from within a singular subject. Cultural processes are communicative practices. We do not passively submit to preexisting frames, rules and codes, but reshape and recreate ourselves, each other, our worlds and our symbolic forms in an at least potentially open, active and creative process. All this has always been true, but recent developments of late modernity have made it unusually clear is.” (Fornäs 1995: 1)
Für den hier vertretenen Kulturbegriff lassen sich folgende Grundannahmen festhalten:
1. Symbolische „Verwebungen“ entstehen durch intersubjektive Kommunikationsprozesse. Im Mittelpunkt der Genese von Kultur stehen also Kommunikation im weiteren Sinne und ihre Praktiken. Kultur ist ein soziales oder kollektives Phänomen, da es mindestens zweier Menschen bedarf, sich über den symbolischen Bedeutungsgehalt von bestimmten Ideen auszutauschen (vgl. Mauritz 1996: 20).
2. Kulturelle Prozesse vollziehen sich auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad. Sie haben somit Oberflächen- und Tiefenstrukturen (vgl. Schmid 1996: 115ff.) und äußern sich in miteinander verbundenen Praktiken, die räumlich und zeitlich mal stabiler und ausgedehnter, mal instabiler und kurzfristiger sein können (vgl. Straub/Thomas 2003: 37).
3. Kultur ist dynamisch, d.h. die kulturellen Rahmenbedingungen werden in einem permanenten Dialog zwischen Deutungsgemeinschaften neu ausgehandelt (vgl. Bisang 2004: 40; Bachmann-Medick 2003: 96). Dadurch befinden sich kulturelle Gemeinschaften in einem steten Wandlungsprozess, der sich auf all ihre Mitglieder auswirkt, so wie sie auch in ihrer kulturellen Gemeinschaft durch Handeln ihre Spuren hinterlassen (vgl. Fornäs 1995: 1). Regeln und Normen haben zwar eine Orientierungsfunktion für das Denken und Handeln, können aber interpretiert und verändert werden und haben daher keinen absoluten Bindungscharakter.
2.2. Perspektiven zur Kommunikation
Kommunikation und Sprache sind grundlegende Eigenschaften des Menschen, der durch sie in die Lage versetzt wird, intersubjektive Wirklichkeitsentwürfe zu entwickeln und soziale Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen (vgl. Schmidt 1994: 48): Erst durch Kommunikation kann der Mensch Kultur erschaffen und nach ihr leben. Das Kommunikationsverständnis dieser Arbeit fußt in Übereinstimmung mit dem vertretenen Kulturverständnis auf dem symbolisch-interpretativen Paradigma, bezieht allerdings strukturierende Kraft der positivistisch geprägten mechanistischen und psychologischen Kommunikationsperspektiven ein: Dies wird deutlich an dem Modell „ Communicating with Strangers “ (Gudykunst/Kim 1997), das am Ende des Kapitels beschrieben wird. Die neuere system-theoretische Perspektive[7] hingegen soll bewusst nicht einbezogen werden, da für ihre Anwendung „ein ungleich zeit- und methodenaufwendigeres Forschungsdesign“ (Theis-Berglmair 2003: 110) unabdingbar ist, das bisher von sehr wenigen Studien geleistet werden konnte. Im Folgenden soll diese Auswahl grob charakterisiert und begründet werden.
2.2.1. Von der mechanistischen zur symbolisch-interpretativen Perspektive
Grundstein der modernen Kommunikationsforschung ist das informationstheoretische Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver (1949) (vgl. Krallmann/Zielmann 2001: 23). Zentrales Element des Modells ist die Nachrichtenquelle, die mittels eines Senders ihre Nachricht kodiert und über einen Übertragungskanal an einen Empfänger sendet. Dieser Empfänger dekodiert die Nachricht in umgekehrter Weise, die somit das Nachrichtenziel erreicht (vgl. Schramm 1969: 4f.). Die erfolgreiche Übertragung kann laut des Modells nur durch eine Störquelle verhindert werden, die sich durch Übertragungsfehler bemerkbar macht. Das Modell lässt offen, wer oder was Nachrichtenquelle und -ziel ist, und befasst sich nicht mit der Bedeutung oder dem Sinn einer Nachricht (vgl. Schmidt 1994: 51). Im Zuge weiterer Modifikationen des Modells wurde festgestellt, dass Sender und Empfänger über personenspezifische Zeichenrepertoires verfügen und Kommunikation nur dann erfolgreich zustande kommt, wenn beide über eine ausreichende Schnittmenge ihres Zeichenvorrats verfügen (vgl. Schützeichel 2004: 27f.). Gleiche Botschaften führen nicht zu gleichen Wirkungen, da sich der Rezipient aktiv der unterbreiteten Kommunikationsangebote bedient und auswählt, was in seinen kontextuellen Rahmen passt.
Diese Einsicht spiegelt sich im erweiterteten Stimulus-Organism-Response-Modell wider, das den Rezipienten in seiner Funktion als aktiver Selegierer in den Mittelpunkt rückt. Auch dieses psychologische Kommunikationsverständnis ist von positivistischen Annahmen zur Linearität und Transitivität von Kommunikationsprozessen geprägt (vgl. Theis-Berglmair 2003: 45). Allerdings verlagert sich der Ort des „Informationstransfers“ von der rein physikalischen Ebene auf interne Ereignisse (vgl. Sperka 1996: 86) und berücksichtigt dabei die Dekodierungsweise des Empfängers (vgl. Oelert 2003: 42). Aus psychologischer Perspektive befinden sich die Kommunikanten in einer Informationsumwelt, die eine Vielzahl von Stimuli produziert. Diese Umwelteinflüsse werden durch interne „konzeptionelle Filter“ (Einstellungen, Meinungen, Motive, Vorstellungen, Kognitionen etc.) selektiv und interpretierend ausgewertet. Erst dadurch werden Daten zu sinnhaften Informationen umgewandelt. Der Schwerpunkt dieses Kommunikationsverständnisses liegt also auf der intrapersonellen Ebene, da sie den (konzeptionellen) Ort der Kommunikation und deren Prozesscharakter bestimmt. Demnach werden Kommunikationshindernisse als Fehlinterpretationen oder Fehlattributionen verstanden, die durch kulturelle, soziale oder personelle Faktoren bedingt sind. (Vgl. Theis-Berglmair 2003: 46f.) Diese Perspektive lässt jedoch außer Acht, wie Informationsverarbeitungsmuster entstehen und dass sie sich dynamisch verändern können. Die implizite Annahme, dass jede Informationsverarbeitung als Reiz eine Reaktion hervorruft und von daher eine verhaltensprägende Wirkung besitzt, geht nur wenig über das mechanistische Verständnis hinaus (vgl. ebd.: 47).
Hier setzt der Symbolische Interaktionismus nach Mead (1934) und Blumer (1969) an, der Kommunikation als Symbolvermittlung versteht (vgl. Schützeichel 2004: 87). „Symbolisch“ bedeutet, dass menschliches Zusammenleben auf Basis von Sprache abläuft, die sich an einem Set von Symbolen bedient. Der Begriff der „Interaktion“ lässt darauf schließen, dass Menschen immer im Bezug zu anderen Menschen handeln und dabei ihre individuellen Handlungen reflexiv untereinander koordinieren, um ihre Ziele aufeinander abzustimmen. (Vgl. Denzin 2000: 137). Menschen erfahren sich also „aus der Reaktion anderer Mitmenschen auf das eigene Verhalten [.]“ (vgl. Heini 2003: 123).
Der Symbolische Interaktionismus beschäftigt sich dabei mit Bedeutungszuschreibungen, die in Interaktionsketten mehrfach kodiert und modifiziert werden. Aus dieser Sicht sind es menschliche Diskurse und Erzählungen, welche die Welt abbilden und dem Alltagsleben somit eine Struktur geben: Sie machen die „Welt“ kohärent und bedeutsam. (Vgl. Denzin 2000: 144f.) Der Kern des Symbolischen Interaktionismus kann mit diesen drei Grundannahmen veranschaulicht werden:
1. Menschen verhalten sich gegenüber Objekten entsprechend der Bedeutungen, die diese für sie haben.
2. Objektbedeutungen entstehen erst durch Kommunikation zwischen Menschen (vgl. Funke-Welti 2000: 31).
3. Objektbedeutungen werden mittels eines interpretativen Prozesses der Personen, die mit diesen Objekten umgehen, gebraucht und modifiziert. (Vgl. Schützeichel 2004: 109)
Daraus folgt, dass die symbolische Welt durch permanente Revision, Neudefinition und wechselseitige Aushandlungen kommunikativ erschaffen wird (vgl. Hofbauer 1991: 83) und eine reale Welt nicht existiert. Dadurch wird das klassische Kommunikationsverständnis bewusst konterkariert: Das „Güterprinzip“ von Kommunikation wird ersetzt durch eine wechselseitige Anpassung der Kommunikanten an bestimmte Kommunikationsvorgaben (vgl. Schützeichel 2004: 110). Sowohl der Sender als auch der Empfänger erhalten eine aktive Rolle im Kommunikationsprozess. In diesem Prozess werden verbale und nonverbale Zeichen vermittelt, die beim Empfänger bestimmte Assoziationen auslösen und dadurch als Symbol verstanden werden (vgl. Theis-Berglmair 2003: 62). Was er letztlich als Symbol auffasst und welche Bedeutung er diesem Symbol zuschreibt, hängt von seiner kulturellen Prägung und den individuellen Gefühlen und Erfahrungen ab, die er damit assoziiert (vgl. Thieme 2000: 387). Diese Assoziationen sind kontextabhängig und können sich zeitlich verändern. Die Interpretation der in einer Interaktion verwendeten Symbole kann bei den Interaktionspartnern nie völlig kongruent sein. Vielmehr nähern sich die Beteiligten graduell in ihrem Symbolverständnis aneinander an. Dabei spielen gemeinsame Erfahrungen und eine ähnliche Sozialisierung eine entscheidende Rolle. (Vgl. Theis-Berglmair 2003: 63)
Angewandt auf interpersonale Kommunikation stehen im Symbolischen Interaktionismus v.a. Ähnlichkeiten der Bedeutungszuschreibung im Mittelpunkt. Die Interpretationsmuster von Wirklichkeit sind individuell und gruppenspezifisch verschieden und führen zu unterschiedlichen Bedeutungszuweisungen. Daher geht es um die Analyse verbaler und nonverbaler Symbole, die diese kultur- und gruppenspezifischen Erfahrungshintergründe sichtbar werden lassen. (Vgl. ebd.: 66).
2.2.2. Das Kommunikationsverständnis dieser Arbeit
Im direkten Vergleich der hier dargestellten Kommunikationsperspektiven wird ersichtlich, dass das symbolisch-interpretative Modell die Komplexität und Prozesshaftigkeit interkultureller Kommunikation am besten erfasst, da es die heterogenen Erlebnis- und Erfahrungswelten der verschiedenen (national-) kulturellen und (organisations-) kollektiven Gruppen berücksichtigt (vgl. Thieme 2000: 387). Nichtsdestoweniger besitzt es einen begrenzten forschungspragmatischen Wert, da es sich hauptsächlich für Beschreibung von Einzelfällen eignet und objektivierende oder quantifizierende Aussagen über Kommunikation kategorisch ausschließt. Konsequenterweise lehnt der Symbolische Interaktionismus in seiner radikalen Form allgemeingültige Modelle und Theorien ab (vgl. Denzin 2000: 141). Dabei kann es auch Forschungszusammenhänge geben, in denen sich ein einfaches, lineares Kommunikationsmodell mit einem positivistischen Theorieverständnis bewährt, da einzelne Kategorien und Dimensionen besser isoliert und generalisiert werden können (vgl. Warthun 1997: 14). Triandis (1972) schlägt vor, subjektivistische und objektivistische Perspektiven miteinander zu verknüpfen, da ihre Annahmen zwar auf gleichen Analyseebenen inkompatibel, auf verschiedenen aber durchaus kombinierbar seien (vgl. Gudykunst/Nishida 1989: 20): Es soll der Versuch unternommen werden, Kommunikation als Symbolaustausch in einem komplexen Kontext zu erfassen. Die involvierten Elemente sollten jedoch kategorisierbar sein, was sich mittels objektivistischer Klassifizierungen bewerkstelligen lässt. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit auf Elemente beider wissenschaftlicher Strömungen zurückgegriffen, um sich dem Untersuchungsgegenstand pragmatisch annähern zu können.
2.3. Interkulturelle Kommunikation
Im Folgenden soll das Konzept der interkulturellen Kommunikation erläutert werden. Zuerst wird dabei die Entwicklung der interkulturellen Kommunikationsforschung nachgezeichnet (Kap. 2.3.1.). Danach erfolgt die Eingrenzung dieses Forschungszweiges (Kap. 2.3.2.) und eine genauere Betrachtung der Besonderheit und Problemhaftigkeit interkultureller Kommunikation (Kap. 2.3.3.). In diesem Unterkapitel wird des Weiteren ein Organisationsmodell zur näheren Bestimmung der daran beteiligten strukturellen Elemente vorgestellt.
2.3.1. Entwicklung der interkulturellen Kommunikationsforschung
Der Anthropologe Edward T. Hall prägte den Begriff Intercultural Communication in seinem 1959 erschienen Klassiker „The Silent Language“ und setzte damit die Arbeit von Benjamin Whorf fort (1940; 1956).[8] Von ihm stammt eine ebenso bahnbrechende wie tautologische Erkenntnis: „Communication is culture, culture is communication.“ (Hall 1959: o.S., zit. n. Knapp/Knapp-Potthoff 1987: 3). Ziel seines Vorhabens war damals die Übertragung abstrakter anthropologischer Konzepte auf die pragmatische Ausbildung von US-Diplomaten und die Erweiterung des anthropologischen Kulturbegriffs um den der Kommunikation (vgl. Jandt 1995: 31). Dadurch wurde die interkulturelle Kommunikationsforschung in Nordamerika wesentlich stimuliert. In den 60er Jahren wurde das Interesse durch das von Kennedy gegründete Peace Corps weiter angefacht. Erst ab den 70er Jahren kam es zu einer wissenschaftlich fundierten Beschäftigung mit diesem Thema. Dabei rückte der eigentliche Kommunikationsprozess in den Mittelpunkt des Interesses interkultureller Studien (vgl. Asante/Gudykunst 1989: 7) und es begann der „Kampf“ um einen eigenständigen Platz dieses Feldes in den Kommunikationswissenschaften. Interkulturelle Kommunikationsforscher argumentierten, dass die Entwicklung einer einzigen Kommunikationstheorie nicht ausreichte, um dem komplexen Gebilde menschlicher Interaktion gerecht zu werden (vgl. Mauritz 1996: 77). Ende der 60er Jahre führte Geert Hofstede eine IBM-Studie über Kulturdimensionen und kulturspezifische Werthaltungen durch („Culture’s Consequences“ 1980), die auf breiter empirischer Basis (Befragung von über 116 000 Managern in 72 Ländern) den Einfluss von Landeskulturen auf multinationale Konzerne nachwies (vgl. Hofstede 2001: xix). Eine Reihe von thematisch spezialisierten Zeitschriften[9] etablierte sich, die in den 80er Jahren dazu übergingen, jede Ausgabe einem speziellen Thema (etwa zum theoretischen Stand, zu Forschungsmethoden, Organisationsprozessen und Kultur etc.) zu widmen und dem Fach zu einem ausdifferenzierten Profil zu verhelfen (vgl. Asante/Gudykunst 1989: 8). Im Theoriebereich legten Gudykunst (1983) sowie Gudykunst und Kim (1988) richtungsweisende Sammelbände vor, die dem praxisnahen Forschungsgebiet ein akademisches Fundament gaben (vgl. Warthun 1997: 23). Seit den 80er Jahren ist die interkulturelle Kommunikation fest in der amerikanischen Kommunikationswissenschaft verankert und bildet einen eigenständigen Studienzweig. Im Hinblick auf die amerikanische Theoriebildung fällt auf, dass immer wieder dieselben Namen erwähnt und zitiert werden. Darunter fallen etwa William Gudykunst, Stella Ting-Toomey, Mitchell Hammer und Young Yun Kim. Als internationale Vertreter der kulturvergleichenden Forschung sind hier insbesondere Edward T. Hall, Geert Hofstede, Fons Trompenaars und Charles Hampden Turner zu nennen. Seither hat der fortschreitende Globalisierungsprozess den Stellenwert dieser Forschungsrichtung kontinuierlich erhöht; sie hat sich in mehrere Bereiche aufgegliedert, die nicht immer trennscharf voneinander abgegrenzt wurden.
2.3.2. Abgrenzung des Forschungsfeldes
Seit geraumer Zeit hat sich die Forschung weitgehend auf eine Unterteilung in interkulturelle Kommunikation, Cross-Cultural Communication, internationale Kommunikation und komparative Massenkommunikation geeinigt (vgl. Gudykunst/Ting-Toomey 1988: 29ff.). Zur besseren Veranschaulichung sollen diese hier kurz erläutert werden.
Abb. 2-1 Forschungsgebiete der Interkulturellen Kommunikation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Gudykunst/Ting-Toomey 1988: 32.
2.3.2.1. Interkulturelle Kommunikation
Das Präfix „Inter“ bezeichnet, dass sich die Forschung in diesem Feld auf grenzüberschreitende Kontakte oder Beziehungen konzentriert. Knapp und Knapp-Potthoff verstehen darunter „ongoing interaction among members of different (sub-)cultures“ (Knapp/Knapp-Potthoff 1987: 7). Damit verweisen sie auf den Umstand, dass auch eine Subkultur eine eigene (oder gar eigenständige) Kultur hat. Die Kommunikation zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern einer solchen Entität verlangt eine kulturelle Grenzüberschreitung, die in diesem Begriff zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz zur internationalen Kommunikation ist mit interkultureller Kommunikation im Allgemeinen Face-to-face -Kommunikation gemeint (vgl. Jandt 1995: 31). Im konkreten Beispiel bedeutet das: Kommunizieren eine Spanierin aus Unternehmen A und ein Deutscher aus Unternehmen B miteinander, so ist ihre Kommunikation auf zweierlei Art interkulturell. Zum einen ist sie es, weil beide verschiedener Nationalität sind und unterschiedliche Sprachen sprechen. Zum anderen kommen sie aus unterschiedlichen Unternehmenskulturen, die über unterschiedliche Werte, Regeln und Normen verfügen.
2.3.2.2. Cross-Cultural Communication
Wie der englische Begriff „Cross“ ausdrückt, handelt es sich um den komparativen Vergleich bestimmter Phänomene über verschiedene Kulturen hinweg. Werden z.B. Höflichkeitsformen und Grußformeln in Deutschland mit denen in Frankreich verglichen, spricht man von dem Erkenntnisbereich der Cross-Cultural-Forschung. Auch diese Forschung beschäftigt sich mit Face-to-face -Kommunikation (vgl. Gudykunst/Mody 2002: ix).
2.3.2.3. International/Comparative Mass Communication
Im Allgemeinen versteht man unter internationaler Kommunikation, dass über Ländergrenzen hinweg kommuniziert wird. Das heißt, sie kann sowohl in einem interkulturellen als auch monokulturellen Setting stattfinden, da der Begriff nur besagt, dass sie über Staatsgrenzen hinweg geschieht (vgl. Maletzke 1978: 410). Telefoniert bspw. ein peruanischer Immigrant von Madrid aus mit seiner daheim gebliebenen Familie in Lima, so spricht man von (monokultureller) internationaler Kommunikation, während das Gespräch zwischen eben diesem Peruaner und seinem chinesischen Gemüsehändler an der Ecke nicht international, sondern interkulturell ist. Aufgrund ihrer Charakteristik, Ländergrenzen zu überschreiten, hat internationale Kommunikation jedoch mittlerweile eher die Konnotation medial vermittelter, professioneller oder politischer Kommunikation erhalten (vgl. Jandt 1995: 30). Als komparative Variante widmet sie sich auch ländervergleichenden Analysen von Massen- und Medienkommunikation (vgl. Asante/Gudykunst 1989: 9).
2.3.3. Zur Besonderheit interkultureller Kommunikation
In Kap. 2.1. und 2.2. wurden die Begriffe von Kultur und Kommunikation dahingehend eingegrenzt, dass sie für die avisierte Untersuchung nutzbar gemacht werden können. Dabei wurde festgestellt, dass diese Begriffe sehr unterschiedlich definiert werden und sich eher auf Glaubensbekenntnisse verschiedener Schulen berufen, als ein interdisziplinär kompatibles Gesamtverständnis zu generieren. Dieser Umstand erschwert die definitorische Bestimmung der interkulturellen Kommunikation. Die meisten Definitionen halten es deswegen sehr allgemein: „By verbal definition, intercultural communication is communication between human beings of different cultures“ (Maletzke 1978: 409). Diese und viele andere Definitionen rekurrieren auf Kultur und Kommunikation, ohne sich auf die Besonderheit von konkreten, situational einzigartigen Kommunikationsepisoden zu beziehen, in denen interkulturelle Interaktion stattfindet (vgl. Graf 2004: 7). Ellingsworths Definition fällt ähnlich generalistisch aus, bezieht aber den Aspekt der persönlichen Wahrnehmung ein: „An interpersonal encounter may be designated as intercultural when the participants act as though they believe it is intercultural“ (Ellingsworth 1988: 265). Somit rücken explizit das Verhalten und implizit die dahinter stehende Fremdheit der Beteiligten in den Fokus. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht also nach dem klassischen Verständnis die kulturelle Andersartigkeit der Beteiligten. Sie sind sich dessen dann bewusst, wenn der andere als „fremd“ empfunden wird, also „Kodes, Konventionen, Einstellungen und Alltagsverhaltensweisen“ (Maletzke 1996: 37) anders verwendet und versteht. Dieser Bezug wird bei Thomas/Hagemann (1992) dargestellt:
„Interkulturelles Handeln findet in einer kulturellen Überschneidungssituation statt, in der gewohnte, eigenkulturell geprägte Verhaltensweisen, Denkmuster und Emotionen mit fremden, ungewohnten Verhaltensweisen, Denkmustern und Emotionen zusammentreffen. Die bisher zur Zielerreichung geeigneten Handlungsweisen, Bewertungs- und Interpretationsmuster versagen ganz oder teilweise, die Kommunikation mit den Interaktionspartnern ist erschwert und ihre Reaktionen werden nur ungenügend oder überhaupt nicht verstanden.“ (Thomas/Hagemann 1992: 175, zit. n. Mauritz 1996: 73).
Der Verweis auf eine kulturelle Überschneidungssituation wirft die Frage auf, wie sich die verschiedenen kulturellen Kontexte strukturell überlappen. Sind damit landeskulturelle Kontexte gemeint oder auch schon subkulturelle oder gar organisationskulturelle? Wann kommt es zu solch einer Überschneidungssituation, d.h. wo ist die Grenze zwischen intra- und interkultureller Kommunikation zu ziehen? Auf diese Fragen soll nachfolgend präziser eingegangen werden.
2.3.3.1. Interkulturalität zwischen sozialen Gruppen
Wie bereits in Kap. 2.1.1. erörtert wurde, kann Kultur nicht nur auf nationalstaatliche oder ethnische Grenzen bezogen werden, da es sich dabei um keine homogenen Einheiten handelt. Hansen (2000) geht davon aus, dass Kultur von Kollektiven getragen wird und deren Identität definiert (vgl. ebd.: 317). Deswegen beginnt Interkulturalität bereits an kollektiven Grenzen. Kollektive werden dabei verstanden als „alle denkbaren menschlichen Gruppierungen, die gemeinsame Gewohnheiten zu erkennen geben“ (ebd.: 193). Um die eigene Kohärenz sicherzustellen, bündeln Kollektive die Individualitäten ihrer Mitglieder, die sich einem Kollektiv immer dann freiwillig anschließen, wenn dieses einen Teil ihrer Identität abdeckt oder befriedigt (vgl. ebd.: 196). Diese Kollektive suchen sich von anderen abzugrenzen, um die inneren Kohäsionskräfte (in Form von Solidarität als Zusammenspiel aus realen und erwünschten Gemeinsamkeiten) zu stärken.[10] Man kann Kollektive nach ihrer Komplexität als Orientierungssysteme und dem damit verbundenen Identitätsangebot an seine Mitglieder unterscheiden. Politische Parteien oder Religionsgemeinschaften etwa haben eine viel größere Orientierungskapazität als der lokale Sportverein und beeinflussen ihre Mitglieder stärker. Als entscheidende Wirkungskraft von Kollektiven versteht Hansen die „Entindividualisierung“: die Mitglieder eines Kollektivs bewerten Mitglieder eines anderen Kollektivs aufgrund eben jener kollektiven Eigenschaften und ignorieren weitgehend deren individuelle Besonderheiten (vgl. ebd.: 324; Apeltauer 1997: 17f.). Dies ist ein charakteristisches Phänomen interkultureller Kommunikationssituationen: Die Beteiligten sehen den jeweils Anderen als Mitglied eines fremden Kollektivs und sich selbst als Repräsentant des eigenen.
Eine Nation oder einen Staat kann – mit starken Einschränkungen – aufgrund von Sprache und historischer Entwicklung als „Superkollektiv“ bezeichnet werden (vgl. Hansen 2000: 209), das von innerer Divergenz und Diversität geprägt ist (vgl. ebd.: 339). Zwar gibt es Staaten mit mehreren (offiziellen) Sprachen und auch verschiedene Migrationsbewegungen machen eine Gleichsetzung von Staat mit Ethnie unmöglich; jedoch wirken verschiedene superkollektive Standardisierungen (Bildungssystem, Sozialsystem, Gesetzgebung, Medien, etc.) für alle im Staat integrierten Kollektive bindend und beeinflussen deren Wertekern (vgl. Stüdlein 1997: 37). Insofern funktioniert die Nationalität wie eine kulturelle Klammer für weitere kulturelle Feinausprägungen der darin liegenden Kollektive auf der Meso- und Mikroebene (vgl. ebd.). Die Frage nach Interkollektivität oder Interkulturalität ist also eine graduelle. Je heterogener und größer zwei Kollektive sind, umso interkultureller ist auch die Kommunikation zwischen ihren Mitgliedern.
2.3.3.2. Zum fließenden Übergang zwischen Intra- und Interkulturalität
Wenn es verschiedene Kollektive gibt, deren Interaktion unabhängig von ihrer gesellschaftlichen oder ethnischen Zugehörigkeit Interkulturalität voraussetzt, was unterscheidet dann interkulturelle von intrakultureller Kommunikation? Mit anderen Worten: Ist die Kommunikation zwischen dem deutschen Manager eines Computerchipkonzerns und einem Tischlermeister nicht genau so interkulturell oder gar interkultureller als die Kommunikation des gleichen Managers mit seinem amerikanischen Arbeitskollegen? Personen mit verschiedenem ethnischen Hintergrund können eine reibungslose und unproblematische Kommunikation eingehen, sofern sie beispielsweise einen ähnlichen Bildungsgrad, vergleichbaren Beruf und kompatible Interessen haben. Dagegen fällt intrakulturelle Kommunikation oft ungleich komplizierter aus, wenn sich die Interaktionspartner nicht kennen, verschiedenen Alters sind oder unterschiedlichen sozialen Schichten, bzw. anderen „Subkulturen“ (also Kollektiven) angehören. (Vgl. Apeltauer 1997: 18). „[…] Menschen [können] als kulturell einzigartig betrachtet [werden][…]; somit [trägt] jede kommunikative Begegnung zwischen zwei Individuen ein bestimmtes Maß an interkulturellen Elementen in sich [.]“ (Mauritz 1996: 80). Ma bemerkt, dass Sprache, Gewohnheiten und Sitten zwischen Landeskulturen stark voneinander abweichen können, aber dennoch immer gewisse Gemeinsamkeiten und Analogien aufweisen (Ma 1999: o.S.).
Kommunikation impliziert, dass Individuen miteinander Bedeutungen von Symbolen aushandeln und dabei versuchen, den „Anderen“ oder den „Fremden“ zu verstehen. Dieser Prozess läuft unabhängig von der landeskulturellen Herkunft ab (vgl. Knapp/Knapp-Potthoff 1987: 8). Da die soziale Fähigkeit der Symbolverhandlung auf intrakultureller Ebene bereits angelegt ist, wird interkulturelle Kommunikation überhaupt erst möglich. Trotzdem ist es ebenso einleuchtend, dass sich Erfahrungen mit Menschen aus anderen Ländern vorteilhaft auf die eigene interkulturelle Kommunikationskompetenz auswirken.
Was ist das Besondere daran, wenn Menschen aus unterschiedlichen Landeskulturen miteinander interagieren? Als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal identifiziert Knapp (2003) die Sprache, da mindestens einer der Beteiligten nicht in seiner Muttersprache kommuniziert und aufgrund mangelnder Sprach- und Vokabelkenntnisse oftmals vorhandenes Hintergrundwissen nicht aktivieren kann. „Die spezifischen Beschränkungen fremdsprachlichen Kommunizierens bedingen eine weit höhere Komplexitätsstufe mit höheren Risiken für die Verständigung“ (Knapp 2003: 113). Ein weiterer Indikator ist das Ausmaß der Interkulturalität einer Kommunikationssituation. Je größer die Heterogenität der Interaktionspartner ausfällt, umso komplizierter wird es, sich beidseitig auf ähnliche Bedeutungen zu einigen und diese relativ deckungsgleich zu interpretieren. Die Heterogenität richtet sich danach, inwieweit die Beteiligten Weltanschauungen, normative Glaubensvorstellungen und Verhaltensmuster, Kodierungssysteme sowie Beziehungseinschätzungen und -absichten teilen (vgl. Sarbaugh 1988: 27).
Intra- und interkulturelle Kommunikation bilden in sich keinen Widerspruch und sind qualitativ nicht unterscheidbar (vgl. Kim 1988: 13). Modellhaft gedacht könnte man eine Skala aufspannen, deren beide Extrempole völlige Interkulturalität und Intrakulturalität darstellen:
„All communication […] is viewed as ‘intercultural’ to an extent, and the degree of ‘intercultural-ness’ of a given communication encounter is considered to depend on the degree of heterogeneity between the experiential backgrounds of the individuals involved.“ (ebd.)
Die Grenze zwischen den beiden Termini muss der Forscher anhand seiner eigens festgelegten Operationalisierung (vgl. ebd.) und seines Kulturverständnisses ziehen. Daher kann immer nur davon gesprochen werden, dass eine Interaktion tendenziell intra- oder interkulturell ist, je nachdem ob die Gemeinsamkeiten oder Differenzen der Beteiligten überwiegen (vgl. Mauritz 1996: 80).
2.3.3.3. Die Problematik interkultureller Kommunikation
Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt (vgl. Ward et al. 2001: 53), dass interkulturelle Kommunikation ein erhöhtes Potential an Konflikten und Missverständnissen aufweist, da sich der kulturelle Hintergrund der Beteiligten signifikant auf ihr Verhalten auswirkt (vgl. Stüdlein 1997: 92). Bei größerer kultureller Unterschiedlichkeit teilen die Beteiligten weniger kulturvermittelte Grundannahmen und Wertvorstellungen (vgl. Graf 2004: 49). Sie folgen weitestgehend den Verhaltensregeln ihres eigenen Orientierungssystems und haben deshalb nur wenige fundamentale Sozialisierungserfahrungen gemein.
Die existenten kulturellen Unterschiede bieten allerdings auch Chancen, neue Sichtweisen oder Ideen hervorzubringen und das eigene Verhalten auf seine Angemessenheit zu überprüfen. Die Art und Weise, wie Menschen diese Unterschiede wahrnehmen und mit ihnen umgehen, ist also entscheidend für erfolgreiche interkulturelle Kommunikation (vgl. Kumbruck/Derboven 2005: 6f.). Dafür sind besondere interkulturelle Kompetenzen notwendig, und es müssen bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein, die diese Kompetenzen aktivieren. So ist es wichtig, motiviert in eine kulturüberschreitende Situation hineinzugehen und sich möglichst offen zu geben (vgl. Breuer/Bartha 1996: 130). Eine positive und ermutigende situationale Umwelt fördert zudem die psychische Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen (vgl. Gudykunst/Kim 1997: 3). Neben der individuellen emotionalen Disposition kommen noch eine Reihe anderer Strukturdimensionen (d.h. die behaviorale und kognitive Ebene) hinzu, die interkulturelle Kompetenz ausmachen und in Kap. 4.4. aufgegriffen werden. Zunächst einmal wird ein Modell vorgestellt, das der Vielzahl an Elementen und Einflussgrößen interkultureller Kommunikation eine Struktur geben soll.
2.3.4.Ein Organisationsmodell interkultureller Kommunikation
Gudykunst und Kim (1997: 44ff.) stellen ein Organisationsmodell vor, um die Erkenntnisse über Elemente der interkulturellen Kommunikation zu systematisieren. Sie konzeptionalisieren interpersonale Kommunikation als reziproken Prozess zwischen zwei Kommunikanten, der immer die gleichzeitige Übertragung und Interpretation zweier Botschaften voraussetzt. Kommunikation ist durch den simultanen Austausch von Botschaft und Feedback als dynamischer Prozess angelegt. Die Kommunikanten verfügen über ein Kontingent möglicher Übertragungs- und Interpretationsoptionen, die durch angelegte „konzeptionelle Filter“ verringert werden. Diese beeinflussen das „Wie“ und „Was“ seiner Kommunikation. Gudykunst und Kim unterscheiden zwischen vier verschiedenen Filtern, die nach dem Zwiebelprinzip in Form konzentrischer Kreise um die Kommunikanten angelegt sind.
Abb. 2-2 Organisationsmodell „ Communicating With Strangers “
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Gudykunst/Kim 1997: 45.
Als äußerer, makrokultureller Einfluss gilt der kulturelle Filter, d.h. Wertvorstellungen, Normen und Regeln. Sie spezifizieren akzeptables oder nicht-akzeptables Interaktionsverhalten und erwartete Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation. Der soziokulturelle Filter bezieht sich auf Einflüsse mittlerer Ebene, also jene, die sich aus sozialen Beziehungen, Kollektivzugehörigkeiten und Rollenverhalten ergeben. Der innere, psychokulturelle Filter bezieht sich auf das psychische System. Es geht dabei darum, wie sich die Persönlichkeit ausbildet und wie kognitive und affektive psychologische Prozesse stabilisiert und in Einklang gebracht werden (vgl. Gudykunst/Kim 1997: 15). In diese Kategorie ordnen die Autoren u.a. Erwartungen, Stereotype und Ethnozentrismus ein. Die vom Modell dargestellte Kommunikationssituation steht immer in direkter Verbindung zu dem vierten Filter, d.h. zu einer bestimmten Umwelt, die in Form von geografischen, klimatischen, architektonischen Parametern Einfluss auf die Interaktionspartner ausübt. Vermutlich würde eine deutsche Familie das eigene Wohnzimmer als Ort formloser, ungezwungener Kommunikation betrachten, während eine spanische Familie sich dort eher zu besonderen Anlässen aufhalten würde (vgl. ebd.).
Botschaften werden verbal und nonverbal kodiert. Verbale Kodierung erfolgt auf einer hohen Bewusstseinsebene. Nonverbale Kommunikation ist dagegen unbewusster und nur teilweise steuerbar; deswegen gilt sie gemeinhin als Vertrauen erweckender (vgl. Knapp 2003: 117). Die Kodierung einer Botschaft funktioniert auf Basis der beschriebenen Filter und der Erwartung, wie bei seinem Gegenüber diese Filter funktionieren. Gleichzeitig dekodiert der Rezipient die Botschaft mithilfe seiner eigenen Filter und interpretiert sie im Rahmen des kommunikativen Kontextes. Erfolgreiche Kommunikation findet also nach diesem Modell dann statt, wenn die Filter der Beteiligten annähernd deckungsgleich sind (vgl. Warthun 1997: 20f.). Kommunikationsunterschiede sind dabei auf unentdeckte Unterschiede bei den Filtern zurückzuführen. Der Übergang zwischen den Filtern ist fließend, da sie sich gegenseitig beeinflussen. So können z.B. Stereotype auf gesamtkultureller oder soziokultureller Ebene verankert sein, beeinflussen aber die psychokulturelle Disposition der an einer interkulturellen Interaktion beteiligten Personen (vgl. Gudykunst/Kim 1997: 48).
Wie die Gudykunst und Kim selbst betonen, verfolgt dieses Modell nicht das Ziel, den Kommunikationsprozess selbst zu beschreiben, sondern nur dessen Elemente zu sortieren. Es ist eng an das in Kap. 2.2.1. beschriebene psychologische Kommunikationsverständnis angelehnt und entspricht somit nicht dem symbolisch-interaktiven Kommunikationsverständnis. Kritikwürdig ist die Konzeption der Filter, die hier als unveränderbare Grundkonstanten verstanden werden (vgl. Warthun 1997: 21). Dass sich diese Filter aufgrund neuer Erfahrungen dynamisch verändern, wird nicht berücksichtigt. Der Gedanke, dass durch weitgehend identische Filter störungsfreie Kommunikation möglich wird, missachtet ebenso den Einfluss situativer Faktoren (wie Status-Gefälle, Gefühle und Stimmungen) wie auch die Tatsache, das inkompatible „Filtereinstellungen“ durch individuelle Offenheit und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung überwunden werden können (vgl. ebd.). Dennoch identifiziert dieses Modell in übersichtlicher Weise die wichtigsten Parameter interkultureller Kommunikation. Es dient der vorliegenden Arbeit, um in den folgenden Kapiteln diese Parameter gesondert voneinander betrachten zu können
2.4. Zwischenfazit
In diesem Kapitel wurde das hier vertretene Verständnis von interkultureller Kommunikation dargelegt. Dazu wurden Kultur und Kommunikation als die konstituierenden Komponenten des Begriffs einzeln aufgearbeitet. Kultur kann nach Geertz als symbolisches Bedeutungsgewebe verstanden werden, das historisch überliefert ist. Dies ermöglicht es Menschen, einander Wissen und Einstellungen über das Leben mitzuteilen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Da Kultur und Kommunikation untrennbar miteinander verbunden sind und einander wechselseitig konstituieren, gelten für Kommunikation ähnliche Merkmale. Auch hier wird eine symbolisch-interpretative Perspektive befürwortet, nach der Menschen durch Interaktion gemeinsame Symbole erschaffen und je nach ihrer kulturellen Prägung diesen bestimmte Bedeutungen zuweisen.
Für die interkulturelle Kommunikation kann festgehalten werden, dass es sich dabei um interpersonale Kommunikation handelt, deren Grad an Interkulturalität davon abhängt, wie heterogen die Identitäten der Beteiligten sind. Eine größere kulturelle Variabilität führt tendenziell zu größeren Kommunikationsproblemen. Diese lassen sich lösen, wenn sich die Interaktionspartner darüber bewusst werden, welchen Einfluss ihre kulturell geprägten Sicht- und Verhaltensweisen auf den Kommunikationsprozess besitzen. Im Hinblick auf den empirischen Teil der Arbeit sollen die einfachen, linearen Kommunikationsmodelle (Stimulus-Response und Stimulus-Organism-Response) nicht gänzlich verworfen werden, da sie zu einer besseren Kategorisierung der gewonnenen Daten beitragen und verallgemeinernde Schlüsse zulassen.
3. Der kommunikative Kontext im internationalen Unternehmen
Dieses Kapitel widmet sich dem spezifischen Kontext, in dem deutsche Sojourners mit ihren spanischen Mitarbeitern kommunizieren. Sie treten bei Antritt ihres neuen Arbeitsverhältnisses nicht nur in die spanische Kultur ein, sondern auch in eine völlig neue Unternehmenskultur. Dabei gelten generell in einem Unternehmen besondere Kommunikationsbedingungen, die sich von alltäglicher Kommunikation unterscheiden. Diese werden in Form eines Exkurses in Kap. 3.1. erörtert, da sie keinen direkten Bezug zu der Untersuchung aufweisen, sondern lediglich einen Überblick über ihren Kontext verschaffen sollen. Kap. 3.2. befasst sich mit dem Wechselspiel zwischen Nationalkultur und Unternehmenskultur, das diese Kommunikationsbedingungen beeinflusst. Hier soll zunächst geklärt werden, wie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen nationalkulturellen Grundwerten beschrieben werden können. Darüber hinaus wird eine Einordnung der Untersuchungsländer Deutschland und Spanien in vorgestellten theoretischen Wertedimensionen vorgenommen (vgl. Kap. 3.2.1). Um diese Faktoren für die organisationale Ebene zu konkretisieren, soll danach beschrieben werden, was Unternehmenskultur ist (vgl. Kap. 3.2.2.). Im letzten Schritt wird dann eine Einordnung der Kulturtypen spanischer und deutscher Unternehmen vorgenommen (vgl. Kap. 3.2.3.).
3.1. Exkurs: Interpersonale Kommunikation im Unternehmen
Bei der Beschäftigung mit interpersonaler Kommunikation innerhalb des Unternehmens ist zunächst festzuhalten, dass für sie all das gilt, was schon in Kap. 2 festgehalten wurde. Verbale und nonverbale Zeichen werden ausgetauscht, welche die Kommunikanten als Symbole verstehen. Mithilfe dieser Symbole erschaffen sie durch wechselseitiges Aushandeln von Bedeutungen ihre soziale Welt auf subjektive Weise. Je kongruenter dieses Symbolverständnis wird, umso freier von Missverständnissen und Fehlinterpretationen wird die Kommunikation.
„Interpersonal communication [.] is characterized by the development of a relational identity, that is, the negotiated enmeshment of individual identities or maintenance and support of an established relational identity.“ (Cupach/Imahori 1993: 115)
Die Aktivitäten der Unternehmensmitglieder werden durch Kommunikation initiiert und koordiniert, d.h. ohne Kommunikation wäre ein zielgerichtetes Handeln nicht möglich (vgl. Wahren 1987: 48). Das Informations- und Kommunikationssystem stellt in diesem Sinne das „Nervensystem“ des Unternehmens dar, da die verschiedenen Funktions- und Entscheidungsträger sich darüber mittels Weisungen, Mitteilungen, Kritik und Informationsaustausch koordinieren (vgl. Kalmus 1998: 50). Betriebliche Kommunikation findet dabei in einem Umfeld statt, „das im Hinblick auf bestimmte Zielvorgaben formalisiert ist und sich durch eine hohe Regeldichte auszeichnet“ (Funke-Welti 2000: 26). Die hiermit verbundenen Einflussgrößen sind so komplex wie das Gebilde „Unternehmen“ an sich. Im Folgenden werden in Anlehnung an Wahren (vgl. Wahren 1987: 45ff.) einige zentrale Charakteristika der betrieblichen Kommunikation herausgegriffen.
Kommunikation im Unternehmen ist oft asymmetrisch und abhängig vom Macht- und Statusgefälle der beteiligten Akteure (vgl. ebd.: 64f.):
Macht äußert sich durch Beherrschung eines bestimmten Sachwissens, besondere Beziehungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens und die Kontrolle von Informations- und Kommunikationskanälen (vgl. ebd.: 65). Dies ist z.B. bei Führungskräften der Fall, die als zentrale Informationssammler fungieren. Sie wählen nach bestimmten Relevanzkriterien externe und interne Informationen aus, die sie dann als Informationsverteiler[11] anderen Mitgliedern zugänglich machen. (Vgl. Trujillo 1983: 75) Durch Steuerung der Informationsverteilung wird Macht konstituiert und geschützt, da Unternehmensmitglieder zur Aufgabenerfüllung bestimmte Informationen brauchen. Durch Herausgabe partieller Informationen, Anwenden von Taktiken im zwischenmenschlichen Interaktionsbereich (Überhäufen mit Informationen, Verdrehen oder Vorenthalten von Informationen) und Bestimmen von Zeit und Ort eines Gesprächs wird Macht konsolidiert (vgl. Meier 2002: 21). Führungskräfte messen der Kommunikation mit Gleichgestellten und Höherrangigen eine größere Bedeutung bei, da diese über einen höheren Status verfügen. Es wird dabei fast automatisch angenommen, dass Vorgesetzte kompetenter und fähiger sind als untergebene Kollegen[12], was sich u.a. in einem höheren Anteil an Redebeiträgen der Vorgesetzten ausdrückt. Richtung und Intensität von Kommunikation bemisst sich also zu einem großen Teil an Statusdifferenzen (vgl. Wahren 1987: 64f.).
Der Großteil interner Kommunikationsprozesse ist formell vorgegeben, regelgeleitet, dauerhaft und personenunabhängig (vgl. Meier 2002: 20):
Organisierte Kommunikationswege ergeben sich durch festgelegte Arbeitsabläufe und Organisationsmitglieder unterliegen qua ihrer eingenommenen Rollen verbindlichen Verhaltensnormen (vgl. Heini 2003: 125). Die Bildung von Zwangsgemeinschaften im Unternehmen – unabhängig von den eigenen Sympathien ist es obligatorisch, sich mit seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten zu arrangieren – erschwert die Kommunikation in diesem Kontext (vgl. Wahren 1987: 64). Die sprachliche Verständigung wird im formalen Handlungssystem eines Unternehmens durch Steuermedien (wie etwa Gruppensitzungen oder Besprechungen) entlastet und begrenzt (vgl. Kalmus 1998: 50f.). Das formale Kommunikationssystem bestimmt auch, welche Abteilungen miteinander kommunikativ in Verbindung treten müssen und dürfen, um ihre Ziele zu erreichen. Formelle Kommunikationsrichtlinien normieren kommunikative Stilfragen, z.B. wie bestimmte Stelleninhaber mit anderen zu kommunizieren haben. Dies wird in Kommunikationsdiagrammen festgehalten, die solche Fragen systematisch klären (vgl. Wahren 1987: 64). Das bedeutet, dass Konsens nicht nur kommunikativ hergestellt werden muss. Vielmehr kann man auf das Regelwerk der Organisation zurückgreifen, um ihn zu erzwingen. Die formalen Regeln entbinden die Organisationsmitglieder von vielen Verständigungs- und Interpretationsleistungen. (Vgl. Funke-Welti 2000: 26)
Informelle Kommunikation dient der zwischenmenschlichen Interaktion im Unternehmen:
Lange Zeit ging die Managementforschung davon aus, dass informelle Kommunikation dem Unternehmen schade. Mittlerweile ist man sich jedoch darüber einig, dass zwischen der für den Betrieb positiven informellen Kommunikation (dort wo normierte Kommunikationsregeln fehlerhaft oder unvollständig sind) und betriebsschädigender informeller Kommunikation (wie Klatsch und Gerüchte) unterschieden werden muss. (Vgl. Wahren 1987: 69; Kalmus 1998: 52, Sperka 1996: 22f.). Informelle Kommunikation macht ein Unternehmen insofern flexibler, als durch soziale Gespräche unzählige Querverbindungen hergestellt werden, die den betrieblichen Ablauf erleichtern und Defizite in der formalen Kommunikation kompensieren (vgl. Wahren 1987: 69, Sperka 1996: 23). Die Regeln informeller Kommunikation wachsen historisch und gelten als ungeschriebene Gesetze innerhalb eines Unternehmens, um den zwischenmenschlichen Umgang zu regeln (vgl. Warthun 1997: 29).
3.2. Der Einfluss von Nationalkultur auf Unternehmenskultur
Für den Sojourner ist es wichtig, die formellen und informellen Kommunikationsgepflogenheiten seines neuen Arbeitsumfeldes kennen zu lernen. Er muss diese sicher anwenden können, um erfolgreich mit anderen Unternehmensmitgliedern zu kommunizieren und seine Aufgaben souverän zu bewältigen. Die betriebliche Kommunikation steht in direkter Wechselwirkung zu der Unternehmenskultur, wird allerdings stark von der Nationalkultur des Unternehmens und der Mitarbeiter geprägt. Deshalb sollen hier die Einflussgrößen „Nationalkultur“ und „Unternehmenskultur“ zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Der konkurrierende Einfluss von Nationalkultur und Unternehmenskultur wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur kontrovers diskutiert (vgl. Graf 2004: 259). Mittlerweile besteht jedoch die Tendenz, National- und Unternehmenskultur als unterschiedliche Einflussfaktoren auf das Arbeitsverhalten zu verstehen, die nicht als isolierte Phänomene zu betrachten sind:
„Nationale oder überregionale Kulturen können in einem bestimmten Grad und Ausmass die Organisationskulturen als deren Kontext beeinflussen. Das wird schnell deutlich, wenn man beispielsweise Unternehmungen des asiatischen Raumes mit amerikanischen oder europäischen vergleicht. Dasselbe gilt auf der nationalen Ebene, wenn der Stil deutscher Unternehmungen von lateinisch-europäischen (französisch oder italienisch) unterschieden wird.“ (Heini 2003: 143)
Innerhalb eines Konzerns arbeiten Vertreter verschiedener Kulturen, die einerseits die Unternehmenskultur erlernt haben, sie aber gleichzeitig mit ihren individuellen, von der nationalkulturellen Herkunft geprägten Werten verändern (vgl. Hummel/Zander 2005: 50). Organisationsmitglieder bewegen sich auch außerhalb der Organisation und gehören mehreren weiteren kollektiven Gebilden an (vgl. Buhr 1998: 43). Durch die strukturelle Offenheit von Organisationen wirken somit auch kulturelle und soziale Einflüsse von außen (z.B. Landeskultur, Branchenkultur, Politik, Sozialsystem etc.) auf die Unternehmenskultur ein. Die Unternehmenskultur ist demnach in einen weiteren kulturellen Kontext eingebettet. (Vgl. Stüdlein 1997: 39)
Abb. 3-1 Einbettung der Unternehmenskultur in Branchen- und Nationalkultur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Stüdlein 1997: 34, in Anl. an Scheuss 1985: 87.
Im Folgenden soll nun näher auf die für das Arbeitsverständnis der Sojourners wichtigen Kontextfaktoren der Nationalkultur und der Unternehmenskultur eingegangen werden.
3.2.1. Nationalkulturelle Wertedimensionen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit kulturellen Wertdimensionen, die in wissenschaftlichen Kreisen weitgehend akzeptiert sind (vgl. Thieme 2000: 152). Sie dienen einem ersten, wenn auch stark vereinfachten Verständnis grundlegender Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Landeskulturen. Die hier dargestellten Arbeiten von Hofstede (2001), Hall (1976) und Lewis (2000) beschränken sich auf wenige zentrale Kulturaspekte und versuchen, diese auf interkulturelles Handeln zu übertragen. Daraus leiten sie Hinweise auf konkrete Interaktionssituationen ab und verwenden ihre Erkenntnisse für Vorschläge zur Problemminimierung interkultureller Kommunikation (vgl. Graf 2004: 41).
„Die mit Kulturanalysen beschäftigten Forscher setzen sich also überwiegend mit grundlegenden, an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Individuum angelagerten Zielzuständen auseinander, die von den Angehörigen einer bestimmten Kultur aufgrund eines allgemeinen, gesellschaftlich vorgegebenen Soll-Maßstabs als wünschenswert angesehen werden.“ (Wolf 1997: 158, in Anl. an Hondrich 1984: 73f.)
Der niederländische Sozialpsychologe Geert Hofstede konnte in einer breit angelegten kulturvergleichenden Studie zu organisationalen Werten in verschiedenen Ländern fünf verschiedene Kulturdimensionen isolieren, die das Verhalten am Arbeitsplatz maßgeblich beeinflussen (vgl. Hofstede 2001: xix). Die Studie wurde 1968 und 1972 mit ca. 116 000 Managern des IBM-Konzerns aus 72 Ländern durchgeführt und mittels umfangreichen quantitativen Analysen ausgewertet. Auf Basis der fünf Dimensionen konnten auf Werteskalen von 0-100 den 72 Ländern Punktzahlen für jede der Dimensionen zugeordnet werden. Sie ermöglichen es der Managementforschung, erste Anhaltungspunkte über die kulturellen Werte eines Landes zu erlangen (vgl. Stüdlein 1997: 195). Folgende Dimensionen wurden identifiziert und werden hier mit den respektiven Indexwerten Deutschlands und Spaniens dargestellt (vgl. Hofstede 2001; Stüdlein 1997: 193f.; Kutschker/Schmid 2005: 713ff.):[13]
1. Machtdistanz beschreibt das Ausmaß, in dem die weniger machtbefugten Mitglieder von Institutionen bzw. Organisationen eines Landes erwarten bzw. akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist. Eine hohe Machtdistanz bedeutet, dass Ungleichheiten in der Gesellschaft in hohem Maße akzeptiert werden. In Unternehmen drückt sich niedrige Machtdistanz in flachen Hierarchien und einem partizipativen Führungsstil aus (vgl. Hofstede 2001: 107). Deutschland (35) gehört neben Großbritannien und der Schweiz zum Drittel jener Länder, die nur geringe Machtunterschiede akzeptieren, wohingegen in Spanien (vergleichbar mit Südkorea und Griechenland) die Machtdistanz deutlich höher ausfällt (57) (vgl. ebd.: 87).
2. Unsicherheitsvermeidung meint das Ausmaß, bis zu dem Mitglieder einer Kultur sich in ungewissen und unbekannten Situationen beeinträchtigt oder bedroht fühlen. Auf kollektiver Ebene geht es darum, inwieweit eine Gesellschaft versucht, Risiken durch forcierte und allgemeingültige Regeln zu vermeiden. Im Unternehmen versucht man, durch klare und präzise Entscheidungen und einen hohen Formalisierungsgrad zukünftige Ereignisse zu kontrollieren. Risikoscheue Länder sind sowohl Deutschland (65) als auch in ausgeprägterer Form Spanien (85) oder Japan, während beispielsweise Länder mit englischer Kultur, Skandinavien und China zu den risikofreudigen Ländern zählen (vgl. ebd.: 151).
3. Individualismus vs. Kollektivismus bezeichnet den Grad, zu dem sich Individuen Gruppen zugehörig fühlen und über diese ihre Identität definieren. Betrachtet man die dichotomen Extreme, dient das Individuum in kollektivistischen Kulturen den Zielen seiner Gruppe oder Gesellschaft, während in individualistischen Kulturen die Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, die individuelle Entfaltung zu gewährleisten (vgl. Layes 2005a:118f.) Hofstede ordnet Nationalkulturen wie die USA, Kanada und eingeschränkt auch Deutschland (67) den individualistischen Kulturen zu, Spanien (51) befindet sich genau in der Mitte des Kontinuums, während Südkorea, Japan oder Ecuador eher zu den kollektivistischen Kulturen zählen (vgl. ebd.: 215).
4. Maskulinität vs. Femininität: Maskuline Kulturen legen besonderen Wert auf Trennung von Geschlechterrollen sowie auf bestimmte „harte“ und männliche Werte wie Ehrgeiz, Leistungsorientierung und Wettbewerbsbezogenheit. In femininen Kulturen überschneiden sich die Geschlechterrollen und es zählen „weiche“ und weibliche Werte wie Toleranz, Empathie, Feinfühligkeit und Bescheidenheit. Deutschland (66) ist tendenziell maskulin eingestuft worden, wie auch die Schweiz und die USA. Spanien (42) ist neben Frankreich und Portugal eher feminin eingestellt (vgl. ebd.: 286).
Die dargestellten Dimensionen verstehen sich als Kontinuum und dienen der Erklärung elementarer kultureller Verhaltensdifferenzen (vgl. Kutschker/Schmid 2005: 711). Obwohl sich die Studie auf ein relativ einfaches und positivistisches Kulturverständnis stützt (vgl. McSweeney 2002: 89ff.), das dem symbolischen Kulturverständnis dieser Arbeit nur partiell gerecht wird und Schwächen in ihrer methodologischen Konzeption offenbart (wie z.B. mangelnde Trennschärfe bei Praktiken und Werten) (vgl. Mauritz 1996: 181), gehört sie aufgrund ihrer Bandbreite zu den meistrezipierten Werken interkultureller Managementforschung (vgl. ebd.: 189). Problematisch zu betrachten sind eventuell fehlende Dimensionen[14] und das hohe Alter des Datenmaterials. In Anbetracht der Untersuchung dieser Arbeit liegt auf der Hand, dass sich das frankistische Spanien und das durch die 68er-Bewegung geprägte Deutschland der späten 60er Jahre mittlerweile in vielen Wertdimensionen verändert haben.
In der Forschung wurden weitere dichotom angelegte Dimensionen herausgearbeitet, die Hofstedes Erkenntnisse ergänzen. Zu nennen wäre hier Hall, der bei seiner Untersuchung kulturell divergenter Kommunikationsarten auf die Erkenntnis stieß, dass Kommunikation in unterschiedlichem Maße Bezug auf ihren Kontext nimmt (vgl. Hall 1976). Die Bezugnahme auf den Kontext ist kulturabhängig und kann daher zur Erklärung interkultureller Differenzen herangezogen werden. Hall unterscheidet zwischen High-Context - und Low-Context -Kulturen (vgl. Hall/Hall 1990: 6ff.):
1. High-Context -Kommunikation stützt sich darauf, dass ein Großteil der Information entweder durch den physischen Kontext gegeben oder schon in den Interaktionspartnern internalisiert ist. Durch enge persönliche Beziehungen, eine unscharfe Trennung von privaten und geschäftlichen Kontakten und ein breites Informationsnetzwerk sind alle Beteiligten bereits so umfassend informiert, dass sie für die normale und alltägliche Interaktion wenige Hintergrundinformationen benötigen (Dialogorientiertheit, vgl. Lewis 2000: 59). Aussagen betten sich in diesen breiten Informationskontext ein und sind nicht immer wörtlich zu verstehen: „In these cultures, determining a person’s reliability, credibility or veracity is judged more by what people do, than by what is said“ (Copeland/Schuster 1996: 146).
2. Low-Context -Kommunikation ist in Kulturen verbreitet, die ihre persönlichen und berufliche Beziehungen strikter voneinander trennen und größeren Wert auf Privatsphäre und Distanz legen. Dadurch sind ihre Mitglieder kontextuell weniger informiert und integrieren mehr explizite Informationen in ihre Botschaften. Um sich zu informieren, sammeln ihre Mitglieder solide Daten und stützen sich bei ihrem Vorgehen auf das so angesammelte Wissen (vgl. Lewis 2000: 59). Man kann diese Kulturen auch als datenorientiert bezeichnen.
Eine weitere dichotome Unterscheidung trifft Hall bezüglich des kulturell divergenten Zeitverständnisses, das je nach Kultur monochron oder polychron ist (vgl. Hall/Hall 1990: 13ff.):
3. In monochronen Kulturen wird Zeit linear verwendet und in Einzelsegmente unterteilt: „[I]t is scheduled and compartmentalized, making it possible for a person to concentrate on one thing at a time. In a monochronic system, the schedule may take priority above all else and be treated as sacred and unalterable“ (ebd.: 13). Für monochron agierende Personen steht im Vordergrund, Aufgaben zeit- und anforderungsgerecht zu erledigen: „Zeitmanagement gilt damit als Vorraussetzung für effektives Handeln überhaupt […]“ (Schroll-Machl 2005: 77). Es besteht ein Zusammenhang zwischen Low-Context -Kulturen und einem monochronen Zeitverständnis, da der zwischenmenschliche Umgang von strikten Zeitplänen beeinflusst wird. So wird Zeit zu einer Art Raum, den nur manche Personen betreten dürfen (vgl. Hall 1990: 14) und erhält großen Symbolwert: Nur wichtigen Dingen oder Personen wird Zeit eingeräumt (vgl. Schroll-Machl 2005: 77). Dies verringert das Ausmaß, in dem verschiedene Personen miteinander involviert sind und somit auch deren Informationsstand über das sie umgebende soziale Netz.
4. Polychrone Kulturen können als Antithese dazu verstanden werden. Ihre Mitglieder sind es gewohnt, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun und sich intensiv auf andere Menschen einzulassen. Zeit gilt in diesen Kulturen als dehnbar und abhängig von der Bedeutung einer Handlung. Zeitpläne werden zwar erstellt, aber beliebig nach hinten verschoben. Die Beziehungen zu anderen Menschen stehen hier im Vordergrund.
Lewis Unterscheidung zwischen linear-aktiven, multi-aktiven und reaktiven Kulturen[15] verbindet die Kontext- und Zeitdimension Halls miteinander in einer Aktivitätsdimension und wendet sie spezifisch auf das Berufsleben an (vgl. Lewis 2000: 50f.). Dabei werden Spanier, Portugiesen und Italiener als Mittelmeervölker den multi-aktiven Kulturen zugeordnet, während Deutsche neben Schweizern, US-Amerikanern und Skandinaviern als linear-aktive Kulturen verstanden werden. Wie Hall charakterisiert Lewis Mitglieder multi-aktiver Kulturen als personenbezogen und flexibel in ihrem Zeitmanagement. Der persönliche Kontakt und eine Vielzahl von Beziehungen sind für sie wichtiger als das strikte Einhalten von Zeitplänen und Terminen. Defizite im Planungsverhalten werden durch die Fähigkeit ausgeglichen, mehrere Aktivitäten parallel durchführen zu können und sie so lange zu verfolgen, bis sie zu einem zufrieden stellenden Ergebnis geführt worden sind. Diese Einstellung bedingt auch einen hohen Grad an Spontaneität und die Neigung zu kreativen Planänderungen sowie Strategieanpassungen bei auftretenden Fehlern. Soziales und Berufliches werden eng verknüpft und Aufgaben an Freunde und Bekannte delegiert. Copeland und Schuster (1996: 149) erwähnen in diesem Zusammenhang, dass in mediterranen Ländern Emotionen direkt und offen gezeigt werden. Dies drückt sich oftmals in lautstarken und langen Diskussionen aus, bei denen jedoch ein taktvolles Auftreten bewahrt wird. Deswegen ist z.B. in Spanien direkte Kritik an einer anderen Person unangemessen, da sie zwischenmenschliche Beziehungen gefährden könnte (vgl. Helbing 2004: 32).
Mitglieder linear-aktiver Kulturen legen großen Wert auf eine schrittweise und geordnete Arbeitsweise, was sich mit der Einstellung verbindet, durch eine genaue Befolgung von Zeitplänen effizienter arbeiten zu können. Dadurch konzentrieren sie sich nur auf eine Tätigkeit und zerlegen Projekte in zeitliche Einzelsegmente. (Vgl. Lewis 2000: 68) Zeit gilt als knappe Ressource und Meetingabläufe werden mittels einer Agenda straff durchorganisiert (vgl. Warthun 1997: 51). Das Denken ist eher aufgaben- und faktenorientiert und das Zuhörverhalten datenorientiert: Entscheidungen werden auf soliden Fakten aufgebaut (vgl. Kumbruck/Derboven 2005: 14). Das Auftreten ist sachlich und regelgeleitet, bürokratische Ordnungen werden befolgt (vgl. Schroll-Machl 2005: 75). Durch einen reservierten und taktvollen Konversationsstil werden Emotionen kontrolliert und Meinungsverschiedenheiten können offen diskutiert werden (vgl. Copeland/Schuster 1996: 149).
Mediterrane Völker werden den Dimensionen High-Context (dialogorientiert), polychron und multi-aktiv zugeordnet (vgl. Copeland/Schuster 1996, Hall/Hall 1990, Lewis 2000). Dennoch gilt festzuhalten, dass sie sich relativ flexibel auf die monochrone Zielorientiertheit der Nord- oder Mitteleuropäer einstellen können, sobald sie mit diesen zusammenarbeiten (vgl. Hall/Hall 1990: 137).
Auch wenn Konflikte zwischen Kulturtypen mit unterschiedlichen Dimensionsausprägungen programmiert scheinen, könne beide n bei lang anhaltendem Kontakt voneinander lernen. So betont Lewis, dass die Einhaltung von Zeitplänen multi-aktiven Menschen dazu dienen kann, Ziele zu klären und Effizienz zu kontrollieren. Auf der anderen hilft die multi-aktive Flexibilität „Linear-Aktiven“ dabei, dynamischer und anpassungsfähiger auf unvorhergesehene Störungen im Planungsablauf zu reagieren (vgl. Lewis 2000: 51f.).
Die vorgenommene Darstellung wird von Lewis als stereotypes Raster angelegt, das dem Ziel einer ersten Annäherung dient, ohne jedoch allgemeingültigen Charakter zu haben: Um ein Grundverständnis über kulturelle Unterschiede zu erlangen, sind stereotype Zuordnungen hilfreich, wobei die Begrenztheit dieser Unterscheidungen nicht übersehen werden darf (vgl. Kumbruck/Derboven 2005 13).
Wie die hier vorgestellten Grunddimensionen von Hofstede, Hall und Lewis für Deutschland und Spanien zugeordnet werden können, ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
Tab. 3-1 Deutschland und Spanien im Kulturdimensionenvergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung nach Hall/Hall 1990, Hofstede 2001 und Lewis 2000.
Kritisch betrachtet verallgemeinern die Autoren der hier dargestellten Kategorisierungsansätze ihre Aussagen sehr stark. Sie setzen nicht nur Kulturgrenzen mit Ländergrenzen gleich, sondern identifizieren sogar Kulturcluster über ganze Ländergruppen hinweg.[17] Die unzähligen Varianzmöglichkeiten kultureller Grundwerte auf individueller oder Gruppenebene werden ebenso wenig berücksichtigt, wie entscheidende Persönlichkeits-, Identitäts- oder Erfahrungsvariablen.
Es kann festgehalten werden, dass die vorgestellten Autoren in großer Übereinstimmung deutliche kulturelle Unterschiede zwischen beiden Ländern festgestellt haben, wie in der obigen Tabelle abzulesen ist. Diese Unterschiede existieren unabhängig vom Komplexitätsniveau ihrer Beschreibung und könnten ursächlich sein für viele Interaktionsprobleme zwischen Deutschen und Spaniern. Aus diesem Grund sollen sie in die Untersuchung einfließen, jedoch in der Auswertung mit der gebotenen Distanz kritisch hinterfragt werden.
Halls Kontext- und Zeitdimension und Hofstedes Kollektivitäts- und Unsicherheitsdimension werden in der Untersuchung aus Vereinfachungsgründen der Aktivitätsdimension von Lewis zugeordnet: Die Aktivitätsdimension schließt diese aufgrund ihrer breiteren Auslegung ein. Des Weiteren stellt Lewis besonders deutlich die Unterschiede zwischen mediterranen und nordeuropäischen Kulturen heraus. Sollten sich die in der Untersuchung festgestellten kulturbedingten Interaktionsprobleme nicht mittels der Aktivitätsdimension erfassen lassen, wird entsprechend Bezug zu den hier vorgestellten Einzeldimensionen genommen.
3.2.2. Unternehmenskultur
In den Ausführungen zum Kulturbegriff wurde gezeigt, dass Kultur ein Phänomen sozialer Gruppen oder Kollektive ist (vgl. Hansen 2000). Unternehmen gelten im Regelfall als konservative gesellschaftliche Subkulturen, da sie sich stark an der sie umgebenden Kultur orientieren und auf gesellschaftlich breit akzeptierte Verhaltensweisen und Etikette wert legen (vgl. Hummel/Zander 2005: 180).
Die Literatur bezieht sich bei der Beschreibung von Unternehmenskultur häufig auf das breitere Konstrukt der „Organisation“, wobei ähnliche Wirkungsprinzipien identifiziert werden. Unternehmen gelten dabei als umsatzorientierte Variante sozialer, gesellschaftlicher Organisationen (vgl. Krulis-Randa 1990: 13). Die Unterscheidung zwischen Unternehmen und Organisation ist für diese Arbeit nicht relevant: Deshalb sollen die beiden Begriffe hier synonym verwendet werden.
Moderne Unternehmen präsentieren sich als komplexe und in sich widersprüchliche soziale Entitäten, die zwar einerseits relativ wertestabil, andererseits aber durch dynamische Veränderungsprozesse einem steten Wandel ausgesetzt sind (vgl. Farace et al. 1977: 19). Dabei kommt gerade dem soziokulturellen Aspekt eine zentrale Bedeutung zu, da er die divergenten Interessen und Handlungsweisen der Organisationsmitglieder bändigt (vgl. Schuh 1989: 29).
Die Unternehmenskulturforschung untersucht den soziokulturellen Einfluss anhand folgender Frage: Hat eine Organisation eine Kultur oder ist sie eine Kultur? Erstere Annahme basiert auf der objektivistisch-funktionalistischen Organisationskulturforschung und versteht Kultur als eine weitere, wenn auch vielschichtige Variable in der Organisation, die gleichberechtigt neben anderen Variablen wie Größe, Technik, Art der Spezialisierung usw. steht (vgl. Prabitz 1996: 156). So kann bspw. Kultur als Korrektiv für die Schwächen existierender Sicht- und Verhaltensweisen verstanden werden (vgl. ebd.: 157). Aus dieser Perspektive wird versucht, das Einmalige, Typische und Besondere eines Unternehmens herauszuarbeiten (vgl. Schuh 1989: 31). Vertreter des subjektivistisch-interpretativen Paradigmas hingegen sehen eine Organisation selbst als Kultur an, und begreifen sie als expressive Manifestation menschlicher Interaktion (vgl. ebd.: 32). Organisationen sind somit ein Stück subjektive Realität, die durch symbolische Handlungen und Diskurse entsteht (vgl. ebd. 33). Das symbolische Verständnis von Organisationskultur wird von Schein (1995) folgendermaßen präzisiert:
„Ein Muster gemeinsamer Grundannahmen (-prämissen), das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit diesen Problemen weitergeben wird.“ (Schein 1995: 28)
Dieses Kulturverständnis bindet neben der evaluativen (Werte und Normen betreffenden) und kognitiven (Überzeugungen und Wissen betreffenden) Dimension auch die dingliche (Verhaltensmuster und Technologien betreffende) Dimension ein (vgl. Kasper 1987: 7). Es bietet somit einen holistischen Erklärungsansatz, der alle Wirkmechanismen in einer Organisation durch ihre Kultur erklärbar macht.
Aufbauend auf seiner Definition legt Schein (1995) ein Modell für Unternehmenskultur vor, das zwischen drei Analyseebenen unterscheidet: 1) Artefakte, 2) bekundete Werte und 3) Grundprämissen.
Abb. 3-2 Drei Ebenen der Kultur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anl. an Schein 1995: 30.
Die sicht-, hör- und fühlbaren Aspekte menschlichen Verhaltens, Handelns und Interagierens sind deren materieller Ausdruck und werden von Schein als kulturelle Artefakte bezeichnet (vgl. Schein 1995: 30f.). Dazu zählt Sprache, weil sie Symbole verbalisiert, aber auch Architektur, Technologie und Produkte sowie der Stil eines Unternehmens. Des Weiteren zählt Schein kollektive Handlungsmuster wie Rituale, Zeremonien und Feiern, wie auch Manifestationen kollektiver Denkmuster dazu (in Form von Geschichten, Mythen, Legenden etc.) (vgl. Alvesson/Berg 1992: 78). Artefakte sind oberflächlich und leicht erkennbar, aber auch schwer zu entschlüsseln, da sie nur sehr indirekt Auskunft über latente und oft mehrdeutige symbolische Bedeutungen geben (vgl. Schein 1995: 30f.). Um sie zu verstehen, müssen Kenntnisse über dahinter liegende Werte[18] und Grundprämissen (s.u.) vorhanden sein. Die Wichtigkeit von Artefakten bei der Kulturanalyse darf jedoch keinesfalls unterschätzt werden, da sie auch diffuse, anders nicht kommunizierbare Erfahrungen materiell greifbar machen können. Für Geertz (1983) sind Artefakte „not necessarily illustrations of conceptions already in force, but equally primary documents […] which materialize a way of experience and of feeling“ (Gagliardi 1990: 28).
Auf der darunter liegenden Wahrnehmungsebene sind die bekundeten Werte verortet (vgl. Schein 1995: 31f.). Sie beeinflussen Normen[19], worunter auch Richtlinien und Verbote fallen, sowie Einstellungen[20]. Bekundete Werte sind meist unbewusst, aber bewusstseinsfähig Sie wachsen historisch und entwickeln sich dadurch, dass einzelne Personen die Gruppe von der Effektivität einer Vorgehensweise oder von bestimmten Problemslösungsstrategien überzeugen können. Wird dieses Vorgehen als wirksam eingestuft, kann es von der Gruppe übernommen werden und ein Wert entsteht. Dabei können die hier aufgeführten Werte durchaus widersprüchlich sein und nicht zum beobachteten Verhalten passen. Ein Unternehmen kann bspw. in dem Konflikt stehen, einerseits Gewinnmaximierung und leistungsbezogene Konkurrenz als bekundeten Wert zu haben und andererseits den Anspruch haben, einen humanistischen und sozialen Umgang mit seinen Mitarbeitern zu pflegen. In diesem Fall stellen Werte lediglich angestrebte Ziele oder rationale Erklärungen dar. Erst durch Erschließen der dahinter liegenden Prämissen werden solche Widersprüche verstehbar.
[...]
[1] Kulturfremde Mitarbeiter werden im Folgenden als Sojourners bezeichnet. Der Begriff Sojourner wird hier aus der englischsprachigen Literatur in Ermangelung eines deutschen Terminus technicus übernommen und bezeichnet Personen, die sich übergangsweise und freiwillig über einen undefinierten Zeitraum im Ausland aufhalten (vgl. Ward 2001 et al.: 142). Darunter werden hier einerseits entsandte Expatriates und andererseits ausländische Mitarbeiter, die vor Ort eingestellt wurden, gefasst. Expatriates haben eine besondere Stellung, da sie zumeist Führungskräfte sind, die das Stammhaus vertreten, um Strategieanpassungen zu koordinieren und Know-how in die Tochterunternehmen zu transferieren (vgl. Stahl 1997: 10ff.). Bei speziellen Hinweisen auf diese Gruppe soll deshalb auf den Begriff des Expatriates zurückgegriffen, ansonsten allgemein von Sojourners gesprochen werden.
[2] Der Kulturrelativismus basiert auf der Annahme, „daß alle Kulturen je individuelle, einzigartige, daher nicht vergleichbare Selbstwertgrößen darstellen, die sich allein aus ihren eigenen Voraussetzungen heraus begreifen lassen, d.h. weder legitim noch zureichend von anderen beurteilt werden können [Herv. i.O.]“ (Müller 1998: 41).
[3] „When linguists became able to examine critically and scientifically a large number of languages of widely different patterns, […] they experienced an interruption of phenomena hitherto held universal, and a whole new order of significances came into their ken. It was found that the background linguistic system […] of each language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself a shaper of ideas.“ (Whorf 1956: 212)
[4] Eine typische Mischform ist die Hybridisierung, also das kulturellen Borgen und Aneignen fremder Symbolstrukturen (vgl. Brandstetter et. al. 2004: 88).
[5] „Symbols are objects, acts, relationships or linguistic formations that stand ambiguously [Herv. i.O.] for a multiplicity of meanings, evoke emotions, and impel men to action“ (Cohen 1976: 23; zit. nach Gagliardi 1990: 8).
[6] Die idealistisch-organische Kulturperspektive versteht Kultur im Gegensatz zum Kulturrealismus als Gedankensystem, das nicht direkt beobachtbar ist. Kulturartefakte sind hier nicht als Manifestation materieller Kultur zu verstehen, sondern als Ausdruck von konzeptionellen Ideen und Symbolsystemen. Organisch ist diese Perspektive deshalb, weil sie Kultur als eine an den Menschen gebundene Bedingung des Lebens definiert, anstatt Kultur als eigenständig und unabhängig vom Menschen anzusehen (supraorganische Interpretation). Der Kulturrealismus hingegen versteht Kultur in Sinne menschlicher Anpassung an materielle Zwänge der Umwelt. Danach wird das Überleben einer sozialen Gruppe durch die Erschaffung sozialer Organisationsformen, Denkweisen, Ideologien und Verhaltensweisen gesichert. (Vgl. Mauritz 1996: 12ff.)
[7] Z.B. das Coordinated Management of Meaning (CMM) nach Pearce/Kronen (1980) (vgl. Theis-Berglmair-Berglmair 2003: 100ff.).
[8] Benjamin Whorf hatte zusammen mit Edward Sapir die Relativität von Sprache und deren Zusammenhang mit kulturellen Differenzen untersucht, was Hall auch auf nonverbale Kommunikation übertrug (vgl. Rogers/Steinfatt 1999: 65).
[9] Z.B. The International and Intercultural Communication Annual oder das International Journal of Intercultural Relations (vgl. Asante/Gudykunst 1989: 7f.)
[10] Kollektive werden von der englischsprachigen Literatur in Out-Groups und In-Groups unterteilt. Out-Groups sind dabei all jene Kollektive, denen ein Individuum nicht angehört, wohingegen In-Groups die Kollektive darstellen, zu denen sich das Individuum zugehörig fühlt. (Vgl. z.B. Gudykunst/Ting-Toomey 1988: 205ff.) Dies sei hier angemerkt, weil im empirischen Teil der Arbeit diese Begriffe erscheinen werden.
[11] Führungskräfte verwenden den Hauptteil ihrer Arbeitszeit für verbale Kommunikation und stellen mittels Kurzgesprächen und Telefonaten eine Vielzahl von Verbindungen im Unternehmen her. Untersuchungen taxieren den Anteil verbaler Kommunikation von Führungskräften auf 50 bis 90% der Gesamtarbeitszeit. (Vgl. Wahren 1987: 50)
[12] Wazlawick (1969) nennt das Verhältnis Vorgesetzter-Untergebener komplementäre Interaktion, ein spiegelbildliches Verhältnis (Mitarbeiter–Mitarbeiter) hingegen bezeichnet man als symmetrische Interaktion (vgl. Sperka 1996: 25).
[13] 0 = niedrigste Ausprägung, 100 = höchste Ausprägung.
[14] Hofstede ging ursprünglich nur von den ersten vier Dimensionen aus. Diese erklärten jedoch nur 49% der empirisch erhobenen Varianz: Sie deckten viele, aber nicht alle kulturellen Unterschiede ab. Erst in einer Folgestudie wurde die fünfte Dimension der Langfrist-/Kurzfristorientierung hinzu genommen. (Vgl. Kutschker/Schmid 2005: 711ff.) Diese fünfte Dimension stellt v.a. Unterschiede zwischen asiatischen und westlichen Ländern heraus und soll deshalb hier nicht betrachtet werden.
[15] Reaktive Kulturen sind besonders asiatischen Ländern wie Japan zuzuordnen (vgl. Lewis 2000: 54) und werden deshalb hier nicht dargestellt.
[16] Wertungen zwischen 0 und 34 werden hier als ‚niedrig“, zwischen 35 und 45 als ‚moderat niedrig“, zwischen 46 und 55 als ‚mittel“, zwischen 56 und 65 als ‚moderat hoch“ und zwischen 66 und 100 als ‚hoch“ eingestuft.
[17] Problematisch an dieser Zuordnung ist nicht nur die Bündelung mehrerer Länder und somit ihre kulturelle Gleichbehandelung, sondern auch die Nichtbeachtung regionaler Unterschiede. Auf einem Multi-Aktivitätsindex würden bspw. Katalanen aus Nordostspanien einen wesentlich niedrigeren Wert erhalten als Andalusier aus Südspanien. Dieses Phänomen weist augenscheinlich Parallelen zu den Unterschieden zwischen Nord- und Süditalienern auf (vgl. Lewis 2000: 52).
[18] Werte sind nicht-gegenstandsbezogene Orientierungspunkte auf hohem Abstraktionsniveau. Sie haben handlungsleitenden Charakter in konkreten Situationen und sind die Basis für gegenstandsbezogene Einstellungen (vgl. Kutschker/Schmid 2005: 681).
[19] Normen sind als kollektive Handlungsmaxime zu verstehen, „die als zielorientierte Anweisungen das Handeln von Menschen und von sozialen Gruppen regeln bzw. regulieren. […] Mit Shaw (1971, S. 247) können Normen zusammenfassend als Verhaltensregeln definiert werden, die zu einer Verhaltenskonsistenz mehrerer Gruppenmitglieder führen sollen und deren Mißachtung zumeist mit Sanktionen verbunden ist.“ (Kasper 1987: 7)
[20] Einstellungen sind konkreter und kurzfristiger als Werte und bezeichnen das Verhältnis zu bestimmten Situationen, Handlungen oder Personen. Dabei können Individuen sich positiv oder negativ, ablehnend oder befürwortend in einer bestimmten Situation verhalten. Eng verbunden mit Einstellungen sind Affektionen und Emotionen. (Vgl. Kutschker/Schmid 2005: 681)
- Arbeit zitieren
- Dominik Daling (Autor:in), 2006, Interkulturelle Kommunikation in der internationalen Unternehmung - Akkulturation und interkulturelle Kompetenz am Beispiel deutscher Mitarbeiter in Spanien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57812
Kostenlos Autor werden





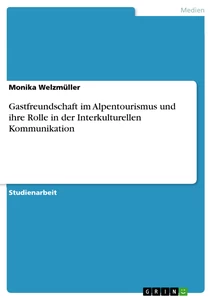
















Kommentare