Leseprobe
Inhalt:
1. Einleitung
2. Zustand von Boliviens Gesellschaft und Politik
2.1. Sozialer und wirtschaftlicher Kontext
2.2. Politische Strukturen
2.3. Die Doppelte Transformation – Reformen 1993-
2.4. Indígenas in Politik und Gesellschaft
3. Krise der Demokratie – Proteste und Unruhen seit
3.1. Die Ursachen: Exklusion, Coca, Gas und Indígenas
3.2. Die Oppositionsbewegung am Beispiel zweier Protagonisten: Evo Morales und Felipe Quispe (El Mallku)
3.3. Neue Akteure und Akteursstrukturen
4. Politische Veränderungen als Folge der Krise
4.1. Politische Projekte der neuen Regierung
4.1.1. Referendum zum Gas
4.1.2. Kommunalwahl mit neuem Wahlgesetz
4.1.3. Verfassunggebende Versammlung
4.2. Eine neue Demokratie für Bolivien
5. Fazit
6. Literatur
1. Einleitung
Seit 1985 galt Bolivien zunächst als hoffnungsvolles Beispiel eines Entwicklungslandes, das sich trotz vieler Probleme als relativ stabile Demokratie erwies und strukturelle Reformen zur Entwicklung des Landes anging. Langfristig erfolgreich war dieser Weg wohl nicht, macht Bolivien doch seit 2000 vor allem wegen einer Welle immer wieder eskalierender, auch blutiger, Unruhen von sich reden. Auf dem Höhepunkt der Proteste wurde der Präsident Sánchez de Lozada im Oktober 2003 aus Amt und Land verjagt. Diese Proteste werden oft als größte Krise Boliviens seit Wiedereinführung der Demokratie 1982 und als Gefahr für diese bezeichnet, vor allem aber werden sie in ihrem Charakter fast ausschließlich als Ausschreitungen dargestellt.
Diese Arbeit wird versuchen, die Auseinandersetzungen in einem etwas anderen Licht und mit ihren Ursachen und Folgen umfassender zu betrachten. Die zentrale These der Arbeit lautet, dass sich Bolivien in einem Transformationsprozess der Demokratisierung befindet, der als Antwort auf die Krise deren Ursachen bekämpfen soll.
Zur Argumentation wird zunächst Boliviens Ausgangslage anhand der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Situation, der besonderen Phase der Reformen Mitte der 90er Jahre sowie anhand der Stellung der Indígenas als wichtiger Bevölkerungsgruppe der Gesellschaft dargestellt. Darauf aufbauend werden im dritten Abschnitt die Ursachen, die Akteure und deren Forderungen in den Protesten seit 2000 genauer untersucht, um den Charakter der Aufstände erkennen zu können. Dabei wird in der sozialen und politischen Exklusion großer Bevölkerungsteile die Hauptursache der Unruhen identifiziert. Im vierten Abschnitt werden die bereits erfolgten und möglichen absehbaren politischen Folgen der Proteste mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Debatte um eine Erneuerung der Demokratie in Bolivien analysiert, sowie die Anforderungen an den Transformationsprozess aufgezeigt. Dabei wird deutlich, dass eine Demokratisierung im Sinne einer Integration bisher marginalisierter Schichten und ihrer Kulturen die Voraussetzung für ein stabiles und friedliches Bolivien ist. Abschließend wird die These überprüft und ein Fazit gezogen.
2. Zustand von Boliviens Gesellschaft und Politik
2.1. Sozialer und wirtschaftlicher Kontext
Bolivien ist auch nach fast zwei Jahrzehnten als „Musterschüler“ ökonomischer Reformen nach Haiti das ärmste Land Mittel- und Südamerikas, das Pro-Kopf-Einkommen lag 2002 bei US$2460 (in Kaufkraftparität, vgl. UNDP 2004). Nach umfangreichen neoliberalen Reformen war das Wirtschaftswachstum ab 1990 relativ hoch, nach 1999 aber pro Kopf negativ (vgl. Quiroga 2002: 166). Vor allem reichte es nicht aus, um genügend Arbeitsplätze zu schaffen und ließ nur eine kleine Oberschicht davon profitieren. Als das politische System und die Reformen delegitimierend wird vor allem die große und in den 90er Jahren noch gewachsene Ungleichheit in der Gesellschaft angesehen. Bolivien hat eines der weltweit höchsten Niveaus an Einkommensungleichheit (vgl. Spanger/Wolff 2003: 29). Damit steht das Land in der ambivalenten Position, zugleich Musterschüler der internationalen Entwicklungspolitik (gewesen) und Armenhaus Südamerikas zu sein. Zuletzt wurden im Rahmen der Armutsbekämpfung auch auf den Entschuldungsprozess HIPC II[1] große Hoffnungen gesetzt, die jedoch bereits an vielen Stellen enttäuscht wurden. So wird schon jetzt ein neuer Rekord der Schuldenbelastung erwartet, sowie die mangelnde Effizienz der Programme und die unzureichende Einbindung der Zivilgesellschaft kritisiert.
Die indigene Bevölkerung stellt mit über 60% die Mehrheit, ist dabei als Gruppe aber sehr heterogen. Sie spaltet sich zunächst in Aymara, Quechua und über 30 kleineren anderen Völkern (v. a. Guaraní) auf (vgl. Wolff 2004: 25). Stark unterschiedliche Interessen ergeben sich aber vor allem zwischen beispielsweise Hochlandbauern auf dem Altiplano, Cocabauern (vor allem in den Yungas und dem Chapare), vom Handel profitierenden aufstrebenden urbanen Indígenas in den Städten und den Campesinos im Tiefland und im Amazonasbecken. Jenseits des Gefühls der Ausgeschlossenheit verbindet diese Interessengruppen relativ wenig.
62,7% der Bolivianer leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze, 34,3% von weniger als $2 pro Tag (vgl. UNDP 2004:10). Besonders betroffen sind die Landbevölkerung, Indígenas, Frauen und informell Arbeitende, „all of whom have historically suffered from discrimination” (León et al. 2003: 3). Bedeutend für Bolivien ist das Ausmaß sozialer und politischer Exklusion, die mit Armut in einer wechselseitigen Beziehung steht – beide bedingen sich gegenseitig. Exklusion definieren León et al. (2003) als eine sehr geringe „institutional consumption“ eines Individuums, welches also seine Rechte, Ansprüche und Pflichten nur in sehr geringem Maße wahrnehmen kann. Ursachen dafür sind in Bolivien Diskriminierung, ungleiche Infrastruktur (z. B. schlechte Bildungseinrichtungen und mangelhafte Gesundheitsversorgung auf dem Land), Informationsasymmetrien, Korruption und fehlende Papiere vieler Menschen[2]. „Arm sein“ ist mit 42% die von Bolivianern am häufigsten genannte Ursache ungleicher Behandlung (vgl. Latinobarómetro 2004: 36). So erstaunt es nicht, dass die Wirtschaft (bis auf den informellen Bereich) und das politische System noch fest in der Hand der weißen urbanen Elitenminderheit sind.
2.2. Politische Strukturen
Bolivien war lange Zeit das wohl putschfreudigste Land des Kontinents, allein in den viereinhalb Jahren vor Rückkehr zur Demokratie im Jahre 1982 kamen neun Präsidenten an die Macht (vgl. Mesa 2001: 368). Demgegenüber galt Bolivien nach 1985 als unerwartet stabil, trotz enormer ökonomischer Schwierigkeiten gab es seitdem nur verfassungskonforme Regierungswechsel.
Boliviens Verfassung sieht ein „parlamentarisches Präsidentialsystem“ (vgl. Mayorga 2002) vor. Der Präsident wird direkt gewählt, allerdings findet, falls kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, die Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten im Parlament statt. Da in Bolivien ein Mehrparteiensystem besteht und seit 1985 kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderlichen Stimmen erhielt, sorgte dieses eher ungewöhnliche Konzept für positive Anreize zur Kooperation zwischen den Parteien und eine Verbindung zwischen Legislative und Exekutive, da zur Wahl des Präsidenten koalitionsähnliche Absprachen der Parlamentsparteien notwendig werden. So wird die dem Präsidentialsystem eigene und in Lateinamerika sehr verbreitete, zu Blockaden führende Konfrontationsstellung zwischen den beiden Gewalten vermindert. Die Macht des Präsidenten, mit Dekreten am Parlament vorbei zu regieren, darf dabei nicht unterschätzt werden. Die Legislative besteht aus dem Senat mit 27 Senatoren (drei aus jedem Departamento) und dem Abgeordnetenhaus mit 130 Parlamentariern, die als Direktkandidaten in 68 Wahlkreisen oder über geschlossene Listen der Departamente (ähnlich dem deutschen System) gewählt werden (vgl. ebd.: 236f).
Die Parteien genießen in Bolivien einen schlechten Ruf. Sie sind zwar tragender und unterstützender Bestandteil des politischen Systems und haben viel dazu beigetragen, dass Boliviens Regierungen seit 1985 erstaunlich stabil und regierbar waren (vgl. Mayorga 2002: 222f). In der Bevölkerung genießen sie aber extrem wenig Rückhalt. So nannten auf die Frage, welche Partei sie bei einer Wahl am nächsten Sonntag wählen würden, nur 24% der Befragten konkret eine Partei, der niedrigste Wert ganz Lateinamerikas (vgl. Latinobarómetro 2004: 30). Durch ihre Unfähigkeit, sich von innen heraus zu erneuern und neues Führungspersonal zu rekrutieren, haben es die Parteien nicht geschafft, gesellschaftliche Interessen in die Politik einzubringen. Die inneren Strukturen sind sehr autoritär, meist auf die Gründungsperson zugeschnitten und können die seit 1999 existierende gesetzliche Auflage nach innerparteilicher Demokratie nicht erfüllen (vgl. Mayorga 2002: 255f). Ein weiteres großes Problem in Bolivien ist die Korruption: Auf der Skala von 0 (extrem korrupt) bis 10 (korruptionsfrei) des TI-Korruptionsindex erreicht Bolivien nur 2,2 Punkte, nach Paraguay und Haiti der schlechteste Wert des Subkontinents. 2001 bildete es mit 2,0 Punkten gar das Schlusslicht (vgl. Transparency International 2001, 2004).
Gängige Demokratie-Indikatoren hingegen geben Bolivien vorwiegend gute Werte. Bei Freedom House gilt Bolivien seit 2003 nur noch als weitgehend frei, doch erreichte es zwischen 1997 und 2001 bei „political rights“ sogar den bestmöglichen Wert[3]. Der „Polity IV Index“ erklärt Bolivien sogar für sehr demokratisch (vgl. Wolff 2004: 41). Ein etwas anderes Bild ergibt sich allerdings mit den Weltbank-Indikatoren für Good Governance, bei denen Bolivien mittelmäßig bis schlecht abschneidet[4]. Diese standardisierten Indikatoren vermögen jedoch oft nicht die komplexe Realität zu erfassen, und so wird eine qualitative Analyse differenzierter bzw. negativer urteilen. Wolff unterscheidet dabei zwei wichtige Problemdimensionen: Defizite demokratischer Verfahren (Input-Legitimität) und Defizite demokratischer Performanz (Output-Legitimität)[5]. So scheinen die oben erwähnten Indikatoren zunächst nur zu bestätigen, dass Bolivien das prozedurale Minimum einer Demokratie erfüllt, doch sei hier nochmals auf die Probleme der Exklusion und der fehlenden Papiere verwiesen, die dazu führen, dass ein großer Teil der Bevölkerung faktisch nicht einmal wählen kann (vgl. León et al. 2003). So ist Bolivien nur als eine formale Demokratie zu bezeichnen, die breite Schichten von politischer Partizipation ausschließt.
2.3. Die Doppelte Transformation – Reformen 1993-1997
Unter der ersten Amtszeit des Präsidenten Sánchez de Lozada (1993-1997) erhielten die Reformen zur „Strukturanpassung“ v. a. durch Privatisierungen neuen Schwung, doch wurden auch wichtige politisch-institutionelle Reformen angegangen. Mit dem Volksbeteiligungsgesetz (Ley de Participación Popular) und dem Ley de Descentralización Administrativa sollte die regionale Selbstverwaltung gestärkt werden. Dazu wurden 311 Gemeinden gegründet, denen auch weit reichende Kompetenzen (Erziehung, Bildung, Infrastruktur) übertragen wurden (vgl. Wolff 2004: 17). Der Bürgermeister (Alcalde) und die Mitglieder des Consejo Municipal werden jeweils für fünf Jahre demokratisch gewählt, zusätzlich wurden Comités de Vigilancia gegründet, die, bestehend aus Basisorganisationen, die Verwendung munizipaler Ressourcen überwachen sollen. So ging es bei den Reformen um zwei Prozesse: einen funktionalen, um die Qualität der staatlichen Verwaltung zu verbessern, und um einen „soziopolitischen Prozeß der Konstituierung von territorialisierten Gemeinden und der Stärkung der gesellschaftlichen Partizipation“ (Mercado 1996: 47). Probleme ergaben sich bei der Umsetzung vor allem durch mangelhafte Koordination der beteiligten Institutionen, in der Anwendung durch unzureichende Führungskapazitäten auf der Munizipalebene und der ungleichen Verteilung der Investitionen durch die Munizipien zugunsten des Bausektors bei Vernachlässigung des Bildungs-, Wirtschafts- und Gesundheitssektors (vgl. ebd.: 49). In den letzten Jahren erfahren die Munizipien insbesondere durch die finanziellen Spielräume, die sie über die HIPC-Entschuldungsgelder erhalten, eine Aufwertung[6]. Auf politischer Ebene verliefen die Reformen eher enttäuschend, denn es gelang langfristig nicht, „die Bevölkerung politisch und sozial zu integrieren und die massive Legitimitätskrise des traditionellen parlamentarischen Systems abzumildern“ (Ramírez Voltaire 2004: 217, vgl. Mayorga 2002: 262ff). Allerdings verbesserte sie die Möglichkeiten der Indígenas zur Teilnahme am politischen Prozess: „Ninguno de los indígenas que está en el Parlamento hoy en día hubiera llegado a ese nivel si no era a través del proceso de la participación popular” (Urioste 2004: 333). Enttäuschend ist auch der Fortschritt bei der Armutsbekämpfung. Die Armut auf dem Land konnte nicht verringert werden, sie ist immer noch sehr mit der Eigenschaft indigen zu sein verbunden. Allein in Regionen, die schon vorher über ein größeres Potential (an landwirtschaftlichen Ressourcen oder Touristik-Infrastruktur) verfügten, konnten Fortschritte gemessen werden (vgl. Urioste 2001).
Ebenfalls wichtig war die ausgearbeitete Bildungsreform (Ley de Reforma Educativa). Statt der bisher verfolgten „assimilatorischen Bildungspolitik“ und der „systematische(n) Erziehung zur Geringschätzung der eigenen Herkunftskultur“ sollte nun nach den Prinzipien der Interkulturellen Zweisprachigen Pädagogik gelehrt werden. Das Bildungswesen sollte „als Medium zur Festigung der nationalen Einheit bei gleichzeitiger Anerkennung der Verschiedenheiten der Kulturen im Lande angesehen“ werden (Ströbele-Gregor 1996: 63ff). Problematisch waren und sind vor allem die massiven Defizite des Schulsystems auf dem Land, die ironischerweise aber auch zur Bewahrung der indigenen Kulturen beigetragen haben: Das missionarische Curriculum der weißen Elite erreichte die ländlichen Gemeinden eben nicht. Dabei stellt „sich umgekehrt die Frage, wie kulturelle Eigenständigkeiten jenseits von Folklore erhalten bleiben können, wenn das Schulsystem einmal flächendeckend funktioniert.“ Gewerkschaften und Opposition kritisierten weniger die Inhalte der Reform als vielmehr deren Zustandekommen ohne Partizipation ihrer Vertreter (vgl. ebd.: 63, 69ff).
2.4. Indígenas in Politik und Gesellschaft
Zum ersten Mal in der Geschichte seit der Kolonisation wurden nach der bolivianischen Revolution 1952 durch die MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) auch die ursprünglichen Bewohner Boliviens formal als Staatsbürger anerkannt. In Folge der Revolution trat am 02.08.1953 eine, damals als revolutionär angesehene, Agrarreform in Kraft. Dabei wurden bis 1962 etwa 4 Millionen (bis 1968: 8 Millionen) Hektar Landwirtschaftsfläche umverteilt. Diese Zahlen sollten aber nicht von der heutigen Verteilung des Landbesitzes ablenken: 87% der Fläche ist im Besitz von nur 7% der Landbesitzer, nichtstaatliche Stellen sprechen zudem von 250.000 landlosen Bauern und einer Million mit Kleinstparzellen (alle Zahlen: vgl. Wierling 2003: 38). Trotzdem hat die Politik, besonders die MNR, den Mythos der Landreform als Befreiung der Indígenas gepflegt, auf dem Land feiert man noch heute statt des Unabhängigkeitstages den Día del campesino am 2. August. In den letzten Jahren verstärkt sich die kritische Auseinandersetzung mit den Landverhältnissen und es wird, nach dem folgenlosen Agrarreformgesetz Ley INRA von 1996, in Anbetracht der Verteilungsverhältnisse eine zweite Bodenreform immer vehementer gefordert (vgl. Urioste 2003b). Letzten Endes war die Revolution von 1952, deren „sozialrevolutionärer Elan (…) bald verpuffte, deren Errungenschaften verkamen und die keinen bleibenden strukturierenden Einfluss auf die politische Entwicklung Boliviens behielt“, an ihren Zielen gemessen ein Fehlschlag (Nohlen 2001: 27). Indígenas, ihre Interessen und ihre Kultur, spielten in dem Staat weiterhin keine Rolle, „(a)n der Herrschaft der Spanisch sprechenden, weißen Minderheit änderte sich nichts“ (Goedeking 2002: 85).
Mit der Rückkehr zur Demokratie 1982 ergaben sich potentiell neue Chancen, doch die weiße Minderheit behielt trotz allgemeinem und gleichem Wahlrecht das Monopol in der Politik. Die Probleme der indigenen Bevölkerung erlangten erst Anfang der 90er Jahre wieder Gewicht. Ein erster Indikator für die wachsende Bedeutung der Indígenas war das Condepa-Phänomen[7]. Von Bedeutung war dann die Ernennung des Aymara Víctor Hugo Cárdenas als Vizepräsident durch den gewählten Präsidenten Gonzales Sanchez de Lozada (MNR) im Jahre 1993. Die soziale (weiße) Elite Boliviens äußerte sich dabei begeistert darüber, „wie culto der ehemalige Universitätsprofessor (…) sei, also wie sehr er sich von der aus Elitensicht ungebildeten rohen Masse von Indígenas abhebe“ und zeigte damit auch, dass „(r)assistische Denkmuster (…) nach wie vor weit verbreitet“ sind (Goedeking 2001: 112). Bei Indígenas war Cárdenas auch sehr umstritten und galt vielen mit seinem Diskurs[8] der Kooperation und des Ausgleiches als der weißen Elite zu angepasst. Heute spielt er kaum noch eine Rolle, doch wurden während seiner Vize-Präsidentschaft (1993-1997) wichtige Reformen angegangen (siehe 2.3.), die, zumindest im Ansatz, im Sinne der indigenen Bevölkerungsmehrheit gestaltet wurden. Die Regierung unter dem Ex-Diktator Banzer (ADN) von 1997-2002 setzte diese auf gesellschaftlichen und sozialen Ausgleich bedachte Politik nicht fort und polarisierte mit ihrem härteren Konfrontationskurs wieder stärker.
Mit den Protesten ab 2000 rückten soziale Fragen und damit die Debatte über die Stellung der Indígenas erneut auf die Agenda. Auf politischer Ebene war vor allem die Wahl 2002 bedeutend. Die eher radikale MIP (Movimiento Indígena Pachacuti) des Indígena Felipe Quispe erreichte 6%, die MAS (Movimiento al Socialismo) stellte (für manche überraschend) mit 21% die zweitstärkste Fraktion, ihr Anführer, der Aymara Evo Morales, unterlag im ersten Wahlgang nur knapp dem bei der Parlamentsabstimmung gewählten Präsidenten Sánchez de Lozada. Die Vertreter dieser Parteien wurden von den übrigen Abgeordneten jedoch als anti-systemische Kräfte beschimpft und aus dem politischen Prozess quasi ausgeschlossen (vgl. Wolff 2004: 26). Die Bilder von den ins Parlament einziehenden Aymaras und Quechuas in ihren Ponchos und mit Cocablättern hatten dabei jedoch eine große symbolische Wirkung und unterstützten das neue Selbstbewusstsein der marginalisierten Mehrheit. So lässt sich zunehmend eine wachsende Einsicht erkennen, dass „el tema indígena no es accesorio ni marginal, es más bien determinante y central. La exclusión étnica de la que son víctimas los pueblos indígenas campesinos desde hace siglos no ha concluido y el tema debe de estar en el centro del debate. Bolivia es un país racista y excluyente, donde en la práctica los ciudadanos no son iguales.” (Urioste 2003b)
3. Krise der Demokratie – Proteste und Unruhen seit 2000
Angesichts der großen sozialen und wirtschaftlichen Probleme Boliviens ist das eigentlich Bemerkenswerte nicht die Krise der Demokratie, sondern deren lange Überlebensfähigkeit. 63% der Bolivianer halten die Demokratie für die beste aller Regierungsformen, nur 7% meinen jedoch, sie habe zurzeit keine oder nur kleine Probleme. Im Krisenjahr 2004 glaubten 79%, dass sich das Land auf einem schlechten Weg befindet (Rang 4 der 18 lateinamerikanischen Länder) (alle Zahlen: Latinobarómetro 2004: 9, 7, 37). Als Ausgangspunkt der jüngsten Welle der Unzufriedenheit, die ihren (vorläufigen) Höhepunkt mit der Absetzung des Präsidenten Lozada im Oktober 2003 fand, kann der „Wasserkrieg“ in Cochabamba[9] im Jahre 2000 angesehen werden: „Der Krieg um das Wasser war (…) die Initialzündung für eine beispiellose, immer größer werdende und bis heute anhaltende Welle von sozialen Bewegungen und Protesten“ (Ramírez Voltaire 2004: 218). Die Krise konterkariert dabei die Wahrnehmung auf internationaler Ebene von einem Bolivien als Musterland der Reformen seit 1985. Dabei wurden und werden die Proteste immer noch meist ausschließlich als Gefahr angesehen, sogar als irrationale und unorganisierte Rebellion zur Installation vormoderner Strukturen (vgl. ebd.: 216, 227). Dieses Bild ist jedoch nicht haltbar, wenn man die Ursachen und Akteure näher betrachtet.
3.1. Die Ursachen: Exklusion, Coca, Gas und Indígenas
Die letzten Aufstände im Oktober werden als „Guerra del Gas“ bezeichnet, doch kann man die Gas-Exportpläne der Regierung nicht als eigentliche Ursache der Konflikte bezeichnen. Sie waren vielmehr ein Anlass und dabei ein idealer Kristallisationspunkt für die heterogenen sozialen Bewegungen (vgl. Wolff 2004: 5). Die Krise muss dabei als eine Krise seit 2000 gesehen werden, die ihre Ursprünge in der Politik seit 1985 findet. Viele Menschen fühlten sich im politischen System nicht repräsentiert, demokratische Mitbestimmung schien nicht möglich. „La palabra democracia adquirió el rango de dispositivo normativo y prescriptivo de la constitución de los poderes públicos pero, como nunca, la capacidad de intervención de la sociedad en la gestión de lo público fue escandalosamente restringida y mutilada” (García Linera 2002).
Ein zentrales Konfliktfeld ist in Bolivien seit langem der Cocaanbau. Im Rahmen des Anti-Drogen-Krieges der USA wurde seit Mitte der 80er Jahre damit begonnen, diese Felder systematisch zu zerstören. Dabei hat das Cocablatt in Bolivien zunächst eine traditionelle und medizinische Bedeutung, die nichts mit der Droge Kokain zu tun hat. Trotzdem wissen die „Cocabauern im Chapare (…) genauso gut wie Evo Morales, dass sie den Grundstoff für die Kokainproduktion liefern und sich dabei wohl kaum auf Jahrhunderte alte Traditionen berufen können“, deshalb sei der „Diskurs von der ‚heiligen Pflanze’ (…) als Instrument der Legitimation zu verstehen“ (Goedeking 2002: 92f). Für die allermeisten Bauern fehlt schlichtweg eine ökonomische Alternative. Die Zerstörung der Plantagen als Strategie der Regierung auf Druck und mit Unterstützung der USA kann dabei als in keiner Weise erfolgreich gelten. Während die Lebensgrundlage vieler Bauern und der gesellschaftliche Frieden durch die Militarisierung in vielen Regionen zerstört wurden, tat dies der Kokain-Produktion keinen Abbruch (vgl. Ramírez Voltaire 2004: 221). Viele Cocabauern sind ehemalige Minenarbeiter, die in Folge der (Neo-)Liberalisierung entlassen wurden und in den Chapare migrierten. Dorthin brachten sie auch ihre Erfahrungen gewerkschaftlicher Organisation mit, die dazu beitrugen, aus der Masse der Cocabauern einen der mächtigsten Akteure in der Politik zu machen (vgl. Goedeking 2002: 91).
[...]
- Arbeit zitieren
- Christof Mauersberger (Autor:in), 2005, Die Krise der Demokratie Boliviens: Demokratisierung als Antwort?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57058
Kostenlos Autor werden










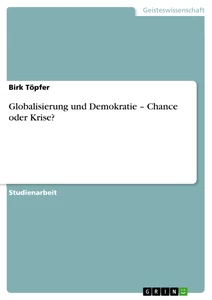

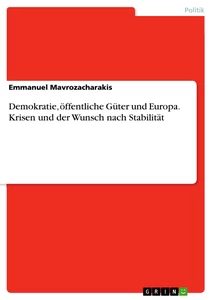









Kommentare