Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Aufbau der Arbeit
1.2 Danksagungen
2. Verhaltensauffälligkeit
2.1 Vorbemerkungen
2.2 Definitionen und Erklärungsansätze
2.3 Stand der Forschung
2.3.1 Verhaltensauffälligkeit: von Lehrkräften präferierte Definitionen und Definitionen durch Lehrkräfte
2.3.2 Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern aus Sicht der Lehrkräfte
2.3.3 Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten aus Sicht der Lehrkräfte Zusammenfassung
3. Prävention und Intervention
3.1 Maßnahmen (in) der Schule
3.1.1 Handlungsmuster von Lehrkräften
3.1.2 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz
3.1.3 Trainingsraummethode
3.1.4 Streitschlichtung, Mediation, Täter – Opfer – Ausgleich
3.1.5 Stufenpläne
3.1.6 Verstärkung und Token – Programme
3.1.7 Kontingenzverträge
3.1.8 Selbstkontrollverfahren und Partner – Lernen
3.1.9 Soziale Lernprogramme und Gewalt-präventionsprogramme
3.1.10 Kooperation mit Schülerinnen und Schülern
3.1.11 Kooperation im Kollegium
3.1.12 Empowerment
3.2 Möglichkeiten der Jugendhilfe nach dem KJHG
3.2.1 Das neue Verständnis der Jugendhilfe
3.2.2 Beratung
3.2.3 Hilfen zur Erziehung
3.2.4 Hilfeplanung
3.3 Möglichkeiten im Bereich der Sonderpädagogik
3.3.1 Schule für Erziehungshilfe und „E – Klasse“
3.3.2 Mobile sonderpädagogische Dienste
3.3.3 Ergebnisse einer Studie zum mobilen sonderpädagogischen Dienst
3.3.4 Integrative Möglichkeiten in Kooperation zwischen Sonder- und Sozialpädagogik
3.4 Förderplanung
3.4.1 Begriffserklärung und Funktion in der Schule
3.4.2 Förderplanung: von der Eingangsdiagnose zur Fortschreibungsdiagnose
3.4.3 Problematiken von Förderplänen
3.4.4 Prinzipien gelingender Förderplanung
3.4.5 Kooperative Förderplanung
3.5 Sonstige Maßnahmen
3.5.1 Medikamentöse Behandlung
3.5.2 Therapeutische Verfahren
3.5.3 “Psychotechniken”
4. Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
4.1 Rechtliche Grundlagen
4.1.1 Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- und Jugendhilfegesetz
4.1.2 Schulgesetz
4.1.3 Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugend-hilfe und Schulen in Baden – Württemberg
4.2 Spannungsfelder
4.2.1 Strukturelle Spannungsfelder
4.2.2 Spannungsfeld „Feuerwehrfunktion“
4.2.3 Spannungsfelder zwischen Lehrkräften und Professionellen der Sozialen Arbeit
4.3 Gegenseitige Erwartungen, Forderungen und Rahmenbedingungen
4.4 Möglichkeiten und Modelle der Kooperation
4.4.1 Möglichkeiten im Bereich der Planung und Entwicklung
4.4.2 Möglichkeiten im Bereich der Prävention
4.4.3 Möglichkeiten im Bereich der Schulsozialarbeit
4.4.4 Möglichkeiten im reaktiven Bereich
4.4.5 Kooperationsmodelle
4.5 Kooperation und Ganztagsschule
4.5.1 Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“
4.5.2 Definition und Modelle von Ganztagschulen
4.5.3 Anzeichen und Impulse für Kooperation
4.5.4 Beispiele für Kooperation im Ganztagsbetrieb
4.6 Stand der Forschung
4.6.1 Aufgaben von Schule und Lehrkräften aus Lehrersicht
4.6.2 Informiertheit der Lehrkräfte über die Jugendhilfe
4.6.3 Kooperation von Lehrkräften mit internen und externen Partnern
4.6.4 Verhältnis Lehrkraft – Sozialarbeiter/in
4.6.5 Zufriedenheit der Lehrkräfte bei Kooperationsprojekten
5. Praxisteil
5.1 Forschungsziel und Forschungsfragen der Untersuchung
5.2 Subjektive Theorien
5.2.1 Begriffserklärung
5.2.2 Abgrenzung zu wissenschaftlichen Theorien und zur Kognitionsforschung Subjektive Theorien im Kontext von Schule
5.3 Grundlagen der qualitativen Sozialforschung
5.3.1 Zur Geschichte der qualitativen Sozialforschung
5.3.2 Grundsätze qualitativen Denkens
5.3.3 Gütekriterien
5.4 Zur Untersuchung
5.4.1 Methodenreflexion
5.4.2 Forschungsdesign
5.4.3 Erhebungsverfahren
5.4.4 Aufbereitungsverfahren
5.4.5 Analyseverfahren
5.4.6 Aussagekraft der Untersuchung
5.4.7 Kategorien
5.5 Reflexion
6. Auswertung
6.1 Zum Erziehungs- und Bildungsauftrag
6.2 Pädagogische Leitideen der Lehrkräfte
6.2.1 Aufbau einer Beziehung zu den Schülern
6.2.2 Vermittlung von Werten: Höflichkeit, Pünktlichkeit, Umgangsformen
6.2.3 Stärkung des Selbstvertrauens der Schüler/innen
6.2.4 Förderung des sozialen Miteinanders
6.2.5 Erziehung zur Selbstständigkeit
6.2.6 Lehrkraft als Vorbild
6.2.7 Vermittlung von Fachwissen
6.2.8 Zusammenfassung
6.3 Beschreibung von verhaltensauffälligen Schülern
6.3.1 Aktualität des Themas
6.3.2 Unterrichtsstörende Verhaltensweisen
6.3.3 Aggressive Verhaltensweisen
6.3.4 Verhältnis zu den Klassenkameraden
6.3.5 Verhältnis zu den Lehrkräften
6.3.6 Leistungsprobleme
6.3.7 Selbstwahrnehmung
6.3.8 Einzelbeschreibungen
6.3 Zusammenfassung
6.4 Ursachen von Verhaltensauffälligkeit aus Sicht der befragten Lehrkräfte
6.4.1 Die Schwierigkeit eine Ursache herauszudeuten
6.4.2 Familie
6.4.3 Im Schüler selbst liegende Ursache
6.4.4 Schule und Unterricht
6.4.5 Medien
6.4.6 Pubertät
6.4.7 Migration
6.4.8 Peergroup
6.4.9 Individualismus
6.4.10 Einzelpositionen
6.4.11 Zusammenfassung
6.5 Definitionen durch die Lehrkräfte zum Begriff der Verhaltensauffälligkeit
6.5.1 Vom Problem eine Definition zu formulieren
6.5.2 Auftretensformen und Frequenz
6.5.3 Normbezug
6.5.4 Begründungen
6.5.5 Umgang
6.5.6 Zusammenfassung
6.6 Angewandte Erziehungsmittel der Lehrkräfte im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern
6.6.1 Elternarbeit
6.6.2 Regeln – Struktur – Konsequenz
6.6.3 Gespräche mit dem Schüler
6.6.4 Gespräche mit der Klasse
6.6.5 Unterrichtsplanung
6.6.6 Auszeit
6.6.7 Extraaufgaben
6.6.8 Nachsitzen
6.6.9 Lob und Belohnung
6.6.10 Verstärkungsprogramme/ Schülerprogramme
6.6.11 Schulausschluss
6.6.12 Laut werden
6.6.13 Ignorieren
6.6.14 Streitschlichtung/Täter – Opfer – Ausgleich
6.6.15 Verträge
6.6.16 Sitzordnung
6.6.17 Ermahnung
6.6.18 Einzelnennungen
6.6.19 Exkurs: Das ambivalente Verhältnis zur Strafe
6.6.20 Zusammenfassung
6.7 Schulische Konzepte zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeit
6.7.1 Anstoß zur Konzeptentwicklung
6.7.2 Schulen ohne fertig ausgearbeitetes Konzept
6.7.3 Schulen mit ausgearbeitetem Konzept
6.7.4 Zusammenfassung
6.8 Kooperation im Kollegium
6.8.1 Zufriedenheit bei der Kooperation
6.8.2 Den Unterricht betreffende Kooperation
6.8.3 Kooperation im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern
6.8.4 Zusammenfassung
6.9 Kontakt zum Jugendamt/ zu Einrichtungen der Sozialen Arbeit
6.9.1 Keine Kontakte zum Jugendamt
6.9.2 Kontakt zum Jugendamt nur in Einzel- oder „Akutfällen“
6.9.3 Probleme bei der Kooperation
6.9.4 Zufriedenheit
6.9.5 Kontakte über die Schulsozialarbeit
6.9.6 Kontakte zu weiteren sozialen Einrichtungen
6.9.7 Zusammenfassung
6.10 Kooperation mit dem Sonderpädagogischen Dienst
6.10.1 Keine Kontakte zum Sonderpädagogischen Dienst
6.10.2 Kooperationsformen
6.10.3 Aufgaben des Sonderpädagogischen Dienstes
6.10.4 Zufriedenheit
6.10.5 Zusammenfassung
6.11 Förderplanung
6.11.1 Verbreitung von Förderplänen im Schulalltag
6.11.2 Förderplanung in Kooperation mit Sonderpädagogen
6.11.3 Bereiche der Förderplanung
6.11.4 Begründung für den Verzicht auf Förderplanung: Differenzierung im Unterricht
6.11.5 Begründung: Überforderung
6.11.6 Begründung: Kein Bedarf
6.11.7 Sonstige Begründungen
6.12 Abschließende Bemerkungen
7. Hauptergebnisse und Konsequenzen für die Soziale Arbeit in Schulen
7.1 Hauptergebnisse der Untersuchung
7.2 Konsequenzen für die Soziale Arbeit in Schulen
7.3 Schlusswort
Quellenangaben
Anhang
Vorwort
Das Thema Verhaltensauffälligkeit bei Jugendlichen interessiert mich besonders, da ich in meiner beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit in der Schule, in der offenen und verbandlichen Jugendarbeit, sowie in der Schulsozialarbeit häufig mit verhaltensauffälligen Jugendlichen konfrontiert wurde. Dabei stellte ich fest, dass die Möglichkeiten im Umgang mit verhaltensauffälligen Jugendlichen häufig nicht ausgeschöpft werden und dringender Handlungsbedarf besteht. Meine Erachtens liegen große Chancen, effektive Strategien im Umgang mit verhaltensauffälligen Jugendlichen zu etablieren, in einer engeren Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule. Durch meine Kenntnis beider Bereiche – der Schule und der Jugendhilfe – und aufgrund meines Wunsches beruflich an der Schnittstelle tätig zu sein, habe ich großes Interesse an einer Vernetzung beider Institutionen, um Präventions- und Interventionsmöglichkeiten im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten auszubauen.
Ich war gespannt darauf, ob meine Erfahrungen im Umgang mit verhaltensauffälligen Jugendlichen mit denen der interviewten Lehrkräfte vergleichbar sind.
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Subjektiven Theorien von Lehrkräften über Schüler und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeit und über den Umgang damit. Ziel der Arbeit ist die Ermittlung von Lehrereinstellung bezüglich verhaltensauffälliger Schüler/innen und die Ermittlung von Umgangsformen mit diesen Jugendlichen sowie der Konsequenzen, die sich daraus für die Soziale Arbeit in Schulen ziehen lassen.
Aus dieser Zielsetzung ergeben sich folgende zentrale Fragestellungen:
- Wie beschreiben Lehrkräfte verhaltensauffällige Schüler/innen und welche Möglichkeiten nutzen sie im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen?
- Welche Faktoren begünstigen einen effizienten Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten?
- Welche Konsequenzen sind daraus für die Soziale Arbeit in Schulen zu ziehen?
Um diese Fragen zu beantworten, wird der Stand der Wissenschaft in den Bereichen Verhaltensauffälligkeit, Prävention und Intervention sowie Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe dargestellt und 19 Interviews mit Klassenlehrer/innen an baden – württembergischen Hauptschulen werden mit qualitativen Methoden ausgewertet.
1.1 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit besteht aus sieben Kapiteln. In den Kapiteln 2, 3 und 4 werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit gelegt und der Stand der Forschung erhoben, Kapitel 5, 6 und 7 betreffen die empirische Untersuchung.
Kapitel 2 „Verhaltensauffälligkeit“ umfasst neben Definitionen und Erklärungsansätzen, auch Ergebnisse aus der Lehrerforschung bezüglich Verhaltensauffälligkeit.
In Kapitel 3 „Prävention und Interaktion“ werden Möglichkeiten vorgestellt, wie in Schul-, Sonder- und Sozialpädagogik mit verhaltenauffälligen Jugendlichen umgegangen werden kann. Dabei wird auf Ergebnisse empirischer Studien über Wirksamkeit und/oder Umsetzung verwiesen.
Kapitel 4 „Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe“ widmet sich Problematiken und Chancen, Bedingungen und Möglichkeiten einer Kooperation. Außerdem gibt es einen Einblick in verschiedene Studien, die sich u.a. mit dem Selbstverständnis der Lehrkräfte über ihre Aufgaben und Kompetenzen sowie der Zufriedenheit der Lehrkräfte in Kooperationsprojekten beschäftigen. Eine genaue Abgrenzung der Kapitel 3 und 4 war wegen der großen Schnittmenge schwierig.
Kapitel 5 „Praxisteil“ enthält Abschnitte über Grundlagen der Qualitativen Sozialforschung und über das Forschungsprogramm „Subjektive Theorien“. Des Weiteren werden Forschungsziele, Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren sowie die Kategorien der Untersuchung dargestellt.
Kapitel 6 „Auswertung“ umfasst die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, wie die Beschreibung von verhaltensauffälligen Schülern durch Lehrkräfte, Ursachen von Verhaltensauffälligkeit und in Schulen angewandte Umgangsmöglichkeiten.
In Kapitel 7 „Hauptergebnisse und Konsequenzen für die Soziale Arbeit in Schulen“ findet sich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung. Aus diesen Ergebnissen werden Konsequenzen für die Soziale Arbeit in Schulen gezogen.
Im Anschluss folgen die Quellenangaben zu den Werken bzw. Aufsätzen, die in der Arbeit genannt werden. In der Arbeit wird nach der sog. Harvard – Methode zitiert. Im Anhang finden sich die Transkripte der 19 Interviews, der Interviewleitfaden und das Transkriptionssystem.
In der Arbeit wird weitmöglichst, sowohl die männliche als auch weibliche Form verwendet. An manchen Stellen wird aufgrund der besseren Lesbarkeit nur eine Form benutzt. Selbstverständlich sind stets beide Geschlechter angesprochen, außer wenn es ausdrücklich betont ist, dass es um ein bestimmtes Geschlecht geht.
1.2 Danksagungen
Mein besonderer Dank geht an Herrn Dipl. Päd. Ralf Brandstetter, der mir im Rahmen seiner Dissertation die Bearbeitung dieses Themas ermöglicht hat und mir während der ganzen Zeit zur Seite stand. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Frau Prof. Dr. Jutta Mägdefrau und Herrn Prof. Dr. Norbert Huppertz für die kompetente Betreuung. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei den Studierenden, von denen ich die Interviews mit den Lehrkräften erhielt.
2. Verhaltensauffälligkeit
2.1 Vorbemerkungen
Bei der Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Verhaltensauffälligkeit fällt sofort auf, dass sich eine Vielzahl von Erklärungsansätzen, Termini und Klassifikationsversuche finden lassen. Dabei handelt es sich um Versuche Verhaltensweisen von Jugendlichen und Kindern, die den normativen Erwartungen der Erwachsenen nicht entsprechen, zu beschreiben, zu erklären und zu kontrollieren. Da die Disziplinen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen – also Pädagogik, Sonder- und Sozialpädagogik, Pädiatrie, Soziologie, Kriminologie, Psychologie und Psychiatrie, sich mit jeweils anderen Aspekten beschäftigen, andere Untersuchungsinteressen und -perspektiven verfolgen und sich hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Tradition und Methodologie sowie ihrer normativen Bezugssysteme unterscheiden, kam es bisher weder zu einem interdisziplinären, noch zu einem intradisziplinären Konsens. Die Vielzahl der Veröffentlichungen führt nicht zu weiterer Klärung, sondern zu einer immer größer werdenden Diffusität[1].
Nach Goetze (2001:11) wird bereits auf der Ebene der Begrifflichkeit die Diffusität deutlich: verhaltensgestört, verhaltsauffällig oder -originell, sozial unangepasst, erziehungsschwierig. Gemein ist diesen Begriffen nur, dass sie negativ besetzt sind. Eine Einigung in der Fachwelt gibt es bisher nicht, obwohl es für die Verständigung förderlich wäre. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung „verhaltensauffällig“ bevorzugt, weil sie weniger wertend ist. Zudem betonen Ortner/Ortner (1995:4), Bezug nehmend auf Barkey (1986:883), dass eine verhaltensauffällige Person nicht in jedem Fall bestimmte Merkmale aufweist, sondern einer beobachtenden Person etwas „auffällt“.
Eine weitere Schwierigkeit bei der Definition von Verhaltensauffälligkeit ergibt sich aus der Kulturabhängigkeit dessen, was als „auffällig“ gilt. Definitionsversuche sind daher mit Vorsicht zu behandeln. Bezug nehmend auf Kauffman (1989) stellt Goetze (2001:13ff) ausführlich dar, welche Kriterien eine Definition erfüllen muss, wenn sie wissenschaftlichen Kriterien genügen will:
- Bezug zu einem theoretischen Konzept, z.B. tiefenpsychologisches Konzept oder biologisches Konzept
- Normenbezug (was in der Gesellschaft als normal verankert ist)
- Entwicklungsbezug (Verhalten ist abhängig von der psychischen Entwicklung à Alter)
- Sozial- und Ökologiebezug (Verhalten ist abhängig von der Umgebung in der ein Kind aufwächst à Bezugspersonen als Vorbild)
- Bio – Physis – Bezug (organische Störungen, z.B. Hirnschädigungen)
Die Kriterien tauchen in den auffindbaren Definitionen in der Literatur kaum vollständig und jeweils mit unterschiedlicher Gewichtung auf, teilweise finden sich auch andere Kriterien. Im Folgenden werde ich einige Definitionsversuche und Erklärungsversuche kurz darstellen.
2.2 Definitionen und Erklärungsansätze
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (2002:28ff) definiert Verhaltensauffälligkeit als eine Abweichung „von einem bestimmten sozialen Verhalten, das als Norm gilt.“ Folglich liegt eine Störung dann vor, wenn ein Verhalten als deutlich abweichend betrachtet werden kann, ganz unproblematisch ist dieses Verständnis nicht. Wer legt den Bereich fest, der noch als „normal“ gilt, und wo beginnt die Störung? Die Bundesagentur für Arbeit definiert „Verhaltensstörung“ wie folgt: „ Erscheint das wahrgenommene regelwidrige Verhalten den Beurteilern als so schwerwiegend bzw. als ein so verfestigtes Verhaltensmuster, dass es ohne eine besondere erzieherische oder sonderpädagogische Hilfe zur sozialen Integration und Rehabilitation nicht zu beheben ist, spricht man im pädagogischen Sinn von einer Verhaltensstörung[2].“ In der Statistik wird Verhaltensauffälligkeit, laut Ostermann/Saueressig[3] (1996:70), so definiert: Alle Verhaltensweisen, die sich zu weit vom erwartbaren Durchschnitt entfernen, gelten als verhaltensauffällig. Dieses Verständnis von Auffälligkeit bleibt auf der Ebene der Beschreibung. Bach (1993:27ff) unterscheidet gleich drei verschiedene Definitionsansätze, die seiner Meinung nach keinesfalls von einander losgelöst betrachtet werden dürfen, sondern stets in Kombination gesehen werden müssen: Verhaltensstörung als Eigenschaft, Verhaltensstörung als Zuschreibung und Verhaltensstörung als situative Reaktion. Der deutsche Bildungsrat vertritt, nach Ostermann/Saueressig (1996:70f)[4], eine ursachenorientierte Definition: „Als verhaltensgestört gilt, wer aufgrund organischer, vor allem hirnorganischer Schädigungen oder eines negativen Erziehungsmilieus in seinem psychosozialen Verhalten gestört ist und in sozialen Situationen unangemessen reagiert und selbst geringfügige Konflikte nicht bewältigt“. Bower stellt, nach Ostermann/Saueressig[5] (1996:70f), einen Merkmalskatalog auf, mit dessen Hilfe man Verhaltensauffälligkeiten einordnen kann. Wer mindestens fünf Merkmale des Katalogs über einen längeren Zeitraum zeigt, gilt als verhaltensauffällig.
In der Medizin bzw. Humanbiologie geht man, so Goetze (2001:31), davon aus, dass allem menschlichen Verhalten organische Mechanismen zugrunde liegen. Denken und Handeln sind ohne eine entsprechende Anatomie und Physiologie nicht möglich. Dementsprechend könnten Hirnschädigungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, genetische Dispositionen als Ursachen für ADHS, Depressionen und weitere Auffälligkeiten/Krankheiten angesehen werden. Interventionsmöglichkeiten sind diesem Ansatz zufolge zum Beispiel Medikation, Chirurgie, oder Diätkontrolle. Der Schule wird durch diesen Ansatz kein Handlungsspielraum eröffnet. Im Gegenteil, die Verantwortung wird in den Bereich der Medizin gerückt, allerhöchstens kann er im Einzelfall zu mehr Verständnis bei Lehrkräften führen. Bach betont (1993:27) allerdings, dass „in keinem Fall somatische Gegebenheiten vorliegen, ohne dass emotionale und kognitive Bereiche mitbeteiligt wären und umgekehrt“.
In der Psychologie gibt es verschiedene Ansätze Verhaltensauffälligkeiten zu erklären, beispielsweise den psychoanalytischen Ansatz, den Goetze (2003:32) darstellt. Hier geht es nicht um die Interpretation der sichtbaren Verhaltensweisen, sondern um das, was dahintersteht, was in den dynamischen Teilen der Person zu lokalisieren ist (Es, Ich, Über – Ich). Das auffällige Verhalten steht nach diesem Ansatz im Zusammenhang mit frühkindlichen Erfahrungen, die dem Bewusstsein häufig nicht zugänglich sind[6]. „Wie der Erwachsene mit dem Leben fertig wird, wie er zu seinen Mitmenschen – in Liebesbeziehungen, in Freundschafts- und Arbeitsverhältnis – steht, dies hat oft alles in der frühen und frühsten Kindheit seinen Anfangspunkt“ (Wolfsheim 1966)[7].
Aus der Lernpsychologie (Ortner/Ortner 1995:16) kommt ein weiterer Ansatz, das Beobachtungslernen oder „Lernen am Modell“. Hier geht man davon aus, dass das Verhalten an einem Modell beobachtet und imitiert wird. Kinder gewalttätiger Eltern könnten demnach aggressive Verhaltensweisen erlernen, wenn deren Verhalten keine negativen Folgen hat. In der Verhaltenspsychologie geht man aus, dass erlerntes Verhalten wieder verlernt werden kann (Verhaltenstherapie). Lehrkräfte in der Schule stellen auch ein Modell dar, durch positive und negative Verstärkung (instrumentelles Lernen – „Lernen am Erfolg“) versuchen sie zudem erwünschtes Verhalten zu fördern bzw. unerwünschtes zu unterdrücken.
Powers Wahrnehmungs – Kontrolltheorie (Bründel/Simon 2003, Kapitel 2) kann man zur Erklärung auffälligen Verhaltens ebenso heranziehen. Diese Theorie besagt, dass Verhalten nicht eine Reaktion auf die Umwelt darstellt, sondern das Ergebnis, von Impulsen zur subjektiven Veränderung der Umwelt ist, um sie den Bedürfnissen und Wünschen der handelnden Person anzupassen. Das Verhalten wird dann geändert, wenn die tatsächliche Wahrnehmung nicht der erwünschten Wahrnehmung entspricht. Verhalten soll demnach modifizieren, was eine Person wahrnimmt. Die Wahrnehmungs – Kontroll – Theorie ist die Grundlage des Arizona – Programms, das in vielen Schulen angewendet wird, um Unterrichtsstörungen zu minimieren.
In der Soziologie ist vor allem der Ansatz des „labeling approach“ bekannt, der wichtigste Vertreter, Becker (1973), stellt ihn in „Außenseiter – Zur Soziologie abweichenden Verhaltens[8] “ ausführlich dar. Ihm zufolge wird abweichendes Verhalten von der Gesellschaft geschaffen. Sie stellt Regeln auf, deren Verletzung überhaupt erst abweichendes Verhalten möglich machen. Verschiedene Gruppen können verschiedene Regeln aufstellen, sogar innerhalb desselben Kulturkreises. Ob eine Verhaltensweise als abweichend klassifiziert wird, hängt mit den in der Gesellschaft gesetzten Normen zusammen. Maßgeblich ist dabei, wer eine Normverletzung begeht und wer sich davon bedroht bzw. geschädigt fühlt. Nach Goetze (2003:16) gehen von soziologischen Ansätzen keine Impulse für das pädagogische Handeln aus. Ihr Verdienst liegt darin auf die Gefahr jeder Etikettierung hinzuweisen.
Innerhalb der traditionell geisteswissenschaftlichen Pädagogik versteht man Verhaltensauffälligkeiten als Resultat von störenden äußeren Einwirkungen auf den Erziehungsprozess. Speck (1993:34) führt v.a. „den zunehmenden Verlust moralischer Orientierungen und ethischer Haltgebungen“ als Grund für Verhaltungsauffälligkeiten an. Werte- und Normensysteme seien zu widersprüchlich in der pluralistischen Gesellschaft. Der Mensch sei vermehrt auf sich selbst gestellt – er wächst nicht mehr in soziale Verbindlichkeiten hinein („Ich – Fieber“).[9] Ortner/Ortner (1995:9-14) verweisen auf die Einflüsse von Familie, Erziehungsstil, ökonomischen Verhältnissen, Zeitgeist (Medien) und Gesellschaftsstruktur sowie Schulsituation. Faktoren wie Klassengröße, Unterrichtsstil, Verhalten der Lehrkraft, Leistungsdruck können Einfluss auf körperliches und psychisches Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen haben und damit auf das Verhalten. Für die Schule hat dieser Ansatz große Relevanz, weil er einen Handlungsspielraum eröffnet.
Weitere Erklärungsversuche führen Ostermann und Saueressig (1996)[10] an, wie den ökologischen Ansatz nach Hobbs, der Verhaltensstörungen als im sozialen Netzwerk des Kindes verankert versteht. Ostermann und Saueressig (1996:71) nennen zudem noch einen interaktionistischen Ansatz nach Des Jarlais, der starke Ähnlichkeit zu Beckers soziologischer Sicht hat. Verhaltensauffälligkeiten seien auf die implizierten Regeln sozialer Interaktion zu beziehen. Hier stellt sich die Frage, wer die Macht hat Konformität zu fordern, und welche Beziehung zwischen denen besteht, die für die Durchsetzung von Regeln zuständig sind und denen, die sie brechen.
Abschließend ist anzumerken, dass bei der Beurteilung, ob eine Verhaltensweise auffällig ist, die subjektive Einstellung des Beurteilenden entscheidend ist. Jeder entscheidet auf der Grundlage seiner eigenen Werte und Normen, seines Theoriewissens, seiner Vorerfahrungen und Wahrnehmungen. Es gibt kein verbindliches Klassifikationsraster (wiewohl in der Psychologie die ICD 10 – Skala existiert (Rees 1996:317f)) und es gibt keine allgemein gültigen Verfahren zur Beurteilung. Verhaltensauffälligkeit ist keine empirisch – deskriptive Kategorie. Verhaltensaufälligkeit kann als soziales Konstrukt betrachtet werden, das sich in der Kommunikation mit vielen Ursachen konstituiert.
2.3 Stand der Forschung
Wie nun definieren Lehrkräfte in der Praxis den Terminus „Verhaltensauffälligkeit“? Gibt es einen Konsens? Wie werden verhaltensauffällige Schüler/innen beschrieben? Welche Verhaltensweisen fassen Lehrkräfte im besonderen Maße als auffällig auf? Wie häufig sind Verhaltensauffälligkeiten aus Sicht der Lehrenden? Welche Ursachen liegen diesen ihrer Meinung nach zugrunde? Diesen und anderen Fragen bin ich an Hand neuerer empirischer Studien nachgegangen. Im Folgenden möchte ich Auszüge aus diesen Lehrerbefragungen darstellen, die an unterschiedlichen Schultypen und in verschiedenen Bundesländern durchgeführt wurden.
2.3.1 Verhaltensauffälligkeit: von Lehrkräften präferierte Definitionen und Definitionen durch Lehrkräfte
Ostermann und Saueressig (1996:68ff) führten 1996 eine quantitative Studie mit Lehrkräften an Schulen für Erziehungshilfe in Nordrhein – Westfalen durch. Die Lehrkräfte sollten aus elf Definitionen zum Begriff der Verhaltensstörung, die jenige auswählen, die ihrer Auffassung am ehesten entspricht. So sollte herausgefunden werden, welche Definitionen und Aussagen zum Begriff der Verhaltensstörung Akzeptanz bei Lehrenden finden. Festgestellt wurde, dass Lehrkräfte die tiefenpsychologische, die ursachenorientierte, die merkmalsorientierte und die normativ – pädagogische Definition bevorzugen. Die interaktionistische und die deskriptiv – statistische Definition werden allem Anschein nach abgelehnt, sie stehen auf Platz 10 und 11 des Rankings. Ostermann und Saueressig gehen davon aus, dass das Ranking u.a. durch Textmerkmale beeinflusst wurde – einfache, verständliche Definitionen wurden eher präferiert als komplizierte. Zudem wurden Definitionen gewählt, welche Aspekte der „Verhaltensstörung“ (z.B. „unangemessenes Verhalten“) einfach und anschaulich beschrieben, des Weiteren Ursachen (z.B. „organische Schäden“) benannten und zusätzlich einen Ansatzpunkt für pädagogische Hilfe (z.B. „Maßnahmen der Führung“) anboten, also Definitionen mit Praxisnähe. Daran zeigt sich, dass Lehrkräfte der Sonderschulen eine Berufsgruppe mit großer Praxisorientierung darstellen. Sie müssen sich, wenn sie den Förderbedarf feststellen, an genau diesen Anhaltspunkten orientieren. Wenig erstaunlich ist, dass eher theoretische Definitionen ohne Praxisbezug auf den hinteren Rängen landen. Bemerkenswert ist allerdings, dass der lerntheoretische Ansatz nur auf Rang 5 steht, da dieser Ansatz viele Handlungsmöglichkeiten in der Schule eröffnet und Lehrkräfte als Experten für Lehr- und Lernprozesse dies nutzen könnten. Die befragten Lehrkräfte wurden auch zu ihrer Einstellung zu Unterricht und Erziehung befragt (traditionell/schülerzentriert). Wider Erwarten hatte dies, laut Ostermann/Saueressig, keinen Effekt auf die Präferenzen. Einzuwenden ist bei dieser Studie, dass sie ungeeignet ist, Aussagen über die Praxis der befragten Lehrkräfte zu formulieren. Es zeigt sich nur, welche theoretischen Konzepte bevorzugt werden, nicht deren mögliche Einflüsse auf die Praxis. Des Weiteren handelt es sich bei dieser Studie nur um Zustimmung zu Definitionen, nicht um subjektive Konstruktionen von Definitionen durch Lehrkräfte. Gleichwohl vermittelt sie einen Eindruck, welche subjektiven Definitionen möglicherweise dahinter stehen können.
Mit subjektiven Definitionen der Begriffes der Verhaltensstörung beschäftigte sich Ostermann (1997:20ff). Wie wird der Begriff an der Basis – von Lehrenden – subjektiv definiert? Ostermann versucht dem mittels einer qualitativen Studie auf die Spur zu kommen. Lehrkräfte[11] aus Schulen für Erziehungshilfe und Schulen anderer sonderpädagogischer Fachrichtungen formulierten schriftlich subjektive Definitionen über „Verhaltensstörung“, ohne sich vorher mit Kollegen auszutauschen. Die Definitionen wurden nach Überlegungen zur Sachstruktur anhand von 39 Kategorien ausgewertet. Ostermann merkt an, dass man aus den Definitionen weder herauslesen könne, wie der „Autor“ zu seiner Definition kommt (z.B. durch welche Gedanken oder Wissensbestände), noch welche latenten Inhalte eventuell mitschwingen könnten. 44[12] Definitionen enthielten Umschreibungen bzw. Nennungen von Erscheinungsbild und Auftretensmodalitäten des Verhaltens. Für das Erscheinungsbild wurden v.a. die Kategorien „Sozialverhalten/Kooperation/Kommunikation“ sowie „Persönlichkeit/Emotionalität/Selbstkontrolle/Ichbezogenheit“ gezeichnet, bezüglich der Auftretensmodalitäten vor allem „Stärke/Dauer/Häufigkeit“. Über die Hälfte der Texte nennen Folgewirkungen, hier vor allem aus der Kategorie „Beeinträchtigungen anderer, der sozialen Ordnung oder von Sachen“. Ebenfalls spielt der Normenaspekt in gut 50% der Definitionen eine Rolle, am häufigsten gezeichnet wird hier die Kategorie „die Relation Norm/Störung wird global erwähnt“. Der Normenaspekt wird folglich seltener für einen Kontext spezifiziert oder im Verhältnis zu einem Toleranzspielraum erwähnt. Auffallend ist, dass „Verhaltensstörung“ von den Lehrkräften kaum im Hinblick auf pädagogische Konsequenzen definiert wird, und dass auch eine kritisch – distanzierte Bewertung selten ist. Zwischen den Lehrkräften der verschiedenen Fachbereiche ergeben sich keine signifikanten Unterschiede. Ostermann folgert daher, dass Lehrkräfte des Fachs Erziehungshilfe keine anderen Vorstellungen über „Verhaltensstörung“ haben, als Lehrkräfte einer anderen sonderpädagogischen Fachrichtung.
Auch Mand (1995:75f) untersuchte 1990/1991 im Rahmen einer Studie, wie Lehrkräfte auffälliges Verhalten definieren. Über drei Viertel der Lehrkräfte versuchen eine Definition durch einen Bezug auf eine Norm oder auf nicht auffällige Schüler/innen – auffällige Schüler/innen verhalten sich nicht altersentsprechend. Als zweithäufigstes Merkmal wird der Zeitfaktor in die Definition aufgenommen, verhaltensauffällige Schüler/innen zeigen aus der Sicht der Lehrkräfte über einen längeren Zeitraum Verhaltensformen, die sich deutlich von denen der Mitschüler/innen unterscheiden. An dritter Stelle folgt die Intensität der Auffälligkeit. Die Lehrkräfte betonen, dass auch nicht verhaltensauffällige Schüler/innen auffällige Verhaltensweisen zeigen, allerdings in einem geringeren Ausmaß. Fast 60% der Lehrkräfte nennen in ihren Definitionen inhaltlich Auffälligkeiten, die zu Unruhe im Unterricht führen (Spielen, Kippeln, Disziplinprobleme...). Knapp die Hälfte erwähnt Probleme im Arbeitsverhalten als charakteristisch, wie etwa Konzentrationsprobleme, Leistungsprobleme oder Desinteresse. Für mehr als 40% der Lehrkräfte, so Mand, stehen aggressive Verhaltensweisen im Mittelpunkt. Die Lehrkräfte wurden zudem nach dem vermuteten Definitionsverhalten anderer Lehrkräfte befragt. Über 70% hielten es für möglich, dass Kollegen zu anderen Definitionen kommen. Erklärt wurde dies v.a. mit unterschiedlicher Erfahrung (andere Schule, andere Schüler/innen...), aber auch mit unterschiedlichen Toleranzgrenzen, unterschiedlicher Belastbarkeit und Persönlichkeit. Nur ein geringer Teil führt Unterschiede auf Aus- und Fortbildung zurück.
2.3.2 Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern aus Sicht der Lehrkräfte
Giovanni et al. (1998:108ff) führten 1997 eine quantitative Studie[13] zu Verhaltensauffälligkeiten bei Erstklässlern aus Sicht von Eltern und Lehrkräften durch. Die Lehrkräfte beurteilten Verhalten, Auffälligkeiten und Leistungsstand ihrer Schüler/innen. An der Studie nahmen 3 Schulen aus dem Raum Rhein – Neckar teil. Sieben der insgesamt 10 Klassenlehrerinnen sandten die Bögen zurück. Daher sind die Ergebnisse nur bedingt interpretierbar. Der Lehrerfragebogen umfasste neben Beurteilung des Lern- und Arbeitsverhaltens Items zu Verhaltensproblemen (z.B. aggressives Verhalten; Aufmerksamkeitsprobleme) mit Verhaltensausprägung sowie eine Skala zur Gesamtbeurteilung des Verhaltens. Laut Giovanni et al. (1998:115f) sind die mit Abstand am häufigsten genannten Verhaltensprobleme Aufmerksamkeitsstörungen, wie Unkonzentriertheit, Unruhe, Impulsivität und Ablenkbarkeit. Circa ein Drittel der Schüler/innen fällt den Lehrkräften dadurch stark bzw. sehr stark auf. Knapp 20% der Kinder haben aus Sicht der Lehrkräfte ein (stark) erhöhtes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Seltener wird aggressives Verhalten beobachtet: fast die Hälfte der Kinder ist niemals aggressiv, gegenüber nur 10% die „häufig“ und „sehr häufig“ aggressives Verhalten zeigen. Festzuhalten ist noch, dass aus Sicht der Lehrkräfte alle Verhaltensprobleme eher bei Jungen als bei Mädchen auftreten. Vermutlich hat dies u.a. mit der Art der Verhaltensauffälligkeit zu tun. Jungen sind eher nach außen auffällig, Mädchen dagegen zeigen eher Verhaltensstörungen, die nicht ohne Weiteres auszumachen sind und die Lehrkraft nicht vom Unterrichten abhalten. Vermutlich ist letztgenanntes ein Grund, warum Jungen aus Sicht der Lehrkräfte eher verhaltensauffällig sind. Der größte Unterschied zwischen Mädchen und Jungen wird beim aggressiven Verhalten sichtbar, aber auch bei aufmerksamkeitsforderndem Verhalten und sozialen Problemen werden wesentlich häufiger Jungen benannt. Die Mädchen werden in fast allen anderen Bereichen ebenfalls etwas günstiger eingeschätzt, allerdings sind diese Unterschiede nicht signifikant. Zudem kommen Giovanni et al. zu der Erkenntnis, dass der Leistungsstand in der Schule mit fast allen Verhaltensauffälligkeiten mehr oder weniger stark korreliert. Relativ hohe Korrelationen bestehen zwischen Leistungen und dem Gesamtverhalten sowie den Aufmerksamkeitsproblemen, was wiederum mit dem Lern- und Arbeitsverhalten korreliert. Giovanni et al. (1998:121) erwähnen eine Lehrerbefragung, die Berg et al. 1994 im Raum Bamberg durchführten, die zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist: als häufigste Auffälligkeiten wurden Unkonzentriertheit, Ungenauigkeit, Unruhe benannt. In einer weiteren Untersuchung, so Giovanni et al. (1998:121), waren 75 – 85% der Lehrkräfte der Meinung, dass mehr Kinder als früher als „konzentrationsschwach“, „unruhig“ und „wenig ausdauernd“ zu bezeichnen seien.
Bei der Beschreibung verhaltensauffälliger Schüler/innen durch die Lehrkräfte kommt Mand (1995:78ff) in seiner bereits erwähnten Studie zu folgenden Ergebnissen. Fast 40% der für verhaltensauffällig gehaltenen Schüler/innen werden mit Problemen mit dem Arbeitsmaterial (Unordnung, Sauberkeit, Unvollständigkeit...) charakterisiert, gefolgt von körperlichen Aggressionen gegenüber Klassenkameraden mit knapp über 30%. Wutanfälle und andere Zustände mit Kontrollverlust, wie etwa mit dem Stuhl werfen, treffen die befragten Lehrkräfte bei gut 11% der verhaltensauffälligen Schüler/innen an. Deutlich weniger im Vordergrund stehen verbale Aggressionen (12%). Das bedeutet, so Mand, nicht, dass die restlichen 88% für verhaltensauffällig gehaltenen Schüler/innen nicht auch zu verbalen Aggressionen greifen. Vielmehr ist es ein Zeichen dafür, dass auch der Umgangston bei „normalen“ Schüler/innen von verbalen Entgleisungen geprägt sei, so dass diese Verhaltensweise nicht unbedingt als „auffällig“ betrachtet werde. Fast jeder dritte für verhaltensauffällig gehaltene Schüler/in hat in den Augen der Lehrkraft Probleme mit der Motorik (Bewegungsdrang, Grobmotorik). 27% der auffälligen Schüler/Innen sind nach Ansicht der Lehrkräfte zerstreut, chaotisch oder leicht ablenkbar (Konzentrationsprobleme). Dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass die Lehrkräfte betonen, dass bei einem guten Teil der für verhaltensauffällig gehaltenen Schüler/innen Anweisungen mehrfach zu wiederholen seien. Immerhin fast 18% dieser Schüler/innen verweigern Mitarbeit. Trotz dieser Verhaltensweisen ist die Integration in den Klassenverband aus Lehrersicht nicht beeinträchtigt. Lediglich eine Lehrkraft gab an, dass ein Schüler von seinen Klassenkameraden abgelehnt werde. Allerdings scheint die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler/in gestört zu sein. So gibt es Schüler/innen, die ihre verbalen Aggressionen gegen die Lehrkraft richten. Erschreckend ist, dass knapp einem Viertel der für verhaltensauffällig gehaltenen Schüler/innen von der Lehrkraft unterstellt wird, dass Regelverstöße gezielt und kontrolliert seien. Etwa 10% der verhaltensauffälligen Schüler/innen möchten, so die Lehrkräfte, Aufmerksamkeit erzielen. An dieser Stelle ist noch anzubringen, dass Zwischenrufe über ein Fünftel dieser Schüler/innen in den Augen der Lehrkraft charakterisieren. Leistungsprobleme werden einem Teil der verhaltensauffälligen Schüler/innen attestiert, allerdings gibt es auch Schüler/innen, die verhaltensauffällig sind, ohne „leistungseingeschränkt“ zu sein. Eine nur marginale Gruppe stellen die als auffällig bezeichneten Schüler/innen dar, die als sehr introvertiert, still oder verträumt gelten.
Auch Klicpera/Gesteiger-Klicpera (1998:69) kommen in einer Studie in Österreich zu ähnlichen Ergebnissen: bei Schülern, die von Sonderpädagogen zusätzlich betreut werden, stehen störende Verhaltensweisen, Konzentrationsschwierigkeiten, Unruhe, aggressives Verhalten, geringe Folgsamkeit und sozial unreifes Verhalten aus Sicht der Klassenlehrer/innen im Vordergrund der Problematik. Niedergeschlagenheit, Ängstlichkeit und Scheu werden dagegen seltener genannt.
Ettrich und Herbst (2003:363ff) kommen in einer quantitativen Längsschnittstudie zu ähnlichen Ergebnissen. Befragt werden Schüler/innen einer Schule für Erziehungshilfe (Leipzig seit 1994) und deren Klassenlehrer/innen anhand des „Youth Self Report“ und des „Teacher´s Report Form“ der „Child Behavior Checklist“. Im Folgenden werden nur die Ergebnisse der Lehrerbefragung erwähnt. Wie schon in den bereits genannten Studien weisen auch hier externalisierende Störungen (v.a. aggressives Verhalten) sowie Aufmerksamkeitsstörungen[14] die größte Auffälligkeitsrate auf, jedoch scheinen auch internalisierende Störungsarten (sozialer Rückzug, Angst..) eher genannt zu werden (Ettrich/Herbst 2003:366f). Ettrich und Herbst betonen allerdings, dass die befragten Lehrkräfte eine sehr professionelle Problemsicht bezüglich ihrer Schüler/innen aufweisen.
Untersuchungsergebnisse aus der Studie von Berg et al. (1998:285) in Bamberg zeigen, wie bereits auch schon die Studie von Giovanni et al., deutliche Unterschiede bei der Einschätzung von Verhaltensauffälligkeit zwischen den Geschlechtern: Etwa 21 % der Mädchen wurden in einer Kategorie als „stark auffällig“ eingeschätzt, gegenüber fast 40% der Jungen. In fast allen Kategorien werden bei Jungen signifikant häufiger starke Auffälligkeiten wahrgenommen. Nur bei den internalisierenden Verhaltensproblemen sind keine signifikanten Unterschiede festzustellen. Wie auch in den anderen Studien bereits festgestellt, erleben Lehrkräfte v.a. „Unkonzentriertheit“, „Unruhe“, „Ungenauigkeit“, „mangelnde Motivation“ und „Fordern von Aufmerksamkeit“ als charakteristisch bei Schülern (Berg et al. 1998:283), die sie für stark auffällig halten.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Studie der Alice – Salomon – Fachhochschule in Berlin (Ballusek 2004:293). Befragt zu den drei schwierigsten Schülern/innen im Unterricht, geben die Lehrkräfte zu 75% Jungen an.
Interessant ist auch eine Studie mit Lehrer/innen, die zwischen 1996 und 2002 aus Krankheitsgründen frühpensioniert wurden, die Harder (2003:8f)[15] erwähnt. Als Hauptgrund für ihre Krankheiten nannten die Lehrkräfte, die aus ihrer Sicht zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern, v.a. Hyperaktivität, mehr Erziehungsaufgaben, Disziplinlosigkeit, Schulunlust bei Schüler/innen, Leistungsunterschiede und zu wenig Sanktionsmöglichkeiten. In Anbetracht der Tatsache, dass nur 6% der Lehrkräfte (Harder 2003:8f) zum regulären Zeitpunkt pensioniert werden, stimmt dies nachdenklich und verdeutlicht den Handlungsbedarf.
2.3.3 Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten aus Sicht der Lehrkräfte
Nach Mands Studie (1995:80ff) ist die Mehrheit der Lehrkräfte der Überzeugung, dass Verhaltensauffälligkeiten durch das Elternhaus verursacht werden – genauer bei über 70% der Schüler/innen mit Verhaltensauffälligkeiten. Als verursachende Umstände im Elternhaus gelten v.a. Eheprobleme und Ein – Eltern – Familien, aber auch fehlende Liebe und Zuneigung (Zuwendungsdefizit), Geschwisterkonstellationen (Nachkömmling, bevorstehende Geburt...) und „Verwahrlosung“ (Kleidung, Hygiene, Informationen über Elternhaus) werden als Erklärung herangezogen. Bei circa einem Zehntel der auffälligen Schüler/innen vermuten die Lehrkräfte Verwöhnungserscheinungen (Überbehütung). Für einen kleinen Teil der „Fälle“ wird ein inkonsequenter Erziehungsstil der Eltern verantwortlich gemacht. Als problematisch gelten für die Lehrkräfte insbesondere der „Laissez – Faire – Stil“, Unterschiede im Erziehungsverhalten der Partner sowie das Ausprobieren verschiedener Erziehungsstile. Von fehlenden Normen sprechen die Lehrkräfte in dieser Studie ebenfalls bei einem kleinen Teil der auffälligen Schüler/innen. Geschlechtsrollenerwartungen werden noch seltener als Ursache für Verhaltensprobleme herausgestellt – wenn doch, dann in der Regel bei Migrantenkindern. Auch der Einfluss des Leistungsdrucks seitens der Eltern wird in wenigen Fällen als ursächlich eingeschätzt.
Bezogen auf den Einfluss vom Elternhaus auf Schüler/innen, die von ihren Lehrern für verhaltensauffällig und behandlungsbedürftig gehalten werden, stellen Gasteiger - Klicpera/ Klicpera (1998:8) in einer Befragung von Wiener Lehrkräften fest, dass diesen Kindern mangelnde Unterstützung und Förderung durch ihr Elternhaus attestiert werden. Auch in der Studie der Alice – Salomon – Fachhochschule (Ballusek 2003:293) geben Lehrkräfte bei Verhaltensauffälligkeiten v.a. die Familie als Ursache an. Die Rolle der Schule geht bei ihnen völlig unter. Bei Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:70) halten Lehrkräfte das Elternhaus ebenfalls für prägend, messen allerdings auch der Schule eine Bedeutung zu: ein guter Teil der Schüler/innen versuche v.a. seine Position in der Klasse zu verbessern, ebenfalls ein erheblicher Teil würde von Mitschülern abgelehnt und bei etwa jedem fünften Kind würde die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler/in zur Auffälligkeit beitragen. Ein weiteres Feld zur Erklärung von Verhaltensauffälligkeiten stellen, nach Mand (1995:80ff), medizinische Ansätze dar. Bei jedem zehnten verhaltensauffälligen Kind ziehen die Lehrkräfte in der Befragung physiologische Gründe als Ursache in Betracht, wie etwa MCD, „Alkoholkind“, „Gehirnstörung“ oder „Debilität“. Eine gewisse Rolle spielen hier auch die genetischen Anlagen des Kindes („Vorbelastungen“) – teilweise werden dabei auch rassistische Erklärungen herangezogen (ausländischer Elternteil).
2.3.4 Zusammenfassung
Insgesamt verdeutlichen die Studien, dass die externalisierenden Störungen (Unruhe, aggressives Verhalten) die Wahrnehmung der Lehrkräfte bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern dominieren. Wahrscheinlich resultiert dies aus der Tatsache, dass diese Störungen schnelle Reaktion der Lehrkraft erfordern und sich im Gesamteindruck eher summieren. Aufmerksamkeitsprobleme sind ebenso ein Charakteristikum, welches durchgängig genannt wird – allerdings ist davon auszugehen, dass dies v.a. dann auffällt, wenn es mit Folge- bzw. Ursacheerscheinungen zusammenhängt, wie Lernbeeinträchtigung, Unruhe, Dazwischenreden u.v.m.. Weniger oft werden internalisierende Störungen als störend wahrgenommen. Ein Grund mag sein, dass diese Störungen den Unterrichtsgang nicht aufhalten – möglich wäre allerdings auch, dass diese Störungen manchmal gar nicht wahrgenommen werden. Auffällig ist auch die unterschiedliche Wahrnehmung von Jungen und Mädchen bezüglich des Verhaltens, wobei vermutlich die Jungen aufgrund der Art der Störungen eher auffallen – obschon die Mädchen auch durch internalisierende Verhaltensweisen keineswegs mehr auffallen als die Jungen, im Gegenteil. Bei den Definitionen überwiegen Beschreibungen von Auftretensmodalitäten (Dauer und Intensität), Erscheinungsformen, der Bezug zu Normen und der Vergleich zu Klassenkameraden. Bezeichnend ist, dass bei den subjektiven Definitionen kaum Bezug zu Handlungsmöglichkeiten genommen wird, obwohl dies in der Studie zu Präferenz von Definitionen positiv gewertet wurde. Des Weiteren lässt sich sagen, dass die Definitionen sich jeweils von Lehrer zu Lehrer unterscheiden, weil jede Lehrkraft über eine subjektive Theorie von Verhaltensauffälligkeiten, deren Erscheinungsformen, Ursachen und zum Umgang damit verfügt.
3. Prävention und Intervention
3.1 Maßnahmen (in) der Schule
Den Anfang dieses Kapitels bilden Ergebnisse einer Studie zu konkreten Handlungsmustern von Lehrkräften im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen. Die verbreiteten Maßnahmen, wie Gespräch, Extra – Aufgabe, Einsatz von Signalreizen werden nicht weiter thematisiert. Es folgen einige Möglichkeiten, wie man mit verhaltensauffälligen Schülern umgehen kann, bzw. wie man Verhaltensauffälligkeiten vorbeugen kann. Eine Trennung in präventive- und reaktive Maßnahmen ist nicht vorgenommen worden, weil sie im Einzelfall nicht immer eindeutig scheint. So reagiert beispielsweise die Trainingsraummethode auf Unterrichtsstörungen, beugt ihnen gleichzeitig aber auch vor. Es ist nicht möglich einen umfassenden Überblick zu geben, da der „Markt“ der Möglichkeiten schier unübersehbar ist. Die Auswahl umfasst bekannte, verbreitete und/oder bewährte Umgangsmöglichkeiten, wie auch neue Ansätze. Vieles ist davon nicht nur für und im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern, sondern für Lehrkräfte, Schüler/innen und Schulklima generell sinnvoll.
3.1.1 Handlungsmuster von Lehrkräften
In einer Studie von Mand (1995:84ff) wurden Lehrkräfte befragt, welche Handlungsmuster sie gegenüber verhaltensauffälligen Schülerinnen empfehlen und welche sie konkret – bezogen auf verhaltensauffällige Schüler/innen anwenden. Dabei kamen deutliche Unterschiede zu Tage. So setzen Lehrkräfte nach eigenen Angaben bei der Hälfte der verhaltensauffälligen Schüler/innen auf das Klassengespräch, empfohlen hat es allerdings nur ein Viertel. Elternkontakt spielt in den Empfehlungen sowie auch im konkretem Umgang eine wichtige Rolle – bei ca. 30% der verhaltensauffälligen Schüler/innen setzen Lehrkräfte darauf. Etwa ein Fünftel der verhaltensauffälligen Schüler/innen wird ermahnt, obgleich dies bei den empfohlenen Handlungsmustern von keiner Lehrkraft genannt wurde. 18% der verhaltensaufälligen Schüler/innen werden gelegentlich von ihrer Lehrkraft angeschrieen. Als angemessenes Handlungsmuster wurde dies kaum je genannt. Erklärbar wird dies durch eine emotionale Aufladung der Lehrkraft (Wut[16], Ärger) und durch den Zwang rasch handeln zu müssen. Bei nur etwa 14% der verhaltensauffälligen Schüler/innen setzen Lehrkräfte auf Unterrichtsveränderungen, obwohl dies jede fünfte Lehrkraft empfiehlt. Jeder zehnte auffällige Schüler muss Zärtlichkeiten der Lehrkraft über sich ergehen lassen, auch wenn dies nur äußerst selten empfohlen wird. Obwohl fast jede fünfte Lehrkraft Lob als adäquaten Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern empfiehlt, wird Lob nur bei gut 10% der Schüler/innen praktiziert. Gut jede zehnte verhaltensauffällige Schülerin wird ignoriert oder hat einen besonderen Sitzplatz. 8% der Schüler/innen haben es mit Lehrkräften zu tun, die glauben, dass es sich nicht rentiert laut zu werden, empfohlen wird dies von keiner Lehrkraft. Fast 7% sind mit Sanktionssystemen konfrontiert und 5% besuchen Klassen, in denen es eindeutige Regeln gibt, letzteres wird erstaunlicherweise von kaum einen Lehrer als Handlungsmuster empfohlen. Ebenfalls etwa 5% werden des Raumes verwiesen und nur 3% bekommen Extraaufgaben, obwohl beides von deutlich mehr Lehrkräften empfohlen wird. Kontakte zum Schulpsychologen, zu Kollegen und Ämtern werden zwar empfohlen, aber kaum verwirklicht. Ein gutes Drittel der Lehrkräfte ist, Mand zufolge, mit ihren Handlungsmustern gegenüber verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen nicht zufrieden.
3.1.2 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 des Schulgesetztes für Baden – Württemberg stellen einen Teil dessen dar, wie auf grobes Fehlverhalten in Schulen reagiert wird. Sie dienen, nach Böhm (2000:1), der Gewährleistung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schulen, wie auch dem Schutz von Personen und Sachen. Im Gegensatz zu strafrechtlichen Sanktionen fehlt ihnen der Vergeltungs- und Sühnegedanke, denn sie gelten nicht als Strafe.
Nicht durch § 90 geregelt sind, nach Böhm (2000), pädagogische Maßnahmen, wie Ermahnung, Brief an die Eltern, Übertragung besonderer Aufgaben, Änderung der Sitzordnung, Eintrag ins Klassenbuch u.v.m.. Diese Maßnahmen darf die Lehrkraft nach eigenem Ermessen und in eigener Verantwortung auswählen – basierend auf den Grundsätzen der Angemessenheit, der Verhältnismäßigkeit und der Geeignetheit. Bei pädagogischen Maßnahmen ist der Erziehungsgedanke vorrangig, Alter und Entwicklungsstand des Schülers werden berücksichtigt. Pädagogische Maßnahmen greifen sofort, da die Eltern kein Anhörungsrecht, sondern nur ein Beschwerderecht haben und daher keinen Widerspruch mit aufschiebender Wirkung einlegen können.
Im Gegensatz[17] dazu sind Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz festgelegt, Lehrkraft und Schule dürfen den Katalog nicht verändern. Bei der Auswahl spielt neben dem erzieherischen Aspekt oftmals der Schutz- bzw. Ordnungsgedanke eine Rolle. Zudem muss gelten, dass pädagogische Maßnahmen alleine nicht mehr ausreichen. Bei Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gelten gewisse Zuständigkeitsregeln, so darf die Lehrkraft nur über Nachsitzen bis zu zwei Unterrichtsstunden alleine entscheiden. Für alle weiteren Entscheidungen ist der Schulleiter (Nachsitzen bis zu vier Unterrichtstunden; Androhung/Ausschluss vom Unterricht bis zu zwei Tagen/Überweisung in Parallelklasse), die Klassenkonferenz (Ausschluss vom Unterricht bis zu vier Wochen, Androhung/ Ausschluss aus der Schule) oder das Schulamt bzw. Kultusministerium (Ausweitung des Schulausschlusses) verantwortlich. Maßgeblich für die Wahl sind die gleichen Grundsätze wie bei pädagogischen Maßnahmen. Die Maßnahme des zeitweisen Ausschlusses ist nur bei wiederholtem bzw. bei schwerem Fehlverhalten zulässig, Schulausschluss nur dann, wenn der Verbleib des Schülers in der Schule eine Gefährdung der Erziehung und Gesundheit der Mitschüler/innen darstellt. Die stark in die Rechte des Schülers eingreifenden Maßnahmen des Ausschlusses sowie der Überweisung in eine Parallelklasse stellen Verwaltungsakte dar. Die Eltern minderjähriger Schüler/innen sind daher vor deren Durchführung förmlich anzuhören. Die Eltern können zudem einen Widerspruch einlegen, der eine aufschiebende Wirkung hat. Wiewohl generalpräventive Aspekte, nach Böhm (2000:51), in die Überlegungen einfließen dürfen, sollte die Auswahl einer Maßnahme nicht maßgeblich davon beeinflusst werden.
Es sei dahin gestellt, ob Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ein adäquates Mittel sind, um Verhaltensauffälligkeiten zu begegnen. Nach Simsa (1999:142) weisen Befragungen von Schulleiterinnen, Lehrkräften und Schülern darauf hin, dass Ordnungsmaßnahmen nur selten angewandt werden und Lehrkräfte deren Wirksamkeit skeptisch beurteilen. Knapp 28% schätzen beispielsweise den Schulausschluss als „sehr wirksam“ ein, allerdings über die Hälfte als „nicht“ oder „wenig wirksam“.
Simsa (1999:143) erwähnt eine weitere Studie, aus der hervorgeht, dass vor allem Gewaltvorfälle und mit deutlichem Abstand andere Normbrüche, dauerhafte Störungen, Fernbleiben und Drogenkonsum die Ursache für Schulausschlüsse darstellen. Begründet wurde diese Maßnahme am häufigsten damit, dass der Unterricht sowie das Wohl von Lehrkräften und Mitschülern zu gewährleisten sei oder dass bestimmte Verhaltensweisen bestimmte Konsequenzen erfordern. Nur in ca. einem Drittel der Fälle wurden Überlegungen getroffen bezüglich der Schülerin, wie etwa „bisherige Maßnahmen haben nicht genützt“ und nur in einer geringen Zahl wurden spezialpräventive Gründe herangezogen. Nach Simsa konnte der pädagogische Sinn daher in vielen Fällen nicht ausreichend begründet werden.
3.1.3 Trainingsraummethode
Die Trainingsraummethode wurde von Edward Ford entwickelt und in Schulen in Arizona erstmals erprobt und ist daher auch als „Fordprogramm“ bzw. „Arizonamethode“ bekannt. Nach Balke/Balz (2005:31) wird sie in Deutschland seit 1996 mit steigender Tendenz angewendet. Ziel des Programms ist es, so Balke/Balz (2005:31), langfristig Disziplinstörungen im Unterricht zu minimieren und so einen entspannten Unterricht für Lehrkräfte und Schüler/innen zu ermöglichen. Die wissenschaftliche Theorie, die dem Programm zugrunde liegt, ist, so Bründel/Simon (2003:Kapitel 2), die von Powers begründete Wahrnehmungskontrolltheorie, die davon ausgeht, dass Verhalten nicht eine Reaktion auf die Umwelt darstellt, sondern das Ergebnis von Impulsen zur subjektiven Veränderung der Umwelt ist, so dass sie den Bedürfnissen und Wünschen der handelnden Person entspricht. Das Verhalten wird also dann geändert, wenn die tatsächliche Wahrnehmung nicht der erwünschten Wahrnehmung entspricht. Alle Menschen kontrollieren ihre Wahrnehmung permanent („Was sehe ich?“ vs. „Was möchte ich?“). Verhalten soll demnach modifizieren, was eine Person wahrnimmt.
Grundlage des Programms ist, so Schlegel (2003:18), gegenseitiger Respekt. Bezogen auf eine Klasse lassen sich daraus drei Regeln ableiten:
- Jede Lehrerin, jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
- Jede Schülerin, jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen.
- Jeder muss die Rechte des anderen akzeptieren.
Auf dieser Grundlage werden in der Klasse Regeln erarbeitet, die für alle gelten.
Wenn, so Balke/Hogenkamp (2000:2f), ein störender Schüler[18] trotz Erinnerung an die Regeln und ruhiger Ermahnung weiterhin stört, muss er den „Trainingsraum für eigenverantwortliches Denken“ aufsuchen und dort einen Plan erarbeiten, in dem er eine Möglichkeit darlegt, wie er wieder am Unterricht teilnehmen kann ohne zu stören. Dabei ist es wichtig, dass die Zielsetzung des Verhaltens freigelegt wird. Auf dieser Grundlage wird überlegt, wie der Schüler sein Ziel erreichen kann ohne zu stören. Die Vorschläge sollten, so Balke/Hogenkamp, auf der Ebene des beobachtbaren Verhaltens liegen, damit die unterrichtende Lehrkraft Fortschritte sieht und ggf. zurückmelden kann. Bei der Erstellung bekommt der Schüler Unterstützung durch eine Lehrkraft oder Sozialpädagogin. Wird der Plan von der unterrichtenden Lehrkraft akzeptiert, kann der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen.
Vorteil des Programms ist meines Erachtens v.a. die stets gleichbleibende Frageprozedur mit der immer gleichen Konsequenz. Die Schüler/innen sind nicht der Willkür der Lehrkraft ausgesetzt und haben eine gewisse Entscheidungsfreiheit, da sie sich nach der ersten Störung selbst entscheiden können, ob sie im Klassenverband verbleiben oder in den Trainingsraum gehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schüler/innen für ihr Verhalten selbst verantwortlich gemacht werden. Unberücksichtigt bleibt, dass Störungen im Unterricht manchmal auch auf Fehlverhalten der Lehrkraft zurückzuführen sind.
Nach einer von Balz (2005:7) durchgeführten Studie in Nordrhein – Westfalen arbeiten in über 40% der Trainingsräume Schulsozialarbeiter/innen aktiv mit. Sie werden v.a. für die Arbeit mit „Viel – Besuchern“ und deren Eltern eingesetzt. Die Sozialarbeiter/innen nennen als Maßnahmen v.a. Beratungsgespräche und Vermittlung an andere Einrichtungen. Nach Balz (2005:11f) ist die Zustimmungsquote bei Einführung in den Kollegien hoch, in über 85% der Schulen liegt sie bei mehr als 80%. Im Verlauf des Programms steigert sich dies sogar noch. Das kann daran liegen, dass die befragten Lehrkräfte viele Vorteile des Programms sehen: Höchste Zustimmungsraten hatten beispielsweise die Entlastung der Lehrkraft im Unterricht, ein geringerer Lärmpegel, die einfachere Führung schwieriger Schüler/innen, die ersparte Zeit bei Störungen und weniger Machtkämpfe zwischen Schülerinnen und Lehrkräften. Unterrichtsunabhängige Items erfuhren deutlich weniger Zustimmung, wie beispielsweise eine Verbesserung der Kooperation im Kollegium. Ein Teil der Lehrkräfte lehnt, laut Balz (2005:11), das Programm aus organisatorischen/finanziellen, didaktisch – methodischen oder persönlichen Gründen ab.
Diverse andere Programme haben in ihren „Kanon“ ebenfalls „Auszeiten“ integriert, wie zum Beispiel das Marburger Konzentrationstraining, welches, so Krowatschek/Hengst (2004:61), mit „roten“ und „gelben“ Karten arbeitet.
3.1.4 Streitschlichtung, Mediation, Täter – Opfer – Ausgleich
Mediation durch Schülerstreitschlichter ist, nach Schlegel (2003:17f), ein wesentlicher Bestandteil der Konfliktbewältigung an Schulen. Streitschlichtung durch Schüler/innen wird bei alltäglichen Streitigkeiten eingesetzt, bei denen oft nicht mehr auszumachen ist, wer den Streit angefangen hat und sich die Konfliktparteien gegenseitig die Verantwortung zuschieben. In den meisten Mediatorenprogrammen wird den Schülern viel Verantwortung überlassen, so zeigt eine Studie unter Koordination des Instituts des Rauhen Hauses (2005:97), dass nur bei jeder zehnten befragten Hauptschule die Schüler/innen nicht in das Mediationsprogramm integriert waren, in fast einem Viertel der Schulen sind sie sogar alleine zuständig, ansonsten häufig in Kombination mit Lehrkräften. Auch Sozialarbeiter sind in 25% der Schulen mitbeteiligt, selten sind dagegen Eltern involviert. Bezüglich der Sozialarbeit lässt sich sagen, dass Schulsozialarbeit noch lange nicht flächendeckend eingerichtet ist und das Ergebnis dadurch verzerrt wird. Man kann davon ausgehen, dass Schulen mit Sozialarbeit ihre Sozialarbeiter/innen im Mediationsprogramm einsetzen.
Bei der Schlichtung darf, nach Schlegel (2003:17), jede Partei ihrer Sicht schildern. Ziel ist es, dass zum Schluss ein schriftlicher „Vertrag“ geschlossen wird, in dem jede Partei festlegt, was sie zur Beilegung des Konflikts betragen kann. Idealerweise wird hierbei eine Lösung angestrebt, von der beide Parteien profitieren und die Entschuldigungen bzw. Wiedergutmachungen von beiden Parteien enthält. Dem Bundesverband Mediation (2002:8f) zufolge gelten für Streitschlichtung folgende Grundsätze: Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Offenheit, Allparteilichkeit, Einhalten der Gesprächsregeln und Fairness. Zudem wird auf die Wichtigkeit einer gründlichen Ausbildung und einer Begleitung durch speziell qualifizierte Lehrkräfte hingewiesen.
Dies geschieht nach der Studie des Rauhen Hauses (2005:99) auch. Zwei Drittel der Schulen lassen sowohl beteiligte Lehrkräfte als auch beteiligte Schüler/innen für das Programm schulen. Nur 17% bzw. 10% schulen ausschließlich Schüler/innen bzw. Lehrkräfte. Laut Schlegel (2003:17f) hat sich in vielen Schulen gezeigt, dass die Streitschlichter in sozialer und moralischer Hinsicht enorm von ihrer Tätigkeit profitieren und sich dies auf das soziale Klima der Schule auswirkt. Hier liegt m.E. auch die Chance des Programms bezüglich verhaltensauffälliger Schüler/innen. Wichtig ist dabei, dass Mediation dauerhaft betrieben wird, nach der Studie des Rauhen Hauses ist dies in über 60% der Grund- und Hauptschulen der Fall, allerdings nur in einem Drittel der reinen Hauptschulen.
Für Simsa (1999:147) gerät Schulmediation bei Schülern mit „erheblicher krimineller Energie“ an ihre Grenzen. Hier kommt zur Schlichtung allenfalls ein Täter – Opfer – Ausgleich in Frage, der ein Verfahren zur Lösung nicht alltäglicher bzw. gravierendener Konflikte ist. Nach Schlegel (2003:17) ist der Täter – Opfer – Ausgleich ursprünglich als eine Alternative zum Strafvollzug entwickelt worden. In den letzten Jahren wird er verstärkt in Schulen angewendet und soll einen Ausgleich schaffen, wenn Schüler/innen durch körperliche-, psychische- oder verbale Gewaltformen von Mitschülerinnen geschädigt werden. So soll eine Konfliktbewältigung im gegenseitigen Einvernehmen ermöglicht und eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme vermieden werden. Ein Täter – Opfer – Ausgleich wird von speziell ausgebildeten Lehrkräften/Sozialarbeitern durchgeführt. Dabei wird der Täter mit den Folgen seines Handelns konfrontiert, angehalten sich in sein Opfer hineinzuversetzen, sein Verhalten zu reflektieren und Wiedergutmachung in Wort und Tat zu leisten. Der Täter hat dadurch die Chance, die Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen, und das Opfer erfährt Gerechtigkeit.
Glattacker et al. (2002:141ff) berichten von den Evaluationsergebnissen des Programm „Konflikt – Kultur“, welches aus Streitschlichtung und Täter – Opfer – Ausgleich an Schulen besteht. Die Ergebnisse zeigen, dass je 60% der Lehrkräfte und Schüler/innen Veränderungen an ihrer Schule durch das Programm wahrnehmen, ein Viertel sieht jedoch keine bzw. eher keine Veränderung. Die festgestellten Veränderungen beziehen sich seitens der Schüler/innen v.a. auf „weniger Gewalt“ und mit einigem Abstand „verbesserte Konfliktkultur“, während Lehrkräfte die „verbesserte Konfliktkultur“ am häufigsten nennen – und hier vor allem das verbesserte Schulklima. Weniger häufig nennen sie Veränderungen bezüglich Gewalt. 40% sind zwar der Meinung, dass die Gewalt zurückgegangen ist, aber 60% teilen diese Auffassung nicht. Ein guter Teil der Lehrkräfte lobt die Arbeitsentlastung durch das Programm. Sowohl Schüler/innen als auch Lehrkräfte stehen mit Zustimmungsraten von jeweils ca. 80% hinter dem Programm. Beide Verfahren stellen m.E. eine Entlastung für die Lehrkraft dar, weil sie nicht mehr für die Lösung aller Konflikte alleine verantwortlich ist.
3.1.5 Stufenpläne
Die Grundidee von Stufenplänen ist, nach Schlegel (2003:17), verhaltensauffälligen Schülern ein durchschaubares und abgestuftes System an Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dabei sollte jede Interventionsmöglichkeit innerhalb des Stufenplans mit einer Rückmeldung zur Situation, mit einem Gespräch über mögliche Ursachen des Verhaltens, mit Abklärung von Unterstützungsmöglichkeiten und mit der Erstellung eines Plans zur zukünftigen Vermeidung des Fehlverhaltens verbunden sein. Für den Fall, dass vereinbarte Hilfen nicht greifen, bzw. die betroffene Schülerin ihr Verhalten nicht ändert, drohen weitere Interventionen bis hin zum Schulausschluss. Stufenpläne sind ein Mittelweg zwischen von oben auferlegten Konsequenzen und Vereinbarungen. Auf beides wird nicht zugunsten des anderen verzichtet. Nach Schlegel (2003:16) stammen Stufenpläne ursprünglich aus der Drogenhilfe. Dementsprechend existieren eine Reihe von Stufenplänen bezogen auf den Umgang mit suchtkranken Jugendlichen im Bereich der Schule. Diese Stufenpläne lassen sich ohne weiteres auf verhaltensauffällige Schüler/innen übertragen.
Der Stufenplan der „Fachstelle Prävention“ (S.13ff) umfasst beispielsweise fünf Stufen, die von reiner Beobachtung, über Gespräche mit Lehrkraft, Eltern, Schulleitung bis hin zum Schulausschluss reichen. Jede Stufe ist mit konkreten Gesprächsinhalten, Zielen und Maßnahmen verbunden.
Vorteile von Stufenplänen sind, so Schlegel (2003:17), dass Schüler/innen durch die hohe Transparenz besser einschätzen können, welche Konsequenzen auf ihr Verhalten folgen. Sie werden durch die gestuften Interventionsmöglichkeiten immer wieder gewarnt, bevor sie aus der Schule ausgeschlossen werden. Zudem sind alle Interventionsmöglichkeiten im Idealfall mit weitreichender Unterstützung verbunden. Lehrkräfte sparen, so Schlegel, Zeit und Energie, weil frühzeitig reagiert wird und die Lehrkräfte im stetigen Dialog mit betroffenen Schülern und Schülerinnen stehen.
3.1.6 Verstärkung und Token – Programme
Verhaltensverstärkung beruht auf der verhaltenstherapeutischen Annahme, dass Fehlverhalten erlernt wurde und folglich auch wieder verlernt werden kann. Erwünschtes Verhalten wird aufgebaut und nicht erwünschtes Verhalten abgebaut. Nach Ortner/Ortner (1995:28) greift dies ineinander über. Gearbeitet wird dabei u.a. mit positiven Verstärkern, welche die Auftretenswahrscheinlichkeit erhöhen. Sie können, so Ortner/Ortner, materieller, sozialer und symbolischer Art sein. Sofortige und planvolle Verstärkung erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit – vor allem zu Beginn. Da Verstärker Abnutzungsprozessen unterliegen, ist es wichtig, allmählich auf intermittierende Anwendung umzuschalten. Goetze (2001:196) nennt neben positiver Verstärkung weitere Möglichkeiten erwünschtes Verhalten aufzubauen: Zum einen „prompting“, also eine verbale Hilfestellung, die den Schüler auf das erwünschte Verhalten lenkt und zum anderen Verhaltensverkettung. Hier wird einem Schüler beispielsweise bei einer Aufgabe geholfen, den letzten Schritt muss er alleine lösen und wird dafür gelobt. Er verweist auch auf die Notwendigkeit Verstärker „auszuschleichen“, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Verhaltensabbau geschieht, laut Ortner/Ortner, hauptsächlich mit Maßnahmen der Bestrafung und der Extinktion. Goetze (2001:196) nennt hier beispielhaft Löschung (in Koppelung mit Verstärkung von erwünschtem Verhalten), Entzug von Verstärkern und Auszeit. Er verweist auf die Gefahr der „negativen Verstärkerfalle“, dass Lehrkräfte zum Beispiel durch ihre Aufmerksamkeit negatives Verhalten verstärken. Goetze hält v.a. den Entzug von Verstärkern für sinnvoll, allerdings muss dies sofort erfolgen bzw. spürbar sein.
Token – Systeme arbeiten mit solchen Abbau- und Aufbaustrategien. Sie sind, nach Ortner/Ortner (1995:29), Motivationssysteme, in welchen Schüler/innen für die Ausführung festgelegter Verhaltensweisen sog. Tokens erwerben und diese bei Fehlverhalten gegebenenfalls wieder verlieren. Die Tokens können, nach Ortner/Ortner, Gutscheine, Münzen oder Punkte sein, die gegen festgelegte Sachen oder Tätigkeiten eingewechselt werden können. Die Inhalte des Token – Programms müssen vorher zwischen Lehrkraft und Schüler/in ausgemacht werden, welche Verhaltensweisen erwünscht sind, wie diese „entlohnt“ werden und wie die Tauschregeln aussehen. Wenn die Kriterien für Tokens eindeutig festgelegt sind, können die Schüler/innen sich durch eine Strichliste selbst kontrollieren und diese mit jener der Lehrkraft vergleichen. Ziel des Programms ist es, nach Ortner, dass die materielle Verstärkung allmählich überflüssig wird und beispielsweise soziale Verstärker, wie Lob an deren Stelle treten. Das Marburger Konzentrationstraining für Kinder mit ADHS arbeitet beispielsweise, nach Krowatschek/Hengst (2004:60), mit einem Punkteplan, bei dem die Punkte eingetauscht werden können.
Goetze (2001:197) kritisiert an Verhaltensverstärkungsprogrammen u.a., dass menschlichem Handeln ein „Warencharakter“ zugewiesen werde. Die Machtverhältnisse zwischen Lehrkraft und Schüler/in würden nicht thematisiert. Nur leicht operationalisierbares Verhalten stehe im Fokus, soziale Zusammenhänge würden dem Schüler nicht bewusst gemacht. Zudem sei das System abgekoppelt von ethischen Modellen und die Menschen würden im Prinzip fremdgesteuert, fast wie die Ratten in Pawlows Käfig. Vernunft und Diskursfähigkeit des Menschen gingen nicht in das Programm ein.
Diesen Kritikpunkten gegenüber darf man allerdings nicht vergessen, dass Verstärkerprogramme funktionieren und so teilweise Unterricht erst ermöglichen, Hoffmann (2004:75) merkt diesbezüglich an, dass Untersuchungen zufolge verhaltenstherapeutische Verfahren bei Kindern und Jugendliche mittlere bis starke Effekte haben. Die o.g. Kritikpunkte wurden daher aufgegriffen und u.a. bei den Kontingenzverträgen berücksichtigt.
3.1.7 Kontingenzverträge
Nach Goetze (2001:199f) sollte Verhaltensmodifikation stets in Absprache mit dem Betroffenen erfolgen. Eine Möglichkeit der Absprache ist ein Kontingenzvertrag, in welchem die jeweiligen Einzelheiten festgeschrieben werden. Sie sind eng verwandt mit den eben schon genannten Token – Programmen. Kontingenzverträge werden, nach Ortner/Ortner (1995:29), zwischen einem oder mehreren Schülern, bzw. der ganzen Klasse und der Lehrkraft geschlossen. Zielsetzung ist, dass sich der Schüler im besten Fall vollständig selbst kontrolliert. Voraussetzung, um einen Vertrag schließen zu können, ist nach Ortner/Ortner, die genaue Verhaltensbeobachtung, da sie die Grundlage für den Vertrag bilde. Folgendes sollte, nach Goetze (2001:199f), im Vertrag festgelegt werden: Ziele, Gültigkeitsdauer, Verstärker und Verstärkungspläne, „Vertragsstrafen“ und Bonusmodalitäten. Der Vertrag wird von den beteiligten Partnern unterschrieben. Wie auch bei Verstärker – Programmen ist es wichtig, erwünschtes Verhalten sofort zu verstärken, anfangs auch kleine Schritte zu belohnen und nicht Gehorsam, sondern abgesprochene Leistung zu honorieren. Selbstredend muss der Vertrag positiv sein und in regelmäßigen Abständen kritisiert und verändert werden, bis das abgesprochene Ziel erreicht ist.
Fliegert (2003: 552f) merkt an, dass Schülerverträge Untersuchungen zufolge nur dann funktionieren, wenn der Inhalt des Vertrags mit den Schülern und Schülerinnen gemeinsam entworfen und abgesprochen wurde und so für alle einsichtig ist. Fliegert verweist auf die Wichtigkeit die Verträge regelmäßig zu überdenken. Schüler/innen müssten die Möglichkeit haben, bei Verstößen zu verhandeln (u.a. über den Sinn der Regeln), im Sinn einer Erziehung zu Demokratie und Toleranz. Von oben aufgedrückte Verträge lehnt Fliegert (2003:554) ab, da diese an militärischen Drill erinnern können.
3.1.8 Selbstkontrollverfahren und Partner – Lernen
Dem verhaltensauffälligen Schüler wird, nach Goetze (2001:199), die Verantwortung für seine eigene Intervention selbst übertragen. Ziel ist, dass der Schüler sein Verhalten selbstständig kontrolliert und steuert. Im Selbstkontrollverfahren soll dem Schüler vermittelt werden, wie er sich selbst steuern kann. So wird der Schüler aktiv in den eigenen Änderungsprozess einbezogen. Inhalt des Verfahrens ist: Selbstwahrnehmung, Selbstaufzeichnung, Selbstverstärkung und Selbstbewertung. Für Selbstwahrnehmung und – aufzeichnung bietet sich, so Goetze, zum Beispiel ein akustisches Signal an, welches den Schüler an die Einschätzung erinnert.
Nach Goetze (2001:200) bietet auch der Ansatz des Partner – Lernens vielversprechende Möglichkeiten. Hier wird in die Nähe des verhaltensauffälligen Schülers ein Mitschüler gesetzt, der ein gutes Verhältnis zum betreffenden Schüler hat und von dem dieser bereit ist Verhaltensweisen zu erlernen, bzw. sich ggf. korrigieren zu lassen. Ein Vorteil ist, laut Goetze, vor allem, dass so ein Arrangement Teil des natürlichen Lernsettings ist. Goetze weist auch auf die Möglichkeit hin, verhaltensauffällige Schüler/innen gegenseitig als Partner einzusetzen. Partner – Lernen kann auch innerhalb eines Token – Programms zur „Überwachung“ des Verhaltens eines Mitschülers angewendet werden. Mitschüler/innen können, so Goetze, effektivere Verhaltensmodikateure sein als Lehrkräfte. Schüler und Schülerinnen, die als Partner fungieren, bekommen eine gewisse Autorität, welche sich u.a. in erwünschtem Verhalten niederschlagen kann.
3.1.9 Soziale Lernprogramme und Gewaltpräventionsprogramme
Goetze (2001:202f) nennt als weitere Möglichkeit mit Verhaltensauffälligkeiten umzugehen bzw. ihnen vorzubeugen, soziale Lernprogramme und Gewaltpräventionsprogramme.
Soziale Lernprogramme haben das Ziel, die Fertigkeiten bei verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen zu entwickeln bzw. auszubauen, die noch nicht fest in ihrem Verhaltensrepertoire verankert sind. Goetze nennt bezüglich eines sozialen Lernprogramms den Ansatz von Goldstein, der u.a. folgende Fähigkeiten vermitteln möchte: zuhören, an einem Gespräch aktiv teilnehmen, etwas planen können und sich selbst kontrollieren.
Nolting/Knopf (1998:251f) nennen als Beispiele für solchen Unterricht zur Förderung sozialer Kompetenz u.a. den Einsatz von Bildern, Filmen, Rollenspielen, in denen es darum geht, sich in Menschen hineinzuversetzen und konstruktive Lösungen zu suchen. Nolting/Knopf verweisen auf einige Studien, die zum Ergebnis kamen, dass Jugendliche ihre sozialen Fähigkeiten durch solche Programme steigerten. So konnten sie sich besser in Menschen einfühlen und die Lehrkräfte beobachteten vermehrt pro – soziales Verhalten. Nolting/Knopf kritisieren, dass solche Programme hauptsächlich die „Bullys[19] “ bremsen, dabei müssten ihre Opfer ebenfalls lernen sich zu behaupten. Konsequenterweise fordern Nolting/Knopf daher (1998:255) eine Stärkung der Opfer, da so die Erfolge der „Bullys“ verhindert würden.
Gewaltpräventionsprogramme verfolgen, nach Goetze (2001:202), das Ziel eines friedlichen Schullebens. An solchen Programmen nimmt in der Regel die ganze Klasse ggf. auch die ganze Schule teil.
Ein Beispiel für so ein Gewaltpräventionsprogramm ist das „Antimobbingprogramm“ nach Olweus (Knaack/Hanewinkel 1999:13f). Im Zentrum des Programms stehen Klassenregeln, die jeweils in den Klassen gemeinsam entwickelt und regelmäßig im Gespräch bewertet werden. Sanktionen für Fehlverhalten werden ebenso im Klassenverband entwickelt. Laut Knaack/Hanewinkel haben sich u.a. schriftliche Arbeiten mit Problembezug und Auszeit – Modelle bewährt. Die Sanktionen sollten leicht umzusetzen und unangenehm, allerdings nicht feindlich sein. Ebenso können Belohnungen für erwünschtes Verhalten bzw. Ausbleiben von Fehlverhalten abgesprochen werden. In regelmäßigen Klassengesprächen werden Vorkommnisse besprochen, so werden die Regeln thematisiert und im Gedächtnis gehalten sowie ggf. verändert. Die Schüler/innen können Rückmeldung über ihre Erfahrungen mit den Regeln bzw. mit ihren Mitschülerinnen geben, und auch die Lehrkraft gibt der Klasse eine Rückmeldung. Auch können Einzelprobleme, wie Außenseitertum o.a. in der Klasse thematisiert und Möglichkeiten zur Konfliktlösung trainiert werden, zum Beispiel Streitschlichtung als Rollenspiel. Zum Programm gehört darüber hinaus eine intensivierte Aufsicht, auf dem Pausenhof, in den Fluren und für die Zeit vor Unterrichtsbeginn. Nach Knaack/Hanewinkel (1999:15) nimmt einer Studie zufolge die Zahl der Mobbing – Opfer aus Sicht von Lehrkräften und Schülern in den meisten Schulen im Verlauf des Programms ab. Zudem verbesserte sich in den Augen der Lehrkräfte die schulinterne Kooperation und das Schul- bzw. Klassenklima.
Preuss – Lausitz (1999:25) schlägt zur Gewaltprävention in Schulen vor, den Schülern mehr Körpererfahrungen zu ermöglichen. In der Schule sollte es, so Preuss – Lausitz, erlaubt sein, zu toben und zu schreien. Die in den Kindern steckende Gewalt sollte verfeinert und ausagiert werden. Beispielhaft genannt wird ein möglicher Ringkampf zwischen den „Kontrahenten“ unter der Berücksichtigung bestimmter Regeln, ein Tobe – Raum mit Punchingball, freies Theaterspiel, und anstrengende Werkstattarbeit. Im Prinzip geht es darum, dass Schüler/innen Ausdrucksformen für ihre Gefühle finden, im Einklang mit den Mitmenschen. Die Kartharsis – Hypothese ist, nach Nolting (2000:214ff), widerlegt. Aggressionen lassen sich nicht abreagieren.
Weitere Programme verfolgen, so Werner (2003:126ff), einen konfrontativen Ansatz, wie etwa das „Anti – Aggressivitäts – Training“ das ursprünglich aus der Arbeit mit delinquenten Jugendlichen stammt und modifiziert bzw. abgeschwächt als „Coolness Training“ auf die Arbeit mit Schulklassen übertragen werden kann. Grundidee ist es, den Gewaltbereiten die Provokation zu bieten, die sie sonst immer suchen. Sie sollen sich mit ihrem Tun auseinander setzen und sich in ihre Opfer einfühlen. Dies geschieht auf eine provokante, konfrontative Weise, wie etwa mit dem „heißen Stuhl“. Bestandteile solcher Programme sind u.a. „Opferperspektive“, „Konfliktlösung“, Interaktionsspiele, Selbstreflexion und Kompetenztraining. Eine Studie[20] zeigte, dass Anti – Aggressivitäts – Training keinen Effekt auf spontan-aggressive Verhaltensweisen und deviante Peerkontexte hat. Allerdings waren Effekte zur Lösung von Konflikten mit nicht – aggressiven Verhaltensweisen festzustellen. Cladder-Micus/Kohaus (2000:80ff) weisen auf die Gefahr hin, dass die Reflexion der eigenen Verhaltensweisen und das realistischere Selbstbild zu einer Lebenskrise führen könne. Das Programm führe zudem zu einer Verhaltensverunsicherung. Die bisherigen Verhaltensmuster würden aufgebrochen, und neue müssten entwickelt werden. Diese Entwicklung sei nicht immer vorhersehbar und müsse nicht unbedingt in eine erwünschte Richtung gehen. Cladder-Micus/Kohaus sprechen sich daher für eine therapeutische Begleitung aus. Als Erfolge des Programms schätzen sie verbesserte Reflexionsfähigkeit und gesteigerte Achtung der Mitmenschen ein. Meines Ermessens sind solche Effekte auch auf anderen Wegen zu erreichen. AAT hat in meinen Augen nur magere Erfolge aufzuweisen und greift massiv in die Persönlichkeitsrechte des Täters ein. Um neue Verhaltensweisen zu erlernen, erscheint es mir nicht sinnvoll, die Persönlichkeit einer Person zu demontieren. Es fehlen positive Vorbilder und eine Besinnung auf die Stärken, die als Basis für Verhaltensänderung nutzbar wären. Stattdessen bedient sich das Programm selbst aggressiver Methoden und erweitert das Handlungsspektrum des Täters so nicht. Grundsätzlich ist es richtig, den Opfern Raum zu geben. Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass auch Täter gewisse Rechte haben. Insgesamt stelle ich die Berechtigung von AAT in pädagogischen Arbeitsfeldern in Frage.
3.1.10 Kooperation mit Schülerinnen und Schülern
Eine gute Möglichkeit Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen ist, die Schüler/innen möglichst viel an der Gestaltung des schulischen Lebens teilhaben zu lassen.
Hallitzky (1998:192) nennt zum Beispiel die Schul- bzw. Klassenregeln, in denen sich die Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen und Vorstellungen wiederfinden sollten. So werden Gefühle des Ausgeliefert –Seins vermieden, welche zu auffälligem Verhalten führen können. Klassenregeln entstehen, so Hallitzky (1998:194), im Idealfall aus schwierigen Situationen unter aktiver Mitarbeit der ganzen Klasse. Die Regeln werden den Schülern und Schülerinnen dadurch einsichtiger, und sie können sich mit ihnen identifizieren.
Gleiches gilt, nach Hallitzky (1998:1993), für die Gestaltung des Klassenraums. Auch hier sollten die Schüler/innen aktiv mitgestalten, wie etwa bei Wandschmuck, Pflanzen und bei der Tischordnung. Unter Berücksichtigung verschiedener Bedürfnisse, Ziele und Interessen können Schüler/innen und Lehrkraft gemeinsam planen, so dass konzentriertes Arbeiten ermöglicht wird. Gegebenenfalls müssen bei Problemen Korrekturen vorgenommen werden, die wieder gemeinsam abgesprochen werden.
Als weitere Möglichkeit Schüler/innen einzubeziehen, nennt Hallitzky Projektunterricht, der ein Gegengewicht zum oftmals lebensfremden Bildungsplan darstellen kann.
Für die Bearbeitung von konkreten Konflikten wird eine wöchentliche Schülersprechstunde sowie ein Lehrer – Schüler – Arbeitskreis vorgeschlagen, in denen positive und negative Vorfälle besprochen und Wünsche, Anregungen sowie Lösungen thematisiert werden.
Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2002) nennt neben den rechtlich zugesicherten Formen, wie SMV und Schulkonferenz, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man Schüler/innen aktiv an der Gestaltung des Schullebens beteiligen und ihnen mehr Mitsprache einräumen kann. Dazu gehört die schülergeleitete Gesprächsrunde zur Lösung von Konflikten (2002:15), schülergeleitete Klassenversammlung (2002:57), Beschwerdekasten (2002:57) und Schülerfeedback zu Klassenklima und Lehrkraft. Hier können Schüler/innen durch Fragebögen Stellung zu Klasse und Lehrkraft beziehen (2002:65ff). Die Ergebnisse müssen selbstverständlich gemeinsam besprochen werden.
Goetze (2001:250ff) verweist auf die „Lehrer – Schüler – Konferenz“ nach Gordon, wo Lehrer – Schüler – Probleme mit einem Sechsschritt – Verfahren gelöst werden können. Wichtig ist dabei, dass beide Parteien ihre Sicht mittels „Ich – Botschaften“ mitteilen, daran schließt sich eine unstrukturierte Sammlung von Lösungsvorschlägen an, die erst im Anschluss gewertet werden. Die Klasse entscheidet sich schließlich für eine Lösung, dabei gilt der Grundsatz, dass es keine Verlierer geben soll. Dann wird besprochen, wie man dies konkret umsetzen kann. Nach einiger Zeit wird diskutiert, ob sich die Umsetzung als tragbar erwiesen hat.
Pöhlker (2000:20) nennt die Möglichkeit einer „sozialen Gruppenstunde“, in welcher die Klasse zur festgelegten Zeit jede Woche das Zusammenleben und –arbeiten thematisiert. Ziel ist der Aufbau pro – sozialer Strukturen. Dabei werden auch auf die Klasse zugeschnittene Verstärker genutzt.
3.1.11 Kooperation im Kollegium
Nach Hallitzky (1998:202f) äußern sich Verhaltensauffälligkeiten eines Schülers selten nur bei ausschließlich bei einer Lehrkraft. Kollegiale Unterstützungsverfahren zum Umgang mit auffälligen Schülern und Schülerinnen erfahren zunehmend Verbreitung in Schulen.
Hallitzky (1998:202f) weist beispielsweise auf die Möglichkeit hin, in regelmäßigen Abständen oder aus aktuellem Anlass Konferenzen einzuberufen, die pädagogische Themen behandeln. Daraus können sich u.U. auch Initiativgruppen entwickeln, die eine Thematik vertieft weiterbehandeln, und die Ergebnisse allen zugänglich machen. Möglich ist auch die Einladung schulexterner Experten.
Bergson/Luckfiel (1998:102f) nennen kollegiale Fallberatung als Möglichkeit in einem festgelegten Verfahren Problemfelder innerhalb des Kollegiums aufzuarbeiten. Bestandteile dieses Verfahrens sind u.a. Klärung des Rahmens (Zeit, Moderation), Bericht der betroffenen Lehrkraft, Blitzlicht (Gedanken, Gefühle der Zuhörer/innen), Nachfragen, „Ich als...“ – Runde (Perspektivenwechsel), Lösung suchen und Vereinbarungen. Auch Ortner/Ortner (1995:38) sprechen von Arbeitssitzungen, in denen sich Lehrkräfte über Erfahrungen mit Schülerinnen austauschen, sich über Hilfen beraten und ein gemeinsames Konzept entwickeln.
Hallitzky (1998:203) verweist auf das Konstanzer Trainingsmodell, bei dem Lehrkräfte gegenseitig im Unterricht hospitieren und Eindrücke, Erfahrungen sowie Beobachtungen austauschen. Lehrer- und Schülerverhalten mit ihren Ursachen und Verschränkungen können so aus einem anderen Blickwinkel gesehen werden und anders interpretiert werden. Zudem können eingefahrene Muster aufgedeckt und aufgebrochen werden. Klicpera/Gasteiger- Klicpera (1998:35) erwähnen eine Studie zum Konstanzer Trainingsmodell, welche eine deutliche Steigerung der Problemlösekompetenz und der Teamarbeit zeigte. Lehrkräfte setzten nach eigenen Angaben weniger auf punitive oder neutrale Reaktionen. Zudem schätzten sie die erzieherischen Aufgaben der Schule als wichtiger ein und räumten den Schülern mehr Möglichkeiten ein den Unterricht mitzugestalten. Die Schüler/innen nahmen aktiver am Unterricht teil und die Aggressionen gegenüber Lehrkräften gingen zurück. Nach Hallitzky (1998:203) steigert die Zusammenarbeit zudem die Verbindlichkeit sich mit Störfaktoren auseinander zusetzen. Obwohl diese Arbeit zeitaufwändig ist, sparen Lehrkräfte Energie, weil Probleme frühzeitig erkannt und flexibler gelöst werden.
Hallitzky (1998:203) spricht sich zudem für kooperatives Arbeiten im „Patenlehrer – System“ aus, in welchem die Schüler/innen neben dem Klassenlehrer eine zweite Ansprechperson haben. Beide Lehrkräfte arbeiten jeweils zu Hälfte ihres Deputats in zwei „Partnerklassen“, die wenn möglich über benachbarte Räume verfügen. Wenn die Lehrkraft zur Partnerklasse wechselt, unterrichtet die Partnerlehrkraft weiter. Die beiden Lehrkräfte unterstützen sich gegenseitig, Probleme können aus zwei Perspektiven beleuchtet und miteinander gelöst werden. Hallitzky weist darauf hin, dass beide Lehrkräfte eine gewisse Übereinstimmung hinsichtlich ihrer Erziehungsvorstellung haben müssen, die allerdings auch nicht zu ähnlich sein dürfen, um Stigmatisierungen vorzubeugen.
3.1.12 Empowerment
Im Gegensatz zu den bisherigen Umgangsweisen erlaubt Empowerment einen völlig anderen Zugang zur Prävention von Verhaltensauffälligkeiten. Empowerment zielt, nach Voß/Haug (2000:164), auf die Stärkung und den Ausbau der Kompetenzen und Ressourcen der Menschen sowie deren Bezugspersonen im sozialen Umfeld. Zentral ist das Vertrauen in die Selbsthilfekräfte und Stärken, über die jeder Mensch verfügt.
Für die Schule bedeutet dies, (verhaltensauffälligen) Schülern die Möglichkeit zu geben verborgene und offensichtliche Stärken zu entdecken, offen zu legen, zu erweitern und zu nutzen. Um das zu ermöglichen, muss sich die Rolle der Lehrkraft verändern. Sie muss die Sicherheit des standardisierten Unterrichts mit festgelegten Inhalten, Methoden und Zeitrahmen usw. ein Stück weit aufgeben zu Gunsten einer Suche nach den unterschiedlichen Kompetenzen der Schüler/innen. Die Lehrkraft lässt sich auf ungewohnte Prozesse im Unterricht ein, die vorher nicht planbar sind.
Voß/Haug (2000:168) heben Nebentätigkeiten der Schüler/innen besonders hervor, mit denen die Schüler/innen u.a. auf lebensfremde oder kognitiv fordernde Unterrichtsinhalte reagieren. Die Schüler/innen lenken ihre Aufmerksamkeit also auf ein anderes Gebiet. Die Lehrkraft sollte dies beobachten und für den Unterricht nutzbar machen. Die Lehrkraft wird, nach Voß/Haug, zur Lernbegleiterin, zur Partnerin und Beobachterin, welche Energie, Motivation und Kompetenzen ihrer Schüler/innen entdeckt und durch differenzierte Angebote fördert. Durch die Einbeziehung der Lebenswelt erhöht sich die Anstrengungsbereitschaft der Schüler/innen. Zudem erhöhen sich auch Selbsttätigkeit und Autonomie der Schüler/innen durch die Erweiterung ihrer Kompetenzen, da sie über mehr Handlungsmöglichkeiten verfügen. Auf den Unterricht bezogen kann das, laut Voß/Haug (2000:175), bedeuten, dass Aufgaben in einem größeren Sinnzusammenhang stehen. Schüler/innen kontrollieren sich selbst und helfen sich gegenseitig. Es bestehen mehr Wahlmöglichkeiten und die Lehrkraft bleibt im Hindergrund, um Einzelne zu fördern und um Stärken zu entdecken, die wiederum nutzbar gemacht werden. Empowerment ist, nach Voß/Haug (2000:168), angewiesen auf Verbindungen zwischen den einzelnen Ebenen, wie beispielsweise zwischen Lehrkräften, Eltern, Horten, Jugendämtern und weiteren Hilfspersonen.
3.2 Möglichkeiten der Jugendhilfe nach dem KJHG
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz spielt eine große Rolle bei der Unterstützung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher sowie deren Eltern. Dies verdeutlicht auch eine von Petermann durchgeführte Studie zur Hilfeplanung, in welcher Sozialarbeiter/innen von Jugendämtern zu insgesamt fast 130 Hilfeplanungen befragt wurden. Bei über der Hälfte der betroffenen Kinder und Jugendlichen lagen aus Sicht der Sozialarbeiter/innen Verhaltensprobleme vor (Petermann/Schmidt 1995:66f), hierbei stellen externalisierende Probleme den größten Anteil. Man kann also sagen, dass ein guter Teil der Hilfeplangespräche aufgrund Verhaltensauffälligkeiten geführt wurde. Dazu passt, dass von Mitarbeiterinnen des Jugendamts als häufigstes „Elternproblem“ Erziehungsmängel angegeben sind.
3.2.1 Das neue Verständnis der Jugendhilfe
Die Reform des JWG zum KJHG 1990 führte, nach Sengling/Jordan (2000:67ff), zu weitreichenden gesetzlichen Veränderungen, so ist das heutige Jugendhilferecht als ein Leistungsrecht zu verstehen, welches von Rechtsansprüchen der Betroffenen ausgeht, repressive Elemente zurückdrängt und auf Prävention setzt. Das JWG war, so Petermann/Schmidt (1995:13), eher eingriffs- und ordnungsrechtlich organisiert.
Heute sind, so Sengling/Jordan (2000:67ff), Beratungsangebote, aber auch Hilfen zur Erziehung als Dienstleistungen zu verstehen und daher grundsätzlich freiwillig. Antragsteller für Hilfen zur Erziehung sind die Erziehungsberechtigten, nicht der Staat. Die Eltern haben dadurch eine starke Position erhalten. Nur bei einer akuten Gefährdung des Kindeswohls (und wenn das Kind darum bittet) ist das Jugendamt dazu verpflichtet, das Kind in „Obhut“ zu nehmen (§ 42 KJHG). Das KJHG verzichtet also weitgehend auf Eingriffe in das elterliche Erziehungsrecht, welches diesen verfassungsrechtlich zugesichert ist. Dementsprechend werden Eltern und Kinder im KJHG stark in den Hilfeplanprozess eingebunden und nach Petermann/Schmidt (1995:16) als Partner mit Rechtsansprüchen, die Entscheidungs- und Beteiligungsrechte von hoher Verbindlichkeit haben. Die von Petermann/Schmidt durchgeführte Studie zur Hilfeplanung untermauert den Anspruch des Jugendamts als Dienstleistungsbehörde. Es ergab sich, dass die Initiative bei über einem Drittel der „Fälle“ von Seiten eines oder beider Elternteile kam, in gut einem Viertel der Fälle die Schule oder Kindergarten der Initiator war und in etwa jedem zehnten Fall die Verwandtschaft. Nur in 13% bzw. in 5% der Fälle lag die Initiative beim Jugendamt selbst bzw. bei einem anderen Amt (Petermann/Schmidt 1995:36). Dies verdeutlicht, dass das Jugendamt keine Eingriffsbehörde des Staates ist.
3.2.2 Beratung
Als Zwischenglied zwischen Angeboten der allgemeinen Förderung und den Hilfen zur Erziehung sind Beratungs- und Unterstützungsangebote im KJHG verankert. Sie sind, nach Sengling/Jordan (2000:125), im Gegensatz zur allgemeinen Förderung (wie z.B. Spielplätze, Kindergärten) auf spezifische Problem- und Bedürfnislagen von Personen bzw. Gruppen ausgerichtet und sollen die Zielgruppe als niedrigschwellige Dienstleistungsangebote erreichen. Beratung kann, nach Sengling/Jordan (2000:129), sowohl präventiven als auch reaktiven Charakter im Sinn einer Krisenintervention haben. Ziel ist es, einen Zustand der Hilfebedürftigkeit zu beseitigen oder zu vermindern, dabei sind die Klienten bei der Lösung von Problemen zu unterstützen, ohne ihnen Lösungen aufzudrängen. Beratungsangebote sind freiwillig, kostenlos, im Gegensatz zur Therapie offener gestaltet und über einen kürzeren Zeitraum angelegt. Zu Beratungsangeboten gehören u.a. die Jugendberatung § 11 KJHG, welche der Jugendliche selbst in Anspruch nimmt, die Familienberatung § 16 KJHG und die Erziehungsberatung § 28 KJHG.
Sengling/Jordan (2000:131) bezeichnen letztere als personenbezogene Beratung, die von Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigten in Anspruch genommen werden kann. Erziehungsberatung hat, nach Sengling/Jordan (2000:130), den Auftrag, Verhaltensauffälligkeiten, Erziehungs- und Lernschwierigkeiten vorzubeugen, zu diagnostizieren und zu behandeln. Bei der Beratung sollen nach § 28 KJHG Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken. Nach Sengling/Jordan (2000:130) sind mindestens drei Fachkräfte aus beispielsweise Sozialpädagogik, Medizin, Pädagogik, Psychologie usw. zu beteiligen. Aufgabenschwerpunkte sind beratende und therapeutische Intervention, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch präventive Multiplikatorenarbeit, wie die Beratung und Unterstützung von Eltern und Lehrkräften, damit diese Probleme frühzeitig erkennen und adäquat darauf reagieren können.
3.2.3 Hilfen zur Erziehung
Hilfen zur Erziehung können bei massiven Krisen und Problemlagen von den Erziehungsberechtigten beantragt werden. Rechtsanspruch besteht nach dem § 27 KJHG dann, wenn „eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht mehr gewährleistet ist“, und die Hilfemaßnahme notwendig und geeignet ist. Im KJHG sind eine Reihe von Maßnahmen verankert, die, nach Sengling/Jordan (2000:130), alle als gleichrangig gelten, so muss nicht etwa eine Reihenfolge eingehalten werden, die Auswahl und Ausgestaltung richtet sich nur nach dem spezifischen Einzelfall, nach der Indikation. Im KJHG finden sich unterschiedliche Hilfen zu Erziehung, die, nach Petermann/Schmidt (1995:12), von Fall zu Fall unterschiedlich ausgestaltet sein können, da es sich um Einzelfallhilfen handelt, die individuell angepasst werden. Petermann/Schmidt (1995:13) weisen darauf hin, dass es gesetzlich festgelegte Anspruchsvoraussetzungen gibt, ohne dass allerdings eine Rangfolge bebildet wird.
Soziale Gruppenarbeit nach § 29 KJHG stellt beispielsweise eine familienunterstützende Maßnahme dar, sie soll durch soziales Lernen in der Gruppe „älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen[21].“ Nach Sengling/Jordan (2000:171f) wird soziale Gruppenarbeit sowohl in Kursform als auch fortlaufend, i.d.R einmal wöchentlich für vier Stunden angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig und kann nicht verordnet werden. Soziale Gruppenarbeit kommt in Betracht, wenn der Jugendliche über ein tragfähiges familiäres Beziehungsnetz verfügt. Soziale Gruppenarbeit wirkt im Gegensatz zu anderen Erziehungshilfen nicht stark in die Familie ein.
Als weitere familienunterstützende Maßnahme ist der Erziehungsbeistand nach § 30 KJHG zu nennen, dieser soll den Jugendlichen bei der „Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbezug des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie[22] “ bei der Verselbstständigung fördern. Gegenstand der Betreuung sind, nach Sengling/Jordan (2000:173), v.a. Beziehungen zwischen Jugendlichem und Eltern, schulische Probleme sowie andere soziale Probleme. Das Ziel der Erziehungsbeistandschaft richtet sich u.a. nach dem Alter des Jugendlichen, je älter desto eher wird auf selbstständige Lebensführung hin gefördert. Nach Sengling/Jordan ist sie zumeist auf ein bis drei Jahre angelegt und wird von Sozialarbeitern durchgeführt. Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme freiwillig, es gibt jedoch eine Ausnahme, mit § 12 JGG besteht die Möglichkeit der Anordnung eines Bewährungshelfers.
Eine weitere Maßnahme stellt die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 KJHG dar, hier soll Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen, im Kontakt mit Ämtern und Einrichtungen Unterstützungen gegeben werden. Dabei wahrgenommene Aufgaben sind, so Sengling/Jordan (2000:177), u.a. Erziehungs- und Eheberatung, Hausaufgabenbetreuung, Anleitung zur Führung des Haushalts und Unternehmungen – also Beratung und Anleitung zur Lebensführung. Nach dem KJHG soll die Familie dabei zur Selbsthilfe befähigt werden. So ist es, nach Sengling/Jordan (2000:177), auch wichtig, die Isolation der Familie aufzubrechen, damit diese sich Unterstützung im sozialen Umfeld suchen kann. Sie ist auf längere Sicht angelegt und erfordert Mitarbeit durch die Familie. Ziel ist es, so Sengling/Jordan (2000:177ff), dass die Familie die Fähigkeit zur selbstständigen Bewältigung ihres Lebens (wieder) gewinnt. Die Anwesenheit eines Familienhelfers stellt einen massiven Einbruch in das Familienleben dar. Sie eignet sich, so Sengling/Jordan, v.a. für Familien in akuten Einzelsituationen, wie etwa beim Tod des Partners oder bei besonderen Schwierigkeiten mit Kindern. Zuvor muss allerdings die Möglichkeit einer weniger invasiven Hilfe ausgeschlossen werden, wie Vermittlung von Hort, Kuren, Aktivierung von Verwandtschaft usw. Nicht geeignet ist sozialpädagogische Familienhilfe, nach Sengling/Jordan, für Familien mit multiplen Problemkrisen, die dauerhaft überfordert sind.
Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 KJHG stellt eine Form der teilstationären Pflege dar, in welcher der junge Mensch durch „soziales Lernen in der Gruppe, durch Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit[23] “ in seiner Entwicklung unterstützt wird und in seinem sozialen Umfeld verbleibt. Dadurch wird, so Sengling/Jordan (2000:180f), die Familie tagsüber entlastet und erhält gleichzeitig Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Problemlagen. Die Betreuungsdauer liegt bei durchschnittlich zwei bis vier Jahren und umfasst beispielsweise Angebote zum sozialen Lernen, Freizeitangebote, Einzelförderung, Hausaufgabenhilfe und Hausbesuche. Ziele sind u.a. den Jugendlichen in seiner emotionalen Entwicklung zu stärken, ihn in schulischer sowie sozialer Hinsicht zu fördern und zu integrieren sowie die Beziehungen zwischen ihm und den Eltern zu verbessern. Erziehung in der Tagesgruppe wird, nach Sengling/Jordan (2000:183), genutzt, um eine vollstationäre Unterbringung zu vermeiden. Von Betroffenen wird sie oft als wenig stigmatisierend erlebt, weil sie häufig hortartig organisiert ist.
Nach § 33 KJHG kann die Vollzeitpflege die Erziehung in der eigenen Familie ersetzen. Familienersetzende Hilfen sind unter anderem Familienpflege und Heimerziehung (§ 34). Heimerziehung soll Kinder und Jugendliche nach dem KJHG durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Heimerziehung kann, nach Sengling/Jordan (2000:200), dann angezeigt sein, wenn die familiären Bedingungen ungünstig sind (Misshandlungen, Sucht, massive Konflikte zwischen Eltern und Kind...).
§ 35 KJHG nennt als weitere Möglichkeit die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, die allerdings kostenintensiv ist und nur in Einzelfällen angewandt wird.
3.2.4 Hilfeplanung
§ 36 KJHG sieht eine weitreichende Mitwirkung am Hilfeplan vor, so sind die Erziehungsberechtigten und der junge Mensch vor ihrer Entscheidung über eine Inanspruchnahme einer Hilfe oder einer Änderung von Umfang bzw. Art der Hilfe, zu beraten und über die möglichen Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen aufzuklären. Zudem dürfen sich Eltern und Jugendlicher bei der Auswahl einer Pflegestelle oder Einrichtung beteiligen, wenn eine Hilfe außerhalb der Familie angestrebt wird. Den Wünschen ist zu entsprechen, wenn sie nicht mit hohen Mehrkosten verbunden sind. Petermann/Schmidt (1995:51) kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass am Hilfeprozess beteiligte Mütter und Kinder in den meisten Fällen Wünsche bezüglich der Hilfe äußern. Petermann/Schmidt (1995:13) weisen auf die Wichtigkeit hin, den Betroffenen die Möglichkeiten der Jugendhilfe transparent zu machen, damit sie überhaupt einen Überblick bekommen und sich an der Hilfeplanung beteiligen können. Die Entscheidung über die Hilfeleistung soll nach § 36 KJHG im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Zusammen mit dem jungen Menschen und den Erziehungsberechtigten soll ein Hilfeplan erstellt werden, in welchem der Bedarf festgestellt wird, der die Art der zugewährenden Hilfe und notwendigen Leistungen enthält.
Petermann/Schmidt (1995:20f) nennen als Grundlage eines Hilfeplans Anamnese, Problembeschreibung, Zusammenfassung von Gutachten und Befunden und Bewertung der momentanen erzieherischen Situation. Auf dieser Basis erfolgt die Feststellung der Art der Hilfe, was also notwendig und geeignet ist und wie lange sie dauern soll. Anschließend legt das Team die Leistungen fest: Bestimmungen über Einrichtungen, Beginn, Dauer, Ziele, Schwerpunkte, Therapie, heilpädagogische Angebote, schulische Förderangebote u.v.m.. Regelmäßig muss überprüft werden, ob die Hilfeart weiterhin angezeigt und geeignet ist. Falls zur Durchführung gewisser Leistungen andere Personen oder Einrichtungen tätig werden, sind sie ebenfalls an der Hilfeplanung zu beteiligen, nach Petermann/Schmidt (1995:14) sollen diese dem Jugendamt regelmäßig Bericht erstatten. Der Hilfeplan ersetzt einen Behandlungsplan, so Petermann/Schmidt, zwar nicht, stellt aber die Grundlage für die Gewährung einer Hilfe dar, welche durch einen Verwaltungsakt erfolgt. Gegebenenfalls sind die Leistungen im Hilfeplan einklagbar.
Sengling/Jordan (2000:216) weisen darauf hin, dass Eltern und junge Menschen Unterstützung brauchen, um herauszufinden, was sie möchten und benötigen, so dass ihr Wahlrecht und ihre Wünsche auch wirklich zum Tragen kommen. Dafür müssen die Fachkräfte über Methoden verfügen, wie man Beteiligungsprozesse sinnvoll gestaltet und zugleich beratend sowie kontrollierend tätig werden kann.
Der Hilfeplan resultiert, nach Sengling/Jordan, aus Fachlichkeit und Expertenwissen, aus Wissen und Wünschen der beteiligten Familien und Jugendlichen. Petermanns und Schmidts Studie (1995:48) kommt zu dem Ergebnis, dass die Sachbearbeiterin tatsächlich in 80% der Fälle Informationen von Mutter und Kind bezieht, der Vater allerdings nur an gut der Hälfte der Fälle beteiligt ist. In jeweils knapp 60% werden Jugendamt (Akten, Mitarbeiter) und Schule (Noten, Gutachten...) als Informanten herangezogen. Ärzte und Psychotherapeuten spielen mit 16% bzw. 13% eine eher untergeordnete Rolle. Für entscheidungsrelevant werden dabei v.a. Informationen von Mutter und Kind gehalten. Insgesamt wurden 77% bzw. 84% der Kinder und Mütter und 86% der Einrichtungen in die Hilfeplanung einbezogen. Dritte, wie Psychologen und Ärzte wurden nur in jedem dritten Fall hinzugezogen. Trotz dieser recht ermutigenden Zahlen waren, nach Petermann/Schmidt (1995:52), dennoch nur in 6% der Sitzungen Jugendamt, Einrichtung und Familie gemeinsam an einem Tisch und nur 4% der Teamsitzungen fanden mit Beteiligung der Familie statt. Bei ebenfalls 4% nahmen externe Experten teil, wozu auch die Schule gehört. Allerdings nahmen bei 30% der Sitzungen Mitarbeiter/innen der zukünftigen Einrichtungen teil. Petermann/Schmidt (1995:87) stellen dementsprechend in Frage, ob Kinder- und Elternrechte tatsächlich genügend berücksichtigt werden, da Mitarbeiter des Jugendamts in Hilfeplansitzungen meist unter sich bleiben und als Externe am ehesten geplante Einrichtungen[24] hinzuziehen. Zudem wird kritisiert, dass die starke Zusammenarbeit von Mutter und Sachbearbeiterin (Gesprächsdauer im Mittel ca. 4[25] Stunden) ein Machtgefälle aufweisen kann, auch weil zu wenig Dritte involviert seien. Das Machtgefälle zeigt sich u.a. daran, dass sich bei nur 14%[26] der Sozialarbeiter/innen während des Hilfeplanprozesses die Einschätzung der erforderlichen Maßnahme änderte, während bei über der Hälfte die Sichtweise der Problematik gleich blieb und damit möglicherweise auch einseitig verwirklicht wurde.
Die Zusammenarbeit mit der Schule begrenzt sich hauptsächlich auf den Bereich der schulischen Förderung und der Feststellung der Intelligenz. Fast ein Drittel der Sozialarbeiter/innen orientiert sich, so Petermann/Schmidt (1995:38f), bei letzterem an Einschätzungen der Schule (Gutachten, Noten). Jeweils ein Drittel orientiert sich an standardisierten Tests und Elternurteil. Aufgrund dieser Informationen wurden die intellektuellen Fähigkeiten bei 40% der Kinder als unterdurchschnittlich angesehen. Ca. ein Viertel besuchte eine Sonderschule (Petermann/Schmidt 1995:84) und etwa 30% wiesen Teilleistungsstörungen auf. Diese Zahlen verdeutlichen die Wichtigkeit, welche der Schule am Hilfeplanprozess zukommen sollte.
Insgesamt kann man feststellen, dass 1995 eine kooperative Entwicklung eines Hilfeplans nur in Ansätzen verwirklicht war. Immerhin stimmen, so Petermann/Schmidt (1995:88), über 90% der Kinder und Eltern dem Hilfeplan zu und jeweils fast 80% (Petermann/Schmidt 1995:76) waren mit dem Ergebnis „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“. Dies steigert die Chance, dass der Hilfeplan zu einer Verbesserung führt. Allerdings äußerten jeweils 15% Bedenken bezüglich bestimmter Regelungen, gegenüber nur 8% der Einrichtungen (1995:52). Petermann/Schmidt werfen hier die Frage auf, ob Einrichtungen, durch eine mögliche Abhängigkeit vom hilfegewährenden Jugendamt in ihrem Urteil beeinflusst werden, da dagegen die Hälfte der unabhängigen Experten Einwände erhebt. Dies verdeutlicht deren möglichen Einfluss auf den Hilfeplan und die qualitätssteigernde Wirkung einer kooperativen Planung.
Insgesamt geht die Entwicklung dennoch in die richtige Richtung, man konnte 1995 noch nicht erwarten, dass die Reformen des KJHG sofort perfekt in die Praxis umgesetzt wurden, da dies zeitaufwändige Umstrukturierungsprozesse erfordert.
3.3 Möglichkeiten im Bereich der Sonderpädagogik
3.3.1 Schule für Erziehungshilfe und „E – Klasse“
Nach § 15 Schulgesetz dient die Sonderschule für Erziehungshilfe der Beschulung verhaltensauffälliger Schüler/innen, die in der allgemeinen Schule „nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bildung und Ausbildung erfahren können.[27] “ Daran zeigt sich, dass der Förderort zu allererst die allgemeine Schule ist, denn wenn es möglich ist, sollen nach § 15 Schulgesetz behinderte Schüler/innen[28] in allgemeinen Schulen unterrichtet werden. Die Umschulung in eine Sonderschule für Erziehungshilfe sollte folglich nur die letzte Maßnahme in einem langen Prozess aus gescheiterten Maßnahmen darstellen, wenn, so Schor (2003:55), alle Mittel der allgemeinen Schule, auch unter Unterstützung durch Fachdienste erfolglos waren.
Als Entscheidungsgrundlage für den Besuch einer Schule für Erziehungshilfe dient nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom 8. März 1999 der pädagogische Bericht, der von allgemeiner Schule und einem unterstützenden Sonderpädagogen angefertigt wird. Erziehungsberechtigte oder Schule stellen im Einvernehmen mit den Eltern einen Antrag beim Schulamt. Dieses prüft anhand der Unterlagen den Besuch der Schule für Erziehungshilfe, beteiligt dabei die zuständige Sonderschule sowie ggf. weitere Leistungsträger. Besteht zwischen Schule und Eltern kein Einvernehmen, zieht das Schulamt nach einem Gespräch mit den Eltern unabhängige Sonderpädagogen, psychologische Tests und ggf. Experten anderer Disziplinen hinzu.
Nach Schor (2003:50) besteht der einzige Vorteil einer Umschulung darin, dass die allgemeine Schule entlastet wird. Das Meldeverfahren wird, so Schor, zum Abmeldeverfahren, weil der Weg zurück in die allgemeine Schule zumeist verbaut ist – jedenfalls sind Rückschulungsquoten gering. So geraten Sonderschulen für Erziehungshilfe, wie auch Förderschulen in die Funktion des Auffangbeckens für „Versager“. Schor (2003:55) weist darauf hin, dass sich Verhaltensprobleme in Schulen für Erziehungshilfe potenzieren und nicht etwa verringern und Lehrkräfte an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:23) nennen einige Problemfelder, die häufig anzutreffen sind: Schulunlust und Schulverweigerung, Schulabbruch, Delinquenz – die intensive schulische Betreuung hat daran nichts geändert. Zudem werden Schüler/innen stigmatisiert, was Folgen hat für deren Selbstwert und (berufliche) Integration. Klicpera/Gasteiger - Klicpera kritisieren zudem, dass die Schüler/innen nicht mehr die Möglichkeit haben, von Schülerinnen ohne Beeinträchtigungen zu lernen und so ihre sozialen Erfahrungen eingeschränkt werden. Eng damit verbunden ist auch eine Einschränkung der Kontaktmöglichkeiten im eigenen sozialem Umfeld, weil kein flächendeckendes Angebot vorhanden ist und viele Schüler/innen in Heimen untergebracht werden.
Um das Problem der Isolation ein wenig abzuschwächen, wurden, so Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:24), in vielen Ländern Einrichtungen geschaffen, die es ermöglichen, verhaltensauffällige Schüler/innen innerhalb der allgemeinen Schule getrennt zu unterrichten, so dass sich ihr Bildungsweg weniger deutlich vom herkömmlichen unterscheidet.
Schor (2003:51) nennt einen Schulversuch in bayrischen Grundschulen, in welchem verhaltensauffällige Schüler/innen des Sprengelbereichs zusammengeführt werden und in einer „E – Klasse“ innerhalb der Grundschule unterrichtet werden. Laut Schor ist darauf zu achten, dass diese Außenklasse nicht nur unter formal – organisatorischen Gesichtspunkten der Grundschule angegliedert ist, sondern dass die Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens kultiviert werden, auch um Rückschulungen zu ermöglichen. Trotz einiger Vorteile kann man „E – Klassen“ nicht als integrative Beschulung bezeichnen.
Über eine weitere Variante der „E – Klasse“ berichtet Sorg (2003:183f). Im Berliner Programm „Casa Nuvola“ werden verhaltensauffällige „nicht beschulbare“ Schüler/innen über den Zeitraum von längstens einem Jahr in einer Kleinklasse außerhalb der allgemeinen Schule unterrichtet. Die Schüler/innen bleiben Schüler ihrer Stammschule. Ziel ist eine schrittweise Reintegration. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften der allgemeinen Schulen, Eltern, Sonder- und Sozialpädagogen ist dabei sehr eng, alle Planungen finden im Team statt.
3.3.2 Mobile sonderpädagogische Dienste
In den letzten Jahren entstanden durch die mobilen sonderpädagogischen Dienste Möglichkeiten verhaltensauffällige Schüler/innen innerhalb ihrer Stammklasse zu fördern. Die sonderpädagogischen Dienste haben dabei eine recht gute Rechtsgrundlage in Baden – Württemberg. Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist die Förderung behinderter Schüler/innen bzw. Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf nach § 15 Schulgesetz, Aufgabe der allgemeinen Schule. Behinderte Schüler/innen besuchen die allgemeine Schule, wenn sie nach pädagogischen, finanziellen, personellen und organisatorischen Möglichkeiten dem Bildungsgang folgen können. Dabei ist es zuerst einmal die Aufgabe der allgemeinen Schule auf die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schüler/innen einzugehen, also auch auf Verhaltensauffälligkeiten. Zu allererst ist also die allgemeine Schule für Förderdiagnostik und Förderplanung verantwortlich (in Zusammenarbeit mit den Eltern). Sie wird dabei nach § 15 Schulgesetz von Sonderschulen durch die sonderpädagogischen Dienste unterstützt, welche jedoch nur subsidiär tätig werden.
Als Aufgabenbereiche dieser stundenweisen Beratungstätigkeit durch Sonderpädagoginnen nennt die Verwaltungsvorschrift des Kultusministerium vom 8. März 1999 Beratung von beteiligten Lehrkräften und Eltern sowie Klärung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Rahmen einer kooperativen Diagnostik in Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrkräften und ggf. weiteren Experten. Zudem beteiligt sich der Sonderpädagoge an der Förderplanung der Schule und vermittelt ggf. Kontakt zu Angeboten der Jugendhilfe, wie z.B. zur sozialpädagogischen Schülerhilfe oder Erziehungsberatung und beteiligt sich ggf. auch an der Hilfeplanung nach § 36 KJHG. Außerdem leistet er im Rahmen des Unterrichts konkrete sonderpädagogische Förderung betroffener Schüler, wenn dies den Verbleib in der allgemeinen Schule sichern kann. Zudem unterstützt er Schulen beim Aufbau von Förderkonzepten. Nach Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:24) wird die Lehrkraft auch konkret dabei unterstützt, den Unterricht besser auf die Bedürfnisse der Schüler/innen abzustimmen. Der Sonderpädagoge berät Lehrkräfte auch bei der Gestaltung des Unterrichts, beispielsweise bezüglich Differenzierung und Unterrichtsformen.
Neben den o.g. Kritikpunkten an der selegierenden Beschulung ist, so Schor (2003:55), vor allem die zunehmende Anzahl von verhaltensauffälligen Schülern ein Grund, dass mobile sonderpädagogische Dienste ausgebaut werden müssen. Das Sonderschulwesen verfügt nicht über ausreichende Personalressourcen, um sich als einziges um diese Schülerschaft kümmern zu können. Lehrkräfte der allgemeinen Schulen müssen sich also befähigen, diese Aufgabe gut zu bewältigen, mit der Hilfe der mobilen sonderpädagogischen Dienste, welche, so Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:24), durch ihr Angebot an vielfältiger Diagnostik, Beratung und individueller Förderung ihr „Know – how“ in die allgemeinen Schulen transportieren und so betroffenen Schülerinnen den Verbleib in ihrer Schule ermöglichen.
Eng verwandt mit mobiler Erziehungshilfe ist das Frankfurter Programm der Präventionslehrer/innen, in welchem, so Reiser/Willmann (2004:154ff), Sonderschullehrer/innen fest an Grundschulen angestellt sind und somit zum Kollegium gehören. Ziel des Programms ist es Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen. Im Fokus steht v.a. Klassenstufe 1/2. Der Arbeitsablauf lässt sich so beschreiben: Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen, Unterrichtshospitation mit Verhaltensbeobachtung und Planungen, wie man verhaltensauffällige Schüler/innen konkret fördern kann. Der Präventionslehrer bietet in der Folgezeit in Abstimmung mit den Kolleginnen Unterstützungsformen an, wie etwa Ko – Unterricht, Spiel-, Lern- und Fördergruppen.
3.3.3 Ergebnisse einer Studie zum mobilen sonderpädagogischen Dienst
Klicpera/Gasteiger-KLicpera kamen bei einer Studie über die sonderpädagogischen Dienste in Österreich zu recht interessanten Ergebnissen, die im Folgenden ausschnitthaft dargestellt werden.
So warten zum Beispiel Lehrkräfte lange, bevor sie den mobilen sonderpädagogischen Dienst hinzuziehen, da, laut Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:69), über drei Viertel der Lehrkräfte sowie die Hälfte der Beratungslehrer/innen den Eindruck hatten, dass die Auffälligkeiten des betroffenen Schülers schon recht lange bestehen. Zu fast 80% führte ein unmittelbarer Anlass die Lehrkraft dazu, sich an eine Beratungslehrerin zu wenden, wobei hier v.a. eine deutliche Zunahme von Problemverhalten genannt wurde, seltener einzelne besondere Ereignisse (Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1998:71).
Als Ziele der Betreuung nannten die Klassenlehrer/innen neben der Ursachenklärung v.a. emotionale Stützung der Schülerin, die Verbesserung des Zurechtkommens in der Klasse sowie der Konzentrationsfähigkeit und der Lernmotivation. Weiterhin wünschen sich Klassenlehrer/innen Ratschläge hinsichtlich des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten, demgegenüber erhofft sich nur jede Zehnte, dass der Schüler aus dem Unterricht genommen wird, und nur 4% wünschen konkrete Hilfe im Unterricht.
Zudem sind mangelnde Kenntnisse der Möglichkeiten des sonderpädagogischen Dienstes festzustellen: Nur ein Viertel der Lehrkräfte hatte konkrete Vorstellungen darüber, wie die Arbeit der Sonderpädagogin konkret aussehen kann, ein Drittel hatte keine Vorstellungen (Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1998:74). Die Lehrkräfte, welche Vorstellungen haben, wünschen sich mehrheitlich Beratungstätigkeit mit dem Schüler außerhalb des Unterrichts. Obschon die Klassenlehrer/innen selten den Wunsch äußerten, Unterstützung im Unterricht zu bekommen, wurden dennoch ca. 30% der Schüler/innen im Unterricht besucht und die Klassenlehrerin bei der Gestaltung des Unterrichts bzw. der Schüler während des Unterrichts unterstützt. Wo gemeinsame Arbeit in der Klasse praktiziert wurde, wurde sie von den Klassenlehrer/innen i.d.R. als hilfreich eingeschätzt, allerdings glaubten in den anderen Klassen nur wenige Lehrkräfte, dass dies sinnvoll sei (Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1998:79). Möglicherweise fürchteten einige Lehrkräfte im Unterrichts bloßgestellt zu werden. Die Zusammenarbeit erstreckte sich zumeist auf Gespräche, bezüglich des Umgangs mit verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen.
Die Zusammenarbeit ist, so Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:80), als gut zu bezeichnen, ca. die Hälfte der Beratungslehrer/innen setzte sich regelmäßig mit den Klassenlehrerinnen zusammen, um sich gegenseitig über die Entwicklung der Schülerin und ihre Arbeit zu informieren. Ein guter Teil traf sich sogar einmal pro Woche. Drei Viertel der Klassenlehrer/innen und zwei Drittel der Beratungslehrer/innen waren mit dem Informationsaustausch zufrieden (Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1998:80f). Die Zusammenarbeit mit dem Beratungslehrer und seine Anregungen wurde von fast 90% der Klassenlehrer/innen als „sehr hilfreich“ und „recht hilfreich“ eingeschätzt, und nur jeder 10. Lehrer empfand sie als wenig hilfreich.
Das zeigte sich auch in den Auswirkungen auf ihre Arbeit (Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1998:81): die Klassenlehrer/innen berichteten, dass sie bei 18% der Schüler/innen die Gestaltung des Unterrichts oder ihre Interaktion mit diesen Schülern verändert hätten aufgrund von Anregungen durch den Beratungslehrer. Bei ca. der Hälfte der Lehrkräfte war dies teilweise der Fall. Im einzelnen gaben Lehrkräfte an, sich um mehr Rücksichtnahme, Geduld, Ignorieren von Verhaltensauffälligkeiten sowie Konsequenz zu bemühen. Ein guter Teil der Lehrkräfte stellte, so Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:84f), positive Veränderungen durch die Betreuung fest. Bei einem Viertel der Schüler/innen sprachen Klassenlehrer/innen von eindeutig positiven Veränderungen, bei etwas über der Hälfte der Schüler/innen waren aus ihrer Sicht immerhin teilweise Veränderungen festzustellen. Dabei zeigte sich die Veränderung, so Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:84f), v.a. im Rückgang aggressiver/ störender Verhaltensweisen, einer besseren Integration in die Klasse sowie einer besseren Konzentration und Motivation im Unterricht. Gut ein Fünftel zeigt allerdings verstärkt auffälliges Verhalten, das heißt, dass die Betreuung im Einzelfall nicht unbedingt ausreicht. Auch die Schulleistung wurde in den meisten Fällen nicht besser eingeschätzt. Die Klassenlehrer/innen stellten die Verhaltensänderungen zum größeren Teil erst nach einem längeren Zeitraum der Betreuung fest, bei knapp einem Fünftel der verhaltensauffälligen Schüler/innen aber schon recht bald. Die Gründe für die Verhaltensänderungen sehen Klassenlehrer/innen v.a. im Verständnis und Interesse, welches der Schülerin durch den Beratungslehrer entgegengebracht wurde. Darüber hinaus wurden als weitere Gründe die Möglichkeit belastende Erlebnisse zu bearbeiten, sowie das Bemühen des Schülers sein Verhalten zu verändern, genannt. Beratungslehrer/innen nannten zudem noch ein gesteigertes Verständnis der Lehrkraft als Ursache für positive Entwicklungen. So veränderte sich, laut Klicpera/Gasteiger-Klicpera (1998:86f), bei über 60% der verhaltensauffälligen Schüler/innen die Sicht der Lehrkräfte auf deren Probleme wenigstens teilweise. Dazu passt auch, dass sich die Beziehung aus Sicht der Lehrkräfte zu jeder dritten verhaltensauffälligen Schülerin entspannte. Die Lehrkräfte konnten auch deutlicher sehen, wenn Schüler/innen sich um Verhaltensänderungen bemühten, dass sie selbst oft einen Teil zu Problemverhalten im Unterricht beitrugen und dass sie durch die Gespräche besser mit eigenen Frustrationen umgehen konnten. Die Klassenlehrer/innen stellten durch die Betreuung bei ca. 60% der Schüler/innen zumindest eine teilweise Entlastung für den Unterricht fest. Jeweils ein Viertel der Lehrkräfte machte dies an der Herausnahme des Schülers aus dem Unterricht, der besseren Anpassung des Schülers im Unterricht und verbesserten Möglichkeiten mit Problemverhalten der Schüler/innen umzugehen, fest.
3.3.4 Integrative Möglichkeiten in Kooperation zwischen Sonder- und Sozialpädagogik
Schulstationen sind eine weitere Möglichkeit verhaltensauffällige Schüler/innen innerhalb der allgemeinen Schule zu fördern. Nevermann (2004:137f) zufolge wurde die Einrichtung von Schulstationen im Rahmen eine Modellprojekts der Bund – Länder – Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung zwischen 1992 und 1995 gefördert. Während dieser Zeit wurden in Berlin 300 Schulstationen eingerichtet. Mit Auslaufen der Förderung musste ein Großteil der Stationen aus finanziellen Gründen wieder geschlossen werden, obwohl ihnen gute Wirksamkeit bescheinigt wurde. Eine Schulstation ist, so Nevermann (2004:125f), ein pädagogischer Ort, ein besonders ansprechender Raum, innerhalb einer Schule, wo Schüler/innen in akuten Stresssituationen, bei Konflikten oder besonderen emotionalen Problemen, Hilfe von Sozialarbeiter/innen bekommen können. Ziel ist es, die Arbeit der Förderung verhaltensauffälliger Schüler/innen auf mehreren Schultern zu verteilen. Lehrkräfte und Sozialpädagogen (und Eltern) arbeiten kooperativ und ziehen ggf. außerschulische Partner hinzu, wie Jugendhilfe oder schulpsychologischen Dienst. Das Angebot von Schulstationen umfasst sowohl präventive Elemente, wie beispielsweise Problemlösetraining, Vermittlung von Techniken, um mit Emotionen angemessen umgehen zu können, und soziale Integration/Schülertreff, als auch reaktive Elemente, wie Deeskalation in Problemsituationen und Entlastung für die Lehrkraft im Unterricht.
In Frankfurt existiert, so Reiser/Willmann (2004:159ff), eine weitere interessante Möglichkeit, verhaltensauffällige Schüler/innen integrativ zu fördern, das „Zentrum für Erziehungshilfe“. Dort wird in Tandems gearbeitet, welche jeweils aus einem Sonder- und einem Sozialpädagogen bestehen, die für je einen Stadtteil zuständig sind. Sogar die Leitung des Zentrums ist paritätisch besetzt. In Förderdiagnose, Förderplan und Förderphase können Kompetenzen beider Professionen einfließen. Sowohl Lehrkräfte als auch Sozialpädagoginnen erleben die Zusammenarbeit als Erleichterung. Lehrkräfte der allgemeinen Schulen können sich ohne vorherige Überprüfung des Förderbedarfs an das Zentrum für Erziehungshilfe wenden.
[...]
[1] Werning (1996:9f)
[2] Bundesagentur für Arbeit (2003)
[3] Bezug nehmend auf Goetze (1993:615f)
[4] Bezug nehmend auf Goetze (1993:615f)
[5] Bezug nehmend auf Goetze (1993:615f)
[6] Weiteres nachzulesen in Goetze (2003:24) und Warzecha (1997:Kapitel 2)
[7] In Warzecha (1997:24)
[8] Becker (1973:Kapitel 1)
[9] Vertieft dargestellt in: Speck (1993:34ff)
[10] Bezug nehmend auf Goetze (1993:615f)
[11] aus NRW
[12] n=70
[13] Für die Universitätsklinik Heidelberg, Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie/ in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Rhein – Neckar - Kreis
[14] Wird in der Studie unter „gemischte Störung“ subsumiert.
[15] Bezug nehmend auf Dauber/Vollstädt (2003)
[16] Mand (1995:87)
[17] Ausführlicher im Schulgesetz §90
[18] Nach der ersten Störung, darf sich der Schüler entscheiden, ob er im Klassenverband verbleiben möchte oder in den Trainingsraum gehen will. Die zweite Störung ist die Entscheidung.
[19] Bully = Person, die antisoziale Verhaltensweisen zeigt
[20] Weichold (2003)
[21] § 29 KHJG
[22] § 30 KJHG
[23] § 32 KJHG
[24] welche auf Klienten angewiesen sind!
[25] Petermann /Schmidt (1995:50)
[26] Petermann/Schmidt (1995:48)
[27] § 15 Schulgesetz für Baden - Württemberg
[28] bzw. Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf
- Arbeit zitieren
- Dipl. Päd. Valerie Kremp-Ries (Autor:in), 2006, Lehrer und ihre Einstellung gegenüber verhaltensauffälligen Schülern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54407
Kostenlos Autor werden



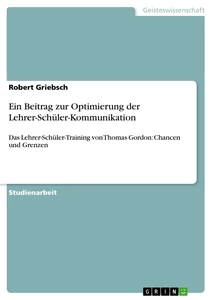
















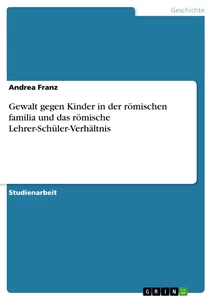


Kommentare