Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Zielstellung
2. Suchterkrankung
2.1 Suchtmittelmissbrauch und Suchtmittelabhängigkeit
2.2 Körperliche und psychische Abhängigkeit und Suchtformen
2.3 Diagnose von Suchterkrankungen
2.4 Epidemiologie von Suchterkrankungen
2.5Ätiologie von Suchterkrankungen
2.5.1 Genetische Perspektive
2.5.2 Biochemische Perspektive
2.5.3 Lerntheoretische Perspektive
2.5.4 Griffnähe-Umfeld-Subjekt
3. Angststörungen
3.1 Diagnose von Angststörungen
3.2 Epidemiologie von Angststörungen
3.3 Ätiologie von Angststörungen
3.3.1 Neurobiologisch-genetische Aspekte
3.3.2 Lerntheoretische Aspekte
3.3.3 Psychosoziale Aspekte
3.3.4 Psychologische Aspekte
4. Komorbidität
4.1 Erklärungsansätze für Komorbidität zwischen Angst und Sucht
4.2 Epidemiologie von Angststörungen mit komorbiden Suchterkrankungen
4.3 Der Zusammenhang zwischen Angst und Sucht
4.4 Das Teufelskreismodell der Komorbidität zwischen Angst und Sucht
5. Fragen und Hypothesen
5.1 Woran erkennt man die Komorbidität zwischen Angst und Sucht?
5.2 Wie lässt sich der Teufelskreis der Komorbidität auflösen?
6. Qualitative Interviews
6.1 Forschungsmethode: Qualitatives Interview
6.2 Versuchsaufbau und Vorstellung des Interviewleitfadens
6.3 Probandinnen
7. Paarvergleich der Kernfragen
8. Diskussion
9. Fazit
Dankesagung
An dieser Stelle möchte die Autorin der Arbeit ihren Dank an allen aussprechen, die das Zustandekommen dieser Arbeit ermöglicht haben.
An erster Stelle spreche ich meinen Dank an meinen Erstgutachter, Herr Dr. Michael Knuth, aus. Er stand mir während der gesamten Forschung für diese Arbeit mithilfe seiner eigenen Expertise unterstützend zur Seite und half mir bei der Strukturierung.
Ein weiter Dank richtet sich an Katrin Bock. In Zeiten meines 20-Wochen-Praktikums in der Suchtberatungsstelle des AWO Kreisverband Salzland e.V. gab sie mir, als meine Praxisanleiterin, vielerlei Fachwissen und Kompetenzen im Bereich Sucht und der Arbeitsmentalität innerhalb der Sozialen Arbeit. Des Weiteren half sie mir sehr bei der Auswahl der befragten Probanden.
Besonderen Dank spreche ich meiner Familie und meinen Freunden aus, die mich seit jeher unterstützen. Danke, dass ihr mir zu jeder Zeit zur Seite steht und mich in guten, sowie schlechten Zeiten nie aufgegeben habt.
Vielen Dank.
Zusammenfassung
Im klinischen Alltag von Medizin, Psychiatrie und der Suchtkrankenhilfe sind monomorbide Krankheitsbilder eher die Ausnahme als die Regel. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Erkrankungen parallel bestehen, die den Erfolg von Therapie und Abstinenzbestrebungen zunehmend einschränken, wenn diese keine differentialdiagnostische Beachtung finden.
Im Rahmen der Bachelorarbeit „Komorbidität zwischen Angststörungen und Suchterkrankungen“ wird die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Störungsbildern wissenschaftlich erläutert und empirisch untersucht. Dabei werden Begriffsbestimmungen, Diagnosekriterien, Epidemiologie und Ätiologie der unterschiedlichen Symptomcluster behandelt, um das semantische Netzwerk dieser Forschungsarbeit zu erzeugen.
Innerhalb der empirischen Untersuchungen werden zwei qualitative Interviews mit Personen durchgeführt, die jeweils eine Angststörung und ein dadurch bedingtes Suchtproblem vorweisen. Die zentralen Fragen, die es in dieser Abschlussarbeit zu beantworten gilt, sind, woran man Komorbidität zwischen diesen beiden Erkrankungen erkennen kann, wie sie sich gegenseitig bedingen und in wie weit die Soziale Arbeit präventiv und problembezogen auf dieses Verhältnis einwirken kann.
Die Ergebnisse sollen als Anstoß für die Entwicklung von Präventions- und Hilfsangebote fungieren, sowie die Etablierung der Sozialen Arbeit als interdisziplinäre Wissenschaft zur Krankheitsbehandlung vorantreiben.
1. Zielstellung
Durch Gesellschaft und Medien wird dem Individuum eine Kontrollierbarkeit des Lebens vermittelt. Diese gesellschaftliche Erwartungshaltung an Leistungsfähigkeit erzeugt eine Vielzahl von psychischen Belastungsfaktoren. Da Menschen mit unterschiedlichen persönlichen Ressourcen ausgestattet sind, erfolgt eine Bewältigung dieser Belastungen auf unterschiedliche Weise. Demnach können Personen, mit einer defizitären psychischen Widerstandskraft destruktive Verhaltensweisen ausbilden, die zum Beispiel zu einer Suchtmittelabhängigkeit führen können. Diese kann von schweren gesundheitlichen Einschränkungen über soziale Degeneration bis hin zum frühzeitigen Ableben des Individuums führen. Sucht kann demnach ein Ausdruck von psychischer Überforderung sein. Betroffene nutzen Suchtmittel, um den Leidensdruck zu minimieren und eine bessere Kontrolle über ihre Beschwerden zu bekommen. Diese Art der Selbstmedikation kann zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes führen. Auf der anderen Seite kann die medizinische Behandlung von psychischen Beschwerden ebenfalls in eine Sucht münden. Wie bei einer Substanzabhängigkeit tritt auch bei Angsterkrankungen ein hohes Maß an Kontrollverlust auf. Angst ist ein grundlegendes und überlebenswichtiges Gefühl, das im Individuum Reaktionen auslöst, bedrohlichen Situationen zu entgehen oder sich zu verteidigen. Betroffene einer Angststörung überkommt dieses Gefühl in unterschiedlichen Alltagssituationen. Dies äußert sich zum Beispiel durch körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Zittern und Übelkeit sowie der Erfahrung von Hilflosigkeit und Panik. Um solchen unangenehmen Gefühlszuständen zu entgehen, reagieren Betroffene mit Vermeidungsverhalten und dem Rückzug aus dem sozialen Leben. Dies führt oft zu einer teufelskreisartigen Verstärkung des Leidensdrucks. Das wechselseitige Verhältnis zwischen Suchtmittelmissbrauch und psychischer Beeinträchtigung soll in dieser Abschlussarbeit anhand der Komorbidität zwischen Angst- und Suchterkrankungen wissenschaftlich erläutert werden. Die über allem stehenden Fragen sind, wie man so eine Komorbidität feststellen kann und was die Soziale Arbeit dafür tun kann, diesen Teufelskreis der Komorbidität, zu durchbrechen. Da psychische Erkrankungen sowie Suchterkrankungen einen einschneidenden biografischen Bruch im Leben der betroffenen Person erzeugen, befindet sich diese in einer Entwicklung, die ohne äußere Hilfe rapide Verschlechterung erfahren kann. Die Gemeinsamkeit beider Erkrankungen besteht darin, dass sie für den Betroffenen sehr einnehmend sein können und ihn in seiner Lebensführung einschränken. Je nach Schweregrad und subjektiv empfundenen Leidensdruck spiegelt sich dies in sozialem Rückzug und einer mangelnden Fähigkeit der Selbsterhaltung wider. Dies ist bei einer Suchtproblematik beispielsweise in der materiellen Versorgung erkennbar. Das Suchtmittel hat im Leben des Betroffenen einen übersteigerten Wert und die Wahrnehmung bzw. die Befriedigung von anderen Bedürfnissen ist allein vom finanziellen Aspekt merklich beeinträchtigt. Die Folgen können Verschuldung, Kriminalisierung und Verelendung sein. Bei Angsterkrankungen erhält die Vermeidung der Angst ebenfalls einen sehr großen Stellenwert. Die Befriedigung von lebensnotwendigen Bedürfnissen wird der Angst untergeordnet und es ereignet sich auch hier ein Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben und einer psychischen sowie körperlichen Marginalisierung. Dieser Rückzug macht den Nachgang einer Erwerbstätigkeit nahezu unmöglich. Ängste, Spannungen, Langeweile und unbewältigte Freizeit verstärken hierbei die Perspektivlosigkeit. Die Betroffenen entziehen sich immer mehr der sozialen Kontrolle und der gesellschaftlichen Interventionsmöglichkeiten. Demnach stellen diese Menschen eine wichtige Zielgruppe der Sozialen Arbeit dar. Im Bereich der Suchtkrankenhilfe leisten Suchtberatungsstellen, Entzugs- und Rehabilitationskliniken, Adaptionseinrichtungen, sowie ambulant und stationär betreutes Wohnen Suchtkranker einen Großteil der professionellen Betreuung.
Für die psychologische Unterstützung bietet der sozialpsychiatrische Dienst, psychologische Beratungsstellen, psychosomatische (Tages-) Kliniken und ebenfalls ambulant oder stationär betreute Wohnformen Hilfe bei psychischen Problemlagen. In allen Hilfeeinrichtungen kommen in unterschiedlichem Maße Methoden der Sozialen Arbeit zum Einsatz. Innerhalb einer Beratung werden Betroffene und Angehörige über Hilfsangebote zur Verbesserung ihrer Lebenssituation aufgeklärt. Hierbei ist ein interdisziplinäres Fachwissen und ein gutes Verweisungswissen unabdingbar. Durch multiperspektivische Fallarbeit kann die Lebenssituation der Hilfebedürftigen genauer eingeschätzt werden. Es werden Hilfepläne erstellt, um Betroffene zu unterstützen, ihren Lebensunterhalt zu sichern, Veränderungen durchzusetzen und ihnen durch psychosoziale und emotionale Betreuung wieder eine Perspektive geben zu können. Durch motivationale Gesprächsführung, Ressourcenarbeit, Coaching und soziale Trainings werden Menschen dazu befähigt, diese Veränderungen in ihrem Leben leichter realisieren zu können. All diese Interventionsmethoden zielen darauf ab, die Fähigkeit der Selbsthilfe zu stärken und Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Damit ist die Sozialarbeit eine notwendige Ergänzung der medizinischen und gesundheitlichen Hilfssysteme in Deutschland. Die derzeitigen Hilfesysteme der Medizin und des Gesundheitswesens zeichnen sich durch eine starke Tendenz der Medikalisierung aus. Menschen werden in Diagnosen eingeordnet und demnach therapiert. Aus Kosten- und Zeitgründen werden vielerlei Beschwerden medikamentös behandelt. Dabei bleibt die individuelle Diagnose und Intervention vielfach auf der Strecke. Dies ist bei Krankheiten, wo die Therapie einen hohen Anteil an Motivations- und Beziehungsarbeit darstellt, ein großes Problem. Ohne das nötige Einhergehen von Medikamenten und Psychotherapie bleiben Menschen mit niedriger psychischer und sozialer Belastbarkeit oft auf der Strecke. Dabei ist es wichtig, dass man sich bei der Behandlung am jeweiligen Lebenshintergrund des Betroffenen orientiert, was selbstverständlich nicht zeitökonomisch rationalisiert werden kann. Die Leistungen der Sozialarbeit werden immer noch weitestgehend unterschätzt und erlangen wenig gesellschaftliches Ansehen. Dies zeigt sich auch in den Kapazitäts- und Versorgungsdefiziten im kommunalen Bereich. Einrichtungen werden zu wenig gefördert und das ohnehin schon wenig vorhandene, professionelle Personal erfährt sowohl auf fachlicher, als auch auf finanzielle Ebene zu geringe Anerkennung. Auch aus Sicht von Betroffenen ist der Zugang zu Hilfsmöglichkeiten nicht immer ohne weiteres möglich. Es gibt wenige Möglichkeiten, wie man diese Menschen in ihrer Krankheitseinsicht bzw. ihrer Überwindung sich Hilfe zu suchen, bestärken kann. Dadurch, dass psychische Erkrankungen und der psychische Druck immer mehr zunehmen, sind die Kapazitäten von Psychotherapeuten und/oder vergleichbaren Fachkräften schon sehr lange ausgereizt. Einen Therapieplatz bzw. allein schon einen Platz in einer Entzugsklinik zu bekommen, ist sehr oft mit wochen- bis monatelangen Wartezeiten verbunden. Sofortigen Zugang zu Hilfe bekommt man nur dann, wenn es um direkte Gefährdung von „Leib und Leben“ geht. Von daher herrscht hierbei ein großer Verbesserungsbedarf in der Früherkennung von psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel von Suchterkrankungen und Angststörungen.
2. Suchterkrankungen
Der Konsum von Drogen aller Art ist schon seit je her ein soziales Phänomen, welches großes destruktives Potential besitzt. Suchterzeugenden Substanzen und deren Missbrauch lassen sich in allen Gesellschaften wiederfinden und genießen, vor allem in der heutigen Zeit, eine hohe wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachfrage.
Einen Erklärungsansatz bietet der Psychoanalytiker Fritz Riemann mit seiner Theorie „Grundformen der Angst“ (2013). Die Menschen verliert in einer hochtechnologischen und sich schnell verändernden Welt immer mehr das Gefühl von Geborgenheit. Reizüberflutung, die Angst vor Kriegen und nicht kontrollierbarer existenzieller Bedrohungen sind Dinge, denen sich der Mensch sehr schwer entziehen kann. Der Konsum von Drogen ist dabei eine naheliegende Fluchtmöglichkeit aus der Realität.
In Bezug auf die depressive Persönlichkeit, wie Riemann sie beschreibt, lässt sich ebenfalls eine Parallelität zwischen psychodynamischen Konflikten und dem Gebrauch von Suchtmitteln ziehen.
„Die Konflikte Depressiver drücken sich körperlich bevorzugt in Störungen des Aufnahmetraktes aus, der ja symbolisch-repräsentativ für alles sich Nehmen, sich Einverleiben, Zugreifen und Fordern steht Von hier führt oft eine schmale Grenze zu Süchten aller Art, die als Ersatzbefriedigung oder Weltflucht zu verstehen sind.“ (Riemann, S. 75-76).
Die Frustkompensation durch Drogenkonsum ist, vor allem für Personen mit einer defizitären psychischen Widerstandskraft, eine leicht zugängliche aber sehr schädliche Form der Stressbewältigung. Heckmann (2013) sieht in der Motivation des Substanzkonsums den Aufbau und den Erhalt einer Scheinwelt und damit verbundener Realitätsflucht.
Im folgenden Themenkomplex wird sich mit dem Wesen einer Suchterkrankung durch diverse Betrachtungsweisen sowie mit dem zerstörerischen und abhängigkeitserzeugenden Potential des Drogenkonsums intensiver auseinandergesetzt.
Der Suchtbegriff wird heutzutage für eine Vielzahl von Krankheitsformen verwendet. Dies können, nach Bell (2014), alle Verhaltensauffälligkeiten von Alkohol- bis Glücksspielsucht umfassen aber auch die psychische Abhängigkeit zu Sekten oder ähnlichem.
Aufgrund dessen, dass jedes Verhalten dieTendenz einer Sucht in sich trägt, geraten neuere Phänomene wie Online- oder Arbeitssucht vermehrt in den wissenschaftlichen Fokus und bewirken eine stetige Grenzerweiterung des Begriffs. Jede beliebige Handlung, die der Trieberfüllung dient, hat eine Tendenz, unkontrollierbar zu werden und die Funktion zu übernehmen, den Drang der inneren Leere zu stillen. Sucht ist ein aufdringliches und einschränkendes Krankheitsbild, welche im Reagieren und Verhalten in allen Lebensbereichen zu finden ist (Bell, 2014, S, 19).
Für Myers (2008) bezeichnet der Suchtbegriff das zwanghafte Verlangen nach einer Droge, auch wenn damit verbundene nachteilige Folgen, wie Schmerzen, Übelkeit und Erschöpfung beim Absetzen der Substanz, zu erwarten sind.
Eine Suchterkrankung ist laut Brosch (2007) ein fortschreitender und chronisch verlaufender Prozess, der von destruktiven Verhaltensauffälligkeiten geprägt ist und sich in psychischem und körperlichem Verfall widerspiegelt.
Flöttmann (2015) beschreibt Sucht als ein nicht ablegbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand, welches rational nur schwer kontrollierbar ist. Als Folge der Sucht sieht er die Beeinträchtigung der freien Persönlichkeitsentfaltung und die Zerstörung von sozialen Bindungen und die Sozialchancen einer Person.
Sozialpsychologe Heckmann beschreibt Sucht ebenfalls als zwanghaftes Verlangen, durch bestimmte Reize und Reaktionen, die Erzeugung von Lustgefühlen bzw. die Vermeidung negativer Gefühlen anzutreiben. Die sofortige Bedürfnisbefriedigung stellt den Versuch dar, Verhaltensweisen, die natürlicherweise zu Befriedigung führen zu umgehen. Er assoziiert diesen Zwang auch mit einer mangelhaften Selbstkontrolle (Heckmann, 2013, S. 945).
Für den Untersuchungsgegenstand der Abschlussarbeit ist die Definition von Heckmann am zutreffendsten. Innerhalb dieser Begriffsbestimmung fungiert das Suchtmittel als Maßnahme für „sofortige Bedürfnisbefriedigung“ in Hinblick auf die Kompensation der Angstsymptome. Aufgrund von mangelnder Selbstkontrolle muss dieses Verhalten zwanghaft aufrechterhalten.
2.1 Suchtmittelmissbrauch und Suchtmittelabhängigkeit
Bei Störungen durch Substanzkonsum unterscheidet man zwischen Substanzmittelmissbrauch und Substanzmittelabhängigkeit. Einer Suchterkrankung liegt immer ein vorheriger Missbrauch zugrunde.
Von Missbrauch wird, laut Heckmann (2013), gesprochen, wenn der Konsum einer oder mehrerer Drogen eine Menge und Frequenz übersteigt, dass dieser zu körperlichen, seelischen oder sozialen Beeinträchtigungen führen könnte.
Nach Margraf und Schneider (2009) stellt Missbrauch ebenfalls den schädlichen Gebrauch von abhängigkeitserzeugenden Substanzen dar, welcher auf ein problematisches Konsumverhalten hindeutet. Corner (2001) nimmt daher an, dass durch den Konsum negative Konsequenzen im schulischen, beruflichen, rechtlichen oder zwischenmenschlichen Bereich zu erleiden sind. Familiäre und andere soziale Bindungen können aufgrund des erhöhten Fremd- aber auch Eigenschädigungspotentials, stark gefährdet sein. Erlangt die Substanz einen zentralen Stellenwert im Leben der Person, kommt es vermehrt zu einer Dosissteigerung und zu Kontrollverlust und es herrscht ein höheres Risiko vor, an einer Suchtmittelabhängigkeit zu erkranken.
Suchtmittelabhängigkeit, entstanden durch ein problematisches Konsumverhalten, gilt als fortgeschrittene Störung durch Substanzkonsum. Hinter diesem Begriff steht das Krankheitsbild, was man umgangssprachlich hin als „Sucht“ bezeichnet. Abhängigkeit zeichnet sich vorrangig durch den psychischen aber auch physischen Drang aus, eine erstmalig konsumierte Substanz erneut einzunehmen. Zusätzlich zum Substanzmittelmissbrauch kommt hinzu, dass sich eine körperliche Abhängigkeit manifestiert, die sich in Toleranz gegenüber der Substanzwirkung oder in Entzugssymptomen widerspiegeln, wenn der Konsum eingestellt wird (Corner, 2001, S. 319).
Myers (2008) charakterisiert Toleranz als eine die neuroadaptive Reaktion des Gehirns, dessen Chemie so zu verändern, dass die Wirkung bzw. die Beeinträchtigung durch die eingenommene Substanz verringert wird. Diese sogenannte funktionelle Toleranz wird nach Feuerlein (1989) von der dispositionellen Toleranz unterschieden, welche alle Anpassungsprozesse des Verdauungssystems umfasst, was den Körper dazu veranlasst, eine Substanz schneller abzubauen. Demzufolge werden immer größere Mengen einer Droge benötigt, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, was in den meisten Fällen einen intensiven Rausch darstellt. Bei der Dosisverringerung oder beim Absetzen der Substanz werden die neuronalen Strukturen im Gehirn vom Wirkstoff der Droge befreit und die Synapsen sind außerordentlich empfindlich. Erregende Aminosäuren wirken demnach stärker und rufen so diverse körperliche, kognitive aber auch emotionale Beschwerden hervor. Diese physiologischen und psychischen Reaktionen sind substanzspezifisch und werden Entzugserscheinungen genannt. Das Krankheitsbild des Entzugssyndroms zeichnet sich durch veränderten Blutdruck, Schwitzen, Zittern, Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe, Angstattacken, psychomotorische Unruhe, Brechreiz, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen Aggressionen, Halluzinationen und Bewusstseinsstörungen, Muskelkrämpfe, Angstattacken, psychomotorische Unruhe, Brechreiz, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen aus (Brosch, 2007, S. 167).
Kirschbaum (2008) merkt an, dass substanzspezifische Entzugserscheinungen unterschiedlich schnell abklingen. In besonders schweren Fällen ist eine medizinische Behandlung erforderlich, da Entzugserscheinungen, wie Krampfanfälle oder ein Delirium für den Betroffenen sogar lebensbedrohlich werden können. Weitere Begleiterscheinungen können zum einen das unbezwingbare Verlangen sein, die Substanz erneut zu konsumieren, was umgangssprachlich auch als Craving bezeichnet wird. Zum anderen kann ein Entzug auch einen Kontrollverlust über das eigene Verhalten herbeiführen.
Weitere Unterschiede zum Substanzmittelmissbrauch liegen zum einen in diversen Verhaltensänderungen, wie zum Beispiel der Rückzug aus dem sozialen Leben, der Verlust von Interessen und die wachsende Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Person und der sie umgebenden Umwelt. Eine wachsende Unfähigkeit zur Kontrolle über den Substanzkonsum ist zu beobachten. Zum anderen kommt es bei einem langwierigen, regelmäßigen und chronischen Konsum zu massiven körperlichen, psychischen und neuronalen Schädigungen (Markraf & Schneider, 2009, S. 764).
2.2 Körperliche und psychische Abhängigkeit und Suchtformen
Die WHO unterscheidet bei der Bezeichnung des Abhängigkeitsbegriffes zwischen psychischer und physischer Abhängigkeit. Beginn der psychischen Abhängigkeit markiert der mögliche Wunsch nach Wiederholung, nach dem ersten Konsum einer suchterzeugenden Substanz. Im weiteren Verlauf der psychischen Abhängigkeit treten vermehrt Kontrollverlust über Menge, Zeit und Häufigkeit des Konsums auf.
Durch die stressreduzierende und stimmungsaufhellende Wirkung einer Droge, entsteht eine psychische Abhängigkeit um einiges schneller als die körperliche Abhängigkeit. Diese entsteht erst nach mehrmaligen, schädlichen Konsum einer Substanz und spiegelt sich in Toleranzentwicklung, Dosissteigerung und Entzugssymptome beim Absetzen des Suchtmittels wider. Sie ist in der Regel immer von der psychischen Abhängigkeit begleitet. Bei der körperlichen Abhängigkeit stehen nicht mehr die positiven Wirkungen im Vordergrund sondern die Linderung von auftretenden Entzugserscheinungen.
Eine weitere Unterscheidung des Suchtbegriffes wird durch die Einteilung in Suchtformen vorgenommen. Es handelt sich dabei um stoffgebundene und stoffungebundenen Süchten (Heckmann, 2013, S. 218).
Bei der stoffgebundenen Sucht werden, wie Heckmann (2013) schreibt, dem menschlichen Körper psychoaktive Substanzen, wie zum Beispiel Alkohol, Nikotin, Sedativa, Stimulanzien und Halluzinogenen oral, nasal, intravenös oder über die Atemwege zugeführt. Der Konsum zielt auf den Missbrauch ab und birgt ein großes destruktives Potential in sich, sowie eine stärkere soziale Auffälligkeit als die stoffungebundenen Suchtformen.
Nach Bell (2014) zeichnet sich eine stoffungebundene Sucht durch den zwanghaften Drang, eine Handlung auszuführen oder einer bestimmten Verhaltensweise nachzugehen, aus. Unter dieser Kategorie fallen zum Beispiel die Glücksspielsucht, Essstörungen, Kleptomanie, Pyromanie, Sexsucht, Arbeitssucht und vielen weiteren Arten von sogenannten Verhaltenssüchten.
In dieser Arbeit soll es aber vorzugsweise um stoffgebundene Süchte in Form von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit gehen.
2.3 Diagnose von Suchterkrankungen
Suchterkrankungen zeichnen sich durch ein bestimmtes Symptomcluster aus, welches durch diverse klinische Diagnoseverfahren festgestellt werden kann. Grundlage dafür bieten sogenannte Klassifikationssysteme, die als Richtlinie für eine präzise Diagnosestellung fungieren. Die beiden relevantesten Klassifikationssysteme innerhalb der Psychiatrie sind, nach Hoyer und Wittchen (2011), das DSM-IV-TR, welches vor allem in der Forschung eingesetzt wird und das ICD-10, welches innerhalb des internationalen Gesundheitssystems für die therapeutische Diagnosestellung gebraucht wird. Beide diagnostischen Kataloge definieren psychische Erkrankungen als eine krankheitsspezifische Symptomkonstellation, deren Kriterien in unterschiedlichem Maße quantitativ und zeitlich erfüllt sein müssen, um eine Diagnose erstellen zu können. Bei näherer Betrachtung ist auffällig, dass sich das Abhängigkeitssyndrom aus unterschiedlichen Kriterien zusammensetzen kann und dass die Symptome nicht immer eindeutig beobachtbar sind. Die heterogene Ausprägung dieser Störung erfordert daher eine multidimensionale Diagnosestellung.
Zielweisend ist, nach Margraf und Schneider (2009), das Kernmerkmal der geringen Bereitschaft zur Aufgabe oder Verringerung des Konsums bei der erkrankten Person.
Aufgrund der wissenschaftlichen und empirischen Konzeption dieser Abschlussarbeit, wird sich bewusst auf die Vorstellung des DSM-IV-TR konzentriert, da im Zentrum der Untersuchungen nicht die Diagnosestellung, sondern die Erforschung der Komorbidität zwischen Angststörungen und Suchterkrankungen steht.
Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ist ein Klassifikationssystem, welches diverse psychische Symptome in Krankheitsbilder einteilt und diese dadurch statistisch vergleichbar sind. Es wurde von der American Psychiatrie Association, kurz APA, entwickelt und wird, vor allem, in Wissenschaft und Forschung angewendet.
Die Krankheitsbilder werden in sogenannten Achsen erfasst. Achse I stellt hierbei die klinischen Störungen dar, wie zum Beispiel Angststörungen, Suchterkrankungen aber auch Störungen der Impulskontrolle, die sich in pathologischen Glücksspielen ausprägen kann. Achse II umfasst die Persönlichkeitsstörungen, wie die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ängstliche Persönlichkeitsstörung, die schizoide Persönlichkeitsstörung oder die antisoziale Persönlichkeitsstörung.
Die Achse III enthält medizinische Krankheitsfaktoren, die Ausprägung einer psychischen Störung sein können. Achse IV umfasst psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme, die die Ausprägung bzw. die Begünstigung einer psychischen Erkrankung bewirken könnten. Und zu guter Letzt, die Achse V, welche die globale Beurteilung des Funktionsniveaus beinhaltet und mehr der Therapie- und Hilfeplanung dient (Hoyer & Wittchen, 2011, S. 702).
Im Hinblick auf Störungen, die mit dem Konsum von suchterzeugenden Substanzen Zusammenhängen, unterscheidet das DSM-IV-TR zwischen Störungen durch Substanzkonsum und substanzinduzierten Störungen. Zusätzlich gehört zu einer Diagnose der Vermerk von einer der 11 verschiedenen Substanzen.
Substanzinduzierte Störungen, sind psychische Störungen, die durch den unmittelbaren Konsum einer psychoaktiven Substanz entstanden sind. Darunter fallen das Krankheitsbild der Substanzintoxikation, das Entzugssyndrom sowie psychische Störungen, die durch den Konsum von einer bestimmten psychoaktiven Substanz zurückzuführen sind.
Krankheitsbilder wie ein Delir, psychotische Störungen, Angststörungen und affektive Störungen können durch den Konsum von Drogen initiiert werden.
Die Substanzintoxikation wird durch eine Überdosis einer Droge verursacht. Dieser Zustand ist reversibel, wenn das Suchtmittel im Körper abgebaut wird. Je nach Art der Substanz kommt es zu unterschiedlichen Vergiftungserscheinungen, welche sich durch abweichende Verhaltensweisen und psychische Veränderungen zeigen. Die Diagnose einer Substanzintoxikation darf nur gestellt werden, wenn die Beschwerden durch andere psychische Störungen oder einem medizinischen Krankheitsfaktor vorliegen (Hoyer & Wittchen, 2011, S. 700-703).
Das DSM-IV-TR unterscheidet innerhalb der Kategorie „Störungen durch Substanzkonsum“ zwischen Substanzmittelmissbrauch und Substanzmittelabhängigkeit. Diese beiden Erkrankungen sind der Achse I zuzuordnen und gelten als organisch bedingte psychische Störungen. Medizinische Folgen, die durch den schädigenden Konsum entstanden sind, werden hingegen in der Achse III aufgeführt.
Die Kriterien für Substanzmissbrauch nach dem DSM-IV-TR sind im Anhang einsehbar.
Im Zentrum der Substanzmissbrauchsdiagnose stehen die körperliche Selbst- und Fremdgefährdung sowie negative Konsequenzen und Verhaltensweisen, die vom sozialen Umfeld beobachtbar sind. Die negativen Konsequenzen müssen in direkter Verbindung mit dem missbräuchlichen Substanzkonsum stehen. Probleme mit dem näheren sozialen Umfeld resultieren beispielsweise daraus, dass der zumeist unerlaubte Gebrauch eines Suchtmittels nicht von der Gesellschaft oder von der Familie geduldet wird. Aufgrund der Illegalität des Konsums kann der Betroffene in Konfrontation mit Polizei und Justiz kommen, was mit rechtlichen und strafgesetzlichen Konsequenzen verbunden sein kann.
Der Gebrauch einer schädlichen Substanz kann beobachtet werden, wenn der Konsum die betroffene Person so weit in ihren psychischen und sozialen Kompetenzen einschränkt, dass sie gesellschaftlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist. Als Vorstufe der Substanzabhängigkeit, erhält der Substanzmissbrauch eine ernstzunehmende klinische Bedeutsamkeit. Bereits in dieser Phase tritt eine Tendenz zur Leugnung der Substanzproblematik auf (Hoyer & Wittchen, 2011, S. 700).
Die Kriterien für Substanzabhängigkeit nach dem DSM-IV-TR sind im Anhang aufgelistet.
Bei der Substanzabhängigkeit handelt es sich um mehr als ein Muster schädlichen Konsums. Die Substanz nimmt eine zentrale Rolle im Leben der Person ein und der Konsum wirkt sich in destruktiver Weise auf Körper und Psyche aus. Die Selbstkontrolle über den Zeitraum und die Dosis ist zunehmend eingeschränkter. Es treten Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen auf. Nach der Unterscheidung zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit, müssen physiologische Abhängigkeitssymptome nicht zwingend notwendig sein, um die Störung zu diagnostizieren. Sobaldjemand eine Abhängigkeitsdiagnose gestellt bekommt, ist es eine Diagnose auf Lebenszeit. Ist die Person abstinent und stabil, so wird diese durch die Remission der Störung erweitert (Hoyer & Wittchen, 2011, S. 700).
2.1.3 Epidemiologie von Suchterkrankungen
Aufgrund des gesellschaftlichen und gesetzlichen Tabus von Drogenabhängigkeit ist die empirische Untersuchung der Verbreitung von Substanzkonsum und substanzbezogenen Störungen schwer in genauen Zahlen zu erfassen. Vielmehr nimmt man eine große Dunkelziffer aufgrund der Illegalität des Verhaltens und der mangelnden Einsichtsfähigkeit zur Abhängigkeitserkrankung an. Durch den, zum Teil Jahre dauernden Erkrankungsprozess von Substanzmissbrauch zur Substanzabhängigkeit, ist die Aufstellung von Prävalenzraten ebenfalls sehr schwer formulierbar (Hoyer & Wittchen, 2011, S. 717).
Aufgrund des Untersuchungsgegenstandes, wird sich auf die epidemiologische Untersuchung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit konzentriert.
Alkohol:
Im Jahre 2015 haben 9,5 Millionen Menschen Alkohol in gesundheitlich riskantem Maß konsumiert. Laut dem Epidemiologischen Suchtsurvey aus dem Jahre 2012 geht hervor, dass 1,77 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren eine Alkoholabhängigkeit vorweisen. Durchschnittlich liegt die Zahl der Todesfälle, die an den Folgen von Alkohol allein und in Verbindung mit Tabak gestorben sind pro Jahr bei 74.000.
Der dadurch entstehende wirtschaftliche Schaden, der durch riskantem Konsum entsteht, beruft sich auf 26,7 Milliarden Euro pro Jahr.
Unter den Jugendlichen, innerhalb der Altersspanne 12-17 Jahren, haben 68,0 % schon einmal Alkohol getrunken. 10,9% dieser Altersgruppe trinken mindestens einmal die Woche Alkohol (Orth, 2016, S. 13-15).
Medikamente:
Medikamente mit psychotroperWirkung sind im deutschen Gesundheitswesen ein unerlässlicher Bestandteil der Therapie. Die meisten dieser Medikamente sind legal, jedoch verschreibungspflichtig erhältlich. Aufgrund ihres oft unterschätzten Abhängigkeitspotentials geschieht eine Dosissteigerung bis zum Missbrauch eher schleichend. Durch eine anzunehmend hohe Dunkelziffer ist eine präzise quantitative Erhebung schwer durchführbar. Im Jahre 2015 gelten 1,4 bis 1,5 Millionen Menschen in Deutschland mit steigender Tendenz als medikamentenabhängig. Die suchterzeugenden Medikamente, die am häufigsten verschrieben werden, sind Schlaf- und Beruhigungsmittel.
Der Epidemiologische Suchtsurvey aus dem Jahr 2012 geht hervor, dass 61,9% der 18- bis 64-Jährigen in den letzten zwölf Monaten Schmerzmittel einnahmen. Andere Medikamente wie Antidepressiva, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Neuroleptika und vieles mehr, folgen dicht darauf. Im Gegensatz zu anderen psychoaktiven Substanzen, werden Arzneimittel häufiger von Frauen als von Männern eingenommen (Mortler, 2016, S. 35-36).
2.5 Ätiologie von Suchterkrankungen
Innerhalb ätiologischer Untersuchungen wird aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven die Entstehung einer Erkrankung untersucht.
In diesem Kapitel erfolgt eine Klärung des nomologischen Netzwerkes verschiedener Theorien zur Suchtpathogenese.
2.5.1 Genetische Perspektive
Anhand der familiären Aggregation von Substanzstörungen kann man davon ausgehen, dass genetische Dispositionsfaktoren einen Einfluss auf die Ausprägung missbräuchlichem und abhängigen Verhaltens haben. Dieses Phänomen wird intergenerationale Transmission genannt. Vulnerabilitätsfaktoren und Verhaltensweisen haben eine Wahrscheinlichkeit an die nächste Generation weitergegeben zu werden.
Innerhalb der Untersuchungen werden Probanden mit einer Substanzstörung und deren Familienangehörigen ersten Grades vernommen. Die Risikowahrscheinlichkeit ist nach manchen Studien bis um das 8-fache höher, dass Familienangehörige ebenfalls eine Substanzstörung vorweisen.
Die intergenerationaleTransmission wird mittels Zwillings- und Adoptionsstudien, sowie High-Risk-Studien untersucht. Daran wird untersucht, in wie weit genetische Faktoren eine Suchtpathogenese begünstigen. In Zwillingsstudien werden eineiige und zweieiige Zwillingspaare in ihrem Konsumverhalten von Alkohol, Nikotin, aber auch illegalen Drogen untersucht. Die daraus abgeleitete Konkordanzrate für eine Abhängigkeitsentwicklung betrug innerhalb einer Untersuchung bei monozygoten Zwillingspaaren 41%, bei dizygoten Zwillingspaaren 24% (Margraf & Schneider, 2009, S. 768).
Eine Studie zur Konkordanzrate von Alkoholmissbrauch ergab mit 54% bei eineiigen und 28% bei zweieiigen Zwillingen einen vergleichbaren Wert. Die Annahme der genetischen Prädisposition wird durch Adoptionsstudien gestützt. Innerhalb dieser Studien werden Menschen, die kurz nach der Geburt adoptiert wurden und deren biologische Eltern Alkoholiker waren mit denen, deren biologische Eltern keine Abhängigkeitsdiagnose besaßen verglichen. Die Adoptiveltern waren in beiden Fällen nicht durch
Substanzstörungen belastet. Im Erwachsenenalterwiesen Personen, deren biologische Eltern Alkoholiker waren, eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit auf, ebenfalls missbräuchlicheTrinkgewohnheiten zu entwickeln (Comer, 2001, S. 342).
Die Übereinstimmung in den jeweiligen Konsummustern in sowohl Zwillings- und Adoptionsstudien ist zurückführbar auf genetische und familiäre Umgebungsfaktoren.
Das Zusammenwirken von genetische Dispositionsfaktoren, familiären und individuell spezifischen Umgebungsfaktoren begünstigt demnach die Suchtpathogenese.
2.5.2 Biochemische Perspektive
Aus biochemischer Sicht erfolgt die Suchtpathogenese durch eine Korrelation von molekularen und zellulären Mechanismen im Zentralnervensystem, wenn Drogen auf die neuronalen Überragungsmechanismen einwirken. Das Suchtverhalten ist ein vornehmlich motivational generiertes Verhalten, welches sowohl kortikale, als auch subkortikale Hirnareale beeinflusst. Der präfrontale Kortex ist Bestandteil des kortikalen Hirnareals und Sitz des Bewusstseins. Dort befindet sich das Kontroll- und Entscheidungssystem von kognitiven Funktionen (Margraf & Schneider, 2009, S. 769).
Dieser Bereich ist nach Hoyer und Wittchen (2011) bei einer Substanzabhängigkeit um ein Vielfaches eingeschränkt. Die Amygdala und der Hippocampus fungieren als das Gedächtnis- und Lernsystem und sind in der subkortikalen Hirnregion lokalisiert.
Das limbische System ist Teil des subkortikalen Hirnareals, welches Gehirnstrukturen verbindet, in denen Triebgenerierung und Emotionsregulation stattfindet. Dieses limbische System steht bei der biochemischen Suchtpathogenese im Mittelpunkt, da das darin lokalisierte mesolimbische System eine besondere Bedeutung für die Anreizmotivation in sich trägt. Dieses sogenannte Belohnungssystem zieht sich, nach Comer (2001), über Nervenfaserstränge vom subkortikalen bis in den kortikalen Hirnabschnitt und affektiert somit auch das Kontroll- und Entscheidungssystem des Gehirns.
Das Belohnungssystem nimmt bei der positiven und negativen Verstärkung von Verhalten einen großen Stellenwert ein. Grund hierfür ist, laut Feuerlein (1989), der Neurotransmitter Dopamin, welcher neben Noradrenalin, Endorphinen und Serotonin die Reizweiterleitung im Zentralnervensystem verursacht und als Belohnungsmodulator fungiert. Primäre Verstärker und erlernte Belohnungsanreize führen zu einer erhöhten Ausschüttung von Dopamin. Dieser Belohnungsschaltkreis kann, nach Myers (2008), durch suchterzeugende Substanzen angeregt werden. Der Konsum einer psychoaktiven Droge veranlasst das Belohnungssystem dazu, mehr Dopamin auszuschütten. Im Gegensatz zu natürlichen Verstärkern ereignet sich, laut Margraf und Schneider (2009), eine Überstimulierung des Belohnungssystems beim Drogenkonsum. Je nach Substanz wird bis auf das Zehnfache der normativen Dopamin- Menge freigesetzt. Dadurch werden in unmittelbarer Zeit euphorische Zustande erzeugt, bis die Wirkung nachlässt. Das Suchtverhalten ist nach Feuerlein (1989) eine Opportunität, Triebbefriedigungsmechanismen auszulösen, um positive Gefühlszustände zu erreichen. Ein begünstigender Faktor bei der Suchtpathogenese ist die Assoziation zwischen der positiven Wirkung einer Droge in Hinblick auf psychosomatischen Beschwerden, wie Angst, Anspannung oder Schmerz. Bereit beim Erstkonsum einer Droge werden emotionale, sensorische, motorische und motivationale Aspekte des Rauschzustandes in einem sogenannten Suchtgedächtnis gespeichert. Diese anatomisch-neurobiologischen Assoziationen sind so immens in diesem komplexen Funktionsgefüge verankert, dass sie kaum wieder verlernt werden können. Ausgeschüttetes Dopamin führt nach Margraf und Schneider (2009), neben der Auslösung euphorischer Gefühle, zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit, durch die der Konsum und die psychophysischen Veränderungen als bedeutsamer wahrgenommen werden. Diese Verknüpfungen werden aus dem Gedächtnis reproduziert und stellen einen potentiellen Auslöser für den erneuten Konsum dar. Dies zeigt sich vor allem bei Personen, deren akute Entzugserscheinungen bereits abgeklungen sind. Die internalisierten Assoziationen und Hinweisreize in Verbindung mit der Droge lösen selbst dann noch physiologische Erregung und ein starkes Verlangen nach der Droge aus. Bei regelmäßigen, missbräuchlichen Konsum entstehen, laut Myers (2008) neurophysiologische Veränderungen, welche aus einem veränderten Neurotransmitterhaushalt resultieren. Vor allem bei einem hohen Spiegel von Dopamin reagiert der Körper mit einer Adaption an den Neurotransmitter. Nach Baumann und Perrez (1998) bedeutet das, dass die körpereigene Produktion wird auf ein Minimum reduziert wird. Das bedeutet zum einen, eine erhöhte Toleranz gegenüber des Suchtmittels, was zu einer exponentiellen Steigerung zwischen reduzierter Wirkung und Dosissteigerung entwickelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 01: Drogentoleranz
Zum anderen verursacht diese Neuroadaption Fehlregulationen in Hinblick auf Wohlbefinden, Entspannung und Wachheit, wenn die Droge nicht konsumiert werden kann. Die neurophysiologische Verstärkungswirkung ist eng mit assoziativen Lernprozessen im Belohnungssystem verbunden und hat bei der Suchtpathogenese eine unbestreitbare Relevanz. Je höher der persönliche Nutzen an einer Substanz ist, desto schneller werden instrumentelle Verhaltensweisen aufgebaut, die weiteres Wohlbefinden generieren.
2.5.3 Lerntheoretische Perspektive
Neben Lernprozessen der operanten Konditionierung aufgrund substanzinduzierter neurobiologischer Verstärkungswirkungen, wird dem sogenannten Lernen am Modell ebenfalls eine große Relevanz bei der Suchtpathogenese zugesprochen.
Eines der entscheidenden Bedingungen für die Initiierung des ersten Substanzkonsums und der erneuten Substanzeinnahme stehen, neben Neugier und aversiver Emotionen, auch die soziale Akzeptanz bzw. die Gruppenzugehörigkeit, wie Baumann und Perrez (1998) schreiben. Die sozial-kognitive Lerntheorie von Albert Bandura wird auch als Beobachtungslernen oder Nachahmungslernen bezeichnet und stützt sich nach Dietz (2006) auf die Annahme, dass sich Menschen durch den kognitiven Prozess des Nachahmens eines anderen Individuums, neue Verhaltensweisen, Einstellungen und Normen aneignen. Dieses Individuum fungiert als Modell, welches dem Beobachter die positiven bzw. negativen Konsequenzen eines Verhaltens aufzeigt. Dieser Modelling-Effekt führt dazu, dass Verhaltensweisen übernommen, verstärkt oder vermieden werden.
Margraf und Schneider (2009) merken an, dass, wenn ein Modell durch spezifische Verhaltensausprägungen, Anerkennung und Gruppenzugehörigkeit erlangt und wenn eine emotionale Bindung zum Beobachter vorliegt, dass das Verhalten häufiger nachgeahmt wird. Hierbei steht die Selbstwirksamkeit des Verhaltens im Vordergrund. Dieses Phänomen zeigt sich vor allem in Peer-Groups sehr deutlich.
Beim Modelllernen unterscheidet man, nach Dietz (2006), zwischen der Akquisition und der Performanz. Bei der Akquisition wird das Verhalten beobachtet und damit verbundenen Konsequenzen im Gedächtnis verknüpft. Zur Performanz, also zur Eigenanwendung des Verhaltens, muss es nicht sofort kommen bzw. es muss überhaupt nicht selbst angewendet werden. Bandura ergänzt durch seine soziale Lerntheorie die behavioristische Perspektive, in der Lernprozesse allein durch äußere Reize initiiert werden um eine soziale Komponente. Faktoren der Person, ihr Verhalten und ihr Umfeld wirken zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.
2.5.4 Griffnähe-Umfeld-Subjekt
Es gibt neben monokausalen Ansätze eine Vielzahl von multikausalen Theorien zur Suchtpathogenese. Die Gemeinsamkeit all dieser Modelle liegt in einer Interaktion zwischen verschiedenen Faktorengruppen, die je nach Zusammenwirken zu einer Suchterkrankung führen können. Visualisiert wird dieses kausale Bindungsgefüge in einem ätiologischen Trias, bestehend aus der Griffnähe, dem Umfeld und dem Subjekt, welches unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze in einem Modell vereint.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 02: Kielholzsches Dreieck
Das Modell des „Kielholzschen Dreieicks“ veranschaulicht, dass Sucht keinen monokausalen Krankheitsursprung besitzt, sondern vielmehr aus multifaktoriellen Beziehungsstörungen resultiert, die sich von Fall zu Fall unterscheiden. Die Krankheitsentstehung geschieht, laut Brinkmann, Nowak und Schifman (1994), nach über einen längeren Zeitraum hinweg, indem Rückkopplungsprozessen auf den systemischen Prozess der Suchtpathogenese in unterschiedlichem Maße einwirken.
Dabei wird die Griffnähe einer Droge, nach Bell (2014), erst durch den Willen des Konsumenten zu einer Ursache. Die Einwirkung der Droge auf den Suchtentstehungsprozess ist zum einen durch die Substanz an sich, deren Verfügbarkeit, deren Anwendung und deren Wirkweise beeinflusst. Je länger und intensiver eine Droge konsumiert wird und wie der Konsum von der sozialen Umwelt bewertet wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Droge einen zentralen Platz im Leben der betroffenen Person erhält.
Das soziale Umfeld hat einen immensen Einfluss auf die Ausprägung pathologischen Konsumverhaltens. Dieser reicht von der Sozialschicht über die soziale Gruppe bis in die familiären Strukturen einer Gesellschaft (Brinkmann et.al., 1994, S. 10-11).
Die Gesellschaft gibt Gesetze, soziale Regeln und Normen vor und bestimmt somit in erster Linie die allgemeine Verfügbarkeit einer Droge, sowie die Einstellung zur Substanz.
[...]
- Arbeit zitieren
- Lisa Mertens (Autor:in), 2016, Komorbidität zwischen Angststörungen und Suchterkrankungen. Ein Beitrag aus der sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542667
Kostenlos Autor werden






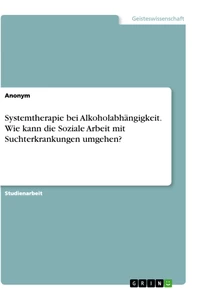






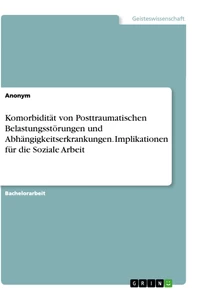






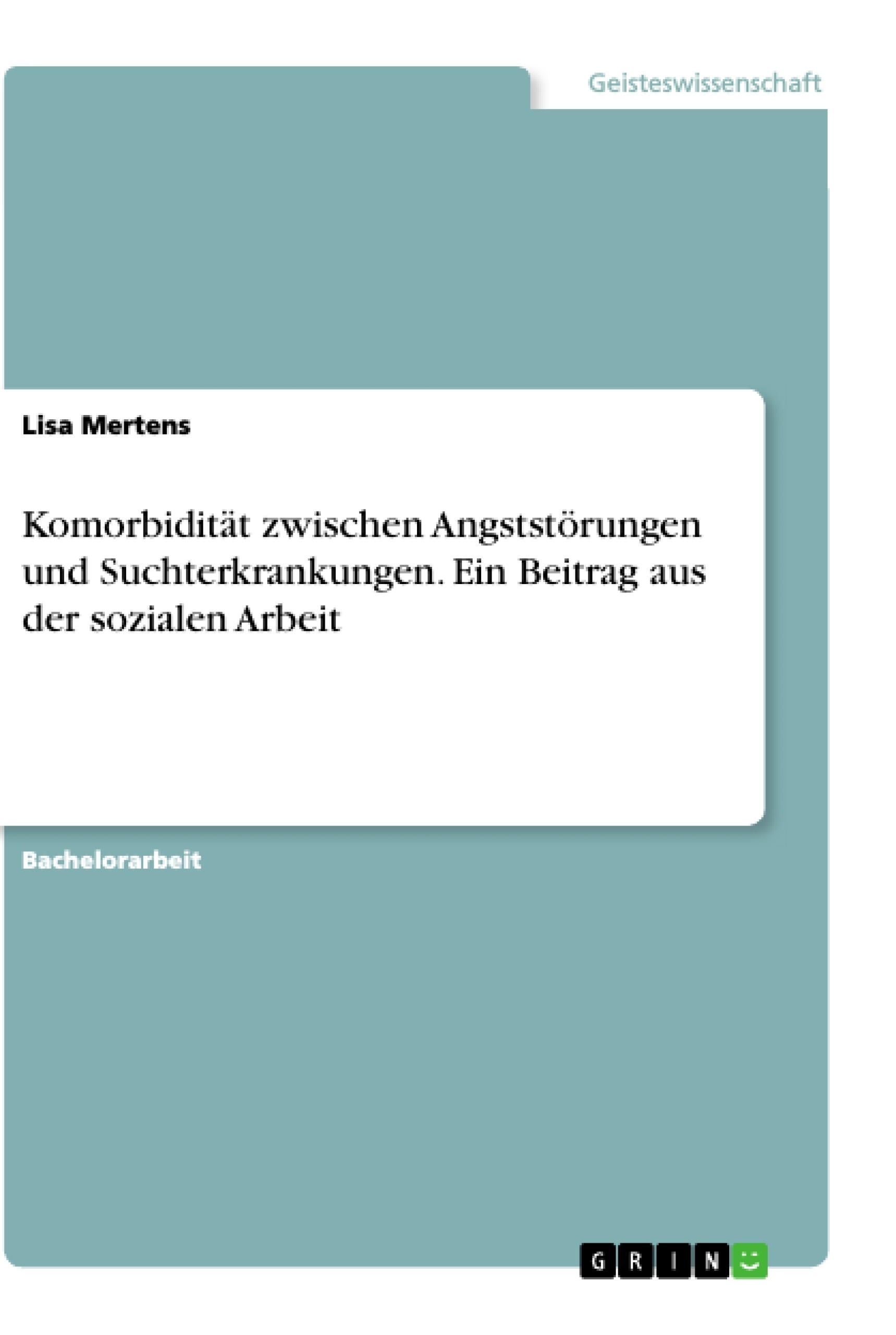

Kommentare