Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemskizzierung und Zielsetzung dieser Arbeit
1.2 Gliederung und Vorgehensweise der Arbeit
2 Sucht – Siech – Krank
3 Morphinismus, Heroinismus
3.1 Geschichtlicher Abriss
3.2 Abhängigkeitsrisiko und Abhängigkeitskarriere
3.3 Wege aus oder mit der Heroinsucht
4 Substitution
4.1 Rechtliche Voraussetzungen
4.2 Substitution in der Praxis
5 SubstitutionsseniorInnen
6 Methodisches Vorgehen
6.1 Das Ergebungsinstrument
6.2 Aufbau und Inhalt des Interviewleitadens
6.3 Auswahl und Beschreibung der Experten
6.4 Datenerhebung
6.5 Datenauswertung
7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
7.1 Soziodemografische Angaben
7.2 Kategorie 1: Aktuelle Lebensumstände
7.3 Kategorie 2: Lebens- und Drogenkonsumverlauf
7.4 Kategorie 3: Substitution
7.5 Kategorie 4: Gesundheitliche Situation
7.6 Kategorie 5: Bedarfslage hinsichtlich Beratungs- und Unterstützungsangebote
7.7 Sonstiges
7 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
8 Schlussbetrachtung
9 Literaturverzeichnis
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Interviewpartnern bedanken, die durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Gelingen dieser Bachelorarbeit beigetragen haben. Ein sehr großes Dankeschön gilt hier den befragten Substituierten, die bereit waren ein persönliches Interview über ihre Lebenssituation und ihre sozialen Bedingungen zu führen und zwar im Vertrauen darauf, an einer guten Sache mitzuwirken. Zudem möchte ich mich herzlich bei Dr.S bedanken, der mir sein Engagement und seine Zeit widmete und mir für weitere Fragen immer zur Verfügung stand.
Mein Dank gilt außerdem Herr Prof. Dr. phil. habil. Hubert Beste für die freundliche Hilfsbereitschaft, die er mir entgegenbrachte.
Vor allem aber muss ich mich bei meiner Familie, meinen Freunden und vor allem meinem Freund bedanken. Danke dafür, dass ihr mir immer den Rücken gestärkt habt und ich immer auf euch zählen konnte. Was würde ich nur ohne euch tun?
Dankeschön! Ihr seid meine persönlichen Helden!
Abstract
Unsere Gesellschaft altert. Vor allem durch die medizinischen Fortschritte können Menschen heutzutage ein viel höheres Lebensalter erreichen. Auch drogenabhängigen Menschen wird, nach jahrelangen Debatten seitens der Politik über Sinn und Unsinn akzeptierender Drogenhilfe, durch sogenannte Harm Reduction Angebote, wie der Substitutionsbehandlung, diese Möglichkeit geboten. Doch wie kann eine Versorgung dieser Klientschaft im Alter aussehen? Welchen Betreuungsbedarf hat die Klientel? Wie kann die Soziale Arbeit Lösungsstrategien entwickeln, um auch für ältere Langzeitsubstituierte ein würdevolles Leben im Alter verwirklichen zu können? Die Versorgungssituation dieser Personengruppe ist durch komplexe Problemlagen und beschleunigte Alterungsprozesse gekennzeichnet. Jedoch sollte auch für sie einer Realisierung sozialer Teilhabe nichts im Wege stehen. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der subjektiven Wahrnehmung der substituierten Menschen. Ihre Problem- und Versorgungslage soll in den Mittelpunkt gerückt werden. Um eine möglichst realitätsnahe Einschätzung der sozialen Lage substituierter älterer Menschen in Augsburg zu gewinnen, wurden zwei persönliche Interviews mit genau dieser Personengruppe geführt.
Auch für die Sucht- und Altenhilfe stellt das Altern der Klientel eine Mammutaufgabe dar. Daher müssen neue Wege der Zusammenarbeit und Angebotsentwicklung aller beteiligten Einrichtungen gefunden werden. Ebenfalls spielt die Politik hierbei keine unwesentliche Rolle. Auch sie muss durch entsprechende gesetzliche Neuregelungen die Grundlage für eine solche Angebotsentwicklung schaffen. In dieser Arbeit sollte daher auch eine Fachkraft aus professioneller Sicht die Substitutionsbehandlung beleuchten und dazu Stellung nehmen. Hier schien ein Substitutionsarzt als Experte am geeignetsten. Ebenfalls wird das Bild der Gesellschaft auf substituierte, also opiatabhängige, Menschen diskutiert und der nötige Handlungsbedarf aufgezeigt.
Dies sind Fragen und Anliegen, denen die Verfasserin dieser Arbeit nachgegangen ist, vor allem, da diese Thematik bislang von der Forschung im deutschsprachigen weitestgehend vernachlässigt wurde.
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Interviewleitfaden
Anhang 2: Einwilligungserklärung zum Interview
Anhang 3: Transkriptionsregeln
Anhang 4: Kategoriensystem mit Ankerbeispielen
Anhang 5: I2 Interviewprotokollbogen
Anhang 6: I2 Volltranskript
Anhang 7: I2 Case Summary
Anhang 8: I2 kat. Auswertung entlang der Hauptthemen
Anhang 9: I3 Interviewprotokoll
Anhang 10: I3 Volltranskript
Anhang 11: I3 Case Summary
Anhang 12: I3 kat. Auswertung entlang der Hauptthemen
Anhang 13: Dr.S Interviewprotokoll
Anhang 14: Dr.S Volltranskript
Anhang 15: Dr.S Case Summary
Anhang 16: Dr.S kat. Auswertung entlang der Hauptthemen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gemeldete Substitutionspatienten in D,
Abbildung 2: Trias-Modell der Sucht
Abbildung 3: Heroin-Flacon
Abbildung 4: Rechtliche Grundlagen der Substitution
Abbildung 5: Dosierautomat
Abbildung 6: Behandlungspasen Substitution
Abbildung 7: Gegenüberstellung der Interviewtypen
Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden
Abbildung 9: Tabelle Soziodemografische Daten
Abkürzungsverzeichnis
BÄK Bundesärztekammer
BSG Bundessozialgericht
BtMG Betäubungsmittelgesetz
BtMVV Betäubungsmittelverschreibungsverordnung
DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
PSB Psychosoziale Betreuung
RMvV Richtline Methoden vertragsärztlicher Versorgung
WHO World Health Organization
1 Einleitung
Bereits seit den 1980er und 1990er Jahren weisen BevölkerungsforscherInnen, SozialwissenschaftlerInnen und RentenexpertInnen auf den demografischen Wandel in Deutschland hin. Der demografische Wandel zeichnet sich dabei aufgrund von drei Faktoren ab:
- dem Geburtenrückgang aufgrund der Veränderung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen;
- der gestiegenen Lebenserwartung der Menschen aufgrund der Fortschritte der Medizin, die eine Alterung der Gesellschaft zur Folge hat;
- und der Multiethnizität. (Vgl. Vogt 2011: 9ff.; Niekrens 2012: 9f.).
Heutzutage ist der kontinuierliche Anstieg der Lebenserwartung Gegenstand allgemeiner öffentlicher Diskussionen. Immer wieder werfen sich die Fragen auf, wie ein würdevoller Umgang mit alten und älteren Menschen in unserer Gesellschaft gelingt und welche speziellen Bedürfnisse diese RentnerInnengeneration hat. Viele ältere und alte Menschen leiden neben gesundheitlichen Einschränkungen an multiplen Problemlagen wie der materiellen Armut (Stichwort: Altersarmut) und sozialer Isolation (Vgl. Wolter 2011: 191ff.). Bezüglich des Gesundheitszustandes werden in dieser Arbeit SeniorInnen jedoch nicht nur als eine Gruppe von älteren Menschen, die an einer Reihe von eher typischen Alterserkrankungen wie Arthrose, Demenz vom Alzheimer-Typ oder Bluthochdruck leiden, gesehen (Vgl. Backes/Clemens 2008: 109ff.). Der Blick soll vielmehr auf eine Personengruppe gelenkt werden, die neben den altersbedingten Krankheiten auch unter einer Suchtkrankheit leiden. Dabei beschäftigt sich diese Arbeit gezielt mit älteren substituierten Menschen, die nach jahrelangem Drogenkonsum nun ihr Leben mit Unterstützung von Substituten meistern.
Suchtkranke Menschen haben es generell schwerer, soziale Kontakte zu pflegen und von den Angeboten am Wohnort zu profitieren. Sie sind stärker auf sich allein gestellt und leben oft auch isoliert. Der Alltag mit der Sucht bringt verschiedene Verunsicherungen und viele Zusatzaufgaben mit sich. Gerade diese Menschen sind jedoch umso mehr auf Kontakte, auf Unterstützung und auf ein ihnen entgegengebrachtes Zugehörigkeitsgefühl angewiesen.
Die ausführliche Auseinandersetzung mit langzeitsubstituierten älteren Menschen kann das Potenzial bieten, sie mit der Gesellschaft zu vernetzen, den Erfahrungsaustausch anzuregen und ihr Kompetenzgefühl zu stärken. Dies ist der Ausgangspunkt für die vorliegende Bachelorarbeit. Es geht darum, Möglichkeiten zur sozialen Unterstützung seitens der Sozialen Arbeit und der Gesellschaft im Allgemeinen auszuloten, um diesem Klientel ein würdevolles Dasein im Alter ermöglichen zu können.
Über die Lebenssituation und die Gesundheitsprobleme älterer Menschen, die illegale und legale Drogen konsumieren und von diesen abhängig sind, gibt es nur wenige empirische Daten. Es gibt lediglich einige Studien und Untersuchungen zum Alkohol- und Medikamentenkonsum im Alter, wie unter anderem die von Fleischmann (1998) und Supp (2008). Es stellen sich daher die Fragen: Welche speziellen Bedürfnisse haben diese Menschen? Wie könnte eine Lösung der Unterbringung von substituierten Menschen im Alter in Augsburg aussehen? Wie kann die Soziale Arbeit positiv darauf Einfluss nehmen?
Auf das „Late Onset“ Phänomen sowie die Substitution mit Diamorphin soll in dieser Arbeit nicht eingegangen werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.1
1.1 Problemskizzierung und Zielsetzung dieser Arbeit
Schneider (2000) betonte schon immer, dass DrogenkonsumentInnen, die Opiate in ihrer Reinform zu sich nehmen, die gleiche Lebenserwartung haben, wie Menschen, die diese nicht konsumieren. Doch die meisten Menschen dieser Personengruppe mussten aufgrund der enormen Kriminalisierung durch den Staat sowie der damals als selbstverständlich geltenden abstinenzorientieren Drogenhilfe auf gewöhnliches Straßenheroin, das „meistens mit problematischen Substanzen gestreckt ist“ (Ders. 2013: 97) zurückgreifen. Dieser repressive Ansatz war viele Jahre vorherrschend (Vgl. Bossong/Stöver 1992: 17f.). Durch sogenannte Harm Reduction Angebote, die weitestgehend eben nicht diese Abstinenzorientierung zum Ziel haben, kann es süchtigen Menschen in der heutigen Zeit ermöglicht werden, „ein legales und zugleich weniger gesundheitsgefährdendes Leben zu führen“ (ebenda: 26). Daher ist die Substitutionsbehandlung für einen Großteil der opiatabhängigen Männer und Frauen eine Alternative. Viele, vor allem ältere Substituierte, bleiben meist ein Leben lang im Substitutionsprogramm. Aber werden denn wirklich so viele Drogenabhängige durch dieses Harm Reduction Angebot erreicht? Wie in der Tabelle zu sehen ist, gab es 2014 77.500 gemeldete SubstitutionspatientInnen in Deutschland. Man geht davon aus, dass von diesen 77.500 SubstitutionspatientInnen etwa 3% bis 20% über 50 Jahre alt sind. Jedoch lässt sich dies nicht pauschalisieren. Es gibt Einrichtungen, in denen der Anteil der über 40-Jährigen bereits 60 % beträgt (Vgl. Westermann/Witzerstorfer 2011: 211).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Gemeldete Substitutionspatienten in D,
Quelle: Drogenbeauftragte(r) der Bundesregierung 2015
Insgesamt zeichnet sich der Trend ab, dass die Zahl der substituierten Menschen steigen wird. Durch die Substitution können die Menschen älter werden bzw. nahezu ein normales Lebens führen. Das heißt: wenn die Zahl der SubstitutionspatientInnen steigt, müsste dann nicht auch die Zahl der Substitutionsärztinnen und –ärzte steigen? Wie läuft eine Substitutionsbehandlung in der Praxis überhaupt ab? Gibt es Einrichtungen, in denen die Personengruppe im Alter versorgt werden kann? Ist die Substitutionsmittelvergabe dort gewährleistet? Das sind Fragen, die sich in Anbetracht dieser Thematik stellen und im Laufe dieser Bachelorarbeit beantwortet werden sollen.
Ziel der nachfolgenden Arbeit ist es also, die Bedürfnisse der älteren langzeitsubstituierten Menschen in Augsburg in Erfahrung zu bringen. Hierzu wurden Interviews mit zwei älteren Langzeitsubstitutionspatienten sowie einem Substitutionsarzt durchgeführt und ausgewertet. Außerdem wurde während einer Substitutionsmittelvergabe hospitiert, um „näher am Gegenstand zu sein, mehr die Innenperspektive erheben zu können.“ (Mayring 2002: 80). Die Arbeit soll folglich aus dem Blickwinkel der Substituierten sowie aus professioneller Sicht die Problem- und Versorgungslage in Augsburg wiederspiegeln und Änderungsmöglichkeiten aufzeigen. Abschließende Intention ist es, mögliche Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse der KlientInnenngruppe herauszuarbeiten, die der öffentlichen Wahrnehmung und Verdeutlichung der Dringlichkeit dieser Thematik dienen soll.
1.2 Gliederung und Vorgehensweise der Arbeit
Diese Arbeit beginnt mit einigen theoretischen Fakten zum Krankheitsbild Sucht. Hier wird auf das von der WHO geprägte Suchtverständnis sowie im Gegenteil dazu auf das ganzheitliche Trias-Modell der Sucht eingegangen.
Als nächstes folgt das dritte Kapitel Morphinismus, Heroinismus. Der Blick soll zunächst auf die Geschichte des Heroins gelenkt werden, da das heutzutage sehr von Vorurteilen behaftete Bild der Gesellschaft auf drogenabhängige Menschen dort seinen Ursprung findet. Daraufhin werden das Risiko, eine Heroinabhängigkeit zu entwickeln, und die „typischen“ Abhängigkeitskarrieren erläutert. Anschließend sollen Möglichkeiten des Ausstiegs, im Sinne einer abstinenzorientierten und einer akzeptierenden Drogenhilfe, hervorgehoben werden. Danach steht die Substitutionsbehandlung mit allen für die vorliegende Arbeit relevanten Facetten im Fokus. Hauptsächlich soll es hier um die rechtlichen Voraussetzungen und die eigentliche Praxis der Substitution gehen.
Nach einer vertieften Auseinandersetzung mit der Problem- und Versorgungslage der älteren Substituierten beginnt im 6. Kapitel der empirische Teil dieser Arbeit. Hier werden das Forschungsdesign sowie die Datenerhebung und -auswertung aufgezeigt. Es folgen die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse aus den geführten Interviews sowie die Schlussbetrachtung, die diese Arbeit abrunden und auf weitere Gedanken, die während der Bearbeitung der vorliegenden Thematik entstanden sind, eingehen soll.
2 Sucht – Siech – Krank
Sucht leitet sich aus dem Volksmund stammenden Wort „Siech“ ab und bedeutet „Krank“ (Vgl. Kielholz/Ladewig 1973: 9). In der vorliegenden Arbeit soll Sucht durchgehend als eine Krankheit betrachtet werden. Das wird deshalb so betont, da Teile der Gesellschaft Sucht immer noch als Folge eines selbstverschuldeten Schicksals und Drogen als das Teufelszeug schlecht hin sehen. Auch Groenemeyer (2012) weist darauf hin, dass Drogen bzw. die Droge „eine negativ besetzte Metapher, die mit bestimmten Bildern und Stereotypen funktioniert“ (ebenda: 433) über Jahre und Jahrzehnte hinweg geworden ist. Süchtige Menschen haben sich diese Krankheit nicht ausgesucht. Selbst das Bundessozialgericht hat 1968 entschieden, Sucht als eine Krankheit anzuerkennen (Vgl. BSG 1968). Die Suchtkrankheit ist also gleichgestellt mit anderen Krankheiten zu betrachten.
Wolter (2011) folgend wird das Verständnis von Sucht von zwei Seiten betrachtet:
1. Sucht als eigenständige Erkrankung
2. Und Sucht als Symptom einer psychischen Störung, deren Entstehung durch bestimmte Risiko- und Schutzfaktoren begünstigt oder vermindert werden kann.
Die World Health Organisation, also das WHO Expert Committee on Addiction-Producing Drugs, hat 1957 Sucht als einen Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung beschrieben, der durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge hervorgerufen wird. 1964 wurde die Definition erweitert und „Sucht“ wird seitdem mit den Begriffen „Missbrauch“ und „Abhängigkeit“ ersetzt. Die Kriterien der Abhängigkeit wurden von der WHO veröffentlicht und werden gemäß ICD 10 sowie weitestgehend ähnlich in den DSM-IV geregelt (1. entsprechend). Um als „abhängig“ zu gelten, müssen für die Dauer von einem Jahr mindestens drei der folgenden sechs Kriterien erfüllt sein:
- Reduzierte bis aufgehobene Kontrolle über Beginn, Umfang und Beenden des Substanzkonsums;
- Toleranzsteigerung2 ;
- Unwiderstehlicher Zwang, die Substanz zu konsumieren;
- Auftreten von Entzugserscheinungen bei Beendigung der Einnahme;
- Fortsetzen der Einnahme trotz Folgeschäden;
- Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten der Substanzbeschaffung und des Konsums (Vgl. Gaßmann/Behrendt 2015: 17).
Zu unterscheiden ist außerdem sowohl eine psychische, als auch eine körperliche, physische Abhängigkeit. Bei der psychischen Abhängigkeit überwiegt das unwiderstehliche Verlangen zum Konsum des Mittels, das nicht mehr willentlich steuerbar ist. Suchtdruck („Craving“) ist die Folge. Das ganze Leben des süchtigen Menschen dreht sich um die Beschaffung und den Konsum der Substanz. Die körperliche Abhängigkeit zeigt sich in der Abhängigkeit von den Wirkungen des Mittels. Erst beim Absetzen oder bei nicht rechtzeitiger Einnahme der Substanz wird die körperliche Abhängigkeit durch erkältungsähnliche Symptome wie Muskelzittern, Schweißausbrüche oder ähnliche Erscheinungen erkennbar (Vgl. Kielholz/Ladewig 1973: 10; Beise/Heimes/Schwarz 2009: 333f.). Zudem kommt es bei einem Entzug zu psychischen Entzugserscheinungen wie Unruhe, Depression und Angstzuständen. Eine psychische Abhängigkeit ist meist langwieriger und schwerer zu überwinden als eine körperliche. Am Schlimmsten ist der sogenannte „kalte Entzug“, den viele Drogenabhängige beispielsweise durch eine Inhaftierung erleiden müssen. Man spricht hier im Rahmen eines Heroinentzuges auch von einem „cold turkey“ oder einem „Affen“ (Vgl. Schneider 2013: 99).
Schneider (2013) gibt in seinem Buch eine Faustregel vor, an der man eine Abhängigkeit, ähnlich der Erkennungsmerkmale des ICD 10/ DSM-IV, erkennen kann:
„Abhängig von psychotropen Substanzen ist jeder, der auf den Konsum der Substanz angewiesen ist, um das Auftreten unangenehmer Zustände körperlicher oder seelischer Art zu verhindern, oder der wiederholt so viel zu sich nimmt, dass er sich selbst und anderen Schaden zufügt, ohne daran etwas zu ändern.“ (Schneider 2013: 188)
Doch diese Erklärung würde Sucht nicht ganzheitlich genug betrachten und individuelle Faktoren außen vor lassen. Ein Abhängigkeitssyndrom kann nicht valide und reliabel anhand dieser Kriterien diagnostiziert werden, da einerseits diese Indikatoren eher Zuschreibungen darstellen, welche das gesellschaftlich mitdefinierte Konsumverhalten klassifizieren. Zum anderen trifft auch nicht jedes abhängige Konsumverhalten und nicht jede psychotrope Substanz auf die Indikatoren zu (Vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007: 7ff.). Die Definition der WHO ist eher als ein eindimensionaler, pharmakologischer Ansatz zu betrachten.
Deshalb soll nun auf ein breiteres, ganzheitliches Verständnis von Sucht eingegangen werden. Es haben sich viele Disziplinen mit dem Thema Sucht und Suchtentstehung beschäftigt und mehr oder weniger schlüssige Erklärungen geliefert. Jedoch weist keine dieser Theorien zur Entstehung von Sucht die Ganzheitlichkeit auf, die jenem Phänomen gerecht wird. So soll in diesem Abschnitt das Trias- Modell der Sucht auch, bio-psycho-soziales Modell, beleuchtet werden. Vorab ist anzumerken, dass die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Abhängigkeit auf sehr komplexen Prozessen beruhen, die individuell sehr unterschiedlich sind. Ein heutzutage weitverbreiteter Erklärungsansatz ist eben, dass sich Sucht bzw. Abhängigkeit durch ein „Wechselspiel von substanzspezifischen, individuellen und sozialen Umweltfaktoren“ (Wolter 2011: 88) entwickeln kann. Diese Entwicklung wird dabei durch einen multifaktoriellen Ursachenkomplex, also durch das Zusammenspiel von den spezifischen Eigenschaften der Drogen, des Individuums sowie der Besonderheiten des sozialen Umfeldes, ausgelöst. Das haben u.a. die Suchtforscher Kielholz/Ladewig (1973) in ihrem Schema aufgezeigt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Trias-Modell der Sucht
Quelle: Eigendarstellung, angelehnt an Kielholz/Ladewig 1973: 24
Die drei Variablen in diesem Modell beeinflussen sich gegenseitig. Zu den Faktoren, die die Persönlichkeit mitprägen, gehören laut Kielholz/Ladewig (1973: 24ff.):
- die Charakterstrukturen der Person (ist die Person ängstlich, verschlossen etc.?);
- in gewisser Weise die Vererbung (Heredität): Die Ergebnisse von Studien haben ergeben, dass 60 % der Drogenabhängigen aus Familien stammen, die auch suchtbelastet waren. Hier ist aber anzumerken, dass es sich lediglich um eine Vulnerabilität hinsichtlich einer späteren potentiellen Abhängigkeit handelt (Vgl. Schneider 2013: 149);
- das frühkindliche Milieu, in dem die Drogenabhängigen aufgewachsen sind, war in 83 % geprägt von Trennungen und Scheidungen etc. (Broken-Home-Situationen). Ausschlaggebend für eine Entwicklung einer Drogenabhängigkeit kann auch durch Störungen in der Eltern-Kind-Bindung begründet sein.
- Außerdem wird die Persönlichkeit beeinflusst von der sexuellen Entwicklung, der aktuellen Stresssituation und der Erwartungshaltung.
Zu der zweiten Variable, die sich auf die Entstehung einer Abhängigkeit auswirken kann, die Droge, zählen zunächst die Art der Droge überhaupt, sowie „die Art der Applikation, die verwendete Dosis und die Zeitdauer der Einnahme“ (Kielholz/Ladewig 1973: 28), die wiederrum vom Umfeld und der persönlichen Erwartungshaltung mitbeeinflusst wird. Nach bestimmter Dauer der Einnahme von Drogen, tritt eine Gewöhnung an die entsprechende Dosis ein und die Toleranz muss für weitere berauschende Wirkungen erhöht werden. Des Weiteren spielt die individuelle Reaktion eine Rolle. (Wie wurde die Droge empfunden? Positiv, negativ?) (Vgl. ebd.: 24). Die dritte Ursache, die die Entstehung von Drogenabhängigkeit beeinflussen kann, ist das soziale Milieu. Dazu gehören die familiäre Situation, der Beruf, die aktuelle Wirtschaftslage, der soziale Status, die aktuelle Gesetzgebung, die Religion, die Einstellung des sozialen Umfeldes zum Drogenkonsum im Allgemeinen, Werbe- und Modeeinflüsse sowie Konsumsitten (Vgl. ebd.).
Es gibt laut diesem Modell eben nicht die eine Ursache von Sucht, sondern sie ergibt sich aus dem Zusammenspiel verschiedenster Faktoren. Ebenso ist zu betonen, dass diese Faktoren Risikofaktoren darstellen, die eine Suchtentstehung begünstigen. Es kann also nicht daraus geschlossen werden, dass aufgrund des Vorhandenseins mehrerer der genannten Faktoren eine Drogenabhängigkeit die sichere Folge ist. Auf weitere Theorien kann in der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden. Vertiefende Literatur dazu bieten Schneider (2013) und Wolter (2011).
3 Morphinismus, Heroinismus
Al erstes soll auf die Geschichte des Heroins eingegangen werden, um zu erfahren, wie sich dieses Wundermittel zu einer der härtesten Drogen auf dem Markt entwickeln konnte. Dadurch kann beleuchtet werden, warum die gegenwärtige Haltung der Gesellschaft gegenüber (Heroin-) Süchtigen so stark von Vorurteilen geprägt ist. Darauffolgend soll das Risiko opiatmittelabhängig zu werden, typische Abhängigkeits- und Belastungskarrieren sowie Ausstiegsmöglichkeiten aus der Heroinsucht aufgezeigt werden.
3.1 Geschichtlicher Abriss
Bei Heroin handelt es sich um ein halbsynthetisches Produkt aus dem Extrakt von Rohopium, dem Milchsaft des Schlafmohns. Opium, Morphium, Heroin und Kodein gehören zur Gruppe der Opiate. Alle Opium-Alkaloide und alle weiteren Stoffe, die Antagonisten derselben Rezeptoren im Gehirn sind, werden unter dem Begriff Opiate oder Opioide zusammengefasst. Zu unterscheiden sind neben den natürlichen Opiaten, halbsynthetische Opiate wie Heroin und vollsynthetische Opiate wie Methadon, sowie einige weitere Substanzen unterschiedlicher chemischer Struktur (Vgl. Schneider 2013: 96). Untereinander unterscheiden sich diese Opiate nur in der Wirkungsdauer, Verweildauer im Körper und Verfügbarkeit bei der oralen Aufnahme (Vgl. Bossong 1992: 22).
Um eine angemessene Beschreibung der Entwicklung des Heroins vom gesellschaftlich hochgepriesenen Medikament zum, vom Großteil der Bevölkerung abgestempelten Teufelszeug nachvollziehen zu können, muss bei der Entdeckung eines anderen Opiats, dem Morphin, begonnen werden. Der folgende geschichtliche Abriss bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum.
Nach der Entdeckung des Morphins (1806) wurde es 1828 als stark wirkendes Schmerzmittel auf den Markt gebracht und löste daraufhin regelrechte Morphinsuchtwellen aus. Hauptsächlich wurde es Soldaten zur Ruhestellung und Schmerzlinderung im Krieg, z.B. im deutsch-französischen Krieg (1871-1872) verabreicht (Vgl. Ridder 2000: 23f.). Doch wie war es möglich, den nun morphinabhängigen Teilen der Bevölkerung aus der Sucht zu helfen? Damals hatte man den Gedanken, dass die Morphinsucht, durch die Einnahme von Heroin „geheilt“ werden konnte, da davon ausgegangen wurde, dass Heroin zwar auch schmerzstillend ist, aber eben keine Abhängigkeit hervorruft. Somit wurde Heroin ab 1898 von Friedrich Bayer & Co. als ein wirksames Medikament gegen die verschiedensten Krankheiten, v.a. bei Atemwegserkrankungen und zur Bekämpfung der Morphinabhängigkeit, eingesetzt (Vgl. ebenda: passim; DHS 2015). Heroin wurde damals zunächst in Pulver form (Heroinum Purum) und danach auch als salzsaures Salz (Heroinum hydrochloricum) angeboten. Ab 1921 verschrieben Ärztinnen und Ärzte Heroin auch in Tablettenform, wie auf der Abbildung 3 zu erkennen ist. 1931 stellte Bayer die Produktion ein (Vgl. Ridder 2000: 67 ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Heroin-Flacon
Quelle: Hogshire 2009: 174f.
In der Bundesrepublik wurde die Abgabe und Verschreibung von Heroin 1971 verboten, als allmählich klar wurde, dass immer mehr Menschen das Opiat missbräuchlich verwendeten und oftmals eine Sucht entwickelten (Vgl. ebenda: 185). Das Verbot der Substanz war die Geburt des illegalen Handels und des erneuten rasanten Anstiegs der Heroinabhängigen. Die Zahl der Heroinabhängigen stieg zu Beginn der 70er Jahre auf bis zu 40.000. Nun musste seitens der Politik eingeschritten werden: aufgrund der erfolgsversprechenden Einsätze von Methadon in der Behandlung von Heroinabhängigen in den USA und Schweden, wurde daraufhin 1973 bis 1975 das erste Mal auch in Deutschland ein Modellprojekt in Hannover gestartet. Doch die Ergebnisse dieses Versuches waren damals laut den ForscherInnen der Beweis dafür, dass abstinenzorientierte Therapien immer noch der methadongestützten Therapie vorzuziehen sind, da die ProbandInnen im hannoverschen Modellprojekt nach kurzer Zeit wieder rückfällig wurden. Diese Haltung wurde über viele Jahre hinweg von der Regierung vertreten. Die Drogenpolitik war anfangs der Meinung, dass durch eine Zuordnung der Substitution zur Schadensminimierung (Harm Reduction) die Gefahr der Verharmlosung des Heroingebrauchs sowie eine Zunahme von NeueinsteigerInnen und längere Abhängigkeitskarrieren die Folge wären (Vgl. Gerlach 2004: 13).
Erst Mitte der 80er Jahre, als sich u.a. immer mehr Heroinabhängige durch das sogenannte Needle Sharing mit Krankheiten wie HIV und Hepatitis infizierten, rief die Regierung erneut Modellprojekte für den Einsatz von Methadonprogrammen ins Leben, die dann letzten Endes den erwünschten Erfolg bestätigten. 1992 wurde daraufhin das BtMG reformiert und die Substitutionstherapie als Harm Reduction Maßnahme eingeführt (Vgl. ebenda: 13f.). Heftige politische Debatten gab es außerdem einige Jahre später über die ärztlich kontrollierte Verschreibung von Heroin (Diamorphin) an schwerstabhängige Heroinkranke. Nach den positiven Resultaten aus Modellprojekten, wird die „diamorphingestützte[.] Behandlung [derzeit] in den Diamorphinambulanzen in Hamburg, Frankfurt, Köln, Bonn, Karlsruhe und München angeboten.“ (Bundesministerium für Gesundheit 2016). Wie in der Einleitung bereits erwähnt, wird auf diese Thema nicht weiter eingegangen.
Warum wird in dieser Arbeit überhaupt der geschichtliche Abriss thematisiert? Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat zwar zu einer akzeptierenderen Haltung seitens der Politik beigetragen, aber die teilweise jahrelangen Debatten über das Verbot von Heroin und über eine methadon- bzw. diamorphingestützte Behandlung von Heroinabhängigen hat dazu beigetragen, dass die KonsumentInnen heutzutage leider immer noch stigmatisiert und aufgrund der Abhängigkeit ausgegrenzt und diskriminiert werden. Hier besteht also weiterhin Handlungsbedarf.
Im nächsten Gliederungspunkt geht es um Fragen wie: ist das Risiko so hoch nach einem Heroinkonsum eine Abhängigkeit zu entwickeln? Und sind dann alle HeroinkonsumentInnen „Junkies“?
3.2 Abhängigkeitsrisiko und Abhängigkeitskarriere
Das Opiat Heroin ist im Hinblick auf das Abhängigkeitspotential, das physische und psychische Funktionen beeinträchtigt, eine der gefährlichsten bzw. suchtpotentesten Drogen. Schneider (2013) gibt an, „dass bereits 7 bis 10 Einzeldosen ausreichen können, um den Konsumenten süchtig werden zu lassen.“ (ebenda: 96). Die Heroinabhängigkeit kann viele negative Folgen nach sich ziehen: Die Personen leiden unter dem Druck der Beschaffungskriminalität, sozialer Verelendung, konsumieren zusätzliche Drogen, Alkohol und Medikamente und leiden unter Mangel- und Fehlernährung sowie unter einer Verschlechterung des Allgemeinzustands (Vgl. Kielholz/Ladewig 1973: 38ff.). Diese Folgen kann ein Heroinkonsum nach sich ziehen, muss er aber nicht. Dieses Bild vom auf der Straße herumlungernden, ungepflegten und kriminellen Junkie hat ein großer Teil der Gesellschaft heutzutage im Kopf, wenn von Heroinabhängigen die Rede ist. Ridder (2000) geht in seinem Buch mehreren in der Gesellschaft verbreiteten Thesen bzw. auch Vorurteilen nach und entkräftet diese. Seiner Ansicht nach hat ein großer Teil der Gesellschaft bei „der Heroinkonsumentin“ oder „dem Heroinkonsumenten“ bestimmte Stereotype im Kopf, die lediglich dazu „dienen der Plausibilisierung der Abgrenzung der Mehrheit der Gesellschaft von einer als bedrohlich erlebten Minderheit, beziehungsweise dazu, die Identität der Mehrheit, wie fragwürdig und brüchig sie auch immer sein mag, zu stützen.“ (Ebenda: 166)
Im Allgemeinen wirken Drogen bei den KonsumentInnen meist grundzustandsabhängig. Das heißt, dass die Wirkung der Substanz meist von der derzeitigen physischen und psychischen Ausgangssituation abhängt. Nach den Aussagen von HeroinkonsuemntInnen wirkt Heroin beruhigend, entspannend, schmerzlösend, bewusstseinsmindernd und gleichzeitig stark euphorisierend (Vgl. DHS 2015). Heroin kann, wie bereits erwähnt, nach kurzzeitigem regelmäßigem Konsum psychisch und physisch abhängig machen. Hinzu kommt die schnelle Toleranzbildung. Daraus folgt, dass der Körper die Substanz immer in kürzeren Abständen und höherer Dosis benötigt, um den Entzugserscheinungen entgegenwirken zu können (Vgl. Kielholz/Ladewig 1973: 38f.). Nach der ersten Einnahme von Heroin überkommt den User zunächst ein starkes Euphoriegefühl, das sogenannte Flash-Erlebnis, das am stärksten durch den intravenösen Konsum erreicht werden kann (Schneider 2013: 97).
Nun stellt sich die Frage, ob man überhaupt von idealtypischen Karrieren dieser Klientschaft sprechen kann. Die meisten „Karrieren“, wenn man das so nennen mag, beginnen, wie schon im zweiten Kapitel angedeutet, in der Jugend. Der Personenkreis, der bereits in dieser Lebensphase anfängt Heroin zu konsumieren, kommt laut Vogt (2011) meistens aus zerrütteten Familienverhältnissen. Nicht selten sind genau diese Kinder in Familien aufgewachsen, in denen Alkohol und Drogen konsumiert wurden. Teilweise auch schon in der Schwangerschaft, was natürlich beträchtliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes hat (Vgl. Vogt 2011: 17). Die Einnahme von psychotropen Substanzen und Alkohol in der Schwangerschaft bzw. als Elternteil lässt folglich auch darauf schließen, dass die Eltern-Kind-Bindung nicht sehr innig war. Hier ist die Studie von Baer/Corrado (1974) aufschlussreich: Die Familie sowie die herrschenden Familienverhältnisse von Süchtigen wurden mit denen der Nichtsüchtigen verglichen. Die Forschungsergebnisse haben zu Tage gebracht, dass der überwiegende Teil der Süchtigen eine Kindheit erlebten, die durch körperliche und psychische Gewalt gekennzeichnet war. Die Ursachen eine Sucht daraufhin zu entwickeln sind also oftmals vorhanden. Sollte sich dann also aufgrund des bio-psycho-sozialen Ursachenbündels eine Sucht in der Jugend entwickeln, wird nach Vogt (2011) die Schule vernachlässigt, Ausbildungen werden abgebrochen und oft endet der berufliche Werdegang in befristeten Zeitarbeitsverträgen oder in der Arbeitslosigkeit (Vgl. ebenda 19ff.). Aber die Tatsache, dass man in der Jugend mit Drogen experimentiert, hat nicht zur Folge, dass man auch eine ernsthafte Sucht entwickelt. In Anlehnung an Vogt (2011) kann man die Bevölkerung in unterschiedliche Gruppen einteilen:
- Die, die aus der Sucht herauswachsen;
- Die, für die die Sucht zum Lebensthema wird;
- Die, die ein festes Konsummuster entwickeln, das sie ein ganzes Leben beibehalten;
- Die, die erst im Alter (<50) in die Sucht hereinwachsen;
- Und die abstinent lebenden Menschen, also jene Menschen, die im Laufe des Lebens nie in Berührung mit psychoaktiven Substanzen kommen (Vgl. ebenda: 33ff.).
In der vorliegenden Arbeit geht es also um die Gruppe der Menschen, für die Sucht zum Lebensthema wird. Ob dieser Zeitpunkt während der Jugend oder doch erst im Erwachsenenalter stattfindet, ist in dieser Arbeit unerheblich. Fakt aber ist, dass sich die Dauer der Heroinabhängigkeit auf das Risiko auswirkt, ein Leben lang davon abhängig zu werden und damit die Sucht zu einem zentralen Lebensthema werden zu lassen (Vgl. Vogt 2011: 51). In dieser Personengruppe befinden sich auch die älteren langzeitsubstituierten Menschen, die meist eine lange Abhängigkeitskarriere hinter sich hatten, bevor sie sich für die Substitutionsbehandlung entschieden haben. Für die meisten, vor allem die älteren unter ihnen, stellt ein Leben ohne das Substitut keine Option mehr dar.
3.3 Wege aus oder mit der Heroinsucht
„Wege AUS der Heroinsucht“? Nicht zwingend ist hier ein abstinenzfreies Leben ohne jeglicher Art von Betäubungsmitteln gemeint. Außerdem ist festzuhalten, dass eine Suchterkrankung ein Leben lang eine Erkrankung darstellt, die bis dato nicht geheilt werden kann. Also sollte eine Heroinabstinenz erreicht werden, hat dies nicht zur Folge, dass man nicht mehr suchtkrank ist (Vgl. Schneider 2013: 270ff.).
Es geht also darum eine Lösung zu finden, ein Leben ohne die Beschaffung der illegalen Drogen tagtäglich fortführen zu müssen. Ein sicheres Leben, ohne die regelmäßige Angst vor Inhaftierung oder Überdosen. Wie die Sucht selbst, ist auch der Weg aus der Heroinsucht ein individueller Weg, den jede Konsumentin oder jeder Konsument für sich selbst entscheiden und gehen muss. Durch das Drogenhilfesystem wird ihnen lediglich eine helfende Hand geboten. Ergreifen müssen sie sie selbst. Auch Sickinger (1994) weist darauf hin, dass es keine allgemeine Theorie für den Ausstieg aus der Drogensucht gibt, da „die Vielzahl der subjektiven Ausstiegsbegründungen, die Verschiedenartigkeit der Ausstiegskontexte sowie Veränderungen der sozialen, ökonomischen und auch politischen Ausstiegsvoraussetzungen“ (ebd. 1994: 45) eine Verallgemeinerung, ein „Modell“, unmöglich machen. Jedoch ist der Weg aus der Sucht oftmals ein Prozess, der sich aus den Schritten „Wissen- Wollen- Können“ (Schneider 2013: 270) zusammensetzt. In der Literatur gibt es hierzu eine Vielzahl von Modellen über den Weg der Veränderung etc. (Vgl. ebenda: 271 ff.).
Bülow et al. (1991) beschreiben in ihrem Buch zwei Möglichkeiten: zum einen die psychotherapeutisch orientierte Drogentherapie mit dem Ziel der Abstinenz und zum anderen der sozialpädagogisch/sozialtherapeutisch ausgerichtete Ansatz der Drogentherapie, der vornehmlich „psychische Gesundung und Ordnung der Lebensverhältnisse“ (ebenda: 7 f.) zum Ziel hat.
Die abstinenzorientierte Therapie hat sich im Laufe der Zeit, aber auch durch die Anerkennung von Sucht als Krankheit durch die Gesetzgebung (1968) ergeben (Vgl. Krause 2012: 12). Daher galt: Eine Erkrankung muss behandelt oder gar geheilt werden. Somit wurden in Deutschland über viele Jahre hinweg Debatten über den Sinn und Zweck abstinenzorientierter und akzeptierender Drogenhilfe geführt. Vor allem Mitte der 80er Jahre war der Streit um die Behandlung von Heroinabhängigen mit Methadon voll im Gange (Vgl. Vogt 1993: 22ff.). Heutzutage wird der abstinenzorientierte Therapieansatz zwar noch praktiziert, jedoch haben sich für die KonsumentInnen auch Chancen ergeben, ein nicht völlig abstinentes Leben führen zu müssen.
Der sozialpädagogisch ausgerichtete Ansatz wird mit der Abgabe eines Substitutes beispielsweise Methadon kombiniert. Stöver (1995: 7) folgend, können sich PatientInnen mittels einer Substitutionsbehandlung „einen legalen Lebenszusammenhang“ schaffen und „die gesellschaftliche Reintegration“ meistern. Dieser Ansatz macht daher einen Weg aus der Heroinsucht möglich, jedoch nicht auch der Opiatabhängigkeit. Die Substitution stellt damit eine der Harm-Reduction Maßnahmen dar, die im nächsten Kapitel aufgezeigt werden soll.
4 Substitution
Nach nun 24 jähriger Substitutionsgeschichte in Deutschland wurden über 74.000 Opiatabhängige durch diese Harm Reduction Maßnahme erreicht, die HIV-Infektionen wurden vermindert, die Gesundheit des Klientel verbessert und der Anteil der älteren PatientInnen ist gewachsen bzw. wächst (Vgl. Meyer-Thompson 2012 passim.). Die Substitutionsbehandlung wird durch ein multiprofessionelles Team, bestehend aus der Ärztin oder dem Arzt, die oder der die Substitutionsbehandlung anbietet, der psychosozialen Betreuung sowie mitunter Apotheken und kooperierenden Einrichtungen, getragen (Vgl. Bühringer 1995: 14ff.).
Im Allgemeinen versteht man unter Substitution das Ersetzen einer bestimmten Sache durch eine andere. In der Substitutionstherapie von intravenös Drogen gebrauchenden Menschen bedeutet dies: Die PatientInnen erhalten unter ärztlicher Kontrolle ein Suchtstoff wirkungsäquivalentes Medikament, ein sogenanntes Substitutionsmittel, z. B. Methadon. Zu den heutzutage gebräuchlichsten Substitutionsmitteln gehören wie bereits erwähnt das Methadon sowie Levomethadon, Levacetylmethadol, Buprenorphin (inzwischen Verabreichung mit Naloxon, um intravenösen und nasalen Konsum einzudämmen) und Codein/Dihydrocodein (nur in Einzelfällen) (Vgl. BAS 2010: 42ff.). Generell besetzen die Substitutionsmittel die Opiatrezeptoren im Gehirn und stillen so den Hunger auf andere Opiate bzw. vermindern den Suchtdruck (Vgl. Vogt 1993: 11). Der Patient soll im optimalen Fall während der Substitution Abstand zur Szene gewinnen und sich physisch, psychisch wie auch sozial stabilisieren, um ein Leben ohne Drogen führen zu können. Im Grunde aber sind die Substitutionsprogramme nicht für abhängige Menschen, die komplett aus der Sucht aussteigen wollen, sondern vielmehr für „jene Süchtige, die dies- aus welchen Gründen auch immer- aktuell nicht, noch nicht oder nicht mehr wollen.“ (Bossong/Stöver 1992: 28). Selbst die DHS (2016) hat das Abstinenzziel nicht mehr an die erste Stelle einer Substitutionsbehandlung gestellt:
„Die Zielhierarchie einer Substitutionstherapie reicht von der Krisen- und Überlebenshilfe über die Erhaltung und Verbesserung der somatischen und psychischen Gesundheit, die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität sowie der sozialen/gesellschaftlichen Integration und die (Wieder-)Herstellung der Erwerbsfähigkeit bis zur Abstinenz auch vom Substitutionsmittel.“
Bossong/Stöver (1992) folgend lassen sich drei Gestaltungen von Substitutionsprogrammen unterscheiden:
- Kurzzeitprogramme, auch Detoxifikations- und Überbrückungsprogramme genannt;
- Mittelfristige Programme bzw. Maintenance-to-abstinence-programmes;
- Und die Langzeitprogramme, auch unter den Namen Maintenance- bzw. Erhaltungsprogramme oder Sonderprogramme geläufig. (Vgl. ebenda: 24ff.)
Heutzutage befinden sich viele substituierte Menschen in den Langzeitprogrammen. Auch das in der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) festgeschriebene Abstinenzparadigma (§ 5 Abs. 1, Nr. 1 BtMVV) ist veraltet und wird heute nicht mehr als zwingend notwendig betrachtet (Vgl. DHS 2016.
In den folgenden Gliederungspunkten soll auf für diese Arbeit wesentliche Bestandteile der Substitution eingegangen werden. Zunächst werden die rechtlichen Grundlagen der Substitutionsbehandlung beleuchtet. Danach soll ein Blick auf die Substitution in der alltäglichen Praxis geworfen werden.
4.1 Rechtliche Voraussetzungen
Bis zu Beginn der 80er Jahre war in Deutschland der Einsatz von Substitutionsmitteln bei Drogenabhängigen aufgrund der zunehmenden Verbreitung von AIDS unter injizierenden HeroinkonsumentInnen in Einzelfällen oder Notfällen genehmigt. 1992 wurde auch die Substitutionsbehandlung mittels Methadon erlaubt (Vgl. Bossong/Stöver 1992: 45f.; Wittchen et al. 2004: 81 ff.).
Die rechtlichen Voraussetzungen, unter denen ein Patient mit einem Substitut behandelt werden darf sind zu finden im Betäubungsmittelgesetz (BtMG), als Rechtsverordnung in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) und in den Behandlungsrichtlinien der Bundesärztekammer (BÄK-RL). Die substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung ist in den derzeit geltenden Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung (RMvV) geregelt (Vgl. Bossong/Stöver 1992: 43f.). Als oberste Priorität für das Verabreichen eines Substitutionsmittels steht, wie in Abbildung 4 zu erkennen ist, das BtMG. Dies bildet die Grundlage, um überhaupt Opiate ausgeben zu dürfen. Je mehr sich die Pyramide zuspitzt, desto spezieller werden die Vorschriften und Regelungen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Rechtliche Grundlagen der Substitution
Quelle: Eigendarstellung, angelehnt an Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 2013
Laut § 13 Absatz I des Betäubungsmittelgesetzes dürfen die „Betäubungsmittel [ ] nur von Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten und nur dann verschrieben oder im Rahmen einer ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Behandlung einschließlich der ärztlichen Behandlung einer Betäubungsmittelabhängigkeit verabreicht oder einem anderen zum unmittelbaren Verbrauch oder nach Absatz 1a Satz 1 überlassen werden, wenn ihre Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper begründet ist.“
Eine Substitutionsbehandlung ist daher laut Gesetz nicht begründet, wenn der beabsichtigte Zweck auf andere Weise erreicht werden kann.
Es gibt Voraussetzungen seitens der Bundesärztekammer (2010b: 2), die für eine Aufnahme in das Substitutionsprogramm vorliegen müssen bzw. sollen. Diese sind gesetzlich in der BtMVV verankert. Der Patient sollte
- mindestens 18 Jahre alt sein;
- seit mindestens zwei Jahren heroinabhängig (gemäß ICD 10) sein
- und eine „soziale Substitutionsfähigkeit“, wie es Bühringer (1995: 36) nennt, sollte vorhanden sein. (also fester Wohnsitz, gewisses Maß an Zuverlässigkeit bezüglich regelmäßigem Erscheinen etc.)
Aufgrund der deutschen Gesetze und Verordnungen stehen die deutschen Substitutionsärztinnen und Substitutionsärzte im europäischen Vergleich ganz oben in der Kriminaliltätsrangliste. Sie sind leider immer der Gefahr ausgesetzt sich durch mangelnde Dokumentation etc. selbst strafbar zu machen. (Vgl. Meyer-Thompson 2012 passim. ).Folglich stellt die Substitutionsbehandlung für viele Ärztinnen und Ärzte keine Option dar. Um als Ärztin oder Arzt überhaupt eine Substitutionsbehandlung anbieten zu können, muss seit Juli 2002 eine spezielle Qualifikation, die „suchtmedizinische Grundversorgung“, bei der entsprechenden Ärztekammer erworben werden (Vgl. § 5 Abs. 2 BtMVV). Inhalte dieser Zusatzausbildung sind laut der Bundesärztekammer (2010a) u.a. motivierende Gesprächsführung, illegale Drogen und Substitution (Vgl. ebenda: 11). Nach dem Bestehen der Prüfung und einer Antragsstellung bei der zuständigen Ärztekammer werden dem Arzt darauf die ersten 50 SubstitutionspatientInnen zugewiesen (Vgl. Anhang 14: 7-9).
Wie lassen sich diese Regelungen nun in der Praxis umsetzen?
4.2 Substitution in der Praxis
Wie läuft nun eine Substitutionsbehandlung ab? Durch die Hospitation bei Dr. S. konnten darauf Antworten direkt aus der Praxis gefunden werden.
Zunächst muss eine PatientInnenaufnahme erfolgen. Sobald eine Substitutionsbehandlung indiziert ist, kann die entsprechende Dosis für die Patientin oder den Patienten gefunden werden (Vgl. Bühringer 1995: 41ff.; BAS 2010: 49ff.). Daraufhin muss die Patientin oder der Patient zunächst täglich zur Substitutionsmittelausgabe erscheinen, und das Substitutionsmittel als „einmalige Tagesdosis verdünnt in Saft unter Aufsicht“ (ebenda: 44) einnehmen. Die Substitutionsmittel werden ausschließlich oral, in Tablettenform oder als Sirupgemisch, verabreicht und sind exakt dosiert (Vgl. Krause 2012: 19f.). Für die exakte Dosierung des Medikaments gibt es in manchen Substitutionsräumen spezielle Dosierautomaten, siehe Abbildung 4. Auch Dr. S. besitzt jeweils einen Dosierautomaten für Methadon und für Polamidon. Die PatientInnen kommen nacheinander in das Arztzimmer. Nach dem Erkundigen über den momentanen Gesundheitszustand, wird der Name in das Computersystem eingegeben und der Dosierautomat füllt die entsprechende Menge des Substitutionsmittels in einen Plastikbecher. Auf diese Weise kann die Ausgabe der exakten Substitutionsmittelmenge sowie deren Dokumentation gewährleistet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Dosierautomat
Quelle: CompWare Medical 2016
Ist der Zustand stabil, die soziale Substitutionsfähigkeit konstant und kein Rückfall oder Beigebauch, kann ein so genanntes Take-Home vereinbart werden. Gemäß § 4 Abs. 8 kann der Arzt einer Take-Home Verordnung zustimmen, „sobald der Verlauf der Behandlung dies zulässt, Risiken der Selbst- oder Fremdgefährdung soweit wie möglich ausgeschlossen sind sowie die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs nicht beeinträchtigt werden.“
Das Take-Home kann jederzeit seitens des Arztes durch Nichteinhalten der Abmachungen bzw. Rückfälle oder andauernden Beigebrauch versagt werden. Wenn eine Patientin oder ein Patient den Take-Home Status erworben hat, muss die- oder derjenige nur noch wöchentlich mit jeweils einer (der letzten von sieben Tagesdosen) Tagesdosis, die unter Sicht der Ärztin oder des Arztes eingenommen werden muss, zur Substitutionsmittelvergabe erscheinen. Hier wird der- oder demjenigen dann ein Rezept für die nächsten sieben Tagesdosen des Substitutionsmittels ausgehändigt (Vgl. § 5 Abs. 8 BtMVV). Bei Auslandsaufenthalten besteht die Möglichkeit, das Substitutionsmittel für 30 Tage pro Jahr verschrieben zu bekommen (Vgl. ebenda).
Während einer Substitutionsbehandlung werden regelmäßige Urinkontrollen sowie Kontrollen mittels einem Alkometer durchgeführt, um Beigebrauch und Rückfälle erkennen zu können und Gegenmaßnahmen, beispielsweise Ursachenforschung, Bearbeitung des Rückfalls mit Hilfe der psychosozialen Betreuung (PSB), einleiten zu können (Vgl. Bühringer 1995: 47f.). Im Verlauf der Substitutionsbehandlung treten bei vielen PatientInnen Rückfälle und Beigebrauchsproblematiken auf. Unter eine Rückfall im Rahmen einer Substitutionsbehandlung wird in der Praxis grundsätzlich ein erneuter Heroinkonsum verstanden, als Beigebrauch wird der Konsum anderer psychoaktiver Substanzen oder nicht verordneter Medikamente bezeichnet. (Vgl. ebenda). Rückfälle und Beikonsum werden vor allem von der PSB thematisiert. Findet regelmäßiger Beigebrauch oder Heroinkonsum statt, kann das ein Zeichen auf beispielsweise innerpersonelle Konflikte sein. Hier gilt es auf alle Fälle die Ursachen aufzuarbeiten und durch Rückfallprophylaxen vorzubeugen. Je nach Art der Ursache für Beigebrauch oder Rückfall können unterstützende Interventionen wie psychotherapeutische Hilfe erfolgen (Vgl. Bossong/Stöver 1992: 95ff.). Laut den Richtlinien zur Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger der Bundesärztekammer (2010b) muss die PSB während einer Substitutionsbehandlung ein wesentlicher Bestandteil sein. Zu den Aufgaben der PSB gehört also die Unterstützung der KlientInnen in der Sicherung des (möglichst gesunden) Überlebens generell, in der sozialen Rehabilitation und Integration, in der psychischen Stabilisierung und in der Selbstrealisierung und Autonomie (Vgl. Krause 2012: 27ff.). Im Großen und Ganzen soll die PSB also zur Verbesserung des Allgemeinzustandes der KlientInnen beitragen.
Die BAS (2010) hat ein Behandlungskonzept für die Substitutionsbehandlung veröffentlicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Behandlungsphasen Substitution
Quelle: BAS 2010: 54
Selbstverständlich gestalten sich diese Phasen individuell je nach PatientIn. Für die das interdisziplinäre Team bedeutet das, die Klientschaft in jeder Phase zu unterstützen und Hilfe zu leisten. In den Behandlungsphasen können immer wieder krisenhafte Situationen auftreten. Die PSB sollte daher präventiv gemeinsam mit den KlientInnen Lösungsstrategien entwickeln, damit im Falle eines Rückfalls oder Beigebrauchs entsprechend gehandelt werden kann. Jeder Rückfall oder Beigebrauch ist als Symptom der Suchterkrankung zu sehen. Jedoch kann das seitens der PSB auch als Möglichkeit gesehen werden, bestimmte Themen erneut zu bearbeiten und die aktuelle Situation der Klientin oder des Klientin vertiefter zu betrachten (Vgl. Krause 2012: 26ff.).
5 SubstitutionsseniorInnen
Um auf die Problem- und Versorgungslage älterer langzeitsubstituierter Menschen eingehen zu können, sollte zunächst der Begriff „Alter“ definiert werden. Wann gilt man als „alter Mensch“? In dieser Arbeit sind das chronologische Alter und das biologische Alter von Bedeutung. Unter dem chronologischen oder kalendarischem Alter wird die vergangene „Zeit von der Geburt bis zur gegenwärtigen Lebenszeit eines Menschen“ (Buchka/Leive 2012: 13) verstanden. Das biologische Alter hingegen „bezieht sich auf die körperlichen, seelischen und geistigen Lebenskräfte und Prozesse, die in den jeweiligen Lebensstadien normalerweise anzutreffen sind.“ (Ebenda: 14). Diese Unterscheidung wird vorgenommen, da viele ältere Substituierte meist ein höheres biologisches Alter aufweisen.
Das Älterwerden ist generell durch biologische, kognitive, soziale und emotionale Faktoren gekennzeichnet. Auch der finanzielle Faktor spielt mit zunehmenden Alter eine große Rolle. Ebenso ist es vielen älteren Menschen generell wichtig so lange wie möglich autonom und ohne die Inanspruchnahme fremder Hilfe leben zu können. (Vgl. Backes/Clemens 2008: 191ff.) Bei älteren SubstitutionspatientInnen zeigt sich dieser Drang so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu führen noch intensiver. Dadurch, dass viele bereits negative Erfahrungen mit dem Hilfesystem gemacht haben, ist es ihnen umso wichtiger, auf niemanden angewiesen zu sein und die Substitutionsbehandlung normal fortsetzen zu können (Vgl. Vogt 2011: 105f.).
Studien belegen, wie bereits oben erwähnt, dass ältere Langzeitsubstituierte generell schneller altern, „möglicherweise aufgrund von chronischer Aktivierung des Immunsystems“ (ebenda: 105). Oft leiden sie dann frühzeitig an chronischen Erkrankungen und Invalidität. Des Weiteren sind die sozialen Beziehungen meist auf wenige beschränkt und finanzielle Ressourcen sind nicht vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass die Lebenserwartung von drogenabhängigen Menschen um ca. 20 Jahre verkürzt ist. Es gibt verschiedene Erkrankungen, die im Alter bei Menschen, für die Sucht zum Lebensthema geworden ist, gehäuft auftauchen wie Lebererkrankungen, Nierenschädigungen oder Hypertonie. Vor allem durch den meist jahrelangen intravenösen Konsum können Abszesse, Thrombosen und Embolien die Folge sein. Des Weiteren ist die Zahl der HIV, Hepatitis B und C infizierten Menschen weitaus höher als in der Allgemeinbevölkerung. Darüber hinaus steigt im höheren Alter die Sturzgefahr, die bei SubstitutionspatientInnen noch höher ist, vor allem bei gleichzeitigem Beikonsum (Vgl. ebenda, Schneider 2013: 267). Zu den psychiatrischen Problemen, die häufig bei älteren Substituierten wahrgenommen werden, gehören unter anderem „affektive[.] Störungen wie Depressionen und Angsterkrankungen […] [sowie] Persönlichkeitsstörungen“ (Vogt 2011: 108). Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch einmal, dass bislang nur wenig gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Substitution im Alter, Beigebrauch und Rückfall sowie die daraus resultierenden psychischen und physischen Nebenwirkungen vorliegen.
Wie können alternde langzeitsubstituierte Menschen versorgt werden? Es stellt sich die Frage, wie die Personengruppe bei zunehmender Immobilität zur Substitutionsvergabe kommen kann. Laut Vogt (2011) wäre ein gemeinnütziger Fahrdienst denkbar. Dieser müsste jedoch finanziert werden oder durch ehrenamtliche HelferInnen getragen werden (ebenda: 112ff.). Die Sozialdienste, die die älteren Menschen daheim betreuen, haben in ihrer Ausbildung meist keine spezielle thematische Vertiefung hinsichtlich des Umgangs mit drogenabhängigen Menschen erhalten. Strittig ist auch, ob das Pflegepersonal gesetzlich befugt werden kann, das Substitutionsmittel auszugeben. Im Moment besteht in Bayern dazu keine Möglichkeit. Bereits mehrere Einrichtungen der sozialen Arbeit bieten substituierten Menschen betreute Wohngemeinschaften oder betreutes Einzelwohnen an (z.B. Condrobs, Caritas). Eine weitere Möglichkeit der Versorgung im Alter, die auch Vogt (2011) anspricht, ist das traditionelle Seniorenwohnheim. Es müsste aber als erstes abgeklärt werden, ob das Heim an einer Aufnahme eines substituierten Menschen interessiert ist, da dadurch weitere Anforderungen an das Heim die Folge wären. Viele Substituierte konsumieren auch psychotrope Substanzen, Medikamente und Alkohol während der Substitutionsbehandlung. Folglich müssten die Pflege- und Altersheime dazu bereit sein, eine akzeptierende Haltung gegenüber etwaigen Konsum einzunehmen.
In Norden Deutschlands wurde 2015 ein spezielles Seniorenwohnheim für Substituierte und DrogengebraucherInnen eröffnet. Bundesweit gibt es ein solches Projekt bislang nur einmal (Vgl. Sponholz 2015). Hier stellt sich die Frage, ob ein spezielles Heim auch in dem Interesse der SubstitutionssenorInnen liegt. In Augsburg gibt es zum Zeitpunkt des Verfassens der Bachelorarbeit keine speziellen Einrichtungen, ambulante Dienste oder Fahrdienste. Daher müssten in Augsburg Einrichtungen mit ärztlicher und pflegerischer Spezialisierung geschaffen werden. Außerdem müsste eine enge Vernetzung mit der Substitutionsbetreuung der Drogenhilfe stattfinden. Es müssten altersentsprechende ambulante und stationäre Hilfen und geeignete Wohnformen ins Leben gerufen werden. Dafür sind spezifische Fort- und Weiterbildungen, vor allem für Pflegekräfte von Nöten. Genau dieser Thematik widmet sich derzeit die Drogenhilfe Schwaben mit ihrem zweijährigem Modellprojekt „Netzwerk40+“ (Vgl. Amedovski: 32f.; Drogenhilfe Schwaben gGmbH 2015).
Wie Vogt (2011) in ihrem Buch des Öfteren erwähnt, gibt nahezu keine Untersuchungen älterer substituierter Menschen im Raum Deutschland. Deshalb soll nun der Empirieteil folgen und die Erkenntnisse diesbezüglich dargestellt und diskutiert werden.
6 Methodisches Vorgehen
Empirische Sozialforschung möchte bestimmte Ausschnitte der sozialen Wirklichkeit untersuchen. Anhand der getätigten Beobachtungen dieser sozialen Realitäten können daraufhin Rückschlüsse auf Theorien gezogen und Theorien können auch weiterentwickelt werden (Vgl. Gläser/Laudel 2010: 24). Hauptsächlich lassen sich zwei Forschungsstrategien unterscheiden: die quantitative und die qualitative Erklärungsstrategie. Das Forschungsinteresse gilt in dieser Arbeit unter anderem der Problem- und Versorgungslage älterer langzeitsubstituierter Menschen in Augsburg. Diese sozialen Sachverhalte können am besten durch Interviews dargestellt werden. Es wurde sich klar gegen die quantitative Sozialforschung entschieden, da beispielsweise eine Befragung mittels Fragebogen zu einer weitgehenden Standardisierung der Untersuchungssituation und einer Reduktion der sozialen Komplexität dieses komplexen Themas geführt hätte. Ebenfalls hätte ein Fragebogen kein sofortige Nachfragen bzw. Nachhacken möglich gemacht. Przyborski/Wohlrab-Sahr (2010) beschreiben qualitative Forschung als Feldforschung. Das heißt, es gilt sich Gedanken zu machen über Fragen wie „was und wer gehört zum Feld?“ und „Wie bekomme ich Zugang dazu?“.
In dieser Arbeit wurde, wie bereits erwähnt, gezielt die qualitative Sozialforschung gewählt. Es wurde sich für die qualitative Sozialforschung in Form der persönlichen Befragung von Experten entschieden, um Aspekte zu gewinnen, die durch eine quantitative Fragestellung nicht erfasst worden wären. Mayring nennt fünf Grundsätze qualitativen Vorgehens: „die Forderung stärkerer Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung der Deskription und der Interpretation der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schließlich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess.“ (Mayring 2002: 19)
Jedoch sind laut Mayring (2002) diese fünf Postulate zu abstrakt. Sie müssen daher auf 13 Säulen qualitativen Denkens erweitert werden, die die Grundlage für qualitatives Forschen bilden: Einzelfallbezogenheit, Offenheit, Methodenkontrolle, Vorverständnis, Introspektion, Forscher-Gegenstands-Interaktion, Ganzheit, Historizität, Problemorientierung, Argumentative Verallgemeinerung, Induktion, Regelbegriff und Quantifizierbarkeit (Vgl. Mayring 2002: 24ff.).
Zunächst wird das Erhebungsinstrument und der Interviewleitfaden vorgestellt. So dann wird auf die ausgewählten Experten eingegangen. Daraufhin folgt die Vorgehensweise der Datenerhebung sowie der Auswertung der Interviews. Zum Schluss werden die Forschungsergebnisse im siebten Kapitel vorgestellt.
6.1 Das Ergebungsinstrument
Durch Interaktion seitens des Interviewenden in Form von Nachfragen oder weiterführenden Fragen können in Interviews tiefere und zusätzliche Informationen gewonnen und Widersprüchlichkeiten unmittelbar wiederlegt oder aufgespürt werden. Das Interview bietet die Möglichkeit aussagekräftigere Antworten zu bekommen und das Expertenwissen voll auszuschöpfen. ExpertInnen können daher selbst als Wegweiser der Untersuchung angesehen werden. Sie wissen am besten, in welche Richtung erörtert werden muss, damit die Thematik umfassend geklärt wird. Deshalb hat sich die Verfasserin dieser Arbeit für ExpertInneninterviews, „eine anwendungsbezogene Variante von Leitfadeninterviews“ (Kruse/Schmieder 2014: 168) entschieden. Ziel dieser ExpertInneninterviews ist „die Rekonstruktion von besonderen Wissensbeständen bzw. von besonders exklusivem, detailliertem oder umfassendem Wissen über besondere Wissensbestände und Praktiken“ (Pfadenhauer 2009: 99).
Insgesamt wurden in dieser Arbeit im Zeitraum vom September 2015 bis Dezember 2015 drei Interviews geführt. Es wurde ein Leitfaden mit offenen Fragen erstellt, der der Interviewerin während dem Interview zur Verfügung stehen soll, damit das volle thematische Spektrum abgedeckt wird und keine brisanten Themen hinsichtlich der Forschungsfrage vergessen werden. Das hat aber nicht zur Folge, dass im Interview stur alle Fragen nach der Abfolge abgefragt werden müssen. Vielmehr dient der Leitfaden als Orientierung. Letztlich konnte die Interviewerin selbst entscheiden, welche Fragen sie in der konkreten Interviewsituation stellt (Vgl. Gläser/Laudel 2010: passim).
Ein Experteninterview stellt eine besondere Form eines Leitfadeninterviews dar. Unter dem Expertenwissen versteht man in der Sozialwissenschaft laut Bogner/Littig/Menz (2009) das Wissen der Interviewperson über spezielle soziale Wirklichkeiten und Sachverhalte. Die Interviewperson nimmt die Rolle der Expertin oder des Experten ein.
6.2 Aufbau und Inhalt des Interviewleitadens
Der Interviewleitfaden forderte ein bestimmtes Wissen des Forschers über aktuelle Sachverhalte und Rechtsprechungen und ist daher erst nach ausführlicher Beschäftigung mit der zentralen Thematik erstellt worden. Bei der Interviewleitfadenerstellung wurde sich an den Maximen von Helfferich (2011) orientiert: „So offen und flexibel - mit der Generierung monologischer Passagen – wie möglich, so strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresses notwendig“ (ebenda: 181). Der Leitfaden nutzt der Strukturierung des Interviews, so dass der Befragte selbst den Verlauf des Gespräches bestimmen kann. Des Weiteren erlangt die oder der Interviewende bei der Erstellung eines Leitfadens “die thematische Kompetenz, die ein ertragreiches Interview ermöglicht.“ (Meuser/Nagel 2009: 52). Er dient außerdem als Orientierungsrahmen bzw. Gedächtnisstütze sowie zur Unterstützung und Ausdifferenzierung von Erzählsequenzen des Interviewten. Zudem soll durch diese Vorgehensweise eine Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews gewährleistet werden (Vgl. ebenda).
Methodologisch wurde sich gegen ein offenes Leitfadeninterview entschieden, da „nicht die Biographie des jeweiligen Experten im Fokus [steht], sondern die auf einen bestimmten Funktionskontext bezogenen Strategien des Handelns und Kriterien des Entscheidens.“ (ebenda: 53). Es wurde ein Leitfaden für die Gespräche mit den älteren Substituierten sowie mit dem Substitutionsarzt ausgearbeitet (für Einzelheiten vgl. Anhang 1). Hier wurde lediglich der Leitfaden für die Interviews mit den Substituierten an das Interview mit Dr.S inhaltlich angepasst. Der Leitfaden umfasst die folgenden Fragekomplexe:
- Die aktuelle Lebenssituation der Interviewpartner (Wohnsituation,
- Lebens- und Drogenkonsumverlauf;
- Substitutionsbehandlung
- Kenntnisse über kommunale Angebote für ältere substituierte Frauen und Männer und subjektive Einschätzung dieser Angebote;
- Vorstellungen vom Leben im Alter und zur Pflege im Krankheitsfall;
- Sonstiges wie Wünsche für die Zukunft, weitere Anregungen.
Dieser Leitfaden soll von den Interviewer und Interviewerinnen so gehandhabt werden, dass sowohl Formulierung als auch Reihenfolge der Fragen dem Interviewverlauf angepasst werden (Vgl. Helfferich 2011; Littig 2009: 126f.).
6.3 Auswahl und Beschreibung der Experten
Wer ist ExpertIn? Nach der Meinung von Meuser/Nagel (2009) ist eine Expertin oder ein Experte „eine Person, […], [die] über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendig alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist.“ (ebenda: 37).
Die Voraussetzung, die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantworten zu können, ist, mit betroffenen Personen, also substituierten Menschen, aber auch mit Fachkräften, die mit genau dieser Klientel arbeiten, Interviews durchführen zu können. Aufgrund der Komplexität qualitativer Daten und des hohen Auswertungsaufwands sowie mit Blick auf den engen Rahmen einer BA-Thesis konnten nur eine begrenzte Anzahl an Interviews geführt und ausgewertet werden (s.o.).
Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, spielt die Individualität der Interviewperson in der qualitativen Forschung eine maßgebliche Rolle. Um eine Stichprobe bestimmen zu können, stehen mehrere Verfahren zur Verfügung. In dieser Arbeit wurden die Interviewpersonen anhand des „theoretical sampling“, auch induktiven Sampling genannt, ausgewählt (Vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010: 67ff.). Es ging also um die bewusste Fallauswahl und –Kontrastierung. Hierzu wurden sich im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Personen aus welchen Gründen für die Beantwortung der Fragestellung am geeignetsten wären.
Die Motivation zum Interview sowie Kontaktadressen wurden während der Praxistätigkeit der Verfasserin bei der Bewährungshilfe Augsburg erfragt. Hier konnten bereits gewisse Vorinformationen erworben werden. Die Interviewpartner stellten von vornherein verschiedene Typen dar. Wie auf Abbildung 7 zu erkennen ist, stellt I2 das Gegenteil des von der Gesellschaft erahnten Bildes eines ehemaligen Junkies dar. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass I3 dieses Klischee erfüllt. Diese Interviewpartner wurden ausgewählt, da sie sich in Dingen wie der Erwerbstätigkeit unterscheiden, jedoch auch in vielen Dingen sehr ähnlich sind. Des Weiteren haben sie beide ein ähnliche Alter und ähnliche Drogenkonsumverläufe hinter sich. Diese Kontrastierung der Interviewpartner soll wiederrum darstellen, dass es eben nicht „den Junkie“ oder „den Süchtigen“ gibt. Wie bereits in den Kapiteln zwei und drei beschrieben, entsteht Sucht aus einem Bündel an Ursachen. Durch diese Gegenüberstellung der beiden Interviewpartner sollte dieses ganzheitliche Modell der Sucht nochmal in Erinnerung gerufen werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Gegenüberstellung der Interviewtypen
Des Weiteren sollte anfangs ein Sozialarbeiter der Drogenhilfe Schwaben, der Initiator des Projektes Netzwerk40+ in Augsburg, befragt werden, doch aufgrund einer länger andauernden Erkrankung konnte leider kein Interview stattfinden. Deshalb fiel die Wahl auf Dr.S, einen Substitutionsarzt in Augsburg. Hier konnte durch sogenanntes Sampling durch einen Gatekeeper, in diesem Fall durch den Substitutionsarzt, weiterer Feldzugang möglich gemacht werden (Vgl. Helfferich 2011: 175). Die Hospitation bei einer Substitutionsmittelausgabe half, mit weiteren substituierten Menschen in Kontakt zu treten und somit tiefer in das Feld einzutauchen. Somit konnte die Verfasserin an den realen Situationen der Objekte oder Individuen teilhaben und sich an die Innenperspektive annähern sowie spezifische Inhalte erschließen, die von außen nicht zugänglich sind und Kontextwissen erfordern. Die Hospitation wurde hierbei lediglich zur eigenen Wissenserweiterung und nicht im Sinne einer Forschungsmethodik verwendet.
6.4 Datenerhebung
Pfadenhauer (2009) folgend, muss sich die Interviewerin oder der Interviewer selbst vor der Interviewdurchführung zunächst qualifizieren (Vgl. ebenda: 111). Damit ist gemeint, dass sich die oder der Interviewende „mit allen [ihr oder] ihm zur Verfügung stehenden Mitteln möglichst viel von jenem- relativ exklusivem- Sonderwissen aneignet, das der Experte in der Regel in einem langwierigen (sekundären) Sozialisationsprozess erworben hat.“ (ebenda)
Zur Wissenserweiterung wurde hauptsächlich Fachliteratur gelesen. Außerdem konnte die Verfasserin von Interview zu Interview mehr Wissen generieren, da jedes geführte Interview einen Zuwachs an Erfahrung und Wissen darstellte.
Nach der Erstellung des Interviewleitfadens, wurde zunächst zu I2 und I3 telefonisch Kontakt aufgenommen. Es wurde sich nochmal hinsichtlich der Teilnahmemotivation erkundigt und über Sinn und Zweck des Interviews aufgeklärt. Die Kontaktaufnahme zu ihnen bezüglich der Zeit- und Ortsabsprache erwies sich als problemlos. Dr.S wurde per Email angefragt. In der Email wurden Informationen zum Forschungsinteresse und Ziel der Arbeit weitergegeben. Interviewzeit und -ort wurden daraufhin telefonisch vereinbart.
Für die Teilnahme an den Interviews nannten die Befragten unterschiedliche Beweggründe. Einheitlich ging es darum, von ihrer generellen Lebenssituation zu berichten und als mittelbar Betroffene, Lösungen der Unterbringung substituierter Menschen im Alter zu finden. Weitere Aspekte waren die Aufklärung für andere Menschen über die Substitutionsbehandlung, sowie deren immensen Bürokratiegehalt (Vgl. Anhang 5, 9 und 13).
Bezüglich der Durchführung der Interviews erwies sich anfangs die Frage schwierig, wo das Interview stattfinden kann. Die Räumlichkeiten in der Bewährungshilfe Augsburg hätten auf die Interviewteilnehmer einschüchternd und hemmend wirken können (Zwangskontext). Daraufhin wurden die Interviewpartner gefragt, an welchem Ort sie sich am wohlsten fühlen. Dieser konnte dann zusätzlich als „Erkenntnismittel“ (Helfferich 2011: 177) genutzt werden. Gleichzeitig sollte es ein Ort sein, an dem das Interview ungestört geführt und eventuelle Hintergrundgeräusche soweit wie möglich vermieden bzw. minimiert werden konnten. Das Interview mit I2 fand bei dem Interviewpartner daheim statt. Während des Interviews waren die Freundin und deren Sohn auch in der Wohnung anwesend. Sie haben sich jedoch in separaten Zimmern aufgehalten. Bis auf eine einmalige Unterbrechung durch den Sohn, gab es keine weiteren Störungen. Das Interview mit I3 fand in einem Schrebergarten der Verfasserin dieser Arbeit statt. Der Vorschlag wurde ihm gemacht, nachdem der eigentlich geplante Interviewort nicht besucht werden konnte. Der Schrebergarten wurde gemeinsam aufgesucht. I3 fand diesen Ort sehr einladend, da er ungestört rauchen konnte und das Gespräch offen ohne fremde Zuhörer geführt werden konnte. Das dritte Interview, mit dem Substitutionsarzt, fand in der Arztpraxis statt. Auf eine einladende Sitzanordnung wurde generell vor Ort geachtet.
Die Interviews wurden mit einem Aufnahmegeräte aufgezeichnet. Aus forschungsethischen und datenschutzrechtlichen Gründen ist es wichtig, den Interviewten Anonymität zuzusichern und zu erklären, wie und wofür die Daten verwenden werden (Vgl. Helfferich 2011: 190ff.). Zu Beginn jedes Interviews wurde den Interviewten ein Einleitungstext, vorgelesen und vorgelegt, in dem sowohl einige Hinweise auf den Inhalt und die Beweggründe des Gesprächs mitgeteilt wurden, als auch die formalen Rahmenbedingungen. Dazu gehören Versicherungen der Interviewten hinsichtlich der Vertraulichkeit und der Wahrung der Anonymität im Umgang mit den Inhalten des Gesprächs. Mit einer Einwilligungserklärung bekräftigten die Interviewpartner ihre Bereitschaft, an dem Interview teilzunehmen. Ein Vordruck dieser Einwilligungserklärung befindet sich im Anhang 2.
Nach Abschluss des Gesprächs wurde ein Interviewprotokoll seitens der Interviewerin ausgefüllt, das Fragen über die im Interview erworbenen soziodemographischen Informationen sowie Ort, Zeit, Motivation zum Interview etc. beinhaltete (Vgl. Anhang 5, 9 und 13).
6.5 Datenauswertung
Die Tonbandaufnahmen wurden zunächst mittels dem F4-Transkriptionsprogramm verschriftlicht. Nach Przyborski/Wohlrab-Sahr (2010) ist die Transkription ein Verschriftlichen sozialen Phänomene: „Sie überführt die Dokumente der sozialen Welt in abdruckbare Text- und Bildsequenzen, auditive Wahrnehmungen in schriftliche Texte und bewegte Bilder in eine Abfolge von Standbildern.“ (ebenda: 161). Für die Transkription stehen verschiedene Formen zur Verfügung: Das Spektrum reicht dabei von sehr feinen und aufwendigen Formen, die sprachliche Feinheiten wie Auslassungen oder Betonungen im verschriftlichten Text darstellen bis zu recht groben Formen, welche die Inhalte zusammenfassen (Vgl. Mayring 2002: 89ff).In dieser Arbeit wurde eine vollständige Transkription der digitalen Aufnahme erstellt. Die Sprache wurde nicht geglättet und enthält daher dialektale Verfärbungen. Ebenso wurde der Satzbau direkt übernommen. Die wörtliche Transkription eignet sich, wenn die inhaltlich thematische Ebene im Vordergrund steht (Vgl. ebenda.). Redebegleitende und nichtsprachliche Äußerungen sind mit in die Transkription der Gespräche aufgenommen worden. Somit sind Füllwörter (mhm, ähm), hörbare Ausdrücke (lacht, schnauft etc.) und situationsgebundene Ereignisse (Handy klingelt, Sohn betritt das Wohnzimmer etc.) mit transkribiert worden. Zitate der Interviewpartner wurden, wie in den Transkriptionsregeln zu finden ist, als jene gekennzeichnet (Vgl. Anlage 3).Alle Merkmale und Daten, die Rückschlüsse auf die Probanden zulassen würden, wurden anonymisiert beziehungsweise pseudonymisiert (Vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 165).
Es stehen viele verschiedene Auswertungsmethoden in der qualitativen Sozialforschung zur Verfügung. Die Methode muss zur Forschungsfrage und zum Forschungsgegenstand passen (Vgl. Kuckartz 2010: 72-105). Eine sehr strukturierte Auswertungsmethode ist die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002). Die transkribierten Interviews werden dabei regelgeleitet und methodisch kontrolliert und Schritt für Schritt mithilfe von Kategorien bearbeitet sowie ausgewertet. Die Analyse und Interpretation der Interviews wird in einzelne Schritte zerlegt und folgt einem zuvor festgelegten Ablauf. Die ursprünglichen Texte, sprich hier die vorliegenden Interviewtranskripte, enthalten in der Regel viel mehr Informationen, als für die Beantwortung der Forschungsfrage notwendig sind (Vgl. Mayring 2002: 114 ff.). Die Informationsmenge muss folglich reduziert und für die weitere Analyse und Interpretation aufbereitet werden: Laut Gläser/Laudel (2010) muss der gesamte Text zunächst mithilfe des „Suchrasters“ bzw. des Kategoriensystems durchgearbeitet werden, um die relevanten Textstellen herausfiltern zu können. Die „Suchergebnisse“, also die herausgefilterten Textstellen, werden zusammengefasst und nach für die Auswertung relevanten Kriterien sortiert (ebenda: passim). Laut Mayring (2002) gibt es drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse:
- Die Zusammenfassung. Das Datenmaterial soll soweit reduziert werden, dass es „immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring 2002: 115);
- die Explikation. Zusätzliches Datenmaterial soll „zu einzelnen fraglichen Textstellen“ (ebenda) verwendet werden, um das Verständnis zu erweitern und diese Textstellen zu erklären;
- und die Strukturierung. Die Textstellen werden mit Codes versehen und daraufhin „herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet.“ (ebenda: 120).
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte bei der Auswertung von Interviews Schritt für Schritt näher dargestellt. Dabei orientiert sich das Vorgehen an Mayring (2002) sowie Kuckartz (2010).
Die Interviewdaten wurden nach dem transkribieren zunächst ausführlich gelesen. Gläser/Laudel (2010) verwenden den Begriff „Extraktion“ bzw. hier die Vorbereitung zur Extraktion. Gemeint ist damit, dass Informationen aus dem Interview genommen und themenbezogen ausgewertet werden (Vgl. ebd.: 199ff.). Da unterstützend mit MAXQDA 12 gearbeitet wurde, konnten auffällige Textstellen anhand erster Memos stichpunktartig festgehalten und erste Zusammenfassungen getätigt werden. MAXQDA ist eine Software für die qualitative Inhaltsanalyse und bietet „Unterstützung für die interkulturelle Auswertungsarbeit“ (Kuckartz 2010: 13). Von immenser Relevanz ist bei der Extraktion, dass die qualitativen Daten, „nach fachlichen Maßstäben angemessen und systematisch analysiert werden, damit die Fragestellungen der Evaluation effektiv beantwortet werden können.“ (Kuckartz et al. 2009: 66).
Daraufhin wurden Case Summarys, also eine erste Fallzusammenfassung eines Interviews, erstellt, um sich einen ersten Überblick über die Interviews zu verschaffen. Diese wurden paraphrasierend festgehalten und sind frei von etwaigen Interpretationen. Sie stellen ein stark komprimiertes erste Bild von der Interviewperson bzw. des Interviews dar (Vgl. Kuckartz et al. 2009: 70f.). Die Case Summarys befinden sich in den Anhängen 7, 11 und 15. Dadurch konnten die ersten Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich gemacht werden. Ebenso konnten fallübergreifende Themen identifiziert und mittels der Memo-Funktion festgehalten werden.
Das Kategoriensystem kann man, wie bereits in 6.4 erwähnt, als „Suchraster“ bezeichnen, mit dem die Textstellen einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden. Da u.a. mit MAXQDA 12 gearbeitet wurde, würde man hier von einem Codebaum sprechen. Normalerweise besteht ein Kategoriensystem bzw. ein Codebaum aus Hauptkategorien und Unterkategorien bzw. werden diese in MAXQDA 12 Codes und Subcodes genannt, wobei nicht jede Hauptkategorie zwangsläufig auch Unterkategorien aufweisen muss. Die Hauptkategorien stellen ein zentrales Thema dar, das für die Auswertung und Interpretation der Interviews wesentlich ist. Die Unterkategorien beschreiben demnach Teilaspekte dieses zentralen Themas (Vgl. Kuckartz 2010: 57ff.).
Ein Kategoriensystem beinhaltet neben den Bezeichnungen für die jeweilige Kategorie auch Kategoriendefinitionen, Ankerbeispiele und Codierregeln, siehe Abbildung 8.
Das ist deshalb so wichtig, weil feststehen muss, was bzw. welche Textstellen unter welche Kategorien fallen und mit welcher Begründung. Die Abbildung zeigt das Kategoriensystem. Der vollständige Kodierleitfaden bzw. Kategoriensystem mit Ankerbeispielen befindet sich im Anhang 4 dieser Arbeit.
[...]
1 Unter „Late Onset“ versteht man alte Menschen die erst aufgrund von z.B. Einsamkeit oder Armut eine Abhängigkeit entwickeln.
2 Dosissteigerung im Verlauf, um gleiche Wirkung zu erzielen.
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2016, Versorgung älterer Menschen mit Suchterkrankung. Lösungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit mit langzeitsubstituierten Menschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538283
Kostenlos Autor werden


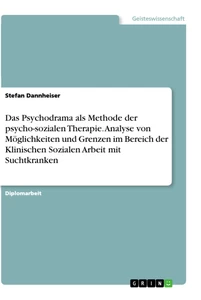







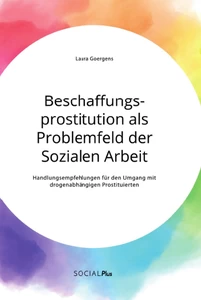






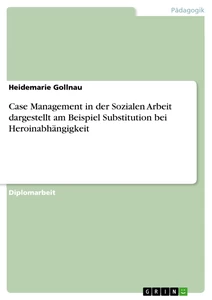

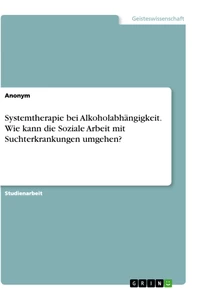
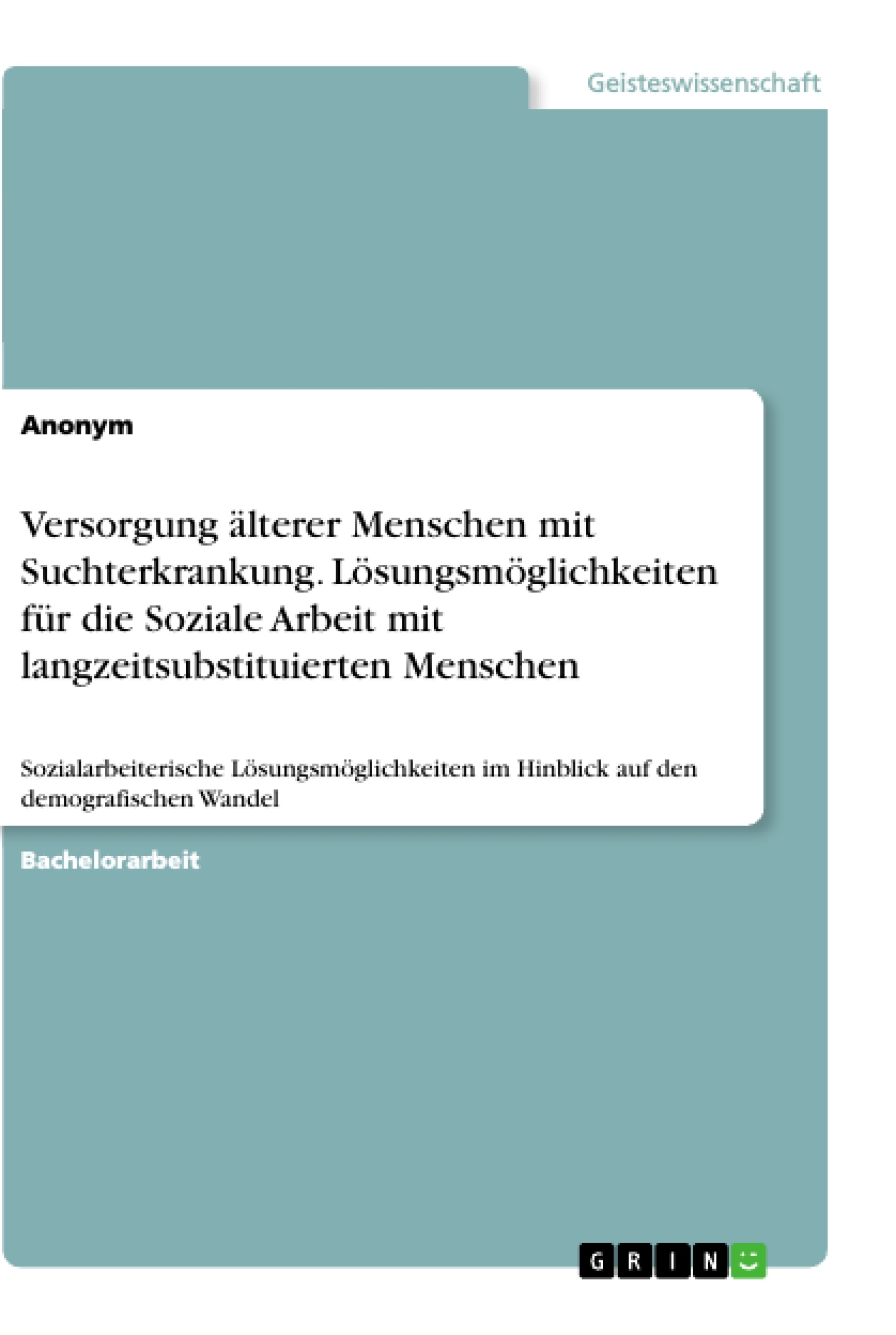

Kommentare