Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. EINLEITUNG
II. BEGRIFFSEXPLIKATION ‚IDENTITÄT’
1. Identität als ‚Privates Selbst’
2. Identität als ‚Soziales Selbst’
III. PSI & PSB MIT FERNSEHAKTEUREN
1. Fernsehakteure
1.1 Prominente und Stars
1.2 Das Persona-Konzept
2. Basale Prozesse der Wahrnehmung und Verarbeitung von Fernsehakteuren
2.1 Das Grundverständnis sozialer Interaktionsprozesse und Beziehungen
2.2 Parasoziale Interaktion
2.3 Parasoziale Beziehung
2.4 Differentielle PSI|PSB im Zwei-Ebenen-Modell
IV. IDENTITÄTSENTWICKLUNG IM ZEITALTER DER MEDIEN(AKTEURE)
1. Identitätsentwicklung durch parasoziale Teilprozesse
1.1 Soziale Vergleichsprozesse mit Fernsehakteuren
1.2 Beobachtendes Lernen von Fernsehakteuren
1.3 Rollenidentifikation mit Fernsehakteuren
2. Implikationen für die Identitätsbildung durch Medien
2.1 Medien-Identität, Fernsehgeneration und Sozialcharakter
2.2 Risiken und Chancen der PSI|PSB mit Fernsehakteuren
2.3 Differentielle Rezeption und das Wirkungspotential von Fernsehakteuren
V. FAZIT
VI. BIBLIOGRAPHIE
I. EINLEITUNG
Sind Medien alleinverantwortlich für das Entstehen eines medial geprägten Sozialcharakters, einer Medienidentität oder gar einer ganzen Fernsehgeneration? In der öffentlichen Debatte ist immer wieder von solchen Begrifflichkeiten und meist kausalen ‚Schuldzuweisungen’ die Rede (vgl. Winterhoff-Spurk, 2005; Hepp, Thomas & Winter, 2003; Tannenbaum 1980), wodurch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema ‚Medien und Identität’ besondere Relevanz erlangt.
Menschliche Identität, die sich weitgehend über interpersonale Interaktionen sowie Beziehungen entwickelt, sieht sich zwar seit jeher soziokulturellen Herausforderungen[1] gegenübergestellt (vgl. Leschig, 1999), jedoch spielen Medien in diesem Kontext eine besondere Rolle. Sie eröffnen neue Möglichkeiten für das Herausbilden von Identität und können dadurch bspw. die abnehmende Stabilität zwischenmenschlicher Bindungen kompensieren (vgl. Hepp, 2003. S. 115; Schemer, 2003). Denn identitätsbildende Prozesse können vermutlich nicht nur mit orthosozialen, sondern auch mit medial vermittelten Charakteren ablaufen. Zur dynamischen Selbstentfaltung benötigt das Individuum ein Gegenüber, wobei ein entsprechender Dialog auch mit fiktiven „Platzhalter[n]“ (Charlton & Neumann, zit. nach Leschig, 1999, S. 30) erfolgen kann und muss. Diese ‚Dialoge’ werden in der Kommunikationswissenschaft unter den Begrifflichkeiten Parasoziale Interaktion (PSI) und Parasoziale Beziehung (PSB) mit sogenannten ‚Personae’ gefasst. Im Unterschied zu orthosozialen Interaktionen (OSI) und Beziehungen (OSB) zeichnen sich diese medienspezifischen Abläufe im Wesentlichen durch ihre asymmetrische Natur aus: Menschen erhalten bei PSI|PSB auf ihr Kommunikationsverhalten keine unmittelbare Reaktion durch die Persona.
Das populärste und meistgenutzte Medium[2], das Fernsehen, gilt im Besonderen als „Lückenfüller“ (Weiß, 2001) sowie Sozialisationsinstanz (vgl. Huter, 1998; Wegener, 2004) und besitzt somit ein Wirkungspotential auf die Rezipientenidentität. Es unterscheidet sich durch seine audiovisuelle Kraft und funktionelle Vielfalt von anderen Medien (vgl. Klingler & Gerhards, zit. nach Weiß, 2001, S. 254) und ist laut Gerbner (zit. nach Schenk, 2002, S. 537ff) die gebräuchlichste Lernumgebung für die Mitglieder der Gesellschaft. Außerdem stellt das Fernsehen durch die theatralische Inszenierung von Personen und Rollenbildern ein überaus geeignetes „Medium des Anscheins idealisierter Identitätskonzepte“ (Weiß, 2001) dar. Ihm kommt deshalb eine „Schlüsselrolle in der Strukturierung von zeitgenössischer Identität“ (Kellner, zit. nach Mikos, 1999) zu: Es bietet dem Rezipienten[3] durch (selbst)reflexives Erleben und eine „Art externalisierte[n] Dialog [...] über die Welt mit sich selbst“ (Krotz, zit. nach Weiß, 2001, S. 252) eine besonders vielseitige Grundlage für die imaginative Interpretation von Identität.
PSI|PSB mit Fernsehakteuren[4] implizieren deshalb Folgen für die Identitätsbildung, welche sich von einer rein orthosozial geprägten Identitätsentwicklung unterscheiden und sowohl negativer wie auch positiver Natur sein könnten. Die vorliegende Arbeit zielt demnach einerseits darauf ab, die relevanten zugrunde liegenden PSI-Teilprozesse zu explorieren, welche für das Herstellen eines Bezugs zwischen Fernsehakteur und Rezipient und dadurch für dessen Identitätsbildung konstitutiv sind. Andererseits sollen die daraus entstehenden (möglichen) Implikationen für die Identitätsentwicklung aufgezeigt werden. Deshalb folgt eine theoretische Annäherung an die Beantwortung der folgenden Frage: Welches Wirkungspotential auf die Identitätsentwicklung des Rezipienten bergen PSI|PSB mit Fernsehakteuren, insbesondere die PSI-Teilprozesse soziales Vergleichen, beobachtendes Lernen am Modell und Rollenidentifikation?
Zu Beginn soll der ganzheitlichen Betrachtung wegen (vgl. Aigner, 1987, S. 8) eine umfassende Deutung des komplexen Phänomens ‚Identität’ durch begriffliche Auffächerung aus verschiedenen Perspektiven erfolgen: zu diesem Zweck wird Identität einerseits (Abschnitt II.1) in das „Private Selbst“ (Hurrelmann, zit. nach Mattern, 1999, S. 27f) und andererseits (Abschnitt II.2) in das „Soziale Selbst“ (Ebd.) kategorisiert. Anschließend folgt die Explikation des Verständnisses von Fernsehakteuren (Abschnitt III.1) sowie der basalen Prozesse der Wahrnehmung und Verarbeitung ebendieser in Form von PSI|PSB (Abschnitt III.2). Diese beiden Kapitel werden anschließend zusammengeführt, indem auf die ausgewählten Teilprozesse von PSI|PSB (Abschnitt IV.1) mit Bezug zu Identität eingegangen wird. Zentral für die Arbeit ist der nun folgende Teil, in welchem daraus folgende Implikationen für die Identitätsentwicklung (Abschnitt IV.2) diskutiert werden, durch welche der Zusammenhang zwischen Fernsehakteuren und Rezipienten-Identität deutlich werden sollte. Abschließend werden die zentralen Ergebnisse in Form eines Fazits ausblickend summiert (Kapitel V.).
II. BEGRIFFSEXPLIKATION ‚IDENTITÄT’
Um zu verstehen, was die Welt der Menschen im Innersten zusammenhält, bietet sich zunächst eine Betrachtung des menschlichen „Seelenkern[s]“ (Jung, zit. nach Mattern, 1999, S. 25), der Identität, an. Diese ergibt sich nicht nur aus der ständigen hermeneutischen Selbstauslegung (Frank, zit. nach Rath, 2002, S. 154), sondern auch durch Interaktionen mit und Beziehungen zu anderen Menschen. Dabei ist die Entwicklung der Identität in einigen Lebensphasen zwar besonders ausgeprägt (bspw. in der Pubertät), findet jedoch nach neueren Ansätzen im gesamten Lebensverlauf statt. Identität darf demnach als dynamisches und veränderliches Konstrukt verstanden werden, welches sich vor allem im Zusammenspiel mit der sozialen Umwelt und über symbolische Interaktionen (z.B. über Sprache und Habitus) im Verlauf des gesamten Lebens ergibt.
1. Identität als ‚Privates Selbst’
In der Psychoanalyse findet sich bspw. der Begriff der „Ich-Identität“ (Erikson, 1970, S. 217), welche das Ergebnis der sozialen Funktion des ‚Ichs’ an der „Ich-Grenze“ (Ebd.), der Außen- und Umwelt, darstellt. Freud (zit. nach Aigner, 1987, S. 13) stellt diesbezüglich fest, dass das ‚Ich’ darum ringt, „[...] die Harmonie unter den Kräften und Einflüssen herzustellen, die in ihm und um es wirken“. Dabei unterscheidet er das wahrnehmende, willensbildende „Ich“, das begünstigende, triebhafte „Es“ sowie das mäßigende, normative „Über-Ich“ (vgl. Freud, 1999; Tillmann, 1996, S. 56ff; Krotz, 2004, S. 38). Im klassischen Sinne begreift die psychologische Sicht eines ‚Privaten Selbst’ die Identität jedoch als Überbegriff oder auch „Konsistenzrelation“ (Witte & Linnewedel, 1993, S. 30) mehrerer subjektiver Selbst(teil)bilder, welche in ihrer Bewertung zum Selbstkonzept und in ihrer Summe zur Identität des Individuums führen. Das Selbstkonzept bezieht sich dabei auf drei zentrale inhaltliche Ebenen: das kognitive (‚Welche Eigenschaften besitze ich?’), konative (‚Welche Handlungen zeige ich?’) und affektive (‚Wie bewerte ich diese Eigenschaften und Handlungen?’) Selbstbild (vgl. Witte & Linnewedel, 1993, S. 30). Demnach besteht das Selbstkonzept aus Ergebnissen der Selbstwahrnehmung, -bewertung und -reflexion (vgl. Hurrelmann, zit. nach Mattern, 1999, S. 25f) und fokussiert auf das Individuum sowie die Summe aller auf die eigene Person bezogenen Bewertungen und Einstellungen (vgl. Mummendey, 1995; Rosenberg, 1979; Baldering, zit. nach Mattern, 1999, S. 26). Menschen streben danach, durch Balance bzw. Konsistenz oben genannter Selbstbilder ihre Identität zu wahren, woraus u.a. ein positives Selbstwertgefühl resultiert (vgl. Witte, 1993, S. 10ff).[5] Dies geschieht (gemäß der hierarchischen Betrachtung von Selbstkonzepten bzw. -bildern; vgl. Mummendey, 1995) von bereichsspezifischen Konstrukten (vgl. Krampen, 2000) über generelle Einstellungen hin zur Summierung eines globalen (Selbst-)Werts. Ein identitätsstiftendes Selbstkonzept ist dabei sowohl Voraussetzung als auch Ziel des Individuums (vgl. Hurrelmann, zit. nach Mattern, 1999, S. 25f).
2. Identität als ‚Soziales Selbst’
Aufbauend auf dieser Identitäts-Auffassung erweitert Erikson (1993, S. 107) die „Ich-Identität“ um eine sozialpsychologische Perspektive, da Identitätsentwicklung innerhalb einer sozialen Wirklichkeit abläuft und neben der Selbstwahrnehmung auch die Fremdwahrnehmung durch andere berücksichtigt.[6] Dabei steht der Organismus im Spannungsfeld der „Identitätsbalance“ (Krappmann, 1973) zwischen Stabilität und Kontinuität einerseits (gemäß des ‚Privaten Selbst’; vgl. Abschnitt II.1) sowie Dynamik und Flexibilität andererseits (durch die Auseinandersetzung und Anpassung an wechselnde Ansprüche und Situationen). Dadurch wird „[...] das psychische mit dem gesellschaftlichen und das gesellschaftliche mit dem psychischen Leben vermittelt [...]“ (Ebd.). Um ein identitätsstiftendes Selbstkonzept zu besitzen, müssen laut Hauszer (1983, zit. nach Dorsch, 1998) generell verschiedene Aspekte des „Identitätserlebens“ in die Entwicklung der Identität integriert sein. Identität sollte u.a. auf einer kontinuierlich biographischen Linie ablaufen, in verschiedenen Lebenskontexten konsistent sein, und sich als einzigartig und gleichwertig im Vergleich zu den Identitäten anderer herausstellen. Die biographische Konsistenz wird im Rahmen spezifischer Entwicklungsaufgaben nach Havighurst et. al. (zit. nach Dorsch, 1998; Münch, 2002, S. 71; Erikson, 1993) in Form periodischer Zeitspannen aufgegriffen, welche für die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung typisch sind.[7] Die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem erwarteten bzw. gewünschten Entwicklungsstand wird als sogenannter ‚Entwicklungsbedarf’ tituliert. Um diesen zu bearbeiten, suchen Menschen oft die Bindung an eine solidarische Gruppe (Gruppenkohäsion), wodurch eine gemeinsame Gruppenidentität[8] entstehen kann (vgl. Bierhoff, 2002, S. 113ff). Die Gruppe ermöglicht außerdem das Abgrenzen von anderen (Gruppen), um die eigene Identität zu schützen.[9]
Nach soziologischer Auffassung im symbolisch-interaktionistischen Sinne Mead s (1973) ist die Entstehung von Identität im Rahmen des Sozialisationsprozesses die Folge kommunikativen Handelns und sozialer Erfahrungen (vgl. auch Tillmann, 1996, S. 133f; Mikos, 1999, S. 4). Das Individuum wird demnach über ein geteiltes Symbolsystem (z.B. Sprache) mit stabilisierten Erwartungen durch andere konfrontiert, welche teilweise einer aktiven Interpretation und konativen Antwort seitens des Individuums bedürfen. Dabei handeln Individuen ‚Dingen’ gegenüber auf Basis der Bedeutungen und Assoziationen, die sie mit diesen verbinden, kreieren diese über soziale Interaktionen und modifizieren sie über alltägliche OSI (vgl. Blumer, zit. nach Krotz, 1996, S. 54).[10] Auch hier wird die Bedeutung der Identitätsbildung in der Pubertät betont: In dieser Phase ist es für Individuen besonders wichtig, mit bestimmten Kulturen zu sympathisieren, deren Symbolwelt zu verstehen und Mitglied zu werden, spezifische Sozialisationskontakte auszuwählen und ihre Identität durch die (temporäre) Übernahme eines Lebensstils zu konstruieren (vgl. Müller et. al., 1999, S. 26).
Das allgemein bekannte, überlieferte ‚Cogito ergo sum’ nach Descartes kann deshalb heute um ein ‚Interago ergo sum’ ergänzt werden (Anm. d. Verf.). Denn das Individuum bringt beim symbolischen Interagieren stets seine Identität mit ein, welche Mead (1973) in „I“ und „Me“ unterscheidet: „I“ beschreibt das Selbstkonzept (vgl. II.1), das biographisch und eher intrinsisch entsteht, indem es weitgehend auf Interaktionen verzichtet. Das reflektierende „Me“ umfasst Fremdwahrnehmungen, Beurteilungen und Spiegelungen durch andere Menschen (vgl. Mummendey, 1995). Diese Auffassung wurde von Goffman (zit. nach Tillmann, 1996, S. 137) weiterentwickelt in die Aufteilung von personaler und sozialer Identität (vgl. hierzu die Aufteilung in ‚Privates’ und ‚Soziales Selbst’), aus deren Balance sich die „Ich-Identität“ (Ebd.) ergibt. Diese steht im Spannungsfeld zwischen Selbstdarstellung („Role-Making“) und den (Kommunikations-) Erwartungen anderer bzw. dem Fremdbild („Role-Taking“), und wird durch intrapersonale Kommunikation bzw. Interaktion vermittelt (vgl. Mead, 1973; Tillmann, 1996). Daraus entstehende Diskrepanzen fordern das Individuum immer wieder zur Identitätsarbeit heraus, wobei Identität als Ergebnis des diskursiven Verhältnisses zwischen „Me“ (als Außenperspektive) und „I“ (als Innenperspektive) interpretiert werden kann. Denn das Individuum muss „[...] einen Weg zwischen Normenkompatibilität und –distanz, zwischen Anerkennung [...] und Selbstachtung finden“ (Schramm & Hartmann, 2005, S. 6). Demnach wird es dem Individuum laut Mead (zit. nach Mattern, 1999, S. 29) erst durch Wahrnehmung und Übernahme anderer Meinungen möglich, selbst zum Objekt seiner eigenen Wahrnehmungen zu werden. Dabei zeichnet sich das Individuum im Vergleich zu anderen sowohl durch eine gewisse Ähnlichkeit, als auch durch Einzigartigkeit aus (vgl. Mikos, 1999, S. 4, Krotz, 1996b, S. 61). Durch den offenen, dynamischen Prozess zwischen ‚I’ und ‚Me’ bildet sich Identität in Interaktionen mit anderen Menschen aus (vgl. Keupp et. al., 1999) und wird im Zeitverlauf immer differenzierter und vernetzter (vgl. Baldering, zit. nach Mattern, 1999).
Identitätsentwicklung entsteht dieser Auffassung nach über interpersonale OSI|OSB, kann jedoch auch wie eingangs angedeutet mittels PSI und PSB mit Fernsehakteuren ablaufen. Solche Fernsehakteure sollen im Rahmen dieser Arbeit auf menschliche Figuren und Personen eingeschränkt werden, welche im Fernsehen (bzw. optional zusätzlich in anderen Medien) präsent sind. Dazu zählt auch die große Menge an Prominenten und Stars, welche oft Ich-Ideale und Vorbilder der Rezipienten verkörpern und deshalb im Kontext dieser Arbeit eine besondere Rolle für die Identitätsentwicklung (insbesondere von Jugendlichen) spielen dürften.
III. PSI & PSB MIT FERNSEHAKTEUREN
1. Fernsehakteure
Fernsehakteure sind für die Identitätsentwicklung von Bedeutung, da zu ihnen eine Form der „secondary attachments“ (Erikson, zit. nach Giles, 2002, S. 814), d.h. Bindungen zweiter Ordnung, auf Distanz hergestellt werden können. Besonders Jugendliche können durch die Interaktion mit und Beziehungen zu Fernsehakteuren Rollen erproben (z.B. auf sozialer, emotionaler und berufsbezogener Ebene), sich dadurch von den Eltern lösen und ein eigenes, autonomes, individuelles Ich erarbeiten (vgl. Giles, 2002). Zum einen können Fernsehakteure eine Rolle für das private Selbst (durch die Bedeutung für das Selbstkonzept), zum anderen aber auch für das soziale Selbst (als soziale Unterhaltungsfunktion in der Interaktion mit anderen) spielen (vgl. Maltby et. al., zit. nach Giles, 2002). Im Sinne des letztgenannten Selbst können Fernsehakteure den Status von „pseudo-friends“ (Cohen, zit. nach Giles, 2002, S. 20) erlangen, über die im lebensweltlichen Kontext gesprochen wird und die dadurch zur Gruppenkohäsion beitragen (vgl. Abschnitt IV.2.2). Im Folgenden sollen Prominente und Stars aufgrund ihrer besonderen Stellung im Kontext identitätsbezogener Funktionen vorgestellt werden.
1.1 Prominente und Stars
Aus dem ehemals filmspezifischen Starsystem ist laut Langer (1997, S. 167ff) ein fernsehspezifisches „Personality System“ geworden. Diese „Personalities“ sind nicht mehr nur unerreichbare, vereinzelte, distanzierte Ideale, sondern oft durchschnittlicher Teil der Zuschauerwelt und scheinbar ‚zum Greifen nahe’. Die Besonderheit dieser „instant stars“ (Winterhoff-Spurk, 2005, S. 74) liegt paradoxerweise in ihrer Durchschnittlichkeit, da sie aus dem selben, meist bürgerlichen Milieu stammen wie ihre Anhänger. Dadurch versprechen sie nonverbal: „Auch Du kannst es schaffen“ (Ebd., S.75), zumindest die bekannten Warhol ’schen 15 Minuten lang, Starruhm zu genießen. „[...] [A]lle können heute prominent sein“, meint deshalb Kraus (zit. nach Winterhoff-Spurk, 2005, S. 73), weswegen der Begriff ‚Prominenz’ alle Menschen umfasst, welche in der medialen Öffentlichkeit mindestens einmal angesehen werden.[11] Aufgrund des Fernsehens vermehrt sich ihre Zahl ständig und bedingt eine Tendenz hin zu eigens produzierten Prominenten. Dabei gilt: „Nicht alle Prominente sind Stars, aber alle Stars gehören zu der Kategorie der Prominenten.“ (vgl. Staiger, 1997, S. 49).
Prominente werden erst dann zu Stars, wenn die Zuschauer in ihnen idealisierte Charakteristika, Werte oder Sehnsüchte verorten, die sie eigentlich sich selbst oder anderen zuschreiben (Ebd., S. 117). Denn Stars grenzen sich von Prominenten durch Erfolg, Image und Kontinuität ab (vgl. Sommer, 1997, S. 114) und sind die „Personifikation von Träumen großer Menschengruppen, die deren Wünsche über sich selbst, ihre Idealbilder [...], sicher und dauerhaft verkörpern.“ (Winterhoff-Spurk, 2005, S. 66f; vgl. auch Hickethier, 1997). Sie sind Werte-Führer (z.B. Schauspieler, Sportler, Musiker), welche die Gruppe repräsentieren, und sich gleichzeitig als einzigartig emporheben lassen (vgl. Faulstich et. al., 1997; Sommer, 1997). Prominente wie auch Stars erhalten ihren Status erst durch Medienrezeption, da sie in Abhängigkeit des gegenwärtigen soziokulturellen Rahmens und ihres Publikums sozial konstruiert werden und aus einem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage entstehen (vgl. Sommer, 1997). Insbesondere Stars werden oft idealisiert und idolisiert, weshalb sie sich zu gesellschaftlichen Vorbildern entwickelt haben und nicht mehr nur mit emotionalen, sondern auch mit intellektuellen und moralischen Vorstellungen aufgeladen und als identitätsstiftende Orientierungsmuster genutzt werden (vgl. Janke, 1997, S. 21; Kapitel IV.).[12]
Neben diesen Prominenten und Stars, die größtenteils sich selbst ‚spielen’, offeriert v. a. das Fernsehen eine besondere Form der „Personalities“ (Langer, 1997): Horton & Wohl (1956, S. 216) bezeichnen diese als ‚Personae’. Darunter verstehen sie Persönlichkeiten, deren Existenz und Popularität nur auf ihrer Präsenz in den Medien basiert (z.B. Nachrichtensprecher, Quizmaster).
1.2 Das Persona-Konzept
Personae sind typische Figuren der Medienschauplätze und -situationen, welche dem anonymen Massenpublikum eine intime ‚Beziehung’ zu den Personae ermöglichen. Das Persona-Konzept umfasst dabei nach neueren Betrachtungen sowohl ‚reale’ Medienakteure (z.B. Nachrichtensprecher) als auch fiktionale Medienfiguren (z.B. Seriendarsteller)[13]. Sie befinden sich zwischen Personen und Performern und entfalten ihre Bedeutung nur aus ihrer Funktion als Interaktionspartner der Zuschauer. Dies geschieht, indem eine Persona den Zuschauer imaginativ in ihre ‚Performance’ einbindet und eine fiktive Rolle, bspw. als Freund, Vorbild oder Ratgeber, einnimmt (vgl. Ebd.; Hippel, 1996, S. 57). Personae vermitteln die Sphäre des Medieninhalts über ihre eigene ‚Person’ mit der Rezipientensphäre und ermöglichen dem Rezipienten nicht nur eine scheinbare ‚Beziehung’ zu den Personae (vgl. hierzu Kapitel III.2), sondern nach Hippel (1996) auch eine Beziehung zum medialen ‚Text’, dem Medieninhalt.
Personawahrnehmung ähnelt dabei der Wahrnehmung ‚realer Personen’ (vgl. Hartmann et. al., 2004b, S. 26), und kann drei Ausprägungen annehmen, welche sich gegenseitig beeinflussen und überkreuzen können (vgl. Keppler, 1996, S. 19ff): Erstens können Rezipienten eine Figur als fiktive Person wahrnehmen, welche durch einen Darsteller personifiziert wird, und sich mit dieser entsprechend identifizieren. Zweitens kann eine Identifizierung (vgl. hierzu Abschnitt IV.1.4) mit dem Typus stattfinden, welchen die Person darstellt. Drittens kann auch eine Identifikation mit den Personae als medienvermittelte, öffentliche Menschen von statten gehen, wenn die Medien genügend zusätzliche Informationen bereitstellen (vgl. auch Wulff, 1996, S. 47).
Um die Bedeutung von entsprechenden Medienpersonen zu ergründen, bietet es sich an, die bezugnehmenden, tieferliegenden Rezeptionsprozesse zu beleuchten. Aufgrund der einleitend genannten Besonderheiten des Mediums Fernsehen (vgl. Kapitel I.) und seiner Akteure kann die Illusion einer sozialen Kommunikationssituation von Angesicht zu Angesicht erzeugt werden. Diese Situation birgt das Potential, via Interaktion eine (durch den Rezipienten hergestellte) Verknüpfung des Akteurs mit dem Rezipienten entstehen zu lassen. Diese PSI ähnelt dabei den Funktionsweisen orthosozialer Interaktionen und Beziehungen, weist jedoch auch einige Besonderheiten auf. Um diese Unterschiede zu verdeutlichen, sollen zunächst OSI|OSB erklärt werden, bevor auf PSI|PSB eingegangen wird.
2. Basale Prozesse der Wahrnehmung und Verarbeitung von Fernsehakteuren
2.1 Das Grundverständnis sozialer Interaktionsprozesse und Beziehungen
Soziale Interaktion kann generell als „[...] wechselseitiges Geschehen zwischen zwei oder mehreren Lebewesen verstanden werden, welches mit einer Kontaktaufnahme beginnt [...] und zu Reaktionen der in Kontakt stehenden Lebewesen führt.“ (Burkart, 2002, S. 30). Als Kontaktaufnahme gilt hier bspw. auch die rein physische Anwesenheit der sozialen Entitäten. Infolgedessen beginnt die Interaktion durch die Wahrnehmung eben dieser Kontaktaufnahme und Reaktion[14] darauf durch die andere soziale Entität. Letztere Reaktion kann wiederum durch die erste soziale Entität wahrgenommen werden, ein entsprechendes Reagieren (‚Reaktion zweiter Ordnung’) auslösen und dadurch die interaktionistische Sequenz vervollständigen. Diese „aktiv-reaktive Komponente“ (Lersch, zit. nach Schramm & Hartmann, 2005, S. 8) des menschlichen Zusammenwirkens kann unbewusst sowie nicht intendiert ablaufen und dabei von entitätenbezogenen Determinanten (z.B. Persönlichkeit, Motive) bestimmt sein. Dadurch, dass das Individuum einerseits seine eigenständige Identität präsentiert, sich andererseits aber auch auf die Erwartungen der anderen Entität einlassen muss, ist soziale Interaktion „immer auch ein Präsentieren und Aushandeln von situativ interpretierten Identitäten“ (Krotz, 1996a, S. 76), welches in einer balancierenden Identität mündet (vgl. Krappmann, 1973; Abschnitt II.2).
[...]
[1] Hierzu zählen gegenwärtig u.a. der gesellschaftliche Wertewandel, die Individualisierung und Pluralisierung von Lebens- und Schaffensräumen sowie die Veränderung von geschlechtsbezogenen Rollenbildern (vgl. Mikos, 1999).
[2] Seit Anfang der 1980er Jahre besitzen laut der Time Budget 12 -Langzeitstudie etwa 98 Prozent aller deutschen Haushalte mindestens ein Fernsehgerät und nutzen dieses (in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen) durchschnittlich 168 Minuten pro Tag (vgl. SevenOne Media GmbH, 2005b, Online).
[3] Im Folgenden ist nur von ‚Rezipient(en)’ die Rede, dieser Begriff soll jedoch auch die ‚Rezipientin(nen)’ miteinbeziehen.
[4] ‚Fernsehakteur(e)’ umfasst in dieser Arbeit auch ‚Fernsehakteurin(nen)’ und wird synonym mit den Begriff ‚Akteur(e)’ (und im Kontext von PSI|PSB auch mit dem Begriff der ‚Persona[e]’) verwendet.
[5] Zur Vertiefung vgl. das Self-Evaluation Maintenance Model nach Tesser, A. (1980). Self-esteem maintenance in family dynamics. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 77-91; vgl. auch Herkner, 1991, S. 370f.
[6] Somit wird zusätzlich die Frage auf ein ‚Was denken andere über mich?’ gegeben (vgl. hierzu auch das Self-Schema nach Markus, zit. nach Leffelsend, 2002, S. 14).
[7] Bspw. zählen im Jugendalter zu den typischen Aufgaben: körperliche Reifung, Aufbau von Freundschaften, Eingliederung in das soziale Leben und Herausbilden einer Persönlichkeit (vgl. Wegener, 2004, S. 21f).
[8] Zur Vertiefung vgl. die Social Identity Theory (Tajfel, zit. nach Herkner, 1991, S. 490ff) sowie den Social Identity Approach (Wagner & Zick, 1990).
[9] Zur Vertiefung vgl. die Selbst-Diskrepanz -Theorie (Higgins, zit. nach Herkner, 1991, S. 367ff).
[10] Diese Auffassung findet sich auch bei Elias (zit. nach Krotz, 2004, S. 32f) sowie Cassirer s Philosophie der symbolischen Formen (zit. nach Rath, 2002, S. 155f), wonach das Erkennen und Gestalten der Welt per se bereits durch die eigene Person und deren prädisponierende „symbolische Formen“ geprägt ist, und weniger durch die zu erkennende Welt. Der Mensch konstruiert, produziert und identifiziert somit sich und seine Welt über Symbole, dadurch werden Mensch (im Gegensatz zum Tier) und Welt über ihre physikalische Natur hinaus auch symbolhaft. Cassirer bezeichnet den Menschen deshalb als „animal symbolicum“ (Ebd., S. 155f) in einer symbolhaften, medialen Lebenswelt.
[11] Dazu zählen die rund 20.000 Menschen, die jährlich in Talkshows oder Reality-Formaten auftreten (vgl. Ebd., S. 174ff).
[12] Dies haben zahlreiche Studien ergeben, u.a. die repräsentative Shell Jugendstudie (N=5.000; vgl. Fritzsche, 2000, S. 215ff): 1996 benannten nur noch 33 Prozent (1950er Jahre: 75 Prozent) der befragten Jugendlichen Vorbilder aus dem Nahbereich (z.B. Eltern). Ergänzend ergab eine andere Studie mit Jugendlichen (N=8.000; vgl. Zinnecker, 2003), dass rund 60 Prozent der Vorbilder aus dem Medienbereich stammen. Außerdem möchte rund ein Fünftel der Jugendlichen selbst einen Medienberuf erlangen.
[13] Vgl. hierzu das Paraperson -Konzept (vgl. Wulff, 1996), welches durch eine mediale „Personalität“ gekennzeichnet ist.
[14] Diese Reaktion kann bspw. auch durch eine basale psycho-physiologische Aktivierung stattfinden (vgl. Blickle, zit. nach Schramm & Hartmann, 2005, S. 7).
- Arbeit zitieren
- Anna Budel (Autor:in), 2006, Medienidentität, Sozialcharakter und Fernsehgeneration...?! Die Rolle von PSI/PSB mit Fernsehakteuren für die Identitätsentwicklung der Rezipienten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53386
Kostenlos Autor werden


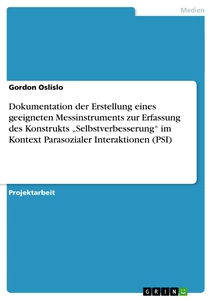

















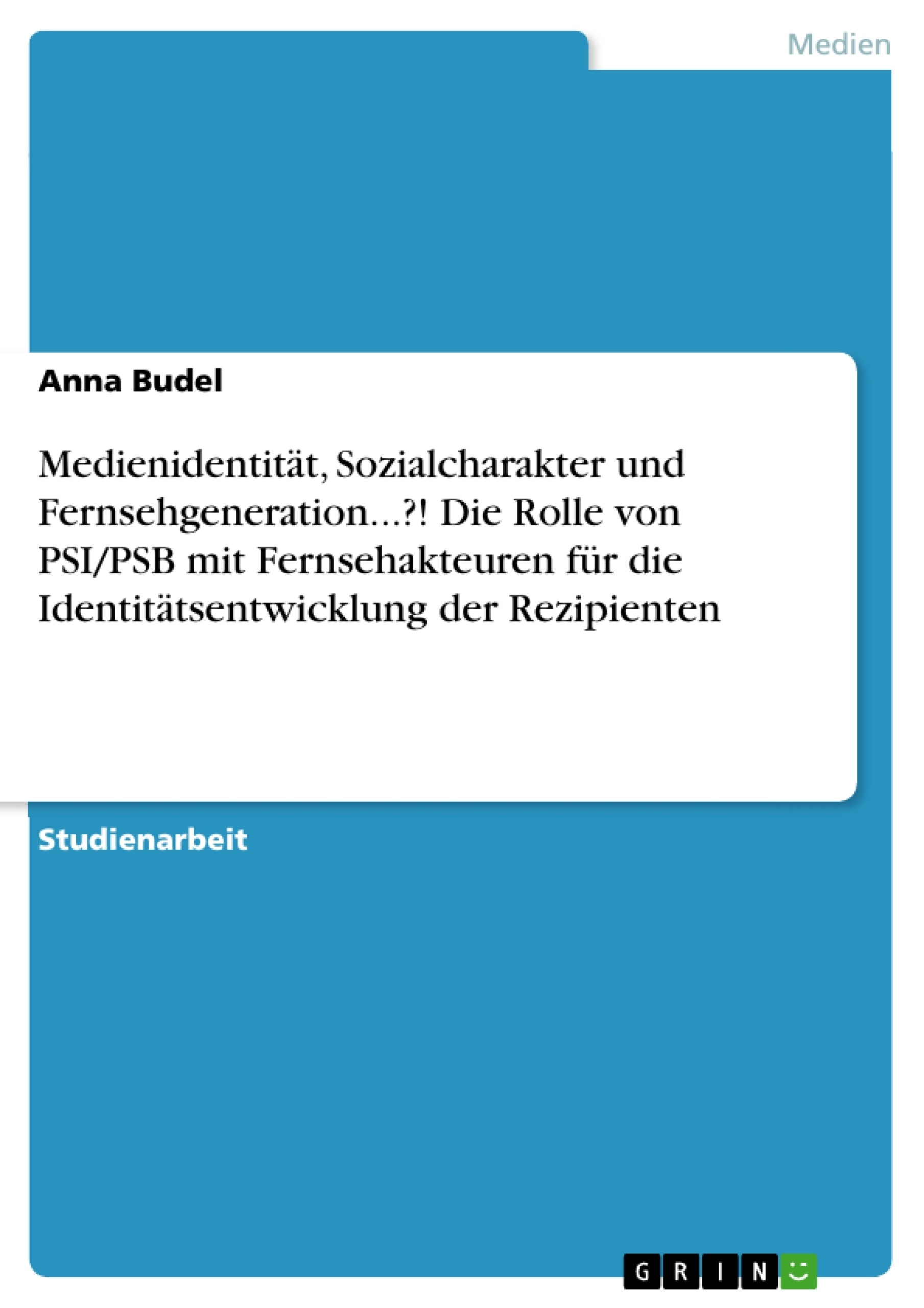

Kommentare