Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsklärung
2.1 Konzept versus Konzeption
2.2 Behinderungsbegriffe und ihre Integrationsrelevanz
2.2.1 Der medizinische Behinderungsbegriff
2.2.2 Der erziehungswissenschaftliche Behinderungsbegriff
2.2.3 Das normative Verständnis von Behinderung
2.2.4 Behinderung als „Systemfolge“
2.2.5 Auswirkungen auf die Integration
2.3 Integration: Ein Begriff – viele Bedeutungen
2.3.1 Allgemeines
2.3.2 Ulrich Bleidicks Operationalisierung des Integrationsbegriffs
2.3.3 Die sieben Gegensatzpaare von Emil E. Kobi
2.3.4 Georg Feusers Integrationsdefinition
2.3.5 Weitere Definitionsversuche
2.3.6 Neue Begriffe für ein „in die Jahre gekommenes“ Thema
2.3.7 Abschließende Gedanken
3 Von der Vergangenheit zur Gegenwart: Die entwicklung der Integration von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung
3.1 Wurzeln des Integrationsgedankens
3.2 Historischer Abriss
3.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
3.3.1 Gegenwärtiger Stand der Integrationsbemühungen
3.3.2 Von der Integration zur Inklusion
3.3.3 Gegenströmung: Förderung der Elite
3.3.4 Eine allgemeine (integrative) Pädagogik
3.4 Abschließende Gedanken
4 Formen integrativen Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen
4.1 Grundsätze und Prinzipien von Integration
4.2 Gemeinsame Erziehung im Elementarbereich
4.2.1 Allgemeines
4.2.2 Die Grundformen der Erziehung im Elementarbereich
4.2.3 Richtungen der Konzeptentwicklung gemeinsamer Erziehung im Elementarbereich
4.3 Gemeinsame Erziehung im Sekundarbereich
4.3.1 Allgemeines
4.3.2 Möglichkeiten schulischer Integration nach Empfehlung des deutschen Bildungsrates von 1973
4.3.3 Formen schulischer Integration
4.3.4 Organisationsformen schulischer Integration
4.3.5 Erfahrungsberichte: Schwierigkeiten und Chancen schulischer Integration im Anschluss an die Grundschulzeit
4.4 Integrative Freizeitangebote
5 Möglichkeiten der Übertragung von bestehenden Konzepten für Betreuungen am Nachmittag auf Integrative Kooperationsklassen an Grundschulen in Bayern
5.1 Das Konzept der Integrativen Kooperationsklasse
5.1.1 Allgemeines
5.1.2 Das Coburger Modell
5.2 Konzepte der Nachmittagsbetreuung von Schüler/innen der Integrativen Kooperationsklassen in bayerischen Grundschulen
5.2.1 Allgemeines
5.2.2 Betreuung am Wohnort
5.2.3 Mittagsbetreuung an Volksschulen
5.2.4 Heilpädagogische Tagesstätten der Schulen zur individuellen Lebensbewältigung nach dem Rahmenplan der Diakonie
5.2.5 Kindertageseinrichtungen am Beispiel „Hort“
5.2.6 Ganztagsschule
5.3 Das Für und Wider vorhandener Konzepte
5.4 Abschließende Gedanken
6 Entwurf einer pädagogischen Konzeption für eine integrative Tagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung im Rahmen von Integrativen Kooperationsklassen an Grundschulen in Bayern
6.1 Vorwort
6.2 Grundlagen zum Thema
6.3 Leitbild der Einrichtung
6.4 Strukturen der Einrichtung
6.4.1 Träger
6.4.2 Gesetzliche Grundlagen
6.4.3 Finanzierung
6.4.4 Personelle Besetzung
6.4.5 Gruppenzusammensetzung
6.4.6 Lage
6.4.7 Räumlichkeiten
6.4.8 Öffnungszeiten
6.5 Zielgruppe
6.6 Zielsetzung
6.7 Pädagogische Grundgedanken und Methoden
6.7.1 Tagesablauf
6.7.2 Mittagstisch
6.7.3 Hausaufgabenbetreuung
6.7.4 Freizeitgestaltung
6.7.5 Arbeit mit dem Kind
6.7.6 Gestaltung des Gruppenraumes
6.7.7 Aufgaben der Mitarbeiter
6.7.8 Teamarbeit
6.7.9 Therapie und therapieunterstützende Arbeit
6.7.10 Elternarbeit
6.8 Vernetzungsarbeit
6.8.1 Zusammenarbeit mit der Grundschule
6.8.2 Zusammenarbeit mit der Förderschule
6.8.3 Zusammenarbeit mit den Therapeuten
6.8.4 Kooperation mit den Kindergärten
6.9 Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit
6.10 Qualitätssicherung
6.11 Nachwort
7 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Auszug aus BayKiTa
2 Konzeptionsentwurf der Integrativen Tagesstätte Sonnenstrahl
(Zusatzheft)
Abbildungssverzeichnis
Abbildung 1: Behinderung nach dem SGB IX
Abbildung 2: Unterscheidung von ICIDH-1 (1980) und ICF (2001) der WHO (1)
Abbildung 3: Unterscheidung von ICIDH-1 (1980) und ICF (2001) der WHO (2)
Abbildung 4: Entwicklungsstufen nach Sander
Abbildung 5: Zum Verhältnis der Grundpositionen der Pädagogik heute zu einer Allgemeinen integrativen Pädagogik nach Feuser
Abbildung 6: Formen der schulischen Erziehung behinderter Kinder geordnet nach Möglichkeiten des Sozialkontaktes mit nichtbehinderten Kindern nach Sander
Abbildung 7: Möglichkeiten der Nachmittagsbetreuung für Schüler/innen von Integrativen Kooperationsklassen
Abbildung 8: Gruppenzusammensetzung und personelle Besetzung
1 Einleitung
Die Idee für das Thema „Entwurf einer pädagogischen Konzeption einer integrativen Tagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung im Rahmen von Integrativen Kooperationsklassen1 an Grundschulen in Bayern“ entwickelte sich im Zusammenhang mit meinem Praktikum in einer Integrativen Kooperationsklasse an der Melchior-Franck- Schule in Coburg und der dort angeschlossenen Tagesstätte.
Immer wieder habe ich während meiner Arbeit in der Integrativen Kooperationsklasse Begriffe gehört wie Behinderung und Nichtbehinderung, Integration und Ausgrenzung, normal und behindert. Je mehr ich mich mit diesen Themen auseinander setzte, desto mehr Fragen ergaben sich: „Was steckt eigentlich hinter diesen Begrifflichkeiten? Warum ist die Auseinandersetzung mit Definitionen und bestehenden Gesetzen von so großer Bedeutung? Warum schult man nicht einfach alle Kinder gemeinsam in eine Schule ein? Welches ist denn nun der „richtige“ Weg der Integration?“
Ich spüre oft die Angst und Unsicherheit, wenn ich mit Freunden über Behinderung spreche bzw. sie mit Menschen mit Behinderung persönlich konfrontiert werden. Wiederholt bekam ich zu Ohren: „Wieso Integration? – Die sind nun mal nicht die Norm, also sind sie doch in ihren Sondereinrichtungen besser aufgehoben.“
Während des Praktikums in der ‚Integrativen Kooperationsklasse’ von September 2002 bis März 2003 beobachtete ich, wie die Kinder nach anfänglicher Unsicherheit mehr und mehr ohne Scheu miteinander agierten. Dies hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Wenn die Kinder in der Lage sind derart unbefangen mit dem jeweils „Anderen“ umzugehen, warum bereitet uns dann die Frage nach der Notwendigkeit von Integration überhaupt Kopfzerbrechen?
In meiner Praktikumstätigkeit in der heilpädagogischen Tagesstätte habe ich versucht, Ansätze von Integration einfließen zu lassen. Wir (die Mitarbeiter der Tagesstätte) strebten eine Zusammenarbeit mit der Mittagsbetreuung der Grundschule und einen wöchentlichen Besuchstag der Mitschüler ohne Behinderung in der Tagesstätte an.
Zu meinem Bedauern musste ich jedoch immer wieder feststellen, welche vielfältigen bürokratischen und ideellen Barrieren es zu bewältigen gilt, wenn integrativ gearbeitet wird. Jedes Mal wenn wir Kinder von außen einladen wollten, mussten rechtliche und organisatorische Angelegenheiten wie Aufsichtspflicht und Versicherungsschutz aufs Neue geklärt werden.
Ein weiteres Hindernis ist der Punkt, dass die Kinder mit Behinderung nicht wohnortnah eingeschult sind, im Gegensatz zu den Kindern ohne Behinderung. Das heißt also, sie sind auf Kontakte am Schulort angewiesen. Wenn nun die Tagesstätte nicht integrativ arbeitet, wird beiden Seiten die Chance genommen, sich in der alltäglichen Begegnung näher zu kommen, voneinander zu lernen und Kontakte bis hin zu Freundschaften aufzubauen.
Dies alles ließe sich in Angriff nehmen. Aber das größte Hindernis aus meiner Sicht sind die festgefahrenen Vorurteile bzw. die Unsicherheiten von Eltern, Lehrern und sogar Kindern, bedingt durch die geringe Erfahrung im Umgang mit behinderten Kindern. Diese verhindern, dass eine gegenseitige Annäherung, sei es körperlich oder geistig, überhaupt erst zustande kommt.
Ich bin der Ansicht, dass die oben aufgezeigten Barrieren nur beseitigt werden können, indem die Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung gezielt gefördert und gefordert wird, mit der Folge, dass daraus ein regelmäßiger, alltäglicher Kontakt miteinander heranwächst .
„Wer Lebenswege behinderter Menschen nicht unmittelbar kennt, wird, ..., stark von verinnerlichten Meinungen (oft Vorurteilen) und von Vermutungen geleitet und dann in der Beurteilung leicht in die Irre gehen. ‚Es gibt keine Entdeckung ohne Begegnung’.“ (Krebs, 2002, S.42)
Ziel meiner Arbeit ist es, die Problematiken von Integration zu erörtern und zu analysieren sowie Wege einer gelingenden Integration aufzuzeigen, um schließlich mit dem Entwurf einer pädagogischen Konzeption die Grundlage für professionelles integratives Arbeiten zu schaffen.
Ich möchte in diesem Sinne versuchen, eine pädagogische Konzeption zu entwickeln, welche die integrative Arbeit in der heilpädagogischen Tagesstätte an der Melchior-Franck-Schule2 ermöglicht. Sie soll den Mitarbeitern als Grundlage für ihre pädagogische Arbeit dienen und ihnen Orientierung und Sicherheit geben.
Durch eine mögliche praktische Umsetzung der Konzeption möchte ich dazu beitragen, dass Unterrichtsschluss nicht zwangsläufig „Integrationsschluss“ sein muss.
Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich im Rahmen meiner Arbeit verschiedene Begriffe, Ansätze und Methoden der Integration von Kindern mit und ohne Behinderung darstellen sowie kritisch hinterfragen.
Zunächst kläre ich die für meine Arbeit grundlegenden Begriffe. Ich unterscheide die Ausdrücke ‚Konzept’ und ‚Konzeption’. Danach stelle ich verschiedene Definitionen von Behinderung und Integration vor und diskutiere sie. An dieser Stelle möchte ich insbesondere meine Vorstellung von Integration verdeutlichen, denn meine Auffassung über Behinderung und Integration ist Ausgangspunkt für den praktischen Teil meiner Diplomarbeit.
Anschließend zeige ich anhand der geschichtlichen Entwicklungen die Wurzeln, den gegenwärtigen Stand von Integration und aktuelle Trends in der integrativen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung auf.
Ausgehend von diesen Überlegungen werde ich bestehende Formen der Integration in Kindergarten, Schule und Freizeitbereich zusammenfassen und erläutern.
Im nächsten Schritt stelle ich vorhandene Konzepte vor, welche für die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern in Bayern relevant sein können und diskutiere Chancen und Grenzen der verschiedenen Ansätze in Hinblick auf ihren Einsatz in Integrativen Kooperationsklassen an Grundschulen in Bayern.
Den Schwerpunkt meiner Arbeit bildet der Entwurf der pädagogischen Konzeption für die integrative Kindertagesstätte, die – im Rahmen einer Grund- und Förderschule – Integration im Anschluss an den regulären Unterricht ermöglichen soll. Diese Konzeption werde ich auf Grundlage der rechtlichen, finanziellen, personellen und räumlichen Rahmenbedingungen der Tagesstätte der Außenklasse3 und der Mittagsbetreuung an der Melchior-Franck-Schule erstellen und sie dort für die praktische Umsetzung als Handlungsgrundlage zur Verfügung stellen.
2 Begriffsklärung
Falsche Begriffe führen zum Krieg
(Chinesisches Sprichwort)
In einem ersten Schritt werde ich grundlegende Begriffe klären, welche von Bedeutung sind für das inhaltliche Verständnis und die Transparenz meiner Arbeit.
2.1 Konzept versus Konzeption
Die Begriffe ‚Konzept’ und ‚Konzeption’ finden im sozialpädagogischen Sprachgebrauch des öfteren Anwendung und werden dabei nicht selten synonym verwandt. In diesem Kapitel versuche ich die Begriffe ‚Konzept’ und ‚Konzeption’ in ihrer Bedeutung voneinander abzugrenzen.
Zunächst unterscheide ich die beiden Begriffe anhand einschlägiger Lexika. Diese Verfahrensweise ist angelehnt an Hollmann und Benstetter (2001, S.29-30) in ihrem Buch „In sieben Schritten zur Konzeption“.
- Fremdwörterbuch (2004, S.307)
Ein ‚Konzept’ wird im Fremdwörterbuch übersetzt als ein Entwurf, eine erste, noch zu korrigierende Niederschrift oder die Vorstellung darüber, wie etwas getan werden soll. Die ‚Konzeption’ ist entweder ein Entwurf, ein Plan oder die genaue Vorstellung von einem zu erarbeitenden Werk.
- Duden (2000, S.567)
Laut Duden ist ein ‚Konzept’ ein Entwurf, eine erste Fassung oder ein grober Plan. Eine ‚Konzeption’ dagegen ist ein künstlerischer Einfall oder der Entwurf eines Werkes.
Fasse ich die Definitionen der Lexika zusammen, stellt ein Konzept demnach den ersten Entwurf oder den groben Plan einer Niederschrift dar, die Konzeption dagegen ist der Entwurf bzw. die grundliegende Idee zu einem Werk.
Um ein konkreteres und greifbareres Verständnis von den Begrifflichkeiten zu bekommen, betrachte ich in einem weiteren Schritt einige Definitionen verschiedener Autor(inn)en aus der Pädagogik.
Elisabeth Hollmann und Sybille Benstetter (2001, S.31) beschreiben den Begriff ‚Konzept’ als „eine vorläufige, zum Teil auch unbewusste, Grundlage nach der in einer Kita bzw. in ihrer Trägerorganisation gearbeitet wird.“ Eine ‚Konzeption‘ dagegen ist ihrer Meinung nach die reflektierte Antwort auf die Einflussfaktoren einer Kindertagesstätte bzw. ihrer Trägerorganisation. Sie enthält aufgabenbezogene pädagogische Ziele, entsprechende Umsetzungsschritte, sowie Entwicklungsziele für die Zukunft der Einrichtung . „Eine Konzeption ist das Ergebnis eines Prozesses der Bewusstmachung aller Beteiligten“ (ebd.).
Armin Krenz (1996, S.15) beschreibt ein ‚Konzept‘ als den ersten Entwurf einer offenen Planung von möglichen Zielen und Schwerpunkten. Es ist eher undifferenziert und umfasst oft nur Absichtserklärungen ohne klärende Beispiele. Als ‚Konzeption‘ bezeichnet er die „schriftliche Ausführung aller inhaltlichen Schwerpunkte, die in dem betreffenden Kindergarten/einer Kindertagesstätte für die Kinder, die Eltern, die MitarbeiterInnen selbst, den Träger und die Öffentlichkeit bedeutsam sind“ (ebd., S.14). Im Gegensatz zum Konzept spiegelt sie die Realität wieder und verzichtet auf bloße Absichtserklärungen. Ihre Aussagen sind für alle Mitarbeiter/innen verbindlich. „Jede Konzeption ist damit individuell und trifft in ihrer Besonderheit nur für diese spezifische Einrichtung zu, um das besondere Profil zu verdeutlichen und unverwechselbar mit anderen Institutionen zu sein“ (ebd., S.13-14).
Bei dem Gebrauch der Begriffe ‚Konzept’ und ‚Konzeption’ werde ich mich innerhalb dieser Arbeit an die Definitionen der oben aufgeführten Autor(inn)en anlehnen. Spreche ich künftig von einem Konzept, meine ich die vorläufige und teilweise unbewusste Grundlage einer Einrichtung. Spreche ich von einer Konzeption, dann in der Bedeutung eines individuellen und differenzierten Profils einer Einrichtung. Dieses sollte in schriftlicher Ausführung vorliegen und in seinen Aussagen für alle Mitarbeiter verbindlich sein.
In einem nächsten Schritt werden verschiedene bestehende Behinderungsbegriffe aufgezeigt und diskutiert.
2.2 Behinderungsbegriffe und ihre Integrationsrelevanz
In seinem Aufsatz „Behinderungsbegriffe und ihre Integrationsrelevanz“ erläutert Alfred Sander (2002, S.99), warum es notwendig ist, den Behinderungsbegriff klar abzugrenzen. Die Notwendigkeit ergibt sich demzufolge aus der Tatsache, dass Sonderpädagog(inn)en ‚Behinderung‘ immer noch als zentralen Gegenstand ihres Arbeitsfeldes betrachten, dass bis heute kein einheitlicher und allgemein anerkannter Behinderungsbegriff existiert und dass die verschiedenen Begriffe zudem unterschiedliche Auswirkungen auf die Integrationsmöglichkeiten der Betroffenen haben.
Der Sprachgebrauch der Behinderungsbegriffe hat demzufolge Einfluss auf die Chancen, aber auch die Formen der Integration von Menschen mit Behinderung. Aus diesem Grunde werde ich im folgenden Abschnitt zu den verschiedenen Begriffen eindeutig Position beziehen und deutlich machen, welche Auffassung meiner Vorstellung am nächsten kommt.
Ich werde in meiner Arbeit nicht nach geistiger und körperlicher Behinderung unterscheiden. Der Ausdruck „Mensch mit Behinderung“ umfasst jegliche Art von Behinderung. Dabei beziehe ich mich auf Alfred Sander (2002, S.100), der formuliert: „... die Bezeichnung ‚Behinderter’ ist heute ohne Zusatz sowohl in der Alltagssprache wie in der Rechtssprache üblich.“
2.2.1 Der medizinische Behinderungsbegriff
Ulrich Bleidick (1981, S.66) beschreibt in seinen vier Paradigmen der Behinderung unter anderem das personenzentrierte Paradigma. Behinderung wird von ihm als individuelle, meist medizinisch fassbare Kategorie definiert: ein absolut feststehender Defekt, ein unabänderliches und hinzunehmendes Schicksal. Nach medizinischem Verständnis wird die Relativität von Behinderung kaum betont. Die Ursachen werden in der Person gesucht (vgl. ebd.).
Erika Schuchardt (1996, S.17) nimmt in ihren Ausführungen Bezug auf Ulrich Bleidicks Modelle eines Behinderungsbegriffes. Sie unterscheidet in ihrer Definition gemäß Bleidick nach vier Kategorien und hebt auf diesem Wege hervor, wie aktuell dieser Ansatz auch heute noch ist.
Auch Hans Stadler (1996, S.167) definiert den Behinderungsbegriff nach medizinischem Verständnis. Behinderung ist demnach die „Folge von Krankheit oder Schädigung“. Bestimmte Leistungen, die zum durchschnittlichen Leben gehören, können nicht selbständig, nicht vollständig oder nicht im durchschnittlichen Zeitmaß erreicht werden. Abweichungen vom gleichaltrigen Entwicklungsstand und normierten Verhaltensweisen gelten als Defizite (vgl. ebd.).
Dieses Verständnis ist meiner Auffassung nach bedeutend für Betroffene und deren Angehörige, wenn es darum geht, bestimmte Therapien und Gelder zu erhalten. Es würde aber Personen mit Behinderung ihre Einzigartigkeit, ihre Subjektivität absprechen. Menschen in Kategorien einzuteilen ist unzureichend. Der Aspekt der Individualität eines jeden – mit und ohne Behinderung – bleibt hier jedoch unbeachtet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das medizinische Verständnis von Behinderung primär defizitorientiert auf Menschen mit Behinderung blickt. Integration wäre folglich nicht möglich, aber auch gar nicht notwendig, da es sich bei den Betroffenen um „medizinische Kategorien“ handelt, welche einzig und allein medizinische Hilfe benötigen.
Behinderung entsteht jedoch nicht zwangsläufig durch Krankheit oder Schädigung. Es gibt noch viele weitere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Die Erziehungswissenschaften haben den Begriff der Behinderung differenzierter betrachtet.
2.2.2 Der erziehungswissenschaftliche Behinderungsbegriff
Ich fasse den pädagogischen und den sonderpädagogischen Begriff der Behinderung unter dem erziehungswissenschaftlichen Behinderungsbegriff zusammen, da sie meiner Meinung nach von einem Großteil der Autoren weitgehend gleichbedeutend gebraucht werden.
Gemäß Alfred Sander (2002, S.104) genügte der aus dem Sozialrecht kommende Behinderungsbegriff dem wissenschaftlichen Anspruch theoretischer Sonderpädagogik nicht mehr. Es wurde vielmehr ein Zusammenhang zwischen Behinderung und Gesellschaft gesehen. Behinderung ist folglich nicht identisch mit einer medizinischen Kategorie und auch nicht linear von dieser abhängig, „sie wird von anderen, außer-individualen Bedingungen wesentlich mitbestimmt“ (ebd.).
Diese Auffassung hat in meinen Augen für die Pädagogik eine große Bedeutung. Behinderung gilt nun nicht mehr als unabänderlich, sondern kann durch Spezialisten angegangen werden, die an dem betreffenden Kind arbeiten.
Hans Stadler definiert den pädagogischen Behinderungsbegriff über bestehende Erwartungen in einer Gesellschaft. In Gesellschaften existiert nach Stadler (1996, S.167) eine „Minimalvorstellung über individuelle und soziale Fähigkeiten“. Entspricht ein Individuum diesen Vorstellungen nicht bzw. nur bedingt, dann wird dessen Behinderung offensichtlich. Sie wird zum sozialen Gegenstand. Entgegen dem medizinischen Verständnis ergibt sich Behinderung folglich aus sozialer Interaktion und Kommunikation. Diese Definition beachtet den Beziehungsaspekt und wird somit der Anerkennung der Würde des Menschen gerecht (vgl. ebd.).
Behinderung ist mehr als eine bloße medizinische Kategorie. Ich schließe mich den Autoren diesbezüglich an. Der Mensch mit Behinderung muss als Subjekt wahrgenommen werden, das sich von anderen gesellschaftlichen Subjekten in einigen Merkmalen unterscheidet, aber – wie ich finde - auch viel mit dem „Anderen“ gemein hat. In diesem Punkt liegt meiner Meinung nach das Problem des erziehungswissenschaftlichen Verständnisses von Behinderung. Es setzt trotz der Einräumung des Beziehungsaspektes in der praktischen Arbeit an den Defiziten der Menschen mit Behinderung an.
Im nächsten Abschnitt betrachte ich verschiedene normative Sichtweisen des Behinderungsbegriffs.
2.2.3 Das normative Verständnis von Behinderung
Unter dem normativen Behinderungsbegriff habe ich rechtliche Definitionen der Bundesregierung und der Weltgesundheitsorganisation sowie die Behinderung als Etikett und als Abweichung von der Norm zusammengefasst. Zunächst möchte ich auf die in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich verankerte Definition von Behinderung eingehen.
- Das Behinderungsverständnis der Bundesregierung
In §2 des neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) ist folgende Behinderungsdefinition festgehalten:
Abbildung 1: Behinderung nach §2 SGB IX
§ 2 Behinderung
(1 ) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Im Sinne der rechtlichen Definition sind die Merkmale von Menschen mit Behinderung an der betreffenden Person selbst zu suchen unabhängig von dessen Lernumfeld (vgl. Sander, 2002, S.101). Behinderung ist demnach die einfache, kausale Folge der Eigenschaften des Individuums (vgl. Humphreys, Müller, 1996, S.61).
Die gesetzliche Definition ist nicht nur Zustandsbeschreibung, sondern beeinflusst oft auch die rechtliche Situation von Menschen, die definitionsentsprechend als ‚behindert‘ anerkannt werden. Einerseits erhalten sie somit einen gewissen Anspruch auf Rechte und Hilfen (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite bewirkt dies in meinen Augen eine Stigmatisierung der Betroffenen, d.h. aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften gelten sie als behindert und werden als anormal abgestempelt.
Bei dieser Auffassung von Behinderung bleibt meines Erachtens, wie auch beim medizinischen Behinderungsverständnis, der Beziehungsaspekt vollkommen außer Acht. Ähnliches gilt für den dreistufigen Aufbau des Behinderungsbegriffes der Weltgesundheitsorganisation von 1980 (vgl. Stadler, 1996, S.167), welchem ich mich im nächsten Abschnitt widmen werde.
- Die Definitionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Die erste Definition von Behinderung der WHO – das ICIDH-1 - entstand 1980 und ging von einem defizitären Verständnis von Behinderung aus. Seit 2001 existiert eine Neufassung des WHO-Modells, welche nunmehr an den Defiziten sowie an den Ressourcen ansetzt.
Abbildung 2: Unterscheidung von ICIDH-1 (1980) und ICF (2001) der WHO (1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Stadler (1996, S.167) greift das Verständnis der WHO 1980 in seiner Definition von Behinderung auf. Er unterscheidet Schädigungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen. Eine Schädigung betrifft den organischen Bereich und zeigt sich in Mängeln und Abweichungen „der physiologischen, anatomischen und psychischen Strukturen und Funktionen des Körpers“ (ebd.). Beeinträchtigungen sind „Funktionseinschränkungen aufgrund von Schädigungen, die das Alltagshandeln erschweren oder unmöglich machen“ (ebd., S.168). Behinderungen sind die „Folge der Schäden und Beeinträchtigungen; sie schränken die Übernahme sozialer Rollen ein, ..., oder verhindern sie ganz.“ (ebd.).
Auch Heinz Krebs (1996, S.49) nimmt Bezug auf das Modell der WHO von 1980. Für ihn ist Behinderung jedoch nicht nur Krankheit, sondern ‚menschliche Seinsweise‘. Strukturelle Defekte bzw. funktionale Defizite beschreibe zwar genau die Behinderung, so der Autor, erfassen jedoch das Menschsein nicht. Fähigkeiten des Individuums bleiben nach Krebs mehr oder weniger unberücksichtigt. Er beschreibt Schädigung, Behinderung und Benachteiligung als die drei Ebenen, die notwendig sind, sich dem ‚menschlichen Behindertsein‘ anzunähern. Schädigung ist das akute „krankhafte Ereignis als organismisches Widerfahrnis“ (ebd.). Behinderung kommt nach Schädigung und ist stets Folge pathologischer Ereignisse. Benachteiligung stellt die zwangsläufige soziale Folge von Behinderung dar (vgl. ebd., S. 48-49).
Alfred Sander (2002, S.105-106) beschäftigt sich in seinen Ausführungen mit den alten WHO-Definitionen von 1980 sowie den neuen Verfassungsentwürfen der WHO von 1999 und 2000.
In der folgenden Abbildung5 sind die wesentlichen Unterschiede der beiden Definitionen zusammengefasst:
Abbildung 3: Unterscheidung von ICIDH-1 (1980) und ICF (2001) der WHO (2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Laut Sander (ebd.) werden in den neuen Definitionen die einfachen Kausalitätsannahmen zwischen Schädigung, Fähigkeitsstörung und sozialer Beeinträchtigung zugunsten einer realitätsnäheren, systemischen Sichtweise der Zusammenhänge aufgegeben. Funktionsfähigkeit wird dreidimensional verstanden: Körperfunktionen eines betroffenen Menschen, seine Aktivitäten und seine Partizipation. Gesundheitsbedingte Störungen auf diesen Ebenen werden mit dem Oberbegriff „Behinderung“ bezeichnet. Die Dimension Partizipation steht in dieser Dimension im Mittelpunkt und ist gleichbedeutend mit Integration (vgl. ebd.).
Die Weiterentwicklung des ICIDH-1 der Weltgesundheitsorganisation von einer Defizitorientierung zur Ressourcen- und Defizitorientierung kann meiner Meinung nach richtungweisend sein. Einerseits können so die sonderpädagogischen Leistungen für die Betroffenen gewährt werden und andererseits steht der Integration nichts im Wege.
Neben den rechtlichen Vorgaben gibt es in jeder Gesellschaft Vorstellungen darüber, was der Norm entspricht und was nicht. Wer den gesellschaftlichen Maßstäben nicht entspricht, wird von den „Normalen“ schnell in Kategorien eingeteilt. Der Mensch mit Behinderung erhält dementsprechend das Etikett „behindert“.
- Behinderung als Etikett
Humphreys und Müller (1996, S. 62-63) verdeutlichen die Brisanz dieser Definition von Behinderung: „Wesentlich beteiligt an der Dynamik des Behinderungsprozesses ist die Benennung, Bezeichnung, Etikettierung (...) behinderter Menschen nach ihrer jeweiligen Normabweichung.“ Mit ihr geht eine defizitorientierte, reduzierte Wahrnehmung ihrer Individualität und entsprechende ‚Attribuierungen‘ einher. Die volle Beurteilung wird erst transparent, wenn auch sachlich-zwingende Bedeutungsanteile beleuchtet werden. Dieses sind mit den Kennzeichen der Normabweichung einhergehende oder erzeugte Bewertungen, Emotionen, Verhaltensweisen und dessen Auswirkungen auf das Leben behinderter Menschen im Spannungsfeld zwischen Integration und Ausgrenzung (vgl. ebd., S.63).
James M. Kauffman (2004, S. 41-46) vertritt dagegen die Ansicht, das Einordnen in Kategorien und die damit verbundene Stigmatisierung sei insofern sogar wünschenswert, dass danach Unterstützungsleistungen berechnet werden. Behinderung sowie Umgang mit Stigmata sind Merkmale jeder Gesellschaft. Kauffman (ebd., S. 43) vergleicht das Stigma Behinderung mit dem Thema Krebs:
„Das Stigma Krebs ist nicht zurückgegangen, weil Menschen versucht haben, es zu verstehen oder mit Euphemismen zu verhüllen – „schöne“ Worte, die benutzt werden, einen unschönen Zustand zu beschreiben ... Es war eher so, dass das Stigma ... abgelöst worden ist, weil Menschen sich ermutigt fühlten, es als das anzunehmen, was es ist ... weder schön noch wünschenswert, nichts, was wir jemandem wünschen, den wir lieben.“
Mir fällt es schwer, einen Vergleich zwischen Krebs und Behinderung zu ziehen. Krebs ist eine Krankheit, die mit Medikamenten behandelt wird. Behinderung ist mehr als nur eine medizinische Kategorie. Das habe ich bereits in den vorangehenden Kapiteln herausgearbeitet.
Behinderung muss wahrgenommen werden, damit eine Gesellschaft die Betroffenen akzeptieren und unterstützen kann, hebt Kauffman (2004, S.45) hervor. Sprechen wir nicht direkt und offen über Behinderung, wird es uns nicht möglich sein, das Problem der Stigmatisierung anzupacken. „Euphemismen sind wie Mäntel, die nichts wirklich effektiv verhüllen oder verstecken. Sie sind eigentlich immer zwangsläufig stolpernde Lumpen, in denen sich die Prävention verfängt.“ (ebd.).
Kauffman (ebd., S. 44-45) beschließt seine Ausführungen mit dem Gedanken: „Eine bestimmte Haltung einzunehmen ist kein Ersatz für das Arbeiten. Die vorrangige Beschäftigung mit Äußerlichkeiten – ‚Mänteln’ – verschärft nur noch die Stigmatisierung und verhindert Prävention.“
Auch Mounira Daud-Harms (2002, S.62), selbst eine Frau mit Behinderung, warnt ausdrücklich davor, dass eine falsche Gleichmacherei nur die Formen der gesellschaftlichen Behinderungen verdrängt und somit auch die Bedingungen ihrer Aufhebung.
Natürlich sind Worte kein Ersatz für Taten, aber ich denke, es war eine lange und schwierige Entwicklung vom sogenannten ‚Schwachsinnigen‘ zum Menschen mit ‚sonderpädagogischen Förderbedarf‘. Dies ist nicht nur ein ‚Mantel‘, oder eine banale Äußerlichkeit, wie ich später an der historischen Entwicklung der Integration nachweisen möchte. Hinter dem Wandel der Begrifflichkeiten steckt vor allem ein Einstellungswandel gegenüber Menschen mit Behinderung.
Den Begriff der Behinderung als Etikett empfinde ich als besonders wichtig für die integrative Arbeit. Im Alltag begegnet man dem Phänomen der oft bewussten, aber auch unbewussten Etikettierungen und damit verbundenen Ausgrenzungen. Ich vertrete die Ansicht, jeder sollte genau überlegen, bevor er sein Gegenüber in eine Kategorie einordnet und in eine Schublade steckt. Unterstreichen möchte ich diese Aussage mit einem Zitat von Klaus von Lüpke (1994, S.19-20):
„Das Leben in seiner Fülle und in seiner Intensität gilt es zu fördern, statt zu behindern; die vielen Ausprägungen von Lebendigkeit gilt es mit Freude und mit Ehrfurcht zu achten, statt nach engen Maßstäben zu messen und zu beurteilen, zu kritisieren und zu diskriminieren; die Fülle des Lebens gilt es zu erschließen, zu aktivieren und zu intensivieren, statt einzuschließen, zurückzustoßen, zu verletzen.“
Aber warum fällt es nun so schwer, den Menschen mit Behinderung als individuellen und einzigartigen Menschen wahrzunehmen und zu akzeptieren? Die nächste Definition versucht dieser Frage auf den Grund zu gehen.
- Abweichung von der Norm
Stadler (1996, S.168) betont: „Behinderung ist keine ‚Minus-Variante des Normalen’, denn das ‚Normale’ an sich gibt es gar nicht; es ist nur als Bandbreite von Verhaltensweisen real, die von einer statistischen Mehrheit repräsentiert wird.“
Aber laut Weinmann (2003, S.9) wird Behinderung oft spontan als Anormalität identifiziert und wie alle von der Norm abweichenden Präsentationen und deren soziale Klassifikationen meist negativ gewertet.
Die Wahrnehmung und Differenzierung von Normalität und Anormalität, setzt „die Etablierung eines Normalfeldes“ (Link, 1997, S.75ff in: Weinmann, 2003, S.12) voraus. Das bedeutet die eine Seite kann ohne die andere Seite nicht existieren. Dominierend ist dabei die ‚Mitte‘, das statistisch ‚Durchschnittliche‘. Dieses gilt als ‚normal‘ und identifiziert das an den Rand gerückte Feld als ‚anormal‘ (vgl. Weinmann, 2003, S.12-13).
Nicht ‚behindert‘ zu sein ist jedoch gemäß Georg Feuser (1996a)6 nicht gleichbedeutend mit ‚Normalität‘. Wir nehmen das in den Augen Feusers nur aufgrund unserer definitorischen Macht als gesellschaftliches Attribut für uns in Anspruch.
Aber nicht nur Menschen mit Behinderungen ‚weichen von der Norm ab’, auch „Nicht-Behinderte“ haben Schwierigkeiten im Alltag. Die Probleme von Gehörlosen oder Rollstuhlfahrern sind bekannt. Ähnlich sind die Alltagsschwierigkeiten vieler anderer Menschen. So ist es beispielsweise für einen durch Arthrose geschwächten Menschen unmöglich, ein Marmeladenglas zu öffnen oder für kleinwüchsige Personen, mit Fahrkartenautomaten umzugehen. Der Glasverschluss wurde für eine andere Norm der Fingerkraft, der Automat für eine andere Norm der Körpergröße konzipiert (vgl. Humphreys, Müller, 1996, S. 62).
Solche Beispiele sollten meiner Meinung nach Anregung sein für eine Grundsatzdiskussion über bestehende Normen und darüber, wer solche Normen überhaupt festlegt. Oder um es mit den Worten Feusers (1996a) zu sagen:
„Wer hat hier ein Zuschreibungsrecht gegenüber dem anderen? Sind, wenn wir ein solches dem ‚behinderten’ Menschen ge genüber in Anspruch nehmen, die Verhältnisse nicht eher auf den Kopf gestellt?“
Im folgenden Abschnitt verdeutliche ich, wie Alfred Sander, Georg Feuser und Erika Schuchardt versuchen, einen umfassenderen Behinderungsbegriff abzubilden.
2.2.4 Behinderung als „Systemfolge“
Die Autor(inn)en betrachten Behinderung unter einem systemischen Blickwinkel. Dieser beinhaltet weit mehr als die vorangehenden Definitionen. Er umfasst den Menschen als Subjekt in seiner individuellen Umwelt.
Alfred Sanders (2002, S.106) formuliert den „ökosystemischen Behinderungsbegriff für die Integrationspädagogik“ als neues Verständnis von Behinderung. Das beachtet neben den defizitären Eigenschaften der Person „auch die sorgfältige Erfassung der Umweltgegebenheiten und ihre Einbeziehung in den pädagogischen Handlungsplan.“ (ebd.) Der Mensch lebt in einem sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und materiellen Umfeld. Diese vielschichtigen Faktoren existieren nicht unabhängig von dem betreffenden Menschen, sondern stehen in einem Systemzusammenhang: dem Person-Umfeld-System (vgl. ebd.).
Sanders ökosystemisches Verständnis steht der neuen Definition der WHO nahe und stützt integrationsorientiertes Denken. Eine gestörte oder ungenügende Integration ist nach diesem Begriffsverständnis nicht die Folge oder ein Aspekt von Behinderung, sondern die Behinderung selbst. Das bedeutet für handelnde Pädagogen, selbst wenn sich die Schädigung oder Leistungsminderung der pädagogischen Beeinflussung entzieht, können doch Umfeldbedingungen dahingehend verändert werden, dass der Betroffene weniger behindert ist als zuvor (vgl. ebd., S.106-107).
Georg Feuser (1996a)7 versteht Behinderung als ein entwicklungslogisches - und nicht pathologisches - Produkt der Systemevolution eines Menschen, unter den für ihn gegebenen Ausgangs- und Randbedingungen seiner Existenz, die er nach Maßgabe der Mittel seines Systems in dieses integriert. Was wir an einem Menschen als gering achten und abqualifizieren, in der Regel als defizitär betrachten (also dessen Behinderung), ist Ausdruck der Kompetenz, lebensbeeinträchtigende Bedingungen zum Erhalt der individuellen Existenz im jeweiligen Milieu ins System zu integrieren. Jede Form von Behinderung ist unter bestimmten Bedingungen existentiell notwendig (vgl. ebd.).
Erika Schuchardt beschreibt Behinderung als nichts Absolutes und exakt Definierbares, was den konventionellen Beurteilungen unterliegt. Der Behinderungsbegriff wird aus den verschiedenen Deutungsmustern wechselnder historischer und gesellschaftlicher Wirklichkeiten lebenslang neu geboren und ist somit etwas Relatives. Schuchardt (1996, S.17) verdeutlicht ihre Aussage anhand der verschiedenartigen englischen Übersetzung des Begriffs ‚Behinderung’: Lange Zeit verwendete man den Begriff ‚dis-abled’, was soviel heißt wie ‚un-fähig’. Schuchardt bevorzugte: ‚affectet persons’, d.h. betroffene Menschen. Heute wird der Ausdruck ‚differently-abled’ bevorzugt: verschiedenartig-fähig’.
Ich möchte mich Sanders ökosystemischen Verständnis von Behinderung anschließen und der damit verbundenen Chance, Behinderung dadurch zu beeinflussen, dass an den konkreten Umweltbedingungen integrationsorientiert gearbeitet wird. Diese Sichtweise eröffnet meiner Meinung nach neue Perspektiven für die theoretische und praktische integrative Arbeit.
2.2.5 Auswirkungen auf die Integration
Zusammenfassend möchte ich Ulrich Bleidick (1989, S. 67) zitieren, der meines Erachtens treffend formuliert:
„Die verschiedenen Begriffe der Behinderung bilden Zugangsweisen der Betrachtung. Sie sind Perspektiven: nicht auf Vollständigkeit hin angelegt, untereinander nicht klar abgegrenzt, für sich jeweils Theorien begrenzter Reichweite. Ihre systemimmanenten ‚Teilrichtigkeiten’ geben zusammen so etwas wie eine multifaktorielle Sicht des Phänomens Behinderung ab.“
Vergleicht man die unterschiedlichen Definitionen von Behinderung in ihrer Wirkung auf integrative Prozesse, so wird ersichtlich: Je nach Betrachtungsweise ändert sich auch der Umfang des Personenkreises, der integriert werden soll (vgl. Stadler, 1996, S. 168).
Die verschiedenen Behinderungsbegriffe können laut Sander (2002, S.99) im weitesten Sinne sogar Folgen für die betroffenen Personen hinsichtlich ihrer Integration nach sich ziehen.
Wer also über Integration schreibt oder integrativ arbeitet, sollte sich in meinen Augen auch darüber im Klaren sein, welches Behinderungsverständnis er vertritt. Zudem ist es unerlässlich, sich mit den verschiedenen Definitionen von Integration auseinander zu setzen. Der nächste Teil widmet sich diesem Thema.
2.3 Integration: Ein Begriff – viele Bedeutungen
2.3.1 Allgemeines
Beim Durchlesen einiger Werke bekannter Autoren zum Thema „Integration von Menschen mit Behinderungen“ musste ich erkennen, dass es weder eine einheitliche Definition noch die einzig geltende Meinung zum Begriff Integration gibt. Aus diesem Grunde werde ich versuchen, dem Thema zunächst über eine kurze sprachliche Analyse näher zu kommen.
Durch die Gegenüberstellung von vorhandenen Definitionen des Begriffes ‚Integration’ in unterschiedlichen Lexika möchte ich ein erstes Bild darüber bekommen, in welchen Zusammenhängen das Wort in der deutschen Sprache verwendet wird. Denn wie Bleidick (1988, S.12) sagt:
„Wir entdecken zunächst einen unterschiedlichen Gebrauch des Wortes Integration, und wir erschließen aus dem weiteren Zusammenhang, daß der jeweiligen Wortwahl auch verschiedenwertige inhaltliche Vorstellungen von Integration entsprechen.“
- Duden (2000, S.502)
Im Duden steht ‚Integration’ für Vervollständigung, Eingliederung und Vereinigung. Das Verb ‚integrieren’ bedeutet so viel wie ergänzen oder eingliedern. ‚Integrierend’ ist ein anderer Ausdruck für notwendig, zu einem Ganzen gehörend.
- Fremdwörterbuch (2004, S.254)
‚Integration’ laut Fremdwörterbuch bedeutet die Verbindung zu einer Einheit, die Herstellung eines Ganzen, der Zusammenschluss, die Vereinigung oder die Einbeziehung in ein größeres Ganzes. ‚Integrieren’ heißt, etwas zu einem Ganzen vereinigen, zu einer Einheit verbinden bzw. in ein größeres Ganzes einbeziehen. Der Begriff ‚integrierend’ meint unbedingt notwendig und für das Ganze unerlässlich.
Zusammengefasst wird deutlich: Integration kann einerseits die Eingliederung in ein größeres Ganzes und andererseits der Zusammenschluss zu einem größeren Ganzen sein.
Emil E. Kobi (1990, S.58-59) diskutiert in seinen Ausführungen die beiden Positionen. Einmal wird Integration dargestellt als gegenseitiger Lern- und Annäherungsprozess zwischen ‚Integratoren‘ und ‚Integranden‘, der in jedem Moment durch Interaktion neu hergestellt werden muss und nie endgültig abgeschlossen ist. Auf der anderen Seite wird Integration aufgefasst als Ein- bzw. Unterordnung des ‚Integranden’ – also des behinderten Kindes – in oder unter den ‚Integrator’ - das Schulsystem. Dabei ist ein gewisses Entgegenkommen nicht auszuschließen.
Ich möchte zunächst Ulrich Bleidicks Definition des Integrationsbegriffes darstellen, welche bis heute in der Fachliteratur von großer Relevanz ist.
2.3.2 Ulrich Bleidicks Operationalisierung des Integrationsbegriffs
Bleidick (1988, S.57) formuliert einleitend eine allgemeine Definition von Integration: „Unter Integration wird - pauschal - in pädagogischen Fachkreisen die gemeinsame Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Schüler verstanden.“ Diese Definition muss gemäß Bleidick (ebd., S.59) operationalisiert werden: „Es ist mithin gewünscht, den Gebrauch des uneinheitlichen Schlagwortes Integration durch präzise Begriffsbestimmungen abzulösen.“ Der Autor differenziert den Begriff folgendermaßen:
-Integration als Ziel und Mittel
-Dialektik von Integration
-Bereiche der Integration
-Stufen der Integriertheit
-Selektive Integration
-Totale Integration
-‚Echte’ Integration
- Integration als Ziel und Mittel
Bleidick (1988, S.66-67) betont, dass die Unterscheidung von Integration als Ziel und Mittel für ihn zweifellos die Wichtigste darstellt:
„Integration als Ziel meint die bestmögliche Teilhabe des Behinderten an Familie, Beruf, Öffentlichkeit und seine Selbstzufriedenheit. Integration als Mittel ist gemeinsame Erziehung von Behinderten und Nichtbehinderten.“
Im zweiten Fall sind Ziel und Mittel identisch. Integriertheit soll durch Integration erreicht werden. Integration als Ziel dagegen kann paradoxerweise sowohl durch Integration als auch durch Separation angestrebt werden. Und genau dies ist das Programm der segregierenden Sonderschulen. Kurz gesagt: „Über das Ziel ist man sich einig, nicht über den Weg.“ (ebd., S.67).
- Dialektik von Integration
Die Dialektik von Integration ist gemäß Bleidick (ebd., S.68) der wechselseitige Zusammenhang verschiedener Stufen und Bereiche von Integration. Diese Wechselwirkung wird zumeist in Form einer Hypothese unterstellt: Integration im Schulbereich verbessert auch die Eingliederung in den übrigen Lebensbereichen.
- Bereiche der Integration
Bei Betrachtung von Integration als bestmögliche Eingliederung Behinderter lassen sich laut Bleidick (ebd.) folgende Bereiche unterscheiden:
-Familie
-Spielgruppe
-Jugendgruppe
-Wohnung
-Nachbarschaft
-Öffentlichkeit
-partnerschaftliche Lebensbeziehung
-Kindergarten
-Schule
-berufsbildende Institutionen
-Berufs- und Arbeitsplatz
Dabei bedeutet eine Eingliederung in den einen Bereich nicht gleichzeitig die Eingliederung in die anderen Bereiche. (vgl. ebd.)
Um keine ‚Integrationsinseln’ entstehen zu lassen, kann man nach Bleidick (ebd.) die verschiedenen Bereiche von Integration auch in aufeinanderfolgenden Phasen darstellen:
-Vorschulzeit
-Schule
-Berufsbildung
-Erwachsenenwelt
„Ebenso wie keine Integrationsinseln entstehen sollen, müßte die Kontinuität des Beieinander von Behinderten und Nichtbehinderten in allen Phasen gesichert sein.“ (ebd., S.69) Außerdem sollte man so früh wie möglich mit einer gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder beginnen, denn die ersten gelungenen Integrationsversuche erfolgten im Kindergarten (vgl. ebd., S.69-70).
- Stufen der Integriertheit
Integration in Sinne der vollständigen Integriertheit ist ein Ideal und kann nicht immer als konkretes Ziel erreicht werden, so Bleidick (1988, S.71): „Integration sollte keine Alles-oder-nichts-Forderung sein, sondern sich realistisch auf Stufen der Verwirklichung einstellen.“ Der Autor beschreibt zur Illustration verschiedene Modelle. Eins davon sind die drei Stufen der Integriertheit in Anlehnung an die Empfehlung des Bildungsrates 19738 (ebd.):
-Vollintegration
-Teilintegration
-Begegnung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten
Bleidick betrachtet die Abstufungen als Kompromiss zwischen den progressiven Tendenzen und eher verharrenden Konzepten. Er betont: „Letztlich sind die angeführten Stufen der Integration aber nicht allesamt als Rangstufen von der vollen über die teilweise bis zur unvollständigen Integriertheit anzusehen.“ (ebd., S.74) Sie beschreiben vielmehr die heute vorkommenden Organisationsmodelle des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Schülern (vgl. ebd.).
- Selektive Integration
Entsprechend dem selektiven Ansatz von Integration werden nach Bleidick (ebd., S.76) bestimmte Gruppen von Behinderten aus laufenden Integrationsprojekten und praktischen Schulversuchen ausgeschlossen.
- Totale Integration
Im Sinne der „Schule ohne Aussonderung“ steht dieser Ansatz dem der Teilintegration oder der selektiven Integration gegenüber. Jegliche Einschränkung wird abgewehrt. Aber: „Die ideologische Behauptung ‚Es gibt keine unüberwindlichen Grenzen der Integration von Behinderten’ widerspricht als normative Forderung den tatsächlichen Erfahrungen.“ (ebd., S.77). Die totale Integration stellt somit ein Ziel bzw. ein Ideal dar, das es zu verwirklichen gilt. Dies kann einerseits wertvoll sein und motivierend wirken, andererseits erzeugt es bedenkliche Illusionen. Betroffenen Eltern und Behinderte überkommt ein Gefühl der Wut, wenn der überzogene Anspruch nicht eingelöst werden kann (vgl. ebd.).
-„ Echte“ und scheinbare Integration
Bleidick (ebd., S.82) erachtet eine Unterscheidung zwischen echter und unechter Integration für falsch:
„Wenn ich politische und administrative Definitionsmacht hätte, würde ich entscheiden: den Begriff Integration gar nicht zu verwenden. Wenn ich einen Behinderten als Freund akzeptiere, ihn in meinem Betrieb einstelle, ihn heirate oder ihn gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern in meiner Schulklasse unterrichte, dann kann ich das präzise so benennen, wie ich das gerade getan habe. Der Begriff Integration ist als Schlagwort eine unnötige Worthülse. Ich akzeptiere, unterrichte einen Behinderten oder nicht. Von ‚echt’ oder ‚unecht’ kann da keine Rede sein.“
Zusammengefasst ist Integration im Sinne Bleidicks (ebd., S.83) „eine subjektive und tatsächliche Eingliederung des Behinderten in den Sozialverband der Nichtbehinderten auf einem Kontinuum von Möglichkeiten, die zwischen den Polen von vollständigem Angenommensein und vollständiger Isolierung auszumachen ist.“
Meiner Meinung nach hat Ulrich Bleidick eine sehr ausführliche Definition des Integrationsbegriffes entwickelt und aufgezeigt, wie komplex das Thema in Wirklichkeit ist. Autoren wie Emil E. Kobi haben die Definition von Ulrich Bleidick in einigen Punkten wieder aufgegriffen. Kobi präsentierte einen noch detaillierteren Integrationsbegriff, indem er Gegensatzpaare bezüglich der sozialen Integration unterschied. Im folgenden Kapitel möchte ich seine Integrationsdefinition von 1990 vorstellen, welche beispielsweise von Gottfried Biewer im Jahre 2001 zur Begriffsklärung von Integration herangezogen wurde.
2.3.3 Die sieben Gegensatzpaare von Emil E. Kobi
Emil E. Kobi (1990, S.58ff) fasst die wichtigsten Positionen, die in der Diskussion um schulische Integration Behinderter anzutreffen sind, in sieben begriffsinhaltlichen Gegensatzpaaren zusammen:
-Prozess vs. Zustand
-Methode vs. Ziel
-Individuale vs. soziale Angelegenheit
-Vorgabe vs. Aufgabe
-Parzellierbare vs. ganzheitliche Daseinsform
-Struktur vs. Wert
-Intentionale vs. koexistentielle Lebens- und Daseinsgestaltung
Ich werde nun schildern, was der Autor unter dem jeweiligen Gegensatzpaar versteht und welche Positionen er bezieht.
- Prozess vs. Zustand
Kobi beschreibt Integration als Prozess der gegenseitigen Annäherung und des beiderseitigen Lernens von ‚Integratoren’ und ‚Integranden’, der nie endgültig abgeschlossen ist. Dieser Prozess ist planbar und steuerungsbedürftig, aber enthält stets Unsicherheitskomponenten.
Demgegenüber steht seiner Meinung nach Integration als Zustand von relativer Dauer und Beständigkeit, der jedoch eher personenunabhängige Tatbestände wie administrative, ökologische und organisatorische Rahmenbedingungen betrifft.
Kobi (ebd., S.58) vereinigt beide Standpunkte in einer Definition:
„Integration kann demgemäß als homöostatisches, labiles Fließgleichgewicht bezeichnet werden, das in jedem Moment durch Interaktion neu hergestellt werden muß. Der dynamisch wechselnde Integrationsgrad wäre somit abzulesen am Umfang, an der Intensität sowie der Häufigkeit sozialer Austauschprozesse.“
[1] Sonder-(Förder-)schulklasse und Klasse einer allgemeinen Schule (z.B. Grundschule) werden gemeinsam unterrichtet, Das Ausmaß des gemeinsamen Unterrichtes kann von einzelnen Stunden bis hin zur gesamten Unterrichtszeit reichen.
[2] Angegliedert an die Melchior-Franck-Schule Coburg (Grund- und Teilhauptschule).
[3] Als Außenklassen werden Klassen einer Sonder -(Förder-)schule bezeichnet, die räumlich aus der Förderschule aus- und an eine allgemeine Schule (z.B. Grundschule) angegliedert werden. Organisatorisch sind die ausgelagerten Klassen und das darin tätige Personal weiterhin der Förderschule unterstellt.
[4] Vgl. Ausbildungsmaterial der WHO: ICF-Folien.ppt (05.3.2004), Online im WWW unter URL: www.vdr.de (30.04.2004).
[5] Vgl. Ausbildungsmaterial der WHO: ICF-Folien.ppt (05.3.2004), Online im WWW unter URL: www.vdr.de (30.04.2004).
[6] Vgl. Feuser, G.: „Geistigbehinderte gibt es nicht !“. Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration (1). (1996), Online im WWW unter URL: http://www2.uibk.ac.at/bidok/ library/schule/feuser-geistigbehinderte.bdkb (30.04.2004)
[7] Vgl. Feuser, G.: „Geistigbehinderte gibt es nicht !“. Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration (1). (1996), Online im WWW unter URL: http://www2.uibk.ac.at/ bidok/ library/schule/feuser-geistigbehinderte.bdkb (30.04.2004)
[8] Genaueres zu den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates in Kapitel 4.3.2.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Sozialpäd. Nadine Schuster (Autor:in), 2004, Pädagogische Konzeption für eine integrative Tagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52367
Kostenlos Autor werden









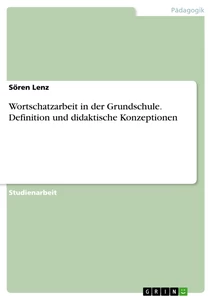













Kommentare