Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Ansätze der Partnerwahl
2.1 Ansätze der rationalen Wahl
2.1.1 Familienökonomischer Ansatz
2.1.2 Austauschtheorie
2.2 Strukturtheoretische Ansätze
2.2.1 Die Strukturtheorie (Blau)
2.2.2 Die Fokustheorie (Feld)
2.2.3 Gelegenheitsstrukturen und individuelle Handlungsorientierung (Blossfeld & Timm)
3. Empirische Strukturierung der bildungswegspezifischen Partnerbeziehungen
3.1 Absolute und relative Homogamieraten der Heiratsbeziehungen
3.2 Studie: Gelegenheit macht Liebe – die Wege des Kennenlernens und ihr Einfluss auf die Muster der Partnerwahl
4. Mögliche Strukturierung von Partnerwahlen durch Bildungswege
4.1 Überlegungen zu bildungswegspezifischen Gelegenheitsstrukturen der Partnerwahl
4.1.1 Gelegenheitsstrukturen in allgemeinbildende Institutionen
4.1.2 Gelegenheitsstrukturen in Ausbildungsinstitutionen
4.2 Gelegenheitsstrukturen in Arbeitssituationen 20
5. Gelegenheitsstrukturen und Präferenzen durch Soziale Differenzierung 20
6. Schlussbetrachtungen
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Muster der Partnerwahl und Heiratsbeziehungen sind bedeutende Sozialstrukturen einer Gesellschaft. So können sie die soziale Schichtung wesentlich beeinflussen und somit die Veränderung der sozialen Ungleichheit über Generationen hinweg mitbestimmen. Überzufällig finden Menschen zusammen, die sich in Bezug auf soziostrukturell relevante Merkmale, wie Herkunft, Bildung, Alter oder Konfession gleichen. Insbesondere lässt sich eine hohe Bildungshomogamie, d.h. eine Tendenz zur Wahl von Partnern mit gleichen oder zumindest ähnlichen Bildungsabschlüssen feststellen. Ich möchte mit dieser Hausarbeit der Frage nachgehen, wodurch die bildungsspezifische Ähnlichkeit von Ehepaaren, die sich auf der gesellschaftlichen Ebene in dem Anteil bildungshomogamer bzw. heterogamer Partnerwahlen und Heiraten wieder spiegelt, entstehen kann. Dabei interessiert mich besonders, welche möglichen strukturellen Auswirkungen die Bildungswege auf die Partnerwahl haben. Deshalb werde ich zunächst Partnerwahl relevante Theorien vorstellen (Abschnitt 2). So werden neben theoretischen Ansätzen der rationalen Wahl strukturtheoretische Ansätze skizziert. Im Anschluss wird die empirische Strukturierung der bildungsspezifischen Partnerbeziehungen dargestellt (Abschnitt 3.1). Damit Individuen Partnerschaften eingehen können, müssen sie zunächst die Möglichkeiten haben, sich überhaupt zu treffen.[1] Neben den Bildungsinstitutionen als bedeutsame Wege des Kennenlernens werden in der Studie von Klein & Lengerer (2001) „Wege des Kennenlernens“ weitere Möglichkeiten derselben und deren Einfluss auf die Bildungs- und Altershomogamie von Partnerschaften analysiert. (Abschnitt 3.2) Da besonders Partner, die sich im Bildungssystem kennen gelernt haben, eine hohe Bildungshomogamie aufweisen[2], möchte ich ausgehend von strukturellen Erklärungsansätzen den Aspekt der bildungswegspezifischen Strukturierung der Gelegenheiten, das „meeting“ diskutieren. Die Fragen nach der bildungswegsspezifischen Vorstrukturierung des „meetings“ und „matings“ innerhalb der allgemeinbildenden und Ausbildungsinstitutionen sowie der aus den begangenen Bildungswegen resultierenden Vorstrukturierung des „meetings“ und „matings“ außerhalb denselben, sind zwar sehr interessant, scheinen dabei aber eine sehr umfangreiche, den Rahmen einer Hausarbeit sprengende, Bearbeitung zu benötigen. Deshalb werde ich versuchen, mich auf das „meeting“ zu beschränken. So werden soziale Kontaktchancen nach allgemeinbildenden Institutionen, Ausbildungsinstitutionen, Arbeitssituationen (Abschnitt 4) und resultierender sozialer Differenzierung (Abschnitt 5) diskutiert. Abschließend werden die Betrachtungen zusammengefasst (Abschnitt 6).
2. Theoretische Ansätze der Partnerwahl
In diesem Abschnitt werde ich zunächst den familienökonomischen Ansatz von Becker und den austauschtheoretischen Ansatz skizzieren. Dann werden die strukturtheoretischen Ansätze von Blau (1994) und Feld (1981) und das Erklärungsmodell von Blossfeld & Timm (1997), in dem Elemente des normativen Ansatzes integriert sind, vorgestellt. Sozialpsychologische Ansätze werden hier nicht diskutiert.
2.1 Ansätze der rationalen Wahl
Die theoretischen Perspektiven der beiden folgenden Ansätze sind durch eine individualistische Sichtweise gekennzeichnet, in der die bildungsbezogene Partnerwahl primär als ein Ausdruck individueller Motive, Vorlieben und Präferenzen erklärt wird. Dabei wird über das Konzept des Partnermarktes aber auch den strukturellen Rahmenbedingungen Rechnung getragen.
2.1.1 Familienökonomischer Ansatz
Die von Gary S. Becker (u.a. 1991) entwickelte familienökonomische Theorie versucht das Partnerwahlverhalten aus mikroökonomischer Sicht zu erklären. Es werden dabei rationale, nutzenmaximierende Akteure unterstellt, die nach Kosten- und Nutzenerwägungen rationale Partnerwahlentscheidungen treffen. Der Nutzen von Partnerschaften, Ehen und gemeinsamen Haushalte wird über die Bedürfnisbefriedigung durch die gemeinsame Produktion von Gütern (commodities) erklärt.[3] Umso mehr Güter in diesen Gemeinschaften produziert werden, desto höher ist die Bedürfnisbefriedigung und somit der Nutzen der Gemeinschaft (der Ehegewinn) für die Partner. Solche Güter können neben emotionaler Zuneigung, gegenseitiger Fürsorge und materieller Sicherheit vor allem auch Kinder sein, die einen wichtigen Heiratsgrund darstellen können.[4] Durch die Zusammenlegung der partnerspezifischen Ressourcen (Ressourcen-pooling) wird eine Arbeitsteilung und Spezialisierung ermöglicht. Durch diese können Güter produziert werden, die entweder auf dem freien Markt nicht, oder zu einem höheren Preis erhältlich sind. Partnerschaften stellen somit langfristige Vertragsbeziehungen dar, in denen Güter effizient und kostengünstig produziert werden können. Das klassische Beispiel für diese Spezialisierung ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Der männliche Partner ist erwerbstätig und die Ehefrau konzentriert sich auf die Erziehung der Kinder und den Haushalt. Damit die Partnerschaft effizient gestaltet werden kann, ist es deshalb notwendig, das sich Individuen finden, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Ressourcen besonders gut zueinander passen. Becker unterscheidet dabei zwischen komplementären und substitutiven Eigenschaften. Erste können Eigenschaften wie ähnliche Erziehung, Sozialisation, Intelligenz, körperliche Attraktivität und Konfession sein, die durch eine positive Korrelation einen positiven Effekt auf den Ehegewinn haben sollten. Zweite können Eigenschaften wie das Erwerbeinkommenspotential sein, das durch eine negative Korrelation einen positiven Effekt auf den Ehegewinn haben sollte.
Das Bildungsniveau wird primär im Sinne von kulturellem Kapital als komplementäre Eigenschaft verstanden, welche Homogamiepräferenzen fördert. Nach dem Modell der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sollte das Erwerbseinkommen der Partner negativ korrelieren. Erwerbseinkommen korreliert in aller Regel hoch mit dem Bildungsniveau. So kann es im Sinne von arbeitsmarktverwertbarem Humankapital als substitutiv wirkendes Merkmal angesehen werden, welches dann bei einer „optimalen“ Partnerwahl negativ korrelieren sollte.[5]
Damit die Partner sich finden können, müssen sich auf Heirats- bzw. Partnermärkten suchen, auf denen die Wahloptionen u.a. durch die Struktur der Geschlechterverteilungen eingeschränkt sind. Insofern ist hier schon ein Element sozialstruktureller Ansätze enthalten. Bei der Suche handelt es sich um einen Wettbewerb, d.h. Männer konkurrieren um Frauen und letzte konkurrieren wiederum um Männer. Die Suche ist durch Unsicherheit über die oft nicht direkt erkennbaren Eigenschaften des potentiellen Partners (begrenzte Information) und durch Suchkosten, die knappe Ressourcen, wie Zeit und Geld tangieren, eingeschränkt. In individuellen Akten werden je nach geschlechts-, bildungs- und herkunftsspezifischen Präferenzen, diejenigen Partner gewählt, die durch ihre spezifischen Eigenschaften und Ressourcenausstattungen den maximalen Ehegewinn erwarten lassen.
2.1.2 Austauschtheorie
Im Zentrum von austauschtheoretischen Ansätzen steht die soziale Interaktion und die Aufnahme, Aufrechterhaltung und Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen (Blau 1964, 1994; Thibaut & Kelley 1959; Homans 1969)
In Analogie zum familienökonomischen Ansatz wird in der Austauschtheorie der Prozess der Partnerwahl mit dem Marktgeschehen verglichen, das heißt, das auch hier die soziostrukturellen Rahmenbedingungen nicht unberücksichtigt bleiben. Dabei wird hier eher die Betonung auf den belohnenden Charakter der Interaktion selbst und nicht auf die Nutzenmaximierung durch Güterproduktion gelegt.[6]
Demnach beruht der Prozess der Partnerwahl auf dem Prinzip „Geben und Nehmen“, d.h. einem wechselseitigen Austausch von Ressourcen, welcher der individuellen Bedürfnisbefriedigung dient. Die Partner müssen dafür über solche Ressourcen verfügen, die das Gegenüber als attraktiv wahrnimmt. Die ausgetauschten Güter können unterschiedlicher Art sein, z. B. soziale Anerkennung, Fürsorge, Freundschaft, Zuneigung und materielle Sicherheit. So kann z. B. materielle Sicherheit gegen emotionale Fürsorge getauscht werden, wobei der jeweilige Wert der Ressource als äquivalent und somit als individuell befriedigend wahrgenommen werden kann. Thibaut und Kelley (1959) gehen davon aus, das die Kosten und der Nutzen der Tauschbeziehung anhand von wahrgenommenen Alternativen bilanziert werden. Mit diesem Modell ist es auch vereinbar, das beispielsweise Männer und Frauen, die ein ähnliches Bildungsniveau und ein ähnliches Einkommenspotential haben eine Verbindung eingehen, sofern sie den Austausch dieser Ressourcen als wechselseitig belohnend wahrnehmen.
2.2 Strukturtheoretische Ansätze
In dieser Theorieperspektive wird davon ausgegangen, das Personen sich nicht zufällig begegnen, sondern das sozial strukturierte Gelegenheiten die Häufigkeit des Treffens sich ähnelnder Personen bestimmen. Die Perspektive sozialer Netzwerke wird hier ausgespart.
2.2.1 Die Strukturtheorie von Blau
Die Sozialstruktur der Gesellschaft bildet das zentrale Konzept und den Ausgangspunkt der Überlegungen bei Blau. (Blau, 1994)[7] Sie wird dabei in einem engeren Sinne konzeptionalisiert als Verteilung der Bevölkerung auf verschiedene soziale Positionen. Die Makrostruktur der Gesellschaft entspricht dann einem mehrdimensionalen Raum von sozialen Positionen, die nach verschiedenen Merkmalen auf die Personen verteilt sind und die ihre sozialen Beziehungen in starkem Maße determiniert. Die Variation von Merkmalsausprägungen über graduelle Parameter, die sich auf Eigenschaften mit einer angebbaren Rangordnung beziehen, wie Bildung und Einkommen erzeugt die vertikale, ungleiche Differenzierung von sozialen Gruppen einer Gesellschaft. Merkmalesverteilungen hinsichtlich kategorialer Parameter wie Geschlecht oder Konfession bestimmen die horizontale Heterogenität einer Gesellschaft. Das Ausmaß, in dem die soziale Differenzierung auf einem Merkmal nun mit einer Unterscheidbarkeit in einer anderen Hinsicht zusammenhängt, d.h. inwiefern sich durch Merkmalsausprägungen gebildeten sozialen Schichten oder Kreise überschneiden bestimmt die Geschlossenheit einer Gesellschaft.
Diese sozialen Kreise bestimmen die Möglichkeiten und Chancen, Kontakte innerhalb und außerhalb einer sozialen Position zu erhalten. So werden Bekanntschaften, Freundschaften und auch Ehen umso unwahrscheinlicher, je größer die Statusdistanzen zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen ist. Mit zunehmender Distanz verändern sich die jeweiligen Lebenschancen, wie Unterschiede der Lebensgestaltung und der Lebensstil und somit auch die Wahrscheinlichkeit einer Eheschließung. Makrotheoretisch können somit unter anderem über Bildungswege homogame Partnerwahlen beeinflusst werden, da das Bildungsniveau eine wesentliche Determinante vertikaler, sozialer Differenzierung, der Ungleichheit ist.
2.2.2 Die Fokustheorie
Die empirischen Prozesse des Kennenlernens und der Partnerwahl finden nicht in abstrakten sozialen Räumen statt.[8] Die sozialen Aktionsspielräume sind eher recht klein. Nach Feld (1981) werden wichtige Aspekte der sozialen Umgebung als Foki verstanden, um die herum gemeinsame sozialen Aktivitäten organisiert sind.
„A focus is defined as a social, psychological, legal, or physical entity around which joint activities are organized...“ (Feld, 1981, S. 1016)
Typische Beispiele sind der Arbeitsplatz, Vereine, Organisationen und die Familie. Im wesentlichen konzentrieren sich soziale Kontaktchancen auf Personen, mit denen man einzelne Foki teilt. Diese sind hinsichtlich der Dimensionen wie räumliche Nähe, Ethnie oder Bildung sozial vorstrukturiert. Deshalb folgt, das die Wahrscheinlichkeiten des Kennenlernens eines potentiellen Lebenspartners nicht sozial zufällig verteilt sind, sondern durch Foki als kleinräumliche Opportunitätsstrukturen mitbestimmt werden. Sie lassen sich dabei u.a. über die Merkmale Größe und Restriktivität beschreiben. Die Größe eines Fokus steigt mit der Anzahl der Personen, die ihn teilen. Umso restriktiver ein Fokus ist, das heißt, je mehr Zeit und Aufwand beteiligte Akteure in gemeinsame fokusspezifische Aktivitäten investieren müssen, umso höher sei zum einen die Wahrscheinlichkeit, das involvierte Individuen eine Beziehung eingehen werden. So steigt zum anderen aufgrund der räumlicher Nähe die Wahrscheinlichkeit der sozialen Interaktion zweier Individuen, die den gleichen Fokus teilen. Des weiteren wird von Feld angenommen, das je häufiger Individuen soziale Interaktionen positiv bewerten, umso wahrscheinlicher werden sie positive Gefühle für einander entwickeln.[9] Foki bilden somit eine clusterförmige Beziehungsnetzwerkstruktur, welche relevante Aspekte der sozialen Umgebung abbilden und somit die Gelegenheitsstruktur der Partnerwahl darstellen können.
[...]
[1] In der englischen Sprache wird dieser Sachverhalt umschrieben mit: „Who does not meet, does not mate.“
[2] vgl. Klein & Lengerer, 2001; siehe Abschnitt 3.2
[3] Die Entscheidung für eine Partnerschaft, sollte dann getroffen werden, wenn der erwartete Nutzen für beide Akteure über dem des Alleinbleibens liegt.
[4] vgl. Hill & Kopp, 2002
[5] vgl. Klein, 1998, S. 128; Wirth, 2000, S.41
[6] Vgl. Wirth, S. 42
[7] vgl. Hill & Kopp, 2002; Kneip, 2002; Teckenberg, 2000
[8] vgl. Hill & Kopp, 2002
[9] entsprechend der Kontakthypothese von Homans (1968); vgl. Feld, 1981, S.1026.
- Arbeit zitieren
- Christian Richter (Autor:in), 2003, Die Vorstrukturierung von bildungshomogamen Partnerwahlen durch Bildungswege, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52160
Kostenlos Autor werden



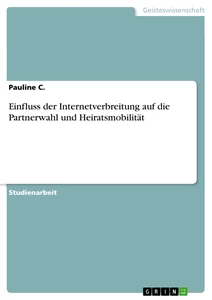


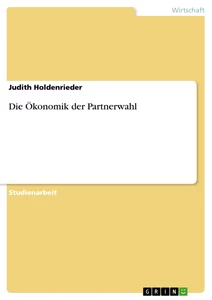















Kommentare