Leseprobe
I. Inhaltsverzeichnis
I. Inhaltsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
III. Abbildungsverzeichnis
IV. Tabellenverzeichnis
V. Abstract
1 Arbeitsumverteilung konzentriert pflegerische Versorgungsverantwortung auf wenige professionell Pflegende
2 Begründungszusammenhang und Forschungsdesign
2.1 Theoretischen Begründungszusammenhänge
2.2 Forschungsdesign
2.3 Methodik der Literaturrecherche
3 Die Definition von Handlungskompetenz als gemeinsame Codierung von Ausbildungszielen
3.1 Vom allgemeinen Kompetenzbegriff
3.2 Die berufsfachliche Handlungskompetenz
3.3 Die Lernzieltaxonomie von Kompetenzen
4 Das Phänomen der pflegerischen Fallsteuerungskompetenz im Kontext domainspezifischer Kompetenzmodelle
4.1 Professionelle Pflegekompetenz nach Weidner (1995)
4.2 Pflegerische Handlungskompetenz nach Raven (2006)
4.3 Pflegekompetenz nach Holoch (2002)
4.4 Pflegekompetenz nach Wittneben (1998)
4.5 Pflegekompetenz nach Benner (1995)
4.6 Pflegekompetenz nach Olbrich (1999)
4.7 Zusammenfassendes Ergebnis der Literaturecherche
5 Die Fallsteuerungskompetenz im Pflegealltag in Abgrenzung zum pflegerischen Case-Management
5.1 Das Pflegerische Case-Management
5.2 Die Fallsteuerungskompetenz innerhalb der pflegerischen Handlungskompetenz
6 Dem Erleben von Pflegekompetenz auf der Spur - Empirischer Teil
6.1 Von der Fragestellung zur Forschungsmethode
6.2 Beschreibung der Forschungsmethode
6.3 Beschreibung des Feldzugangs und Bestimmung der Stichprobe
6.4 Methode der Datenerhebung
6.4.1 Die Rahmenplanung der Interviewsituation
6.4.2 Der Weg zum Interviewleitfaden
6.4.3 Der Leitfaden zum Interview
6.5 Beschreibung der Datenanalyse
6.5.1 Die Transkription
6.5.2 Die Datenauswertung nach Mayring
7 Welche Kompetenz beschreiben Krankenpflegeschüler in ihrer Berufspraxis?
7.1 Die Bedeutung der Themenmatrix
7.2 Die Bedeutung der Fallsteuerungskompetenz in der Pflegewirklichkeit von Lernenden
7.3 Das Wissen der Auszubildenden um die Bedeutung der Fallsteuerungskompetenz
7.4 Die Möglichkeiten zur Entwicklung pflegerischer Fallsteuerungskompetenz in der Ausbildungspraxis
7.5 Als existentiell erlebte Kompetenzen in der Pflegeausbildung
7.6 Die Selbsteinschätzung der erreichten Fallsteuerungskompetenz innerhalb der beruflichen Handlungskompetenz (KMK)
7.7 Zusammenfassung
8 Abschließende Bewertung der Studienergebnisse
8.1 Resümee und Ausblick
8.2 Limitierung der Studie
9 Literaturverzeichnis
10 Anhang
10.1 Daten zur Heterogenität der Stichprobe
10.2 Aushang zur Probanden- Akquise
10.3 Interview-Vereinbarung
10.4 Checkliste zum Interview
10.5 Interviewleitfaden zum Pre-Test
10.6 Codes und Codierung zum Pre-Test
10.7 Textkommentare und Memos zum Pre-Test
10.8 Feedback zum Pre-Test
10.9 Interviewleitfaden der Befragung
10.10 Feedback zur Befragung
10.11 Codes und Codierungen
10.12 Textkommentare und Memos
10.13 Vorläufige Codeverteilung in den Befragungen
10.14 Thematische Verlaufsübersicht der Interviews
10.15 Endgültige Codeverteilung
10.16 Vergleich der Codehäufigkeiten in den Interviews
II. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
III. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Individuelle Kompetenzgenese und Kompetenzpräsentation im Handeln in komplexen Situationen (Gnahs 2010, S. 23)
Abbildung 2: Modell der Handlungskompetenz (Reetz 1999, S. 38)
Abbildung 3: Dimensionen der Handlungskompetenz nach KMK 2011/2017 (Eigene Darstellung)
Abbildung 4: Konstitutive Kompetenzen des professionellen Pflegehandelns in Anlehnung an Raven (1989) (Weidner 1995, S. 125)
Abbildung 5: Modell der pflegerischen Handlungskompetenz nach Raven (2006) (Eigene Darstellung)
Abbildung 6: Professionelle pflegerische Handlungskompetenz nach Holoch (2002) (Eigene Darstellung)
Abbildung 7: Kompetenzmodell nach Wittneben (1998) (Eigene Darstellung)
Abbildung 8: Stufen der Pflegekompetenz nach Benner (1995) (Eigene Darstellung)
Abbildung 9: Kompetenzmodell nach Olbrich (1999) (Eigene Darstellung)
Abbildung 10: Struktur der Pflegekompetenz nach Olbrich (Olbrich 1999; S. 115)
Abbildung 11: Aufbau des Interview-Leitfadens im Pretest
Abbildung 12: Interviewleitfaden nach Pretest
IV. Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Lernzieltaxonomien in der Berufsbildung (Eigene Darstellung)
Tabelle 2: Kompetenzfelder und deren Kompetenzen in Anlehnung an Benner (1995)
Tabelle 3: Diversität der domainspezifischen Kompetenzmodelle (Eigene Darstellung)
Tabelle 4: Eigenständige Pflegetätigkeiten nach § 5 Abs. 3 PflBRefG und deren Vorbehalt
Tabelle 5: Themenmatix der Interviews (Eigene Darstellung)
Tabelle 6: Codeverteilung der Befragungen nach Abweichungen von der absoluten Codehäufigkeit (Eigene Darstellung)
V. Abstract
Diese Untersuchung befasste sich mit der Fragestellung, ob Auszubildende in der Krankenpflege auf Basis domainspezifischer Kompetenzmodelle ein Wissen zur sektoralen Fallsteuerungskompetenz entwickeln. In der qualitativen Studie wurden dazu neun Lernende des dritten Ausbildungsjahres in zwei halbstandardisierten Gruppeninterviews befragt. Die Datenauswertung durch qualitative Inhaltsanalyse ergab, dass die Befragten die Bedeutung einer pflegerischen Fallsteuerung im Behandlungsverlauf erkannten, allerdings eine dahingehende Kompetenzentwicklung im Ausbildungsgeschehen nicht ermöglicht wurde.
Die Ergebnisse verdeutlichten, dass eine unzureichende Kompetenzmodellierung und ein systemisches Burnout im ökonomisierten Gesundheitssektor, welches mit einem Coolout und einer Ausbildungsfeindseligkeit in der Pflege einhergeht, diese Kompetenzgenese behindert.
Schlagwörter: Fallsteuerungskompetenz, Pflegekompetenz, Ausbildungsfeindseligkeit.
This study addressed the question of whether apprentices in nursing can develop knowledge of sectoral case management based on domain-specific competence models. In this qualitative study, nine students in their third year of nursing training were interviewed in two semi-standardized group surveys. An analysis of the qualitative data showed that the respondents recognized the importance of nursing case management in the course of treatment; however, the development of the competence in the training process was not apparent. The results clearly showed that an inadequate competence modeling and a systemic burnout in the economized health sector, which comes with a cool out and resentment towards nursing training, interferes with the development of the aforementioned competency.
Keywords: sectoral case management, care competence, hostility to education.
1 Arbeitsumverteilung konzentriert pflegerische Versorgungsverantwortung auf wenige professionell Pflegende
Veränderte qualitative und quantitative Pflege- und Versorgungsbedarfe und die daraus resultierende Ökonomisierung im deutschen Gesundheitswesen führten zu einer starken Sequenzierung der Patientenversorgung, welche eine veränderte Qualifikation der Pflegeberufe im Sinne einer patientenzentrierten Prozesssteuerungskompetenz erfordern (vgl. Bartholomeyczik 2007, S. 135 f.).
„Gemeint ist mit der individuellen Prozesssteuerung die Verantwortlichkeit einer Pflegenden für den gesamten Versorgungsprozess eines Patienten […] verbunden mit entsprechender Steuerungskompetenz.“ (ebd., S. 141)
Belastender Fachkräftemangel in der Pflege und ein dadurch bedingter Skill- sowie Staff-Mix im alltäglichen Gesundheitsbetrieb verlagern diese Steuerungsverantwortung auf wenige Professionelle im Sinne eines Care-Mix (vgl. Görres et al. 2016, S. 8 f.).
Der bildungspolitische Anspruch einer evidenzbasierten Pflege, die berufliche Vorbehaltstätigkeit der Pflegeprozessplanung sowie ökonomisierte Versorgungsstrukturen (wie z.B. das DRG-Abrechnungssystem) ermöglichen eine „pflegerische Organisationshoheit“ im interdisziplinären Behandlungsteam (vgl. Schneider et al. 2005, S. 395). Der Pflegeberuf besitzt, als einzige Fachdisziplin „ortsgebunden“ organisiert, ein holistisches Bild vom Patienten, um dieser Aufgabe gerecht zu werden (vgl. Bartholomeyczik 2007, S. 141).
In Betrachtung der beschriebenen Ausgangssituation kann pflegerische Steuerungskompetenz in heutiger Berufswirklichkeit nur als Fähigkeit und Bereitschaft verstanden werden, in zentraler Position innerhalb des interprofessionellen Behandlungsteams, Versorgungprozesse und -bedürfnisse des Patienten zu ermöglichen. Diese neu definierte Mandatsstellung zum Patienten würde eine über den Pflegeprozess hinausgehende Fallsteuerungskompetenz als zentrales Ausbildungsziel der Pflegeberufe erfordern.
Fallsteuerungskompetenz in der praktischen Ausübung des Berufes im professionellen Sinne zu beherrschen, setzt eine umfangreiche Berufserfahrung und theoretisches Wissen im Sinne eines ‚Know-how‘ voraus (vgl. Benner und Kesselring 1995, 26 f.). Grundlegend für diesen individuellen Lernprozess ist jedoch das Wissen um diese berufliche Anforderung im Sinne eines ‚Know-that‘, welches in der grundständigen Pflegeausbildung zu ermöglichen wäre.
Nach Erpenbeck et al. (2017) sind Kompetenzen geistige oder physische Dispositionen, um in unübersichtlichen, komplexen Problemstellungen selbstorganisiert zu handeln (vgl. Erpenbeck et al. 2017, S. XII f.). Sie resultieren aus individuellen Anlagen, biographischer Entwicklung sowie individueller psychischer Selbstorganisation von Werten, Motiven, Kognitionen und Emotionen (vgl. ebd.).
In Anlehnung an aktuell gültige Selbstorganisationstheorien machen Erpenbeck et al. (2017) deutlich, dass Kompetenzen nicht endgültig definiert werden können, sondern einem synergetischem Anforderungswandel unterliegen (vgl. ebd., S. XII). Lernende handeln und lernen in einem individuell konstruierten Abbild der Welt (vgl. ebd., S. XIV).
Ausgehend von diesem konstruktivistischen Kompetenz- und Pädagogikverständnis stellt sich somit die Frage, ob die der Krankenpflegeausbildung zugrundeliegenden Kompetenzmodelle geeignet sind, um auf die gewachsene Bedeutung einer Fallsteuerungskompetenz im Pflegehandeln hinzuweisen. Aus Perspektive des Individuums formuliert sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit wie folgt: Entwickeln Lernende in der Krankenpflegeausbildung auf Basis zugrundeliegender Kompetenzmodelle ein Wissen zur pflegerischen Fallsteuerungskompetenz?
Ausbildungsprogramme sollten regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit könnten dazu beitragen, Unterrichtsformen zu überdenken oder ein anderes Verständnis von Pflegekompetenz für die Pflegeausbildung zu entwickeln.
2 Begründungszusammenhang und Forschungsdesign
Die der Arbeit zugrundeliegenden Begründungszusammenhänge werden in den herangezogenen Theoriebezügen und den methodischen Entscheidungen im Forschungsprozess sichtbar. Um die methodisch-theoretischen Überlegungen in dieser Arbeit nachvollziehbar zu machen, sollen im Folgenden einige zugrunde liegenden Positionen skizziert werden.
2.1 Theoretischen Begründungszusammenhänge
Werden Aspekte des menschlichen Handelns, Kommunizierens und Interagierens betrachtet, sind immer auch mikrosoziologische Theorien hinzu zu ziehen.
Comte (1856) verstand menschliches Handeln als Produkt gesellschaftlicher Ordnung und ihrer normativen Entwicklung, welche einer Führung durch die moderne, positive Wissenschaft bedarf (vgl. Comte 1856 zit. n. Vester 2009, S. 26). Diesem normativen Paradigma stellte er eine Verpflichtung der Soziologie zum naturwissenschaftlich geprägten Positivismus beiseite (vgl. ebd.).
Dilthey (1883) erschien dieses Vorgehen als „Verstümmelung“ gesellschaftlicher Wirklichkeit, um „ sie den Begriffen und Methoden der Naturwissenschaften anzupassen. “ (Dilthey 1883, S. XVI) Er rechtfertigte die Notwendigkeit einer verstehenden Geisteswissenschaft mit dem Begründungszusammenhang von freien Handeln und Denken des Menschen in einer natürlichen, gesellschaftlichen Wirklichkeit, die einerseits begrenzt, andererseits vom Individuum variiert werden kann (vgl. ebd., S. 21). Für Dilthey hat die naturwissenschaftliche Betrachtung von Ursache und Wirkung seine Grenze, wenn psychische und geistige Prozesse im Individuum erklärt werden sollen (vgl. ebd., S. 19). Hier setzt die Erklärbarkeit der Geisteswissenschaft im Sinne des Verstehens des Individuellen auf Basis von Allgemeingültigkeit, Überprüfbarkeit und Wissensbezug an (vgl. ebd., S. 10).
„Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.“ (Dilthey 1894, S. 1314)
Nach Dilthey (1900) sollte die Geisteswissenschaft aus einer „ … objectiven Auffassung des Singulären allgemeine gesetzliche Verhältnisse und umfassende Zusammenhänge ableiten ... “ (Dilthey 1900, S. 187). Dilthey bezeichnete diese „ Auslegekunst “ als Hermeneutik (vgl. ebd., S. 189) und betrachtet sie als methodische Grundlage der Geisteswissenschaften (vgl. ebd., S. 202).
Mead (1968), als Begründer des Sozialbehaviorismus, interpretierte soziales Handeln als intersubjektive Reaktion auf menschliche Sozialität mit der Folge von Bewusstwerdung und Intelligenzbildung (vgl. Mead 1968 zit. n. Vester 2009, S. 140 f.). Um Reaktionen beim Gegenüber auszulösen, verwenden Menschen (non-) verbale Symbole (vgl. ebd., S. 141). Durch deren Wiederholung und gegenseitige Bestätigung werden diese signifikant und ermöglichen Intersubjektivität und Sozialität (vgl. ebd.). Durch Ausweitung der Sozialität entstehen eine gemeinsame Sprache, gesellschaftliche Identitäten und soziale Wirklichkeit (vgl. ebd., S. 145 f.). Voraussetzung ist die menschliche Fähigkeit zur reflektierten Übernahme einer fremden Haltung (vgl. ebd., S. 141). Diese, am interpretativen Paradigma orientierte, Theorierichtung diente dem symbolischen Interaktionismus nach Blumer als Grundlage (vgl. ebd., S. 148).
Blumer (1973) beschrieb mit Bezug auf Mead drei Prämissen des symbolischen Interaktionismus:
1. Menschen handeln gegenüber Dingen – hier ist alles inbegriffen, was Menschen wahrnehmen können – aufgrund deren zugeschriebenen Bedeutungen. Solange keine Interaktion über eine Sache stattfindet, gibt es sie sozial nicht.
2. Die Bedeutungen entstehen in der sozialen Interaktion und sind damit daraus ableitbar.
3. Diese Bedeutungen werden interaktiv in der Auseinandersetzung mit den Dingen gehandhabt oder verändert und bilden die gesellschaftliche Realität (vgl. Blumer 1973, S. 81).
Blumer (1973) betonte in Abgrenzung zur quantitativen Methodik die Notwendigkeit eines qualitativen Forscherverhaltens, welches in einer offenen „ Exploration “ den naiven Alltagverstand im natürlichen Feld mit dem Wissenschaftsverstand wechselseitig in Beziehung setzt (vgl. ebd., S. 122 ff.). Die Fragestellungen, Hypothesen, Daten und Interpretationen werden im Forschungsprozess fortlaufend in einer überlagernden, ebenso offenen „ Inspektion “ aktualisiert und bieten so neue wissenschaftliche Erkenntnisse (vgl. ebd., S. 125 f.).
Einen anderen phänomenologischen Ansatz, der am symbolischen Interaktionismus anknüpft, bietet das Konzept von Schütz zum Alltagswissen und der Ethnomethodologie (vgl. Lamnek 2010, S. 39). Es versucht die Sinnzuschreibungen aus der Sicht der handelnden Menschen als Konstruktion von sozialer Wirklichkeit zu erklären, indem die subjektive Sinnhaftigkeit von Handeln, Erleben und Erfahrung methodisch kontrolliert rekonstruiert wird (vgl. ebd.). Schütz (1973) unterscheidet fünf Sinnschichten: die subjektive von Ego, die objektbezogene von Ego, die in Alter hinein interpretierte, die intersubjektiv entstehende und die Wirklichkeit tragende Sinnschicht (vgl. Schütz 1973 zit. n. Vester 2009, S. 173). Gleichzeitig wird die subjektive Sinngebung des Egos mit der objektiven Sinngebung von Alter konfrontiert, so dass eine mehr oder weniger einvernehmliche Abstimmung über Sprache erfolgen muss, um eine Intersubjektivität zu erreichen (vgl. ebd.). In sozialen Gruppen bilden deren Mitglieder zur Vereinfachung des Miteinanders einvernehmliche Sinnprovinzen, sogenannte Ethnien (vgl. ebd., S. 178).
Durch methodisch kontrollierte Interpretation der Alltagskonstruktionen entstehen wissenschaftliche Konstruktionen zweiten Grades, die untersucht werden können (vgl. ebd., S. 173).
Diesem Verständnis der kontextgebundenen Repräsentation von gesellschaftlicher Wirklichkeit in der Erlebniswelt sowie im Handeln des Individuums und dessen wissenschaftliche Interpretation liegen alle hermeneutischen und phänomenologisch-wissenssoziologischen Theorien zugrunde (vgl. Weidner 2011, S. 19). Sie bevorzugen qualitative Sozialforschung und Methodik (vgl. Keller 2009, S. 18).
2.2 Forschungsdesign
Auszubildende in der Pflege erleben Lernen und dessen Evaluation anhand von formulierten Lernzielen im Kontext des Kompetenzmodells, welches für ihre Berufsbildung gültig ist. Durch die gemeinsame Interaktion von Lernenden und Lehrenden innerhalb dieses Bezugsrahmens, entstehen laut Blumer (1973) Annahmen, Erwartungen und Einstellungen als gemeinsames Verständnis von Ausbildungszielen (vgl. Blumer 1973, S. 81). Daher soll im ersten Schritt dieser Arbeit der Kompetenzrahmen in Bezug auf die Pflegeausbildung dargestellt werden.
Im Sinne der Fragestellung soll im zweiten Schritt die Fallsteuerungskompetenz definiert werden und ihre theoretische Verortung in den vorherrschenden Pflegekompetenzmodellen und in der Pflegepraxis betrachtet werden. An dieser Stelle wird auch eine Abgrenzung zum pflegerischen Case-Management unternommen.
Im Rahmen der sozial-interaktiven Aushandlung in der praktischen Berufswelt entwickelt der Lernende im Verständnis nach Blumer (1973) innerhalb der wirksamsten Maximen auch eigene Codierungen und Deutungsmuster zur erforderlichen ‚realen‘ Pflegekompetenz (vgl. ebd.). Darum sollen Lernende vor dem praktischen Staatsexamen mittels halb-standardisierten Gruppen-Interviews befragt werden. Das methodische Vorgehen wird im dritten Teil der Arbeit beschrieben, um im vierten Teil der Arbeit die Ergebnisse vorzustellen. Die Ergebnisse werden abschließend diskutiert und bewertet.
2.3 Methodik der Literaturrecherche
Die Literaturrecherche zur Definition von Pflegekompetenz erfolgte in den Literaturdatenbanken Google Books und Google Scholar, PrinterNet Pflegepädagogik/Pflegewissenschaft, LDBB (Bundesinstitut für berufliche Bildung), WISO-Datenbank, Springer-Datenbank und weiteren Verlagsdatenbanken der DIPLOMA-Hochschule. Es wurden die Begriffe ‚Pflegekompetenz‘, ‚Kompetenz und Pflege‘, ‚Pflegeausbildung‘ in üblicher Boole-Technik genutzt. Zusätzlich erfolgte eine weitere Literaturrecherche im Schneeballsystem. Gleiches Vorgehen erfolgte mit den Begriffen ‚Fallmanagement und Pflege‘ bzw. ‚Case Management und Pflege‘. Die Literaturverwaltung erfolgte mit dem lizensierten EDV-Programm Citavi 6 in der Version 6.3.6 (Beta).
Für den empirischen Teil der Arbeit wurde ausgehend von den Übersichtswerken „Forschungsmethoden und Evaluation“ von Bortz und Döring (2006) und „Qualitative Sozialforschung“ von Lamnek (2010) eine Literaturrecherche im Schneeballsystem vorgenommen. Die Methodik der Datenerhebung stützt sich überwiegend auf das Manual für die Durchführung qualitativer Interviews von Cornelia Helfferich (2011). Die Datenauswertung erfolgt als qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2010).
3 Die Definition von Handlungskompetenz als gemeinsame Codierung von Ausbildungszielen
Die Eingabe des Begriffes ‚Kompetenz‘ bzw. ‚Kompetenzen‘ in der Google-Suchmaske ergibt 24,7 Millionen Schlagwort-Ergebnisse und immerhin noch 378.000 deutschsprachige Buchtitel (Stand 02.01.2019). Es verwundert nicht, dass Kirchhof (2007) diese „ Wortschöpfung […] zu einen populären Modernisierungs- und Leitbegriff “ mit kaum vergleichbarer Bedeutsamkeit und Deutungsvielfalt erklärt (Kirchhof 2007, S. 63). Der Kompetenzbegriff hat in fast allen Lebensbereichen Einzug gehalten und wird selbst Produkten wie Anti-Age-Cremes zugesprochen (vgl. Krautz 2009, S. 8).
Angesichts der inflationären Nutzung soll der Kompetenzbegriff in diesem Kapitel historisch und wissenstheoretisch rekonstruiert werden und im folgenden Kapitel schrittweise auf die Definition in der pflegespezifischen Berufspädagogik reduziert werden.
3.1 Vom allgemeinen Kompetenzbegriff
Etymologisch stammt der Begriff vom lateinischen Wort ‚competentia‘ (Zusammentreffen), welches im rechtlichen Kontext ab dem 16. Jh. als ‚Befugnis‘ von Ansprüchen und ab dem 19 Jh. im rechtlichen Kontext von ‚Zuständigkeit‘ und ‚Sachverstand‘ genutzt wurde (vgl. Pfeifer 1993). In seiner Organisationtheorie nutzte Max Weber (1921) den Kompetenzbegriff zur Beschreibung von legitimen Herrschaftsansprüchen in arbeitsteiligen Organisationen im Sinne von sachlich begründeter Leistungsverpflichtung, der zugeordneten Befehlsgewalt und zulässiger Sanktionsgewalt (vgl. Weber 1921 zit. n. Vonken 2005, S. 17). Hier beinhaltet der Begriff neben der normativen Befugnis, der individuellen Befähigung und Zuständigkeit auch einen Ordnungsbedarf durch soziale Situationen (vgl. ebd.). Es müssen also individuelle Kompetenzen und bewältigungsbedürftige Situationen zusammentreffen (vgl. Kirchhof 2007, S. 65).
„Bedeutsam für das Einbringen von Kompetenz ist jedoch nicht nur deren Besitz, sondern gerade deren Umsetzung in Handeln." (ebd.)
Das Kompetenzkonzept löste ab 1970 den Begriff der ‚Schlüsselqualifikationen‘ nach Mertens ab (vgl. ebd.). Schlüsselqualifikationen sind als übergeordnete Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten beruflichen Handelns zu verstehen, die benötigt werden, um ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden (vgl. Mertens 1974, S. 40). Der Kompetenzbegriff erweitert dieses Verständnis um die Aspekte der individuellen Identitätsbildung, der Transformationsfähigkeit und der Eigenverantwortung (vgl. Vonken 2005, S. 39). Im Rückschluss bedeutet dies jedoch auch, dass heutige Kompetenzdefinitionen auf die inhaltliche Systematik von Mertens zurückgreifen (vgl. Gnahs 2010, S. 29). Darum soll im Folgendem ein kurzer Überblick zum Begriff der Schlüsselqualifikationen gegeben werden. Mertens unterschied die
- Basisqualifikationen,
- Horizontqualifikationen,
- Breitenelemente und
- Vintage-Faktoren (vgl. Mertens 1974, S. 41 f.).
Basisqualifikationen umfassen
„… Fähigkeiten zu logischem, analytischem, kritischem, strukturierendem, dispositivem, kooperativem, konstruktivem, konzeptionellem, dezisionistischem, kreativem und kontextuellem Denken und Verhalten …“ (ebd.)
sowie eine übergreifende Lernfähigkeit (vgl. ebd.).
Horizontalqualifikationen enthalten kognitive Kenntnisse und Fähigkeiten zur Gewinnung, Einschätzung und Verarbeitung von Informationen (vgl. ebd.).
Breitenelemente beinhalten Kenntnisse und Fähigkeiten in berufsübergreifenden Tätigkeitsfeldern (wie z.B. dem Arbeitsschutz) im Sinne von allgemeingültigen gesellschaftlichen Anforderungscodes (vgl. ebd.). Hierzu würde man heute sicherlich Kenntnis und Fähigkeit zum Daten- oder Umweltschutz zählen.
Vintage-Faktoren sind Kenntnisse und Fertigkeit, die durch gesellschaftliche Weiterentwicklungen erforderlich werden, um Ansprüchen der aktualisierten Allgemeinbildung zu entsprechen (vgl. ebd.). Heute würde Mertens wahrscheinlich den allgegenwärtigen Umgang mit digitalen Medien dazu zählen.
In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion, welche jene um den Qualifikationsbegriff abgelöst hat, erfährt die Kompetenzdefinition eine ebenso wechselnde Betonung von Zuständigkeit, Befugnis, Fähigkeit und Motivation (vgl. Vonken 2005, 18 f.).
Eine scheinbar tragfähige bzw. oft zitierte Definition von Kompetenz gibt Weinert (vgl. Franke 2008, S. 35; Erpenbeck et al. 2017, S. XXI): Danach sind Kompetenzen
„… die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (Weinert 2002, S. 27 f.)
Vonken (2005) versucht die diversen Wissenschaftsdisziplinen mit ihrem Bezug zum Kompetenzbegriff zu ordnen (vgl. Arnold und Schüßler 2001 zit. n. Vonken 2005, S. 18 f.), wobei an dieser Stelle abweichend eine chronologisch aufsteigende Auflistung erfolgt:
1. Linguistik: Differenzierung zwischen sprachlichem Regelwissen sowie der Dichotomie von impliziter Sprachkompetenz und kreativ-interaktionistischer Performanz mit Verweis auf Chomsky (vgl. Chomsky 1970, S. 14).
2. Erziehungswissenschaft: Kompetenz als Instrument, um das Bedürfnis des Menschen nach Bewältigung seiner Umwelt zu verwirklichen, im Verständnis von Autonomie bzw. Mündigkeit; bestehend aus Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz (vgl. Roth 1971a, S. 291).
3. Psychologie: Kompetenz als Zusammenwirken von verschiedene Wissensformen, Persönlichkeitseigenschaften, Motiven, Normen sowie Werten in erfolgversprechenden Situationen (vgl. Roth 1971b, S. 388).
4. Soziologie: Kompetenz als Zuständigkeit im Sinne von Weber. Wobei Luhmann (2000) in seiner Organisationstheorie ausdrücklich zwischen der von Weber gemeinten hierarchischen Kompetenz und der subjektbezogenen Fachkompetenz unterscheidet (vgl. Kurtz 2010, S. 10)
5. Arbeitswissenschaft: Kompetenz als Kombination von stellengebundener Legitimation und der damit verbundenen, fachspezifischen Fähigkeit einer Person (vgl. Reiber 2013, S. 59).
6. Betriebswirtschaftslehre: Erfolgreiches betriebswirtschaftliches Handeln einer Organisation entsteht aus der sachbegründeten Legitimation und einer durch Führung generierbaren Kompetenz in einer marktwirtschaftlich herausfordernden Situation (vgl. ebd., S. 3).
7. Pädagogik: Berufliche Handlungskompetenz in Problemsituationen in Ausweitung des Qualifikations- und Bildungsbegriffes (vgl. Kapitel 3.2).
Das interpretationsoffene Konglomerat aus situations-, subjekt- und handlungsbezogenen Definitionsfragmenten des Kompetenzbegriffs erklärt sicherlich das transdisziplinäre und aktuelle Forschungsinteresse (vgl. Erpenbeck et al. 2017, S. XV). Die verschiedenen wissenschaftlichen Kompetenzkonstruktionen nutzen entsprechend der o.g. Definitionsfragmente „ personexterne “, „ personinterne “ und „ interaktionistische “ Blickrichtungen (vgl. Dieterich 1983, S. 22 f.). Ein personenexternes Kompetenzkonstrukt fragt entweder nach den durch eine Position bzw. Situation legitimierten Handlungsmöglichkeiten oder den von einem Individuum erwünschten Kompetenzmerkmalen (vgl. Vonken 2005, S. 27 f.). Ein personeninternes Kompetenzkonstrukt versucht kognitive, innerpsychische Vorgänge des Individuums im kompetenten Handeln zu erklären (vgl. ebd.). Eine interaktionistische Kompetenzkonzeption betrachtet die durch eine Auseinandersetzung mit der Umwelt generierten Kompetenzen (vgl. ebd.). Es ergeben sich dadurch drei grundsätzliche Unterscheidung der Kompetenzbetrachtung in ihrer zeitlichen Dimension: Modelle können Kompetenzen als komplementäre Teildimensionen einer Person im Tätigkeitsfeld, als situations- bzw. personengebundene Handlungsanforderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden oder als Kompetenzentwicklung auf kognitiven Niveaustufen beschreiben (vgl. Kaufhold 2011, S. 40). Winther (2010) unterscheidet entsprechend Struktur-, Niveau- und Entwicklungsmodelle in der Kompetenzdiagnostik (vgl. Winther 2010, S. 37).
Erpenbeck et al. (2017) wiederum unterscheiden nach ihrer Zielsetzung im gegenwärtigen Kompetenzverständnis vier Definitionsmuster:
1. Kompetenzen als Bildungsziel einer ökonomischen Verwertbarkeit gesellschaftlicher Teilhabe des Individuums,
2. Kompetenzen als beschreibenden Handlungsrahmen,
3. Kompetenzen als kognitive Leistungsbeschreibung und
4. Kompetenzen als kreative Selbstverwirklichungsfähigkeit des Individuums (Erpenbeck et al. 2017, S. XXIV).
Diese Aufzählung beschreibt unter Punkt 1 eine Auseinandersetzung zwischen Kompetenzbefürwortern und dessen Kritikern mit humanistischem Bildungsverständnis. Erpenbeck et al. (2017) kritisieren hier namentlich Matthias Vonken (vgl. ebd.) und belegen damit wahrscheinlich ungewollt, dass der Kompetenzbegriff ebenso wie der Bildungs- und Qualifikationsbegriff ein stark wertegebundenes, soziales Konstrukt darstellt (vgl. Sahmel 2011, S. 7; 2017, S. 25 f.).
Zu einer wertfreieren Einteilung kommt Winther (2010), indem sie drei internationale Wissenschaftsströmungen der Kompetenzforschung beschreibt:
1. Ein subjektorientiertes, behavioristisches, Performanz-bezogenes Verständnis,
2. ein objektbezogenes, an den Anforderungen der Situation und dem Kontext gebundenes Verständnis und
3. ein kognitivistisches Verständnis (vgl. Winther 2010, S. 17 f.).
Nach Weinert (1999) umfassen verwendete Kompetenzdefinitionen Zuschreibungen von Persönlichkeitsmerkmalen über erworbenes Allgemeinwissen bis hin zu unspezifischen Schlüsselqualifikationen und fachlichen Fertigkeiten (vgl. Weinert 1999 zit. n. Franke 2008, S. 34). Weinert unterscheidet die verwendeten Komponenten in allgemeine intellektuelle Disposition, funktional definierte kognitive Leistungsdispositionen im Sinne von Strategien oder Routinen, motivationale Orientierungen sowie der, diese Anteile umfassenden, Anwendungskompetenz in einem Handlungsgebiet und übergeordnet eine Metakompetenz zum Erwerb dieser Komponenten (vgl. ebd., S. 34 f.).
Gnahs (2010) beschreibt den Kompetenzbegriff, dessen Genese und seinen Bezug zur Performanz wie folgt (Abbildung 1): Jedes Individuum besitzt genetische, physische Veranlagungen, biographisch erworbene Wissensbestände, Haltungen, Werte, Fertigkeiten sowie Motivationen und andere Dispositionen, um in mehr oder weniger komplexen Situationen diese individuellen Kompetenzen im Handeln zu performen und zu aktualisierten (vgl. Gnahs 2010, S. 23).
Die Kompetenzgenese geschieht durch Sozialisation, implizitem Lernen, informellem Lernen, nicht-formalem sowie formalem Lernen in Abhängigkeit von persönlichen Eigenschaften (Geschlecht, Alter, körperlich/geistige/psychische Physis) und soziokultureller Herkunft (vgl. ebd., S. 31).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Individuelle Kompetenzgenese und Kompetenzpräsentation im Handeln in komplexen Situationen (Gnahs 2010, S. 23)
Allen genannten Kompetenzkonstrukten sind folgende Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen Gewichtungen zuzuschreiben:
a. Die Dichotomie von Kompetenz und Performanz
Die durch Chomsky für die Linguistik vorgenommene Unterscheidung von Kompetenz als Disposition des Individuums und dessen Performanz in der menschlichen Sprachverwendung findet sich in allen durch die Literaturrecherche erschlossenen Kompetenzdefinitionen wieder. Zur Transformation der sprachwissenschaftlichen Theorie auf das menschliche Handeln wird die sozialwissen-schaftliche Theorie des kommunikativen Handelns nach Habermas (1981) herangezogen (vgl. Vonken 2005, S. 22 f.; Erpenbeck et al. 2017, S. XV). Heribert Meyer (2007) beschreibt in einem Eisbergmodell die sicht- sowie messbare Leistung, die Performanz, als Oberflächenstruktur und die Handlungskompetenz als unsichtbare Tiefenstruktur, welche einer theoretischen Modellbildung bedarf (vgl. Meyer 2007, S. 147).
b. Die Subjektbezogenheit von Kompetenzen
Während der Qualifikationsbegriff sachverhaltsbezogene Prüfungsleistungen von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und damit objektiv definierte Bildungspositionen beschreibt, versteht sich der Kompetenzbegriff umfassender als individuelle Disposition zum selbstorganisierten Handeln, welche nicht direkt erfass- oder normierbar ist (vgl. Erpenbeck et al. 2017, S. XVI f.). Disposition kann hier im Sinne von Verfügbarkeit innerer Voraussetzungen und Bereitschaft zum Einsatz derselben verstanden werden (vgl. ebd., S. XII f.). Es wird nur der subjektiv nützliche, situativ erforderliche Anteil der Kompetenzen performt (vgl. ebd.).
c. Die Ganzheitlichkeit und das Augenblickliche von Kompetenzen
Selbstorganisiertes Handeln im Sinne eines kompetenten Handelns ist nicht vorherbestimmbar, da es biographisch einer individuellen Lern- und Werteentwicklung entspringt (vgl. ebd.). Der Kompetenzbegriff umfasst holistisch alle rezeptiven, kognitiven, emotional wertenden, motivationalen und persönlichkeitsbildenden Eigenschaften eines Individuums, die an komplexen Situationen psychisch re-aktualisiert werden (vgl. ebd., S. XIII). Kompetenzen werden im wechselseitigen, interpretativen Aushandeln mit der Situation jederzeit neu performt. Die individuellen Handlungen können bei vergleichbarer Situation variieren (vgl. ebd.).
d. Die Selbstorganisation von Kompetenzen
Mit Verweis auf aktuelle Hirnforschung wird die Aneignung von Kompetenzen als selbstorganisiertes Zusammenwirken von individuellen Wahrnehmungs-, Emotions-, Denk- und Entscheidungsprozessen im Sinne des Konstruktivismus verstanden (vgl. ebd.). Ein Kompetenzerwerb ist somit nicht belehrbar, sondern muss aktiv und selbstgesteuert vom Individuum erfolgen (vgl. ebd.).
e. Die Entgrenzung durch Kompetenzen
Die holistische, biographische und konstruktivistische Betrachtung des Kompetenzerwerbs erweitert den klassischen Lehr-Lernbegriff des formellen, expliziten, fremdbestimmten Instruktionslernen von deklarativem Wissen um ein selbstorganisiertes, lebenslanges, alltägliches, erfahrungsgeprägtes, informelles und implizites Handlungslernen (vgl. Kirchhof 2007, S. 33 f.). Damit findet Lernen nicht nur in formalen Bildungseinrichtungen als bewusster, didaktisch organisierter Prozess statt, sondern auch fortlaufend - problem- sowie handlungsorientiert - in allen bewusst und unbewusst erlebten Alltags- und Arbeitssituationen als Erfahrungslernen (vgl. ebd.). Das Kompetenzverständnis entgrenzt somit Lernwerte, Lernorte, Lernzeiten und überträgt Lernverantwortung im Sinne der Selbstorganisationtheorien auf die Lernsubjekte Individuum, Organisation sowie Gesellschaft (vgl. Arnold und Schüßler 2008, S. 56; Bretschneider und Seidel 2011, S. 69).
f. Die Konstitution normativ offener Werte und Machtaspekte
Der Kompetenzbegriff definiert gesellschaftlich anerkannte Werte, ohne ein intrinsisches Beurteilungsmaß zu liefern (vgl. Zürcher 2010, S. 4; Erpenbeck et al. 2017, S. XVI). Deren Bewertung erfolgt über ein extern konstruiertes Referenzsystem, welches sich nicht an Objektivität und Validität, sondern an sozialer Akzeptanz und Verwertbarkeit orientiert (vgl. Erpenbeck et al. 2017, S. XIV). Dadurch werden Macht- und Legitimationsaspekte impliziert, jedoch selten formuliert (vgl. Vonken 2005, S. 57). Während Erpenbeck dies als gesellschaftlich legitimierte Wissenschaftlichkeit beschreibt (vgl. Erpenbeck et al. 2017, S. XIV), weist Vonken auf die Widersprüchlichkeit zwischen individueller, volitionaler Kompetenzentwicklung und externer, sozial wirksamer Kompetenzmessung hin (vgl. Vonken 2005, S. 51 f.).
g. Das Implizieren abzugrenzender Definitionen
Schlüsselqualifikationen sind nach Mertens:
„… Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu bestimmten, disparaten praktischen Tätigkelten [sic!] erbringen, sondern vielmehr
a) die Eignung für eine große Zahl von Positionen und Funktionen als alternative Optionen zum gleichen Zeitpunkt, und
b) die Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) Änderungen von Anforderungen im Laufe des Lebens.“ (Mertens 1974, S. 40)
Dieses Verständnis wird in der Nutzung des Begriffes von ‚Schlüsselkompetenzen‘ gedanklich nicht abgegrenzt (vgl. Erpenbeck et al. 2017, S. XVIII). Gleiches gilt für die synonyme Nutzung der Begriffe ‚Handlungsfähigkeit‘ und ‚Kompetenz‘, wobei erster eher im Zusammenhang mit operationalisierter Leistungserbringung steht und zweiter mit individueller Selbstorganisation verbunden ist (vgl. ebd.). Auch das Begriffspaar ‚Soft-Skills‘ und ‚Hard-Skills‘, welche für erfolgsversprechende berufliche Persönlichkeitseigenschaften und Qualifikationen stehen, werden zur Kompetenzdefinition herangezogen und im Umkehrschluss werden Kompetenzen zu deren Definition genutzt (vgl. ebd.). Den Anglizismen entsprechend geht es den deutschen Begriffen ‚Talente‘ und ‚Persönlichkeit‘ (vgl. ebd.).
Abschließend muss festgestellt werden, dass der Kompetenzbegriff durch seine diffuse Definitionsoffenheit eine omnipotente Definitionsgewalt besitzt. Eine allgemeingültige Definition muss daher hier ausbleiben. Es handelt sich scheinbar um ein kontextabhängiges, gedanklich konstruiertes Verständnis von menschlicher Disposition, welches interpretativ-subjektorientiert oder normativ-leistungsorientiert betrachtet wird. Im folgenden Kapitel soll das vorherrschende Verständnis von Kompetenz im Kontext der Berufsbildung betrachtet werden, welches durch definierte Lern- und Qualifikationsziele bestimmt ist.
3.2 Die berufsfachliche Handlungskompetenz
Lothar Reetz verknüpfte Roths anthropologisches Kompetenzmodell der mündigen Handlungsfähigkeit mit dem beruflichen Ausbildungskonzept der Schlüsselqualifikationen (vgl. Winther 2010, S. 48). Der Begriff der beruflichen Handlungskompetenz sollte die konträren Positionen des pädagogischen versus des ökonomischen Verständnisses von Berufsbildung vereinen und eine Operationalisierbarkeit von Ausbildungszielen ermöglichen (vgl. Reetz 1999, S. 37). Reetz ordnet vertikal, im Verständnis einer Zunahme der Abstraktion, die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit der Sachkompetenz, die Problemlösefähigkeit der Methodenkompetenz, die kommunikativen Fähigkeiten zur Verhandlung und Kooperation der Sozialkompetenz und die persönlichen Grundfähigkeiten zur Verantwortung und Initiative der Selbstkompetenz zu (vgl. ebd.; Abbildung 2). Die Horizontale Anordnung der Schlüsselqualifikationen und Teilkompetenzen der Handlungskompetenz soll deren enge Relation zueinander verdeutlichen (vgl. ebd.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Modell der Handlungskompetenz (Reetz 1999, S. 38)
Damit wurden die Dimensionen Fach- und Methodenkompetenz, Selbst- sowie Sozialkompetenz komplementäre Bestandteile des berufspädagogischen Kompetenzmodells (vgl. Winther 2010, S. 48). Die berufliche Bildung verliert damit ihre kognitive Ausrichtung und Schulfach-Systematik und gewinnt die Perspektive der Handlungs- sowie Problemorientierung (vgl. ebd., S. 51).
Das Ausbildungsziel der Handlungskompetenz findet sich folgerichtig in der Handreichung zur Erstellung von Curricula für Berufsschulen der Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK 2011/2017) wieder. Das Qualifikationsziel der
„Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.“ (KMK 2011/2017, S. 14 f. [Hervorhebung durch den Verfasser]):
Fachkompetenz beinhaltet die Bereitschaft und Fähigkeit zur sach- und methodengerechten Aufgabenlösung im Problemlösezyklus,
Selbstkompetenz umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung in allen Strukturen der Gesellschaft (vgl. ebd.). Ihr werden Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben wie Wertebindung, Autonomie, Kritikfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein (vgl. ebd.).
Sozialkompetenz entspricht der Bereitschaft und Fähigkeit zur solidarischen Beziehungsgestaltung (vgl. ebd.).
Diesen drei Kompetenzen liegen die Methodenkompetenz, die kommunikative Kompetenz und die Lernkompetenz quergelagert inne. Es besteht somit eine vernetzte Beziehung und Bedingtheit untereinander (vgl. ebd.; Abbildung 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Dimensionen der Handlungskompetenz nach KMK 2011/2017 (Eigene Darstellung)
Methodenkompetenz entspricht der Bereitschaft und Fähigkeit zur zielstrebigen und strukturierten Problemlösung,
Kommunikative Kompetenz umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit zur empathischen zwischenmenschlichen Interaktionsgestaltung und
Lernkompetenz enthält die Bereitschaft und Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und zur Nutzung von Lernstrategien für ein lebenslanges Lernen im Beruf und anderswo (vgl. KMK 2011/2017, S. 15 f.).
Das Qualifikationsziel der Handlungskompetenz nach Reetz findet sich im Krankenpflegegesetz 2003 (vgl. Deutscher Bundestag 16.07.2003, S. 1443) und das erweiterte Kompetenzstrukturmodell der KMK (2011/2017) im Pflegeberufereformgesetz 2017 wieder (vgl. Deutscher Bundestag 17.07.2017, S. 2583).
Der Kompetenzbegriff erweitert den Qualifikationsauftrag von Berufsbildung um die Aspekte der individuellen Identitätsbildung, der Transformationsfähigkeit und der Eigenverantwortung (vgl. Vonken 2005, S. 39). Die Pflegeausbildung soll somit nicht nur handlungsspezifische Qualifikationen vermitteln, sondern vielmehr die Entwicklung von ökonomisch und gesellschaftspolitisch wünschenswerten Persönlichkeitseigenschaften fördern (vgl. ebd., S. 46). Die Einbeziehung der Persönlichkeit, eine fehlende Definitionsschärfe des Strukturmodells und die Ausweitung auf volitive Dispositionen im Handeln führte in der Berufspädagogik zu immer komplexeren Lern-Arrangements und Problemen bei der Überprüfung von inflationär definierten, berufsspezifischen Teilkompetenzen in den Ausbildungszielen (vgl. ebd., S. 71).
Einen Überblick über die vielfältigen Lernarrangements – dem interaktionistischen Lernfeldmodell von Darmann-Finck (2000), dem kritisch-konstruktiven Lernfeldmodell von Wittneben (1991), dem situativen Strukturgitteransatz von Greb (1999), dem kompetenztheoretischen Pflegedidaktikmodell von Olbrich (1998) und dem problemorientierten Fachdidaktikmodell von Schwarz-Govaers (1993) – geben die genannten Ex-Dissertanten selbst in einem Übersichtswerk (vgl. Olbrich 2009). Wittneben und Olbrich legen innerhalb ihres didaktischen Modells eigene Kompetenzstruktur- bzw. Kompetenzentwicklungsmodelle vor (vgl. Wittneben 2009 in Olbrich 2009, S. 111 f.; Olbrich 2009, S. 65 f.).
Ein fachpraktisch verortetes Lernkonzept für den Erwerb von pflegerischer Handlungskompetenz, die Skillslab-Methode als Simulationstraining mit standardisierten Patientenschauspielern, wird für den Einsatz in der tertiären Pflegeausbildung beschrieben (vgl. Blatter und Ochsner Oberarzbacher 2008). Alle pflege-didaktischen Kompetenzmodellierungen beinhalten eine deutliche situationsanalytische Ausrichtung (Pflegeanlass, subjektive Interessen, Handlungsrahmen, Interaktionsstrukturen) und ein handlungsorientiertes Verständnis im Sinne einer vollständigen Handlung (vgl. Wittmann et al. 2017, S. 192 f.).
Ein bundesweiter Vergleich der Effektivität von verschiedenen Länder- Curricula, welche sich inhaltlich auf die oben genannten Didaktikmodelle beziehen, mittels Kompetenzmessungen (ähnlich der PISA-Studien) existiert bisher nicht, da die Kompetenzdiagnostik in Pflegeberufen durch ihre Situationsvielfalt eine besondere Komplexität besitzt (vgl. Simon et al. 2015, S. 9 f.). Alle psychomotorischen und psychometrischen Verfahren zur technologiebasierten Testung pflegerischer Handlungskompetenz – das objektiv-strukturierte klinische Examen im Skillslab (OECE) sowie videogestützte computerbasierte Tests (TEMA) – haben ihre empirische Modellierungsproblematik in der Reichweite ihrer Messung (vgl. Schlegel 2008, S. 182; Wittmann et al. 2017, S. 186). Kompetenzmessungen finden darum im Pflegeberufekontext bisher überwiegend durch Fremd- oder Selbsteinschätzungsfragebögen statt (vgl. Girbig und Bauer 2011, S. 656 f.; Kraske et al. 2016, S. 191 f.; Schorn und Buchholz 2016, S. 108).
In der Berufsbildungspraxis ist – dessen unbeachtet – die Operationalisierung von Qualifikationszielen mittels Taxonomien von Lernzielen üblich (vgl. Franke 2008, S. 13), die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen.
3.3 Die Lernzieltaxonomie von Kompetenzen
Die funktionalen Komponenten von Kompetenz sind Kognition, Handeln und Performanz (vgl. ebd., S. 10).
In der Berufsbildung werden Taxonomien als Klassifikationssysteme zur hierarchischen, kumulativen Ordnung von Lernzielen in aufsteigender Komplexität bzw. Verinnerlichung genutzt, die jedoch einer empirischen Bestätigung bedürfen (vgl. ebd., S. 11). Die Taxonomien der drei zugrundeliegenden Verhaltensbereiche stammen aus der behavioristischen Forschung Mitte des letzten Jahrhunderts: (a) Kognition, (b) Psychomotorik und (c) Affektiver Bereich (vgl. ebd., S. 12). Der Bereich der Kognition nach Bloom (1956) wurde von um die Kategorien faktisches, konzeptuelles, prozedurales und metakognitives Wissen aktualisiert (vgl. Krathwohl und Anderson 2001 zit. n. Franke 2008, S. 13). Den Taxonomiestufen sind beschreibende Verben zur Operationalisierung zugeordnet, denen jedoch die nötige Trennschärfe fehlt (vgl. ebd., S. 14).
Die kognitiven Taxonomiestufen Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten und Gestalten messen sich an der zunehmenden Komplexität der Aufgabe (vgl. ebd., S. 12 f.). Die affektiven Stufen Aufmerksam-Werden, Reagieren, Werten, Eigene-Werteordnung-Bilden und der Werteverankerung beschreiben eine zunehmende Verinnerlichung von Werten (vgl. Krathwohl et al. 1964 zit. n. Franke 2008, 20 f.). Die psychomotorische Lernziel-Taxonomie gliedert eine zunehmende Beherrschung und Automatisierung in der jeweiligen Fertigkeit (vgl. Dave 1968 zit. n. Schewior-Popp 2013, S. 61). Die nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Eindruck über die jeweiligen Stufen und soll die zunehmende Komplexität bei wachsenden Bildungsansprüchen deutlich machen (vgl. Franke 2008, S. 16):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Lernzieltaxonomien in der Berufsbildung (Eigene Darstellung)
Die Einteilung der Verhaltensbereiche in den Taxonomien erscheint eher willkürlich und vernachlässigt den komplementären Charakter von Kompetenzen sowie den integrativen Charakter der kognitiven, motorischen und affektiven Verhaltensbereiche im Handeln (vgl. ebd., S. 53). Damit erweist sich eine allgemeingültige Messung von Kompetenz als ebenso schwierig wie deren Definition.
4 Das Phänomen der pflegerischen Fallsteuerungskompetenz im Kontext domainspezifischer Kompetenzmodelle
Es existiert international keine allgemeingültige Definition von Pflegekompetenz (vgl. Loewenhardt 2012, S. 5). Pflegekompetenz wird in der deutschen Ausbildung situations- und dispositionsgebunden verstanden (vgl. Dütthorn 2015, S. 9). Deren Modellierung findet national wie international am Kompetenzstufen-Entwicklungsmodell von Benner (1994) und national am Kompetenzstrukturmodell von Olbrich (1999) statt (vgl. Wittmann et al. 2017, S. 186). Sie werden nachfolgend genauer betrachtet. Weitere Pflegekompetenzmodelle wurden von Weidner und Raven (2006), Wittneben (1998) und Holoch (2002) auf Basis von Forschungsarbeiten entwickelt (vgl. Loewenhardt 2012, S. 6). Sie sollen im Folgendem komprimiert vorgestellt werden. Ein besonderer Fokus soll auf der Bedeutung einer Fallsteuerungskompetenz im jeweiligen Modell liegen.
4.1 Professionelle Pflegekompetenz nach Weidner (1995)
Frank Weidner (1995) beschreibt konstitutive Kompetenzen von pflegepraktisch-professionellem Handeln unter Bezugnahme auf Raven (1989), welcher ebensolche ärztlichen Kompetenzen in Anlehnung an dem Strukturmodell des ärztlich-professionellen Habitus nach Oevermann (1989) entwickelte (vgl. Weidner 2011, S. 124 f.).
Professionelles Pflegehandeln basiert demnach auf einem konkurrierenden Verhältnis zwischen (pflege-) wissenschaftlichem Begründungszwang und situativem Entscheidungszwang in der Pflegepraxis (vgl. ebd.).
Pflegehandeln erfordert eine entsprechende Begründungskompetenz und eine zugrundeliegende Entscheidungs- und Handlungskompetenz, welche auf den Teilbereichen praktisch-technische, klinisch-pragmatische und ethisch-moralische Kompetenz basiert (vgl. ebd., S. 125; Abbildung 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die praktisch-technische Kompetenz umfasst hier die Fähigkeit zum fachgerechten Einsatz von Pflegetechniken, die klinisch-pragmatische Kompetenz meint ein sozial-empathisches Fallverstehen der Patienten- und Angehörigensituation und die ethisch-moralische Kompetenz bezieht sich auf eine werteorientierte, reflektierte Patienteninteraktion (vgl. ebd., S. 125 f.).
Das professionelle Pflegehandeln ist dabei in einem pflegeprozessualen Geschehen eingebettet, welches durch ein Wissensgefälle zwischen defizitären Alltagswissen des Patienten und einem Spezialwissen von Gesundheit des Pflegepraktikers legitimiert wird (vgl. ebd.). Die Pflegekraft handelt in gesundheitlichen Problemsituationen im Mandat eines Patienten mit Autonomieverlust, bis diese wiedererlangt wird (vgl. ebd.).
Weidners mehrdimensionales Kompetenzmodell auf Basis qualitativ ausgewerteter Experteninterviews stellt damit ein interpretativ-handlungstheoretisches Professionsmodell für die Pflege vor, welches eine analytisch-effiziente Performance in komplexen Situationen dem Kompetenzbegriff gleichstellt und eine Fallsteuerungskompetenz im Pflegeplanungsprozess verortet. Es ist damit eindeutig mehrdimensional und objektbezogen. Eine berufsbildende Persönlichkeitsbildung und Kompetenzentwicklung sind hier ausgeblendet.
4.2 Pflegerische Handlungskompetenz nach Raven (2006)
Ausgehend vom Professionsmodell für die Pflege (Weidner 1995) entwickelte Uwe Raven (2006) auf Basis qualitativer Studien ein Modell der pflegerischen Handlungskompetenz für die Ausbildung (vgl. Raven 2006, S. 22).
In Anlehnung am Kognitivismus nach Piaget (1932) und Chomsky (1979) beschreibt Raven (2006) das Zusammenspiel von Kompetenz und Performanz, welche durch Denkprozesse im Sprechen und sozialen Handeln erworben und in der Persönlichkeit verankert sind (vgl. Raven 2006, S. 23 f.). Die Denkprozesse beinhalten auch die moralische Urteilskraft (vgl. ebd.). Analog dazu leitet er ein generatives Regelsystem für die pflegerische Handlungskompetenz ab, welches rekonstruktiv aus der Performanz ermittelt werden kann (vgl. ebd.).
Wie Weidner bedient sich Raven (2006) professionstheoretischer Begriffe, wie der wissenschaftlichen Kompetenz des Theorieverstehens und der hermeneutischen Kompetenz des Fallverstehens nach Ulrich Oevermann, um professionelles Pflegehandeln im Mandat für den Patienten mit passageren oder andauernden Autonomieverlust zu beschreiben (vgl. ebd., S. 24 f.).
Aus fallrekonstruktiven Analysen von Protokolltexten zu pflegerischen Praxisereignissen identifizierte Raven (2006) Performanz-beeinflussende Faktoren, wie das Autonomiedefizit des Patienten, das Pflegesetting und die medizinische Versorgung (vgl. ebd., S. 25). Pflegerische Handlungskompetenz entwickeln sich nach Raven (2006) aus theoretischem Begründungswissen und nicht-artikulierbaren Fallverstehen (vgl. ebd.; vgl. Abbildung 5). Sie bestehen einerseits aus „pflegewissenschaftlicher Kompetenz, analytisch-reflexiver Kompetenz sowie Planungs- und Steuerungskompetenz“ und andererseits aus „hermeneutisch-lebenspraktischer Kompetenz“ (vgl. ebd.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Modell der pflegerischen Handlungskompetenz nach Raven (2006) (Eigene Darstellung)
„[…] Pflegehandeln erfordert das fallbezogene Zusammenspiel von einerseits wissenschaftlicher Kompetenz – diese stellt ein Amalgam pflegewissenschaftlicher Kompetenz, analytisch-reflexiver Kompetenz sowie Planungs- und Steuerungskompetenz und andererseits hermeneutisch-lebenspraktischer Kompetenz dar. Anders gesagt umfasst wissenschaftliche Kompetenz sowohl pflegerelevantes Fachwissen (wissenschaftliche Erkenntnisse), Methodenwissen (Verfahren, Skills) und (organisations- bzw. systembezogenes) Regelwissen. Die hermeneutisch-lebenspraktische Kompetenz wiederum enthält die Teilkompetenzen praktisch-technische Kompetenz (instrumentelle Handlungssicherheit, manuelle Praktiken), klinisch-pragmatische Kompetenz (interaktive Handlungssicherheit, klinischer Blick, role taking etc.) sowie ethisch-moralische Kompetenz (vertreten eines moralischen Standpunktes).“(ebd., S. 25 f.)
Pflegerischer Handlungskompetenz sozialisiert sich in der Mandatsstellung für den Patienten unter der Dialektik von Begründungsverpflichtung und dem Entscheidungszwang in Problemsituationen, die jeder pflegerischen Handlungsperformanz unterliegt (vgl. ebd., S. 26). Da sich Pflegekompetenz nur in ihrer situationsbezogenen Performanz erfahren lässt, empfiehlt Raven für die Pflegeausbildung die Methode einer realitätsnahen, fallrekonstruktiven Analyse im problemorientierten Lernen und Fallprüfungen „ unter Beteiligung einer über einen voll entwickelten Pflegehabitus verfügenden Pflegelehrkraft “ (ebd.).
Im Gegensatz zum Kompetenzstrukturmodell des KMK (2011) bietet Raven ein handlungstheoretisch begründetes, aus dem professionellen Pflegehandeln rekonstruiertes Kompetenzmodell an, welches an der aktuellen Pflegeausbildung adaptiert werden kann und eine problemorientierte Fallsteuerungskompetenz beschreibt. Es stellt damit ein objektbezogenes, mehrdimensionales Modell vor.
4.3 Pflegekompetenz nach Holoch (2002)
Elisabeth Holoch (2002) greift Weidners Kompetenzmodell der professionell Pflegenden auf (Abbildung 6).
Sie ersetzt die praktisch-technischen Kompetenz im professionellen Pflegehandeln durch eine sinn- sowie beziehungsstiftenden Patienteninteraktion nach Peplau und einem ethisch-moralischen Fürsorgeverhalten nach Orem, da sie tragende Elemente der professionellen Pflegepraxis darstellen (vgl. Holoch 2002, S. 99 f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Professionelle pflegerische Handlungskompetenz nach Holoch (2002) (Eigene Darstellung)
Die Aspekte des Fallverständnisses und des kritisch-reflektierten Pflegehandelns auf Basis von (pflege-) wissenschaftlichen Erkenntnissen sind bei ihr gleichrangig zu den Erstgenannten (vgl. ebd., 116 f.). Eine Kompetenzgenese begründet sie mit Bezug auf Benner (1994) in einem kontinuierlichen kritisch-reflektierten Erfahrungsaustausch von Wissen, auch im Expertenstatus (vgl. ebd.).
Beim Kompetenzmodell von Holoch handelt es sich um ein Professionsstrukturmodell mit eher interpretativ-handlungstheoretischer Auffassung, welches eine geringe Erklärbarkeit für die Kompetenzentwicklung in der Pflegeausbildung besitzt. Fallsteuerungskompetenz generiert sich bei Holoch innerhalb des Pflegeplanungsprozesses aus dem pflegerischen Fürsorgeverhalten und der Selbstpflegeorientierung nach Orem. Pflegekompetenz wird aufgrund der zugrundeliegenden Pflegemodelle in der Patientenbeziehung performt. Sie bietet damit ein mehrdimensionales, objektbezogenes Kompetenzmodell an.
4.4 Pflegekompetenz nach Wittneben (1998)
Karin Wittneben (1998) beschreibt in Anlehnung an der Theorie des kommunikativen Handelns nach Habermas (1982) ein Kompetenzmodell mit zunehmend komplexere Handlungsdimensionen als Grad einer Verständigungsorientierung zum Patienten (vgl. Wittneben in Olbrich 2009, S.111 f.). Beginnend von einer patientenignorierenden Ablaufs- und Verrichtungsorientierung entwickelt sich Pflegekompetenz über die Stufen einer Symptomorientierung, einer Krankheitsorientierung, einer reagierenden Verhaltensorientierung und einer patientenzentrierten Handlungsorientierung (vgl. ebd.; Abbildung 7).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Kompetenzmodell nach Wittneben (1998) (Eigene Darstellung)
Das verständigungsorientierte, kommunikative Handeln dient der einvernehmlichen Abstimmung zwischen Pflegenden und Gepflegten (ebd.) und verfolgt eine Selbstpflegeautonomie des Patienten nach Orem (vgl. ebd., S. 110).
[...]
- Arbeit zitieren
- Jürgen Paschke (Autor:in), 2019, Die Kompetenz von Lernenden zur Pflegeprozesssteuerung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/515292
Kostenlos Autor werden

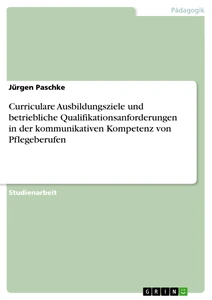













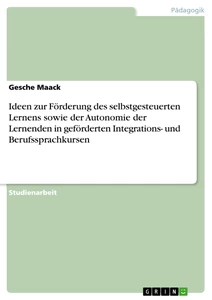

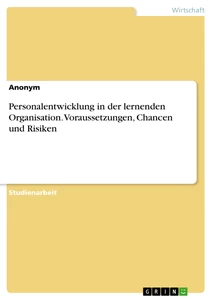




Kommentare