Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Frage- und Zielstellung
1.2 Hypothesen
1.3 Herangehensweise
2 Vorwort
3 Das Gehirn
3.1 Aufbau: Kurzüberblick lernrelevanter Gehirnregionen
3.2 Das neuronale Netzwerk
3.3 Wie das Gehirn lernt
3.4 Neuroplastizität
4 Intelligenz
5 Gehirngerecht Lernen
5.1 Begriffsbestimmungen
5.1.1 Neurowissenschaft
5.1.2 Didaktik
5.1.3 Neurodidaktik
5.1.4 Neuropädagogik
5.2 Ausgewählte ExpertInnen-Theorien
5.2.1 Brand, Matthias und Markowitsch, Lukas
5.2.2 Caine, Renate und Geoffrey
5.2.3 Hattie, John
5.2.4 Herrmann, Ullrich
5.2.5 Roth, Gerhard
5.2.6 Spitzer, Manfred
5.2.7 Stern, Elsbeth
5.3 Sonstige lernrelevante wissenschaftliche Erkenntnisse
5.3.1 Bedeutung des Schlafes für das Gedächtnis
5.3.2 Verstärkung von Gedächtnisinhalten im Schlaf durch „Reminder“
5.3.3 Einnahme von Schlafmitteln zur Erhöhung der Gedächtnisleistung
5.3.4 Steigerung der Gehirnleistung durch Sport
5.3.5 Studie: „Playing Counter-Strike versus Running”
5.4 Anwendungsbeispiele und Erfahrungsberichte
5.4.1 OECD-Projekt
5.4.2 LehrerInnen-Ausbildung
5.4.3 Ron Clark Academy
5.4.4 formatio Privatschule
6 Bildungsziele und Grundsätze laut Rahmenlehrplan
7 Kritische Betrachtung verschiedener Unterrichtstechniken und -methoden
7.1 Offener Unterricht
7.2 Selbstgesteuertes Lernen
7.3 Programmierter Unterricht
7.4 Lernen durch Lehren
7.5 Lerntypen
7.6 Teamteaching
7.7 Fächerübergreifender Gesamtunterricht
7.8 Handlungsorientiertes Lernen
7.9 Lernen unter Selbstkontrolle
7.10 Anwendung an Berufsschulen
8 Alte pädagogische Weisheiten auf dem Prüfstand
8.1 Übung macht den Meister
8.2 Mädchen sind eher sprachbegabt, Burschen eher mathematisch
8.3 Das Gehirn braucht Pausen
8.4 Ein voller Bauch studiert nicht gerne
8.5 Ähnliches nicht nacheinander lernen
8.6 Lehrkräfte müssen Spaß an ihrem Beruf haben
9 Gehirngerecht unterrichten an der Berufsschule
9.1 Die/der „typische“ Berufsschülerin bzw. -schüler
9.2 Probleme
9.3 Chancen
10 Neuroethik
11 Zusammenfassung
12 Conclusio
12.1 Bestätigung der Hypothesen
12.2 Beantwortung der Forschungsfrage
12.3 Wünschenswerte Eingangsvoraussetzungen
12.4 Gehirngerechtes für den Schulalltag
12.5 Beispiel einer 100-minütigen Unterrichtseinheit
13 Quellenverzeichnis
a. Gedruckte Quellen
b. Elektronische Quellen
Anhang
Kurzzusammenfassung
Gute Pädagoginnen und Pädagogen wussten schon immer, wie zielführend unterrichtet wird. Die Ergebnisse der Hirnforschung bestätigen und rechtfertigen in den meisten Fällen die alten pädagogischen Weisheiten.
Gehirngerechte Methoden können helfen, die an Berufsschulen besonders wichtige Fachkompetenz zu vermitteln. Gut im Gedächtnis verankertes Faktenwissen ist nicht nur ein Recht der Lernenden, sondern auch das Recht von bezahlenden Arbeitgeberinnen und bezahlenden Arbeitgebern. Es bleibt zu hoffen, dass die schon vielfältig vorhandenen Ansätze, wie nachhaltig gehirngerecht gelernt werden kann, wieder vermehrt Einzug in den alltäglichen Unterricht finden.
Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, welche gehirngerechten Lernmethoden als aus-reichend gesichert gelten, um sie im täglichen Unterricht anzuwenden. Zu diesem Zweck werden Erkenntnisse anerkannter Expertinnen und Experten und auch unterschiedliche Unterrichtstechniken und –methoden in Hinblick auf deren Übertragbarkeit auf das Berufs-schulwesen analysiert und in eine 100-minütige Unterrichtsvorbereitung eingearbeitet.
Abstract
Successful pedagogues have always known how to teach effectively. The results of brain research confirm and justify the old educational wisdom in most cases.
Brain-based methods can help to provide the professional competence which is particularly important at vocational schools. Actual knowhow is not only the right of the learners themselves but also the right of every employer. It can be hoped that the many ways, how to be sustainably learned, will increasingly find their way back into everyday teaching.
The aim of this work is to find out which brain-based teaching methods are considered to be adequately secured in order to apply them in daily teaching. Therefor the awareness of approved experts as well as different teaching techniques and methods with regard to their transferability to vocational training are analysed and incorporated into a 100-minute lesson plan.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Makroskopischer Aufbau des Gehirns (Quelle: Lampert, 2006)
Abbildung 2: Änderung des synaptischen Aufbaus mit zunehmendem Alter (Quelle: Universität Gießen, 2010)
Abbildung 3: Großhirnaktivität am Beispiel verschiedener sprachlicher Aufgaben (Quelle: Menzel, 2006)
Abbildung 4: The Caines‘ Brain/Mind Principles of Natural Learning (Quelle: Caine/Caine, 2000)
Abbildung 5: Interpretation der Effektstärken von Johan Hattie (Quelle: Spiewak, 2013)
Abbildung 6: Beispiele für privilegiertes und nicht-privilegiertes Lernen (Quelle: Stern, o. J.)
Abbildung 7: Unterricht an der Ron Clark Academy (Quelle: Pro Sieben, 2016)
Abbildung 8: Unterrichtsphasen Lernen durch Lehren (Quelle: Martin, 2002)
Abbildung 9: Kompetenzskala (Quelle: vgl. Manz Schulbuch Verlag, 2012, S. 2)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Positive Effektstärken in Bezug auf den Lernerfolg (Quelle: vgl. Hattie, 2013. Grafik: www.visible-learning.org)
Tabelle 2: Wenig starke und negative Effektstärken in Bezug auf den Lernerfolg (Quelle: vgl. Hattie, 2013. Grafik: www.visible-learning.org)
Tabelle 3: Bildungsbeteiligung der 15- bis 19-Jährigen im internationalen Vergleich (Quelle: OECD, in: Statistik Austria, 2015, S. 39)
Tabelle 4: Gehirngerechte Unterrichtselemente
Tabelle 5: Unterrichtsentwurf Angewandte Wirtschaftslehre
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Seit dem Jahrzehnt des Gehirns, welches im Jahr 2000 endete, gilt dieses als gut - wenn auch nicht lückenlos - erforscht, vor allem die Einführung neuer bildgebender Verfahren (funktionelle Magnetresonanztomografie, Positronen-Emissions-Tomografie) kann hierbei als Meilenstein betrachtet werden.
Der Begriff „Neurodidaktik“ wurde bereits Ende der 80er-Jahre eingeführt, erlebte in den 90er-Jahren und um die Jahrtausendwende eine Hochkultur und scheint seit dieser Zeit mangels direkt messbarer Erfolge wieder zum Stiefkind zu mutieren.
Erst 1990 begann man in der Pädagogik, sich die Erkenntnisse der Hirnforschung mit der Absicht der Verbesserung des Unterrichts zunutze zu machen. Die Euphorie war in diesen Jahren groß. Nachdem sich die teilweise zu hochgegriffenen, unrealistischen Hoffnungen nicht innerhalb weniger Jahre erfüllten, begann vor etwas mehr als zehn Jahren die Phase der Enttäuschung (vgl. Madeja, 2015). Seither spricht man im Schulwesen beinahe ausschließlich von didaktischen Konzepten und Methoden, dem kompetenz- bzw. handlungsorientierten Unterricht, sozialem Lernen sowie personaler Kompetenz. Begriffe wie „Gehirn“, „Nervenzellen“ oder „Vernetzung“ sucht man in Lehrplänen vergebens. Nach der massiven Kritik der Phase ab der Jahrtausendwende ist man nun in einer weiteren Phase angelangt: Das öffentliche Interesse hat sich normalisiert und man kann mittlerweile zwischen Wunschdenken und wirklichen Optionen unterscheiden und seine Schlüsse daraus ziehen.
Manfred Spitzer formulierte in seinem Buch „Lernen“ treffend:
„Schüler sind nicht dumm, Lehrer nicht faul und unsere Schulen nicht kaputt. – Aber irgendetwas stimmt nicht.“ (Spitzer, 2009, Vorwort)
Diese Arbeit beschäftigt sich vordergründig damit, ob die Implementierung der Erkenntnisse aus der Gehirnforschung in den Schulalltag ihre Berechtigung hat. Es werden allgemeine Prinzipien aus der Hirnforschung aufgezeigt und dargelegt, wie diese für das Lernen an Berufsschulen (auf die besondere Herausforderung an Berufsschulen wird unter Kapitel 9 eingegangen) verwendet werden können und sollten.
Es soll keineswegs der Eindruck entstehen, dass didaktische und psychologische Faktoren des Lernens negiert werden, jedoch soll hervorgehoben werden, dass die Gehirnforschung ein wichtiges unterstützendes Glied darstellt.
„Ebenso wenig wie man Hunger hervorrufen kann (wohl aber Appetit) oder Motivation (wohl aber Neugier und Interesse), ebenso wenig können im Gehirn Lernprozesse induziert werden. … Wohl aber können Voraussetzungen erfolgreichen Lernens geschaffen werden.“ (Herrmann, 2009b, S. 14)
Es hat den Anschein, dass jene Erkenntnisse, die als gesichert gelten, nicht in aus-reichendem Maße an die Lehrerschaft kommuniziert wurden und werden. Zusätzlich stellt sich das Problem, dass die meisten Forschungsergebnisse das Lernverhalten von (kleinen) Kindern aufzeigen, nur selten wird auf die Adoleszenz eingegangen. Deshalb scheint das allgegenwärtige Konzept zu sein: ein bisschen Beziehung, ein bisschen Interesse an der Lebenswelt der Jugendlichen, ein bisschen lustiger Einstieg, täglich mehrfach wechselnder (nicht aufeinander abgestimmter) Methodeneinsatz, ein bisschen Projektunterricht, dessen Ergebnis letztendlich doch von der Lehrkraft vorgegeben und oft auch noch geschrieben wird. Frei nach dem Motto: Wenn man alles irgendwie einbaut, dann wird letztlich irgendetwas davon wirken. Unbekannt bleibt dabei, welcher Teil wirksam war.
1.1 Frage- und Zielstellung
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich gegenständliche wissenschaftliche Arbeit primär mit folgender Frage:
Welche neurobiologischen Erkenntnisse untermauern oder widerlegen die Sinnhaftigkeit von häufig an Berufsschulen eingesetzten Unterrichtstechniken und -methoden und inwieweit können diese Erkenntnisse an lehrgangsmäßig organisierten Berufsschulen berücksichtigt werden?
In dieser Bachelorarbeit werden sowohl diverse Expertinnen- und Expertentheorien als auch unterschiedliche Unterrichtstechniken und –methoden kritisch betrachtet. Weiters werden exemplarisch die aktuell laut Lehrplänen für Berufsschulen geforderten allgemeinen und besonderen didaktischen Grundsätze bewertet. Durch Recherche einschlägiger Fachliteratur soll herausgefunden werden, welche neurobiologischen Forschungsergebnisse als gesichert anzusehen sind und sich ohne großen Mehraufwand an Berufsschulen in jedem Unterrichtsgegenstand umsetzen lassen.
„Was kann/muss eine Lehrkraft berücksichtigen, um Schülerinnen und Schüler zum Erfolg zu führen“ steht als zusammenfassende zentrale Frage über den Ausführungen.
1.2 Hypothesen
Hypothese 1:
Die gezielte Anwendung gehirngerechter Methoden kann das Lernen von Neuem und das Merken von Gelerntem maßgeblich fördern.
Hypothese 2:
Neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung bestätigen großteils „alte pädagogische Weisheiten“.
Hypothese 3:
Ist der Lerninhalt für die Lehrkraft nicht interessant, können auch in Folge Schülerinnen und Schüler kein Interesse aufbringen.
Durch Aufarbeitung einschlägiger Literatur sollen genannte Thesen bestätigt werden.
1.3 Herangehensweise
Vorliegende Bachelorarbeit stellt eine hermeneutische Arbeit dar. Mittels intensiver Literaturrecherche in Fachbüchern, Fachzeitschriften sowie Onlinequellen werden unterschiedliche Ansätze aus Neurobiologie und didaktischen Theorien gegenübergestellt und kritisch betrachtet. Das Datenmaterial vieler einzelner empirisch erforschter themenbezogener Details soll Aufschluss über die prinzipielle Anwend-barkeit im Schulwesen, speziell an lehrgangsmäßig geführten Berufsschulen, geben (induktive Herangehensweise).
Die nachfolgend erarbeiteten Expertisen und Erkenntnisse werden – so weit möglich – sofort im jeweiligen Kapitel in Hinblick auf Nützlichkeit bzw. Durchführbarkeit im Berufsschulunterricht analysiert.
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
2. Vorwort
Es hat Wochen der Beschäftigung mit dem gewählten Thema gebraucht, bis ich eine in Schulzeiten selbstverständliche Kleinigkeit, die ich mir in späteren Jahren aus „Entspannungsgründen“ bewusst abgewöhnt hatte, nämlich immer Papier und Bleistift am Nachtkästchen parat zu haben, wieder in meinen Alltag aufgenommen habe. So ist um zwei Uhr nachts an einem Wochenende dieses Vorwort entstanden, ebenso wie einige andere Teile dieser Arbeit. Spätestens nach dieser Erfahrung (die mir schon in Jugendjahren weitergeholfen hat, ohne dafür einen wissenschaftlichen Hintergrund nennen zu können) war es mir ein Bedürfnis, die gehirnrelevanten Erkenntnisse, mit welchen ich mich beschäftigte, an mir selbst auszutesten – sofern möglich. Und so wurde aus dem mit rationellem Verstand gewählten Thema eine Passion mit einem neuen Lebenstraum: Das einjährige Masterstudium an der Harvard School of Education „Mind, Brain, and Education“. Bis dahin ist es sicherlich ein weiter, steiniger Weg, aber Träume beflügeln. Ich wünsche mir, dass auch meine Schülerinnen und Schüler ab und zu erkennen, dass das Beschäftigen mit etwas auf den ersten Blick Trockenem, Uninteressantem den Horizont erweitert und das Leben eventuell in ungeahnte Bahnen lenken kann. Open your mind …
Bevor ich beschloss Lehrerin zu werden, arbeitete ich im Bankwesen, wo ich immer wieder damit konfrontiert war, mit welch nicht vorhandenem Engagement und vor allem auch nicht vorhandenen Kenntnissen junge Menschen in den Arbeitsalltag eintreten. Dies war ein wichtiger Grund, warum ich entschied: Ich möchte etwas ändern! Durch das Studium an der PH Wien kam ich erstmals intensiv mit Humanwissenschaften in Berührung, welche mich von Beginn weg faszinierten. Dies bestärkte mich darin, mich intensiver mit der Gehirnforschung und deren Anwendbarkeit im Berufsschulalltag auseinanderzusetzen. Da ich Lehrerin der Fachgruppe Eins bin, also allgemeinbildende und wirtschaftliche Gegen-stände und keine „echten“ Praxisfächer (aus Schülerinnen- bzw. Schülersicht) unterrichte, ist der Inhalt gegenständlicher Arbeit auch großteils auf diese so unliebsam als „Lern-gegenstände“ bezeichneten Fächer bezogen.
Mein persönliches Anliegen ist das nachhaltige Lernen von Neuem, da bei fach-spezifischem und wirtschaftlichem Lehrstoff nicht prinzipiell mit Vorwissen gerechnet werden kann, unter Einbindung von Methoden, die dies für die Lernenden entweder einfacher oder Erfolg versprechender machen. Geben wir den Schülerinnen und Schülern die Chance, ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber durch topaktuelles (Fach-)Wissen – theoretisch und angewandt – zufriedenzustellen, wenn nicht gar zu beeindrucken.
3 Das Gehirn
3.1 Aufbau: Kurzüberblick lernrelevanter Gehirnregionen
Das menschliche Gehirn entwickelte sich im Laufe der Evolution hierarchisch: Neuere Teile mit höhergeistigen Funktionen wurden quasi über ältere Teile gestülpt. Alle Teile sind miteinander vernetzt und müssen in ihrer Funktionsweise als Ganzes betrachtet werden. Nur dieses Ganze ermöglicht letztendlich die höchste menschliche Gehirn-funktion: den menschlichen „Geist“ (vgl. Schachl, 1998, S. 11-13).
Das Gehirn ist Teil des Zentralnervensystems und besteht zum großen Teil aus Nerven-zellen (Neuronen) und dazwischen gelagerten Faserverbindungen. In der Großhirnrinde (Cortex) von Frauen befinden sind rund 19,3 Milliarden Neuronen, bei Männern in etwa 22,8 Milliarden (vgl. Packenberg et al., 1997, S 312 ff). Diese unterschiedliche Zahl an Zellen geht jedoch mit keinem prinzipiellen Leistungsunterschied einher, denn der männ-liche Kopf ist normalerweise auch größer als der weibliche. Zusätzlich befinden sich im Kleinhirn nochmals zirka 100 Milliarden Neuronen, welche allerdings meist kleiner sind, wodurch das Kleinhirn mehr enthalten kann als das Großhirn (ebd., S. 312 ff).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Makroskopischer Aufbau des Gehirns (Quelle: Lampert, 2006)
a) Stammhirn (Hirnstamm, Hinterhirn, Reptiliengehirn)
Das Stamm- oder Reptiliengehirn ist, wie der Name schon vermuten lässt, der evolutionär älteste Teil des menschlichen Gehirns. Hier werden jene Funktionen verarbeitet, die schon für den Beginn der Menschheit von Bedeutung waren, wie z. B. Atmung, Blutkreislauf oder auch Schlucken und Erbrechen (vgl. Society for Neuroscience, 2006, S. 5). Die wesentlichen Bestandteile des Hirnstamms sind Brücke (Pons), Mittelhirn (Mesencephalon) und verlängertes Mark (Medulla oblongata, Mark-hirn, Nachhirn). Die Begriffe werden oft synonym verwendet, obwohl das Stammhirn per Definition neben dem Hirnstamm auch zusätzlich Teile des Zwischenhirns umfasst.
b) Kleinhirn
Es ist wesentlich bei Lernprozessen mit motorischen Reaktionen beteiligt (vgl. ebd.). Außerdem schreibt man dem Kleinhirn mittlerweile auch eine Rolle bei vielen höheren geistigen Prozessen zu.
c) Zwischenhirn
Das Zwischenhirn ist zwischen Hirnstamm und Großhirn gelegen – daher auch der Name. Hier befinden sich der Thalamus, der Hypothalamus, die Hypophyse und die Epiphyse (vgl. Schachl, 1998, S. 15).
Der Thalamus wird auch als „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet, da er entscheidet, welche der ununterbrochen einlangenden Informationen für den Menschen derart wichtig sind, dass sie bewusst werden müssen. Er übernimmt somit eine wichtige Filterfunktion.
Der Hypothalamus ist ein essenzielles Steuerungszentrum für das Hormonsystem und das vegetative Nervensystem, er ist mitunter wichtig für Ernährung, Fortpflanzung und auch Temperaturregulation (vgl. Society for Neuroscience, 2006, S. 5).
d) Großhirn
Es ist Träger der höheren Funktionen des Gehirns. Die wesentlichen Bestandteile sind Hippocampus, Amygdala und Neocortex mit der Hirnrinde.
Die Oberfläche ist die sogenannte Großhirnrinde, welche in vielen Falten (Gyri) verläuft und aus Frontallappen, Parietallappen, Temporallappen und Occipitallappen besteht. Hippocampus und Amygdala liegen im Temporallappen (vgl. ebd.).
Der Hippocampus spielt bei der Einspeicherung neuer Gedächtnisinhalte die ent-scheidende Rolle – fehlt er jemandem (z. B. nach operativer Entfernung), kann sich diese Person nichts Neues merken. Im Hippocampus sind bekannte Ereignisse gespeichert, dies ist die Basis dafür, dass er einen Abgleich zwischen „bekannt“ und „neu“ vollführen kann. Bewertet dieser eine Information als bereits bekannt, so „kümmert er sich nicht weiter darum“ (Spitzer, 2009, Vorwort). Nur wenn die Information vom Hippocampus als neu und interessant erkannt wird, wird diese gespeichert. Hierbei handelt es sich um eine autonome Gehirnaktivität, die vom Menschen nicht beeinflusst werden kann. Dieses gespeicherte Abbild wird „neuronale Repräsentation“ genannt (vgl. Spitzer, 2009, Vorwort).
Der Stirn- oder Frontallappen ist die größte Struktur im menschlichen Gehirn. Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass hier die höheren geistigen bzw. intellektuellen Funktionen des Menschen angesiedelt sind. Obwohl große Bereiche des Stirnlappens für Motorisches zuständig sind, wird dem präfrontalen Cortex, dem vordersten Bereich des Stirnlappens, auch die Beteiligung an Funktionen wie Aufmerksamkeit, Entscheidung, Planung und konzentriertes Nachdenken zugeschrieben. Er gilt als Sitz der Persönlichkeit. Als weitere Funktion des Frontalhirns ist die Hemmung reflexhaften bzw. triebhaften Verhaltens von Bedeutung. Bei solch existenziellen Funktionen scheint es selbst-erklärend, dass der Frontallappen jener Hirnbereich ist, der am längsten für seine Entwicklung braucht: Erst zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr ist er vollständig ausgereift (vgl. Pontes, 2011). Viele eingeübte Fertigkeiten können ohne maßgeblicher Beteiligung des präfrontalen Cortex ausgeübt werden, sobald es von der Denkleistung her jedoch anspruchsvoller wird, kommt das Frontalhirn zum Einsatz (vgl. Spitzer, 2009, S. 330).
In diesem Kontext sind die Schwierigkeiten an Berufsschulen gut sichtbar: Das Frontalhirn der Jugendlichen ist nicht fertig ausgereift, die momentanen eigentlichen Bedürfnisse (wie beispielsweise per Smartphone über das letzte Wochenende zu kommunizieren) hintanzustellen ist also – rein biologisch betrachtet – ein äußerst schwieriges Unterfangen. Und wessen ureigenes aktuelles grundlegendes Bedürfnis ist schon Wirtschaftskunde oder Politische Bildung?
e) Limbische Region
Das Limbische System kann als Funktionseinheit aus Zwischenhirn und Großhirn betrachtet werden, u. a. Hippocampus, Hypothalamus und Amygdala (Mandelkern) befinden sich in dieser Region. Die Wissenschaft geht mit relativ großer Sicherheit davon aus, dass das limbische System maßgeblich an der Verschiebung von Inhalten aus dem Kurz- in das Langzeitgedächtnis beteiligt ist.
In der Amygdala werden einlangende Eindrücke daraufhin überprüft, ob Gefahr droht oder nicht. Wird Gefahr vom Mandelkern (genau genommen den Mandelkernen, das Gehirn besitzt zwei davon) als solche erkannt, wird der Körper auf schnelle Abwehr oder Flucht vorbereitet. So notwendig diese Angst auch in Hinblick auf Fluchtbereitschaft ist, ist sie im modernen Leben manchmal von Nachteil: Einerseits schließt sie Kreativität aus, andererseits lernt das Gehirn das Angstgefühl gleich mit (vgl. Schipek, o. J., S. 4). Negative Emotionen beim Lernen können somit den Lernprozess blockieren.
3.2 Das neuronale Netzwerk
Eine Nervenzelle „ist die funktionale Grundeinheit des Gehirns. Die strukturellen und funktionellen Eigenschaften von miteinander verschalteten Nervenzellen machen das Gehirn aus“ (Society of Neuroscience 2005, S. 6). Neuronen leiten, speichern und verarbeiten Signale. Über Eingangsleitungen (Dentriten) werden Signale auf den Zellkörper übertragen, welcher wiederum Ausgangssignale über eine Ausgangsleitung (Axon) weiterleitet. Die Eingangssignale müssen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, damit die Zelle ein Ausgangssignal produziert, wird dieser Grenzwert nicht erreicht, so gibt es keine Reaktion seitens der Zelle (vgl. Schipek, o.J., S. 2).
An den Synapsen, die am Ende der axonalen Verzweigungen gelegen sind und den Kontakt zu benachbarten Neuronen bilden, wird der Impuls übertragen. Je höher der Erregungsgrad im Axon ist, desto höher ist die Ausschüttung unterschiedlicher Über-trägersubstanzen. Manche Überträgerstoffe (Neurotransmitter) wirken erregend, andere hemmend (vgl. Schipek, o. J., S. 2). Die Synapsen verstärken sich, sobald miteinander verbundene Zellen zusammen aktiv sind. Dies wurde in der Wissenschaft schon vor mehr als hundert Jahren postuliert, 1973 konnte es erstmalig nachgewiesen werden.
Schon bei der Geburt ist der Mensch mit beinahe allen Nervenzellen ausgestattet, nur in wenigen Gehirnarealen kommt es auch später noch zu Neuronen-Neubildung. Laut Röder zählen hier jene Areale dazu, die für die Gedächtnisbildung von Bedeutung sind (vgl. Röder, 2015). Nach der Geburt wächst hauptsächlich nur mehr die Dicke der Fasern, nicht deren Anzahl. Dicke Nervenfasern leiten Signale bis zu 40 Mal schneller als dünne – erst diese hohe Geschwindigkeit macht es möglich, das Gehirn richtig zu nutzen. Diese komplexen Verdrahtungen passen sich während des gesamten Lebens an die jeweiligen neuen bzw. benötigten Nutzungsbedingungen an (vgl. Hüther, 2010, S. 11).
Relativ neu sind die Erkenntnisse über Gliazellen, welche lange Zeit bloß als „Leim“ zwischen den Neuronen betrachtet wurden. Erst vor wenigen Jahren wurde wissen-schaftlich erwiesen, dass besagte Zellen auch maßgeblich an der Informationsverarbei-tung mitwirken. Dieses Wissen könnte eventuell zu ganz neuen Theorien über die Funktionsweise des Gehirns führen, was aktuell jedoch noch nicht greifbar ist (vgl. Schwarz 2009, S. 5).
3.3 Wie das Gehirn lernt
Die Entwicklung eines Gehirns dauert bis über das 20. Lebensjahr hinaus, manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass sie erst mit 25 Jahren abgeschlossen ist. Der Stirnlappen reift zuletzt aus. Die Hauptfunktion des Stirnlappens ist – wie schon unter Kapitel 3.1 dargelegt – das Beurteilen, die Erkenntnis und die Regungskontrolle. Im schulischen Kontext sind Erstere für das Lernen wichtig, Letzteres in Hinblick auf das Verhalten in der Schule (vgl. Society for Neuroscience, 2005, S. 14).
Unter „deklarativem Gedächtnis“ versteht man die Fähigkeit zu lernen und sich bewusst an alltägliche Tatsachen und Ereignisse zu erinnern. Werden neue Erfahrungen gesammelt, wird die Information zunächst in einer Übergangsform des deklarativen Gedächtnisses, dem sogenannten „Arbeitsgedächtnis“, gespeichert. Das „semantische Gedächtnis“ ist jener Teil des deklarativen Gedächtnisses, das allgemeine Fakten und Einzelheiten beinhaltet. Das Erinnern an ganz spezielle persönliche Erfahrungen, die an einem bestimmten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit gemacht wurden, wird „episodisches Gedächtnis“ genannt (vgl. Society for Neuroscience 2005, S. 22). Die einzelnen „Gedächtnisse“ bilden eine Funktionseinheit, sie unterstützen sich gegenseitig (vgl. Herrmann, 2009b, S. 14).
Wenn man eine Fähigkeit erlernt, so kann man sie schrittweise immer besser – allgemein bekannt als Üben. Dieser Vorgang geht relativ langsam vor sich. Je öfter miteinander verknüpfte Neuronen aktiviert, also benützt werden, desto stärker wird die Verbindung zwischen den Neuronen, es entstehen neue Netzwerke. Je öfter in Folge diese neuen Netzwerke „angesprochen“ werden, desto leichter wird es, diese zu aktivieren (vgl. Schipek, o. J., S. 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Änderung des synaptischen Aufbaus mit zunehmendem Alter (Quelle: Universität Gießen, 2010)
Das bedeutet für das menschliche Gehirn: Synaptisches Lernen ist langsam und lebt von der Wiederholung (Schipek, o. J., S. 2).
Für viele unserer Gefühlsregungen sind Botenstoffe (Neurotransmitter) verantwortlich. Geht es um Freude bzw. Glücksgefühle, spielt Dopamin eine zentrale Rolle, auch dass Neues besonders gut im Gedächtnis haften bleibt, wird Dopamin zugeschrieben, es verstärkt somit den Lerneffekt (vgl. ebd., S. 5). Gesteckte Ziele erreichen, Leistungen erbringen, die stolz machen, bedeutet Freude. In diesen Fällen belohnt das Gehirn den Menschen mit Dopamin. Im Idealfall macht richtiges Lernen also nicht nur gebildet, sondern auch glücklich (vgl. ebd., S. 5).
Der Lernerfolg hängt auch maßgeblich vom Alter ab. Kinder lernen „kinderleicht“, Ältere dagegen vergleichsweise langsam. Dafür kann das Gehirn älterer Menschen auf mehr Vorhandenes zurückgreifen, es gibt mehr gut funktionierende Schaltungen, die Kontakte untereinander herstellen können. Auch die Lebenserfahrungen eines Menschen sind relevant, sie sind mitverantwortlich dafür, wie dieser Mensch aktuelle Geschehnisse erlebt, bewertet und wie er in Folge darauf reagiert (vgl. Hüther, 2010, S. 12).
Leider kennt fast jeder den Unterschied zwischen dem prinzipiellen Vorhandensein einer Erinnerung und der Fähigkeit, diese auch im richtigen Moment abrufen zu können (Stichwort Blackout). Warum das Gehirn bei diesem Aspekt ab und zu versagt, ist in der Wissenschaft nach wie vor ungeklärt.
Wenn es Schülerinnen und Schülern nicht gelingt, schulischen Lernstoff mit den indivi-duellen Lebenserfahrungen kognitiv zu verknüpfen (für Berufsschulen zählen hier auch die jeweiligen Arbeitsanforderungen der Lehrstelle dazu), werden sie letztendlich nicht gut lernen – laut Spitzer sogar gar nichts (vgl. Spitzer 2009, S. 416). Allerdings konnte die Frage, ob das Lernen ausschließlich oder hauptsächlich oder doch weniger von den gemachten Erfahrungen abhängt, wie wichtig also die Rolle der Umwelt in diesem Kontext ist, nicht endgültig geklärt werden, da aus ethischen Gründen die Umwelt von Säuglingen und Kindern nicht systematisch manipuliert werden kann.
Eric Knudsen (Stanford University) konnte 2004 nach zahlreichen vornehmlich tierexperimentellen Arbeiten die Rolle der Erfahrungen in der frühen Kindheit für die funktionelle Gehirnentwicklung sowie die Auswirkungen dieser Erfahrungen auf die Plastizität des Gehirns nachweisen (vgl. Knudsen, 2004, S. 1412 ff). Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Soziologie und Ökonomie leitete er 2006 daraus ab, dass frühkindliche Lernumwelten maßgeblich Einfluss auf späteres Lernpotenzial nehmen (vgl. Knudsen, 2006, S. 1155 ff).
Hier liegt eines der größten Probleme an Schulen, denn die frühkindliche Entwicklung kann nicht mehr revidiert werden. Zusätzlich erschwerend wirkt der Umstand, dass an lehrgangsmäßig geführten Berufsschulen nur zehn Wochen zur Verfügung stehen, in denen es gilt, eventuelle Defizite aus der Kinderzeit zu erkennen und dann entsprechend zu agieren.
Die Frage nach der Speicherung von Erinnerungen im Gehirn konnte nach wie vor nicht restlos geklärt werden. Die meisten Hirnforscherinnen und -forscher propagieren die Konsolidierungstheorie als Erklärungsansatz. Diese Theorie besagt, dass die Bildung von Gedächtnis auf zwei unterschiedlichen Teilprozessen basiert: Der Enkodierung, also der Darstellung eines eintreffenden Reizes als ein für das Gehirn lesbarer Code, und der darauffolgenden Phase der Konsolidierung, was festes Abspeichern der frischen Gedächtnisspuren bedeutet (vgl. Born, 2015). Neues wird zuerst im Hippocampus als Arbeitsgedächtnis abgelegt, weiters wird davon ausgegangen, dass im Tiefschlaf die Erinnerungen vom Hippocampus in die Großhirnrinde „verschoben“ werden, wo die Inhalte geordnet, sortiert und strukturiert werden (Details siehe Kapitel 5.3.1).
Nicht zufriedenstellend geklärt ist, wohin genau bei der nächtlichen Umstrukturierung „verschoben“ wird. Die Großhirnrinde ist ein relativ großer Bereich, diese Angabe ist somit nicht spezifisch. Sehr wahrscheinlich werden Erinnerungen dort in verteilten Netzwerken gespeichert. „Die Tatsache, dass Menschen mit Gedächtnisverlust Defizite in nur einzelnen und nicht in allen Aspekten des Gedächtnisses haben, zeigt, dass das Gehirn über mehrere Gedächtnissysteme verfügt, die von verschiedenen Hirnregionen getragen werden.“ (Society of Neuroscience, 2005, S. 22)
Zusammenfassend kann gesagt werden, je mehr eine Person schon weiß, desto besser kann sie Neues mit vorhandenem Wissen in Verbindung bringen. Das bedeutet nicht, dass jemand etwas nicht erlernen kann, weil er/sie kaum Vorwissen besitzt, es wird jedoch naturgemäß wesentlich schwieriger. Dies ist die altbekannte, tagtägliche Situation, mit der man an Schulen konfrontiert ist: Menschen sind unterschiedlich, ihr Wissen und ihre Erfahrungen gehen stark auseinander, trotzdem sollen sie das Gleiche lernen. Schülerinnen und Schüler, die schon früher mehr Zeit in ihre Bildung (dies darf keinesfalls nur als formale Bildung gesehen werden, vor allem das Elternhaus ist mit dem, was üblicherweise als „Erziehung“ bezeichnet wird, maßgeblich beteiligt) investiert haben, haben es in Folge in Institutionen der formalen Bildung leichter.
3.4 Neuroplastizität
Das menschliche Gehirn ist in der Form eines komplexen neuronalen Netzwerkes or-ganisiert, es lernt und entwickelt sich durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt (vgl. Schirp, 2014, S. 1). Es passt sich ununterbrochen den aktuellen Bedingungen, den Lebensumständen an, was als Neuroplastizität bezeichnet wird (vgl. Spitzer, 1996, S. 148 ff). Beim Verarbeiten neuer, unbekannter Informationen gehen Neuronen neue Verbindungen untereinander ein. Ist dem Gehirn noch kein Verarbeitungsweg bekannt, so bildet die entsprechende Nervenzelle neue, feine Fortsätze (Dentriten) in Richtung der Nachbarzellen, neue Synapsen (Kontaktstellen) entstehen. Werden diese nicht regelmäßig gebraucht, löst sich der Kontakt wieder auf. Je mehr Verknüpfungen es gibt, desto besser werden Eingangssignale verarbeitet, wie folgende zwei Beispiele belegen:
Wer beispielsweise Gitarre lernt, verändert das für die Finger der linken Hand zuständi-ge kortikale Areal (vgl. Elbert et al., 1995, S. 305). Es wird um 1,5 bis 3,5 Zentimeter länger. Je intensiver geübt wird und je früher jemand damit beginnt, desto größer ist der Zuwachs.
Wird jemandem die Hand amputiert, fehlen fortan die entsprechenden Eingangssignale für die betroffenen kortikalen Bereiche, welche dadurch kleiner werden. Bekommt jemand eine Hand transplantiert, so wachsen nachweislich binnen weniger Monate die betroffenen Bereiche des sensorischen Cortex wieder (vgl. Giraux et al., 2001, S. 692).
4 Intelligenz
Es gibt unzählige Versuche und Ansätze, den Begriff „Intelligenz“ zu definieren. Ein bekannter stammt vom Schweizer Biologen Jean Piaget, nach dessen Definition Intelligenz das sei, „was wir benutzen, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen“ (Flavell nach Piaget, 1963). Eine einfache, kurze Definition lieferte Pontes: „Intelligenz ist die allgemeine Fähigkeit, Informationen effizient zu verarbeiten.“ (Pontes, 2014)
Jeder Mensch hat Intelligenz, allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Vergleicht man den Intelligenzquotienten der Menschen, so entspricht das Ergebnis einer Normal-verteilung (Gaußsche Glockenkurve).
Viele Forscherinnen und Forscher betrachten Intelligenz als einheitlichen Faktor, geprägt durch Gene und Umwelt, der sich bei vielen Aufgabenstellungen äußert und maßgeblich die Art der Aufgabenlösung beeinflusst. Dieser einheitliche Faktor wird als IQ dargestellt (vgl. ebd.). IQ-Tests operationalisieren Versuche der Intelligenzmessung. Eine Schwierigkeit bei derartigen Tests ist allerdings darin zu sehen, dass es nachweisbar zu einem Trainingseffekt kommt: Wird ein IQ-Test mehrmals absolviert, schneiden die Testpersonen mit jedem Mal besser ab. Dem steht gegenüber, dass natürlich durch dieses mehrfache Durchführen des Tests niemand reell intelligenter geworden ist.
Intelligenz darf nicht mit Wissen und Bildung verwechselt bzw. gleichgestellt werden, welche man sich aneignen muss und einen starken kulturellen Kontext aufweisen, denn sie ist, genauso wie andere Persönlichkeitsmerkmale, nie vollständig kulturfrei definierbar (vgl. Rost, 2013, S. 17). Sie wird nicht erst durch Schulbesuch generiert, kommt jedoch bei der Aneignung von Wissen zum Einsatz. Der IQ gilt als jenes Per-sönlichkeitsmerkmal, mit dem sich der Erfolg im schulischen und beruflichen Leben am besten prognostizieren lässt.
In den 80er-Jahren wurde von Howard Gardner die Theorie der multiplen Intelligenzen entwickelt, dazu zählen u. a. die soziale und körperliche Intelligenz, in den 90er-Jahren wurde der Begriff der „emotionalen Intelligenz“ geprägt. Der Reiz der vielen Arten von Intelligenz scheint bis heute darin begründet zu sein, dass sich jeder Mensch in zumin-dest einer „Intelligenzart“ wiederfinden kann. Besagte Theorien stießen allerdings in der Wissenschaft auf massive Kritik und konnten auch in empirischen Untersuchungen nicht bestätigt werden. 2006 fand ein Forscherteam um Beth Visser heraus, dass die davor als „unterschiedliche Intelligenzen“ propagierten Fertigkeiten, wie z. B. die mathe-matische Intelligenz oder die soziale Intelligenz, nicht unabhängig voneinander sind, sondern mit dem Grad der allgemeinen Intelligenz bzw. kognitiven Grundfähigkeit korrelieren (vgl. Wolf, 2014), was Spearmans Theorie der kognitiven Grundfähigkeit bestätigt. Der englische Psychologe und Statistiker Charles Spearman (1863-1945) fand bei seinen Studien über Leistungstests heraus, dass jene Testpersonen, die bei der Testung der kognitiven Fähigkeiten reüssierten, tendenziell auch gute bis sehr gute Er-gebnisse bei Aufgaben in Bereichen des abstrakten Denkens vorweisen konnten. Diese Theorie der kognitiven Grundfähigkeit gilt auch heute noch als eine der wahrschein-lichsten Intelligenztheorien (vgl. Wolf, 2014).
Herkömmliche Intelligenztests sind zwar umstritten, geben jedoch eine recht zuverlässige Prognose darüber, wie gut eine Person ihr Leben meistern wird. Eine höhere Grundintelligenz steht (zumindest statistisch) in engem Zusammenhang mit schulischem oder beruflichem Erfolg, ebenso mit Lebenszufriedenheit und Gesundheit (vgl. Wolf, 2014). Trotzdem darf Intelligenz nicht als prinzipieller Garant für diesen Erfolg angesehen werden, nicht umsonst lautet ein altes Sprichwort „Übung macht den Meister“ (und nicht Intelligenz). Leistungsmotivation, Interesse und Disziplin müssen hinzukommen, um ein erfolgreiches Schul- bzw. Berufsleben führen zu können.
Interessant erscheint im schulischen Kontext auch, dass Intelligenz keine Absolute darstellt. Einen bekannten, von vielen Autoren übernommenen Beweis für die Ver-änderbarkeit von Intelligenz lieferte der so genannte Flynn-Effekt (nach dem amerika-nischen Politologen James Flynn), welcher besagt, dass spätere Geburtsjahrgänge in Intelligenztests jeweils besser abschneiden als vorausgehende – immerhin um 0,2 bis 0,4 IQ-Punkte pro Jahr. Weiters gilt als erwiesen, dass sich Intelligenz neben förder-lichen Umweltbedingungen (die ein Kind jedoch kaum selbst beeinflussen kann) durch dauerhaften, mehrjährigen Schulbesuch steigern lässt. Diese Steigerung ist nicht auf das frühe Kindesalter beschränkt, daher also bis zu einem gewissen Grad selbst steuerbar. Nach Detlef Rost (Universität Marburg) bringt jeder Monat Unterricht einen Zuwachs von ungefähr 0,5 IQ-Punkten (vgl. Rost, 2013, S. 15 ff).
Beim Zusammenwirken von Intelligenz und Wissen als Basis für die Bewältigung geistiger Anforderungen sind nach wie vor viele Fragen offen. Einerseits ist der Einfluss der Genetik in Zusammenhang mit Intelligenz unbestritten, andererseits gibt es zahlreiche Belege dafür, dass eine gut strukturierte Wissensbasis in einem speziellen Bereich durchaus eine ausreichende Voraussetzung für die Bewältigung einer gezielten geistigen Anforderung in genau diesem Bereich darstellt. Weniger intelligente Ex-pertinnen und Experten sind bei der Erledigung von Aufgaben (hoch-)intelligenten Neulingen meist überlegen (vgl. Stern, 2009, S. 123).
Die Tatsache, dass der Mensch abseits der herkömmlichen Intelligenzdefinition über wertvolle Talente verfügt, steht außer Zweifel.
5 Gehirngerecht Lernen
Gehirngerechtes Lernen stellt den Versuch dar, die aktuellen Ergebnisse der Hirn-forschung für die Didaktik aufzubereiten. Hintergrund sind die naturwissenschaftlich fundierten Annahmen, dass allen psychischen und geistigen Leistungen ein Vorgang im Gehirn bzw. Zentralnervensystem zugrunde liegt und für gehirngerechten Unterricht demnach umfassende Kenntnisse der Prozesse im Gehirn notwendig sind, um Lernumgebungen (im weiteren Sinn) effektiv und förderlich konstruieren zu können.
Durch bildgebende Verfahren wie Positronen-Emissions-Tomographie und Funktionelle Kernspinresonanz-Tomographie, die die Messung von Hirnaktivitäten bei ungeöffnetem Schädel ermöglichen, konnten enorme Fortschritte in den Untersuchungsmethoden zum Lernen erzielt werden. Vereinfacht ausgedrückt werden die Veränderung im Blutfluss und im Sauerstoffgehalt gemessen sowie aktive Hirnregionen während unterschiedlicher Tätigkeiten beobachtet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Großhirnaktivität am Beispiel verschiedener sprachlicher Aufgaben (Quelle: Menzel, 2006)
Gehirngerechtes Lernen ist kein Wundermittel, wie so manche populärwissenschaft-liche Arbeiten suggerieren. Es bietet jedoch durchaus wertvolle Erklärungen von Lern-vorgängen. Werden diese beachtet, so kann dies maßgeblich zu nachhaltigem Lern-erfolg beitragen. Vieles davon ist allerdings nicht neu und belegt all das, was Lehrkräfte schon immer wussten. Neu ist, dass es jetzt eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, warum manches funktioniert und manches nicht (vgl. Herrmann, 2009a, S. 148 ff).
5.1 Begriffsbestimmungen
5.1.1 Neurowissenschaft
Das Gebiet der Neurowissenschaften ist äußerst interdisziplinär, es zählen Medizin, Bio-logie, Pharmakologie, Informatik, Physik, Ökonomie, Psychologie und Pädagogik dazu.
Für die gegenständliche Bachelorarbeit stellt der Begriff der „kognitiven Neurowissen-schaft“ einen wichtigen Punkt dar. Sie erforscht neuronale Mechanismen, die kognitiven und psychischen Funktionen zugrunde liegen. Sie beschäftigt sich demnach maßgeblich mit den höheren Leistungen des Gehirns.
5.1.2 Didaktik
Didaktik ist die Wissenschaft vom Unterrichten. Didaktische Modelle haben das Ziel, Überlegungen zu Inhalten, Methoden, Medien, Sozialformen etc. für verschiedene Schulformen und -stufen sowie Unterrichtsgegenstände zusammenzufassen und theoretisch umfassend darzustellen. In Folge sollen sie auch praktikabel sein.
5.1.3 Neurodidaktik
Unter Neurodidaktik wird die Verknüpfung von pädagogischen Konzepten mit Erkennt-nissen der Gehirnforschung und Psychologie verstanden. Man könnte Neurodidaktik demnach als pädagogische Anwendung der Erkenntnisse der kognitiven Neurowissen-schaften sehen.
Der Begriff wurde vom Mathematikdidaktiker Gerhard Preiß vorgeschlagen, er erklärte Neurodidaktik als das
„Forschungs- und Handlungsgebiet, das vor allem die Zusammenhänge zwi-schen neurologischen Bedingungen und Lernprozessen des Menschen zu erkennen und zu beschreiben versucht, um daraus theoretische und prakti-sche Schlußfolgerungen sic! für die Didaktik abzuleiten.“ (Preiß, 1992, S. 99)
Es ist somit in erster Linie eine neue Sichtweise auf die Voraussetzungen sowie die Prozesse des Lernens und der Gedächtnisbildung im Hinblick auf die Aufnahme, Ver-arbeitung, Speicherung und Wiedergabe von Informationen. Die Tatsache, dass derlei Prozesse auch immer kulturell bzw. umweltbezogen geformt sind, wird oft als Contra gegen die Neurodidaktik angeführt (vgl. Müller, 2007, S. 202 ff).
5.1.4 Neuropädagogik
Der Begriff „Neuropädagogik“ fand bereits 1990 bei Dr. Andreas Zieger, Facharzt für Neurochirurgie, Verwendung. Zieger beschäftigte sich mit dem Rehabilitationswesen hirnverletzter Patientinnen und Patienten. Populärwissenschaftlich bezeichnet der Begriff jene Form der Pädagogik, in welche Erkenntnisse aus allen Bereichen der Neurowissenschaften einfließen. In der Literatur wird betont, wie wichtig es sei, einen interdisziplinären Austausch anzustreben, um das Erziehen und Lehren zu verbessern (vgl. Armand, 2008).
5.2 Ausgewählte ExpertInnen-Theorien
Die Theorien nachfolgend angeführter anerkannter Expertinnen und Experten werden kurz erläutert und in Hinblick auf Anwendbarkeit im Berufsschulalltag bewertet.
5.2.1 Brand, Matthias und Markowitsch, Lukas
Nach Brand und Markowitsch (vgl. Brand, Markowitsch, 2009, S. 69 ff) gilt es prinzipiell gleichzeitig zwei Wege zu beschreiten, nämlich eine Reduzierung der Anforderungen und eine gezielte Verbesserung unterschiedlicher Gedächtnisleistungen. Die folgenden Empfehlungen zielen auf eine Vermittlung von semantischen Gedächtnisinhalten bei gleichzeitiger Berücksichtigung des episodischen Gedächtnisses ab, was am ehesten dem Lernen im schulischen Kontext entspricht (vgl. ebd., S. 81-82).
- Die Reduktion der Anforderungen in der Aufnahmephase fokussiert die Aufmerk-samkeit auf das Wesentliche, eine Steigerung der Lernleistung kann die Folge sein. Wichtige Informationen müssen hervorgehoben werden, wobei nicht extra erwähnt werden sollte, dass etwas nicht so wichtig ist.
- Priming: Ein Stoffüberblick zu Beginn der Unterrichtsstunde bewirkt die „bessere Wiedererkennungsleistung von zuvor unbewusst Wahrgenommenem“ (Weinreich, 2010, S. 7). Dieser Überblick, vorzugsweise verbunden mit einer Vorstellung der Struktur über die kommende Lerneinheit, wirkt als externe Einspeicherungshilfe.
- Schülerinnen und Schüler sollen das dargebotene Material selbst strukturieren, z. B. könnte das bisher Besprochene selbstständig nach Wichtigkeit sortiert werden, wobei die Lehrkräfte unterstützend helfen können.
- Ein Bezug des Lernstoffs zu bekannten Themen bzw. der fächerübergreifende Bezug erleichtert die Einspeicherung und Festigung, ein persönlicher Bezug und das Erken-nen der Alltagsrelevanz bringen eine tiefere Verarbeitung mit sich. Emotionales wird durchschnittlich besser erinnert als Neutrales.
- Arbeit in Kleingruppen sowie Medienvielfalt führen ebenfalls dazu, dass Neues besser verarbeitet und eingespeichert wird. Jedoch muss ein Medienwechsel bewusst und zielgerichtet eingesetzt werden, bestenfalls wird der Zweck des gewählten Mediums kommentiert.
- Die Begeisterung der Lehrpersonen für ihr Fach sowie das Auftreten derselben beein-flusst Schülerinnen und Schüler positiv. Motivation und Glaubwürdigkeit der Unter-richtenden sind wichtig.
Die Autoren betonen selbst, dass diese Erkenntnisse trivial klingen mögen, aber aus neurowissenschaftlicher Perspektive gut erklär- und belegbar und damit von großer Be-deutung seien (vgl. Brand, Markowitsch, 2009, S. 83).
5.2.2 Caine, Renate und Geoffrey
Die Caines haben die Ergebnisse unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen in zwölf für Pädagoginnen und Pädagogen verständliche und ihrer Meinung nach umsetz-bare Lernprinzipien zusammengefasst.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2016, Gehirngerechtes Lernen im Jugendalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514413
Kostenlos Autor werden




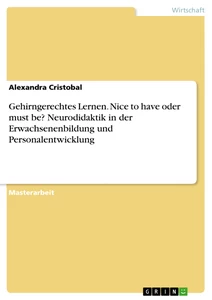















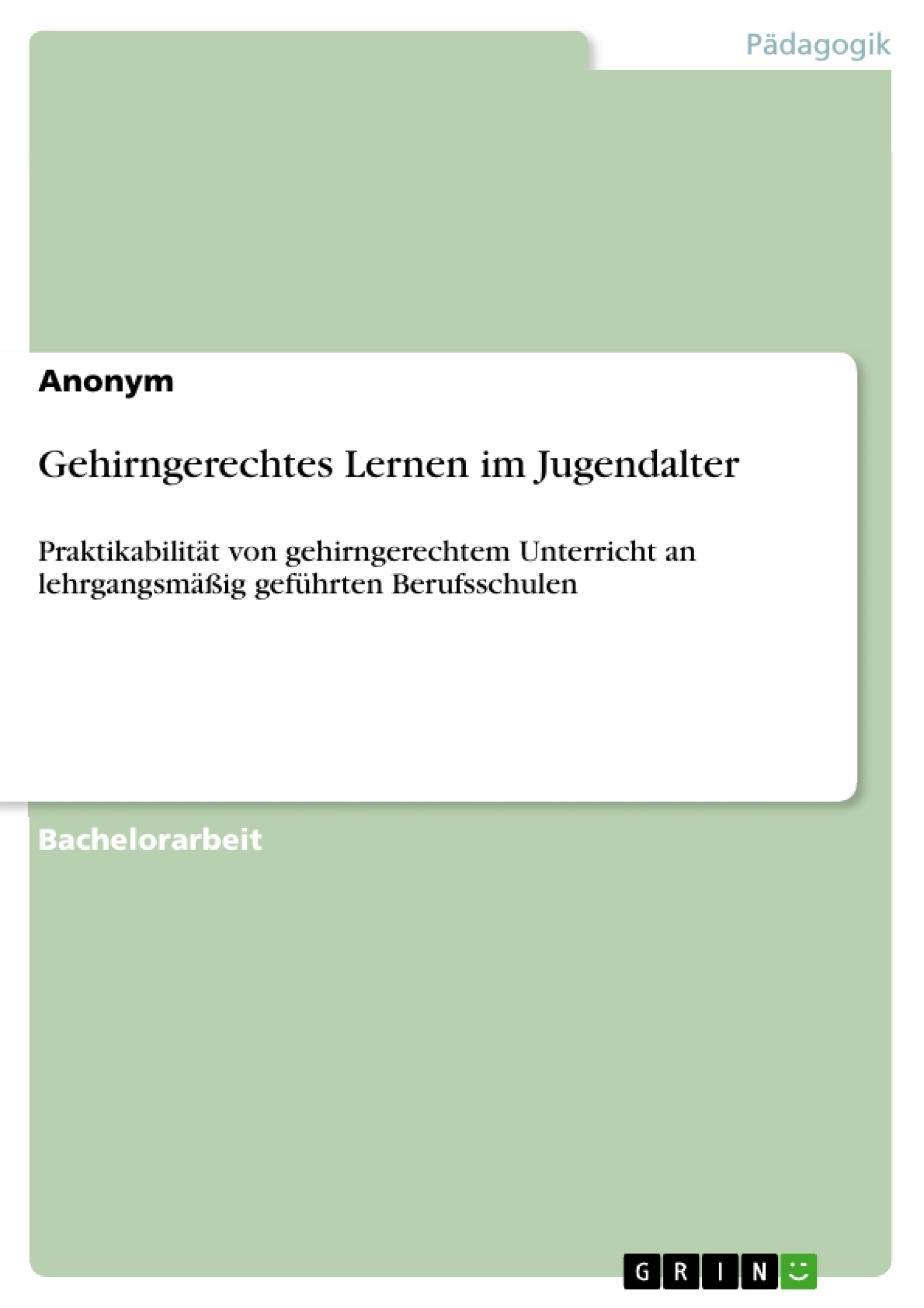

Kommentare