Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
Danksagung
Einleitung
1 Die Ostdeutschlandforschung
1.1 Historischer Verlauf
1.2 Die Entwicklung der theoretisch-methodischen Konzepte
1.3 Bilanzen der deutschen Einheit
2 Begriffsklärung und theoretische Zugänge
2.1 Transformationsforschung
2.2 Transformationstheorie
2.3 Theoretische Konzepte der Transformationsforschung
2.3.2 Systemtheoretische Konzepte
2.3.2.1 Kritische Anmerkungen
2.3.2.2 Vereinigungsbilanzen
2.3.2.3 Validität
2.3.3 Modernisierungstheoretische Konzepte
2.3.3.1 Kritische Anmerkungen
2.3.3.2 Vereinigungsbilanzen
2.3.3.3 Validität
2.3.4 Akteur- und institutionentheoretische Konzepte
2.3.4.1 Kritische Anmerkungen
2.3.4.2 Vereinigungsbilanzen
2.3.4.3 Validität
2.3.5 Handlungstheoretische Konzepte
2.3.5.1 Kritische Anmerkungen
2.3.5.2 Vereinigungsbilanzen
2.3.5.3 Validität
2.4. Zwischenbilanz zu Transformationstheorie und –forschung
3. Innere Einheit
3.1 „Innere Einheit“ – Begriffsklärung
3.2 Positionen der Forschung
3.2.1 Die vollzogene innere Einheit 3
3.2.2 Kulturelle Differenz als Chance
3.2.2.1 Wurzeln der politisch-kulturellen Differenz
3.2.2.2 Zwei politische Kulturen der Einheit?
3.2.3 Ostdeutsche Teilgesellschaft als Entwicklungsblockade
3.2.4 Ostdeutsche als postfordistische Avantgarde
3.3 Gründe für die Ost-West-Differenzierungen
3.3.1 Sozialisationsthese
3.3.2 Situationsthese
3.3.3 Kompensationsthese
3.4 Zwischenbilanz zu innerer Einheit
4 Ostdeutsche Identität
4.1 Personale Identität
4.2 Kollektive und kulturelle Identität
4.3 Gedächtnis und kulturelle Erinnerung
4.3.1 Gedächtnis
4.3.2 Erinnerung
4.3.3. Geteilte kollektive Erinnerung der Deutschen
4.4. Soziale Identität
4.4.1. Ostdeutsche soziale Identität
4.4.2. Ost-Nostalgie
4.5 Bilanz: Ostdeutsche Identität – ein multidimensionales Phänomen
5. Schlussbetrachtungen-
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Sammelbände
Danksagung
Ganz besonders dankbar bin ich Anna, ohne die ich diese Arbeit gewiss gar nicht erst begonnen hätte und die mir immer viel von ihrer Kraft geschenkt hat. Meine ganze Liebe soll dafür und überhaupt mit ihr sein. Dank gilt auch meinen Freunden, die mich auch während schwieriger Launen ertragen mussten und mir dabei mit viel Nachsicht begegneten. Jan und Carl haben mir sehr geholfen. Ohne sie wäre mein Werk nicht in dieser Form erschienen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Meinen Eltern, die mich nun schon so lange vielseitig unterstützt haben, widme ich hiermit diese Arbeit. Dankend erwähnt sei nicht zuletzt Christian Fenner, für die, aus eigenem Verschulden wenigen, aber doch immer sehr anregenden fachlichen Gespräche.
Einleitung
Vierzehn Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung scheinen die Deutschen in Ost und West von der so genannten „Inneren Einheit“[1] weiter entfernt zu sein als je zuvor. Insbesondere nationale Reformprojekte, die mit Einschnitten im Sozialsystem verbunden sind, machen dies immer wieder deutlich.
Die Transformationsforschung und die politische Kulturforschung hat im Laufe dieser eineinhalb Jahrzehnte eine Vielzahl von Erklärungsansätzen geliefert, die im einzelnen keine zufriedenstellende Erklärung des Problems liefern können und sich zum Teil sogar diametral gegenüberstehen, einander widersprechen oder gar das Problem der inneren Einheit als solches in Frage stellen. Obwohl die empirischen Befunde über das Transformations- und Einheitsprojekt im Prinzip recht eindeutig sind, wird die deutsche Einheit unterschiedlich bilanziert.
Jede Vereinigungsbilanz in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bringt auch eine spezifische Position zum Stand der inneren Einheit hervor. Die Positionen verteilen sich dabei, je nach Blickwinkel des Betrachters, über ein weites Spektrum. Angefangen beim Standpunkt einer gelungenen Einheit, die auf dem richtigen Weg ist, bei der Wert- und Einstellungsdifferenzen zwischen den Deutschen im Osten und Westen des Landes als marginal bezeichnet werden und kaum über andere regionale Differenzen hinaus gehen,[2] über die Position einer kulturellen Differenzierung über eine ostdeutsche Sonderidentität, die eine Normalisierung und Bereicherung der politischen Kultur der Bundesrepublik darstellt,[3] bis hin zur Bilanz, dass fundamentale Wertunterschiede und eine Abgrenzungsidentität auf Seiten der Ostdeutschen ein hohes anomisches Potential besitzen, die die demokratische politische Kultur Deutschlands gefährden.[4]
Es stellen sich folgende zentrale Fragen, die sehr unterschiedlich beantwortet werden: Wie verschieden sind, denken und handeln die Menschen in Ost und West? Wie notwendig ist eine Angleichung? Mit welchen Begriffen sind die Unterschiede zu fassen und wie wirkungsmächtig sind diese? Doch worin sind diese inkohärenten Urteile begründet, die als Antworten auf die gleichen Fragen mit der gleichen empirischen Datenbasis angeboten werden?
Ein Grund dafür stellt die mehrfach kritisierte mangelnde theoretische Fundierung der sozialwissenschaftlichen Analysen dar. Eine verbindliche Theorie liegt weder für die Transformation in Ost- und Mitteleuropa vor, noch für den spezifischen deutsch-deutschen Transformationsfall, weshalb Erfolg und Misserfolg beider Fälle nicht genau definiert werden können. Hinzu kommt, dass sich einzelne wirtschaftliche, soziale und kulturelle Tendenzen der Vereinigung überlagern und zum Teil widersprechen. Deshalb können sie nicht eindeutig klassifizieren werden.[5] Solche unterschiedlichen Urteile wären in einem pluralen Wissenschaftsbetrieb kein Problem. Sie treten jedoch auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene dort auf, wo sie auffällig mit dem jeweiligen Standort des Urteilenden und dessen wahltaktischen Kalkülen korrelieren. Deshalb ist ein konzeptioneller und praktischer Bewertungsmaßstab mit nachvollziehbaren Indikatoren gefordert. Dazu gibt es allerdings weder eine gesamtdeutsche noch eine internationale Einigung in den Sozialwissenschaften und darüber hinaus.
Nach einem immensen Forschungsboom bis Mitte der neunziger Jahre, der eine große Anzahl empirischer Forschungen und einige tausend Publikationen zum Thema der postsozialistischen Transformation und der deutschen Einheit hervorgebracht hat, ist in den letzten Jahren die sozialwissenschaftliche Forschung und Theorienbildung zu diesen Themen nahezu zum Erliegen gekommen, obwohl – wie einige Wissenschaftler anmerken – noch immer weiterer Forschungsbedarf besteht und man nicht von einem wissenschaftlichen Konsens über Bilanz und Perspektiven von Transformation und Einheit auf Grund erschöpfender empirischer Datenbasis und theoretischer Fundierung sprechen kann.
In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, einen Überblick über die Forschungen zur deutschen Einheit und postsozialistischen Transformation in Ostdeutschland in ihrem historischen Verlauf und ihren theoretischen Debatten zu skizzieren. Wegen der großen Zahl von Forschungsarbeiten und Publikationen zu diesem Themenkomplex muss eine erschöpfende Darstellung ausgeschlossen und eine Fokussierung auf die politikwissenschaftliche Forschung, insbesondere auf die politische Kulturforschung sowie die Soziologie, vorgenommen werden. Eine weitere Spezifizierung findet die Arbeit in der Konzentration auf die Erforschung und die theoretische Debatte zur sozialen und kulturellen Einheit Deutschlands. Für diese Studie wurden Veröffentlichungen zum Thema innere Einheit respektive den damit zusammenhängenden Begrifflichkeiten wie (ostdeutsche) Sondermentalität oder (kollektive) Identität untersucht, um eine theoretische Spurensuche nach sozialwissenschaftlich operationalisierbaren Begriffen zu unternehmen, auf deren Grundlage eine Einschätzung von Stand und Perspektiven der Einheit Deutschlands erst ermöglicht wird. Zusätzlich wurden multidisziplinäre Ansätze in den Blick genommen und herausgearbeitet, inwieweit diese ein höheres Erklärungspotential besitzen als unidisziplinäre Zugänge.
Ziele dieser Arbeit sind, den Stand der Forschung und die theoretische Debatte zur inneren Einigung Deutschlands zu reflektieren und zu klären, inwieweit die inzwischen weitgehend marginalen sozialwissenschaftlichen Bemühungen um diesen Untersuchungsgegenstand gerechtfertigt werden können, wo Bedarf nach weitergehender Forschung besteht und an welchen theoretisch-methodischen Modellen diese anknüpfen sollten.
Im Einzelnen werden dafür zunächst die Ostdeutschlandforschung in ihrer Entwicklung seit 1989/90 und die dabei zu Grunde gelegten theoretisch-methodischen Fundierungen sowie Bilanzen des Einigungsprozesses resümiert. (Kap. 1) Im Anschluss werden die theoretischen Konzepte der Transformationsforschung und die Aufspaltungen in die verschiednen Theorieschulen vorgestellt. Dieser Darstellung wird eine kritische Beleuchtung der Modelle und Konzepte und ihre jeweils spezifischen Vereinigungsbilanzen gegenübergestellt. (Kap. 2)
Das dritte Kapitel widmet sich dem Begriff der „Inneren Einheit“ und den entsprechenden Positionen der Forschung. Für die Einschätzungen zum Status quo der inneren Einheit in Deutschland sind im Wesentlichen drei Modellannahmen bestimmend, die – der einschlägigen Literatur zum Thema folgend – zusammenfassend als Sozialisationsthese, Situationsthese und Kompensationsthese bezeichnet werden. Alle drei werden hier kurz vorgestellt. Vor dem Hintergrund der Zuordnung der Positionen der Forschung zur jeweiligen methodischen Konzeption soll eine Zwischenbilanz zum Stand der inneren Einheit versucht werden. Dabei wird der folgenden These nachgegangen: Das Problem der kulturellen und sozialen Einheit Deutschlands wird durch die Beobachtung der Herausbildung eigenständiger „Wir“-Gruppen besser erfasst als mit dem Begriff der „Inneren Einheit“ oder dem bloßen Instrumentarium der politischen Kulturforschung über die Untersuchung von Wert- und Einstellungsdifferenzen. (Kap. 3)
Um die Bedingungen der Möglichkeit dieser „Wir“-Gruppen untersuchen zu können, werden die Ergebnisse der politischen Kulturforschung interdisziplinär betrachtet. Eingang finden besonders historische und sozialpsychologische Ansätze der kulturellen respektive sozialen Identität. In dieser Weise wird versucht einen operationalisierbareren Begriff zu finden und damit dem Umstand Rechnung getragen, dass der Identitätsbegriff auf Grund seiner semantischen Breite vielfach als diskreditiert gilt. Verschiedene Forschungsansätze, bei denen der Identitätsbegriff bereits Eingang gefunden hat, werden aufgegriffen und auf ihr Potential zur Erklärung ostdeutscher Wir-Gruppen-Identifikation untersucht. (Kap. 4)
Die gesamte Darstellung soll schließlich eine Einschätzung ermöglichen inwieweit die inzwischen weitgehend marginalen Forschungsanstrengungen zur Vereinigung in Deutschland als gerechtfertigt gelten können oder ob weiterer Forschungsbedarf besteht und an welche Konzepte dieser anknüpfen sollte.
1 Die Ostdeutschlandforschung
Mit dem überraschenden Zusammenbruch der sozialistischen Systeme sowjetischen Typs in Europa und deren damit notwendig gewordener Transformation, entstand ein neues Forschungsfeld, für das zunächst keine theoretischen Grundlagen existierten, da dieser Vorgang weder von der Wissenschaft noch der Politik antizipiert wurden. Gerade die Sozialwissenschaften mussten für dieses „Unvermögen“ der Vorhersage viel Häme einstecken, hatten sie doch seit den siebziger Jahren, wie auch die Politik, auf Systemwandel, Reform und west-östliche Koevolution gesetzt, anstatt auf Systemwechsel, Revolution, Inkorporation und Vereinigung. Festgefahrene Arrangements und Strukturen der Nachkriegsordnung brachen zusammen – gemeinsam mit Grundannahmen und Denkfiguren, die bis dahin auch in den Sozialwissenschaften ihren festen Platz beansprucht hatten.[6] Dies führte zu Irritationen und selbstkritischen Reflexionen.[7] Doch nicht jener „’Schwarze Freitag’ der Sozialwissenschaften“[8] gab die drängenden Fragen der Forschung nach 1989 auf, denn diese Kritik konnte mit den Hinweisen auf die strukturelle Beschränkung der Sozialforschung in totalitären Systemen sowie auf die Begrenzungen der Prognostizierbarkeit sozialer Ereignisse auf Grund von Multikausalität, Nichtlinearität und Interferenz[9] abgeschwächt werden. Sondern in den Mittelpunkt sozialwissenschaftlicher Fragestellung rückten vielmehr die Folgen des Zusammenbruchs des Nachkriegssystems für die Entwicklung der westlichen Moderne, für den sozialen Wandel sowie die Menschen, die ihn zu gestalten oder schlicht zu durchleben hatten. Nicht zuletzt standen Kategorien- und Theorienbildung der Sozialwissenschaften selbst auf dem Prüfstand.[10]
1.1 Historischer Verlauf
Nach der Überraschung von 1989 war die Stimmung von Aufbruch und großen Hoffnungen geprägt. Viele Wissenschaftler sahen sich einer neuen Forschungssituation gegenüber, die die seltene Chance bot, bisher dominierende theoretische Grundannahmen empirisch zu überprüfen. Zudem galt es, einen bis dahin historisch erstmals auftretenden Prozess, der gleichzeitigen wirtschaftlichen wie auch politischen Transformation – von der Einparteienherrschaft zur parlamentarischen Demokratie und von der sozialistischen Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft – direkt und zeitnah sozialwissenschaftlich zu begleiten, d.h. eine empirische Datenbasis anzulegen und daran die Bildung neuer Theorien der Transformation zu messen bzw. zu forcieren.
Es handelte sich also um ein wissenschaftsgeschichtlich wie auch gesellschaftspolitisch attraktives Forschungsfeld. Anhand der großen Zahl empirischer Forschungsprojekte, die direkt nach der 1989er-Wende gestartet wurden und den vielen Publikationen, die bereits ab 1990 erschienen, kann man nahezu eine Euphorie ablesen, die die internationale Forschergemeinde erfasst hatte. Allein zum Thema Ostdeutschland und Transformation bzw. Vereinigung bewegt sich nach FORIS die Größenordnung empirischer Forschungsprojekte zwischen 1000 bis 1600 im Zeitraum zwischen 1990 und 2001.[11] Die Schwankungsbreite resultiert dabei aus der definitorischen Unschärfe der Abgrenzung der Ostdeutschlandforschung von der reinen DDR-Forschung und der Germanistik bzw. „German Studies“. So befasst sich Ostdeutschlandforschung, nach Raj Kollmorgen, aus „sozialwissenschaftlicher Perspektive mit gesellschaftlichen bzw. gesellschaftlich bedingten Transformationsprozessen und deren Folgen in den ‚fünf neuen Bundesländern’ seit 1989/90“.[12] Die DDR-Forschung hingegen betrachtet nur das historische und die Germanistik nur das sprach- und literaturwissenschaftliche Objekt – beide jeweils ohne Bezug auf die Transformation.
Im Folgenden soll die so definierte Ostdeutschlandforschung in ihrem Verlauf von 1989 bis heute beschrieben werden. In diesem Kapitel wird es wesentlich um die Inhalte, also um Forschungsthemen der deutschen und speziell soziologischen und politikwissenschaftlichen Analyse sowie um quantitative Angaben gehen. Im darauf folgenden Kapitel wird die Entwicklung der theoretisch-methodischen Orientierungen näher beleuchtet.
Raj Kollmorgen bietet eine Vier-Phasen-Einteilung als Ordnungsschema für den zeitlichen Verlauf der Ostdeutschlandforschung an, das jedoch wegen der geringen zeitlichen wie inhaltlichen Trennschärfe als weitgehend willkürlich erscheint.[13] Auch Arno Waschkuhn beschreibt die Ostdeutschlandforschung ähnlich in drei Phasen[14] und erfasst diese in einem Schichtenmodell.
Die großen sozialwissenschaftlichen Fördereinrichtungen realisierten in Form von Sonderprogrammen sowie durch neu eingerichtete Forschungs- und Förderinstitutionen breit angelegte Analysen der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Transitionsprozesse in den neuen Bundesländern. In den Anfangsjahren formulierte wesentliche wissenschaftspolitische Forschungsabsichten waren erstens die umfassende Beschreibung und Archivierung des welthistorisch bedeutenden Vorgangs der postsozialistischen Transformation auf Basis einer staatsrechtlichen Vereinigung. Um die Daten dann der deutschen wie auch internationalen Wissenschaftlergemeinde zur späteren Analyse zur Verfügung zu stellen. Zweitens sollten Wissenslücken gegenüber der ostdeutschen Gesellschaft schnellst möglich geschlossen werden, um der Wissenschaft und der Politik empirisch gesichertes Wissen zur weiteren „Verarbeitung“ bereit zu stellen. Schließlich konnte drittens die Ostdeutschlandforschung dazu genutzt werden, die Sozialwissenschaften vor Ort neu zu strukturieren und ostdeutsche Forscher in die gesamtdeutsche Wissenschaftlergemeinschaft zu integrieren.[15]
Die ersten Jahre der Forschung waren von Auseinandersetzungen mit den Verläufen und Ursachen des politischen und ökonomischen Zusammenbruchs der DDR und des Realsozialismus insgesamt geprägt. Damit sollte der Kritik begegnet werden, die Sozialwissenschaften und ihre drei den Sozialismus je spezifisch erklärenden Globaltheorien – die Modernisierungs-, die Totalitarismus- und die Konvergenztheorie – hätten es nicht vermocht, das Ende des sozialistischen Systems, sei es nun Revolution oder Implosion, zu prognostizieren. In diesen Zusammenhang fällt auch die Einordnung des ostdeutschen Falls in die Interpretation des epochalen Bruchs. Desweiteren beschäftigte sich besonders die politische Kulturforschung mit politischen Stimmungen, Orientierungen und Wahlabsichten im engeren Übergang, also der eigentlichen Wende und dem institutionellen Vereinigungsgeschehen. Mit den gewonnenen Daten konnten politikwissenschaftliche Analysen vorgenommen werden, die vorwiegend auf der theoretisch-methodischen Grundlage von Fallstudien und sehr schnell auch repräsentativen Bevölkerungsumfragen erhoben wurden. Von besonderem Interesse waren außerdem die Bereiche Arbeitsmarkt und Beschäftigung sowie soziale Sicherung und Wohlfahrt und die dort zu beobachtenden sozialpolitischen und ökonomischen Wirkungen der Inkorporation der ehemaligen DDR-Bevölkerung.
Obwohl schon in den Anfangsjahren die Hoffnungen groß waren, mit den Untersuchungen der postsozialistischen Transformation die tradierten Theorien sozialen Wandels kritisch zu überprüfen, muss festgestellt werden, dass es sich kaum um empirische Theorietests handelte, sondern eher um Datensammlungen, deren unterschiedliche theoretische Grundlagen eher als orientierende Folien dienten.[16] Jene erste Phase kann auch als „empirisch orientierte Ad-hoc-Forschung“[17] beschrieben werden. Waschkuhn benennt ein doppeltes Defizit der Forschungen bis etwa 1993/94: Zum einen führte die gegenwartsfixierte, empirische Ausrichtung zur Unterbelichtung oder gar „Ausblendung theoretischer Suchmuster und Problemartikulationen“, so dass zum anderen ein Rahmen fehlte, der geholfen hätte, die Studien anzuleiten und die Ergebnisse analytisch zu interpretieren.[18]
Bis Mitte der neunziger Jahre nahmen die Breite empirischer Erhebungen und auch die theoretischen und analytischen Diskussionen erheblich zu. Mit der „Vereinigungskrise“[19] um die Jahre 1991 bis etwa 1994 drängten zunehmend die erheblichen Probleme in Ökonomie, Sozialpolitik und Sozialkultur auf die wissenschaftliche Themenagenda. Etwa zwei bis drei Jahre später gerieten verstärkt die ost- und mittelosteuropäischen Transformationsgesellschaften ins Blickfeld, jedoch ohne die dort gewonnenen Ergebnisse in dem häufig geforderten Maß mit den Verhältnissen in Ostdeutschland zu vergleichen, um aus den unterschiedlich strukturierten Rahmenbedingungen Erkenntnisvorteile ziehen zu können. Erste Anzeichen einer Übersättigung des Ostdeutschlanddiskurses waren zu erkennen. Dies wurde von Seiten der Politik, namentlich der damaligen Bundesregierung unter Helmut Kohl, noch verstärkt. Aus wahltaktischen Überlegungen musste von der Unzufriedenheit der Bevölkerung über die mangelhafte Erfüllung der Wahlversprechen aus den Wendejahren abgelenkt werden, indem man öffentliche wie auch wissenschaftliche Debatten zum Thema vermied. Die staatliche Forschungsförderung für ostdeutsche Transformationsforschung nach dem starken Aufschwung zwischen 1992 und 1996 sukzessive zurückzunehmen, erleichterte das. Insgesamt werden für diesen Zeitraum etwa eintausend sozialwissenschaftliche Projekte mit sehr unterschiedlichem Umfang gezählt. Überwiegend westdeutsche Forschungseinrichtungen und Hochschullehrer realisierten diese. Ostdeutsche Wissenschaftler waren demgegenüber zum überwiegenden Teil auf Drittmittelförderung angewiesen.[20]
Zu den genannten Themen kamen ab Mitte der neunziger Jahre Analysen zu den Finanz- und Elitentransfers zwischen Ost und West sowie den damit verbunden strukturellen und individuellen Folgen. Erstmals gerieten die deutsch-deutschen Kultur- und Identitätskonflikte in den Blick der Wissenschaft. Wendungen vom „Bürger zweiter Klasse“, von der „ostdeutschen Sonderidentität“ oder einer spezifischen „politischen Kultur des Ostens“ wurden im Zuge dessen geprägt. Regionalen Disparitäten innerhalb von Transformation und Vereinigung wurden zunehmend erforscht. Ab 1996 büßte das Thema Ostdeutschland innerhalb der Sozialwissenschaften immer mehr an Attraktivität ein, obwohl oder trotzdem noch einmal ein Aufleben der theoretisch-methodischen Diskussionen erkennbar wurde. Komparative Analysen gewannen an Bedeutung. Langfristige soziokulturelle Eigenheiten der Ostdeutschen traten stärker in den Vordergrund, dies knüpfte an die Debatte um spezifische Ost-Identität an.[21] Wechselseitige Beeinflussungen zwischen Wissenschaft und medialer Öffentlichkeit waren wiederholt zu beobachten. So nahm das Phänomen der Ost-Nostalgie zu, wurde von den Medien aufgegriffen und vermarktet. Das wiederum veranlasste auch die Wissenschaftler dazu, den Eigenheiten der Ostdeutschen nachzugehen, die wieder verstärkt ostdeutsche Produkte kauften, sowie die „alten“ Symbole und Zeichen der DDR-Vergangenheit pflegten. Besonders in diesem Bereich wurde außerdem eine auch allgemein zunehmende Multidisziplinarität der Ostdeutschlandforschung erkennbar.
Anlässlich der zehnjährigen Jubiläen von „Wende“ und Vereinigung konnte noch einmal ein erheblicher aber kurzer Anstieg der publizistischen Aktivitäten verzeichnet werden. Im Besonderen erschienen eine Reihe von Bilanzen der deutsch-deutschen Verhältnisse und dem Stand der Vereinigung.[22] Der Anteil der Ostdeutschlandforschung ging danach erneut weiter zurück und betrug 1999/2000 nur noch ein Zehntel des Wertes von 1992.[23] Lediglich an den Universitäten Halle und Jena wurde der erste Sonderforschungsbereich zu Ostdeutschland (SFB 580) eingerichtet. Das konnte aber den stetigen und erheblichen Niedergang der Ostdeutschlandforschung nicht mehr aufhalten. Die vergleichende Perspektive gewann zwar noch einmal an Aufschwung, das hat aber nur begrenzt zu einem Theoretisierungsschub geführt. Wenn auch in den Jahren nach 2000 wieder ein Aufleben der theoretisch-methodologischen Debatte erkennbar wurde, so ist doch bis heute keine generelle Transformationstheorie zu verzeichnen. Da sich die Forschungsanstrengungen diesbezüglich inzwischen auf einem quantitativ niedrigen Niveau bewegen, muss zunächst auch offen bleiben, ob es diese Theorie aus wissenschaftslogischen Gründen nicht geben kann oder ob einfach die Debatte nicht ausführlich genug geführt wurde. Eine Reihe von Wissenschaftlern erteilt der Möglichkeit genuinen Transformationstheorie inzwischen auch eine Absage.[24]
1.2 Die Entwicklung der theoretisch-methodischen Konzepte
Die begrenzte Zahl an Ordnungsoptionen, die sich innerhalb der Flächenstaaten in der Moderne entwickelt hat, lässt sich in einer weitgehend undifferenzierten Zweiteilung politisch auf demokratische und nicht-demokratische und ökonomisch in markt- und planwirtschaftliche Varianten reduzieren. Innerhalb dieser Dichotomie wurden natürlich eine Reihe wichtiger Differenzierungen getroffen. Hat man die immense Zahl menschlicher Opfer im Blick, die Diktaturen kommunistischer und faschistischer Couleur zu verantworten haben, kann man die Demokratie als die wünschenswerteste Ordnung politischer Systeme betrachten. Wenngleich diese Aussage nicht zum Ausdruck bringen soll, dass die Demokratie gar keine Opfer mit sich bringt, so kann man darauf doch wenigstens das Interesse der Sozialwissenschaften begründen, wie die Bedingungen der Möglichkeit von Demokratie in der Moderne verfasst sind und wie ein Übergang aus anderen Regierungsformen möglich wird. Behält man darüber hinaus im Blick, dass noch Ende der achtziger Jahre das sozialistische Gesellschaftsmodell als dauerhafte Herausforderung der westlichen Demokratie galt, dann wird deutlich, in welch hochgradige Irritation der Zusammenbruch des Staatssozialismus in Ost- und Mittelosteuropa die Sozialwissenschaften gestürzt hatte, die von diesem Phänomen in besonderer Weise berührt wurden.[25]
Für diesen gesamten Themenkomplex des Übergangs in eine andere Ordnungsform, sei sie politischer wie auch ökonomischer Natur, hat sich in der deutschen Forschungslandschaft der Begriff Transformationsforschung als weitgehender Konsens herausgebildet. Für die Ostdeutschlandforschung bleibt zunächst festzuhalten, dass bei der schieren Masse an Publikationen ein erschöpfender Bewertungsversuch von vorneherein zum Scheitern verurteilt bleibt. Außerdem scheint jedes Thema, jeder Gesellschaftsbereich, jeder Problemaspekt und jede Gruppe bereits analysiert und für diese Analysen nahezu jeder theoretisch-methodische Ansatz zur Anwendung gekommen zu sein. Das deutet auf eine Vereinzelung der Forschung hin, weshalb ein Nachlassen derselben nicht als gerechtfertigt gelten kann.[26]
An dieser Stelle soll versucht werden, den Verlauf der theoretischen Debatte ab 1989 nachzuzeichnen. Bei den ersten Forschungsarbeiten zwischen 1989 und 1991 hielten sich die Wissenschaftler an die tradierten Themen und Instrumentarien gängiger Sozialforschung und applizierten diese auf Ostdeutschland. Dabei orientierten sie sich vor allem an zuweil höchst diffusen Modernisierungstheorien.[27] Theorien der Revolution und Konzepte des sozialen Wandels wurden diskutiert. Einige Soziologen und Politikwissenschaftler mahnten zu kritischen Revisionen und theoretischen Öffnungen. Die Ereignisse des epochalen Wandels wurden aber schon frühzeitig in traditionalen Deutungsmustern festgeschrieben. Habermas prägte den Begriff der „nachholenden Revolution“, das implizierte, an den Revolutionen in Ost- und Mitteleuropa wäre nichts Neues zu erkennen, sondern es würden lediglich Entwicklungen nachvollzogen, die der moderne Westen schon hinter sich hat.[28] Der Zusammenbruch des realsozialistischen Systems zeuge lediglich vom Ende der großen Entwicklungsalternativen und deute auf den weltweiten Sieg der liberalen Demokratie.[29] Revolution und Zusammenbruch bilden zwei Pole der Deutung der Ereignisse von 1989, dabei trifft die eher akteurszentrierte Vorstellung eines Revolutions-Ereignisses auf die systemtheoretische Konstruktion eines Evolutionsprozesses. Letztlich bildete sich für die neue Forschungssituation und die einzigartige Chance diesen ungewöhnlichen Untersuchungsgegenstand vor sich zu haben, kein angemessenes Deutungsmuster. Die Leitbegriffe der Sozialforschung über den Wandel in Ostdeutschland nach 1989 blieben vorerst „Systemwechsel“ und „nachholende Modernisierung und Individualisierung“.[30]
Werden unterschiedliche Modifizierungen einmal ausgeblendet, ist für die Modernisierungstheorie kennzeichnend, dass das Ziel von Modernisierung prinzipiell bekannt ist. Da nun die Modernisierungstheorie der Rahmen war, an dem die empirischen Daten normativ bewertet wurden, kann von drei verborgenen Grundannahmen ausgegangen werden, die Waschkuhn folgendermaßen benennt: Erstens wurde das westdeutsche Modell als eine oder die Blaupause betrachtet, nach der die gesellschaftlichen Verhältnisse in Ostdeutschland zu arrangieren wären. Zweitens wurde die Transformation als exogen gesteuerter Prozess konzipiert, der von den Ostdeutschen notwendige Anpassungsleistungen fordert und schließlich drittens, konzentriert sich die Perspektive dabei wesentlich auf die institutionell-organisatorischen Strukturen und blendet die handelnden Akteure weitgehend aus.[31]
Mit der Kritik an dieser neoklassischen Form der Modernisierungstheorie und dem weiteren Erlahmen der theoretischen Debatte insgesamt (schon zu Beginn der Hochzeiten der Forschungsförderung seit etwa 1992) sowie der Besinnung auf tradierte Instrumentarien der Sozialforschung wurde eine verstärkte Systematik der Forschung nötig, womit deren Komplexität und Differenziertheit anwuchs. So genannte „Methoden-Mixe“ kamen zum Einsatz, um aufwendigere Studien und Querschnittsvergleiche zu ermöglichen. Die durchgeführten Studien hatten meist die Analyse der Wirkung makrogesellschaftlicher und institutioneller Strukturveränderungen auf spezifische Personengruppen und deren Verhaltens- und Statusänderungen zum Ziel.[32] Die Bedeutung von Akteuren und deren kulturelle Deutungswelten traten zunehmend in den Vordergrund. Neben die bisher erforschte Struktur in Gestalt der Implementation politischer Institutionen trat die Kultur als gesellschaftlicher, kultureller und historisch gewachsener Hintergrund der Individuen in Ost- wie Westdeutschland. „Struktur und Kultur“ sind dabei gleichwertige Parameter in einem Prozess der Institutionenbildung, bei dem Makro-, Meso- und Mikroebene interdependent miteinander verknüpft sind.[33]
Mit dem stärkeren Bezug auf Personengruppen (also Akteure) standen die Mehrzahl jener Analysen auf der Basis von Aggregatdaten, die streng genommen keine Aussagen über Veränderungen und Stabilitäten von Merkmalen zulassen, auch nicht wenn mehrere Messpunkte über einen gewissen Zeitraum verteilt wurden, das geschah immerhin noch häufiger. Seltener waren Längsschnittstudien, mittels derer Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten an den selben Personen durchgeführt werden. Diese ermöglichten genauere Aussagen über den gesellschaftlichen Wandel. Um aber verlässliche Aussagen machen zu können und diese von individuellen Entwicklungen zu trennen, wäre zusätzlich ein Kohortensequenzdesign erforderlich, da verschiedene Kohorten unterschiedlich von sozialem Wandel betroffen sein können.[34] Größere durchgeführte Panelstudien, sind das Sozio-Ökonomische Panel-Ost (SOEPO) und das IAB-Betriebspanel, das seit 1997 auch für Ostdeutschland erhoben wird. Insgesamt herrscht noch immer ein Mangel an Langzeitpanels. Eine Reihe der Studien analysierten die Bildung organisierter Akteure in Ostdeutschland. Dafür wurden verstärkt Vergleiche zwischen Ost- und Westdeutschland angestellt, die liefs häufig auf Bilanzen hinaus, die Defizite und Negativanalysen auf verschiedenen Ebenen hervorkehrten und interne Differenzierungen in den Landesteilen homogenisierten. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Schwierigkeiten von Befragungsdaten kommt die Tatsache, dass die Aussagen der Befragten nicht unbedingt mit tatsächlichen Handlungsmaximen übereinstimmen müssen. Aus diesen Eigentümlichkeiten der Umfrageforschung sowie der Frageformulierung resultiert auch die Entdeckung des Phänomens ostdeutscher Identitätsbildungen, zunächst als „ein konzeptuell nicht gestütztes und nicht erwartetes Resultat“.[35] Darauf wird später noch näher eingegangen.[36]
Die steigende Bedeutung komparativer Analysen, die häufig auf Vereinigungsbilanzen hinausliefen, hatte eine bedeutende Ursache in einer Argumentationsfigur, die sehr häufig den Fragestellungen und Interpretationen zu Grunde lag: Viele der durchgeführten Analysen lassen sich als Anpassungsstrategien klassifizieren und wurden beschrieben als eine Trias von Transfer der fertigen Institutionen des Westens, Anpassungsprozessen an jene Institutionen die nach der getrennten Sozialisation nötig waren und schließlich die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Angleichung der Bevölkerung des Ostens Deutschlands an die des Westens. Dafür diente die westliche, demokratisch organisierte Gesellschaft als Vergleichsmaßstab, um die Wandlungsprozesse im Osten anhand der theoretisch-methodischen Analysekonzepte für westliche Gesellschaften einschätzen zu können. Dies verengte den Blick auf die Wandlungen in Ostdeutschland. Rolf Reißig benennt drei Folgen jener analytischen Perspektive: Erstens bildete die Analyse der DDR als Ausgangsgesellschaft der Transformationsprozesse eher die Ausnahme, zweitens „wurden die Komplexität, die Ambivalenzen und Paradoxien der Transformationsprozesse in Ostdeutschland – zugespitzt formuliert – auf Anpassungsprozesse der ‚westdeutschen’ Institutionen an die ‚ostdeutschen Umweltbedingungen’ reduziert“ und drittens wurden wichtige Bereiche, wie die Institutionenbildung und Herstellung ökonomischer Randbedingungen, ausgeklammert. Reißig weist auf die Kehrseite dieser zentralen Argumentationsfigur der deutschen Transformationsforschung hin: Die Folgen der Strukturbrüche im Osten für die normativen und faktischen Prämissen und Institutionen im Westen seien nicht hinreichend thematisiert worden.[37]
Die häufig negativen Bilanzen, die auf Basis der beschriebenen komparativen Analysen gezogen wurden, rückten gegen Ende der neunziger Jahre die spezifischen soziokulturellen Eigenheiten der Ostdeutschen stärker in den Fokus des Forschungsinteresses. Damit kamen auch komplexe mesogesellschaftliche Akteur-Institutionen-Dynamiken in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen näher in den Blick. Die Engführung[38] der Jahre bis etwa 1999 löste sich etwas auf und es wurden verstärkt akteur- und institutionentheoretische sowie auch soziokulturtheoretische Ansätze entwickelt und verwendet. Als sinnvoller Rahmen erschienen dabei weiterhin Theorien mittlerer Reichweite[39] mit denen es möglich war, Klassen singulärer sozialer Tatbestände zu erklären, mit denen aber keine allgemeine Gesellschaftstheorie formuliert werden konnte.[40] So ist besonders in den Jahren nach 2000 mit der komparativen Einbettung Ostdeutschlands in die anderen osteuropäischen Transformationsgesellschaften ein Wiederaufleben der theoretisch-methodischen Debatten erkennbar.[41] Es fanden jedoch keine Anknüpfungen an die neuen Ansätze und Themen statt.
Zusammenfassend kann dazu bemerkt werden, dass die Dominanz der in der Tradition von Talcott Parsons konzipierten Modernisierungstheorie – in ihrer Rolle als generalisiertes Legitimationsmuster für eine Reihe impliziter Annahmen – nicht vollständig überwunden wurde.[42] Das hat eine Engführung zur Folge, die methodische und erkenntnistheoretische Nachteile mit sich bringt, auf die im folgenden Kapitel dieser Arbeit noch explizit Stellung genommen wird.[43] Zudem ist ein erheblicher Überdruss am Thema Ostdeutschland und ostdeutschen Transformationsforschung erkennbar, sodass die wenigen verbliebenen sozialwissenschaftlichen Projekte allenfalls noch eine Nische in der deutschen Forschungslandschaft bilden. Dabei kann das Thema Transformation gerade auf sozialer und kultureller Ebene noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden, denn Status und Perspektiven der ostdeutschen Transformation und der deutschen Vereinigung sind vielfach noch ambivalent. Ganz abgesehen von den Erkenntnisgewinnen einer gesamtgesellschaftlichen Einordnung der postsozialistischen Wandlungsprozesse in die neuen Themen wie Globalisierung, Moral und (Post-) Modernisierungstrends. Dafür wäre allerdings eine weitere thematische und konzeptionelle Öffnung notwendig.
1.3 Bilanzen der deutschen Einheit
Bei der Vielfalt der Analysen und Publikationen zur deutschen Einheit und ostdeutschen Transformation und insbesondere bei den Versuchen, diese beiden Entwicklungsprozesse zu bilanzieren, scheint der einzige übergreifende Konsens darin zu liegen, dass überhaupt in regelmäßigen Abständen Bilanzen dieser Prozesse und Erfassungen des jeweiligen Status quo vorgenommen werden. Die Bewertungen fallen aber so unterschiedlich aus, wie die ihnen jeweils zu Grunde liegenden theoretischen Positionen und methodischen Herangehensweisen. Die Positionen innerhalb der Debatte sind vielgestaltig und die Konflikte inhaltlicher und methodischer Art toben teils so heftig, dass auf den ersten Blick der Eindruck entsteht, die theoretischen Argumente und empirischen Belege seien, je nach Position, die es zu belegen gilt, austauschbar. Die empirischen Befunde sind zwar recht eindeutig, eine einstimmige Interpretation fällt jedoch im Wesentlichen aus drei Gründen schwer und führt zu den verschiedenen Einschätzungen: Zum einen ist keine verbindliche Theorie der Transformation und Vereinigung verfügbar, mit der Erfolg oder Misserfolg von Stand und Perspektiven der beiden Prozesse definierbar wären. Zum anderen überlagern sich wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklungen in einer Weise, die eine übereinstimmende Einschätzung erschweren. Hinzu kommt, dass auf gesellschaftspolitischer Ebene – je nach Betrachtungsstandpunkt – jeder einzelne Bürger und jede Partei aus persönlichen oder wahltaktischen Kalkülen einen eigenen Bewertungs- und Vergleichsmaßstab hat. Rolf Reißig fordert deshalb auf gesellschaftlicher Ebene der Evaluation einen konzeptionellen und praktischen Bewertungsmaßstab mit nachvollziehbaren Indikatoren.[44] Die unterschiedlichen Interessenlagen zum deutschen Vereinigungsprozess auf gesellschaftlicher Ebene wirken zum Teil auch in die Wissenschaft[45] hinein. Deren Aufgabe wäre es aber, genau jenen verbindlichen Bewertungsmassstab zu entwickeln.
Methodisch laufen im Prinzip alle Bilanzen auf einen Vergleich hinaus, dafür werden Ziele und Ergebnisse sowie Gewinne und Verluste verglichen. Dabei kommen aber völlig unterschiedliche zeitliche und räumliche Perspektiven zum Tragen.[46] Welche Perspektive die angemessenste ist, hängt wieder von der jeweiligen theoretischen Ausgangsposition ab. Thomas Bulmahn bemerkt dazu, dass bei der wissenschaftlichen Begleitung des „sozialen Großversuchs“ deutsche Einheit im Wesentlichen empirische Studien erstellt worden, theoretische Innovationen aber weitgehend ausgeblieben sind. Er kritisiert die Orientierung an den theoretischen Vorlagen aus dem Feld der Transformationsforschung, wodurch die meisten Thesen zur deutschen Vereinigung den beiden traditionellen Paradigmen der Systemtheorie oder der Akteurstheorie zuzuordnen wären. Entlang dieser beiden großen Paradigmen haben sich zwei separate Debatten der Transformationsforschung – eine modernisierungstheoretische, die der Systemtheorie zuzuordnen ist, und eine akteurstheoretische Kontroverse – entwickelt. Entlang dieser beiden Debatten differenzieren sich die Positionen weiter aus. Dabei fallen die Bilanzen mit modernisierungstheoretischem Hintergrund eher positiv aus und treffen auf skeptische bis kritische Gegenthesen. Akteurstheorien und neo-institutionalistische Ansätze bilden ein Nebeneinander und beschreiben Steuerungsprobleme der Transformation. Sie ziehen meist negative Schlüsse.[47] Theoretische Positionen dazwischen blieben weitgehend unbesetzt, wie auch insgesamt theoretische Positionen eine Mangelware darstellen. Bulmahn fasst die Schwachpunkte der Diskussion in drei Stichworten zusammen: „Spaltung, Isolation und Negativperspektive“.[48]
Erst in den letzten Jahren ist mit der verstärkten Durchführung komparativer Studien eine teilweise Auflösung der Isolation auf methodischer und diskursiver Ebene erkennbar. Insbesondere theoretische Positionen, die sich aus der Erforschung der ost- und mitteleuropäischen Transformation ergeben haben, stehen für ein realistischeres Gesamturteil des deutschen Transformationsprozesses zur Verfügung, das schließt auch eine realistischere Einschätzung der deutschen Wiedervereinigung als privilegierten Sonderfall mit ein.[49] Die komparative Perspektive, in der Stand, Reichweite und Differenziertheit des Akteurs- und Institutionentransfers erheblich besser beantwortet werden können, kommt jedoch insgesamt gesehen noch viel zu kurz. In dem Maß wie Spaltung und Isolation der theoretisch-methodischen Debatte nicht überwunden werden, werden die Bilanzen eher aus einer Negativperspektive gezogen.
Beobachtbare Tendenzen innerhalb der neueren Transformations- und Vereinigungsforschung sind Regionalisierung und Internationalisierung. In der Verbindung von Studien auf beiden Ebenen liegt das theoretische Entwicklungspotential, das wiederum wegen der insgesamt stagnierenden Forschung in diesem Feld noch weitgehend ungenutzt blieb. Methodisch folgenreicher war da der Perspektivenwechsel von den zu überwindenden zu den zu bewahrenden Unterschieden zwischen Ost und West.[50]
2 Begriffsklärung und theoretische Zugänge
Im folgenden Kapitel werden nach einer Klärung der Begriffe Transformationsforschung und Transformationstheorie die einzelnen theoretischen Ansätze einer möglichen Transformationstheorie mit einigen exemplarischen Vertretern vorgestellt. Zu jedem Ansatz wird die jeweils spezifische Vereinigungsbilanz kritischen Anmerkungen gegenübergestellt. Anliegen ist es, zu einer Einschätzung der Validität der einzelnen theoretischen Zugriffe zu gelangen.
2.1 Transformationsforschung
Von dem vielfach beschworenen epochalen Charakter des Zusammenbruchs des Realsozialismus und der Systemübergänge in Ost- und Mitteleuropa sowie der Tatsache, diese Vorgänge nicht antizipiert zu haben,[51] fühlten sich die Sozialwissenschaften besonders herausgefordert, in umfassenden Forschungsprogrammen und vielen Einzelprojekten jene Entwicklungen zu untersuchen. Die Bevölkerungen der „Gesellschaften sowjetischen Typs“ waren durch den Umbruch mit einem radikalen Strukturverlust konfrontiert. „Transformation“ konnte deshalb zunächst übergreifend verstanden werden, als das Problem zu neuen Formen der System- und Sozialintegration zu finden.[52] Unter der Bezeichnung „Transformationsforschung“ hat sich ein Untersuchungsfeld herausgebildet, das seine Konturen zuerst aus der empirisch vergleichsweise klar umrissenen Problematik des Übergangs gewann, ohne ein theoretisch eindeutig verortetes Konzept zu sein. Die Transformationsforschung hat also die Analyse von Systemwechseln mit allen ihren politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Facetten zum Thema. Der Begriff Transformation beschreibt so die formationsüberschreitende Umwandlung von Gesellschaftssystemen, also einen Systemwechsel. Hopfmann und Wolf schlagen vor, diesen als einen von Akteuren getragenen intentionalen Prozess zu denken, um ihn analytisch von Kategorien wie „sozialer Wandel“, „Modernisierung“ oder „Transition“ abzugrenzen. Für eine genauere Definition von Transformation mag dies zutreffend sein. Betrachtet man indessen einerseits die Forschungsarbeiten, die unter diesem Begriff subsumiert werden, und andererseits den tatsächlichen Forschungsgegenstand, so muss man wohl zum Zwecke dieser Darstellung mit einer gewissen analytischen Unschärfe Vorlieb nehmen. Denn ob und wie es den Akteuren gelingt, einen Systemwechsel bewusst hervorzurufen, ist eben auch von anderen Wandlungsformen abhängig. Strukturelle Hintergründe und modernisierungstheoretische Modelle müssen deshalb ebenso mitbedacht werden. Desweiteren wird Transformation charakterisiert durch „zeitgleiche[s] Auftreten mehrerer interdependenter Prozesse von denen das Gesellschaftssystem als Ganzes erfasst ist“.[53] Diese Wendung ist notwendig, um eine analytische Trennung von Begriff und Theorie der Transition herzustellen. Das von O’Donnell, Schmitter und Whitehead 1986 entwickelte Konzept ist wesentlich dadurch bestimmt, dass es einen in drei Phasen gegliederten und auf die Veränderung der politischen Ordnung gerichteten Prozess beschreibt.[54] Aus Gründen der Gleichzeitigkeit des Wandels mehrerer gesellschaftlicher Teilsysteme kommt das Modell der Transition für eine Beschreibung der Prozesse in Ost- und Mitteleuropa nicht in Frage. Hopfmann und Wolf weisen in diesem Zusammenhang auf die begriffs- und ideengeschichtlichen Wurzeln des Begriffs Transformation in Polanyis „The Great Transformation“ von 1944 hin, in dem schon ein mehrere gesellschaftliche Subsysteme umfassender Umbruchprozess beschrieben wird. Diesbezüglich hat Claus Offe bereits 1994 ausgeführt, dass eine Reform einzelner Subsysteme in den Staaten des Warschauer Pakts – entgegen der Konvergenztheorie – nicht zu einer Annäherung der konkurrierenden politisch-ökonomischen Systeme geführt hat, sondern zu einer Destabilisierung der staatssozialistischen Systeme als Ganzes. Dadurch wurde mit der Reform von oben eine Revolution von unten ohne historisches Vorbild und ohne revolutionäre Theorie ausgelöst. Die vergleichenden Studien über politische Modernisierungsprozesse unter dem Titel „transition to democracy“ erweisen sich jedoch auch in der Darstellung Offes zur Analyse der Umbruchprozesse in Mittel- und Osteuropa als untauglich und irreführend, da die Revolutionen dort aus zwei Gründen umfassender waren: Zum einen weil die territoriale Integrität und die „bisherige“ Bevölkerung nicht erhalten geblieben sind, wie in Südamerika und Südeuropa, und zum anderen, weil neben der politisch-konstitutionellen auch die Reform der Wirtschaftsverfassung vollzogen wurde.[55] Er unterscheidet nach Easton drei hierarchisch gegliederte Ebenen: die Ebene der fundamentalen Identitätsbestimmungen, wie Bürgerrechte und Grenzen eines national verfassten Gemeinwesens (1), die Ebene der Regeln, Verfahren und Rechte, was sich in der Verfassung und im institutionellen Rahmen äußert (2) und die der Entscheidungen über Verteilung politischer Macht und materieller Ressourcen (3). Zwischen den Ebenen besteht eine asymmetrische und kausale Determination: Die jeweils untere Ebene determiniert die darüber liegende mehr als umgekehrt und dies in nicht zweckgerichteter oder strategischer Weise.[56] Diese von Offe so genannte Strategieneutralität zwischen den Ebenen hängt mit einer unterschiedlichen Zeitstruktur zusammen. Die erste Ebene des politischen Gemeinwesens Nation weist eine weit größere zeitliche Beständigkeit auf (möglicherweise Jahrhunderte) als beispielsweise die dritte Ebene der Regierungen und Gesetze (wenige Jahre). Die Entscheidungen, die im Zuge der Transformation getroffen werden müssen, spielen sich auf allen Ebenen gleichzeitig ab. Damit können sie sich als gegenseitig obstruierend oder als inkompatibel erweisen. In einer solchen Situation, in der alles kontingent ist, fällt auch die Strategieneutralität weg, da strategisch handelnde Akteure jetzt auf alle Ebenen Einfluss nehmen können. Die Prämissen des politischen Systems – ursprünglich Gegenstand evolutionärer Prozesse – werden nun zum Objekt strategischen Handelns. Damit entsteht nach Offe ein „Dilemma der Gleichzeitigkeit“. Insbesondere bei der Demokratisierung und der Frage der Wirtschafts- und Eigentumsordnung wird dieses Paradoxon deutlich. Die Marktwirtschaft kommt in vormals „zwangshomogenisierten“ Gesellschaften nur unter vordemokratischen Bedingungen in Schwung, da der revolutionäre Aufbau einer Unternehmerklasse Einkommensunterschiede zunehmen lässt, die in Folge dessen Gegner auf den Plan rufen.[57] Eine entwickelte Marktwirtschaft wird wiederum gebraucht, um die sozialstrukturellen Bedingungen für eine stabile Demokratie herzustellen. Andererseits ist die Einführung der Marktwirtschaft in postsozialistischen Gesellschaften aber ein „politisches Projekt“, das nur unter der Bedingung und auf Basis starker demokratischer Legitimation Erfolgsaussichten hat. Somit werden unter Umständen weder Demokratie noch Marktwirtschaft von einer Mehrheit der Bevölkerung gewünscht.[58] Die Erforschung der Transformation muss eben dieses Paradox der Gleichzeitigkeit der Implementierung von Demokratie und Marktwirtschaft zu fassen bekommen.
Ein weiteres Merkmal von Transformation ist, dass sie einen endlichen und entwicklungsoffenen Prozess darstellt, der zu Etablierung von neuen kohärenten Strukturen führt. Als erfolgreich gilt dieser Prozess, wenn das neu entstandene Gesellschaftssystem Stabilität erreicht und auftretende funktionale Störungen kompensieren kann. Entwicklungsoffen ist der Prozess insofern, dass die ihn tragenden Akteure zwar eine bestimmte neue Gesellschaftsordnung anstreben, aber wegen der Schwierigkeiten politischer Steuerung offen bleibt, inwieweit sie dieses Ziel erreichen. Unterstrichen wird dieser Sachverhalt von der Tatsache, dass es sich bei Transformationsprozessen um erratisch verlaufende Prozesse handelt, da die bisher gewohnte soziale Ordnung zusammengebrochen und damit eine rationale Erwartungshaltung verstellt ist.[59]
Hopfmann und Wolf schlagen eine durchaus valide Definition vor: „Unter ‚Transformation’ soll der den Wechsel zwischen verschiedenen Gesellschaftsformationen beinhaltende Prozess bzw. Zeitraum der Umwandlung eines gesellschaftlichen Systems in ein anderes verstanden werden.“[60] Sie stellen die Begreifbarkeit unter die Prämisse, dass Transformation als integraler Bestandteil einer um die Analyse gesamtgesellschaftlicher Entwicklung bemühten Gesellschaftstheorie konzeptualisiert wird. Diese soll den Prozess längerfristiger sozialer Reproduktion von Gesellschaft ebenso erklären, wie den Vorgang des Übergangs einer gesellschaftlichen Entwicklungslogik zur anderen. Damit erteilen den „Theorien mittlerer Reichweite“ eine klare Absage, wovon sie sich einen theoretischen Fortschritt erhoffen, der bisher in der Transformationsforschung nicht oder nur ansatzweise erkennbar ist. Die Autoren kritisieren damit auch ideologiekritisch die bis dato implizierte Annahme der Transformationsforschung, „die bisherige Geschichte sei nun in ein posthistorisches Stadium eingetreten“,[61] da der Untersuchungsgegenstand bisher auf den Übergang von Plan zu Marktwirtschaften quasi historisch beschränkt wurde.
Auch Max Kaase und Rainer Lepsius heben bei der Erforschung der Transformation auf eine gesamtgesellschaftliche Orientierung ab. Sie bedauern, dass für die Sozialwissenschaften das kontrollierte Experiment als Analyseinstrument nicht zur Verfügung steht und die Alternative Staatenvergleich auch an ihre Grenzen stößt, deren „klassische Probleme“ die geringe Zahl der Analyseeinheiten (Nationalstaaten) und die hohe Zahl der einzubeziehenden Variablen ist.[62] Sie knüpfen damit an die Erforschung der einzigartige Situation der Systemtransformation in den ost- und mitteleuropäischen Staaten die Hoffnung, die Zusammenhänge zwischen Institutionen und Akteuren genauer zu analysieren. Von besonderem Interesse bei der Forschung sind dabei die Fragen, auf welche Weise und in welchem Maße sich Institutionen (Makroebene), intermediäre Organisationen (Mesoebene) und Individuen (Mikroebene) gegenseitig beeinflussen sowie in welcher Beziehung sie zueinander stehen und wie sie sich über die Zeit verändern. Besonders der deutsche Fall, mit schneller und plötzlicher institutioneller Anpassung, aber einem Alltagshandeln, dass sich nur langsam verändert, biete da gute Forschungsmöglichkeiten. Allerdings kann der Transformationsprozess in Deutschland als Sonderfall, in seiner strategischen Ausrichtung, seinen Effekten und in seinen Kosten nur im Vergleich mit den anderen osteuropäischen Gesellschaften im Übergang beurteilt werden. Insbesondere Einsichten in Variationen und Alternativen für die Strukturierung von Gesellschaften ergeben sich über einen Vergleich unterschiedlicher Transformationen.[63] Auch diese beiden Autoren erwähnen die doppelte Herausforderung des institutionellen Wandels der Wirtschaftsordnung und des politischen Systems. Die Transformationsforschung muss darum das Verhältnis von politischen und wirtschaftlichen Ordnungsvorstellungen thematisieren, weil viele Veränderungen während der Transformation nicht durch politische Neuordnung, sondern durch wirtschaftliche Umbrüche bewirkt wurden. Die eigenen Erwartungen und Verhaltensweisen der Akteure mussten sich also grundlegend ändern. In dieser Weise wurde die Chance zur Analyse der Zusammenhänge zwischen veränderter Institutionenordnung (Makroebene) und dem Verhalten der Akteure (Mikroebene) eröffnet. Diese Bipolarität führt dazu, dass „Grundannahmen der bisherigen sozialwissenschaftlichen Gesellschaftsanalyse, die stets vom Modell der institutionellen Differenzierungen von Staat und Markt, von Politik und Wirtschaft ausgingen, neu bedacht werden “[64] müssen.
2.2 Transformationstheorie
Zum Stand einer Transformationstheorie liegt eine große Bandbreite an Positionen der sozialwissenschaftlichen Forschung vor, die von der Behauptung reicht, es gebe keine valide Theorie respektive es könne sie nicht geben bis hin zur Beobachtung einer unüberschaubaren Menge theoretischer Ansätze. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle zunächst auf eine genaue Begriffsklärung verzichtet und einige Positionen dazu exemplarisch wiedergegeben werden.
Welche Form eine Theorie der Transformation annehmen, welche Erklärungen sie liefern und welche Stellung sie innerhalb der Sozialwissenschaften einnehmen sollte, waren in den frühen neunziger Jahren vor dem Hintergrund eines sich erst allmählich entfaltenden Szenarios schwierige und umstrittene Fragen. Die empirischen Informationen und Vorkenntnisse über die betreffenden Regionen waren bisweilen mangelhaft, somit lag es für die meisten Sozialwissenschaftler nahe, zuerst auf bewährte Theorieangebote zurückzugreifen oder mit komparatistischen Methoden zu arbeiten. Die Dringlichkeit der schnell voranschreitenden Ereignisse erforderte, zuerst empirische Daten zu erheben, ohne Zeit mit der Entwicklung einer allgemeinen Theorie der Transformation zu verlieren oder auch nur damit, einen einheitlichen Begriff von Transformation vorzulegen. Dies hatte die Konsequenzen, dass die empirische Transformationsforschung in weiten Teilen theoriefern oder theoriekonservativ arbeitete[65] oder sich als rein „deskriptive Begleitforschung“ verstand.[66] Die empirischen Daten wurden vornehmlich mit der empirischen Sozialstrukturanalyse erhoben, die aber keinen Aufschluss über Mechanismen liefern konnte, die für die Veränderung der Strukturen in den betreffenden Regionen verantwortlich sind. Auch die vergleichende Forschung arbeitete deskriptiv und theoriefern, da sich Theorien eher zufällig und unkontrolliert aus der Zusammenstellung von Vergleichsdaten ergaben,[67] was man als induktivistische Methode bezeichnen muss. Gleichwohl hat es natürlich auch theoriegeleitete Transformationsforschung gegeben. Schmid und Weihrich identifizieren dafür hauptsächlich zwei Angebote – die Modernisierungs- und die Systemtheorie – und bringen bei beiden Kritik an. Letztlich fordern sie einen Verzicht auf eine eigenständige Theorie und schlagen eine Modelllogik vor. Da in ihrer Darstellung die soziologische Theorie nicht fähig ist, globale Analysen zu liefern, beschränken sie sich auf mikrofundierte Analysen, bei denen theoretische Modelle für abgrenzbare Mechanismen erstellt werden, die sich empirisch testen lassen. Mit Hilfe des Modellvergleichs sollen diese Modelle gegenseitig korrigiert und auf so ein Theoriefortschritt generiert werden.[68] In eine ähnliche Richtung weist auch Kollmorgen, der zeigt, dass deduktiv geschlossene, modelllogisch homogene Methodologien der Geistes- und Sozialwissenschaften keinen hinreichenden Rahmen bilden, sozialen Wandel und damit auch Transformationsprozesse angemessen zu erklären oder zu verstehen. Dies ist deshalb nicht möglich, weil ihnen jeweils ein Paradigma zu Grunde liegt, das perspektivische und entwicklungstheoretische Grenzen aufweist. Er plädiert deshalb für eine paradigmatisch heterogene Kombinatorik, bei der – ähnlich wie bei Schmid/Weihrich – Sequenzen verschiedener analytischer Perspektiven nacheinander auf einen Objektbereich angewendet werden, um dann eventuell paradoxe Befunde erneut die Sequenzen durchlaufen zu lassen. Die theoretischen Perspektiven folgen dabei den Erfordernissen des zu untersuchenden Gegenstandes. Idealtypisch soll sich so der „reale“ Ablauf von Wandlungsprozessen theoretisch-methodisch widerspiegeln.[69]
Stojanov hingegen erkennt zwar auch eine Vielzahl sozialwissenschaftlicher Ansätze, unterstellt aber nahezu allen eine mehr oder weniger große Dominiertheit durch die Modernisierungstheorie.[70] Klaus Müller hingegen zählt drei allgemeine theoretische Ansätze, die, jeweils in einer Disziplin verankert, von da aus beanspruchen, Aussagen über postkommunistische Gesellschaften als Ganzes treffen zu können, und die der Autor als Paradigmen aufgefasst sehen möchte. Paradigmen in dem Sinne, dass sozialwissenschaftliche Theorien nicht in analytischer Distanz zu ihrem Untersuchungsgegenstand bleiben, sondern auch gesellschaftliche Ordnungsmodelle, Wertorientierungen und politische Optionen zum Gegenstand haben und dabei auf gesellschaftliche Veränderung abzielen. Ein solches Paradigma bezieht seine wissenschaftliche Legitimität aus der neoklassischen Wirtschaftstheorie, deren Marktmodell sowohl als gesellschaftliches Reformprojekt sowie auch als politische Theorie und politische Programmatik gedacht wird. Ein weiteres Paradigma gruppiert sich um die Theorien der „Transition zur Demokratie“, das ebenfalls die Grenzen einer reinen Fachdisziplin überschreitet, indem es Demokratie nicht als abstrakten Idealtypus beschreibt, „sondern als ein auf psychologische Dispositionen, Handlungsroutinen und die politische Kultur verweisender Wert“[71] dargestellt und auf dessen außenpolitische Förderung gedrängt wird. Das dritte Paradigma erkennt Müller in der Modernisierungstheorie als übergreifendes Deutungsmuster von ökonomischem Strukturwandel und Demokratisierung.[72]
[...]
[1] Der Begriff „Innere Einheit“ tritt in zahlreichen Facetten auf und ist vorwiegend ein politischer, insofern auch eine erst sozialwissenschaftlich zu füllende Worthülse. Dieser Tatsache wird mit den Anführungszeichen Rechnung getragen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird, aus praktischen Gründen, auf diese besondere Kennzeichnung verzichtet.
[2] Vgl. Zapf, Wolfgang (2000): Wie kann man die deutsche Vereinigung bilanzieren?, in: Noll, Heinz-Herbert und Roland Habich (Hrsg.), Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft, Frankfurt am Main, New York, S. 15 f.
[3] Vgl. Ahbe, Thomas & Gibas, Monika (2001): Der Osten in der Berliner Republik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. B 1-2/ 2001.
[4] Vgl. Meulemann, Heiner (2002): Werte und Wertewandel im vereinigten Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. B 37-38.
[5] Vgl. Reißig, Rolf (2000a): Die gespaltene Vereinigungsgesellschaft, Berlin, S. 54 f.
[6] Christian Fenner weist in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, wie sehr sich DDR- und Deutschlandforschung den Imperativen der Entspannungspolitik zu beugen hatten. Vgl. Fenner, Christian (1991): Das Ende des 'realen Sozialismus' und die Aporien vergleichender Politikwissenschaft, in: Backes, Uwe und Eckhard Jesse (Hrsg.), Jahrbuch Extremisums und Demokratie, Bonn, S. 35.
[7] Vgl. Reißig, Rolf (2000b): 1989, Die Transformation der deutschen Sozialwissenschaften, in: Berliner Debatte Initial, Nr. 11(2),, S. 9.
[8] Beyme, Klaus von zitiert bei ebd. S. 9, von Beyme verwendet diesen Begriff in Analogie zum „Schwarzen Freitag“ als dem angeblichen Beginn der Weltwirtschaftskrise, mit dem New Yorker Börsenkrach am 25.10.1929. Der entscheidende Kurssturz war aber schon einen Tag früher, genau wie Tag des Falls der Berliner Mauer am 9.11.1989 ein Donnerstag war, aber erst am darauffolgenden Freitag „realisiert“ wurde.
[9] Vgl. Kaase, Max und Rainer M. Lepsius (2001): Transformationsforschung, in: Kollmorgen, Raj und Hans Bertram (Hrsg.), Die Transformation Ostdeutschlands, Opladen, S. 349.
[10] Vgl. Reißig 2000b (FN 7) S. 10.
[11] Vgl. Kollmorgen, Raj (2003a): Das Ende Ostdeutschlands, in: Berliner Debatte INITIAL, Nr. 14(2), S. 4-18, S. 10.
[12] Ebd. S. 4.
[13] Jedoch werden alle Jahreszahlen und Statistiken zitiert nach ebd. S. 10 ff.
[14] Vgl. Waschkuhn, Arno und Alexander Thumfart (1999): Politik in Ostdeutschland, München, S.12 ff. Die Phaseneinteilung wird ähnlich wie bei Kollmorgen unternommen, wobei die vierte Phase etwa nach dem Erscheinungsjahr 1999 einsetzen würde.
[15] Vgl. Kollmorgen 2003a (FN 11) S. 9.
[16] Vgl. Kollmorgen 2003a (FN 11) S. 5 ff.
[17] Waschkuhn/ Thumfart 1999 (FN 14) S. 11.
[18] Ebd. S. 12.
[19] Soweit dies von meiner Seite rekonstruiert werden konnte wurde der Begriff wesentlich geprägt von Jürgen Kocka. Vgl. Kocka, Jürgen (1995): Vereinigungskrise: zur Geschichte der Gegenwart, Göttingen.
[20] Vgl. Kollmorgen 2003a (FN 11) S. 7.
[21] Vgl. Ebd. S. 8.
[22] Exemplarisch: Schluchter, Wolfgang und Peter E. (Hrsg.) Quint (Hrsg.) (2001): Der Vereinigungsschock. Vergleichende Betrachtungen zehn Jahre danach, Weilerswist; Vilmar, Fritz (Hrsg.) (2000a): Zehn Jahre Vereinigungspolitik, Berlin.
[23] 1992 betrug der Anteil der Ostdeutschlandstudien fast 2 % aller gemeldeten Forschungsprojekte in FORIS. Vgl. Kollmorgen 2003a (FN 11) S. 7.
[24] Vgl. Kollmorgen, Raj (1999): Transformationstheorien - Karriere und metatheoretische Kritik, Dissertation, Jena, S. 248 f.
[25] Vgl. Kaase/ Lepsius 2001 (FN 9) S. 343 ff.
[26] Vgl. Land 2005 (FN 26) (2005): Paradigmenwechsel in der Ostdeutschlandforschung, in: Berliner Debatte INITIAL, Nr. 16(2), S. 69-75, S. 69.
[27] Welche Modernisierungstheorien das sind, darauf wird im Kapitel 3 näher eingegangen.
[28] Vgl. Habermas, Jürgen (1990): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main.
[29] Zapf, Wolfgang zitiert bei Reißig 2000b (FN 7) S. 10.
[30] Reißig 2000b (FN 7) S.10.
[31] Waschkuhn/ Thumfart 1999 (FN 14) S. 15.
[32] Kollmorgen 2003a (FN 11) S. 7.
[33] Waschkuhn/ Thumfart 1999 (FN 14) S. 16.
[34] Trommsdorf, Gisela und Hans-Joachim Kornadt (2001): Innere Einheit im vereinigten Deutschland, in: Bertram, Hans und Raj Kollmorgen (Hrsg.), Die Transformation Ostdeutschlands. Berichte zum sozialen und politischen Wandel in den neuen Bundesländern, Opladen, S.378.
[35] Woderich, Rudolf (2000): Allgegenwärtig, ungreifbar : Zur Entdeckung ostdeutscher Identitätsbildungen in Befunden der Umfrageforschung, in: Berliner Debatte Initial, Nr. 3(11), S. 104.
[36] Vgl. Kapitel 3.
[37] Vgl. Reißig 2000b (FN 7) S. 11.
[38] Dieses Wort steht nicht im deutschen Wörterbuch, ist aber ein in den Sozialwissenschaften verbreiteter Begriff, der eine theoretische und/oder methodische Beschränkung im Vergleich zur möglichen Breite bezeichnet.
[39] Vgl. Kollmorgen 2003a (FN 11) S. 9.
[40] Vgl. Hopfmann, Arndt und Michael Wolf (2001): Was heißt und zu welchem Ende betreibt man Transformationsforschung?, in: Ders. (Hrsg.), Transformationstheorie – Stand, Defizite, Perspektiven, Münster, S. 22.
[41] Vgl. exemplarisch Hopfmann/ Wolf 2001 (FN 52); Kollmorgen, Raj und Heiko Schrader (Hrsg.) (2003): Postsozialistische Transformationen: Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Theoretische Perspektiven und empirische Befunde, Würzburg.
[42] Vgl. Stojanov, Christo (2003): Zur Situation der Transformationsforschung, in: Kollmorgen, Raj und Heiko Schrader (Hrsg.), Postsozialistische Transformationen: Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Theoretische Perspektiven und empirische Befunde, Würzburg, S. 61.
[43] Vgl. Kapitel 2.3.3.
[44] Vgl. Reißig 2000a (FN 5) S.58 ff.
[45] Wissenschaftler sind im Grunde auch Ost- oder Westdeutsche und werden – auch wenn sie dies um der wissenschaftlichen Korrektheit zu vermeiden suchen – von ihren individuellen Hintergründen beeinflusst. Hinzu kommt, dass die ostdeutschen Sozialwissenschaftler im gesamtdeutschen Kontext als unterrepräsentiert gelten müssen, wenigstens was die Ausstattung mit Forschungsmitteln und die Berufung in Professuren angeht.
[46] Vgl. Zapf 2000 (FN 2) S.17.
[47] Vgl. Bulmahn, Thomas (1996): Vereinigungsbilanzen - Die deutsche Einheit im Spiegel der Sozialwissenschaften, Berlin, S. 2 ff.
[48] Ebd. S. 25.
[49] Vgl. besonders die Beiträge von R. Kollmorgen, C. Stojanov, H. Schrader, W. Ortlepp, U. Fuhrer und A. Born in: Kollmorgen/ Schrader 2003 (FN 41) auch die von B. Lutz, R. Kollmorgen in: Brussig, Martin/ Frank Ettrich und Raj Kollmorgen (Hrsg.) (2003): Konflikt und Konsens: Transformationsprozesse in Ostdeutschland, Opladen. zur neueren theoretischen Diskussion vgl. Hopfmann/ Wolf 2001 (FN 52) und auch die anderen Beiträge desselben Bandes!
[50] Vgl. exemplarisch Engler, Wolfgang (2001): Die Ostdeutschen als Avantgarde, Berlin. ebenso die Beiträge in: Busse, Tanja und Tobias Dürr (Hrsg.) (2003): Das neue Deutschland. Die Zukunft als Chance, Berlin.
[51] „Analysen Hannah Arendts, Ralf Dahrendorfs und Talcott Parsons’ aus den 60er Jahren [enthielten noch – B.T.] eine Perspektive des östlichen Machtzerfalls.“ Vgl. Reißig 2000b (FN 7) S. 9.
[52] Vgl. Müller, Klaus (2001): Konkurrierende Paradigmen der Transformation, in: Hopfmann, Arndt und Michael Wolf (Hrsg.), Transformationstheorie – Stand, Defizite, Perspektiven, Münster, S. 202.
[53] Ebd. S. 20.
[54] Vgl. Kaase/ Lepsius 2001 (FN 9) S. 345.
[55] Vgl. Offe, Claus (1994): Der Tunnel am Ende des Lichts, Erkundungen der politischen Transformation im Neuen Osten, Frankfurt am Main, S. 58 ff.
[56] Ebd. S. 61 ff.
[57] Offe diskreditiert in diesem Zusammenhang den Begriff der „nachholenden Modernisierung“ als Bagatellisierung, da eine bisher nicht vorhandene Kategorie von Akteuren eingesetzt werden muss, „die auf Grundlage von Eigentumstiteln im Marktwettbewerb stehen“. Keine der bisherigen Umwälzungen hatte so etwas zu bewältigen. Vgl. ebd. S. 60.
[58] Ebd. S. 70 ff.
[59] Hopfmann/ Wolf 2001 (FN 52) S. 20 ff.
[60] Ebd. S. 21.
[61] Ebd. S. 22.
[62] Kaase/ Lepsius 2001 (FN 9) S. 343 f.
[63] Vgl. Kaase/ Lepsius 2001 (FN 9) S. 345 ff.
[64] Ebd. S. 348.
[65] Schmid, Michael und Margit Weihrich (2001): Die Wende und ihre Theorien - eine modelllogische Kritik der soziologischen Transformationsforschung, in: Hopfmann, Arndt und Michael Wolf (Hrsg.), Transformationstheorie – Stand, Defizite, Perspektiven, Münster, S. 152.
[66] Mayntz, Reante zitiert bei ebd. S. 152. Vgl. auch Mayntz, Renate (1996): Gesellschaftliche Umbrüche als Testfall soziologischer Theorie., in: Clausen, Lars (Hrsg.), Gesellschaften im Umbruch. Verhandlungen des 27. Kongresses der deutschen Gesellschaft für Soziologie, Frankfurt am Main/ New York.
[67] Schmid/ Weihrich 2001 (FN 65) S. 154.
[68] Vgl. Schmid, Michael et al. (2001) S. 159 und S. 185 ff.
[69] Kollmorgens breit ansetzender Versuch ist metatheoretisch sehr elaboriert und hier extrem verkürzt dargestellt. Vgl. Kollmorgen, Raj (2003b): Analytische Perspektiven, soziologische Paradigma und Theorien sozialen Wandels. Eine metatheoretische Skizze., Magdeburg.
[70] Vgl. Stojanov 2003 (FN 43) S. 61 f. Erste Veröffentlichung dieses Textes in: Stojanov, Christo (2001): Zur Situation der Transformationsforschung, Magdeburg.
[71] Müller 2001 (FN 52) S. 210.
[72] Vgl. ebd. S. 208 ff.
- Arbeit zitieren
- M.A. Birk Töpfer (Autor:in), 2005, Kultur- und Transformationsforschung über Ost-West-Differenzen und Innere Einheit in Deutschland - Eine metatheoretische Betrachtung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51379
Kostenlos Autor werden

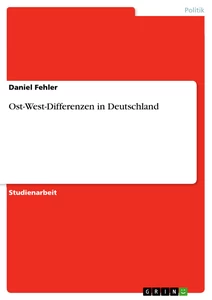




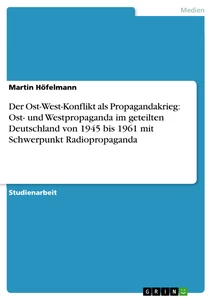


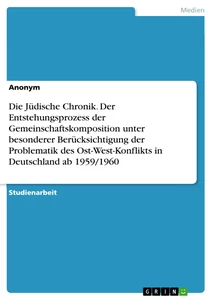












Kommentare