Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Was versteht man unter Lernen?
3 Wie lernen wir?
3.1 Neurobiologische Grundlagen
3.2 Lerntheorien
3.3 Was brauchen Kinder zum Lernen?
4 Schule als optimaler Lernort?
4.1 Wie wird in der Schule gelernt?
4.2 Alternative Erziehungskonzepte
5 Schule muss bewegt sein
5.1 Entstehung der Bewegten Schule
5.2 Begründungsmuster
6 Strukturmerkmale einer Bewegten Schule
6.1 Dynamisches Sitzen und Bewegter Unterricht
6.2 Bewegungspausen und Entspannung
6.3 Bewegter Schultag und Bewegte Pause
6.4 Bedeutung des Sportunterrichts
6.5 Zusätzliche Gesundheitsförderung
6.6 Arbeit mit Kooperationspartnern
7 Fazit
Literaturverzeichnis
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2020
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
1 Einleitung
Als Sportstudent und angehender Sportlehrer muss ich immer wieder feststellen, dass es um die motorischen Fähigkeiten und die körperliche Fitness unserer Jugend zunehmend schlechter bestellt ist. In meiner Tätigkeit als Jugendtrainer in einem Sportverein und während meiner Schulpraktika ist mir aufgefallen, dass sich die Zahl der sporttreibenden Kinder in den letzten Jahren enorm verringert hat. Ein Großteil der Kinder weist schon in frühem Alter Anzeichen von Adipositas auf und zeigt motorische Defizite in verschiedenen Bereichen. Viele Schülerinnen und Schüler wirken nicht richtig ausgelastet, erleben Schule als Stress und scheinen mit dem Unterrichtsstoff überfordert zu sein. Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit zurückerinnere, muss ich daran denken, wie viel Spaß mir der Sportunterricht, vor allem aber das Fußballspielen in der Pause immer gemacht hat. Sobald die Pause begann, kamen Schüler aus unterschiedlichen Klassenstufen auf der Wiese neben unserem Schulgebäude zusammen und es ging sofort los, um die kurze Zeit voll auszunutzen. Häufig kam es vor, dass unsere Lehrer uns extra auffordern mussten, unser Spiel zu beenden und wieder in den Unterricht zu kommen. Die Möglichkeit, sich zwischen den Lernphasen zu bewegen, empfand ich nicht nur als nette Abwechslung, sondern es war ein wichtiger Bestandteil meines Schultags. Die Pause im Schulgebäude verbringen zu müssen und nicht mit meinen Freunden zusammen spielen zu dürfen, war für mich die schlimmste Bestrafung. Auch nach der Schule und oft noch vor den Hausaufgaben traf ich mich in der Regel mit Freunden zum Spielen oder Radfahren. Wenn man sich heute einen Pausenhof an einer Schule anschaut, ist das Bild ein anderes. Bereits in der Grundschule haben die meisten Schülerinnen und Schüler ein Smartphone dabei und kleben während den Pausen an ihren Geräten. Sportspiele wie Fußball finden nur noch als Teil des Sportunterrichts statt und auch sonst sieht man nicht viele Kinder, die sich während ihrer Pause ausreichend bewegen. Auch auf Spiel- und Sportplätzen zeigt sich das selbe Bild. Klettergerüste, Schaukeln und Rutschen sind verwaist und während wir uns damals noch darum stritten, wer nachmittags den Sportplatz wofür nutzen durfte, besteht heute scheinbar gar kein Interesse mehr daran.
Die Ursachen dafür sind vielfältig und hängen mit der zunehmenden Technologisierung unserer Umwelt und den veränderten Bedingungen zusammen, unter denen Kinder heute aufwachsen. Als staatliche Bildungsinstitutionen dürfen sich die Schulen nicht der Aufgabe entziehen, Kindern die Bedeutung und die Wirkung von ausreichend Bewegung zu vermitteln.
Eine Schulkonzept, dass dem Bewegungsmangel und den damit verbundenen Problemen entgegenwirken soll, ist das der Bewegten Schule, das in dieser Arbeit vorgestellt werden soll. Um das Schulkonzept und seine Wirkung auf die kindliche Entwicklung genauer zu diskutieren, werden im ersten Teil dieser Arbeit die Grundlagen von Lernen zusammengetragen. Es wird geklärt, was Lernen eigentlich ist, auf welchen neuronalen Prozessen es beruht und wie verschiedene Theorien unterschiedliche Lernformen beschreiben. Spezielle Aufmerksamkeit kommt der Frage nach, wie Kinder am besten lernen. Im Anschluss wird untersucht, auf welche Art und Weise in den meisten Schulen unterrichtet wird und ob dies Kindern die optimalen Bedingungen zum Lernen bietet. Um dieses Bild zu erweitern, werden einige alternative Ansichten einflussreicher Pädagogen genauer erläutert.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Konzept Bewegte Schule. Zunächst wird die Entwicklung im Raum pädagogischer Möglichkeiten beschrieben und anschließend Begründungen im Zusammenhang mit Entwicklung, Lernverhalten und Gesundheit geliefert. Zum Schluss wird aufgezeigt, welche Merkmale eine bewegte Schule aufweisen muss, um als solche zu gelten und wie sich einzelne Elemente umsetzen lassen, um mehr Bewegung in den Unterricht und das Lernen zu bringen.
2 Was versteht man unter Lernen?
Lernen ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Fähigkeiten aller Lebewesen. Fragt man 100 Menschen nach einer Definition für Lernen, so erhält man vermutlich genau so viele unterschiedliche Antworten. Denn obwohl oder vielleicht gerade weil wir den Begriff ganz alltäglich verwenden, etwa wenn wir davon sprechen, zu lernen, wie man einem Musikinstrument Töne entlockt, wie man in einer Sportart eine Bewegung mit der richtigen Technik ausübt oder ob es darum geht, Stoff für Prüfungen in der Schule oder an der Uni zu lernen, ist es nicht ganz so einfach, den Begriff allgemeingültig zu definieren. Die folgenden Definitionen versuchen, die vielfältige Bedeutung des Wortes kurz und knapp zusammenfassen, ohne auf Essentielles zu verzichten.
Laut Stern, Schalk und Schumacher entsteht Lernen „aus der Interaktion zwischen einem Individuum und seiner Umgebung“ und „ermöglicht es allen Lebewesen, die im jeweiligen Lebensumfeld gestellten Anforderungen zunehmend besser zu bewältigen“ (Stern, Schalk & Schumacher, 2013, S. 106). Die Hauptfunktion von Lernen ist demnach, die individuelle Handlungskompetenz und Handlungsfähigkeit zu steigern und sich in bestimmten Situationen einen Verhaltensvorteil verschaffen zu können. Während wir Lernen heutzutage überwiegend als eine kognitive Weise der Wissensvergrößerung sehen und häufig mit schulischem Lernen gleichstellen und so verallgemeinern, zeigt sich die überlebenswichtige Bedeutung dieser Fähigkeit bei allen Tieren und spielte in der Evolution des Menschen eine entscheidende Rolle. Etwa die Fähigkeit, Hinweise auf Gefahren zu erkennen und schlussfolgernd die Flucht zu ergreifen oder aber Hinweise auf Ressourcen wie Nahrung richtig zu deuten und sich so einen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu verschaffen, haben oft den Unterschied zwischen Überleben und Sterben ausgemacht (vgl. ebd.).
Bei Winkel, Petermann & Petermann findet sich folgende Definition: „Lernen bezieht sich auf relativ dauerhafte Veränderungen im Verhalten oder den Verhaltenspotenzialen eines Lebewesens in Bezug auf eine bestimmte Situation. Es beruht auf wiederholten Erfahrungen mit dieser Situation und kann nicht auf angeborene bzw. genetisch festgelegte Reaktionstendenzen, Reifung oder vorübergehende Zustände (zum Beispiel Müdigkeit, Krankheit; Alterung; Triebzustände) zurückgeführt werden.“ (Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 12) Diese Definition enthält die zentralen Bestimmungsstücke des Begriffs Lernen, auf welche kurz eingegangen werden soll. Ein entscheidendes Kriterium sind demnach Veränderungen im Verhalten, welche sich wie Veränderungen in der physikalischen Umwelt objektiv messen lassen und somit die einzige Möglichkeit darstellen, einen Lernzuwachs zu überprüfen. Verhalten bezieht sich in diesem Sinne jedoch nicht nur auf motorische Verhaltensäußerungen in Form von Bewegungen, sondern ebenfalls auf physiologische, kognitive und emotionale Reaktionen, bei denen Veränderungen schwieriger festzustellen sind (vgl. ebd.). Von Lernen spricht man auch dann, wenn sich in Folge eines Lernprozesses zunächst keine Änderungen im Verhalten feststellen lassen, ein Lebewesen jedoch nach dem Lernvorgang über das Potenzial verfügt, in passenden Situation neues Verhalten zu zeigen. Dabei kann es auch vorkommen, dass Lernvorgänge das Verhaltensrepertoire nicht erweitern, sondern einschränken, etwa wenn ein bestimmtes Verhalten regelmäßig unangenehme Konsequenzen nach sich zieht (vgl. ebd., S. 13). Da Organismen ihr Verhalten im Laufe ihres Lebens ständig verändern, wird Lernen hier als erfahrungsbasierter Vorgang beschrieben, denn für viele Verhaltensänderungen, die sich irgendwann bemerkbar machen, ohne dass ein Lebewesen sie zunächst spezifisch erlernen muss, sind biologische Reifeprozesse und physiologische Veränderungen verantwortlich. Reifungs- und Lernprozesse sind jedoch häufig eng miteinander verbunden und nur durch Deprivation, also wenn ein Lebewesen davon abgehalten wird, Erfahrungen mit der Umwelt zu machen, lässt sich überprüfen, ob eine Verhaltensänderung erlernt wurde oder nicht (vgl. ebd.). Des weiteren darf eine Veränderung im Verhalten oder Verhaltenspotenzial nicht nur kurzfristig auftreten, sondern muss über einen bestimmten Zeitraum hin relativ stabil sein, damit man von einem Lernvorgang sprechen kann. So wird eine auf Lernen beruhende Veränderung von Faktoren wie zum Beispiel Müdigkeit, Krankheit, Drogenkonsum oder Abweichungen im hormonellen Status, deren Einfluss nach einer gewissen Zeit wieder abnimmt, abgegrenzt (vgl. ebd., S. 14).
Ergänzend zu dieser Erklärung, die sich auf die inneren Vorgänge während des Lernens bezieht, findet sich im Beltz-Lexikon Pädagogik folgende Definition, die den Prozess von der Außenperspektive her beschreibt: „Lernen [beschreibt] eine zielgerichtete Tätigkeit, die auf den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten gerichtet ist und je nach Art der angestrebten Lernziele unterschiedliche Einzelaktivitäten umfasst.“ (Andreas Krapp, 2007, S. 455) Zur Steuerung des Lernverhaltens wird hier zwischen einzelnen Lerntechniken, die je nach Situation und Lernziel völlig verschieden sind, und übergeordneten Lernstrategien unterschieden. Letztere werden unterteilt in einerseits Informationsverarbeitungsstrategien, die der Aufnahme und dauerhaften Speicherung von Informationen dienen und andererseits Kontrollstrategien, die die Effektivität der angewandten Lerntechniken überprüfen und eventuell korrigieren. Zusätzlich werden alle Aktivitäten, die sich „auf eine Optimierung innerer und äußerer Ressourcen“ beziehen als Stützstrategien bezeichnet. Dazu zählen etwa die Gestaltung der Lernumgebung, das Zeitmanagement sowie die bewusste Steuerung der Anstrengungsbereitschaft, wobei vor allem metakognitive Faktoren wie Emotionen, Motivation und Volition eine entscheidende Rolle spielen (vgl. ebd., S. 456).
3 Wie lernen wir?
Nachdem etwas Klarheit über die Bedeutung des Begriffes Lernen geschaffen wurden, widmet sich dieses Kapitel der Art und Weise, wie Menschen lernen. Um einen Lernprozess verstehen zu können, muss man sich zunächst einmal bewusst machen, wie unser Körper beziehungsweise unser Gehirn Informationen aufnimmt, verarbeitet und speichert. Dazu ist eine genauere Betrachtung des Nervensystems und der verschiedenen Bereiche unseres Gehirns notwendig. Es werden die neurobiologischen Grundlagen erläutert, um zu verdeutlichen, was in unseren Köpfen beim Lernen eigentlich passiert.
Im Laufe der letzten Jahrhunderte wurden verschiedene Modelle und Hypothesen entworfen, anhand derer Lernvorgänge psychologisch beschrieben und erklärt werden sollen. Unterteilt in die drei Kategorien Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus sollen diese Lerntheorien hier zum besseren Verständnis vorgestellt werden. Anschließend wird der Frage nachgegangen, was Kinder zum Lernen brauchen. Dazu wird untersucht, unter welchen Bedingungen Kinder am besten lernen können, wobei sowohl die inneren Zustände als auch die äußeren Bedingungen, also die räumliche Umgebung und strukturelle Organisation des Umfelds beachtet werden.
3.1 Neurobiologische Grundlagen
In den Neurowissenschaften befassen sich Forscher mit den biologischen und physiologischen Strukturen und Prozessen, die dem Lernen zugrunde liegen. Im Zentrum der Beobachtung steht das zentrale Nervensystem, welches aus Gehirn und Rückenmark besteht und sich aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen) zusammensetzt. Unter dem Begriff des peripheren Nervensystems werden die ca. 25 Millionen Nervenzellen und deren Fortsätze außerhalb von Gehirn und Rückenmark zusammengefasst. Mit dieser unglaublichen Menge an Verbindungen stellt das menschliche Gehirn damit die komplexeste bekannte Struktur in unserem Universum dar (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 18). Demnach ist nicht eine einzelne Nervenzelle von Bedeutung, sondern das durch sogenannte Synapsen verbundene Kollektiv. Die einzelnen Neuronen bestehen aus einem Zellkörper, von dem Nervenfortsätze ausgehen. Dabei wird unterschieden zwischen Neuriten, welche die Nervenzelle mit anderen Zellen verbinden und Dendriten, die als Andockstellen für die Synapsen anderer Zellen fungieren.
Die Dendriten empfangen Informationen von den Rezeptoren der Sinnesorgane in Form von elektrischen Signalen, welche durch die Neuriten bis an das Ende eines Axons, den synaptischen Spalt, transportiert werden. Dort sorgen Übertragungssubstanzen (Transmitter) dafür, dass sich das elektrische Potential auf umliegende Zellen überträgt und die Informationen weitergeleitet werden können. Der Informationsfluss wird durch wiederholtes Auftreten elektro-chemischer Signale verbessert, wobei neuronale Bahnen etabliert werden. So bilden das Zusammenspiel untereinander und die Fähigkeit der Synapsen, sich zu verändern, die Grundlagen für Lernen und Gedächtnis, denn letztlich werden Gedächtnisinhalte dadurch gespeichert, dass die synaptische Datenübertragung zwischen einzelnen Neuronen und ganzen neuronalen Netzen effektiver wird (vgl. ebd.). Diese Fähigkeit des Zentralnervensystems, ständig neue Verbindungen zu schaffen und alte Verbindungen neu zu strukturieren und sich so immer wieder neu den Erfordernissen anzupassen, nennt man neuronale Plastizität. Anders als bis vor etwa 30 Jahren angenommen, ist die Entwicklung unseres Gehirns demnach nicht nach der frühen Entwicklungsphase abgeschlossen, sondern sie dauert das ganze Leben lang an. Die Erfahrungen, die wir als Kinder machen, prägen damit die Struktur des Gehirns, die sogenannte psychische Struktur, die jedoch auch über die Kindheit hinaus veränderbar ist. Allerdings fällt es den Synapsen in jungen Jahren wesentlich leichter, neue Verbindungen herzustellen und alte umzustrukturieren, also etwas Neues zu lernen oder bereits bekannte Denk- und Verhaltensmuster zu modifizieren. (vgl. Rüegg, 2014, S. 19).
Mit ca. 1,4 kg macht das Gehirn nur etwa 2 Prozent des Körpergewichts aus, es zeichnet sich aber für den Verbrauch etwa eines Fünftels der gesamten Energie, die wir über unsere Nahrung aufnehmen, verantwortlich. Doch dieser hohe Energiebedarf ist gerechtfertigt. Während andere Lebewesen wie dafür geschaffen scheinen, schnell zu laufen und zu jagen, zu schwimmen oder zu fliegen, ist der Mensch auf Grund seines Gehirns dazu in der Lage, sich flexibel auf verschiedene Umgebungen, Aufgaben und Probleme einzustellen. Er kann besser lernen als alle anderen Lebewesen, denn genau dafür sind seine Gehirne optimiert (vgl. Spitzer, 2009, S. 14).
Die wichtigste Komponente des Zentralen Nervensystems bildet die Großhirnrinde (Kortex). Dabei handelt es sich um eine stark gefaltete, etwa 1 mm dicke Schicht von Nervenfasern, die die beiden Großhirnhälften, oder auch Großhirnhemisphären, wie eine äußere Hülle umgibt. Der Kortex selbst ist unterteilt in sensorische, motorische und assoziative Bereiche. Die ersten beiden sind für die Aufnahme und Verarbeitung von Sinneseindrücken beziehungsweise die Steuerung von Bewegungen zuständig. Der Assoziativkortex gilt als größter assoziativer Speicher für eine Vielzahl von Fertigkeiten und sprachliches sowie nicht-sprachliches Wissen (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 20). Die verschiedenen Areale im Kortex sind unterschiedlichen Körperteilen zugeordnet, wobei die Größe des Hirnareals nicht proportional der des Körperteils entspricht, sondern abhängig von der Sensibilität der Sinnesorgane beziehungsweise der Präzision der erforderlichen motorischen Steuerung ist. Bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa das Sprachzentrum, welches bei fast allen Menschen in der linken Hemisphäre sitzt, befinden sich sensorische und motorische Regionen in den meisten Fällen in beiden Hemisphären und sind symmetrisch angeordnet. Die Nervenfasern, die Informationen in Form von elektrischen Impulsen von den Sinnesorganen ins Gehirn leiten und die, die von dort zu den Muskeln laufen, sind überkreuzt (vgl. ebd., S. 22). Legt man also zum Beispiel die linke Hand auf eine heiße Herdplatte, so wird der Reiz in der rechten Gehirnhälfte wahrgenommen und als Schmerz identifiziert. Andersherum steuert die linke Gehirnhälfte unsere Bewegungen etwa beim Schreiben mit der rechten Hand.
Seit sich die Hirnforschung mit Verbindungen zwischen psychischen und neuronalen Prozessen beschäftigt, haben sich zwei unterschiedliche Verfahren entwickelt, um diese zu verdeutlichen und anschaulich zu machen. Eine Methode ist es, durch das Anbringen von Elektroden an der Schädeldecke die auftretenden elektro-magnetischen Potentiale an bestimmten Arealen im Gehirn bei psychischen Leistungen zu messen. Die andere Möglichkeit ist ein so genanntes bildgebendes Verfahren. Nimmt die Hirnaktivität zu, so steigen auch der Stoffwechsel und die Hirndurchblutung an. Durch einen schwach radioaktiven Stoff in der Blutbahn lässt sich mittels eines Geigerzählers die Strahlenintensität in bestimmten aktiven Arealen bei der Tätigkeit messen. Diese Untersuchungsmethoden haben ergeben, dass besonders bei höheren kognitiven Funktionen die aktivierten Gehirnregionen überlappen und eine exakte neuronale Entsprechung quasi nicht definierbar ist, da es sich bei nahezu allen Vorgängen um eine schwerpunktmäßige Aktivierung ganzer Areale handelt (vgl. ebd., S. 23).
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Lernen aus neurobiologischer Sicht um vertiefende Verbindungen zwischen Neuronen oder wie Spitzer es sagt: „Je aktiver neuronales Gewebe in einem bestimmten Bereich der Gehirnrinde ist, desto eher finden in ihm Veränderungen von Synapsenstärken und damit Lernen statt.“ (Spitzer, 2007, S. 146) Die Hauptintention beim Lernen ist es, neue Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern. Wie diese Informationen in unser Gedächtnis gelangen und was genau unter Gedächtnis zu verstehen ist, wird mit verschiedenen Modellen versucht, zu erklären. Das Dreispeichermodell von Atkinson und Shiffrin unterteilt das Gedächtnis in sensorisches, oder Ultrakurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Speicherdauer und Speicherkapazität. Das Ultrakurzzeitgedächtnis verfügt, wie der Name schon sagt, über eine sehr kurze Speicherdauer von wenigen Millisekunden und repräsentiert visuelle, auditive, haptische, olfaktorische und gustatorische Sinneseindrücke, welche nicht zwingend bewusst wahrgenommen werden. Das Kurzzeitgedächtnis dagegen verfügt über Informationen, die wir bewusst wahrnehmen, ist jedoch auch auf einen Zeitraum von wenigen Sekunden und eine geringe Kapazität von etwa sieben Informationseinheiten beschränkt. Einzelne Informationen lassen sich aber mittels Chunking zu größeren Informationseinheiten zusammenfassen, wodurch die Speicherkapazität des Kurzzeitgedächtnisses erhöht werden kann (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 34). So lassen sich zum Beispiel Zahlenreihen wie 11092001 (acht Einheiten) zu einem Datum 11.09.2001 bestehend aus drei Einheiten zusammenfassen oder aber als ein eigenständiges Ereignis, den Tag der Anschläge auf das World Trade Center in New York, als eine einzige Einheit abspeichern. Aus dem Beispiel wird ersichtlich, dass Chunking jedoch gewisse Vorkenntnisse voraussetzt und daher nicht in jeder Situation anwendbar ist. Durch häufige Wiederholung können neue Informationseinheiten im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, was zu dauerhaften strukturellen Veränderungen auf neurologischer Ebene führt. Sind diese neuronalen Bahnen gefestigt, spricht man davon, dass die Informationen ins Langzeitgedächtnis aufgenommen wurden. Dieses verfügt quasi über eine unbegrenzte Speicherkapazität und eine sehr lange Speicherdauer von mehreren Jahrzehnten und beinhaltet sowohl deklaratives als auch nondeklaratives Wissen (vgl. ebd., S. 35). Ergänzt wurde das Dreispeichermodell einmal durch das Mehrspeichermodell von Baddeley, welches das Kurzzeitgedächtnis als Arbeitsgedächtnis, bestehend aus mehreren Modulen, die verschiedene Aufgaben übernehmen, versteht. Entscheidend für die Aufnahme von Informationen ins Langzeitgedächtnis ist demnach die zentrale Exekutive des Kurzzeitgedächtnis'. Dieses koordiniert die Funktionen der verschiedenen Speicher akustischer und verbaler (Phonologische Schleife) sowie räumlicher und bildlicher (Visuell-räumlicher Notizblock) Informationen. Die zweite Ergänzung liefert das Modell der Verarbeitungstiefe von Craik und Lockhart, welches jedoch im Gegensatz zu den beiden vorherigen nur einen einzigen Speicher postuliert. Die Dauer der Informationsspeicherung hängt dabei von der Tiefe der Informationsverarbeitung ab, also davon, wie intensiv wir uns mit Informationen auseinandersetzen (vgl. ebd., S. 36).
Eine besonders wichtige Rolle beim Lernen und bei der Gedächtnisbildung kommt dem limbischen System zu. Es besteht aus einer eng vernetzten Gruppe von Hirnarealen, wobei die Bedeutung des Hippocampus für das Lernen hervorzuheben ist und gilt als Ursprungspunkt für Emotionen und Triebverhalten. Es wird vermutet, dass hier komplexe sensorische Informationen mit Gedächtnisinhalten aus der Vergangenheit verglichen werden (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 30). Welche Bedeutung dem Hippocampus zukommt, zeigt der Fall des Patienten H.M., dem auf Grund einer epileptischen Störung der Hippocampus und angrenzende Teile des Gehirns entfernt wurden. Daraufhin konnte zunächst keine große Auffälligkeit bei H.M. festgestellt werden und durch verschiedene Versuchsreihen wurde belegt, dass er nach wie vor in der Lage war, Fertigkeiten durch wiederholtes Üben auch ohne Hippocampus zu erlernen. Jedoch war es ihm nicht mehr möglich, neue Ereignisse zu lernen und sich an sie zu erinnern. Als Ergebnis der Untersuchung stand fest, dass durch den Hippocampus eine Übertragung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurz- in das Langzeitgedächtnis stattfindet, was als Gedächtniskonsolidierung bezeichnet wird (vgl. Spitzer, 2009, S. 24). Eine Störung des Hippocampus hat also zur Folge, dass das Langzeitgedächtnis zwar intakt bleibt, aber keine neuen Inhalte mehr darin gespeichert werden können. Zudem fungiert der Hippocampus als eine Art Neuigkeitsdetektor, der registriert, ob aufgenommene Informationen neu oder bereits bekannt sind. Sind Information neu und unbekannt, werden sie als interessant bewertet und für die Speicherung im Gedächtnis vorbereitet. Leicht abgeänderte oder in einem anderen Kontext verknüpfte Informationen nimmt der Hippocampus auf, indem er die früher abgelegten Gedächtnisinhalte wieder aufruft und neu verknüpft wieder abspeichert. Besonders nützlich ist dabei die Eigenschaft, unvollständige Informationen zu ergänzen und so ganze Informationsnetzwerke zu schaffen beziehungsweise zu vervollständigen (vgl. ebd., S. 34).
3.2 Lerntheorien
Für die Pädagogische Praxis sind drei verschiedene Lerntheorien von großer Bedeutung, die sich vor allem in der jeweils unterschiedlichen Rolle und dem Aktivitätsgrad des Lernenden unterscheiden. Diese Theorien fußen einerseits auf den vorgestellten neurobiologischen Grundlagen und dienen andererseits als Ausgangspunkt für zahlreiche Lehr-Lern-Modelle und bilden den Hintergrund für die praktische Umsetzung von Unterricht. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass es sich hierbei lediglich um psychologische Theorien handelt, weshalb sich die Adaption der Ergebnisse in der Praxis als schwierig herausstellen kann. Die im Folgenden vorgestellten Lerntheorien des Behaviorismus', Kognitivismus' und Konstruktivismus' bauen geschichtlich und inhaltlich aufeinander auf. Da sie sich in manchen Teilen ergänzen, in anderen Teilen jedoch widersprechen oder völlig andere Herangehensweisen beschreiben, ist es unmöglich zu sagen, welche dieser Theorien nun am ehesten zutrifft und welche Lernen am besten beschreibt.
Eine der ältesten lernpsychologischen Strömungen stellt der Behaviorismus dar, der seine Anfänge im 19. Jahrhundert hat. Im Zentrum steht die Wahrnehmung bestimmter Hinweisreize und als Folge die Verstärkungen erwünschten Verhaltens. Lernen wird als rein assoziativer Prozess beschrieben, bei dem Reiz und Reaktion oder zwei Wissenseinheiten miteinander verbunden werden. Der Lernende selbst hat eine passive Rolle und wird als eine Art „Black Box“ angesehen und internen Prozessen wie etwa Gefühlslage, Wahrnehmung, Deutung oder Problemlösekompetenzen wird dabei keine Beachtung geschenkt. Stattdessen wird vermutet, dass Lernen durch Belohnung und Bestrafung gesteuert wird und Assoziationen infolge von Handlungskonsequenzen verstärkt beziehungsweise abgeschwächt werden (vgl. Rinck, 2016, S. 23).
Grundsätzlich wird zwischen zwei Formen des behavioristischen Lernens unterschieden. Als klassische Konditionierung bezeichnet man eine Lernform, bei der ein Reiz ein bevorstehendes Ereignis ankündigt und dadurch eine bestimmte Reaktion nach sich zieht. Die Fähigkeit, auf bestimmte Signale reagieren zu können und mit dem entsprechenden Verhalten zu antworten, hat sich im Laufe der Evolution als fundamental erwiesen, etwa beim Erkennen und Deuten von Gefahren oder bei der Suche nach Ressourcen. Bekannt wurde die Funktion des klassischen Konditionierens vor allem durch die Experimente Pawlows zum Speichelreflex bei Hunden. Bei diesen Experimenten wurde den Hunden zunächst Futter gezeigt und anschließend eine erhöhte Speichelproduktion bei ihnen festgestellt. Dem unkonditionierten Reiz (Futter) folgte somit eine unkonditionierte Reaktion (Speichelfluss), die nicht vorher erlernt werden musste. Das Läuten einer Glocke (neutraler Reiz) hatte zunächst keine Bedeutung für die Hunde, weshalb es auch keine Reaktion nach sich zog. Im nächsten Schritt kombinierte Pawlow die beiden Reize und läutete jedes Mal eine Glocke, bevor die Hunde ihr Futter bekamen. Die Hunde reagierten zunächst weiterhin mit erhöhter Speichelproduktion, wenn sie das Futter gezeigt bekamen. Nach einiger Zeit zeigten sie diese Reaktion jedoch auch, wenn sie lediglich das Glockensignal hörten, aber kein Futter mehr vorgesetzt bekamen. Ab diesem Zeitpunkt kann man von einer konditionierten Reaktion auf einen vorher neutralen, nun aber konditionierten Reiz sprechen (vgl. Rinck, 2016, S. 26). Im Gegensatz zur klassischen Konditionierung steht die instrumentelle oder operante Konditionierung. Diese Form beschreibt das Erlernen einer bestimmten Verhaltensweise mit dem Ziel, eine bestimmte Konsequenz zu erreichen und in Zukunft häufiger Verhalten zu zeigen, das positive Folgen nach sich zieht, beziehungsweise Verhalten zu vermeiden, das negative Folgen hat. Bekanntheit erlangte das instrumentelle Konditionieren vor allem durch Thorndikes Experimente mit Katzen, die sich durch das Lösen einer Aufgabe aus einem Käfig befreien sollten. Zeigten die Katzen das richtige Verhalten und lösten diese, war es wahrscheinlicher, dass das erfolgbringende Verhalten in Zukunft öfter auftrat. Sie hatten also gelernt, dass ein bestimmtes Verhalten eine erwünschte Konsequenz zur Folge hat und, dieses anzuwenden (vgl. ebd., S. 52).
Während man mit Behaviorismus in der Regel eher diese Experimente verbindet, besteht auch für die unterrichtliche Praxis Relevanz. Zwar wird kritisiert, dass die Auffassung über die Natur des Lernens sehr eingeschränkt sei, da sämtliche inneren Prozesse ausgeklammert werden und die Lernenden wie nach dem Prinzip des Nürnberger-Trichters Wissen nur eingeflößt bekommen, aber in gewissen Situationen kann sich dies als durchaus nützlich erweisen. So erfordern viele Fachgebiete oder auch das Lernen von Fremdsprachen zunächst einmal die Vermittlung granulierten Wissens, also sehr kleinschrittige und auf reine Wiedergabe von Lerninhalten ausgerichtete Schritte. Das Auswendiglernen von Fakten oder etwa Vokabeln bietet die Möglichkeit, eine Wissensbasis für komplexere Aufgaben zu schaffen und hat außerdem den Vorteil, dass der Lernstoff möglichst objektiv vorgestellt wird und die Lernenden eine schnelle Rückmeldung (Belohnung/Bestrafung) bekommen (vgl. Spitzer, 2007, S.33). Um nach der behavioristischen Theorie erfolgreich zu lernen, muss zunächst einmal das Lernziel so genau wie möglich festgelegt werden. Die einzelnen Lernschritte sollen in logischer Weise angeordnet sein und die Lernenden fordern, aber nicht überfordern. Eine Aufgabe zu lösen soll zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Lernstoff zwingen und es muss eine Möglichkeit zur Selbstkontrolle und zur Überprüfung des eigenen Lernerfolgs geben (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 120).
Als Gegenbewegung zum Behaviorismus, der als Ansatzpunkt konkret beobachtbares Lernverhalten hat, entwickelte sich ab Mitte des 20. Jahrhunderts der Kognitivismus, der sich auch auf die inneren Prozesse beim Lernen konzentriert und versucht zu entziffern, was die Behavioristen als „Black Box“ abstempeln und ignorieren. Der Fokus liegt auf dem Menschen als Individuum, der Reize nicht nur wahrnimmt, sondern auch aktiv und eigenständig verarbeitet. Dabei ist nicht das beobachtbare Verhalten Indikator für Lernvorgänge, sondern die ablaufenden Denk- und Verarbeitungsprozesse. Vorgänge wie „Wahrnehmen, Erkennen, Verstehen, Bewusstwerden, Denken, Vorstellen, Interpretieren, Problemlösen, Entscheiden oder Urteilen“ rücken in den Mittelpunkt. Lernen wird als Informationsverarbeitungsprozess verstanden, bei dem neue Informationen aufgenommen, im Kurzzeitgedächtnis mit bereits gesichertem Wissen in Zusammenhang gesetzt, gegebenenfalls ergänzt und schließlich im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden (vgl. Rinck, 2016, S. 105).
Eine Form des kognitiven Lernens bezeichnete Köhler als „Lernen durch Einsicht“, wobei Lernen als ganzheitlicher, problemlösender dreistufiger Prozess verstanden wird. Zunächst einmal muss ein Überblick über die einzelnen Komponenten eines Problems und deren gesamter Struktur in einer Situation gewonnen werden. Als nächstes werden durch Überlegen und kognitives Umstrukturieren der Situation Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten hergestellt. Die Einsicht tritt plötzlich ein und beschreibt den Moment, in dem die Zusammenhänge der Komponenten des Problems erkannt werden und ersichtlich wird, wie es sich lösen lässt beziehungsweise wie der gewünschte Zielzustand zu erreichen ist. Der dritte Schritt beschreibt die zielgerichtete Ausführung der Handlung, die zur Lösung des Problems führt. Das erfolgreiche Verhaltensmuster wird gespeichert und kann in Zukunft auf ähnlich strukturierte Situationen übertragen werden (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 150).
Viele kognitivistische Theorien verstehen den Menschen als soziales Wesen und gehen davon aus, dass der Mensch einen Großteil seines Verhaltens auf eine soziale Art und Weise lernt.
Eine dieser Theorien ist die sozial-kognitive Methode, entwickelt von Bandura. Dieses Modell soll erklären, durch welche Prozesse Menschen während ihrer Entwicklung lernen, sich in verschiedenen sozialen Situationen angemessen zu verhalten. Laut Bandura kann der Mensch sowohl durch direkte Erfahrungen (Konditionierung) und symbolische Erfahrungen (Instruktion) als auch durch stellvertretende Erfahrungen (Beobachtung) lernen (vgl. ebd., S. 190). Zentraler Teil des Beobachtungslernens bildet das Lernen am Modell oder auch Modelllernen. Es bedeutet, dass eine Person durch bloßes Beobachten eines Modells neues Verhalten lernen kann, dass zuvor nicht beherrscht wurde. Wichtig ist dabei die Ähnlichkeit zwischen Modell und Beobachter, sodass letzterer sich mit dem Modell identifizieren kann. Als einfachste Form des Beobachtungslernens sieht Bandura das Lernen durch Imitation. Neue Verhaltensweisen können durch Abschauen und Nachahmen von anderen Personen erlernt werden. Aber nicht nur bestimmte Verhaltensweisen können so erlernt werden, sondern auch das Wissen darüber, welches Verhalten in welchen Situationen angemessen ist und zu welchen Konsequenzen es führen kann (vgl. Lefrancois, 2015, S. 312). Ein großer Verdienst von Bandura ist also auch die Trennung von Verhalten und Ausführung und damit der Beweis, dass menschliches Lernen über das reine Reiz-Reaktions-Schema hinausgeht. Zudem unterteilte er das Erlernen von Verhaltensmustern in zwei Phasen: einerseits die Aneignungsphase, in der zunächst die Aufmerksamkeit des Lernenden gewonnen werden muss und dieser die neuen Informationen verarbeiten, abspeichern und im Langzeitgedächtnis ablegen kann. Andererseits die Ausführungsphase mit der motorischen Reproduktion des Verhaltens, die sowohl von den individuellen Eigenschaften des Lernenden als auch dessen Motivation abhängt. Vor allem Letzteres nimmt einen zentralen Platz bei Banduras' und anderen kognitiven Lerntheorien ein. Motivation ist beim Lernen eng mit der Aussicht auf Bekräftigung oder Belohnung verbunden und daher untrennbar mit den eigenen Erwartungen verknüpft (vgl. ebd., S. 314).
Lernen in der Schule oder an der Universität findet zu großen Teilen auf kognitiver Ebene statt. Um sicherzustellen, dass ein Lernprozess im kognitivistischen Sinne erfolgreich ist, müssen die Regeln der Informationsverarbeitung beachtet werden. Zunächst muss die Aufmerksamkeit des Lernenden geweckt werden, was mittels abwechslungsreicher und ungewöhnlicher Methoden, zum Beispiel dem Verpacken von Lerninhalten in eine Geschichte erreicht werden kann. Beim Lernen neuer Informationen ist es hilfreich, wenn diese mit Vorwissen verknüpft werden können. Ein Überblick über das bevorstehende Themengebiet sowie eine Reaktivierung bereits gelernten Stoffes bieten sich daher zum Einstieg in eine Unterrichtsreihe an. Des Weiteren sollen die einzelnen Lerninhalte einfach, verständlich und prägnant dargestellt und komplexere Informationen als aufeinander aufbauende Informationsketten präsentiert werden. Durch häufiges Wiederholen und Verknüpfen neuer Informationen soll die Gedächtnisleistung der Lernenden verbessert werden und sowohl die eigenständige Kontrolle des gelernten Wissens und das damit verbundene Erreichen von Lernerfolgen sowie regelmäßiges Feedback zu der eigenen Leistung können einen positiven Einfluss auf das Lernverhalten haben (vgl. Rinck, 2016, S. 108).
Der Konstruktivismus ist eine neuere und vielseitige psychologische Strömung und sollte hier auf jeden Fall Beachtung finden, da er für unser Verständnis von Lernen elementar ist und die Bedeutung für die Schulpraxis zunehmend wächst. Die Grundidee des Konstruktivismus besteht darin, dass Individuen nicht auf Reize einer objektiven Welt reagieren, sondern sich diese vermeintlich objektive Wirklichkeit anhand von Sinneseindrücken subjektiv konstruieren. Das Gehirn wird als geschlossenes System betrachtet, welches zwar zunächst Reize aus der Umwelt aufnimmt, diese allerdings interpretiert und dadurch zu einem individuellen Sinneseindruck verarbeitet. Was eine Person sieht, hört oder riecht ist also niemals eine objektive Wahrnehmung, sondern lediglich eine subjektive Interpretation der Wirklichkeit. Diese subjektive Wirklichkeit entsteht auf der Basis bereits bestehenden Wissens und wird erst durch den gemeinsamen Kommunikationsprozess verbindlich (vgl. Hußmann, 2002, S. 3). Dabei stehen dem Individuum laut Piaget zwei Möglichkeiten der Informationsverarbeitung zur Verfügung: Akkommodation und Assimilation. Während Assimilation neues Wissen in bereits vorhandene Denkschemata einordnet und diese so modifiziert und erweitert, entstehen durch Akkommodation neue Erkenntnisse, aus denen sich neue Denk- und Verhaltensmuster ableiten lassen (vgl. ebd., S. 4).
Im Gegensatz zu anderen Lerntheorien betrachtet der Konstruktivismus die Vermittlung von Wissen als unmöglich, da Lernprozesse durch das Individuum und nicht durch die Umwelt bestimmt werden. Der Lernende muss Wissen stets selbstständig neu konstruieren, reorganisieren und erweitern und daraus neue Auffassungen und Konzepte der Wirklichkeit ableiten. Folglich kommt dem Lehrer eine eher passive oder assistierende Rolle zu mit der Hauptaufgabe, eine möglichst authentische, abwechslungsreiche und herausfordernde Lernumgebung zu gestalten. Er soll die Lernenden Inhalt und Methodik zum Teil selbst wählen lassen und sie dabei lediglich beraten, wodurch zusätzlich die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung gestärkt werden soll. Das Erzeugen eines guten Lernklimas und eine funktionierende persönliche Beziehung sind elementar und das steife Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler soll aufgelockert werden, sodass sich auch der Lehrer häufiger als lernende Person sehen und das eigene Verhalten reflektieren kann (vgl. ebd., S. 8). Damit stellt der Konstruktivismus eine theoretische Basis für alle offenen, vom Lerner mitbestimmten Lehr-Lern-Situationen dar. Dieser zunehmend beliebtere Ansatz erfordert allerdings auch eine hohe Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler. Zwar ermöglicht das selbstgesteuerte Lernen eine stärkere individuelle Förderung und durch regelmäßiges Feedback und Reflexion der einzelnen Lernschritte lassen sich positive Einwirkungen auf den Lernerfolg feststellen, aber es gibt ebenso Sachverhalte, die sich durch Instruktion deutlich besser vermitteln lassen, weshalb ein rein konstruktivistisches Vorgehen im Unterricht kaum realisierbar ist (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 259).
[...]
- Arbeit zitieren
- Nicolas Kirsch (Autor:in), 2020, Warum Bewegte Schule zu besseren Lernergebnissen führt. Der Zusammenhang zwischen Lernen und Bewegung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510075
Kostenlos Autor werden








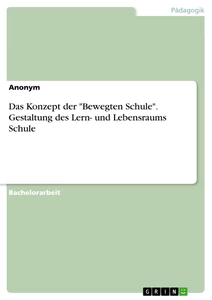











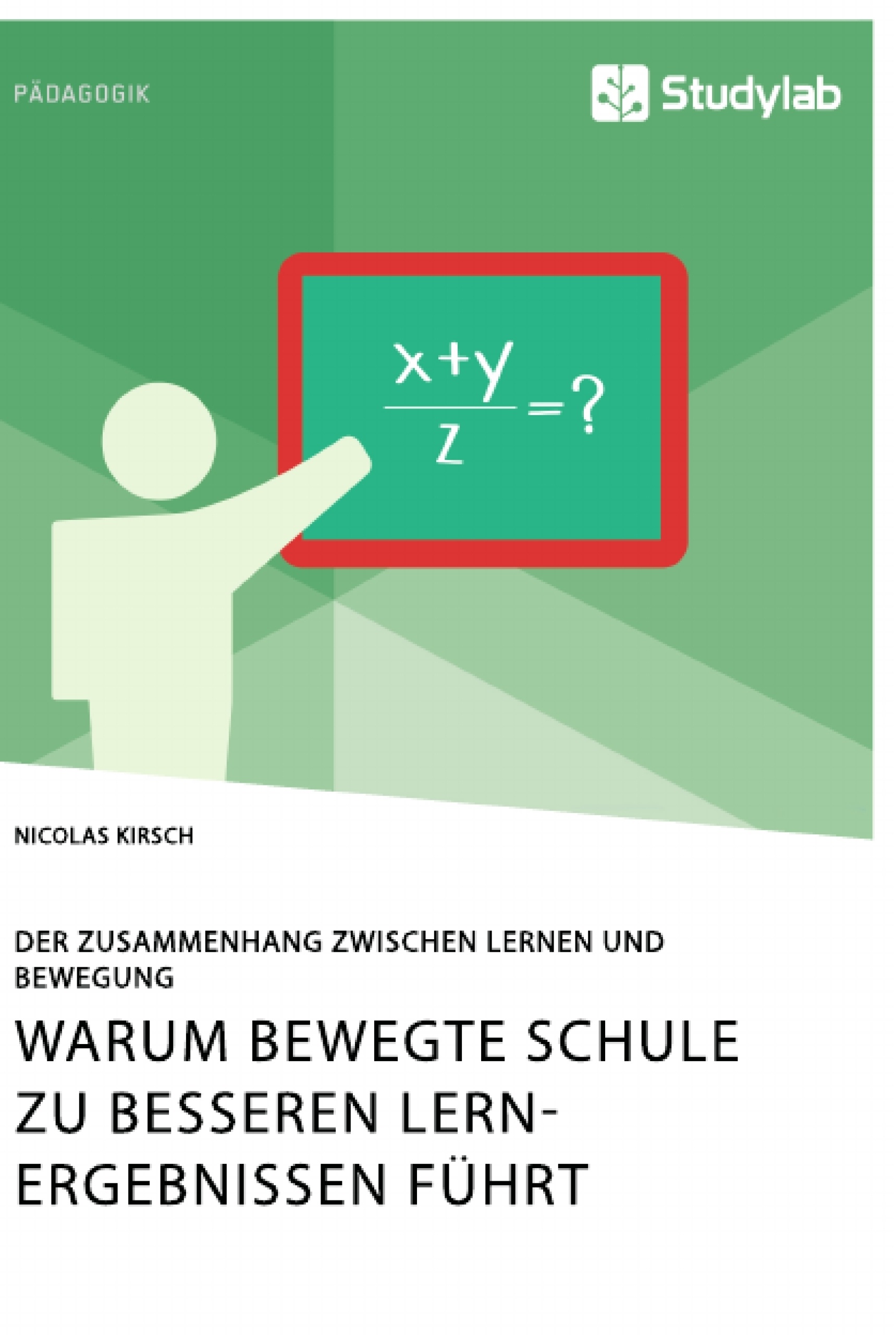

Kommentare