Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Philosophische und naturwissenschaftliche Aspekte zu Körper und Geist
I.1. Der Cartesianismus
I.1.1. René Descartes: Substanzdualismus
I.1.2. René Descartes: die Person als essenzielle Einheit
I.1.3. René Descartes: Naturwissenschaft und Methodologie
I.2. Menschenbilder der Wissenschaften in der Moderne
I.2.1. Wechselwirkungen zwischen den Disziplinen
I.2.2. Erkenntnistheoretische Positionen der Neurowissenschaften
I.2.3. Erfahrung: Geist, Gehirn und Beziehung
I.2.3.1. Die Definition des Geistes
I.2.3.2. Das Prinzip der inneren Strukturierung - Innen wie Außen
I.3. Zusammenfassung
II. Angst: wenn aus Anpassung Stress wird
II.1. Was sind eigentlich Emotionen?
II.1.1. Angst als biologische Anpassungsreaktion
II.1.2. Angst als Stresssymptom
II.1.2.1. Stresstheorien
II.1.2.1.1. Stress als Notfallreaktion
II.1.2.1.2. Stress als unspezifische Phasenreaktion
II.1.2.1.3. Stress als Reizreaktion
II.1.2.1.4. Stress als Beziehungskonzept
II.2. Zusammenfassung
III. Zur Neurobiologie der Angstentstehung
III.1. Auf der Suche nach dem emotionalen Gehirn
III.1.1. Die Architektur des Gehirns
III.1.1.1. Die mikroskopische Struktur des Gehirns
III.1.1.2. Die makroskopische Struktur des Gehirns
III.1.1.2.1. Zur Funktion und Lage der Rindenfelder und Kerne im Gehirn
III.1.1.2.2. Die Amygdala - die Kernstruktur der Angst
III.1.2. Die Emotionstheorie von LeDoux
III.1.2.1. Das Furchtsystem
III.1.2.2. Die Amygdala bei LeDoux
III.1.2.3. Das Zwei-Wege-System der Emotionen
III.2. Zusammenfassung
IV. Angststörungen im Rahmen sozialpädagogischer Praxis
IV. 1. Angststörungen als klinisch relevante Phänomene
IV. 1.1. Angststörungen im ICD-10 und DSM IV-TR
IV. 1.2. Angststörungen: Prävalenz und Komorbidität
IV. 1.3. Angst, die das Leben stört
IV. 1.3.1. Die Angst vor dem Urteil der Anderen: soziale Phobie
IV. 1.3.1.1. Die Soziale Phobie im DSM-IV-TR und ICD-
IV. 1.3.1.2. Zwei Subtypen der Sozialen Phobie
IV. 1.3.2. Selbsthilfe bei Angststörungen
IV. 1.3.2.1. Bibliotherapie
IV.1.3.2.2. Achtsamkeit: sich selbst und anderen ein Freund werden
IV.2. Zusammenfassung
Schluss
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Längsschnitt durch das menschliche Gehirn mit sieben Hirnteilen plus Rückenmark und Kleinhirn
Abb. 2 Lappengliederung und Rindenfelder der linken Hemisphäre des Großhirns
Abb. 3 Medianansicht (Längsschnitt entlang der Mittellinie) des menschlichen Gehirns mit einigen limbischen Zentren
Abb. 4 Die Verschaltungen innerhalb der Amygdala
Abb. 5 Zentraler Kern der Amygdala und seine Outputbahnen
Abb. 6 Diagramm des menschlichen Gehirns von der Mitte nach rechts gesehen
Abb. 7 Die Rolle der Amygdala bei der Verarbeitung angstbezogener Stimuli am Beispiel des Sehens
Abb. 8 Komplexes Teufelskreismodell der Entstehung von Angst- und Substanzstörung
Einleitung
Jeder Mensch kennt die Emotion Angst. Den Gefühlszustand von dem BANDELOW behauptet, der Mensch könne sich von ihm nicht befreien (vgl. 2010a, S. 134). Angst ist allgegenwärtig (vgl. BANDELOW 2010b, S. 16 und LEDOUX 2004, S. 139). Die endgültige Befreiung von Angst käme dem Umstand gleich, sein Leben aufs Spiel zu setzen, denn die Angst schützt den Menschen vor gefährlichen Situationen wie zum Beispiel Krieg, Krankheit, Verlust, Unfällen usw. (vgl. BANDELOW 2010b, S. 16). Die Erfahrung von Angst ist jedem Menschen bekannt und keiner will sie machen. Denn alle Menschen fürchten den Verlust des eigenen Lebens, der Gesundheit, der Arbeit, die Trennung von allem, was ihnen wertvoll ist. Sich zu fürchten und sich zu ängstigen scheint jedoch für die Wissenschaften nicht das Gleiche zu sein. Nach FREUD hatte die Angst ... eine unverkennbare Beziehung zur Erwartung; sie ist Angst vor etwas. Es haftet ihr ein Charakter von Unbestimmtheit und Objektlosigkeit an; der korrekte Sprachgebrauch ändert selbst ihren Namen, wenn sie ein Objekt gefunden hat, und ersetzt ihn dann durch Furcht (1971, S. 302)1.
Die Fachwelt hat einiges zum Thema Angst geschrieben. Dabei ist auffallend, dass die tiefenpsychologisch und lerntheoretisch orientierte Literatur darum 2 bemüht ist zu klären, wie Angst zu verstehen und zu bewältigen ist2. Hierbei bezieht sich das Bewältigen nicht auf die reale Angst, die allgegenwärtig vor Bedrohung schützt, sondern auf die Störung dieses Zustandes. Damit Angststörungen behandelt werden können, ist ihr Ursprung relevant. Auch dazu beschreibt die tiefenpsychologische und lerntheoretische Literatur Ansätze. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass die Emotion Angst in der Psyche bzw. im Geist verortet und die Angststörung eine psychische Erkrankung ist. Dass es sich dabei um ein psychosomatisches Geschehen handelt und die Angst als Pate für die Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist steht (vgl. MORSCHITZKY 2009, S. 3), wird in den Erklärungsansätzen nicht berücksichtigt. Auch finden sich keine eindeutigen Annahmen darüber, was mit Psyche gemeint ist, in der die Angst ihren Ort haben soll und was der Körper und das Umfeld, in dem ein Mensch lebt, mit dem gestörten Zustand und der Psyche bzw. Geist zu tun haben. Wie sich die Trennung von Körper und Geist aus erkenntnistheoretischer Sicht entwickelt hat und welche erkenntnistheoretischen Annahmen die Neurowissenschaften heute einnehmen, ist zur Klärung dieser Teilfrage in Kapitel I ebenso relevant wie herauszuarbeiten, woraus sich Erfahrung zusammensetzt und wie diese Zusammensetzung dazu beiträgt, die Trennung von Körper und Geist aufzuheben.
Das Phänomen Angst wurde, wie eingangs gesagt, ausreichend aus tiefenpsychologischer und lerntheoretischer Sicht untersucht. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht hingegen gibt es gemäß BALZEREIT zu diesem Thema kaum Ausarbeitungen und wenn, beziehen diese sich auf o.g. 3 Erklärungskonzepte3 (vgl. 2010, S. 17). Da die Sozialwissenschaften gemäß BALZEREIT über keine eigenen Erklärungskonzepte verfügen (vgl. 2010, S. 17) und diverse Ausarbeitungen aus 'klassischer Sicht' vorliegen, will ich in dieser Arbeit weitestgehend aus der naturwissenschaftlichen Perspektive folgende Leitfrage genauer untersuchen: Wie wird Angst von Menschen erfahren? Dass das nicht bedeutet, die sozialwissenschaftliche Perspektive auszublenden, wird in den Ausführungen deutlich werden. Zudem werden Bezüge zur Sozialen Arbeit in Kapitel IV hergestellt.
Wenn jeder Mensch die Emotion Angst kennt und sich von der Erfahrung mit ihr nicht befreien kann (vgl. BANDELOW 2010a, S. 134), ist auch zu klären, was eigentlich eine Emotion ist. Auch, wie eine Emotion wissenschaftlich zugänglich wird, die sich als Gefühl, als körperlicher Zustand und als Ausdruck zeigt. Was genau ist mit dem Begriff Angst gemeint? Wie drückt sich die Emotion Angst aus und ist der Ausdruck von Angst angeboren und in jeder Kultur gleich? Wie zeigt sich Angst auf körperlicher Ebene und ist dann der Begriff Angst noch der korrekte Sprachgebrauch? Kapitel II beschäftigt sich mit all diesen Fragen. Dabei wird zwar erörtert, dass psychische Zustände nicht als unabhängig von ihren zugrunde liegenden Hirnmechanismen beschrieben werden können, aber es wird nicht der Frage nachgegangen, welche Gehirnschaltkreise neuronale Aktivitäten zeigen, wenn ein Mensch Angst hat.
In Kapitel III wird dieser Frage nachgegangen. Daraus ergeben sich wieder neue Aspekte, die nach Antworten suchen, wie: Gibt es im Gehirn ein emotionales Gehirn? Welchen Einfluss hat die mikro- und makroskopische Struktur des Gehirns auf die Funktion des Gehirns? Und wie lassen sich diese Funktionen und Strukturen im Zusammenhang mit der Angst erklären? Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist zudem, ob beschriebene Sachverhalte auch für die Soziale Arbeit bzw. Sozialarbeit interessant sein können. Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, muss in Kapitel IV erst einmal auf die Fragen eingegangen werden: Wann haben Sozialarbeiter mit Menschen zu tun, die an einer Angststörung leiden? Welche Ziele verfolgen Sozialarbeiter in der Begleitung von Menschen mit Angststörungen? Welches Fachwissen benötigen Sozialarbeiter zum Verfolgen dieser Ziele? Kann dieses Wissen aus ihrer Profession zusammengestellt werden und wenn nein, aus welcher Bezugsdisziplin rekrutieren sie es dann und warum? Wenn diese Fragen beantwortet sind, bleibt noch offen: Wie lassen sich die neurowissenschaftlichen Zusammenhänge in der Sozialarbeit methodisch umsetzen?
Um einen direkten Bezug zur sozialen Praxis herzustellen, habe ich an den Stellen, wo es mir inhaltlich sinnvoll erschien, die Perspektive einer praktizierenden Sozialarbeiterin eingenommen und Fallbeispiele geschildert bzw. strukturelle Zusammenhänge, wie sie sich im institutionellen Rahmen für mich zeigen, reflektiert.
I. Philosophische und naturwissenschaftliche Aspekte zu Körper und Geist
„Ihnen fehlt nichts“. Diesen Satz bekommen Patienten manchmal zu hören, obwohl sie ihren Hausarzt wegen körperlicher Symptome wie Muskelspannung, Herzklopfen, Herzrasen, Harn- und Stuhldrang, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche und anderer 'funktionellen' Störungen aufgesucht haben (vgl. MEYER-ABICH 2010, S. 13). Die von MEYER- ABICH aufgeführten körperlichen Symptome (vgl. 2010, S. 13) finden sich auch bei MORSCHITZKY in seinen Ausführungen über Angst wieder. MORSCHITZKY beschreibt Angst als angeborenen Überlebensinstinkt, als eine biologisch sinnvolle, jedoch auch massive körperliche und geistige Aktivierung, die in einer Angststörung münden kann. Insbesondere die körperlichen Symptome sind als ein Merkmal von Angst und von Angststörung4 einzuordnen. Ohne die körperlichen Symptome würde MORSCHITZKY eher von intellektueller Besorgtheit sprechen und weniger von einem Zustand der Angst, ganz zu schweigen von einer Angststörung (vgl. 2009, S. 1). Dennoch werden Angststörungen in allgemeinmedizinischen Praxen häufig nicht als solche erkannt, da dem Patienten nichts Medizinisches fehlt (vgl. MEYER-ABICH 2010, S. 13).
Aus der Praxisperspektive
Diese Aussage deckt sich mit den Erfahrungen in meiner Tätigkeit5 als Sozialarbeiterin. In dieser Tätigkeit werde ich mit Menschen konfrontiert, die 6 sowohl an einer Substanzstörung6 als auch an einer oder mehreren psychischen Störungen erkrankt sind. N EUBAUER verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der Komorbidität7 (vgl. N EUBAUER 2007 S. 9). Betroffene, die neben der Substanzstörung unter einer Angststörung8 litten, berichteten mehrfach, erst nach langen Odysseen durch das Gesundheitssystem einen Arzt gefunden zu haben, der hinter der somatischen Wirklichkeit auch eine psychische erkannte. Dabei waren die Reaktionen der Bewohner unterschiedlich.
Vom Standpunkt der medizinischen Philosophie aus betrachtet, drückt MEYER- ABICH die Reaktionen von Patienten sehr knapp aus. Für ihn gibt es Patienten, die ihren Körper als etwas verstehen, was sie sind und wieder andere verstehen ihren Körper als etwas, was sie haben (vgl. 2010, S. 26).
Aus der Praxisperspektive
Im Wesentlichen deckt sich diese philosophische Erkenntnis mit den Erfahrungen aus meiner Tätigkeit als Sozialarbeiterin. Einige Betroffene beginnen, nachdem ihnen erklärt wurde, dass die körperlichen Symptome durch das Zusammenspiel von Körper und Geist ausgelöst werden, zugänglich für eine therapeutische Behandlung zu werden und erkennen den Einfluss ihres eigenen Verhaltens und den Bezug zu ihrer Substanzstörung. Einzelne geraten durch die Erkenntnis, dass es sich bei der Symptomatik nicht um ein rein biologisches Phänomen handelt, in psychodynamische Konflikte. Aus diesem Grund suchen Betroffene trotz mehrfacher Gespräche über die Zusammenhänge bei Auftreten der Angstsymptomatik immer wieder unterschiedliche Ärzte auf, um für die Symptomatik eine organische Ursache als Erklärung zu bekommen.
Eine Behandlung, die sowohl dem körperlichen als auch dem psychischen Geschehen Rechnung trägt, ist laut Aussage von MEYER-ABICH im derzeitigen Gesundheitssystem schwer zu finden. Vielmehr gebe es in der Hauptsache die somatische Medizin mit ihren Fachdisziplinen für kranke Körper ohne Seelen und daneben die psychologische Medizin für kranke leidende Seelen ohne Körper (vgl. MEYER-ABICH 2010, S. 212). Diese Aussage wird, laut MORSCHITZKY, untermauert durch Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), aus denen entnommen werden kann, dass die Mehrzahl der Angstpatienten über vier bis zehn Jahre nicht adäquat diagnostiziert und dementsprechend behandelt wird. Ungefähr 50 % der Angststörungen werden von Hausärzten nicht erkannt oder als somatische Störung fehldiagnostiziert (vgl. 2009, S. 189). Das Gesundheitswesen hat auf diese Kritik mit der Einrichtung von psychosomatischen Lehrstühlen und Kliniken reagiert. Dennoch, so MEYER-ABICH, sei die Gesellschaft bisher nicht ausreichend im psychosomatischen Sinne versorgt. Im Wesentlichen gehe es so weiter wie bisher und nach wie vor können weder Allgemeinmediziner noch Ärzte Krankheiten ausreichend als psychosomatisches Geschehen einordnen (vgl. 2010, S. 212). Entgegen MEYER-ABICH (vgl. 2010, S. 212) beschreibt FAULSTICH den Zusammenhang zwischen somatischer und psychologischer Medizin weniger chancenlos und stellt dar, dass die Entdeckungen der Neurowissenschaften unmittelbare Folgen für die Medizin hatten. Nach FAULSTICH entstand aus den Erkenntnissen der Neurowissenschaften die Psychoneuroimmunologie. Diese Disziplin ist auf der Suche nach den Verbindungen zwischen den vormals als getrennt wahrgenommenen Körpersystemen, sozusagen dem Gehirn, den Drüsen und dem Immunsystem. Die Forschungsergebnisse aus dieser Fachdisziplin machen sichtbar, dass Krankheiten aus den Wechselwirkungen von Körper und Geist sowie innen und außen entstehen (vgl. 2010, S. 44).
Ein Beispiel für so eine Wechselwirkung findet sich auf der ursprünglichsten Körperebene, die der Mensch kennt: bei den Genen. Die Gene sind die Bausteine, aus denen sich das Muster des gesamten Organismus aufbaut. Eric KANDEL (2006) einer der bedeutendsten Gedächtnisforscher der Welt, forschte an einem Weichtier, der Meeresschnecke Aplysia. Ohne an dieser Stelle explizit auf die Details seiner Forschung einzugehen9, lieferte KANDEL die Nachweise einer Forschung, die 1961 mit Francois Jacob und Jacques Monods begann. Beide hatten durch die Forschung an einer Bakterie herausgefunden, dass Gene wie ein Wasserhahn reguliert werden, bzw. an- und abgestellt werden können (vgl. KANDEL 2006, S. 281f.). KANDEL bestätigte dies durch seine Forschung und erklärte, dass Gehirne durch ihre neuronalen Verschaltungen 10 bzw. durch die synaptischen Verbindungen10 bestimmt werden. Diese Verbindungen sind sowohl durch genetische Prozesse als auch durch die lebenslange Entwicklung des Menschen konstituiert. Aber die genetischen Prozesse bestimmen nicht die Stärke der Verbindungen. Vielmehr werden die Verbindungen durch Lernen verstärkt und verändert. Die Stärke der Verbindungen entscheidet, ob etwas nur im Kurzzeitgedächtnis bleibt oder im Langzeitgedächtnis gespeichert wird. Gemäß KANDEL ist für die Gedächtnisspeicherungen eine Veränderung in der Genexpression nötig, die durch Umwelteinflüsse ausgelöst wird. Demnach schalten Umwelteinflüsse in Verbindung mit dem inneren Milieu Gene gewissermaßen ein oder aus. Daraus resultiert, dass Gene keineswegs unveränderbar sind, sondern selbst von körperlichen und geistigen Prozessen geregelt werden (vgl. 2006, S. 281f.). Wieso sich bisher die neuen Erkenntnisse nicht insoweit durchgesetzt haben, dass die Psychosomatik nicht nur ein zusätzliches Fach der Medizin ist, sondern ihr neues Leitbild wird, begründet MEYER-ABICH mit dem vorherrschenden Menschenbild in der Gesellschaft. Für MEYER-ABICH ist die Lehre des Philosophen René Descartes verantwortlich für die Trennung von Körper und Geist und das sowohl in der Medizin wie in dem gleichermaßen dualistischen Allgemeinbewusstsein der Menschen (vgl. 2010, S. 212). GÖLLER schließt sich MEYER-ABICH (vgl. 2010, S. 212) an und unterstellt, dass die Menschen im Alltag unreflektiert an einen Dualismus von Körper und Geist glauben. Die Welt teilt sich in Physisches und Psychisches oder Materielles und Geistiges auf. Ohne dass sich Menschen dessen immer bewusst sind, stellen sie zwischen ihrem Handeln und ihrem Denken fortwährend Kausalzusammenhänge her. Wie ist es jedoch möglich, dass etwas wie der Geist, der keinen Ort noch einen Raum hat, auf einen Körper einwirkt? (vgl. GÖLLER 2009, S. 79). Diese Frage ist bis heute unbeantwortet und alles andere als ein Allgemeinplatz. Selbst dann nicht, wenn Menschen in der Regel das individuelle Empfinden haben, dass Körper und Geist zusammengehören. Dieses subjektive Erleben resultiert laut GÖLLER aus dem menschlichen Bewusstsein, das es ohne das Zusammenwirken von Körper und Geist weder Sinneswahrnehmungen noch körperliche Empfindungen oder gar Emotionen und Bedürfnisse geben kann (vgl. 2009, S. 78). Während das subjektive Empfinden des Einzelnen das Verhältnis von Körper und Geist ungeklärt im Raum stehen lassen kann, beschäftigen sich die Wissenschaften seit der Antike mit dieser Problematik. Die Philosophie der Antike war darum bemüht, das sogenannte Leib-Seele-Problem oder auch Körper-Geist-Problem11 zu klären. Bis heute gibt es verschiedene philosophische Ansätze, die jedoch das Problem bisher nicht abschließend lösen konnten. Dennoch, so betont MEYER-ABICH, war 12 es insbesondere der Cartesianismus12, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass Körper und Geist bis in die Gegenwart vornehmlich als getrennt wahrgenommen werden (vgl. 2010, S. 212).
I.1. Der Cartesianismus
René Descartes (1596-1650) erschuf mit seiner Lehre ein Menschenbild, das den Körper als mechanische Maschine beschrieb, die man nach den Funktionen ihrer Teile analysieren kann. Die Seele hatte in seinem Menschenbild nur insofern ihren Platz, dass sie eben den Körper verlässt, wenn dieser nicht mehr funktioniert (vgl. MEYER-ABICH 2010, S. 28). Scharfe Worte, 13 die zwar nicht den Hintergrund13 beschreiben, der Descartes zu dieser Haltung veranlasste, aber im Wesentlichen durchaus abbilden, was Descartes in seiner Lehre vertrat. Den Hintergrund benennt SPECHT und führt aus, dass Descartes den Leib von der Seele metaphysisch14 trennte, weil er daran interessiert war, eine gesicherte Wissenschaft zu begründen, die den Glauben an Gott und die unsterbliche Seele nicht leugnen muss. Gemäß SPECHT hatte Descartes primär ein Interesse daran, die Lage des Menschen durch eine gesicherte Wissenschaft zu verbessern und nicht den Körper vom Geist zu trennen (vgl. SPECHT 1996, S. 18). Diese Gedanken trug Descartes gemäß SPECHT auch in die Medizin. Damit auch die Medizin eine sichere Wissenschaft wurde, empfahl Descartes von der Seele abzusehen. Das machte die Medizin überschaubarer und einfacher, konnten sich die Ärzte doch auf die Reparatur einer organischen Maschine konzentrieren. Selbst wenn es ursprünglich nicht Descartes Ansinnen war, steht für SPECHT außer Frage, dass Descartes durch seine Philosophie den sogenannten cartesischen Umbruch in der Medizin verursacht habe (vgl. 1996, S. 19f.).
I.1.1. René Descartes: Substanzdualismus
Perler fasst die Metaphysik Descartes' in einer These zusammen. Danach besteht die von Gott geschaffene Welt aus zwei Substanzen: einer körperlichen Substanz, die als wesentliches Attribut die Ausdehnung enthält und einer geistigen Substanz, der sogenannten immateriellen Seele, deren wesentliches Attribut das Denken ist. Beide Substanzen sind real verschieden und nicht nur begrifflich voneinander zu unterscheiden. Der Mensch gilt als Beispiel für die Verbundenheit und Wechselwirkung dieser Substanzen (vgl. 1998, S. 169). Im Allgemeinen, so PERLER, wird hier von der Dualismusthese gesprochen, die fälschlicherweise manchmal so verstanden wird, als würde Descartes von zwei Welten sprechen: Der Welt mit geistigen Objekten wie zum Beispiel Gedanken und Empfindungen und der Welt mit körperlichen Objekten wie zum Beispiel menschliche Körper oder Tische. PERLER erinnert aber daran, dass es sich bei Descartes um einen Substanzdualismus handelt und nicht um eine Zwei- Welten-Theorie, in der Körper- und/oder Geistobjekte in Relation zueinander stehen. Descartes, so versteht es PERLER, geht von unterschiedlichen Substanzen aus, die mit unterschiedlichen Attributen ausgestattet sind. Demnach sind Gedanken oder Gefühle keine geistigen Objekte, sondern, um mit PERLER in der Terminologie von Descartes zu bleiben, der Modus einer geistigen Substanz. Im Rahmen des Cartesianismus bedeutet demnach „Ich habe Angst“, dass das 'Ich' als geistige Substanz das Gefühl der Angst empfindet. Dieses Angstempfinden ist dann der Modus der geistigen Substanz (vgl. 1998, S. 169f.). Es gibt keine inneren Objekte, die das 'Ich' beobachten können, sondern nur geistige Zustände, die den jeweiligen Zustand des 'Ich' modifizieren. An diesem Beispiel macht PERLER deutlich, dass es Descartes nicht darum ging, den realen Unterschied von Körper und Geist zu charakterisieren, sondern nur die Verschiedenheit zweier Arten von Substanzen (vgl. PERLER 1998, S. 171). Im Modell von Descartes sind, gemäß PERLER, Substanzen - ob körperlich oder geistig - nicht unabhängig, sondern ihre Existenz ist zu jedem Zeitpunkt abhängig von Gott. Die immaterielle Seele, also die geistige Seelensubstanz ist somit, gemäß PERLER, in ihrer zweifachen Funktion zu verstehen, nämlich in der Kommunikation mit Gott und mit dem Körper. Nach PERLERS Aussagen wird deutlich, dass Descartes die Substanzen nach ihrer Existenzart und nach ihren wesentlichen Attributen klassifizierte. PERLER differenziert, indem er erklärt, dass die immaterielle Seele das Verbindungsglied zu Gott und dem Körper darstelle. Der Körper interagiert mit der Seele und solange der Körper funktioniert, verfügt er über eine unsterbliche Seele. Gleiches bedeutet aber nicht, dass der Körper der Träger der Seele ist (vgl. 1998, S. 171). Die Seele ist in Descartes' Philosophie, so Perler, eine besondere Substanz, die keinen Träger benötigt, weshalb sie auch als immaterielle Seele bezeichnet wird. In Descartes' Philosophie, so PERLER, bleibt der Körper eine ausgedehnte materielle Substanz. Die materielle Substanz wird nicht von einer inneren Seele gelenkt, sondern ist als Gegenstand zu verstehen, der nach mechanistischen Prinzipien funktioniert und das bewusste Denken nicht benötigt, demnach als ausgedehnte Substanz unbeseelt ist. Deswegen ist der Körper auch sterblich, während die Seele als immaterielle Substanz unsterblich bleibt (vgl. 1998, S. 171).
I.1.2. René Descartes: die Person als essenzielle Einheit
PERLER weist darauf hin, dass Kritiker den cartesianischen Menschen nur noch als 'Gespenst in der Maschine' verstanden. Diese Kritik wurde damit begründet, dass Descartes durch die Lehre seines Substanzdualismus die charakteristische Position des Aristoteles, also die Einheit der Person, aufgegeben hatte und nur die denkende Substanz als unzweifelhaft galt (vgl. 1998, S. 209f.). PERLER führt jedoch aus, dass nach Descartes die Seele nicht einfach ein Schiffer in einem Schiff ist, sondern mit dem Körper aufs Engste verbunden sei. Hier stellt PERLER die Frage, wie Descartes seinen metaphysischen Dualismus verteidigen und gleichzeitig, genau wie die Aristoteliker, die Einheit der Person aufrechterhalten kann: Oder anders ausgedrückt: Wie können die unterschiedlichen Wesenheiten, die immaterielle Seele bzw. die geistige Substanz auf die ausgedehnte Substanz, den materiellen Körper einwirken? (vgl. PERLER 1998, S. 213). PERLER erklärt, dass Descartes die Annahme vertrat, dass es zwischen den Substanzen eine besondere Beziehung gibt. Immer dann, wenn beide Substanzen zufällig miteinander verbunden sind und alle ihre Funktionen auch unabhängig voneinander ausüben können, dann bilden sie eine akzidentielle Einheit, eben ein bloßes Konglomerat. Nur dann, wenn beide Substanzen so miteinander verbunden sind, dass ihre Funktionen nicht unabhängig voneinander ausgeübt werden können, bilden sie zusammen eine essenzielle Einheit. Bei der Verbindung von Körper und Geist ist dies der Fall, und zwar deswegen, weil die zentrale Funktion der Sinneswahrnehmungen auf der dritten Stufe nur möglich ist, wenn Körper und Geist verbunden sind (vgl. 1998, S. 213). PERLER führt dazu die von Descartes gemachte Analyse bezüglich der Funktion der Sinneswahrnehmung aus. Danach gibt es eine reine körperliche Stufe der Sinneswahrnehmung, wenn ein Objekt auf einen Körper einwirkt und dadurch eine Nervenreizung vorliegt. Sodann gibt es eine weitere Stufe, die der reinen geistigen Funktion der Sinneswahrnehmung. Diese zweite Stufe liegt vor, wenn im Geiste ein Urteil über das äußere, auf den Körper einwirkende Objekt gebildet wird. Die letzte oder dritte Stufe, wie oben angeführt, ist in der Philosophie von Descartes die Funktion der Sinneswahrnehmung, bedingt durch die Verbindung von Körper und Geist. Denn weder der Körper noch der Geist können zum Beispiel Farb-, Geruchs- oder andere Empfindungen allein haben. Damit diese essenzielle Verbindung beschreibbar wird, verlangt sie, nach Descartes, einen gesonderten Begriff, den der Person, womit deutlich wird, dass Descartes die Person eben nicht auf ihren Geist reduzierte (vgl. 1998, S. 214f.). Vielmehr, so PERLER, macht Descartes damit deutlich, dass die Person durch die Empfindung lernt, dass der Körper ihr nicht einfach zugeteilt ist wie das Schiff einem Schiffer. Eine Person, die ihren Körper ähnlich begutachtet wie ein Schiffer sein beschädigtes Schiff, hätte bei Verletzungen keinen Anlass, emotional beteiligt zu sein, sie würde ihren Körper reparieren und weiter funktionieren. Genau das meinte Descartes, laut PERLER, aber nicht. Denn gerade das Empfinden hat für die Person die Funktion, Verletzungen zu vermeiden.
Da sie diese aus der Ersten-Person-Perspektive spüren kann, ist sie sich ihrer eigenen Person bewusst (vgl. PERLER 1998, S. 217f.). Der Ort dieser essenziellen Verknüpfung, erklärt LEDOUX, war für Descartes ein kleiner Hirnbereich, der bis heute unter dem Namen Zirbeldrüse bekannt ist. An diesem Ort trat die Substanz der immateriellen bewussten Seele bzw. die denkende Substanz mit dem Körper in Wechselwirkung. Dort wurde der Körper durch die Anweisungen der Seele beeinflusst und Informationen gelangten aus dem Körper als Wahrnehmungen, Emotionen und Erkenntnisse in die Seele (vgl. 2006, S. 30).
Entzieht sich damit das Empfinden einer Person dem Zugang der objektiven Beschreibung? PERLER erörtert, dass Descartes zwei Zugänge beschrieb (vgl. 1998, S. 264). Derjenige, der aufgrund von körperlichen Symptomen wie zum Beispiel Muskelspannung, Herzklopfen, Herzrasen, Harn- und Stuhldrang, Müdigkeit und/oder Erschöpfung seinen Hausarzt aufsucht, wird vermutlich das subjektive Empfinden von Angst verspüren und ernsthaft daran glauben herzkrank zu sein (vgl. MEYER-ABICH 2010, S. 13). Diese Qualität der Empfindung ist, nach Descartes, so PERLER, nur aus der Ersten-Person- Perspektive vollständig beschreibbar. Der behandelnde Arzt hat jedoch auch einen Zugang zu diesem Phänomen. Er kann anhand seiner Fachkenntnisse die Symptome beschreiben und so die körperlichen Symptome der Person diagnostizieren und behandeln (vgl. 1998, S. 218f.). Die Erklärungen bringen, laut PERLER, nicht nur zum Ausdruck, dass Descartes Wahrnehmungen, Emotionen und Erkenntnisse als geistige Zustände auffasst, die bei essenziellen Verbindungen mit körperlichen Zuständen verknüpft sind, sondern sie schließen auch die Dritte-Person-Perspektive mit ein. Es gibt demnach einen subjektiven Zugang durch das Erleben der Person und einen indirekten Zugang durch den Beobachter, der die Symptome bei der Person beobachtet (vgl. 1998, S. 227). Damit ist die Kritik, der cartesianische Mensch sei nur als 'Gespenst in der Maschine' zu verstehen, in Bezug auf den Menschen als Person, laut PERLER, nicht ganz korrekt. Es kann aber gesagt werden, so PERLER, dass Descartes nicht über die physiologischen Kenntnisse verfügte, mit denen er hätte beschreiben können, wie der Körper und der Geist über die Zirbeldrüse miteinander in Verbindung treten. Ferner ging Descartes nach wie vor von verschiedenen realen Substanzen aus, auch wenn sie eine essenzielle Einheit bildeten. Denn Descartes beschreibt, dass die körperlichen Symptome aus der Dritten-Person-Perspektive beschrieben werden können, und der Arzt einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Körper und dem Geist herstellen kann, da die Angst durch die Symptome verursacht werden könnte. Damit bleibt das Bewusstsein über die Angst zwar aus der Erste-PersonPerspektive beschreibbar, ist aber, gemäß PERLER, für Descartes nicht identisch mit der Beschreibung aus der Dritten-Person-Perspektive (vgl. 1998, S. 264).
I.1.3. René Descartes: Naturwissenschaft und Methodologie
Wie SPECHT anführte, wollte Descartes eine sichere Wissenschaft und trennte den Körper vom Geist und das sowohl aus ganz pragmatischen als auch aus theoretischen Gründen. Zum einen war damit das Problem, dass die Seele den Körper überlebt, gelöst und zum anderen machte es die medizinische Behandlung leichter, da von der Seele abgesehen werden und der Körper wie ein mechanischer Automat repariert werden konnte. Die theoretischen Gründe dafür lagen in der cartesischen Physik (vgl. 1996, S. 19ff.). Gemäß PERLER ist Gott, nach Descartes, die einzige unabhängige und vollkommene Substanz (vgl. 1998, S. 170). SPECHT ergänzt und begründet, dass der Gottesbegriff bei Descartes nicht nur die Rolle des ersten Bewegers in der Natur innehatte, sondern zugleich der Verursacher ihrer gesetzlichen Ordnung ist. Diese Haltung brachte die bis dahin getrennten Wissenschaften Physik und Mechanik zusammen und führte die Mathematik in die Physik ein. Das erschien laut SPECHT für Descartes aber nur dann sinnvoll, wenn nicht nur die Himmelskörper anhand der Mathematik beschrieben würden, sondern auch alle Körper, die unter diesem Himmel lebten. Damit führte Descartes als einer der ersten Autoren eine völlig neue Art der Sichtweise über die Natur ein und beschrieb fortan jedwede Bewegung auf Erden mithilfe der Mathematik. Lebende Körper waren nun den mathematischen Naturgesetzen unterworfen (vgl. 1996, S. 22f.). Damit Descartes jedwede Bewegung mithilfe der Mathematik beschreiben konnte, suchte er, laut STÖRIG, nach einer Methode, die in allen Wissenschaftsbereichen den Irrtum von der Wahrheit trennte. Dem nicht genug, widmete sich Descartes auch dem Ziel, die Philosophie zur Universalwissenschaft auszubauen, damit sie als Fundament jeglicher Wissenschaften dienen konnte15 16 (vgl. STÖRIG 1985, S. 312). CAPRA stellt die methodischen Überlegungen sehr anschaulich dar und beschreibt, dass nach Descartes nur noch die Dinge geglaubt werden sollten, die über jeden Zweifel erhaben waren. Descartes bezweifelte alles, was es zu bezweifeln gab. Er zog zunächst die Zuverlässigkeit der Sinne in Zweifel, denn sie können täuschen. Er fragte sich, ob er wie jeder Mensch einen physischen Körper hätte. Aber auch das konnte durch seine Sinne getrübt sein. Bis er darauf stieß, dass er die Existenz seiner selbst als die eines Denkenden nicht bezweifeln konnte. 'Ich denke, also bin ich'. Daraus schloss Descartes, dass das Wesentliche der menschlichen Natur im Denken lag und all jenes, was klar und deutlich gedacht werden könnte, auch wahr sei (vgl. 1994, S. 57f.). Nach CAPRA ist die Vorstellung des reinen und aufmerksamen Geistes das, was Descartes mit Intuition meinte. Die Intuition führte zusammen mit der Deduktion zur wahren Erkenntnis (vgl. 1994, S. 58). Dabei kritisiert CAPRA, dass die Methode aufgrund ihrer analytischen Natur letztlich darin bestand, Gedanken und Probleme in einzelne Teile zu zerlegen und ihre logische Ordnung zu beschreiben. Das hat dazu geführt, dass sich bis heute der Glaube in den Wissenschaften festgesetzt hat, dass alle Aspekte von komplexen Phänomenen durch Reduktion auf ihre Teile verstanden werden könnten (vgl. 1994., S. 58). Zudem enthielt die Materie bei Descartes, nach CAPRA, weder Leben noch Spiritualität, weil die Lehre von Descartes den Menschen und seine biologischen Funktionen auf seine mechanischen Vorgänge reduzierte (vgl. 1994, S. 59f.). Die Folge war, laut CAPRA, dass ab dem 17. Jahrhundert insbesondere die Biologen, aber auch Ärzte und Psychologen drei Jahrhunderte lang die Mechanismen beschrieben, aus denen lebende Organismen zusammengesetzt sind (vgl. 1994, S. 61).
I.2. Menschenbilder der Wissenschaften in der Moderne
Gemäß Perler ist den Ausführungen über René Descartes' Philosophie zu entnehmen, dass in der Barockzeit an ein metaphysisch-ontologisches Menschenbild geglaubt wurde. Der Mensch war das Ebenbild Gottes und seine Seele hatte göttliche Anteile (vgl. PERLER 1998, S. 171). CAPRA erläutert dazu, dass sich dieses Bild mit dem Beginn der Moderne änderte. Die Naturwissenschaften hatten mit ihren objektivierbaren Methoden begonnen, den vergänglichen und als mechanisch verstandenen Körper zu untersuchen (vgl. 1994, S. 134). Der Aufstieg der modernen wissenschaftlichen Disziplinen begann gemäß CAPRA mit den Fortschritten in der Biologie. Die Biologie schaffte die methodischen Möglichkeiten, sich den Zellen und den Mikroorganismen zuzuwenden, nachdem die Medizin mit Beginn des 19. Jahrhunderts die Struktur des menschlichen Körpers mit ihren Methoden bis ins kleinste Detail fast vollständig erforscht hatte. Getreu der reduktionistischen Methode widmeten sich die Wissenschaften dem Studium immer kleinerer Einheiten (vgl. CAPRA 1994, S. 136). Gleichzeitig wurden, laut CAPRA, auch Fortschritte in der medizinischen Technologie gemacht, dabei rückte die Aufmerksamkeit der Ärzte zunehmend vom Patienten auf die Krankheit. Neue Krankheiten wurden entdeckt, in Klassifikationssystemen erfasst und in Krankenhäusern studiert. Letztere entwickelten sich zunehmend zu Zentren für Diagnostik, Therapie und Lehre und es begann in der Medizin der Trend zur Spezialisierung, der im 20. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte. Präzision in der Diagnostik und die genaue Lokalisation von Krankheitsbildern war auch beim Studium der Geisteskrankheiten der Schwerpunkt (vgl. 1994, S. 139). Dabei wurde die Person, deren Merkmal es nach Descartes war, aus einer besonderen Verbindung von Körper und Geist zu bestehen, zunehmend auf ihren Körper reduziert. Der Patient musste es im wahrsten Sinne des Wortes ertragen, dass sein mentales Leiden oder sein Krankheitsempfinden rein körperlicher Natur sein sollte (vgl. CAPRA 1994, S.139). RUDOLF hält den biomedizinischen17 Wissenschaften zugute, dass zu ihrer Zeit keine Möglichkeiten bestanden, die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist empirisch zu erfassen und damit die philosophischen Erkenntnisse Descartes' in die biomedizinischen Theorien zu integrieren (vgl. 2011, S. V). Umso mehr stellt sich für CAPRA die Frage, warum die Psychiatrie sich in ihrem Bemühen, die psychologische Dimension der Erkrankungen zu verstehen, zurückhielt. Es gab vielmehr ein großes Bemühen, die organischen Ursachen der Erkrankungen zu finden, was den biomedizinischen Wissenschaften nach intensiver Forschung teilweise auch gelang (vgl. 1994, S. 139). Und zwar deswegen, so CAPRA, weil die biomedizinischen Wissenschaften die Perspektive immer weiter vom Studium der Körperorgane und ihren Funktionen auf die Zellen und Moleküle verlagerten. CAPRA glaubt daher, dass es den Wissenschaften aus diesem Grunde zunehmend schwerer fiel, sich mit den Wechselwirkungen von Körper und Geist zu befassen (vgl. 1994, S. 135). Gemäß RUDOLF lag das nicht zuletzt daran, dass die Anschaulichkeit psychophysiologischer Zusammenhänge bis zum 21. Jahrhundert sehr gering war und Erkenntnisse nicht in den wissenschaftlichen Kanon integriert werden konnten (vgl. 2011, S. VI). Das hat sich inzwischen im Bereich der Psychosomatik geändert, erläutert RUDOLF. Dort fließen die Ergebnisse der Biochemie, der Neurophysiologie, der Immunologie und der Kognitionswissenschaften zusammen und bilden zunehmend ein solides Fundament, auf welches sich die Psycho- und Sozioaspekte des biopsychosozialen Geschehens stützen können (vgl. 2011, S. VI). RUDOLF geht sogar so weit zu sagen, dass sich ganz unauffällig die Lücke schließt, die vormals zwischen den getrennten Welten klaffte, die unter der Berufung auf Descartes in eine geistige und eine materielle Welt, aufgeteilt war (vgl. 2011, S. VI). LEDOUX beschreibt dazu, dass Descartes sich letztlich nur mit einem Aspekt des Körper-Geist-Problems beschäftigt hat. Descartes setzte gewissermaßen das Bewusstsein mit dem Geist gleich. Seine philosophischen Überlegungen beschäftigten sich insbesondere damit, die Beziehungen zwischen Körper und Geist zu klären. Demnach ging es bei Descartes nicht um die Klärung des Geistes in seiner Gesamtheit, sondern nur um den Aspekt des bewussten Geistes oder der bewussten Seele. Alles, was im Gehirn unbewusst geschah, war nicht Teil der Überlegungen bei Descartes, so wie es heute in den Kognitionswissenschaften der Fall ist (vgl. 2006, S. 30). Das neue Verständnis des philosophischen Leib-Seele-Problems taucht bei den Neurowissenschaften nun in Form der Frage auf: Wie bringt das Gehirn den Geist hervor? Gemäß RUDOLF betonen die modernen Naturwissenschaften, dass sich die Art, wie gefühlt, gedacht und erinnert wird, in der zellulären Gehirnmorphologie niederschlägt. Demnach gehen die modernen Naturwissenschaften davon aus, dass sich die Phänomene Struktur und Funktion, Körperliches und Geistiges durch Wechselwirkungen beeinflussen (vgl. RUDOLF 2011, S. VI).
I.2.1. Wechselwirkungen zwischen den Disziplinen
In einem Gespräch äußert der Neurowissenschaftler Singer, laut METZINGER, dass die Neurowissenschaften immer mehr Phänomene, die bisher traditionelle Gegenstände der Geisteswissenschaften gewesen sind, mit neurowissenschaftlichen Methoden untersuchen. Dabei ist es wesentlich, dass die Phänomene, die untersucht werden, exakt beschrieben und klassifiziert werden, um überhaupt die Voraussetzungen für neurowissenschaftliche Versuche zu schaffen. Zudem werfen die Ergebnisse der Hirnforschung ethische Fragen auf, die ebenfalls diskutiert werden müssen. Demnach wird es zweifellos in Zukunft zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen kommen müssen und die Gräben, die beide vor Jahrhunderten getrennt haben, können vielleicht überbrückt werden (vgl. 2010, S. 108). Begonnen haben diese zarten Bande, so METZINGER, mit dem Interesse der Naturwissenschaften an dem Phänomen des Bewusstseins. Erst nachdem einige Hirnforscher dieses Phänomen als ein für die strenge naturwissenschaftliche Forschung angemessenes Erkenntnisziel betrachteten, begann die Zusammenarbeit (vgl. 2010, S. 34). METZINGER formulierte zum Phänomen Bewusstsein folgende Grundidee:
Die Grundidee besagt, dass der Inhalt des Bewusstseins der Inhalt einer simulierten Wirklichkeit in unserem Gehirn ist und dass das Gefühl des Daseins selbst ein Teil dieser Simulation ist. Unser bewusstes Erleben ist auf systematische Weise externalisiert, weil das Gehirn ständig die Erfahrung erzeugt, dass ich in einer Welt außerhalb meines Gehirns anwesend bin (2010, S. 43).
Was METZINGER hier ausführt, bedeutet schlicht, dass ein Mensch nur in der Welt sein kann, weil er ein Gehirn hat, welches das In-der-Welt-Sein durch eine neuronale Simulation generiert. Der Mensch ist demnach in der Lage, sich außerhalb von sich selbst zu erfahren, weil sein neuronales System diese Erfahrung hervorbringt (vgl. METZINGER 2010, S. 43). Nach METZINGER existiert natürlich dennoch eine Außenwelt, in der sich Wissen und Handeln der Person auf kausale Weise mit dieser Außenwelt verbinden. Wie aber diese Verbundenheit von der Person bewusst erlebt wird, bleibt ausschließlich eine innere Angelegenheit (vgl. 2010, S. 43).
Dieses innere Erleben und seine kausale Verbundenheit zur Außenwelt referieren NIEWÖHNER, KEIL und BECK am Beispiel psychiatrischer Krankheitsbilder. Sie zeigen auf, wie die biomedizinische Wissenschaft durch ihre Forschung und klinische Praxis Einfluss auf die sozio-kulturelle Entwicklung nimmt. Die medizinische Forschung etablierte in der Psychiatrie Klassifikationssysteme. Die damit gestellte medizinische Diagnose kann nun aufseiten des Patienten als Bedingung für weiteres Handeln berücksichtigt werden, sofern dieser über die Fähigkeit verfügt, sich darüber gewahr zu werden. Der Patient hat nun eine medizinische Folie, auf der er sich selbst wahrnimmt und sein Handeln interpretiert. Diese Form der Setzung von Selbstinterpretationen und Selbstverhältnissen kann sich nun wiederum auf der Ebene von Körper und Leiblichkeit manifestieren. Demnach produzieren Forschung und medizinische Praxis bestimmte Formen der Individualität und Sozialität. Dabei berücksichtigt die Forschung nicht, dass sich die Reaktionen des Patienten physiologisch manifestieren und sich verleiblichen: auf der exogenen Umwelt-Umfeld-Ebene und auf der psychologisch-mentalen Ebene bzw. endogenen Ebene des menschlichen Organismus (vgl. NIEWÖHNER / KEIL / BECK 2008, S. 18).
Aus der Praxisperspektive
Innerhalb der medizinischen Kette, beispielsweise der Sucht- und psychiatrischen Hilfen, zeigt sich der eben dargestellte Bezug. Menschen haben ohne eine medizinische Diagnose keinen Zugang zu dem Hilfesystem. Die Diagnose als spezifische Beschreibung eines Krankheitsbildes bildet den Hintergrund der weiteren Behandlung, die nicht selten über Jahre immer wieder neu aufgenommen wird. Dabei können zwei oder mehrere Diagnosen nebeneinander stehen. Patienten werden sich ihrer Diagnosen in der Regel nicht sofort gewahr bzw. sie haben bei ihnen zunächst den Stellenwert einer 'Eintrittskarte' in das System. Ohne diese 'Eintrittskarte', und das wird den Patienten nach kurzer Zeit bewusst, bekommen sie keine Form der Unterstützung. Plakativ gesagt, ist psychosoziale und medizinische Begleitung nur anhand von zunächst krisenhaftem Verhalten und den daraus entstehenden Gesundheitsfolgen garantiert. Für die Sozialität des Individuums hat das Folgen. So berichten Betroffene, dass es ihnen schwerfällt, außerhalb des Hilfesystems Kontakte zu schließen. Als Grund benennen sie die Befürchtung, stigmatisiert zu werden, sobald jemand erfährt, wo sie wohnen und leben und vor allem warum. Demnach schließen Betroffene mehrheitlich zu anderen Betroffenen intensive Kontakte. Das führt dann zu einer Bildung von Milieus, die letztlich wieder die Verhaltensweisen fördern, weswegen Menschen im Sinne der disziplinären Problemsicht krank geworden sind. Innerhalb meiner Tätigkeit als Sozialpädagogin bin ich darum bemüht, mit den Betroffenen neue Verhaltensweisen durchzusprechen. Und zwar empfehle ich ihnen, ihre Suchterkrankung wie auch die damit in Bezug stehende psychiatrische Erkrankung selektiv zu verschweigen. Das bedeutet, dass sie angehalten werden, nicht jedem Gegenüber ihre Problemlagen zu eröffnen, wie zum Beispiel, dass sie aufgrund ihrer Substanzstörung chronisch krank sind. Vielmehr ermuntere ich sie dazu, insbesondere gegenüber Arbeitgebern und Bekannten, zunächst darüber zu schweigen und Verhalten einzuüben, welches zu den sozialen Situationen passt, in denen sie sich zukünftig zurechtfinden wollen. Der Grund für dieses Vorgehen liegt darin, dass die Betroffenen von anderen nicht primär vor dem Hintergrund ihrer Erkrankung wahrgenommen werden wollen. Gegenüber Arbeitgebern muss natürlich differenziert werden, um was für eine Tätigkeit es sich handelt. Ein solcher Umgang mit der Erkrankung fällt vielen Betroffenen vermutlich aus zwei Gründen schwer. Erstens wecken sie in ihrem Gegenüber, durch ihre selektierten Erzählungen, primär keine Hilfsbedürftigkeit mehr und zweitens kann die Erkrankung bei Konflikten nicht als Argument genutzt werden, warum unangebrachtes oder fehlerhaftes Verhalten gezeigt wurde. Der Krankheitsgewinn wird weniger, die Verantwortung für das eigene Tun steigt.
Ebenso wenig wie die Psychiatrie sich um die Wirkung ihrer disziplinären Problemsicht kümmert, tun es die Geistes- und Sozialwissenschaften. NIEWÖHNER, KEHL und BECK weisen hier darauf hin, dass sich die Geistes- und Sozialwissenschaften spiegelbildlich zu den Naturwissenschaften verhalten. Während Letztere als Primat nur das materielle biologische Substrat im Blick haben, nehmen Erstere dieses gar nicht wahr (vgl. NIEWÖHNER / KEHL / BECK 2008, S. 18). Vielmehr halten nach NIEWÖHNER, KEHL und BECK die Geistesund Sozialwissenschaften mehrheitlich daran fest, dass es zwischen innen und außen eine strikte Trennung gibt. Für NIEWÖHNER, KEHL und BECK thematisieren diese Disziplinen den Raum zwischen Sozialem und Molekularem nicht von einer präformierten Körperlichkeit aus, sondern tun so, als sei der Körper eine isolierte Untersuchungseinheit. Folglich beobachten und theoretisieren sie die Konstruktion von Körperlichkeit durch soziale Praxis, durch Aneignungsprozesse und durch veränderte Selbstverständigungsprozesse. Dabei steht diese krampfhafte Trennung entgegen jeder modernen Physiologie, die ja gerade die Verknüpfung zwischen innerem und äußerem Milieu betont (vgl. 2008, S. 18f.). KANDEL glaubt den Grund dafür zu kennen, indem er behauptet, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften auch heute noch davon ausgehen, dass die moderne Biologie die menschlichen Eigenschaften wie physische Gestalt, Verhaltensneigungen, sowie Fähigkeiten und Ansichten auf die Materie einengt. Demnach bestehe bei den Geistes- und Sozialwissenschaften der Glaube, der Mensch sei auf seine Gene reduzierbar (vgl. 2008, S. 85). Diese Vorstellung ist, gemäß KANDEL, grundlegend falsch. Was nicht bedeutet, dass sie nicht existierte. Der angenommene Determinismusglaube entstand vor dem theoretischen Hintergrund der Eugenikbewegung in den 1920er und 1930er Jahren. Die Eugenikbewegung verzerrte die natürliche Selektion zum Sozialdarwinismus und die damalige Hirnforschung nutzte das, indem sie diese Annahmen zum Zwecke der gesellschaftspolitischen Manipulation und Kontrolle missbrauchte. Damit ein solcher Missbrauch nicht mehr stattfinden kann, ist es KANDEL wichtig, die Missverständnisse in den Geistes- und Sozialwissenschaften aufzuklären 17 (vgl. 2008, S. 85f.). KANDEL widmet18 sich deshalb in seiner Forschung der Frage, wie die biologischen Prozesse im Gehirn geistige Ereignisse hervorrufen und wie dabei soziale Beziehungen die biologische Struktur des Gehirns modulieren19 (vgl. KANDEL 2008, S. 96). KANDEL ist nicht der einzige Forscher, den es interessiert, wie das subjektive Erleben dazu beiträgt, dass sich das Gehirn bzw. der Körper und der Geist entwickeln und formen (vgl. 2008, S. 96). Bevor aber andere erkenntnistheoretische Positionen dargestellt werden, vorab einen Perspektivenwechsel in die Praxis.
Aus der Praxisperspektive
Der psycho-soziale Hilfebereich für Menschen mit Doppeldiagnosen ist auf den ersten Blick ein Beispiel für die Bemühungen des Gesundheitssystems, die von N IEWÖHNER, K EHL und B ECK (2008) beschriebenen Unterstellungen zu verringern. Nach M OGGI und D ONATI ist es der Versuch, die bisher vorgenommene Trennung zwischen den Behandlungssystemen für psychische Störungen einerseits und Substanzstörungen andererseits zu überwinden (vgl. 2004, S. 52). Bezüglich der Behandlungssysteme in der klinischen Psychiatrie stimmt das. Sobald jedoch der Standort der Sozialen Arbeit eingenommen wird und Sozialarbeiter Betroffene in sozialtherapeutischen Einrichtungen begleiten, wird deutlich, dass die medizinische Diagnostik ein entscheidendes Kriterium bei der Behandlung bzw. Begleitung der Betroffenen bleibt. Da sich im klinischen Bereich die Behandlung nach der Diagnose richtet, müssen sich auch sozialtherapeutische Einrichtungen für Menschen mit Doppeldiagnosen danach richten. Weil Diagnosen, ob nun für Substanzstörungen oder psychische Störungen, ausschließlich von Ärzten gestellt werden, muss die Sozialarbeit betroffene Menschen in der medizinischen Domäne weiter behandeln. So verfüge ich als Sozialarbeiterin in dem Arbeitsfeld für Menschen mit Doppeldiagnosen nicht über die Möglichkeit, zusätzlich zu den gestellten medizinischen Diagnosen eine soziale Diagnose zu stellen und dadurch ggf. Zusammenhänge zwischen innerem und äußerem Milieu zu generieren. Hintergrund jeder psychosozialen Behandlung bleibt die Medizin. Dabei könnte die Soziale Arbeit Instrumente für eine soziale Diagnose entwickeln. Dafür wäre es aber notwendig, dass Soziale Arbeit für diese Art der Diagnostik die Definitionsmacht innehat. Wäre das möglich und gewünscht, könnte gemeinsam mit der Medizin interdisziplinär gearbeitet werden und aus der Zusammenarbeit ließen sich ggf. Wege finden, das sich verändernde Milieu in die Diagnostik einfließen zu lassen. Dann wären Diagnosen vermutlich bewegliche und fließende Instrumente und nicht unbedingt ein Grund für Stigmatisierung, da sich die Diagnose im Laufe des Entwicklungsprozesses sukzessiv verändert, was dann auch abgebildet werden könnte.
I.2.2. Erkenntnistheoretische Positionen der Neurowissenschaften
HÜTHER führt aus, dass die Biologie, als diejenige Wissenschaft, die Jahrhunderte lang nach der Logik in der Natur suchte, begonnen hat zu verstehen, dass Logik eine Fähigkeit des menschlichen Denkens ist und keineswegs eine Eigenschaft der Natur. Die Biologie ist heute bemüht, in eine Welt einzugreifen, die unter dem logischen Denken und rational begründeten Handlungen leidet (vgl. 2009, S. 25f.). HÜTHER spricht davon, dass das Zeitalter der Aufklärung, in der das Denken und der Verstand das Primat der Erkenntnis war, zu Ende geht. Den Grund dafür sieht HÜTHER in der Annahme, dass das Leben sowohl ein Prozess der Erkenntnisgewinnung ist, als auch ein Prozess, der Erfahrungen in Strukturen verwandelt. Dabei ist es notwendigerweise so, dass ein Mensch nur Erfahrungen machen kann, wenn er mit etwas in Beziehung tritt (vgl. 2009, S. 27). Beziehung oder genauer gesagt die 19 Intentionalität20 gilt, laut HÜTHER, zu den Wesensmerkmalen des Lebendigen. Das bestätigen MARKOWITSCH und WELZER, indem sie betonen, dass die Gedächtnisentwicklung vom Sozialen zum Individuellen verläuft. Nach MARKOWITSCH und WELZER bildet und strukturiert sich das Gedächtnis in einem sozialen Vorgang, der dem Menschen die Möglichkeit gibt, aus seinem Erleben Informationen zu extrahieren und daraus so etwas Umfassendes wie Erinnerungen zu machen. Demnach ist das Gehirn nicht als individuelles oder rein biologisches Organ zu betrachten (vgl. 2005, S. 260). Diesen Aussagen folgend stellt HÜTHER die Frage, ob es nicht an der Zeit ist, auf allen Ebenen die Trennung von Körper und Gehirn bzw. Körper und Geist aufzuheben. Das bedeutet nach HÜTHER auch die Trennung zwischen Denken und Fühlen sowie Erkennen, Erleben und Erfahrung aufzuheben (vgl. 2009, S. 36). Diese Sichtweise wird jedoch nicht unbedingt von den Menschen angenommen. Gemäß ROTH wird an die Neurobiologie vorrangig die Erwartung gestellt, den Geist bzw. die Seele physiologisch fassbar zu machen, um das Innere, das Geistige, ja Metaphysische, auf das Physische zurückführen zu können (vgl. 2009, S. 17). Dem kann nicht entsprochen werden, erklärt ROTH, denn ganz entgegen der Erwartung an die Neurobiologie, nun endlich das Substrat der Seele zu finden, fanden die Wissenschaftler mit ihren objektiven naturwissenschaftlichen Verfahren eine Welt vor, die keineswegs das rationale Paradigma untermauert. Hier liegt der Grund dafür, warum ROTH überzeugt davon ist, dass Fühlen und Denken zwei Seiten der Medaille 'Erkennen' sind, auf die sich unser Handeln und unsere Erfahrungen gründen (vgl. 2009, S. 11). Die philosophische Frage bleibt nach SOLMS und TURNBULL die Frage danach, wie das Gehirn aus den spezifischen Mustern physiologischer Vorgänge ein Bewusstsein schafft oder wie aus Elektrochemie Gefühl wird (vgl. 2004, S. 63f.).
Die philosophische Basis des naturwissenschaftlichen Denkens über das Körper-Geist-Problem ist der sogenannte Materialismus. Materialismus bedeutet im philosophischen Sinne, dass das Materielle oder das Gehirn ursprünglich ist und den Geist hervorbringt. Eine Variante des Materialismus ist der radikale Materialismus (vgl. SOLMS / TURNBULL 2004, S. 66f.). Anhänger dieser Variante wie zum Beispiel LEDOUX gehen davon aus, dass der Geist nicht mehr als das Feuern21 der Neuronen im Gehirn ist (vgl. 2006, S. 10f.). LEDOUX geht sogar so weit zu sagen, dass Descartes irrte, als er beschrieb, dass die Seele immateriell sei. Zwar sei die Wissenschaft heute noch nicht soweit, dass Bewusstsein auf materieller Ebene zu entschlüsseln, das bedeutet jedoch nicht, dass dieses so bleiben muss (vgl. 2006, S. 31). Eine weitere Version der materialistischen Denkweise liefert der Neurobiologe SINGER, indem er sich in seiner Forschung auf die kausalen Zusammenhänge zwischen den Mit 'Feuern' ist die Abgabe von elektrischer Ladung gemeint (vgl. SIEGEL 2010b, S. 33). neuronalen Prozessen und dem kognitiven Verhalten konzentriert und dabei die Annahme zugrunde legt, dass es den Neurowissenschaften [gelungen ist] hochkomplexe kognitive Leistungen bestimmten neuronalen Prozessen zuzuordnen. Da diese beobachtbaren kognitiven Leistungen mit den zugrunde liegenden neuronalen Prozessen nicht identisch sind, sich also aus 21 diesen ergeben, sagen wir, diese Verhaltensleistungen seien emergente*22 Eigenschaften neuronaler Vorgänge. Damit soll ausgedrückt werden, dass die kognitiven Funktionen mit den physiko-chemischen Interaktionen in den Nervennetzen nicht gleichzusetzen sind, aber dennoch kausal erklärbar aus diesen hervorgehen (SINGER 2005, S. 43f.).
Die erkenntnistheoretische Position, die die Neuropsychologen SOLMS und TURNBULL vertreten, ist unter dem Begriff Doppelaspekt-Monismus bekannt.
Diese Position besagt, dass der Mensch aus einem Stoff besteht - deswegen Monismus - welcher jedoch aus zwei Perspektiven wahrgenommen werden kann - deswegen Doppelaspekt - (vgl. 2004, S. 70). Das Gehirn erscheint, nach SOLMS und TURNBULL, von außen betrachtet körperlich und von innen betrachtet geistig (vgl. 2004, S. 70). Demnach ist das Körper-Geist-Problem, nach SOLMS und TURNBULL, ein Problem der Beobachtungsperspektive (vgl. 2004, S. 71f.). Die philosophischen Grundannahmen des naturwissenschaftlichen Denkens von SINGER (2001, 2005), LEDOUX (2006) sowie SOLMS / TURNBULL (2004) und ROTH (2009) betrachtet SIEGEL als zu enge Perspektive. Nach SIEGEL führen diese Haltungen nicht zu einem Verständnis darüber, wie sich der Geist in einem Kind entwickelt. Auch wird dadurch nicht deutlich, in welcher Form die Kultur, in der ein Mensch lebt, Einfluss nimmt auf die Formung seines Geistes bzw. seine Art zu denken und zu fühlen (vgl. 2009, S. 40). SIEGEL geht in seinem Ansatz deswegen der Frage nach, wie das soziale Erleben bzw. Beziehungen die Entwicklung des menschlichen Gehirns beeinflussen und damit den Geist formen (vgl. 2010, S. 9).
Die Grundannahme von SIEGEL ist, dass das Erleben eines Menschen grundsätzlich die Aktivität als auch die Struktur der neuronalen Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen verändert. Somit beeinflusst das Erleben die Schaltkreise, die für Prozesse wie Erinnern, Emotionen und Selbstbewusstheit zuständig sind (vgl. SIEGEL 2010a, S. 16). Deswegen entwarf SIEGEL ein Modell, das verständlich macht, wie aus dem Erleben eines Menschen Erfahrungen werden und wie diese sich aus den Komponenten Geist, Gehirn und Beziehung zusammensetzen (vgl. 2009, S. 40).
I.2.3. Erfahrung: Geist, Gehirn und Beziehung
Für SIEGEL setzt sich menschliche Erfahrung aus drei Komponenten 22 zusammen: Geist, Gehirn und Beziehung23. Wobei SIEGEL unter dem Begriff Gehirn das gesamte Nervensystem subsumiert. Dieses Nervensystem entwickelt sich sukzessiv und breitet sich schließlich im ganzen Körper aus (vgl. 2009, S. 39). SIEGEL wollte über das Thema, wie sich Gehirn und Geist wechselseitig beeinflussen und in welchem Kontext Beziehungen daran beteiligt sind, mehr erfahren. Schwierig bei der Beschreibung seines Modells war, dass er keine Erklärung hatte, die beschrieb, was der Geist ist. So schuf SIEGEL gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern eine Arbeitsdefinition, die verdeutlichen sollte, was den Geist ausmacht. In dieser Definition ist das Besondere, dass die Bestandteile nicht auf eine Komponente reduziert werden können, sondern die einzelnen Elemente wie Gehirn, Geist und Beziehung voneinander abhängig sind (vgl. 2009, S. 40).
I.2.3.1. Die Definition des Geistes
Für SIEGEL lautet die Arbeitsdefiniton für den Geist: „Geist ist ein verkörperter und beziehungsorientierter oder beziehungsbezogener Prozess, der den Fluss von Energie und Information reguliert“ (2009, S. 40). In dieser Definition wird der Geist nicht nur als real angesehen, sondern es wird auch die materialistische Annahme, der Geist sei nicht mehr als die Aktivität des Gehirns, vermieden (vgl. SIEGEL, 2009, S. 40). SIEGEL erklärt die Elemente seiner Definition wie folgt:
Energie und ihre verschiedenen Arten werden in der Physik erforscht und beschrieben. In Bezug auf den Menschen, sagt SIEGEL, geht es letztlich immer um die 'Fähigkeit etwas zu tun' (vgl. 2010b, S. 95). Den Neurowissenschaften, so SIEGEL, obliegt es mit bestimmten technischen Verfahren, die Stoffwechselprozesse, den Energieverbrauch sowie den Blutfluss in Bereichen des Gehirns, von denen angenommen wird, dass sie Konzentrationspunkte lokaler neuronaler Aktivität sind, zu messen. Auch werden mithilfe der Elektroenzephalogramme (EEGs) die elektrischen Aktivitäten an der Oberfläche des Gehirns gemessen. Dabei geht es schließlich immer darum, wie das Gehirn mittels Aktivierung der Nervenzellen - dabei wird Energie verbraucht - seine Aufgaben erfüllt. SIEGEL erklärt, dass das Gehirn seine Aufgaben mittels unterschiedlicher Areale bzw. Systeme erfüllt, die durch eine spezifische Stärke erregt werden. Diese Erregungszustände aktivieren, gemäß SIEGEL, diese Orte und das Gehirn sendet Signale aus, die als Informationen für die weitere Verarbeitung im Gehirn zur Verfügung stehen. Diese Prozesse erzeugen die geistigen Prozesse und sind das, was SIEGEL als den Fluss der Energie und Information im Zeitkontinuum bezeichnet (vgl. 2010a, S.17).
Unter Information versteht SIEGEL alles, was Symbol für etwas anderes ist außer es selbst. Ein Beispiel: Die Worte, die an dieser Stelle geschrieben stehen, sind voll mit Informationen. Die schwarzen Zeichen, aus denen sie gebildet sind, sind jedoch nicht die Bedeutungen der Worte. Selbst wenn die Worte vom Menschen gehört werden, so SIEGEL, sind sie Klangwellen, die die Moleküle in der Luft in bestimmte Schwingungen versetzen (vgl. 2010b , S. 95). Soweit betrachtet, verarbeitet das sensorische System primär Reize aus der Außenwelt. SIEGEL fügt dann noch hinzu, dass es einen Verarbeitungsmodus des Geistes gibt, der die Information als neuronale Aktivierung repräsentiert, welche dann als geistige Symbole auftreten, wie zum Beispiel die Bedeutung der Worte (vgl. 2010a, S. 17).
Solange das Gehirn aktiv ist, entstehen, nach SIEGEL, Repräsentationen unterschiedlichster Arten von Informationen über die äußere und innere Welt. Der Mensch verfügt über Repräsentationen von Ideen oder, wie erwähnt, von Worten und von der Wahrnehmung über die fünf Sinne. Auch hat der Mensch Repräsentationen über die innerlichen Empfindungen des Körpers (vgl. 2010a, S. 17). SIEGEL führt ein Beispiel aus und sagt, dass der Mensch zu jeder Zeit in seinem Leben die Erfahrung machen kann, aufgrund von empfundener Enge in der Brust, zu verspüren schlecht atmen zu können. Der Grund dafür könnte Angst sein. Die Angst ist eine mit Energie gefüllte Empfindung, auf die der Mensch aufbauen kann, indem er sie in andere Hirnregionen kartographiert (vgl. SIEGEL 2010b, S. 96). Diese Region, erklärt SIEGEL, ist der Stirnlappen bzw. der präfrontale Kortex. Aktivitäten in diesem Hirnrindenbereich24 führen zu neuronalem Feuern. Das neuronale Feuern wiederum führt zu neuronalen Mustern, die ihrerseits zu neuronalen Repräsentationen oder anders ausgedrückt zu Vorstellungen von etwas führen (vgl. 2010b, S. 33). SIEGELS Vorstellung ist nun, dass der Mensch sich aufgrund der Repräsentationen darüber gewahr werden kann, dass der Grund für die Enge in der Brust und der damit einhergehenden Atemlosigkeit das Gefühl der Angst ist (vgl. 2010b, S. 96). Gemäß SIEGEL wird ein Mensch, um besser atmen zu können bereit sein, etwas gegen die Angst zu tun. Der menschliche Geist erhält demnach aus dem Fluss der Energie Informationen. Diese Informationen, glaubt SIEGEL, können den Menschen motivieren, seine Energie auf eine andere Art und Weise zu nutzen. Die Möglichkeit, aus der Energie bzw. dem Empfinden von Enge als Information das Gefühl von Angst zu repräsentieren, hilft dem Menschen, sich über die unmittelbare Erfahrung hinaus zu stellen und entsprechend zu reagieren (vgl. 2010b, S. 96f.). Diesem komplexen Geschehen liegt SIEGELS Annahme zugrunde, dass die unterschiedlichen Arten von Repräsentationen in verschiedenen neuronalen Schaltkreisen erzeugt werden. Dabei können die vielfachen Informationsverarbeitungsmodi nicht nur autonom aktiv sein, sondern treten auch in Interaktion miteinander. Die Verarbeitungsaktivität der Informationsmodi wird von diesen Wechselwirkungen unmittelbar beeinflusst (vgl. 2010a, S. 17).
Laut SIEGEL könnte es ein zentrales Ziel im Leben eines Menschen sein, die vielfältigen Informationsverarbeitungsmodi für den sich entwickelnden Geist zu einem kohärenten Ganzen zu integrieren. Dabei bleibt aber, nach SIEGEL, zu beachten, dass zwischenmenschliche Beziehungen die Entwicklung zu einem kohärenten Ganzen fördern oder hemmen können (vgl. 2010a, S. 17). Genauer gesagt, die an Verkörperung gebundene Beziehung (vgl. SIEGEL 2009, S. 40). Mit “an Verkörperung gebunden“ will SIEGEL ausdrücken, dass die Steuerung des Energie- und Informationsflusses durch den Körper geschieht. In der Regel im Gehirn, also dort, wo der Mensch allgemein das Mentale bzw. Geistige verortet. Die Steuerung im Gehirn geschieht in den unterschiedlich verzweigten neuronalen Schaltkreisen und synaptischen Verknüpfungen, die mit dem gesamten Körper Verbindungen eingehen, bekanntlich über das weitverzweigte Nervensystem. Das Nervensystem reguliert den Energie- und Informationsfluss in den Körperorganen, indem es die Organe überwacht, entsprechend beeinflusst und aktiv wird, indem es z.B. die Tätigkeiten des Immunsystems bestimmt (vgl. SIEGEL 2010b, S. 98). Letztlich, so SIEGEL, bleibt der Geist aber ein Prozess, der zwischen Menschen stattfindet. So fließen Energie und Informationen zwischen Menschen hin und her, werden beobachtet und durch die wechselseitigen Prozesse zwischen Menschen wiederum verändert (vgl. 2010b, S. 98). Das bedeutet für SIEGEL, dass ein ganzes Leben lang ein Formungsprozess des Geistes stattfindet. Besonders wirksam sind, laut SIEGEL, die frühkindlichen Erfahrungen, die ein Mensch mit anderen Menschen macht. Diese Erfahrungen haben einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung der Strukturen, die verantwortlich sind für die Repräsentationen, die durch das Erleben eines Menschen erzeugt werden (vgl. 2010a, S.17f.). SIEGEL stellt fest, dass an Untersuchungen mit Menschen beobachtet werden konnte, dass die unterschiedlichen Eltern-Kind-Bindungen mit unterschiedlichen physiologischen Reaktionen einhergingen. Dabei konnten Zusammenhänge hergestellt werden, auf welche Art und Weise Menschen aufgrund dieser frühen Erfahrungen die Welt und zwischenmenschliche Beziehungen wahrnehmen und gestalten. Demnach spielen Gefühle und die Art und Weise ihrer Kommunikation bei Bindungsmustern eine entscheidende Rolle (vgl. 2010a, S. 18). Resultate aus der Emotionsforschung bestätigen die Annahmen von SIEGEL. SIEGEL behauptet, dass Emotionen im Gehirn nicht nur eine zentrale Organisationsfunktion innehaben, sondern auch, dass die Fähigkeit eines Menschen, Emotionen bzw. Gefühle zu organisieren, zum Teil ein Produkt früherer Bindungserfahrungen ist (vgl. 2010a, S. 18). Das Thema Bindung sowie die Erinnerung - wobei dies nicht bewusstes Erinnern sein muss - stehen damit unmittelbar im Zusammenhang mit dem Erleben von Emotionen und ihrer Organisation, wie zum Beispiel Angst. SIEGEL geht sogar so weit zu sagen, dass frühere Bindungserfahrungen25 sich auf die Fähigkeit des Geistes auswirken, Erlebtes bzw. Erfahrungen zu integrieren und sich an Stressoren26 anzupassen (vgl. SIEGEL 2010a, S. 18).
I.2.3.2. Das Prinzip der inneren Strukturierung - Innen wie Außen
In diesen Kanon reihen sich HÜTHER und KRENZ ein, die betonen, dass sich das Gehirn bzw. der Mensch nach den kulturellen, sozialen, physischen und anderen Bedingungen der Umwelt organisiert, in die er hineinwächst. Es wäre demnach eine verfehlte Betrachtungsweise, wenn man das Gehirn ausschließlich von der biologischen Seite betrachten würde. Denn es ist offensichtlich, dass das Gehirn evolutionär und konstitutiv darauf abgestellt ist, sich unter Bedingungen des kulturellen Austausches und der Kommunikation sozial zu entwickeln (vgl. 2010, S. 10).
Aus der Praxisperspektive
In dem Arbeitsbereich, in dem ich tätig bin, nehme ich häufig wahr, dass Menschen aus besonderen sozialen Bezügen kommen. Vermutlich waren die sozialen Bezüge von einem abwertenden Kommunikationsstil geprägt und/oder diese Menschen sind über die Jahre in ihrer Häuslichkeit so vereinsamt, dass sie verlernt hatten, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Schon nach kurzer Zeit innerhalb der Einrichtung beginnen die Betroffenen, die Tagesstruktur mit ihren dazugehörigen Möglichkeiten von sozialen Kontakten anzunehmen, für sich zu nutzen und sich zunehmend psychisch und physisch wohler zu fühlen. Ein häufig von mir wahrgenommenes Phänomen ist auch, dass sich bei Betroffenen vormals brachliegende Potenziale zeigen, die bisher aufgrund des Kardinalziels der Betroffenen, das eigene Überleben zu sichern, nicht gezeigt werden konnten. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass bisher keine Umwelt bzw. tragfähige Beziehungen und ein sicheres Milieu zur Verfügung standen, durch die eine ausreichende psychische Struktur aufgebaut werden konnte.
HÜTHER stellt im Weiteren die Frage, wie lange eine Gesellschaft Bestand hat, die gegen das Prinzip der inneren Strukturierung verstößt. HÜTHER argumentiert an dieser Stelle aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive und beschreibt, dass Menschen bereits im Kindesalter lernen, dass Achtsamkeit und Behutsamkeit nicht die geeigneten Fähigkeiten sind, um in einer Welt zurechtzukommen, die von Effizienzdenken, Machbarkeitswahn und Egoismus geprägt ist. Vielmehr scheint es, gemäß HÜTHER, für den Menschen notwendig, damit er nicht zu den Verlierern gehört, das Gefühl vom Denken, den Körper vom Gehirn und das 'Ich' vom 'Wir' zu trennen. Dieses geht dann, nach HÜTHER, langfristig mit der Einschränkung von Beziehungsfähigkeit einher. Auch führt sie, nach HÜTHER, zu einem Mangel an innerer Struktur und damit dann zum Verlust von Offenheit und Kreativität, der zunehmenden Ausbreitung von emotionaler Instabilität, sowie zum Zerfall von sozialen Bindungen (vgl. 2009, S. 36). Die Arbeitsdefinition des Geistes von SIEGEL (vgl. 2009, S. 40), untermauert die Haltung von HÜTHER. HÜTHER behauptet, dass der Mensch primär kein Individuum ist, auch dann nicht, wenn sich der Mensch als individuelles Subjekt erlebt und sich gegenüber anderen als getrennt vorkommt. Menschen begegnen sich nicht, sagt HÜTHER, sondern sie sind sich schon immer begegnet. Grundlegend für all das, was sich in einem Menschen entwickelt, ist das, was zwischen Personen stattfindet. Deswegen ist, nach HÜTHER, das, was zwischen Personen stattfindet, nicht das, was Menschen in der Regel versuchen, sich in einer rationellen Welt möglichst beizubringen, nämlich sich sachlich auszutauschen, sondern es wird etwas vollkommen anderes ausgetauscht: Emotionen! Individualität entsteht somit, gemäß HÜTHER, erst dann, wenn das, was vorher im Außen reguliert wurde, zunehmend in eine interne Regulierung übergeht (vgl. 2009, S. 36). Ein Praxisbeispiel soll diesen möglichen Übergang exemplarisch deutlich machen.
Aus der Praxisperspektive
In der Regel sind sozialtherapeutische Einrichtungen Abstinenzräume. Das bedeutet, dass Betroffene, die dort leben und innerhalb der Einrichtung Alkohol trinken oder Drogen konsumieren, diese sofort verlassen müssen. Entsprechend der in den meisten Einrichtungen konzeptionellen Haltung werden Bewohner nicht einfach aus der Einrichtung entlassen, sondern haben die Möglichkeit sich in eine stationäre Entgiftungsbehandlung zu begeben. Stimmen sie dem zu, können sie bei erreichter Abstinenz wieder aufgenommen werden.
Ein Betroffener, hier Manfred27 genannt, wohnte in einer solchen Einrichtung. Diagnostisch lag bei Manfred eine Substanzstörung vor und eine Störung aus dem psychotischen Formenkreis. In der Zeit seines Aufenthaltes wurde Manfred kein einziges Mal rückfällig und es gelang ihm, seine Emotionen ausreichend zu regulieren. Manfred hielt sich verbindlich an Vereinbarungen, setzte aber ohne Rücksprache mit dem zuständigen Mitarbeiter seine Psychopharmaka ab. In Absprache mit einer Fachärztin wurde dieses Verhalten mitgetragen, um Manfred die Möglichkeit zu geben, seinen Alltag ohne Medikamente zu bewältigen. Manfred blieb abstinent und zeigte keine Symptome, die auf eine erneute Aufnahme der Medikation drängten. Kurz nachdem Manfred die Einrichtung verlassen hatte, konnte er aus familiären und beruflichen Gründen seine Abstinenz nicht halten und wurde rückfällig. Zusammen mit seinem 27 Bezugsbetreuer erarbeitete Klaus Rückfallpräventionen28. Diese beinhalteten, dass Manfred lernen sollte, seine emotionalen Anspannungen kognitiv zu regulieren. Manfred wurde trotz mehrfacher Rückfallpräventionen immer wieder rückfällig. Er entschied sich deshalb, seine Fachärztin erneut aufzusuchen, um seine Pharmakotherapie wieder aufzunehmen.
[...]
1 Die Begriffe Angst und Furcht werden in dieser Arbeit nicht konkret unterschieden. Dort wo direkt die Rede von Furcht ist, wird im Sinne Freuds der korrekte Sprachgebrauch angewandt (Anmerkung der Autorin).
2 Siehe dazu eine Auswahl: (FLÖTTMAN 2005); (BANDELOW 2010a / 2010b); (MENTZOS 2009); (RIEMANN 2009); (KLEEPSIES 2003); (KROHNE 2010).
3 Meine eigenen Recherchen bestätigen die Behauptung von BALZEREIT (2010) (Anmerkung der Autorin).
4 Wenn pathologische Ängste ohne andere psychische Beeinträchtigungen auftreten, spricht man von Angststörungen. Dabei wird dem Begriff der Störung dem der Krankheit Vorzug gegeben, um deutlicher herauszuheben, dass es sich bei der Störung um ein Phänomen handelt, das kein rein biologisches Erklärungsmodell impliziert (vgl. MORSCHITZKY 2009, S. 21).
5 Meine Tätigkeit übe ich in einer sozialtherapeutischen Wohngruppe für Menschen mit Doppeldiagnosen aus (Anmerkung der Autorin).
6 Unter einer Substanzstörung wird verstanden, dass Menschen von psychoaktiven Substanzen wie z.B. Alkohol oder Drogen abhängig werden. Eine Abhängigkeit entwickelt sich daraus, dass Menschen immer wieder trinken oder andere Substanzen zu sich nehmen, um das subjektive Wohlbefinden auf der körperlichen und emotionalen Ebene zu beeinflussen. Da diese Substanzen zentralnervös auf den Organismus einwirken, ist die Wahrscheinlichkeit, von diesen Substanzen körperlich und psychisch abhängig zu werden, sehr hoch (vgl. BÜHRINGER 2003, S. 269ff.).
7 Komorbidität (lateinisch Morbus = Krankheit) ist das gleichzeitige Auftreten von mehreren eigenständigen Erkrankungen oder psychiatrischen Störungsbildern bei einem Patienten (vgl. NEUBAUER 2007, S. 8).
8 Aus Gründen der Vereinfachung wurde an dieser Stelle der Begriff der Angststörung verwendet. Es muss aber erwähnt werden, dass die Zusammenfassung der Angststörung zu einer Gruppe von Störungen gehört. Es handelt sich demnach hier nicht um eine Störung, sondern um eine sehr heterogene Störungsgruppe (vgl. ZIMMERMANN / HOLLENBACH 2008, S. 230).
9 Für eine ausführliche Erläuterung siehe: KANDEL (2006).
10 Synapsen sind „Kontaktstellen zwischen zwei Nervenzellen, mit der Information von einer Nervenzelle auf die andere übertragen wird“ (MADEJA 2010, S. 220).
11 Für eine ausführliche Einführung siehe: Brüntrup (2008).
12 Cartesianismus: René Descartes. Lateinisch Renatus Cartesius (vgl. STÖRIG 1985, S. 313).
13 Descartes schrieb sein Werk Meditationes de prima philosophia als Antwort auf einen päpstlichen Aufruf an die Philosophie zur Widerlegung der Behauptung, dass die Seele mit dem Körper sterbe (vgl. SORELL 1999, S. 69).
14 Metaphysik: „Das über die Natur (Physik) hinausgehende“ (STÖRIG 1985, S. 176). Die Metaphysik beschäftigt sich mit dem sinnlich nicht Erfahrbaren (vgl. STÖRIG 1985, S. 25).
15 Lateinisch Renatus Cartesius (vgl. STÖRIG 1985, S. 313).
16 Descartes ging davon aus, dass alle Wissenschaften eine Einheit bilden, die aus einer einzigen Wissenschaft hervorgehen. Er beschrieb diesen Zusammenhang mit einem Bild. Man stelle sich die Philosophie als einen Baum vor. Die Wurzeln des Baumes werden durch die Metaphysik gebildet, sein Stamm ist die Physik. Am Stamm wachsen Zweige, die die anderen Wissenschaften darstellen. Diese wiederum können auf die drei Oberwissenschaften Medizin, Moral und Mechanik zurückgeführt werden. Ohne Zweige keine Früchte und deswegen ist der Ertrag der Philosophie, also ihre Früchte, nur durch die diejenigen Wissenschaften zu begründen, an deren Zweigen sie hängen (vgl. SPECHT 1996, S. 9).
17 Die theoretischen Grundlagen der modernen naturwissenschaftlichen Medizin, die in der abendländischen Kultur vorherrschend ist, setzen sich aus den Bereichen der Medizin und der Biologie zusammen, weswegen dann von einem biomedizinischen Modell gesprochen wird (vgl. CAPRA 1992, S. 184).
18 KANDEL erforschte insbesondere das Gedächtnis und bezeichnet sich deswegen als kognitiver Neurowissenschaftler des Gedächtnisses (vgl. 2008, S. 107).
19 Damit ist der Vorwurf von NIEWÖHNER, KEHL und BECK gegenüber den Naturwissenschaften insgesamt durch KANDEL (vgl. 2008, S. 18f.) entkräftet (Anmerkung der Autorin).
20 Intentionalität: Brentano (1838-1917) bezeichnet damit „die Eigenart psychischer Phänomene, im Unterschied zu physischen, auf etwas gerichtet zu sein, d. h. immer Bewusstsein von etwas zu sein“ (KUNZMANN / BURKARD / WIEDEMANN 1999, S. 195).
21 In dem Kapitel werden keine neuronalen Grundlagen zum Bindungssystem erörtert, sondern die Annahmen der Bindungstheoretiker John Bowlby und Mary Ainsworth (vgl. 2010a, S. 83-139).
22 Emergente Eigenschaften bedeutet, dass Geist und Gehirn in derselben Weise real sind, jedoch auf unterschiedlichen Komplexitätsebenen existieren (vgl. SOLMS / TURNBULL 2004, S. 68).
23 Siehe dazu auch 'Das Dreieck des Wohlbefindens' (vgl. SIEGEL 2010a, S. 393).
24 Diese Hirnregion ist in der Hauptsache zuständig für komplexes Denken und Planen (vgl. SIEGEL 2010b, S. 33).
25 SIEGEL widmet dem Thema Bindung in seinem Buch ein ganzes Kapitel. In dem Kapitel werden keine neuronalen Grundlagen zum Bindungssystem erörtert, sondern die Annahmen der Bindungstheoretiker John Bowlby und Mary Ainsworth (vgl. 2010a, S. 83-139).
26 Unter Stressoren werden Ereignisse subsumiert, die Menschen entweder als bedrohlich oder als herausfordernd bewerten (vgl. MYERS 2008, S. 693).
27 Name der Person von der Autorin geändert.
28 Siehe zu Rückfallprävention (BÜHRINGER 2003, S. 278ff.).
- Arbeit zitieren
- Petra Flick (Autor:in), 2012, Die Erfahrung Angst. Aspekte eines emotionalen Phänomens und ihr Bezug zur Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509726
Kostenlos Autor werden


















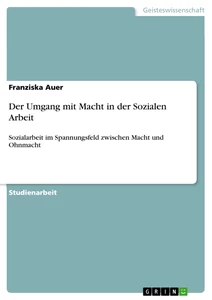



Kommentare