Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
1. Tabellarische Auflistung der Stundenthemen innerhalb der längerfristigen UnterrichtsZusammenhänge
2. Ausgewählte Aspekte der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
2.1 Lehr- und Lernausgangslage
2.2 Curriculare Legitimation der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
2.3 Leitgedanken und Intentionen der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
Teil II: Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
1. Ziele und angestrebte Kompetenzen
2. Didaktische Schwerpunkte
2.1 Lehr- und Lernausgangslage der Lernenden
2.2 Begrenzte Sachanalyse des Unterrichtsgegenstandes
2.3 Relevanz für die Schülerinnen und Schüler
2.4 Begründung der wichtigsten Entscheidungen geplanten Unterrichts
3. Artikulationsschema
4. Literaturverzeichnis
Anhang
- Arbeit zitieren
- M. Ed. David Hanio (Autor:in), 2016, Geht der tropische Regenwald jeden etwas an? Erarbeitung und Beurteilung der landwirtschaftlichen Nutzung eines gefährdeten Ökosystems unter Berücksichtigung des eigenen räumlichen Handelns, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508180
Kostenlos Autor werden
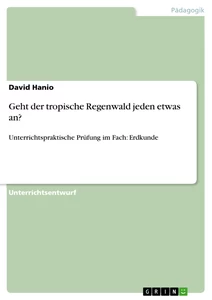
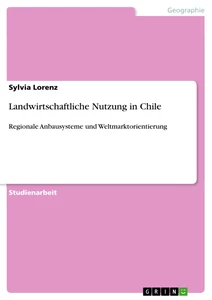
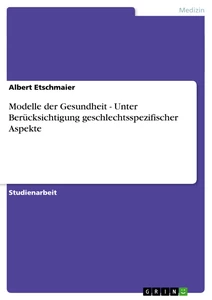
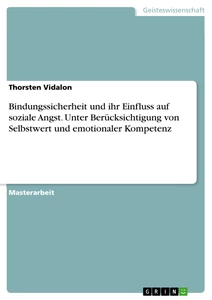
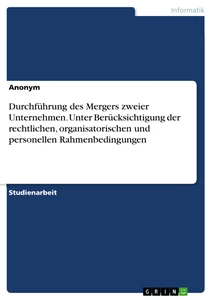
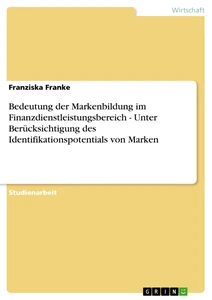
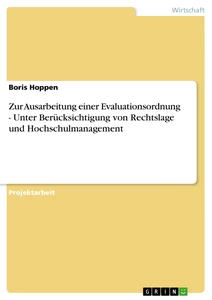
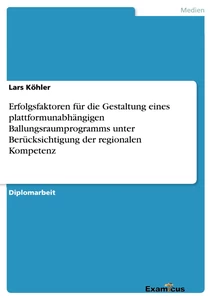
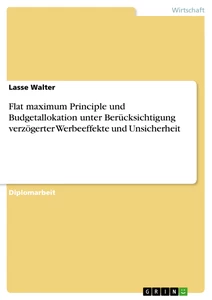
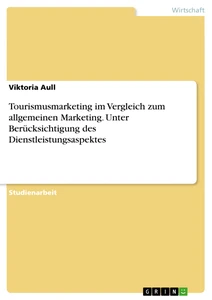
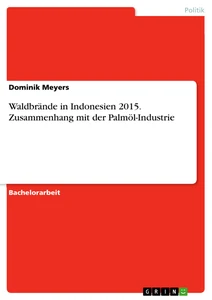
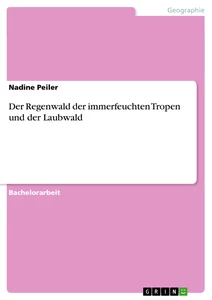
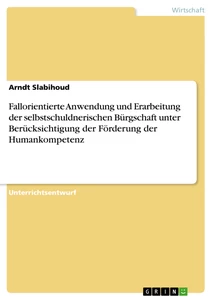


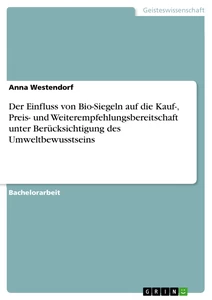
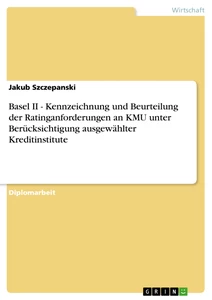
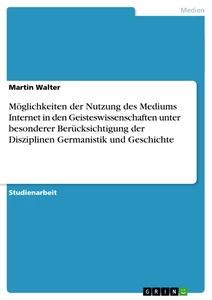
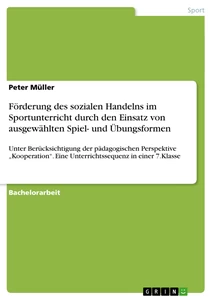
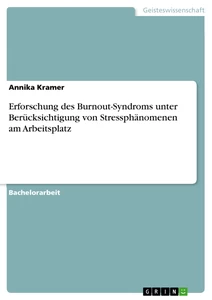
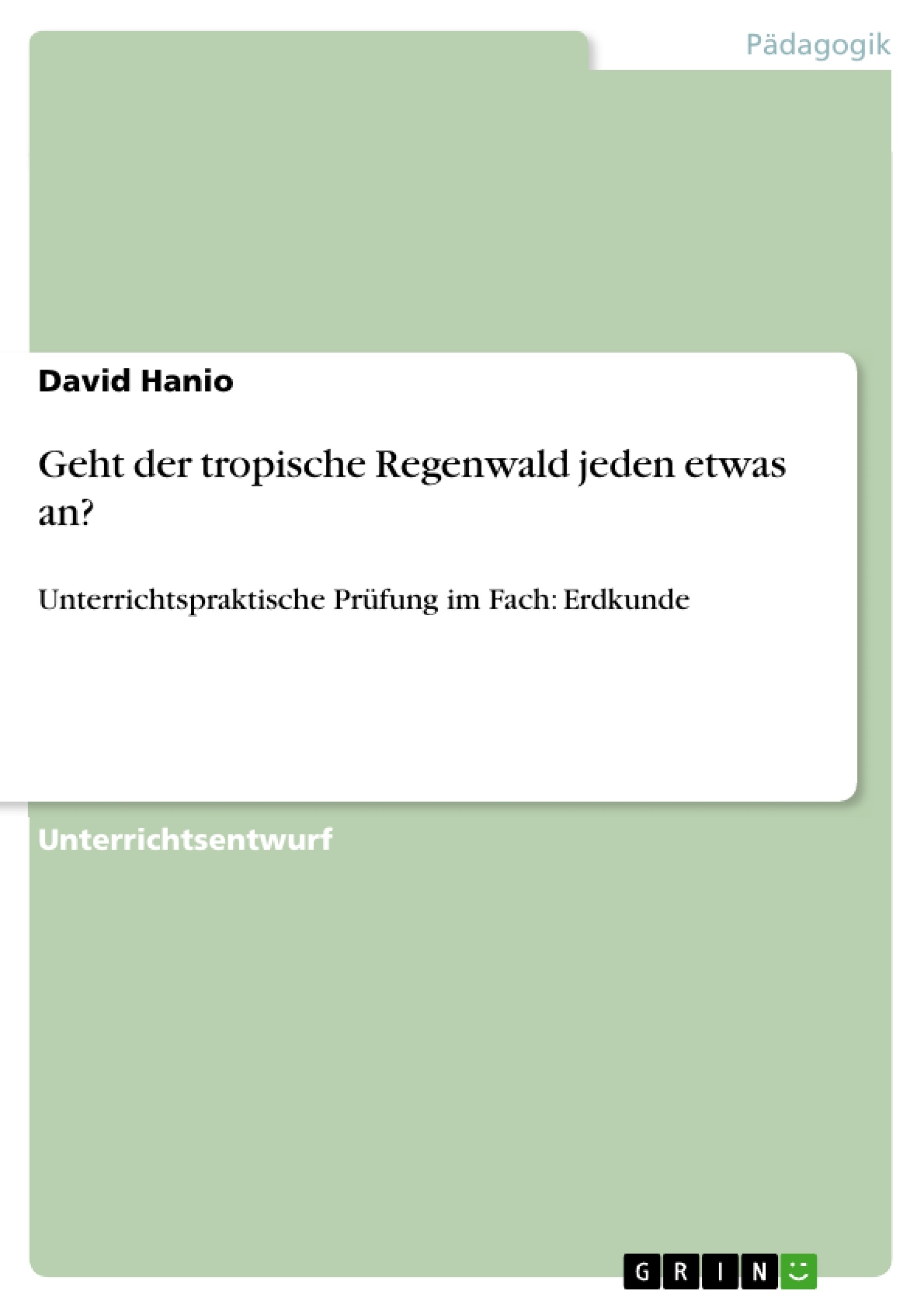

Kommentare