Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bildung und soziale Ungleichheit
2.1. Die Bedeutung von Bildung
2.2. Soziale Ungleichheit innerhalb der soziologischen Forschung
2.3. Bildungsungleichheit als eine Form der sozialen Ungleichheit
3. Pierre Bourdieus Theorie zur Entstehung von Bildungsungleichheit
3.1. Soziale Ungleichheit in der Theorie Bourdieus
3.1.1. Der Raum der sozialen Positionen
3.1.2. Entstehung und Reproduktion sozialer Ungleichheit
3.2. Bildungsungleichheit bei Bourdieu
3.2.1. Die Illusion der meritokratischen Ideologie
3.2.2. Die Vererbung des kulturellen Kapitals
3.2.3. Schule und Hochschule als Institution sozialer Reproduktion
4. Raymond Boudons Theorie zur Entstehung von Bildungsungleichheit
4.1. Soziale Ungleichheit bei Boudon
4.2. Bildungsungleichheit bei Boudon
4.2.1. Primäre Effekte der Schichtzugehörigkeit
4.2.2. Sekundäre Effekte der Schichtzugehörigkeit
5. Theorievergleich der Ansätze von Bourdieu und Boudon
5.1. Einordnung der beiden Theorien
5.2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze
5.3. Potentiale und Defizite der Theorien
6. Resümee und Fazit
Literaturverzeichnis
Filmverzeichnis
1.Einleitung
Unsere moderne Gesellschaft ist geprägt vom Bildungsbegriff. Daher ist häufig die Rede von einer ,Wissensgesellschaft’ oder ,Informationsgesellschaft’, in der das gesellschaftliche System auf der Bildung seiner Mitglieder beruht und sich durch diese auszeichnet. Es gilt die Devise: immer mehr und immer bessere Bildungsmöglichkeiten. Eine Entwicklung, die sich nicht zuletzt in der Bildungsexpansion der vergangenen Jahre widerspiegelt. Vor allem höhere Bildung und die entsprechenden Bildungsabschlüsse dienen als Zugang zu angesehenen Berufen und damit einhergehender finanzieller Sicherheit. Doch haben alle Mitglieder hinsichtlich des Bildungserfolgs die gleichen Chancen?
Obwohl die Maxime der Bildungspolitik im Sinne der Meritokratie die Gewährleistung einer Chancengleichheit aller Mitglieder - unabhängig von externen Faktoren - innerhalb des Bildungssystems darstellt, kann durch etliche Studien, wie die PISA-Studien oder die aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung (vgl. Grainer 2013), nachgewiesen werden, dass diese Idealvorstellung nicht der Realität entspricht. So konnte mehrfach festgestellt werden, dass die schulische Leistung eng im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft der Schüler steht (vgl. Baumert/Maaz 2006: 11). Es scheint also nicht allen Sozialgruppen im selben Ausmaß möglich zu sein, die gleichen Bildungsabschlüsse, und damit einhergehend, den gleichen Wohlstand zu erwerben, woraus eine soziale Ungleichheit von Bildungschancen zwischen den verschiedenen Akteuren einer Gesellschaft entsteht.
Die zentrale Frage, die sich aus dieser Problematik ergibt, lautet: Welche möglichen Ursachen und Mechanismen könnte es für diese Chancenungleichheit im Bildungssystem geben? Um dieser komplexen Frage auf den Grund zu gehen, sollen in der vorliegenden Arbeit zwei unterschiedliche Ungleichheitstheorien näher betrachtet werden, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen und sich innerhalb der soziologischen Forschung etabliert haben. Der erste Theorieansatz, der betrachtet werden soll, ist der Ansatz des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Im Anschluss soll der Ansatz von Raymond Boudon in Augenschein genommen werden. Dabei soll erläutert werden, wie die beiden Soziologen die Entstehung von sozialer Ungleichheit und Bildungsungleichheit erklären. Abschließend sollen die beiden Theorien miteinander verglichen werden und auf mögliche Potentiale und Defizite überprüft werden.
Die Wahl des Themas der vorliegenden Arbeit begründet sich nicht nur durch die aktuellen pädagogischen und politischen Debatten, sondern auch durch das persönliche Interesse, mir als zukünftige Lehrerin der Problematik der Chancenungleichheit in unserem Bildungssystem bewusst zu werden, um einen rücksichtsvollen Umgang mit der Problematik zu erlernen.
2.Bildung und soziale Ungleichheit
2.1. Die Bedeutung von Bildung
Bildung – Auf den ersten Blick handelt es sich hier um einen simplen Begriff, der sich bei genauerer Betrachtung als wesentlich weitläufiger und komplexer darstellt, als zuvor angenommen. Ganz allgemein könnte man Bildung als eine „Vermittlung von Wertehaltungen, Einstellungen, Wissensbeständen und Fertigkeiten“ (Hradil 2006: 129) verstehen, die es dem Einzelnen ermöglicht, sich in seiner Lebenswelt zurecht zu finden, selbstbestimmt und vernünftig zu denken und zu handeln, sowie kritisch urteilen zu können. Diese Idee lehnt an das Bildungsideal des 18. Jahrhunderts nach Wilhelm von Humboldt an, welches sich seinerseits am Ideengut der Antike orientiert. Bildung wird hier als eine Formung des Menschen zur Vollkommenheit an Leib und Seele, sowie als Notwendigkeit für die Gemeinschaft, verstanden (Löw 2006: 20). Im Vordergrund steht hierbei die Selbstbildung und Selbstentfaltung des Individuums. Dabei kann Bildung sowohl den Prozess des Sich-Bildens, als auch das Resultat, also den Zustand des Gebildetseins, bezeichnen.
Doch woran misst man Bildung jenseits der allgemeinen Vorstellungen? Was macht einen gebildeten Menschen aus? Welche Bedeutung kann man Bildung beimessen? Bei der Suche nach der Antwort auf diese Fragen, lässt sich feststellen, dass sich die Bildung des Einzelnen sehr häufig über seine erreichten Bildungsabschlüsse und Bildungszertifikate definiert. Daraus ergibt sich aus einer soziologischen Perspektive heraus betrachtet ein bodenständiger Verwertungsprozess jener Bildungsabschlüsse und -zertifikate (Löw 2006: 19), die somit als individuelles Kapital verstanden werden können. Bildung ist also eine Ressource, ein „Mittel für die Realisierung von individuellen Lebenschancen und gesellschaftlicher Integration“ (Becker 2011: 88). Bildungsabschlüsse dienen dem Zugang zu höherer Bildung und folglich als Qualifikation für den Arbeitsmarkt. Dadurch wird Bildung automatisch zu einer enorm wichtigen Grundlage zur Sicherung des materiellen Wohlstands (Hradil 1999: 145), sowie des sozialen Status innerhalb der Gesellschaft.
Neben der Bedeutung, die Bildung hinsichtlich des Wohlstandes des Einzelnen einnimmt, ist sie genauso fundamental für die Gesellschaft im Ganzen. Hohe Bildung und Wissen dienen als Antrieb für die Entwicklung und den allgemeinen Wohlstand eines Landes.
2.2. Soziale Ungleichheit innerhalb der soziologischen Forschung
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. [...].“(Art. 3, Abs. 3 GG)
So lautet es im 3. Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, in welchem die Gleichbehandlung und Gleichberechtigung eines Jeden - unabhängig von äußeren oder von Geburt aus vorherbestimmten Rahmenbedingungen - festgelegt ist. Dennoch ist häufig die Rede von der in der Gesellschaft bestehenden sozialen Ungleichheit, welche sich direkt oder indirekt auf die Qualität des Lebensstandards des Einzelnen auswirkt und somit eine Ursache für Bevorzugung oder Benachteiligung hinsichtlich gewisser Lebensbedingungen, wie beispielsweise Einkommen oder Arbeitsbedingungen, darstellt. Diese Ungleichheit resultiert aus begünstigten oder beeinträchtigten Zugangsmöglichkeiten zu „erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder zu sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind“ (Kreckel 1992: 17). Es handelt sich bei sozialer Ungleichheit also nicht um beliebige Verschiedenartigkeiten zwischen den Individuen, sondern um eine Ungleichverteilung von bestimmten Ressourcen, die innerhalb der Gesellschaft als wertvoll und verknappt angesehen werden. So besitzen manche Menschen wertvollere Güter als andere, wodurch sie sich Vorteile hinsichtlich ihrer Lebensbedingungen und -chancen verschaffen können, was sie als besser- oder höhergestellt im Vergleich zu Anderen erscheinen lässt (vgl. Hradil 1999: 24).
Dass es sich hierbei um ein häufig diskutiertes und analysiertes Thema und unbestreitbares Phänomen handelt, zeigt sich auch in der Fülle der theoretischen Forschungsarbeiten, die bisweilen zu dieser Problematik veröffentlicht wurden. Die Ungleichheitsforschung innerhalb der Soziologie beschäftigt sich mit Ursachen, Formen und Folgen dieser Problematik.
Ein Rückblick in die Geschichte der Menschheit zeigt, dass man soziale Ungleichheit nicht immer als ein veränderbares Konstrukt mit sozialen Aufstiegsmöglichkeiten angesehen hat. Von der Antike bis hin ins späte Mittelalter waren die Menschen der Überzeugung, dass es eine natürliche, von Gott festgelegte Ordnung gibt (vgl. Burzan 2011: 8). Die Umkehr dieser Denkweise erfolgte größtenteils im Laufe der Aufklärung, in der zunehmend die Ansichten der Kirche hinterfragt wurden und herausragende Persönlichkeiten, wie Voltaire, Rousseau oder Montesquieu1, die gesellschaftliche sowie politische Ordnung in den Blickpunkt der Kritik rückten. Spätestens das Gleichheitspostulat, welches sich in den Worten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der französischen Revolution widerspiegelt, markierte einen Wandel der Sichtweise: „Wenn Ungleichheit nicht natürlich, sondern durch Menschen formbar und veränderbar ist, stellt sich erst die Frage nach ihren Ursachen und Mechanismen“ (ebd.).
In der heutigen Zeit wird nicht mehr von einer gottgegebenen sozialen Ordnung der Gesellschaft ausgegangen. Zwar spielen angeborene Merkmale wie Geschlecht oder Herkunft eine Rolle, jedoch werden sie keineswegs mehr als Legitimation für soziale Ungleichheit angesehen (vgl. ebd.).
Den Beginn der soziologischen Ungleichheitsforschung, die sich konkret mit Fragen über die Ursachen, Phänomene und Wirkmechanismen von sozialer Ungleichheit befasst, könnte man im 18. Jahrhundert mit Jean-Jaques Rousseau festlegen, der oftmals als erster Theoretiker der modernen Ungleichheitsforschung angesehen wird (vgl. Solga 2009: 11; Abels 2010: 300). Im Jahre 1754 verfasste er in seinem Aufsatz „Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen“ eine Antwort auf die Preisfrage der Akademie Dijons, was der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen sei (vgl. Abels 2010: 300). Dabei unterscheidet er zwischen der natürlichen oder physischen Ungleichheit, wie beispielsweise Aussehen, Alter oder Gesundheit, und der sittlichen oder politischen Ungleichheit, die daraus besteht, dass einige zum Nachteil anderer von bestimmten Freiheiten profitieren, „nämlich reicher, angesehener, mächtiger zu sein als diese oder sich gar Gehorsam von diesen leisten zu lassen“ (Rousseau 1754 zit. n. Abels 2010: 300). Die Hauptursache dieser sittlichen Ungleichheit unter den Menschen sieht Rousseau im Eigentum:
„Der erste, welcher ein Stück Land umzäunte, sich in den Sinn kommen ließ zu sagen: dieses ist mein, und einfältige Leute antraf, die es ihm glaubten, der war der wahr Stifter der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Laster, wie viel Krieg, wie viel Mord, Elend und Gräuel hätte einer nicht verhüten können, der die Pfähle ausgerissen, den Graben verschüttet und den Mitmenschen zugerufen hätte: ‚Glaubt diesem Betrüger nicht; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte euch allen, der Boden aber niemandem gehört’.“ (Rousseau 1754 zit. n. Burzan 2011: 9)
Mit diesem Aufsatz hat Rousseau einen revolutionären Grundstein der Forschung zu dem heute ausführlich definierten und analysierten Begriff der sozialen Ungleichheit gelegt. Nach Rousseau entwickelte sich die Forschung über soziale Ungleichheit im 19. Jahrhundert weiter.
Der bekannteste Theoretiker dieser Zeit ist Karl Marx, der im Zuge der Industrialisierung seine antagonistische Klassentheorie entwickelt hat. Seine Theorie basiert auf der Annahme, dass es einen stetigen Klassenkampf zwischen Unterdrückern und Unterdrückten gibt. Auch hier spielt Eigentum eine zentrale Rolle, die Besitzer von Produktionsmitteln herrschen über die nichtbesitzende Klasse (vgl. ebd.: 15). Ein weiterer prominenter Ansatz der Folgezeit ist das Klassen- und Ständemodell von Max Weber, welches im Vergleich zu Marx eine spezifischere Differenzierung der einzelnen Klassen vornimmt und zudem die Konzeption der Stände entwickelt. Während es beim Klassenbegriff primär um den ökonomischen Bereich geht, definieren sich Webers Stände auch nach sozialen und ideologischen Kriterien, wie die Lebensführungsart oder Berufsprestige (vgl. ebd.: 22).
In Anlehnung und aber auch in bewusster Abgrenzung an Marx und Weber entstanden zunehmend komplexere Modelle zu sozialer Schichtung, sozialen Lagen und Milieus2.
Festhalten kann man, dass Ideen und Forschungsansätze, über das, was man unter sozialer Ungleichheit versteht, sich im Laufe der Geschichte ändern. Es handelt sich hierbei also um eine „gesellschaftliche Konstruktion, die an ihre historische Zeit gebunden ist und nie ‚objektiv’ sein kann“ (ebd.: 7). Eine Konstruktion, die immer wieder überdacht, neu aufgewickelt und angegangen werden muss, um ihrer Komplexität gerecht zu werden und um geeignete Ansätze und Methoden entwickeln zu können, die diese soziale Ungleichheit verringern.
2.3. Bildungsungleichheit als eine Form der sozialen Ungleichheit
Nachdem nun eingangs eine allgemeine Abhandlung zum Phänomen der sozialen Ungleichheit aufgezeigt wurde, soll nun im Folgenden eine Fokussierung auf eine konkrete Dimension sozialer Ungleichheit stattfinden: nämlich dem Phänomen der Bildungsungleichheit.
Die Forschung zur Entstehung von sozialer Ungleichheit im Bildungssystems blühte Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Zunächst entwickelte sie sich in den fünfziger Jahren in den Vereinigten Staaten, Skandinavien und England und kurz darauf in den sechziger Jahren in Frankreich, Deutschland und der Schweiz (Boudon 1980: 169). Spätestens seit den PISA-Studien handelt es sich um ein hoch aktuelles Thema, das derzeit mitten im Prozess der Forschung steht.
Bildungsungleichheit kann als eine Form von sozialer Ungleichheit begriffen werden. Dies erklärt sich folgendermaßen: Ein hoher Bildungsabschluss ist eine wertvolle Ressource, um auf dem Arbeitsmarkt, der durch einen hohen Standard an Wissenschaft und Professionalität gekennzeichnet ist, eine gute Berufsposition zu erreichen. Daher ist häufig bei Bildungszertifikaten auch die Rede vom sogenannten „Humankapital“, welches sich aus den „kumulierten Bildungs-, Ausbildungs- und Berufserfahrungen“ (Huinink 2008: 113) zusammensetzt und dem Akteur je nach Erfolg und Höhe des Abschlusses unterschiedlich gute Zugangschancen zu beruflichen Positionen verschafft. Dadurch ergeben sich Ungleichheiten im erreichten Bildungsgrad zwischen den einzelnen Akteuren. Am Beispiel des sekundären Bildungsbereichs kann man zum einen die Höhe des Bildungsabschlusses unterscheiden, also Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder Abitur, und zum anderen den Erfolg des Abschluss anhand der Durchschnittsnote, der wiederrum den Zugang zu weiterführenden Schulen oder Universitäten, sowie Ausbildungsberufen, reguliert.
Wenn man sich nun auf das Prinzip der in vielen Bildungssystemen geforderten Chancengleichheit beruft, könnte man anbringen, dass diese Ungleichheit gerecht sei (vgl. Hadjar 2008: 45f.), da ein Akteur eine bessere Leistung erbracht hat als ein anderer. Diese Ansicht würde aber voraussetzen, dass sich der Erfolg und die Höhe des Bildungsabschlusses des Einzelnen ausschließlich an individuellen Faktoren wie Motivation, kognitiver Fähigkeit, Anstrengung und Leistung bemisst und völlig unabhängig von leistungsfremden Merkmalen, wie beispielsweise dem Geschlecht oder der sozialen Herkunft, sein müsste.
Zahlreiche Studien belegen jedoch, dass eine solche Chancengleichheit und die Idee eines rein meritokratischen Schulsystems nicht der Realität entsprechen und die soziale Selektion im Schulsystem vieler Länder, vor allem in Deutschland, gravierend ist (vgl. Watermann/Baumert 2006: 62). Die PISA-Studie beschreibt beispielsweise einen engen Zusammenhang zwischen in der Schule geforderten Basiskompetenzen und der sozialen Herkunft (vgl. Baumert/Maaz 2006: 11). Bei der Idee der Chancengleichheit wird nämlich oftmals übersehen, dass die Schüler nicht von vornherein über die gleichen Ausgangsvoraussetzungen verfügen und demzufolge Kinder aus niedrigeren Sozialschichten nicht die gleichen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit in die Schule bringen wie Kinder aus den privilegierten Sozialschichten, sodass „Chancenungleichheit in Anbetracht der unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen (Effekte der sozialen Herkunft) nur schwer umsetzbar ist“ (Hadjar 2008: 47). Kinder aus den höheren Klassen haben von Beginn an bessere Chancen im Bildungswettbewerb, da sie von vornherein über bessere Lernvoraussetzungen und ein besseres Bildungsniveau verfügen als Kinder aus der Arbeiterschicht.
Und obwohl in den vergangen Jahrzenten positive Entwicklungen wie Bildungsreformen und Bildungsexpansion stattgefunden haben, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt haben, der bestehenden Ungleichheit entgegenzuwirken und mehr Chancengleichheit und Förderungen zu ermöglichen, findet man immer noch keinen gleichverteilten Zugang aller Sozialgruppen zu höherer Bildung (vgl. Baumert/Maaz 2006: 11). Das allgemeine Bildungsniveau wurde zwar insgesamt angehoben, aber die Bildungschancen sind nach wie vor durch eine soziale Ungleichheit zwischen den verschiedenen Sozialschichten geprägt.
Innerhalb der Ungleichheitsforschung gibt es ein breit gefächertes Feld an Erklärungsansätzen und Theorien zur Problematik der sozialen Ungleichheit und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Eine wichtige Unterscheidung der Ungleichheitstheorien ist zunächst die Einteilung in Makro - und Mikrotheorien. Während die Makrotheorien in den gesamtgesellschaftlichen Kontext eingebettet sind, gehen Mikrotheorien von dem Handeln und den Entscheidungen des Einzelnen aus (vgl. Hradil 2006: 136). Zwischen Makroebene der Gesellschaft und Mikroebene der interagierenden Individuen kann noch die Mesoebene der Organisation angesiedelt werden (Brüsemeister 2008: 11).
Hradil unterscheidet die Ungleichheitstheorien in Modernisierungs- und Integrationstheorien auf der einen Seite und Macht- und Konflikttheorien auf der anderen Seite (vgl. Hradil 2006: 134f.). Modernisierungs- und Integrationstheorien gehen davon aus, dass Chancengleichheit mit der Bildungsexpansion und den zunehmenden, komplexen Anforderungen der modernen Berufswelt erreicht werden müsse, da immer mehr Mitgliedern der Gesellschaft, auch bislang bildungsfernen Gruppen, der Zugang zu Bildung ermöglicht wird und die moderne Gesellschaft auf deren professionelle Ausbildung angewiesen sei. Macht- und Konflikttheorien hingegen gehen davon aus, dass durch die Bildungsexpansion zwar den nicht-privilegierten Schichten ein zunehmender Zugang zu höherer Bildung ermöglicht wird, dass sich die bestehende Ungleichheit jedoch vom Bereich sekundärer Bildung in den Bereich tertiärer Bildung verschiebt, da die Mitglieder der höheren Schichten ihre sozialen Vorteile nicht einbüßen wollen und „die Hürden zur Erlangung von wirklich privilegierenden Bildungsabschlüssen so [...] erhöhen, dass nur ihresgleichen sie erreichen werden“ (ebd.: 135). Dies kann dadurch erzielt werden, dass die Zugangsmaßnahmen zu den begehrtesten Berufen verschärft werden und höhere Bildungszertifikate verlangt werden. Auf der Mikroebene gehören zu den wichtigsten Ansätzen: die ökonomischen Theorien, die Ressourcentheorien und die Humankapitaltheorie.
Ökonomische Theorien betrachten Bildung und Bildungsentscheidungen unter dem Gesichtspunkt des Nutzens, welche die Bildung für den handelnden Akteur hat. Bildung wird als eine Investition angesehen, um Erträge in Form von besseren Berufschancen, höherem Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit zu erhalten (vgl. ebd.: 137).
Bei Ressourcentheorien spielen der kulturelle Hintergrund sowie gewisse schultaugliche Eigenschaften, welche im Sozialisationsprozess von den Eltern auf die Kinder übertragen werden, die entscheidende Rolle (vgl. ebd.).
Die Humankapitaltheorie sieht die Ursache von Bildungsungleichheit „als Ergebnis bewußter [sic], biographisch planender Investitionsentscheidungen auf Grund von Kosten-Nutzen-Kalkülen“ (ebd.: 139). Dabei muss der Akteur bestimmte Faktoren, wie die Investitionen, die er in Form von Zeit und Geld in die Bildung hineinsteckt, sowie den daraus gezogenen Nutzen für eine spätere berufliche Position, gegeneinander abwägen. Beim Kostenfaktor müssen nicht nur die Kosten berücksichtigt werden, die direkt in die Bildung fließen, sondern auch die Lohnausfälle für die Zeit der Ausbildung (vgl. ebd.). Hinzu kommt die Einschätzung der persönlichen Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Berücksichtigung all dieser Faktoren ist letztendlich maßgebend bei den individuellen Bildungsentscheidungen.
Bei der Vorgehensweise zur Etablierung solcher Theorien unterscheidet man zwischen qualitativen und quantitativen Methoden. Qualitative Forschungsmethoden versuchen soziologische Phänomene in ihrer ganzen Detailliertheit zu beschreiben, um einen möglichst tiefen Informationsgehalt zu gewährleisten (vgl. Wolf 2008: 7). Quantitative Forschungsmethoden hingegen versuchen anhand von wenigen Merkmalen einen bestimmten Sachverhalt zu untersuchen. Dabei erfolgt eine Reduktion der Realität auf Zahlen, die auf einer breiten Basis gesammelt werden (ebd.), wie wir es beispielsweise von den PISA-Studien kennen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Bildungsungleichheit eine Form von sozialer Ungleichheit darstellt und dass es derzeit bereits einige unterschiedliche Theorieansätze zu deren Erklärung gibt. Im weiteren Verlauf soll nun der Blick auf zwei dieser Theorien gerichtet werden.
3.Pierre Bourdieus Theorie zur Entstehung von Bildungsungleichheit
Pierre Félix Bourdieu, einer der wichtigsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, hat innerhalb seiner Forschungsjahre ein sehr umfassendes und komplexes Werk über die Strukturen und sozialen Mechanismen in der Gesellschaft verfasst3. In seinem Forschungswerk beschreibt er ausführlich, wie sich die Akteure im gesellschaftlichen Raum einordnen lassen, wie sie sich hinsichtlich ihrer Lebensstile und Geschmäcker unterscheiden und wie ihr Denken und Handeln mit ihrer sozialen Klassengebundenheit zusammenhängt. Hierbei hat er eine interessante Theorie zur Entstehung und Reproduktion von sozialer Ungleichheit entwickelt, die davon ausgeht, dass der Akteur in seinen Möglichkeiten durch seine soziale Herkunft determiniert ist. Seine Theorie erscheint vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebensgeschichte besonders eindrucksvoll und paradox, hat er doch, als Sohn eines einfachen Landwirts und späteren Postarbeiters, an der Eliteschule „École Normale Supérieure“ in Paris studiert und den Aufstieg zu einem der renommiertesten Soziologieprofessoren seiner Zeit geschafft. Dabei hat er sogar eine Lehrstelle am „College de France“, dem wissenschaftlichen Institut mit dem höchsten Prestiges Frankreichs, innegehabt. Im Folgenden soll erklärt werden, wie Bourdieu die gesellschaftliche Welt beschreibt, was er unter sozialer Ungleichheit und Bildungsungleichheit versteht und welche Ursachen und Mechanismen seiner Theorie zufolge zu deren Entstehen beitragen.
3.1. Soziale Ungleichheit in der Theorie Bourdieus
Dass es Unterschiede und soziale Ungleichheiten zwischen den Akteuren unserer Gesellschaft gibt, macht Bourdieu nicht zuletzt in seinem Werk Die feinen Unterschiede deutlich. Er betont diesen Aspekt auch in vielen anderen Werken und Schriften, wie beispielsweise in seinem Aufsatz Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital oder in den Werken Sozialer Sinn, Die Illusion der Chancengleichheit oder Die verborgenen Mechanismen der Macht. Diese Werke sollen zur Erklärung seiner Auffassung bezüglich der Entstehung von sozialer Ungleichheit und auch von Chancenungleichheit im Bildungssystem herangezogen werden.
3.1.1. Der Raum der sozialen Positionen
Pierre Bourdieu entwirft in Die feinen Unterschiede ein Konzept, in dem er erläutert, wie sich die handelnden Akteure in einem sozialen Raum bewegen. Die Position, die der Einzelne in diesem theoretischen, gesellschaftlichen Raum einnimmt, hängt dabei von einer Vielzahl unterschiedlicher Variablen ab, nämlich von der quantitativen Menge an verschiedenen „Kapitalien“, die der Einzelne besitzt.
„Die zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebene Verteilungsstruktur verschiedener Arten und Unterarten von Kapital entspricht der immanenten Struktur der gesellschaftlichen Welt, d.h. der Gesamtheit der ihr innewohnenden Zwänge, durch die das dauerhafte Funktionieren der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestimmt und über die Erfolgschancen der Praxis entschieden wird“ (Bourdieu 1983: 183)
Dabei geht es Bourdieu bei der Konstitution des sozialen Raumes nicht nur um materielle Güter, sondern auch um symbolische Ressourcen, wie Macht, Prestige, Reputation und Ansehen innerhalb der Gesellschaft (vgl. Brüsemeister: 85). Das Gesamtkonstrukt dieses sozialen Raumes, welches er entwirft, hängt von einer Reihe an Faktoren ab, die sich wechselseitig beeinflussen und verstärken. Um ein genaueres Verständnis dafür zu entwickeln, wo innerhalb dieses sozialen Raumes der Akteur eingeordnet werden kann, muss zunächst der Kapitalbegriff, der eine sehr zentrale Rolle bei dieser Einordnung spielt, verstanden werden. Denn „es ist nur möglich, der Struktur und dem Funktionieren der gesellschaftlichen Welt gerecht zu werden, wenn man den Begriff des Kapitals in allen seinen Erscheinungsformen einführt“ (Bourdieu 1983: 184). Dabei kritisiert Bourdieu den bis dato sehr ökonomisch ausgerichteten Ansatz der Wirtschaftstheorie, der im Kapital des Akteurs in erster Linie Privateigentum und Einkommen durch Lohnarbeit sieht. Bourdieu erweitert diesen Kapitalbegriff um ein Vielfaches. Allgemein beschreibt er Kapital als „akkumulierte Arbeit, [die] entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter, ‚inkorporierter’ Form“ (ebd.: 183) vorhanden ist. Es handelt sich also nicht nur um objektive Eigenschaften, wie materieller Besitz, sondern auch um subjektive, verinnerlichte Strukturen und Denkweisen, die sich im ganzen Sein und Handeln des Akteurs widerspiegeln.4 Unter Akkumulation von Kapital ist zum einen die „Vererbung von erworbenen Besitztümern und Eigenschaften“ (ebd.) durch die Familie gemeint, zum anderen auch die Aneignung und das Vergrößern des eigenen Kapitals im Laufe der Zeit.
Bourdieu unterscheidet nun in drei Formen von Kapital: Das ökonomische Kapital, das ausschließlich den materiellen Besitz wie Geld und Eigentum bezeichnet, sowie das kulturelle Kapital und das soziale Kapital.
Mit kulturellem Kapital meint Bourdieu in erster Linie Bildung, Wissen und das Erlangen von Bildungstiteln. Er gliedert den Begriff noch feiner auf und unterscheidet in drei Unterarten an kulturellem Kapital: Erstens im inkorporierten Zustand, zweitens im objektivierten Zustand und drittens im institutionalisierten Zustand (ebd.: 185).
Unter inkorporiertem Zustand kann man alle dauerhaften Dispositionen des Akteurs verstehen (ebd.: 185). Gemeint ist die ,Bildung’, also das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die der Einzelne verinnerlicht hat und die somit Teil seiner Denk- und Lebenswelt geworden sind. Die Kosten für diese Form des Kapitals sind in erster Linie der Zeitaufwand, der von der Person individuell aufgebracht werden muss. Hinzu kommt die Investition von dem, was Bourdieu die libido sciendi5 nennt, „die alle möglichen Entsagungen, Versagungen und Opfer mit sich bringen kann“ (ebd.: 186) – kurz gesagt: ein Wille seitens des Akteurs, der Disziplin und Durchhaltevermögen zum Wohle seines eigenen Bildungserfolgs mitbringt. Diese Form des Kapitals, kann nicht durch direkte Vererbung, Schenkung oder Kauf erworben werden, sie muss eigens durch Fleiß und Zeitaufwand erlangt werden. Der wichtigste Punkt bei der Rede von inkorporiertem kulturellen Kapital ist die Tatsache, dass diese Form von Kapital zum festen Bestandteil der Person wird: Aus „Haben“ wird „Sein“ (ebd.: 187).
Bei objektiviertem Kulturkapital handelt es sich um materielle Kulturgüter, wie beispielsweise Bücher, Lexika, Gemälde, Kunstwerke, Instrumente oder Maschinen. Diese Art von kulturellem Kapital ist sehr wohl durch Schenkung oder Vererbung übertragbar, jedoch nicht die notwendigen Fähigkeiten, sowie das Verständnis für den Genuss oder Gebrauch solcher kulturellen Güter (ebd.: 188), die unter das inkorporierte Kulturkapital fallen.
Die letzte Form kulturellen Kapitals ist das institutionalisierte Kulturkapital: Hierbei handelt es sich um eine Objektivierung des inkorporierten kulturellen Kapitals in Form von Bildungszertifikaten und Bildungstiteln. Das inkorporierte Kapital einer Person wird somit institutionell anerkannt und rechtlich garantiert (ebd.: 190). Dadurch wird jedoch auch ermöglicht, die unterschiedlichen Besitzer von Bildungszertifikaten oder –titeln miteinander zu vergleichen und einen Marktwert für bestimmte Bildungsabschlüsse zu ermitteln (vgl. ebd.).
Als dritte Kapitalform benennt Bourdieu das soziale Kapital. Es handelt sich hierbei um soziale Kontakte, also den „Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens“ (ebd.: 190f.). Gemeint ist auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (vgl. ebd.). Unter sozialem Kapital kann man folglich alle Beziehungen verstehen, die den Akteur sowohl sozial, als auch beruflich weiterbringen und ihm für seine Laufbahn förderlich sein können.6 Durch solche Beziehungen kann es einem Akteur beispielsweise möglich sein, einfacher an ein Praktikum oder eine Arbeitsstelle zu gelangen.
Die verschiedenen Kapitalien sind ineinander konvertierbar, so kann mit ökonomischem Kapital kulturelles Kapital erlangt werden, indem in Bildung investiert wird (vgl. ebd.: 195). Dies geschieht beispielsweise mittels Anschaffung von Büchern oder der Inanspruchnahme von Nachhilfeunterricht. Umgekehrt kann kulturelles Kapital zur Sicherung eines guten Bildungsabschlusses und der Erlangung eines guten Berufs hilfreich sein, wodurch wiederum das ökonomische Kapital gesichert wird (vgl. ebd.: 190). Das Verständnis der verschiedenen Kapitalformen ist in der Theorie Bourdieus ein zentraler Punkt, da das Volumen und die Verteilungsstruktur der Kapitalien entscheidend für die Positionierung des Akteurs im sozialen Raum sind. Dabei besteht der soziale Raum aus drei Grunddimensionen: dem Kapitalvolumen, der Kapitalstruktur und der Entwicklung dieser beiden Größen im Laufe der Zeit (Bourdieu 1982: 195f.).
Bourdieu greift in diesem Zusammenhang auch den Begriff der Klasse auf. Mit „objektive Klasse“ bezeichnet er ein Ensemble von Akteuren, die homogenen Lebensbedingungen unterworfen sind, ähnliche Handlungsmuster aufzeigen und die sich durch eine Reihe an gemeinsamen Merkmalen, wie Besitz oder Teilhabe an Macht, auszeichnen (vgl. ebd.: 175). Dabei kann man die Zuordnung zu einer bestimmten Klasse nicht auf einige wenige Merkmale, wie Einkommen und Beruf, reduzieren. „Eine soziale Klasse ist vielmehr definiert durch die Struktur der Beziehungen zwischen allen relevanten Merkmalen“ (ebd.: 182). So liegt das Hauptaugenmerk zur Unterscheidung der sozialen Klassen im Gesamtvolumen des Kapitals, das sich aus der Summe von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital zusammensetzt (ebd.: 195f.). Umfang und Struktur des Kapitals wiederrum hängen von vielen unterschiedlichen Faktoren (Beruf, Einkommen, Alter, Geschlecht, Wohnort etc.) und der mit ihnen verbundenen Lebensbedingungen ab. Bourdieu verfeinert die Idee der Klasse und teilt diese innerhalb der horizontalen Ebene in verschiedene Klassenfraktionen ein, die sich innerhalb einer Klasse von ihren charakteristischen Eigenschaften noch ähnlicher sind (vgl. ebd.: 206).
[...]
1 Man könnte z.B. das Werk Lettres persanes von Montesquieu in diesem Kontext erwähnen, der durch die Sicht von zwei Persern, die politischen, kulturellen und sozialen Umstände Frankreichs ‚von außen’ betrachtet und somit indirekte Kritik am französischen System ausübt.
2 Zu nennen wären hier beispielsweise die Ansätze von Geiger, Dahrendorf, Geißler, Hradil und viele mehr (vgl. Burzan 2011), auf die nun im Einzelnen nicht eingegangen werden soll.
3 In seinen Analysen bezieht er sich hauptsächlich auf die französische Gesellschaft und das französische Bildungssystem. Die theoretischen Ideen, die er daraus ableitet, sind jedoch allgemeingültig und können auch auf Deutschland übertragen werden.
4 Dieser Denkansatz verkörpert die Idee des Habitus, auf den zu einem späteren Zeitpunkt noch expliziter eingegangen werden soll.
5 sozial konstituierte Libido (eigene Übersetzung)
6 Heutzutage ist auch oftmals die Rede von ‚Connections’.
- Arbeit zitieren
- Viktoria Jung (Autor:in), 2013, Soziale Herkunft als Ursache für Bildungsungleichheit und Bildungsentscheidungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506223
Kostenlos Autor werden


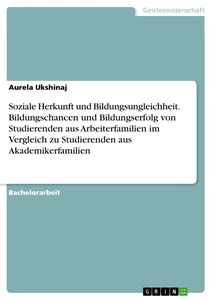

















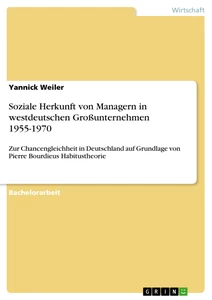
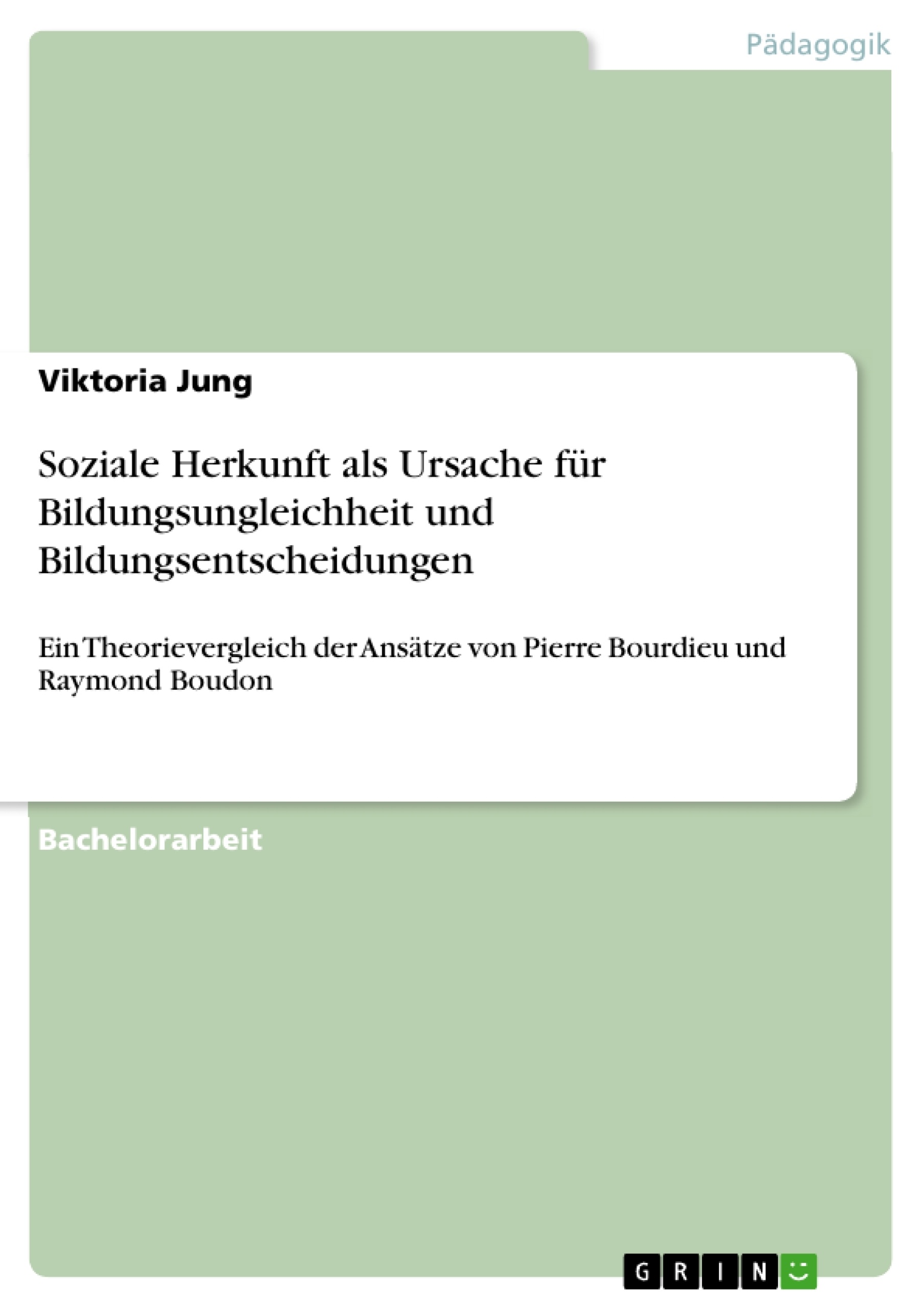

Kommentare