Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Darstellung der problemorientierten Pflege
1.1. Einführung
1.1.1 Die problemorientierte Grundhaltung
1.1.2 Die nicht gesehenen Prozesse
1.1.3 Die unreflektierte Beziehung
1.2. Problemorientierte Interaktionen mit den Patienten
1.2.1 Kontaktaufnahme, Gesprächsführung, Wirken
1.2.2 Starre Reglementierungen
1.2.3 Das Überschreiten von Grenzen, rechtliche Aspekte
1.2.4 Gewalt durch das Personal
1.3. Die Rolle der Pflegekraft
1.3.1 Eigenanteile, innere Motive und „der Schatten“
1.3.2 Ausbildung und Kompetenz
1.4. Äußere Faktoren
1.4.1 Organisatorische Probleme
1.4.2 Problemverstärkende Faktoren des Umfeldes
2. Prozessorientierte psychiatrischen Pflege
2.1 Die prozessorientierte Grundhaltung
2.1.1 Grundsätzliche Betrachtungen
2.1.2 Die Klientenzentrierung
2.1.3 Der Auftrag des Patienten
2.2 . Prozessorientierte Begegnungen
2.2.1 Die Kommunikation
2.2.2 Das Empowerment
2.2.3 Das Prinzip der Ähnlichkeit
2.2.4 Umgang mit Konflikten
2.3. Der Prozess der Pflegekraft
2.3.1 Selbstreflektion
2.3.2 Die eigenen Grenzen sehen
2.3.3 Selbstbefähigung, Professionalisierung, Ausbildung
2.3.4 Psychohygiene
2.4 Äußere Faktoren
2.4.1 Prioritäten setzend organisieren
2.4.2 Die Gestaltung des Umfeldes
3. Ein Fazit, Pro und Kontra
Literaturverzeichnis
Erklärung
Einleitung
Diese Einleitung zu schreiben bereitet mir in diesen Moment die größte Schwierigkeit, weil ich einfach nicht die richtigen Worte finde, um in mein Thema einzuführen. Sicher, ich könnte ausführen, dass ich über Probleme und Schwierigkeiten schreiben wollte, die ich im Pflege- und Beziehungsprozess bei uns Pflegekräften wahrgenommen habe. Probleme, die auf einer Grundhaltung beruhen, die wir uns teilweise nur sehr schwer bewusst machen können oder wollen. Ich könnte mitteilen, dass ich in meiner Hausarbeit einer problemorientierten und direktiven Pflege eine prozessorientierte und klientenzentrierte entgegenstelle, welche ich für die deutlich bessere halte, weil sie den Patienten und uns zu mehr Selbstbefähigung verhilft.
Aber das beschreibt eben nicht, wie sich dieses Thema für mich anfühlt, was es in mir bewegt und bewirkt hat und wie ich dazu gekommen bin. Denn auch ich habe mich in meinem Prozess verändert, fühle mich befähigter, fühle aber auch klarer meine Grenzen. Es hat sich einiges in mir gewandelt und obwohl ich manchmal nicht wusste wohin die Reise geht, haben diese Veränderungen doch dazu geführt, dass es sich heute anders anfühlt, wenn ich mit einem Patienten in Kontakt gehe - achtsamer und sanfter, vor allem aber auch berührbarer.
Für dieses „Berührbar-Werden“ danke ich vor allem meinen Patienten, denen ich mich heute näher fühle und ähnlicher und von denen ich vieles lernen durfte. Lernen, was es heißt alte Überzeugungen loszulassen und lernen, was es heißt sich wirklich einzulassen. Und so möchte ich meine Einleitung jetzt mit dem Satz beenden, welcher mich auf meinem Weg und bei meinem Prozess oft sehr bewegt hat:
Es liegt nur so lange im Schatten, bis man sich traut einmal hinzuschauen.
1 Darstellung der problemorientierten Pflege
1.1. Einführung
1.1.1 Die problemorientierte Grundhaltung
Mit einer problemorientierten Grundhaltung innerhalb der psychiatrischen Pflege bezeichne ich eine Pflege, welche sich ausschließlich auf Krankheitssymptome, Defizite, Verhaltensauffälligkeiten (z.B.: Regelverstöße), den pflegerischen Aufwand bei den Aktivitäten des täglichen Lebens und ähnliche Probleme fokussiert und versucht, durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern, um diese Probleme zu beseitigen. Leider ist der dann dazu angewandte Mechanismus fast immer ein suppressiver also unterdrückender, der sich gegen das Problem richtet und es dadurch zu beseitigen sucht. Durch das problem- oder defizit- orientierte Arbeiten, beschränkt sich aber die Wahrnehmung in der Pflege erheblich. Aus dem Wunsch heraus, das Problem schnell zu beseitigen, werden so Faktoren und Ursachen, die das Problem hervorgebracht haben ignoriert, bzw. nicht in Erfahrung gebracht und eine fehlgeschlagene pflegerische Problemlösung wird dann meist noch stärker und intensiver mit erneuter Suppression beantwortet.
Mir fällt dazu ein schizophrener Patient Mitte Zwanzig ein, der auffiel, weil er sporadisch die Einnahme seiner Neuroleptika verweigerte bzw. versuchte, diese zu entsorgen. Es fiel dann schnell das Wort „krankheitsuneinsichtig“ und es wurde versucht, durch unermüdliches Erklären, durch verschärfte Kontrollen, Umstellung der Medikation auf Tropfenform oder auch durch imperative Gesprächsführung („das ist so angeordnet also nehmen Sie die auch“) das Problem zu beseitigen. Als ich dann den Patienten einfach mal fragte, WARUM er seine Medikation verweigerte, war ich sehr überrascht, wie nachvollziehbar und durchaus nicht „krankheitsbedingt“ sein Wunsch war. Nachdem er etwas Vertrauen gefunden hatte, berichtete er mir nämlich von seinem Potenzverlust nach Einnahme der Neuroleptika und dass er eben aller paar Tage versucht, durch ein Verschwindenlassen der Tabletten eine „Auszeit“ zu bekommen. Und so rückte das Verhalten plötzlich in ein ganz anderes Licht und die Not des Patienten wurde deutlicher. Die Medikation wurde umgestellt und das Problem hatte sich für den Patienten und uns erledigt.
Bei einer Grundhaltung, die ich problem- oder auch defizit- orientiert nenne, wähnt sich die Pflegekraft in der Rolle der Wissenden und Führungskompetenten. Wissend was die Entstehung eines Problems betrifft und wissend, welche Maßnahmen zu dessen Beseitigung führen und kompetent in der Anleitung und Führung des Patienten. Pflegerische Problemlöse-Strategien bestehen darin, den Patienten stetig mit seinen Problemen und Defiziten zu konfrontieren und von ihm zu erwarten, dass er in ein vorgezeichnetes Muster einwilligen soll: - den Anweisungen und Ratschlägen des Pflegepersonals Folge leisten, um die Probleme abzustellen. Ich bin der Meinung, dass diese Grundhaltung wichtige Wirklichkeitsbereiche des Patienten (-und von uns-) ausklammert und ihn in seiner Autonomie sehr stark einschränkt. Und zwar deswegen, weil er nicht dahingehend motiviert wird, eigene Bewertungen seiner Situation und eigene Erklärungsmodelle und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Statt dessen bewerten wir seine Situation. Dieses Bewerten hilft aber keinem Patienten.
Dörner und Plog beschreiben dieses Bewerten im Umgang mit Suchtkranken: „Es fällt uns leicht, die Gründe als Vorwände zu durchschauen. Wir halten das dem Patienten vor. Was erreichen wir damit? Dass der Patient, der das ja auch weiß, sich noch geschickter rechtfertigt, sich wieder bevormundet fühlt. Wenn wir wollen, dass der Patient sich aus sich heraus versteht, haben wir Vorwände und Gründe gleich ernst zu nehmen. Denn sie machen seine subjektive Welt aus. Nur so kann er selbst die Unterschiede wahrnehmen zwischen dem, was er sich einredet und dem, was er auch damit meint. Dasselbe gilt, wenn wir von „Fehlhaltung“ sprechen. Natürlich ist Sucht in der Außenbetrachtung eine entsetzliche Fehlhaltung, „Selbsttötung auf Raten“. Aber auch sie ist nur ein Teil einer Gesamthaltung. Und diese gilt es wahrzunehmen – in allen Anteilen: den Ängsten und Wünschen, den Bewältigungs- und Vermeidungsversuchen der Lebensprobleme. Denn eine Ersatzbefriedigung ist zwar Ersatz, aber auch Befriedigung. Niemand ist so gewohnt, bewertet zu werden, wie der Abhängige. Daher: nur wenn ich jede Wertung verweigere, statt dessen vollständig wahrnehme und alles ernst nehme, kann der Patient sich selbst bewerten, selbst Unterscheidungen, später Entscheidungen treffen, sich selbst einen Wert beimessen. Erst dann kann er davon herunter, sein Selbstbild pendeln zu lassen: zwischen Selbstzerfleischung, Überheblichkeit und Selbstmitleid“ (Dörner, Plog 1996, Seite 266).
Wie der Patient seine Problematik selbst erlebt, ob er überhaupt etwas ändern möchte, oder ob er eigene Lösungsansätze entwickelt, wird aber oft eben nicht in Erfahrung gebracht, weil es auch nicht erwünscht ist. Diese Art der Begegnung geschieht nicht auf gleicher Augenhöhe, denn wir können den Patienten aus dieser Grundhaltung heraus nicht als kompetenten Partner wahrnehmen. Wir halten ihn so in Abhängigkeit und verfehlen damit (im Bereich der Pflege) das Ziel einer jeden Therapie: den Patienten von der Therapie unabhängig zu machen.
1.1.2 Die nicht gesehenen Prozesse
Ein Prozess ist ja ein Geschehen, was sich entwickelt, verändert, keinen fest umrissenen Anfang und kein Ende hat. Bei einer problemorientierten Grundhaltung wird der Fokus auf das Problem und auch überwiegend nur auf den Moment gelegt. Entweder ist der Alkoholiker motiviert oder nicht, nach dem Prinzip Schalter ein, Schalter aus. Aber auch Motivation, um beim Beispiel zu bleiben, ist ein Prozess.
Mit der eingeschränkten Sichtweise der Problemorientierung klammert man die verschiedensten Prozesse aus. Zum einen übersieht man Coping Strategien, deren sich der Patient bedient, welche ihm im Moment Probleme und Konflikte bereiten, welche er aber auch nicht einfach aufgeben kann. Und so kommt es, dass bestimmte Verhaltensweisen mit fehlender Motivation, einem schwachen Willen oder fehlender Krankheitseinsicht erklärt werden, welche eigentlich Abwehrmechanismen wie Isolieren, Verdrängen, Rationalisieren, Projektionen usw. sind (Coping n. Heim). Hier wird wiederum nur auf das Problem bzw. Symptom geschaut und erwartet, dass der Patient sein Verhalten einfach ändert. Dabei wäre es wichtig, eine Coping Strategie erst einmal als solche zu erkennen und dann vorurteilsfrei anzuschauen. Denn um eine Coping Strategie zu ändern, sie von einer nicht hilfreichen in eine hilfreiche zu verwandeln, braucht jeder Mensch wirkliche Bewältigungsalternativen, die sich nur aus einer individuellen Selbstbefähigung heraus entwickeln können. Und dafür braucht es Zeit, Wertschätzung, empathische Begleitung und eine tragfähige Beziehung.
Ein oft übersehener Coping Prozess ist z.B. der Krankheitsbewältigungsprozess, der laut Kübler Ross in fünf Phasen abläuft. Nach Kübler Ross durchläuft ein Mensch, welcher eine infauste oder auch chronifizierende Prognose erhält, zuerst die Phase der Verdrängung, die durch Verleugnung der beängstigenden Situation gekennzeichnet ist, danach eine Aggressionsphase, in welchem sich die Wut und die Verzweiflung über das eigene Schicksal auf das Außen in unserem Fall z.B. auf das Team richtet, später die Verhandlungsphase, Depressions- und als letztes eine Phase der Lösung und Annahme. Diese Phasen durchläuft jeder Mensch in unterschiedlicher Ausprägung und Dauer und uns begegnen diese Phasen auch oft in der Praxis, leider werden solche Prozesse von Pflegekräften selten gesehen, Aggression häufig abgewehrt, zurückgewiesen und persönlich genommen. Nach meiner Erfahrung geschieht dieser Prozess aber nicht nur bei schweren oder infausten Prognosen, sondern ganz allgemein als Reaktion auf eine Diagnose oder auf die Einschränkung des Lebensgefühls.
Als eine weiteres Argument gegen die Problemorientierung, möchte ich einwerfen, dass man, wenn man nur auf das Problem als solches schaut, die Differenziertheit einer Situation bezüglich ihrer Bedeutung leichter übersieht. Im Umgang mit Individuen können wir nicht jedes Verhalten normativ mit einer Schablone überziehen und bewerten. Der persönliche Lebensprozess eines jeden Patienten fordert, dass ich sein ganz individuelles Verhalten auch in einem ganz individuellen Licht betrachte. Das hieße, es mit seiner Eigenheit, Biographie, dem bisherigen Krankheitsverlauf etc. in einen Kontext zu setzen. Und so kann das gleiche Verhalten zweier Patienten individuell betrachtet, für den einen auch kein Problem, sondern vielleicht sogar ein großer Fortschritt sein:
Wenn bspw. zwei Patienten entschieden und gereizt die Therapie ablehnen, sollte ich möglicherweise versuchen, auf die eine Patientin derart einzuwirken, dass sie doch noch am Frühsport teilnimmt, während ich der zweiten sofort gratuliere und ihr meine Freude über ihren Wunsch zurückmelde und diesen noch verstärke. Zwei diametral entgegen gesetzte Reaktionen auf das gleiche Verhalten? Ja, denn bei der ersten Patientin könnte es sich um eine suchtkranke Patientin handeln, welche den Frühsport stetig unter anderen Begründungen ablehnt, welcher ich durch das Vermitteln einer äußere Struktur helfen könnte und der ich (nach einem Beziehungsaufbau) auch meine Sichtweise zu einem als Vermeidung empfundenem Verhalten darstellen kann, während es sich bei der zweiten Patientin um eine bis dato schwer depressive Patientin mit Schuldgefühlen handeln könnte, welche bisher immer an allem widerspruchslos teilnahm, sich für alles verantwortlich zeigte, alle Stationsdienste übernahm etc. und welche jetzt mir (stellvertretend für ihre Umwelt) ihr erstes NEIN seit langer Zeit entgegenschmettert. Jetzt gegenzusteuern, zu maßregeln oder zu überreden unter dem Motto: „Sie haben doch immer so fein mitgemacht“, könnte diesen ersten kleinen Erfolg schnell wieder zunichte machen.
Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wird aus einer problemorientierten, vereinfachenden und direktiven Sichtweise heraus leider ebenfalls oft übersehen, nämlich krankheitsspezifische Prozesse und Erscheinungen, die einen differenzierten Umgang fordern und nicht vereinheitlicht werden können.
So kann ich mit einer an Korsakow erkrankten Patientin, welche in ihrer Orientierung eingeschränkt ist, keine Tagesstruktur im Sinne einer verhaltenstherapeutischen Maßnahme mehr sanktionieren.
Wenn wir nur auf das Problem, die Symptome und die Diagnose schauen, übersehen wir häufig auch die Ganzheitlichkeit des Menschen, dass nämlich jeder Mensch in seinem Lebensprozess nicht nur Defizite und „kranke“ Anteile, sondern auch immer gesunde Anteile und hilfreiche Ressourcen trägt. Und Ressourcen sind meines Erachtens nach keine Erscheinungen, die man überwiegend vernachlässigen oder vielleicht nur ergänzend nutzen kann, sondern für den Heilungsprozess signifikant wichtig. Der letzte Prozess, den man häufig übersieht oder nicht anschauen möchte, ist der Beziehungsprozess zwischen Patient und Pflegekraft, auf welchen ich jetzt auch etwas genauer eingehen möchte.
1.1.3 Die unreflektierte Beziehung
Nach meiner Erfahrung lehnen viele Pflegekräfte eine theoretische Betrachtung und Beschäftigung mit dem Beziehungsprozess ab, verurteilen dies als zu abstrakt und „zu weit hergeholt“, obwohl Pflegetheorien ja aus der Praxis heraus entstanden sind. Fakt ist, dass wir alle eine „innere“ Theorie von Pflege haben, die sich damit auch auf unsere eigene Art zu handeln und in Beziehung zu gehen, auswirkt. Und diese ganz persönliche Herangehensweise lohnt es sich einmal bewusst zu machen, um wahrzunehmen, ob wir auch tatsächlich eine tragfähige und kongruente Beziehung mit dem Patienten eingehen, oder eingehen wollen. Eine Definition solch einer kongruenten (kongruent = deckungsgleich) Beziehungspflege beschreibt Rüdiger Bauer wie folgt: „Die kongruente Beziehungspflege ist die bewusste Wahrnehmung und die professionelle Bearbeitung und Klärung der interpersonalen und interdependenten Aspekte einer Schwester – Patient - Beziehung im Pflegeprozess“ (Bauer, 1997, Seite 18). Eine unreflektierte Beziehung bedeutet in diesem Zusammenhang für den Pflegeprozess, dass ich meine Eigenanteile und Gefühle, die ich dem Patienten gegenüber habe, nicht wahrnehme, oder mir nicht bewusst mache und sie ihm dadurch auch nicht zurückmelden kann. Es heißt ferner, dass ich nicht weiß, in welcher Rolle sich der Patient mir gegenüber sieht und in welcher Rolle ich ihn sehe bzw. gern haben möchte (bspw. in der Rolle eines dankbaren Kindes, dass ich leiten und bemuttern kann). Weiterhin kann ich in einer unreflektierten, nicht transparenten Beziehung natürlich nicht wissen, welchen Auftrag ein Patient an mich hat und wie es ihm mit mir geht. All diese Dinge liegen dann im Dunkeln, wirken dennoch signifikant auf die Beziehung und somit auch auf den Problemlösungsprozess des Patienten ein. Nach Fiechter und Meier „steht vor einem Problemlösungsprozess der Beziehungsprozess, der den Problemlösungsprozess erst wirksam macht“ (Fiechter und Meier, 1988, Seite 32). Bauer führt dazu noch aus: „Problemlösung und Beziehung stehen selbst in Beziehung zueinander. Diese Beziehung wird aber durch die Beziehung zwischen Schwester und Patient beeinflusst, welche somit letztendlich das Behandlungsergebnis bestimmt“ (Bauer, 1997, Seite 23). Leider scheinen Pflegekräfte die Bedeutung ihrer Beziehung zum Patienten zu unterschätzen, wodurch sie der therapeutischen Beziehung zum Arzt oder Psychotherapeuten die größte Wichtigkeit einräumen und sich in eine ausführende, assistierende Rolle flüchten, vielleicht auch aus Angst, etwas falsch zu machen. Habe ich in der Pflege aber keine transparente und tragfähige, nach Bauer kongruente Beziehung, steigt neben dem verlorenen Veränderungspotential auch die Wahrscheinlichkeit von Konflikten und Problemen in den zwischenmenschlichen Interaktionen sehr stark an.
1.2 Problemorientierte Interaktionen mit dem Patienten
1.2.1 Kontaktaufnahme, Gesprächsführung, Wirken
Die Kontaktaufnahme, welche sich aus einer defizit- und problemorientierten Grundhaltung heraus ergibt, gestaltet sich nach meinen Beobachtungen nicht offen. So bin ich der Meinung, dass wir aufgrund der Diagnose, den anamnestischen Informationen, unseren ersten Eindrücken usw. häufig vorzeitig ein inneres Bewertungs- und Erwartungsmodell entwickeln und daraus auf die Art der durchzuführenden Pflege schließen. Das dadurch gewonnene Modell ist dann sehr manifest und wird auch im weiteren Verlauf nur sehr ungern aufgegeben.
Ein weiteres Merkmal der Problemorientierung ist es, dass wir den Patienten bei der Kontaktaufnahme gelegentlich mit einer Flut von Informationen und auszufüllenden Dokumenten in Form von Hausordnungen, Einverständniserklärungen, Verträgen etc. überfordern, weil unser störungsfreier, zeitsparender Arbeitsablauf über dem aktuellen Befinden des jeweiligen Patienten steht. Dann darf es uns aber nicht verwundern, wenn bspw. ein depressiver, von Insuffizienzgefühlen geplagter Patient mit sechs Aufklärungsbögen, die wir abends von ihm gern zurückhätten, dekompensiert. Aufgrund der Problemorientierung haben wir oft auch viel zu schnell, viel zu viele „gute Ratschläge“ parat, strömen wirklichkeitsfremden Optimismus, nach dem Motto: „unser Doktor wird sie schon richtig einstellen“, oder „das wird schon wieder“ aus, statt erst einmal wert- und vorurteilsfrei anzuerkennen was ist. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, was aus Sicht der Pflegekraft sein darf und wenn wir bspw. Lebensüberdruss im eigenen Umfeld sofort ängstlich abwehren, werden wir natürlich auch große Probleme haben, den Suizidwunsch eines Patienten erst einmal so stehen zu lassen und werden ihn mit Vorwurf, bagatellisierenden Äußerungen oder ähnlichem begegnen, oder die Suizidalität im schlimmsten Fall sogar ignorieren. Ein Problem in der Kommunikation, welche sich wiederum aus nicht gesehenen Prozessen (z.B. Krankheitsprozessen) heraus ergibt ist, dass sie oft nicht auf den individuellen Patienten angepasst wird. Wenn ich bspw. einen dementiell veränderten Menschen laut und unerwartet anrede, ihn dann vielleicht noch mit Informationen überhäufe oder Fähigkeiten in seiner Kognition voraussetze, die dieser schon lange verloren hat, muss ich mit Aggressivität seinerseits rechnen.
Dazu fällt mir eine 86jährige Demenzpatienten ein, die ihr Leben lang als Näherin arbeitete und ärgerlich wurde, als ihr eine Schwester plötzlich die benutzte Serviette aus der Hand riss, welche im Erleben und Handeln der Patientin in diesem Moment ihr Nähgut war.
Eine andere Pflegekraft sprach einen schwer depressiven Patienten (vermutlich aus der eigenen Berührungsangst heraus) überschwenglich heiter an, erläuterte ihn in zwei knappen Sätzen die Fähigkeit des Arztes, Patienten „ richtig einzustellen“ .
Ebenso den Konflikt noch verstärkend wirkte die Reaktion einer Schwester auf das Weglaufen eines schizophrenen Patienten, der aus einem paranoiden Einfall heraus plötzlich fluchtartig die Station verließ, sich glücklicherweise wieder zurückfand und nun von besagter Pflegekraft vorwurfsvoll und entrüstet seine Ausgangssperre anhand der Kurve unter die Nase gehalten bekam (an die ich mich vermutlich auch nicht mehr halten würde, wäre mir die Geheimpolizei auf den Fersen)
Wenn wir Probleme schnell beseitigen wollen, gestaltet sich unsere Gesprächsführung direktiv und bevormundend. Und vergesellschaften sich mit ihr dann noch unreflektierte Eigenanteile, dann ist ein transparenter Beziehungsprozess nicht mehr möglich. Problemorientierte Interaktionen gerade in der Gesprächs-führung führen dann zum Invalidieren des Patienten.
Der Definition nach wird Invalidieren als „jedes Verhalten und jede Äußerung verstanden, die persönliche Erfahrungen und Gefühlsäußerungen der Patienten nicht als gültige Reaktionen auf Ereignisse und inneres Erleben akzeptiert“ (Ahrens, 2004, Handout).
[...]
- Arbeit zitieren
- Marco Helmert (Autor:in), 2005, Prozessorientierte psychiatrische Pflege, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50397
Kostenlos Autor werden
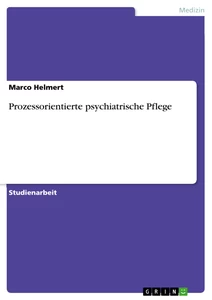



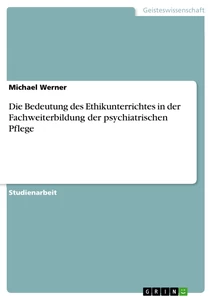


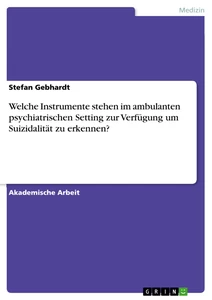









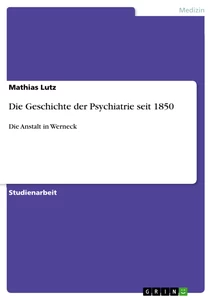


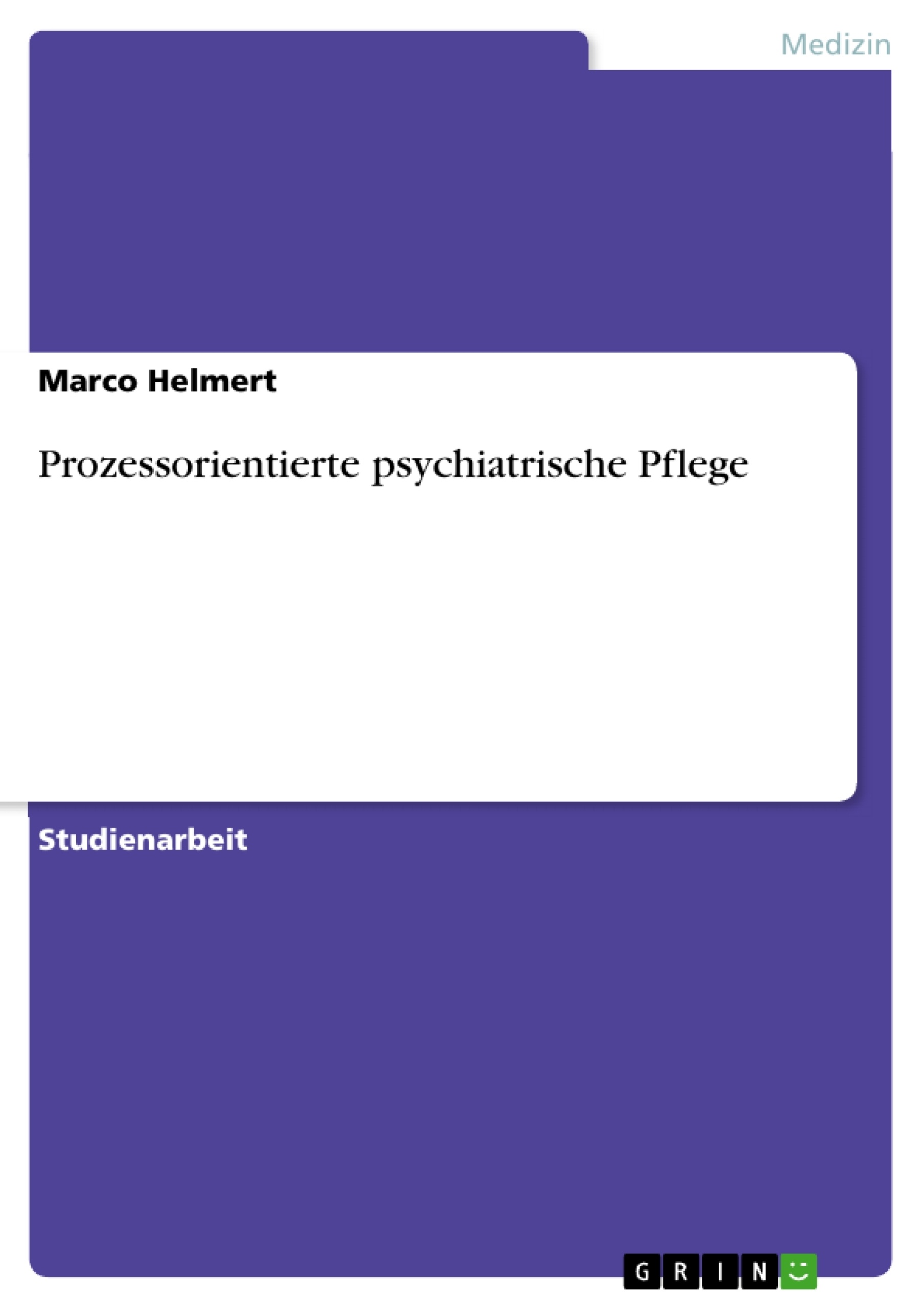

Kommentare