Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Jugendliche und Musik
3. Geschmackskulturen
3.1 Gemeinsamkeiten geschmacklich Gleichgesinnter
3.2 Wahrnehmung der Hörer unterschiedlicher Musikgenres
4. Musik und Identität
4.1 Sozialer Kontakt
4.1.1 Bedürfnis nach Freundschaft
4.1.2 Bedürfnis nach Zugehörigkeit
4.2 Ausdruck der Identität
4.2.1 Musikgeschmack und Badge-Funktion
4.2.2 Gruppenmitgliedschaft und soziale Identität
4.2.3 Sozialer Einfluss
5. Konklusion
5.1 Zusammenfassung
5.2 Abschliessende Bemerkungen
6. Literatur
Abbildungen
Abbildung 1: Heider’sche Triade am Beispiel der Zuneigung zu Jazzmusik 11
Abbildung 2: Beziehung zwischen Gefallen und Stimulus-Erregungspotential 224
1. Einleitung
Im Zuge der Verbreitung elektronischer Medien in Form von Schallplatten, Kassetten und CDs und der massenmedialen Streuung von Inhalten über Radio, Fernsehen und Internet, ergeben sich vermehrt Möglichkeiten, sich der Musik auszusetzen. Betrug der jährliche Verkauf der amerikanischen Musikindustrie 1967 erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar, so durchbrach er 1973 die Schranke von zwei Milliarden Dollar und machte 1994 bereits über zwölf Milliarden Dollar aus (Zillmann & Gan, 1997, S. 161). Der Stellenwert der Musik ist aber nicht nur in kommerzieller Hinsicht stark gestiegen, sondern hat auch im Leben der Hörer einen wichtigen Platz erobert.
Unter diversen Funktionen, die Musik im Alltag des Menschen erfüllt, befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, wie sie von Jugendlichen auf der Suche nach der eigenen Identität genutzt wird. Aus sozialpsychologischer Perspektive betrachtet soll untersucht werden, wie der Konsum von Musik und die damit verbundene Einordnung in ein System unterschiedlicher Geschmackskulturen, als Mittel zur Definition des Selbstkonzeptes eingesetzt werden können. Es soll gezeigt werden, inwiefern der eigene Musikgeschmack zum Ausdruck der Persönlichkeit verwendet werden kann.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist es wichtig, eine eindeutige Begrifflichkeit für die Neigung zu bestimmter Musik zu verwenden. Über unterschiedlichste Studien hinweg betrachtet, ist sie aber nicht einheitlich und kann deshalb zu Missverständnissen führen (Behne, 2002, S. 339). Behne führt hierzu den Vorschlag Abeles’ (1980) an, zwischen aktuellen Entscheidungen (preferences / Präferenzen) und langfristigen Orientierungen (taste / Geschmack) zu unterscheiden (ebenda). „Der umgangssprachliche und sehr diffuse Begriff des Musikgeschmacks könnte demnach sinnvoll global für den Gesamtkomplex verwendet werden, Musikpräferenz hingegen für das Entscheidungsverhalten in definierten, konkreten Situationen“ (ebenda, Hervorhebungen D.B.). Diese Begrifflichkeit soll auch für die vorliegende Arbeit verwendet werden. Es gibt aber auch „Autoren, die unter Musikpräferenz ein ‚gewachsenes, langfristig relativ stabiles System von durch Erfahrung erworbene[n] Wertorientierungen’ ... verstehen“ (z.B. Jost, 1982, S. 246; zit. nach Behne, 2002, S. 340). „Konkreter definiert als der Geschmacksbegriff ist hingegen der aus der Sozialpsychologie stammende ... Terminus der
(musikalischen) Einstellung“ (Behne, 2002, S. 340, Hervorhebung D.B.). Hierbei handelt es sich um einen „seelische[n] und nervliche[n] Bereitschaftszustand, der, durch Erfahrung organisiert, einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktion des Individuums ... ausübt“ (Kloppenburg, 1987, S. 188; zit. nach Behne, 2002, S. 340).
2. Jugendliche und Musik
Bisherige Studien, welche die Musikrezeption und seine identitätsdefinierende Funktion untersucht haben, fokussierten fast ausschliesslich auf die Jugend. Kein anderer Lebensabschnitt scheint stärker vom Bedürfnis nach Musik eingenommen zu sein. „In diese Zeit fällt ein deutlich erhöhter Musikkonsum, der stark emotionalisiert und in der jugendlichen Gleichaltrigenkultur fest verankert ist“ (Dollase, 1997, S. 257). Erstaunlich ist vor allem der rasante Anstieg des Musikinteresses um die Zeit der Pubertät herum und der ebenso schnelle Abfall in der Mitte des dritten Lebensjahrzehnts (ebenda). In der Jugend wird mehr gehört, mehr über Musik geredet, mehr an Informationen über Musik gesucht und mehr über Musik diskutiert als beim Durchschnittsmenschen in fortgeschritteneren Lebensjahren. Von einer regelrechten „Musikphase“ oder einem „Musikalter“ könne man hier reden, meint Dollase (1997, S. 257), wobei nahezu jeder Jugendliche in der einen oder anderen Form davon erfasst werde.
Die Pubertät ist die Zeit, in der Gruppen Gleichaltriger (Peergroups) neben den Eltern eine wachsende Bedeutung bekommen. „Gerade in Bereichen der Ich-Findung und der Bewältigung emotionaler Inanspruchnahme spielen Freundinnen und Freunde eine wesentliche Rolle“ (Baacke, 1997a, S. 14). So sind es denn auch die Peergroups, in denen nun vorwiegend Musik gehört wird. Baacke sieht in diesem Lebensabschnitt die „sensiblen Jahre, in denen das soziale Beziehungsgeflecht sich neu strukturiert“, und genau hier sei es „die Musik, die in verstärktem Masse nicht nur Situationen klanglich grundiert, sondern emotionale Stimuli oder auch emotionale Verarbeitungshilfen bietet“ (ebenda). So könne sich etwa eine Schülerin nach Stress in der Schule in die Klangwelt des Pop zurückziehen. Musik ist laut Baacke für Jugendliche ein „Bestandteil ihrer Existenzerfahrung“ (ebenda). Sie wird erfahren als „ein ganzheitliches, lebensweltübergreifendes Spektrum, in dessen Brechungen die Suche nach dem Ich ihre Orientierungsmuster wählt“ (ebenda).
Die Intensität, mit der sich Jugendliche bestimmten Musikarten zuwenden, ist „ein Zeichen für die Tiefe ihres Erlebnishungers und zugleich ein Zeichen für den Mangel an Erlebnismöglichkeiten in unserer realen Welt“ (Jerrentrup, 1997, S. 88). Jerrentrup zieht hier eine Parallele zum Interesse an Freizeitaktivitäten wie „Free Climbing“, „Bungee Jumping“ oder „River-Rafting“. Man könnte auch sagen, Musik fungiere in dieser Zeit als „Ventil oder Kompensation gegenüber Frustrationen, die aus Eingrenzungen von Lebensmöglichkeiten resultieren“ (ebenda, S. 89). Dies wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass Mitte zwanzig[1] das Interesse an Musik nachlässt, denn Erwachsene, die fest sozialisiert sind und in diesem System ihren Platz errungen haben, werden dieses Gefühl so nicht mehr nachempfinden können. In diesem Zusammenhang spricht Dollase von der „Abschwungphase“ (Dollase, 1997,
S. 360) junger Menschen und ist zur Erklärung um verschiedene Thesen bemüht:
- Der junge Erwachsene etabliert sich im Beruf, er gründet eine Familie, hat andere Ziele und findet schliesslich nicht mehr so viel Zeit und Gelegenheit, am Musikbetrieb derart intensiv teilzunehmen wie früher.
- Er erkennt, dass die symbolischen und, je nach Schicht, anderen Funktionen, die er in der Jugend der Musik zugeschrieben hat – als Ausdruck seiner Lebenshaltung, zur Erleichterung seiner Probleme, zur Findung der Individualität oder auch nur zur Entspannung und Unterhaltung et cetera – den nun einsetzenden Sachzwängen eines etablierten Erwachsenenlebens nicht gewachsen sind. Musik erhält einen weniger bedeutsamen Stellenwert – sie hilft ihm im Leben nicht mehr mit dergleichen Intensität wie früher.
- Er fühlt sich in der nachwachsenden Jugend deplatziert, er gerät als Älterer an den Rand der Altersverteilung und empfindet den Zwang, sich anders zu verhalten und neue Formen des Musik- und Kulturkonsums für sich zu finden.
- Das Leben in einer homogenen Gleichaltrigenkultur wird mit der beruflichen und familiären Etablierung und Mobilität unmöglich – ein wichtiger Stützfaktor entfällt. Es ist keineswegs zwingend anzunehmen, dass die emotionale, soziale und geistige Bereicherung durch Teilhabe an der Musikkultur im Erwachsenenalter naturgegeben nachlässt, sondern eher, dass ein wichtiger Bereich der personalen Selbstverwirklichung durch andere Ursachen beiseite gedrängt wird.
Die „Alterstheorie“ (Mende, 1991) geht demgegenüber davon aus, dass musikalische Präferenzen sich in Abhängigkeit vom Alter verschieben. So wird meistens nach der Jugend von der Rock- und Popmusik zum Schlager übergewechselt, weil Musik nur noch nebenbei gehört wird. „Selbst von Angehörigen der ‚Beat-Generation’ sowie nachfolgender jüngerer Generationen wird jenseits des Jugendalters der Schlager ... präferiert“ (Mende, 1991; zit. nach Müller, 1994, S. 72). Dieser Zusammenhang gilt aber offenbar nur für Menschen, bei denen es auch in der Jugend auf die Musik selbst nicht besonders ankam, solche, die in der Jugend Musik hörten, weil Musik zum „Jugendlichendasein“ dazugehörte (ebenda) und nicht in starkem Masse der Identitätspräsentation und Selbstbildung diente (Müller, 1994, S. 72). Anders scheint es sich nämlich zu verhalten bei Menschen, die sich in ihrer Jugend für Musik besonders interessieren und bei denen eine sehr intensive und kenntnisreiche Beziehung zur Musik besteht. „Sie bleiben über das Jugendalter hinaus so an Musik interessiert, dass sie neue Entwicklungen des von ihnen präferierten Genres mit Interesse verfolgen. Ihre Beziehung zur Musik ist als eher unabhängig vom Alter anzusehen“ (ebenda).
3. Geschmackskulturen
3.1 Gemeinsamkeiten geschmacklich Gleichgesinnter
Identische Lieblingskünstler und Lieblingssongs scheinen nicht die einzigen Gemeinsamkeiten musikalisch ähnlich orientierter Jugendlicher zu sein. Offensichtliche Ähnlichkeiten zeigen sich manchmal sogar im Aussehen. Die Einordnung distinkter Subgruppen wie den Punks oder den Anhängern des Gothic Rock beispielsweise, ist aufgrund typischer Kleidung, Frisur und Make-Up relativ einfach.
Neben visuellen Kennzeichen können Anhänger verschiedener Musik-Genres aber auch charakterliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Little und Zuckerman (1986) beobachteten zum Beispiel, dass der Hang zu Sensationslust positiv korreliert mit der Präferenz von Rock, Heavy Metal oder Punk und negativ korreliert mit der Vorliebe für Soundtracks oder religiöse Musik. Eine amerikanische Studie (Rentfrow & Gosling, 2003) suchte nach Verbindungen zwischen Musikpräferenz und Persönlichkeitsmerkmalen. Die Probanden gaben dabei ihre persönlichen Musikpräferenzen an und beantworteten anschliessend Fragen zu ihrer Persönlichkeit. Hierbei wurden die gängigen musikalischen Vorlieben in vier Dimensionen eingeteilt: Komplexe, nachdenkliche Musik (z.B. Klassik und Blues), intensive, rebellische Musik (Heavy Metal und Rock), konventionelle oder Upbeat-Musik (Pop und Country) sowie energische, rhythmische Musik (Funk, Rap, Electronica). Erstgenannter Dimension (nachdenkliche Musik) wurden Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit für neue Erfahrungen, selbstwahrgenommene Intelligenz oder politische Liberalität zugeschrieben, während eine negative Korrelation mit dem Attribut Dominanz beobachtet wurde. Die Anhänger rebellischer Musik wurden ebenfalls als offen und intelligent (in der Selbstwahrnehmung) eingestuft, während Liebhaber konventioneller Musik offenbar eher extrovertiert, liebenswürdig und politisch konservativ sind. Bei Fans energischer Musik schliesslich wurden positive Beziehungen zu den Attributen angenehm, extrovertiert und politisch liberal festgestellt. Die Studie konnte zeigen, dass die Persönlichkeit einen Einfluss hat auf die Musikpräferenzen.
Dass die absolute Wahrheit (z.B.: „Pop-Fans sind konservativ!“) in solchen Studien vergeblich zu suchen ist, zeigen die teilweise voneinander abweichenden Ergebnisse verschiedener Untersuchungen. Brauchbar ist aber die Erkenntnis, dass unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale im Zusammenhang stehen mit unterschiedlicher Musikpräferenz. Ein weiteres Problem stellt die steigende Diversifikation der Musikstile dar. Die grosse Anzahl der Genre-Bezeichnungen macht eine Einordnung in einige wenige Kategorien immer schwieriger; dies zeigen die verschiedenen Studien, in welchen solche Einteilungen teils erheblich divergieren und die Studien deshalb untereinander kaum verglichen werden können.
Unterscheidungsmerkmale von Anhängern bestimmter Musikgenres können auch demografischer Natur sein. Einige Studien widmen sich der Aufgabe, Musikpräferenzen mit spezifischen Einordnungen nach Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder sozialer Klasse in Beziehung zu setzen. Skipper (1973; zit. nach Zillmann & Gan, 1997, S. 166) hat in diesem Zusammenhang bei amerikanischen Schülern beobachtet, dass klassische Musik mehr Anziehungskraft auf Frauen als auf Männer ausübt, ebenso wie auch auf Weisse mehr als auf Afroamerikaner. Weiter konnte Skipper zeigen, dass die Vorliebe für klassische Musik mit absteigendem sozialem Status abnimmt. Dieser Zusammenhang könnte damit erklärt werden, dass kaum eine Tätigkeit der Jugendlichen so stark vom häuslichen Bildungshintergrund bestimmt ist wie das Instrumentalspiel. Entsprechend prägt möglicherweise nichts so stark wie jene Musik, die man selbst gespielt hat. Von daher ist es verständlich, dass klassische Musik stets wesentlich häufiger von Abiturienten, Popmusik hingegen eher von Volks- und Hauptschülern geschätzt wird (Behne, 2002, S. 347). Auch die Präferenz des Genres Folk nimmt laut Skipper (1973) mit absteigendem sozialen Status ab. Die Präferenz von Pop- und Rockmusik hingegeben war – abgesehen von einer geringeren Zuneigung der Afroamerikaner – über Geschlecht und soziale Klasse hinweg einheitlich. Die Vorliebe für Hard Rock,
Rhythm ’n’ Blues und Jazz stand schliesslich im Gegensatz zu jener für Klassik und Folk und betraf Männer stärker als Frauen, Afroamerikaner eher als Weisse sowie Personen mit niedrigerem sozialen Status öfter als Gegenteilige.
3.2 Wahrnehmung der Hörer unterschiedlicher Musikgenres
Im Wissen über bestehende Gemeinsamkeiten der Hörer bestimmter Musikgenres, ist die Vorstellung nicht weit, dass ein Bedürfnis besteht, diese Gruppen zu normieren und mit entsprechenden Attributen zu versehen. So gibt es „stereotype Vorstellungen ... über Menschen, denen man unterschiedliche musikalische ‚Standorte’ zuschreibt ...“ (Behne, 1991, S. 285). „Die stereotypisierte Wahrnehmung von Mitmenschen basiert aber nicht nur auf deren äusserer Erscheinung und anderer einfach erkennbarer Charakteristika“ (Knoblauch et al., 2000, S. 19) wie zum Beispiel dem Geschlecht oder der ethnischen Zugehörigkeit.
Neben dem Verhalten, über das erst nach längerer Zeit und anhand gegebener Gelegenheiten ein Urteil möglich ist, fungieren auch Informationen zu Geschmack ... und Lebensstil als wichtige soziale Indikatoren. In einer differenzierten modernen Gesellschaft, in der Beruf, Bildungsstand und Einkommen nicht mehr zur Definition der sozialen Position eines Individuums ausreichen, dienen vermehrt auch ‚alltagsästhetische Schemata’ [Schulze, 1995] ... der Distinktion und Zuordnung im sozialen Raum (Knoblauch et al., 2000, S. 19).
Für Knoblauch et al. liegt es nahe, dass solche „alltagsästhetischen Schemata“ für die soziale Kategorisierung und Stereotypenbildung herangezogen werden. „Entsprechend ist zu vermuten, dass bei der Bildung eines ersten Eindrucks über eine Person von Informationen zu deren Lebensstil und Geschmack auf die Gruppenzugehörigkeit dieser Person und auch auf deren Persönlichkeit im engeren Sinne geschlossen wird“ (ebenda).
In einer Studie aus den siebziger Jahren wurde untersucht, was Jazzhörer über Schlagerhörer, und umgekehrt, Schlagerhörer über Jazzhörer denken (Fremdbild), aber auch, wie sie sich jeweils selbst sehen (Selbstbild) (ohne Quellenangabe; zit. nach Behne, 1991, S. 285-286). Dabei zeigten sich „geradezu dramatische Differenzen in der Zuweisung von Bildungsstatus und politischem Standort“ (ebenda, S. 285). So halten sich Jazzhörer selbst für ungewöhnlich gebildet und zugleich den Schlagerhörer für ziemlich ungebildet. Ähnliche Unterschiede – wenngleich nicht in dieser Ausprägung – vermuten sie hinsichtlich einer eher liberalen beziehungsweise eher konservativen politischen Orientierung. Mehr als bemerkenswert ist, dass die Schlagerhörer selbst – in etwas abgemilderter Form – der gleichen Auffassung sind: Sie halten sich sogar selbst für weniger gebildet und weniger liberal als Jazzhörer. Zwar ist bekannt, dass Bildungsstatus und politischer Standort sehr wohl auch Einfluss auf die musikalische Orientierung haben (siehe Kap. 3.1), doch zeigt sich hier, dass „je nach Perspektive [Fremdbild / Selbstbild], bestimmte Aspekte akzentuiert, andere verharmlost werden, naheliegenderweise in der Absicht, das Selbstbild zwar schon realistisch, aber doch auch noch so positiv zu zeichnen, dass man mit ihm ohne Leidensdruck leben kann“ (Behne, 1991, S. 286).
Eine andere Studie (Zillmann & Bhatia, 1989) untersuchte, wie einzelne Individuen charakterlich beurteilt werden, nachdem sie sich zu ihrer Musikpräferenz bekannt haben. Dabei wurden in zwei kurzen Videosequenzen ein Mann und eine Frau präsentiert und ihnen manipulativ unterschiedliche Musikpräferenzen attribuiert. Probanden der Kontrollgruppe erhielten keine Informationen über die musikalischen Vorlieben der vorgestellten Personen. Das Verraten des Musikgeschmacks hatte einen beträchtlichen Einfluss auf die Wahrnehmung dieser Individuen: Männer beurteilten Frauen, die Klassik mochten, als kultiviert und solche, die Heavy Metal mochten, weniger. Frauen hingegen beurteilten Männer, die Klassik und solche die Heavy Metal mochten gleichermassen kultiviert.
[...]
[1] Die Zuordnung bestimmter Altersangaben muss flexibel gedacht werden. Eine erhebliche Schwankung ist möglich.
- Arbeit zitieren
- Dieter Boller (Autor:in), 2006, Musikgeschmack und Identität. Soziale Konsequenzen von Musikpräferenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50352
Kostenlos Autor werden

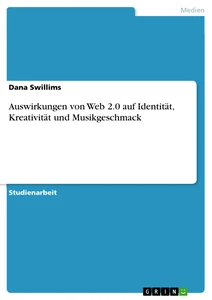
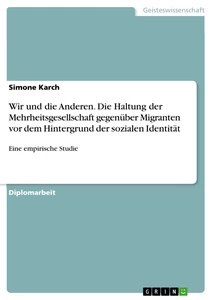

















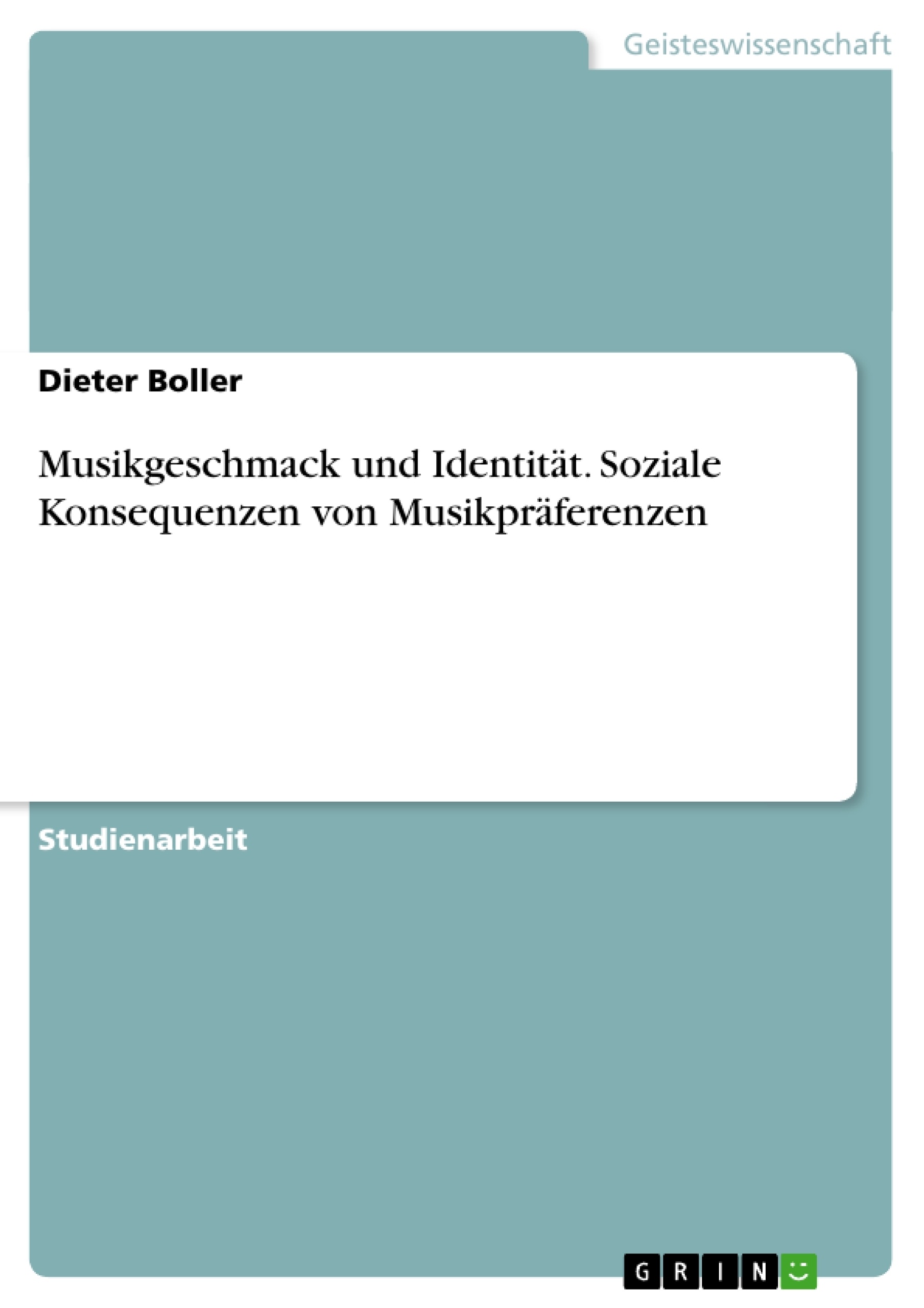

Kommentare