Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Hauptteil
2.1 Geschichte der Drogenkonsumräume in Frankfurt
2.2 Von der Kriminalisierung zur Pathologisierung
2.3 Etikettierungsansatz
2.4 Ausschluss aus sozialem und physischem Raum
2.5 Konsumraum als Instrument der Kontrolle
2.6 Positive Aspekte für Konsumierende
3 Fazit
4 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema des Ausschlusses in Bezug auf Drogenkonsumräume und deren Besucher und geht der Frage nach, ob dieses Instrument der Drogenhilfe dazu beiträgt, dass Konsumierende Teil der Gesellschaft bleiben beziehungsweise werden oder ob durch die räumliche Abgrenzung und Stigmatisierung das Gegensätzliche, also die Ausschließung, befördert wird. Zu betrachten sind dafür die Entwicklungen der Drogenhilfe ab 1980 bis hin zum akzeptierenden Ansatz, welcher Konsumräume beinhaltet und stark fördert. Dieser Ansatz vertritt überwiegend die Auffassung, dass die Vorteile der Konsumräume ausschlaggebend sind und im Sinne der Konsumierenden gehandelt wird. Das wechselnde Etikett von Kriminalität hinzu Krankheit wird durch den „labeling-approach“-Ansatz verdeutlicht und steht im Zusammenhang mit Ausschluss aus dem sozialen und physischen Raum. Dies ist zu beleuchten, auch in Bezug auf Kontrolle durch staatliche Institutionen und deren Teilhabe, durch Finanzierung und dadurch resultierender Entscheidungsgewalt. Zuletzt sind die positiven Aspekte der Konsumräume aufzuführen, um eine Abwägung treffen zu können, inwieweit Konsumräume im Sinne von Konsumierenden sind.
Exemplarisch werden dazu oftmals die Erfahrungen aus der Stadt Frankfurt am Main herangezogen. Durch die vielen Drogenkonsumräume und den sogenannten „Frankfurter Weg“ ein Symbol der akzeptierenden Drogenarbeit. Im Laufe der Gentrifizierung des Frankfurter Bahnhofsviertels im letzten Jahr, ist es wichtig, sich mit Ausschluss der Konsumierenden aus dem öffentlichen Raum zu beschäftigen und deren Hintergründe zu hinterfragen. Generell ist die Frage, ob die Akzeptierende Drogenhilfe mit Konsumräumen einen sicheren Ort geschaffen hat, oder ob der Weg zur wirklichen Akzeptanz noch weitergehen muss. In diesem Kontext sind das aktuelle Betäubungsmittelgesetz und die aktuelle Kontrollpolitik in Kooperation mit der Polizei relevant. Oftmals sehen sich Drogenkonsumierende mit einem Stigma konfrontiert und unter Generalverdacht gestellt, dessen Förderung durch Drogenkonsumräume und der daraus oft resultierende Verweis von öffentlichen Plätzen soll in Zusammenhang gestellt werden. Zu Beginn ist die Entwicklung der Drogenhilfe in Frankfurt und speziell der Drogenkonsumräume zu betrachten.
2 Hauptteil
2.1 Geschichte der Drogenkonsumräume in Frankfurt
Bis zum Anfang der Achtzigerjahre war die Drogenhilfe geprägt durch Repressionen und Abstinenzorientierung, dann entstanden „Initiativen, die sich explizit als Teil einer Bewegung gegen das bis dahin vorherrschende Verständnis der Entstehung, des Verlaufs und der Beendigung von Sucht wendeten“ (vgl. Stöver 1999). Zurückzuführen ist dies auf die in diesem Zeitraum steigende Anzahl an Neuinfektionen mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) bzw. AIDS-Erkrankungen und eine erhöhte Anzahl der Drogentodesfälle, die eine Umorientierung im Denken und Handeln notwendig machten. So stieg die Zahl der Todesfälle in Deutschland von 324 im Jahr 1985 auf 2125 im Jahre 1991. Vor diesem Hintergrund wurde eine Handlungsnotwendigkeit gesehen. Dies fand seinen Ausdruck in der Gründung des Bundesverbandes für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik „Akzept e. V“ im Jahre 1990 in Bremen. 1998 setzte die neue rot-grüne Bundesregierung weitere Entwicklungen in Gang, das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) wurde dahingehend geändert, dass es nun eine Rechtsgrundlage für den Betrieb von Drogenkonsumräumen gab. In §10a des BtMG wird bestimmt, dass die Länder entsprechende Verordnungen erlassen können. Die „Umorientierung drückte sich in neuen Begriffen aus: ‘nicht-bevormundende‘, ‘suchtbegleitende‘, ‘offensive‘, ‘klientenorientierte‘ oder ‘niedrigschwellige‘ Drogenarbeit“ (Stöver 1999). Schmid (2003) merkt außerdem in dem Zusammenhang an, dass mit dem Akzeptanzbegriff ein Wort für die Ausrichtung gefunden worden war, „dass Marketing-Experten nicht besser hätten auswählen können“. Als elementares Ziel dieser Ausrichtung, und somit auch der Konsumräume, sind Angebote, die den Konsumierenden das Überleben sichern und die soziale Desintegration verhindern sowie für die gesundheitliche und psychosoziale Stabilisierung sorgen (vgl. Schneider 2006). Bereits im Dezember 1994 wurde mit dem „Eastside“ in Frankfurt Deutschlands erster offizieller Konsumraum eröffnet, im Mai und September des Folgejahres kamen das „La Strada“ und der Konsumraum in der Niddastraße hinzu. 1996 ergänzte der Drogennotdienst mit dem Konsumraum in der Elbestraße das Angebot in Frankfurt. Anzumerken ist, dass außer dem „Eastside“ alle anderen Einrichtungen im Bahnhofsviertel angesiedelt sind, was eine Verlagerung von dem früheren Szeneplatz rund um die Taunusanlage hin zum Bahnhofsviertel deutlich macht. In allen vier Konsumräumen wurden im Jahre 2013 mehr als 191.700 Konsumvorgänge gezählt (vgl. Auswertung der Frankfurter Konsumraumdokumentation 2013).
2.2 Von der Kriminalisierung zur Pathologisierung
Der Weg von der abstinenzorientierten Hilfe hin zur akzeptierenden Drogenhilfe war lang. Im Jahre 1920 gab es erstmals ein verbindliches „Regelsystem für die Produktion, den Import, den Export und die Abgabe von Rohopium, Opium, Morphin, Kokain, Heroin und andere Zubereitungen aus diesen Substanzen“ (Schmid 2003) und somit wurde eine Unterteilung von legalen und illegalen Drogen geschaffen. Bis 1971 wurde dieses Opiumgesetz kaum verändert und mit ihm kam eine Verbots- und Kontrollpolitik, welche weitgehend erfolglos blieb. Die Zahlen der Drogentodesfälle und sichergestellten Drogen wuchsen stetig (vgl. Bundeskriminalamt 2001). 1971 trat mit dem Betäubungsmittelgesetz ein neues, verschärftes, strafrechtliches Instrument in Kraft. Der Konsum selbst unterliegt zwar keinem Verbot, jedoch der Erwerb und Besitz sowie die Beschaffung einer Konsumgelegenheit (vgl. Lange 1989). Drogenkonsumierende wurden somit stärker kriminalisiert. Die Therapie war geprägt durch vorige „kalte“ Entgiftung und Isolation. Wie oben geschildert, folgte dann durch verschiedene Faktoren die Umstrukturierung zur akzeptierenden Drogenhilfe mit zieloffenem Konzept. 1990 entwickelten Vertreter von verschiedenen Städten die „Frankfurter Resolution“ und hielten fest: „Hilfe für die Süchtigen darf nicht im Schatten der strafrechtlichen Verfolgung stehen, sondern muss zusammen mit Prävention und Erziehungsarbeit gleichrangiges Ziel der Drogenpolitik sein“ (vgl. Frankfurter Resolution 1990). Inwieweit dieser Ansatz innerhalb von Konsumräumen umgesetzt werden kann und inwieweit er zur Partizipation in der Gesellschaft beiträgt, gilt es nun zu betrachten.
2.3 Etikettierungsansatz
Menschen, die Drogen konsumieren, werden oft stigmatisiert. Bei der Betrachtung der Ursachen und des in Folge dessen zustande kommenden Ausschlusses, ist der Etikettierungsansatz (engl. labeling approach) interessant.
Deviantes Verhalten, Verhalten das von geltenden Normen abweicht, ist im Sinne des Etikettierungsansatzes keine zu bewertende Handlung, sondern entsteht erst im Zuge gesellschaftlicher Interaktion als „eine Zuschreibung der Eigenschaft, eine Konsequenz der Anwendung von Regeln und Sanktionen durch andere“ (Becker 1973). Also ist abweichendes Verhalten nicht von der Natur aus deviant, sondern wird von der Gesellschaft als abweichend definiert.
In Bezug auf Heroinkonsum ist dabei zu sehen, dass dieser auch in Deutschland nicht immer als abweichend galt. 1898 meldete die Pharmafirma BAYER ein Patent auf ein neues Hustenmittel namens Heroin an. Der Stoff hieß Diacetylmorphin, welcher aus Morphin synthetisiert wird. Das Medikament wurde bald auch bei verschiedenen anderen Erkrankungen wie Herz- und Blutdruckerkrankungen angewendet. Erst 1920 wurde mit den oben beschriebenen Regelungen Heroin- und Opiumkonsum als abweichend definiert und im Jahre 1971 durch das Betäubungsmittelgesetz kriminalisiert (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V).
Stigmatisierung wird nicht für ein Merkmal verwendet, sondern für eine negative Zuschreibung zu einer bestimmten Handlung. Es basiert auf Verallgemeinerungen, die übernommen wurden, ohne sie nochmal zu überprüfen. Häufig knüpfen Stigmatisierungen an sichtbare oder unsichtbare Merkmale von Personen an. Der Drogenkonsumierende, konsumiert also nicht nur Drogen, er ist auch „schmutzig“, „kriminell“, „verzweifelt“ oder „krank“. Es wird deutlich, dass die zugeschriebenen Merkmale objektiv oft nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun haben (vgl. Peters 2009). Der Etikettierungsansatz basiert auf der theoretischen Grundlage des „Symbolischen Interaktionismus“, welche sagt, dass menschliches Handeln erst durch die Beurteilung von der Gesellschaft Wert oder Sinn bekommt. Dadurch werden Ordnungen und Strukturen mit dem Etikett „normal“ geschaffen und jedes Verhalten, das dieser Definition widerspricht, gilt als abweichend und wird sanktioniert (vgl. Brusten 1973). Durch die Definition von Drogenkonsum als abweichendes Verhalten von der Norm entsteht ein Stigma für Konsumierende. Bei fortlaufendem Konsum werden sie durch Strafen und Verbannung von Orten sanktioniert. Auch durch die Entwicklung von Konsumräumen wird das Stigma verstärkt, da so definiert wird, dass ein besonderer Ort für dieses Verhalten benötigt wird. Jeder neue Konsumraum macht deutlich, welche Räume eben nicht für Konsumierende zugänglich sind (vgl. Schmidt-Semisch und Wehrheim 2007). Nach Semisch und Wehrheim ging es der offiziellen Drogenpolitik „zu keinem Zeitpunkt um eine wirkliche Akzeptanz des Drogenkonsums oder gar der Konsumierenden, sondern lediglich um einen partiellen Austausch der Defizit-Ideologien von Kriminalität und Krankheit“. Die Zuschreibung der Kriminalität wurde in der Drogenhilfe durch die Zuschreibung Krankheit abgelöst. Scheerer vergleicht im Zuge seiner Kritik den Prozess mit der Entkriminalisierung von Homosexualität. Hier wurde sich jedoch nicht darauf beschränkt, die Zuschreibung zu wechseln, sondern es wurde eine Loslösung angestrebt. Bezogen auf die Drogenkonsumräume verstärken diese das Etikett „Krankheit“ weiter, da ein extra Raum deutlich macht, dass Bedarf für eine besondere Räumlichkeit und Behandlung bestünde. Spritzentausch und Safer-Use Aufklärung finden nur in ausgewiesenen Drogenkonsumräumen statt, in welchem sich Konsumierende dem Stigma stellen müssen, sobald sie diese betreten. „Stigmas bedeuten für die Betroffenen eine folgenschwere Ächtung der eigenen Lebensrealität“ (Stöver 2016). Konsumierende setzen sich mit dem Besuch automatisch dem Urteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Umgebung und der Gesellschaft aus, unabhängig deren Haltung. Es geschieht ein sogenannter „Othering-Prozess“.
Der Begriff „Othering“ (von engl. other = andersartig) beschreibt den Gebrauch von und die Distanzierung zu anderen Gruppen, um eine Abgrenzung vorzunehmen. Es werden also gleichzeitig ein Vergleich und eine Differenzierung gebraucht. Oftmals wird dieser Prozess von „mächtigeren“ Leuten geführt (Spivak 1985), was impliziert, dass Nicht-Drogenkonsumierende ein Mächtigkeitsgefühl gegenüber Konsumierenden besitzen. Drogenkonsum wird als von der Norm abweichend, also als andersartig eingestuft. Ein Mensch, der keine Drogen konsumiert, vergleicht dieses Verhalten mit dem eines Konsumierenden und fühlt sich besser, beziehungsweise überlegen, da sein Verhalten der Norm entspricht.
2.4 Ausschluss aus sozialem und physischem Raum
Ausschluss kann durch sozialen und physischen Raum verstärkt werden. Der soziale Raum wird von Kronauer als „Abstände, die durch Differenz von Macht und Machtlosigkeit, Anerkennung und Nicht-Anerkennung im Verhältnis unterschiedlich positionierter sozialer Kategorien zueinander geschaffen werden“, beschrieben, während physische Orte Plätze und Gebäude beinhalten. Diese Ausgrenzung kann man in zwei verschiedene Kategorien einteilen, einmal in erzwungene Mobilität und in erzwungene Immobilität (vgl. Kronauer 2008). In Bezug auf Drogenkonsumräume kann man beide Kategorien finden, einmal der Verweis von öffentlichen Orten wie Bahnhöfen oder Plätzen für den Konsum und somit auch der Zwang zum Konsum in den zugewiesenen Räumen. Verdeutlicht wird dies durch die Aussage: „Die vermeintliche Akzeptanz des Fixerraums legitimiert hierbei ein Verständnis des öffentlichen Raums als No-Go-Area für diesen Personenkreis“ (vgl. Schmidt-Semisch/Wehrheim 2007).
Im Falle der Frankfurter Drogenszene verlagerte sich die Szene an einen Ort, in diesem Fall das Bahnhofsviertel, in welchem sich drei Drogenkonsumräume befinden. Die Szene hält sich auch oftmals unabhängig vom Konsumvorgang in diesem auf, da die Konsumierenden dort ihr komplettes soziales Netz und ihren Lebensmittelpunkt haben.
Eine Studie vom Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Drogenkonsumräume das Stadtviertel, in dem sie ihren Standort haben, „entlasten“. Gemeint ist damit, ob sich die Anzahl der Drogenkonsumierende auf der Straße verringert oder gar erhöht. Auch wenn die Formulierung „Entlastung“ zu hinterfragen ist, da diese Etikettierung impliziert, dass der Stadtteil Schaden durch bestimmte Personengruppen nimmt, ist die Betrachtung der Zahlen spannend. Es zeigt, inwiefern die Verankerung in einem Stadtteil und somit der Ausschluss aus dem Rest der Stadt von Drogenkonsumräumen abhängig sein könnte. Michael Prinzleve und Marcus-Sebastian Marten haben an 20 Tagen, immer zu den gleichen Zeitpunkten, während der Öffnung des in der Nähe liegenden Konsumraums, nach der Schließung und an Tagen, in denen ganztätig geschlossen war, Drogenkonsumierende auf der Straße gezählt. Die Ergebnisse der Zählungen zeigen, dass Konsumräume eine hohe Anziehungskraft auf Konsumierende haben. Jedoch zeigt die Zählung auch, dass sich die Anzahl der Konsumierenden auf der Straße nicht mal halbiert, von 112 auf 59, sobald die Einrichtung geöffnet hat (vgl. Prinleve /Marten Tabelle 4). Die Anbindung liegt bei 70,5 % und somit wird deutlich, dass obwohl viele Konsumierende das Angebot annehmen und im Konsumraum konsumieren, die Bindung an den Ort einen größeren Faktor als der Konsumraum an sich darstellt. Auch Menschen, die nicht innerhalb der Einrichtung konsumieren, halten sich auf Grund der „Szene“ im Umkreis auf. Jetzt stellt sich die Frage, ist der Konsumraum dort, wo die Szene verankert ist, oder ist die Szene verankert, wo sich die Konsumräume befinden. Generell kann man für die Betrachtung dieser Frage nach Ursache und Wirkung das Frankfurter Bahnhofsviertel heranziehen, in dem nicht nur Konsumräume angesiedelt sind, sondern sich auch Einrichtungen für Methadonsubstitution, Notschlafstellen und eine ärztliche Versorgung befinden.
Daraus entstehen zwei Gefahrenquellen: Erstens die Möglichkeit der Entstehung eines „Fixerghettos“, in welchem die Konsumierenden durch Einrichtungen und Kontrollpolitik dazu gebracht werden, dieses nicht mehr zu verlassen und somit keine Partizipation im anderen Teil der Gesellschaft stattfinden kann. Zum andern gerät durch die Auslagerung der Drogenszene aus dem Blickfeld der Stadt auch die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit deren Problemen und Bedürfnissen in Vergessenheit (vgl. Schmidt-Semisch/Wehrheim 2007).
In Frankfurt hat sich durch die Einrichtungen der Drogenhilfe und die festen Szeneorte eine starke Konzentration auf das Bahnhofsviertel ergeben und es ist beinahe eine Art Parallelwelt entstanden. Drei von vier Drogenkonsumräumen befinden im Bahnhofsviertel, der vierte (das Eastside), befindet sich außerhalb des Viertels in der Nähe der Taunusanlage, wo die Szene früher angelagert war. Abends fährt ein Shuttle-Bus vom Bahnhofsviertel zu den angrenzenden Schlafplätzen des Eastsides. Auf der Internetseite der Integrativen Drogenhilfe e. V heißt es dazu: „Die Entfernung von der Innenstadt-Szene zum Eastside ist groß, sodass der täglich angebotene Fahrdienst gerne angenommen wird“. Es besteht also die Annahme, dass die Szene so fest in der Innenstadt verankert ist, dass der Dienst benötigt wird. Kronauer spricht bei seinen Ausführungen in Bezug auf Ghettos über die Bewusstseinsschaffung einer Einheit, die sich um das Ausgrenzungsmerkmal herum bildet. Auch wenn nicht von einem Ghetto gesprochen werden kann, da das Element des Zwangs, nicht nur des sozialen Drucks, nicht gegeben ist, trifft dies auch auf das Bahnhofsviertel zu. Die Szene hat ihre eigenen Regeln, ihren Handel und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, von denen Nicht-Konsumierende ausgeschlossen sind. Viele der Konsumierenden fühlen sich im Bahnhofsviertel heimisch. „Problematisch wird selbst freiwillige Segregation allerdings dann, wenn soziale Aufstiegsmobilität blockiert ist“ (Kronauer 2005). Viele Drogenkonsumierende wollen das Bahnhofsviertel nicht verlassen, jedoch bestehen innerhalb dessen wenige Chancen auf sozialen Aufstieg. Die Drogenbeschaffung nimmt oft auch sehr viel Zeit in Anspruch. Kronauer führt weiterhin aus, dass Lebensbedingungen innerhalb des Viertels zeigen, inwieweit der Rest der Gesellschaft bereit ist, für die Bewohner aufzukommen, beziehungsweise sich verantwortlich zu fühlen.
Die höchste Form des Ausschlusses aus dem physischen Raum ist der Freiheitsentzug, also die Verordnung eines Gefängnisaufenthalts. Der Handel, Tausch und Besitz von Heroin ist durch das Betäubungsmittelgesetz verboten. 2011 meldet das Bundeskriminalamt 11.305 Rauschgiftdelikte in Bezug auf Heroin, die Dunkelziffer ist höher. Durch die Strafandrohung und Verfolgung wird diese Form des absoluten Ausschlusses praktiziert. Das Robert-Koch-Institut hat im Rahmen seiner DRUCK-Studie über 2000 in Freiheit lebende Drogenabhängige befragt: Von über 2000 Befragten waren 81 % schon einmal im Gefängnis. Stöver sagt: „Durch Strafverfolgungs-/Justiz- oder Strafvollzugsbehörden werden soziale Ausgrenzungsprozesse verstärkt, die wiederum Auswirkungen auf das Drogenkonsumverhalten haben.“ Durch den Ausschluss aus der Gesellschaft im Gefängnis wird die Bereitschaft, Drogen zu konsumieren, eher noch erhöht und der Abgrenzungsprozess vertieft sich. Auch der Übergang von Gefängnis in die Freiheit bringt weitere Probleme, zum Beispiel die der anschließenden Krankenversicherung, mit sich, was für viele Konsumierende, die beispielsweise auch Methadon beziehen, problematisch ist (vgl. Stöver 2016).
Manuela Wade schreibt in ihrem Werk „Mikrokosmos Stadt“: „Spiegelt die sozialräumliche Struktur einer Stadt ihre Sozial-und Machtstruktur wider, so geht es nicht nur um den Lebensstandort an sich, sondern um die Verteilung von Lebenschancen.“ Durch das Verweilen im Bahnhofsviertel fehlt es vielen Konsumierenden an Möglichkeiten und Chancen zur Weiterentwicklung oder zur Beendigung des Drogenkonsums. Der Prozentsatz der Konsumierenden, welche es schaffen, über zehn Jahre kein Heroin zu konsumieren ist eher gering, während viele Konsumierende es schon einmal versucht haben, mit Hilfe einer Therapie aufzuhören (vgl. Drogenkatamnese 2007). Das soziale Umfeld und alte Gewohnheiten können hierbei eine große Rolle spielen, die Ablösung davon wird erschwert, wenn sich das soziale Leben davor nur in einem Bereich der Stadt abgespielt hat, und man außerhalb von ebenfalls Konsumierenden keine sozialen Kontakte hat. Die Integrative Drogenhilfe e. V bietet deswegen seit einigen Jahren ein sogenannten „BuddyCare-Projekt“ an, bei dem Nichkonsumierende auf ehrenamtlicher Basis mit Konsumierenden Freizeitaktivitäten unternehmen und gemeinsam Zeit verbringen (vgl. idH-Website). Problematisch hierbei ist, dass wieder ein „Othering–Prozess“ stattfindet, da eine klare Differenzierung vorgenommen wird zwischen der Lebenswelt des Einen und der Lebenswelt des anderen. In der Projektbeschreibung steht: „Es ermöglicht regelmäßige Kontakte und Begegnungen zwischen Drogenabhängigen und ganz normalen Menschen.“ Deutlich wird hier ein Unterschied zwischen Abhängigen und „normalen“ Menschen getroffen, der oder die Abhängige wird damit als „unnormal“ etikettiert. Stadträtin Rosemarie Heilig, Dezernentin für Umwelt, Gesundheit und Personal in Frankfurt, wird auf der Internetseite zum BuddyCare-Projekt mit dem Satz zitiert: „Drogenabhängige brauchen WegbegleiterInnen ins normale Leben!". Sie bezeichnet so das jetzige Leben der Konsumierenden als nicht normal und betont den Bedarf zur Veränderung.
[...]
- Arbeit zitieren
- Hannah Wagner (Autor:in), 2017, Exkludierende Toleranz. Ausschluss in Bezug auf Drogenkonsumräume, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498829
Kostenlos Autor werden




















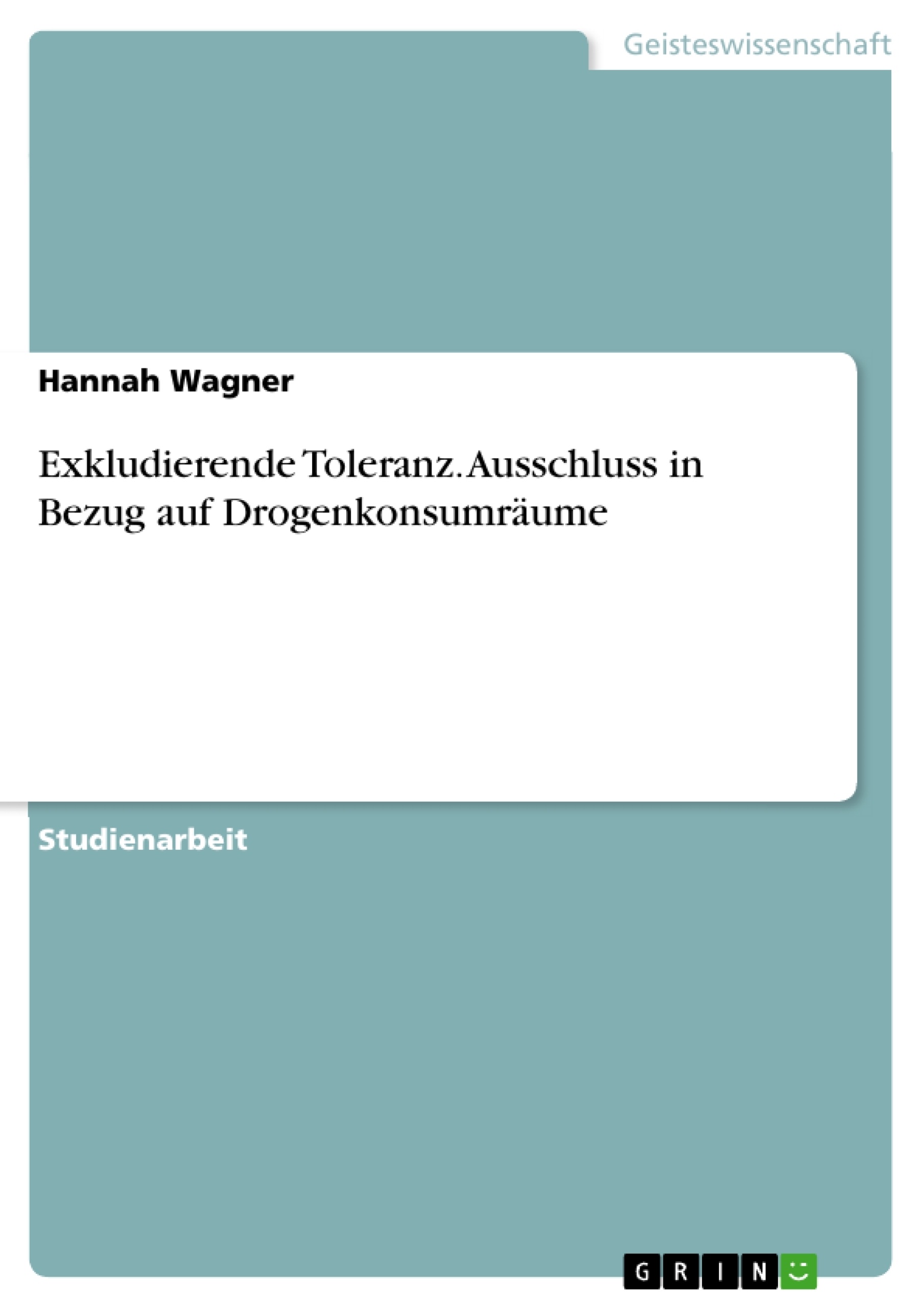

Kommentare