Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition Inklusion
3. Voraussetzungen für ein funktionierendes Inklusionsmodell
4. Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen
4.1 Entwicklung auf Bundesebene
4.2 Entwicklung auf Landesebene
5. Inklusion anhand des Beispiels Bremen
5.1 Paradebeispiel OSK
6. Fazit
Literatur
1. Einleitung
In einer sich immer weiter entwickelnden Gesellschaft, die mehr und mehr darauf abzielt, tolerant und politisch korrekt zu handeln, stößt man immer öfter auf den Begriff der Inklusion. Seit dem Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von Behinderten in Deutschland wird vorausgesetzt, dass behinderte Menschen in Schule und Gesellschaft inkludiert werden sollen und nicht mehr nur integriert. Die Konvention verlangt, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen auf Bildung haben sollen wie Menschen ohne Behinderungen. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit sich diese Forderung als realistisch in ihrer Umsetzung erweist. Gemäß Artikel 1 der UN-Konvention gilt ein Mensch als behindert, wenn er körperlich, geistig oder seelisch langfristig durch verschiedene Barrieren in seinem Handeln eingeschränkt ist (vgl. UN-BRK 2014, S.12). Deshalb wird verlangt, diese Barrieren aus dem Weg zu räumen, sodass alle Menschen möglichst frei in ihrem Handeln sein können. Die folgende Arbeit befasst sich daher mit der Frage, ob seit dem Inkrafttreten der Forderungen der UN-Konvention tatsächlich versucht wird, diese Barrieren zu beseitigen und inwieweit ein inklusives Schulmodell, wie es in der Konvention verlangt wird, bereits in Deutschland umgesetzt wird. Dabei sollen die beiden Begriffe „Inklusion“ und „Integration“ kritisch beleuchtet werden, da sie in Bezug auf die Schulpolitik doch des Öfteren in einen gemeinsamen Topf geworfen werden. Auf dieser Differenzierung aufbauend soll dann in einer makrostrukturellen Untersuchung die Entwicklung von Inklusion in Deutschland im Allgemeinen illustriert werden und daraufhin anhand eines länderspezifischen Beispiels, das sich aus der vorherigen Untersuchung besonders hervorhebt, mikrostrukturelle Faktoren für ein erfolgreiches Inklusionsmodell aufgezeigt werden. Dabei gilt zu beachten, inwieweit Inklusion und Integration einhergehen und inwieweit sie sich von einander abgrenzen.
2. Definition Inklusion
Zunächst gilt zu entscheiden, wann man überhaupt von Inklusion in der Schule sprechen kann. Irrtümlicherweise werden in der Schulpolitik häufig die Begriffe Inklusion und Integration durcheinander geworfen. Inklusion werde oft als „rhetorische Figur“ in der Politik verwendet, die in Wahrheit den Begriff der Integration repräsentiert (Aichele 2014, S.1). Zwar behandeln beide Begriffe das Einbinden von Individuen, doch grenzen sich diese in einem signifikanten Unterschied voneinander ab: Im Allgemeinen bedeutet das Wort Inklusion, welches sich vom lateinischen Wort „includere“ ableitet, so viel wie „(mit) einschließen“. Es setzt also einen aktiven Einbezug eines Individuums in eine Gruppe voraus. Im schulischen Kontext bedeutet dies, dass alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden sollen. Dabei soll keine Gruppe wegen Behinderung, des Geschlechts, sozialer Herkunft, kultureller Herkunft, Sprache, intellektueller Fähigkeiten etc. in irgendeiner Weise ausgeschlossen werden (vgl. Werning 2014, S.606). Spricht man allerdings von inklusiven Schulmodellen, dann liegt der Fokus vor allem auf der Einbindung von Schülerinnen und Schülern, die sonderpädagogische Betreuung benötigen und bisweilen Sonder- oder Förderschulen besuchen. Es wird verlangt, dass diese an normalen Regelschulen partizipieren dürfen. Gemäß Artikel 24 der UN- Konvention über die Rechte von Behinderten sollen daher alle Kinder das Recht haben, öffentliche Grundschulen sowie weiterführende Schulen zu besuchen (vgl. UN-BRK 2014, S.35). Dabei setzt die Definition der Inklusion auch voraus, dass Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet werden.
Das Wort Integration hingegen leitet sich vom lateinischen Wort „integrare“ ab und bedeutet „ergänzen“. Hierbei wird das Individuum zwar der Gruppe angefügt, ist jedoch noch deutlich abgetrennt von dieser. Nach Beschluss der UN-Konvention über die Rechte von Behinderten soll solch ein integrierendes System vermieden werden, da bei diesem nicht deutlich wird, inwieweit Schülerinnen und Schüler in Bezug auf eine gemeinsame Beschulung tatsächlich auch gemeinsam unterrichtet werden. Ahrbeck sieht als wesentlichen Unterschied zwischen Inklusion und Integration den Verzicht, „behinderte Kinder mit einem Sonderstatus zu versehen und sie gesondert zu beschulen“ (Ahrbeck 2014, S.8). Neben dieser Definition jedoch, ergeben sich bereits weitere Schwierigkeiten. So unterscheiden sich Menschen im Grad ihrer Behinderung, wenn beispielsweise ein körperlich behinderter Mensch, dessen kognitive Fähigkeiten nicht beeinträchtigt sind, mit einem Menschen mit Down-Syndrom gleichgesetzt wird. So muss doch zwischen dem Grad der Behinderung differenziert werden, damit eine erfolgreiche Betreuung möglich ist.
3. Voraussetzungen für ein funktionierendes Inklusionsmodell
Versucht man, ein inklusives Schulmodell zu schaffen, genügt es nicht nur zu gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen öffentliche Regelschulen besuchen dürfen, sondern es müssen Rahmenbedingungen angepasst werden, die behinderten Schülerinnen und Schülern den Schulalltag erst ermöglichen. Da die UN-Konvention nicht im Grad der Behinderung von Schülerinnen und Schülern differenziert, die an Regelschulen inkludiert werden sollen, erscheint es notwendig, zu klären, welche verschiedenen Maßnahmen getroffen werden müssen, damit Inklusion an Regelschulen funktionieren kann. Für Schülerinnen und Schüler mit körperlichen Behinderungen gilt es zunächst, physische Barrieren zu beseitigen (vgl. Bielefeldt 2012, S.163). Dazu wird also von der Inklusionsschule verlangt, diesen Schülerinnen und Schülern die Umgehung von Barrieren, wie zum Beispiel Treppen, schwer zu öffnenden Türen usw., zu ermöglichen. Ferner müssen Bewertungssysteme für diese Schülerinnen und Schüler in Schulfächern geschaffen werden, die eine körperliche Beanspruchung erfordern. Die Inklusion von physisch behinderten Schülerinnen und Schülern setzt also vor allem eine finanzielle Förderung voraus, die zwar ökonomische Hürden darstellt, jedoch in der pädagogischen Umsetzung eher leichter ermöglicht werden kann. Dahingegen erweist sich die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit mentalen Behinderungen oder Lern- und Sinnesbehinderungen als komplexere Angelegenheit. Damit auch diese erfolgreich inkludiert werden können, müssen sonderpädagogische Maßnahmen an den jeweiligen Schulen getroffen werden, sei es durch ausgebildete Inklusionshelfer oder Lehrer, die darin ausreichend weitergebildet wurden. Um einen Unterricht zu schaffen, an dem alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen teilnehmen können, werden Lehrkonzepte benötigt, die an die jeweiligen Leistungsspannen der Schülerinnen und Schüler angepasst sind. Außerdem erscheint es gemäß Artikel 8 (1) der UN-BRK notwendig, Vorurteile abzubauen (vgl. UN-BRK 2014, S.19f.), sodass keine soziale Exklusion durch nicht behinderte Schülerinnen und Schüler stattfindet. Nach einer Studie von Haeberlin et al. nämlich gelten leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler als eher unbeliebt in der Klasse und fühlen sich dort unwohler (Haeberlin et al., zit. nach Ahrbeck 2014, S.9). Zwar setzt eine Behinderung nicht automatisch Leistungsschwächen in bestimmten Fächern voraus, doch könnten gerade Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen davon betroffen sein. So schildert Vera Moser, dass auch die Sozialisationsfunktion der Schule ausreichend ausgeführt werden muss, indem Lehrer eine förderliche Lernkultur für die Schülerinnen und Schüler schaffen müssen (vgl. Moser 2013, S.9).
4. Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen
Zunächst soll geklärt werden, wie Inklusion in Deutschland, statistisch gesehen, umgesetzt wurde. Dazu sollen die Statistiken der Kultusministerkonferenz (KMK) dienen, die den Besuch von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen wiedergeben.
4.1 Entwicklung auf Bundesebene
Der KMK von 2014 kann entnommen werden, dass der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen seit 2005 von 14,5 % auf 34,1 % gestiegen ist (vgl. KMK 2014, S.18). Damit zeigt sich, dass es durchaus einen Wandel in Deutschland gibt, zumindest bezüglich der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf. Allerdings gilt zu betonen, dass hierbei von „Integrationsschülern“ gesprochen wird und nicht von „Inklusionsschülern“. Dabei leitet sich doch aus der UN-Konferenz über die Rechte von Behinderten die Forderung ab, behinderte Schülerinnen und Schüler nicht nur zu integrieren, sondern zu inkludieren. Es wird nicht ersichtlich, ob an gemeinsamen Schulen die auch schon von Ahrbeck kritisierte „Etikettierung“ von Schülerinnen und Schülern, wie sie bei der Inklusion eigentlich vermieden werden soll, weiterhin vorherrscht. Klaus Klemm kritisiert hierzu, dass „ein kleinerer Teil dieser Schülerinnen und Schüler, die in den KMK-Statistiken als inklusiv geführt werden, zwar in den allgemeinen Schulen – den Regelschulen also – unterrichtet wird, allerdings nicht in den allgemeinen Klassen, sondern in eigens eingerichteten Gruppen“ (Klemm 2014, S.631). So besuchen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf also zwar häufiger die allgemeine Schule als noch im Jahr 2005, jedoch ist damit nur ein Teil der Forderung von Inklusion erfüllt. Auch zeichnen sich Unterschiede in der Art der Behinderung dieser Schülerinnen und Schüler ab. Dabei zeigt sich vor allem ein Anstieg an Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Sprachbehinderungen sowie mit sozialen und emotionalen Entwicklungsstörungen an allgemeinen Schulen (vgl. KMK 2014, S.18f.). Dies hängt wohl auch damit zusammen, dass diese Arten von Behinderungen einfacher mit einer Regelschule zu vereinbaren sind als andere Behinderungen, die sowohl schulpolitisch als auch pädagogisch aufwändiger zu bewerkstelligen sind. Auffällig ist auch, dass der Anteil an Kindern mit Förderbedarf in körperlicher und motorischer Entwicklung an Förderschulen mit 7,33 % ungefähr 1 % höher ist als der an allgemeinen Schulen. So ergibt sich die Annahme, dass die meisten allgemeinen Schulen in Bezug auf physische Barrierefreiheit noch keine ausreichenden Veränderungen erzielt haben. Trotz des allgemeinen Wandels der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen seit 2005 zeichnet sich eine Problematik ab, die dem Gedanken von Inklusion der UN-BRK widerspricht. Die UN-BRK fordert ein allgemeines Recht auf Bildung für alle Menschen, also auch für alle Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, doch zeigen die Tabellen der KMK, dass eben nur ein Teil dieser Schülerinnen und Schüler inkludiert wird. Folglich werden andere Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf weiterhin exkludiert.
4.2 Entwicklung auf Landesebene
Da Bildung Ländersache ist und sich diese beispielsweise bereits in den Arten ihrer Förderschulen unterscheiden, scheint es notwendig, im Einzelnen zu betrachten, welche Bundesländer den Inklusionsgedanken der UN-BRK am ehesten umsetzen. Henry-Huthmacher schildert, dass Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland eine Teilumsetzung der Forderung der UN-BRK bewerkstelligt hat, indem das 9. Schulrechtsänderungsgesetz verabschiedet worden ist, welches das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf gesetzlich verankert hat (vgl. Henry-Huthmacher 2015, S.3). So kann der KMK-Statistik (Tabelle 2.1.1.1) ebenfalls entnommen werden, dass an allgemeinen Schulen in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf sich von 2005 mit einer Zahl von 10.867 bis 2014 auf 41.167 fast vervierfacht hat. Nordrhein-Westfalen gilt damit als Spitzenreiter in absoluten Zahlen, jedoch lassen sich in allen Bundesländern steigende Trends aufzeigen. Auch Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern weisen signifikante Wachstumsraten auf. Dazu muss natürlich gesagt werden, dass die steigenden Zahlen der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes betrachtet werden müssen und daher größere Bundesländer wie Bayern und Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Förderschüler haben. Deshalb gilt es noch zu berücksichtigen, wie die anteiligen Trends in den jeweiligen Bundesländern zum „Inklusionsanteil“ der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf sind. Anhand der KMK-Statistik (s. Abbildung Klemm) wird ersichtlich, dass vor allem die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und vor allem Bremen hohe Inklusionsanteile aufweisen. Aber auch Schleswig-Holstein und das Saarland haben einen höheren Inklusionsanteil als die übrigen Bundesländer. So ergibt sich die Frage, warum gerade in diesen Bundesländern Inklusion anscheinend stärker umgesetzt wird. Blanck nennt hierzu, dass die Länder eine unterschiedliche Auffassung von Inklusion und Integration haben, die vom jeweiligen sonderpädagogischen Fördersystem abhängen (vgl. Blanck 2015, S.156). So gibt es in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Sachsen Kontaktmöglichkeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, die eine Sonderschule besuchen, mit Regelschülern anhand von Kooperation an außerschulischen Aktivitäten Integration erfahren können und in einzelnen Fächern auch an Regelschulen gemeinsam unterrichtet werden können (vgl. ebd., S.166, Hervorhebung M.K.). Als weiteres „Integrationsunternehmen“ nennt Blanck die Kooperation zwischen Sonderklassen und ihnen zugeordneten Regelklassen, die in manchen Fächern gemeinsamen Unterricht erteilt bekommen. Zwar gibt es somit Teilnahmen von Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf an Aktivitäten der Regelschulen, doch scheint dies nicht der Definition von Inklusion der UN-BRK zu entsprechen, da diesen Schülerinnen und Schülern immer noch eine Sonderrolle anhaftet. Auch wenn sie in manchen Fächern an Regelschulen teilnehmen dürfen, wird deren Exklusion, die nach Werning mit der Inklusion stark zusammenhängt (vgl. Werning 2014, S.606), noch stärker betont, da eben nur manche Fächer in Form von gemeinsamem Unterricht stattfinden. Ein weiteres Konzept lässt sich in den Bundesländern Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Saarland finden, in denen es Regelschulen mit einem besonderen Auftrag zur Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf gibt (vgl. Blanck 2015, S.167). Doch scheint auch hier die Unterrichtung dieser Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf vor allem gesondert durch Sonderpädagogen stattzufinden. Zum Bundesland Bremen, welches im Jahr 2014 den höchsten Inklusionsanteil aufwies, schildert Blanck, dass keine eindeutigen Kooperationsvereinbarungen zwischen Regelschulen und Sonderklassen vorherrschen, sodass nicht ersichtlich wird, inwieweit Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf mit Regelschulen in Kontakt kommen (vgl. ebd, S.167). Da dies dem hohen Inklusionsanteil in Bremen widerspricht, stellt sich die Frage, warum gerade Bremen dennoch diese hohe Zahl erzielt hat.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2016, Inklusion in Deutschland. Entwicklungen in Bremen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497713
Kostenlos Autor werden






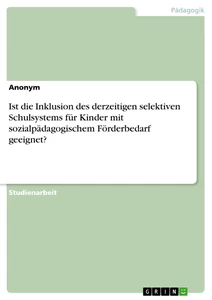

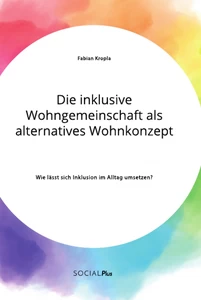










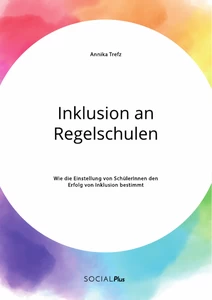

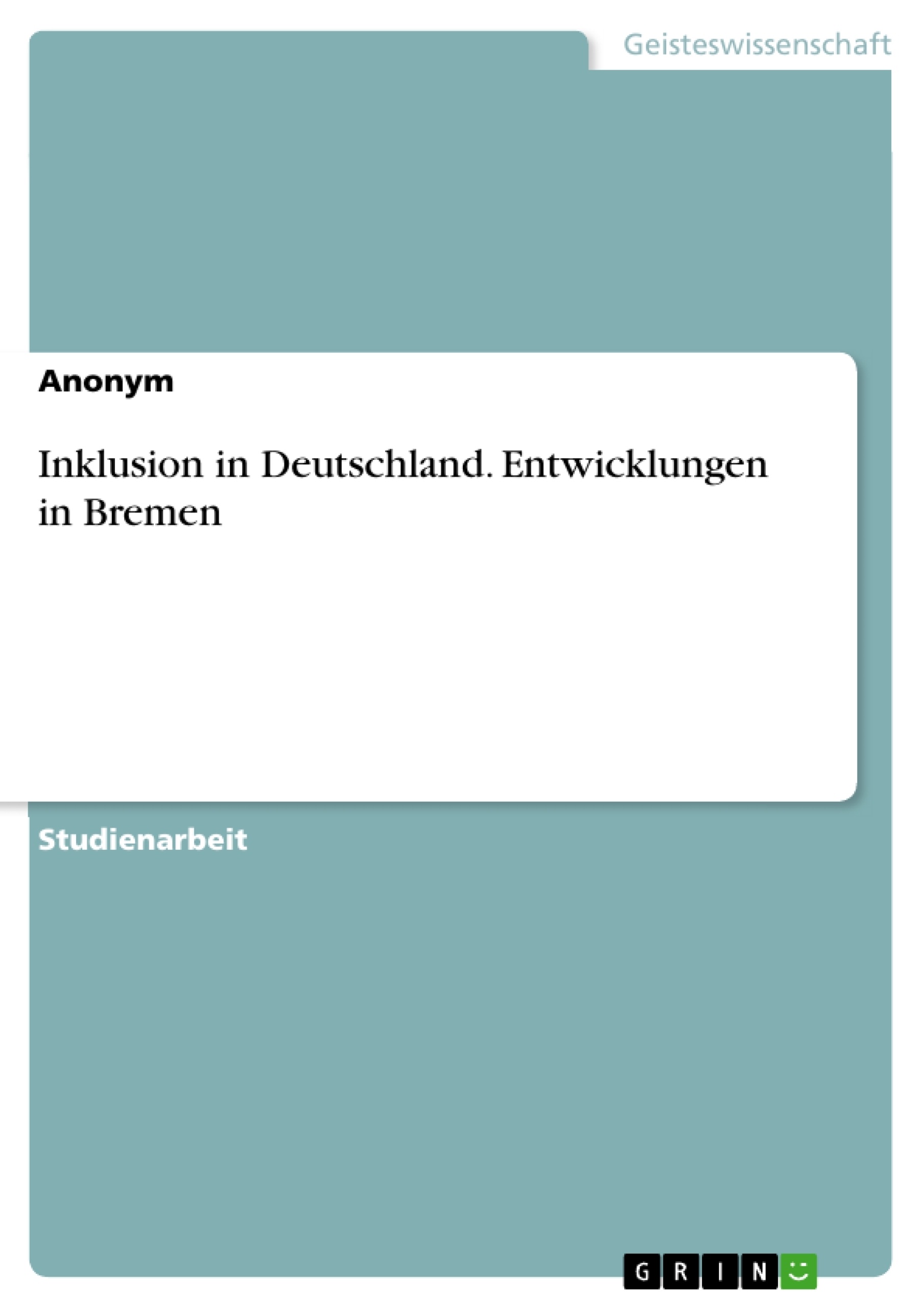

Kommentare