Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Gegenstand und Motivation
1.2 Zielstellung
1.3 Fragestellung
1.4 Aufbau der Arbeit
1.5 Stand der Literatur
2 Theoretischer Rahmen
2.1 Einbettung der Pflegedokumentation in ein Pflegemodell
2.2 Anforderungen an eine Pflegedokumentation
2.2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
2.2.2 Spezielle Anforderungen an die Pflegedokumentation auf einer Intensivpflegestation
2.2.2.1 Interdisziplinäre Anforderungen
2.2.3 Pflegedokumentation als Teil der Leistungserfassung
2.2.3.1 Einbindung von Scores in das Dokumentationssystem
2.2.4 Pflegedokumentation als Teil der Qualitätssicherung
2.3 Der Pflegeprozess
2.3.1 Merkmale des Pflegeprozesses auf Intensivstationen
2.3.2 Kritik am Pflegeprozess
2.4 Klassifikationssysteme der Pflege
2.4.1 NANDA
2.4.2 ACENDIO
2.4.3 ICNP
2.4.4 Pflegediagnosen
2.4.4.1 Kritik an der Pflegediagnostik
3 Dokumentationspraxis
3.1 Konventionelle Pflegedokumentationen
3.2 Rechnergestützte Pflegedokumentation
3.3 Stand der Praxis
3.4 Stand der Dokumentationspraxis der IPS Datteln
4 Konkretisierung der Zielstellung
4.1 Einbindung bereits vorhandener Dokumentationsteile
5 Material und Methoden
5.1 Kostenkalkulation
5.2 Interviews der Berufsgruppen
5.3 Erarbeitung der Rahmenstrukturen
5.4 Aufbau des neuen Patientendokumentationssystems
5.4.1 Vorderseite des Patientendokumentationssystems
5.4.2 Rückseite des Patientendokumentationssystems
5.5 Druck des Patientendokumentationssystems
6. Implementierungsphase
6.1 Implementierungsmanagement
6.1.1 Vorbereitung der Implementierungsphase
6.1.2 Anleitung der Mitarbeiter
6.1.2.1 Anleitung der ärztlichen Mitarbeiter
6.1.2.2 Anleitung der pflegerischen Mitarbeiter
6.2 Pretest des Dokumentationssytems
7. Evaluationsphase
7.1 Dokumentenanalyse
7.2 Befragung der Mitarbeiter auf der Intensivpflegestation
8 Ergebnisse
8.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse
8.1.1 Vergleich der ärztlichen und pflegerischen Prozessdarstellung
8.1.2 „Intensivmedizinische Komplexbehandlung“
8.1.3 Sonstige Dokumentationsfelder
8.2 Analyse der Änderungsvorschläge
8.3 Ergebnisse der Abschlussbefragung der Mitarbeiter
9 Diskussion
9.1 Potentielle Fehler bei der Interpretation
10 Fazit
10.1 Grenzen des wissenschaftlich fundierten Patientendokumentationssystems
11 Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Glossar
Appendix I - Kostenkalkulation
Appendix II - Druckkostenkalkulation
Appendix III - Arbeitsauftrag
Appendix IV - Interviewergebnisse
Appendix V – Intensivstation relevante NANDA-Pflegediagnosen
Appendix VI – Handbuch für Intensivpflegende
Appendix VII – Patientendokumentationsanalyse-Instrument
Appendix VIII – Definition einzelner Merkmalsausprägungen
Appendix IX – Nennungen im Modifikationsbuch
Appendix X – Abschlussbefragung: pflegerische Mitarbeiter
Appendix XI - Zeitplan
Appendix XII - Patientendokumentationssystem
Eidesstattliche Erklärung
2 Abstract
Im Rahmen dieser Diplomarbeit ist ein neues Patientendokumentationssystem für eine interdisziplinäre Intensivpflegestation (IPS) entwickelt worden, das den wissenschaftlichen und rechtlichen Ansprüchen ebenso entsprechen sollte, wie den Anforderungen, die die Mitarbeiter der IPS an ein neues Dokumentationssystem stellen. Außerdem sollte erstmals die Dokumentation am Pflegeprozess stattfinden. Es sollte festgestellt werden, ob ein wissenschaftlich orientiertes Patientendokumentationssystem auf einer IPS anwendbar ist und vom multiprofessionellen Team akzeptiert und genutzt wird.
In die Entwicklung des Patientendokumentationssystems wurden alle Mitarbeiter der IPS integriert. Hierzu wurden einige Mitarbeiter zu „Internen Projektbegleitern“ ausgebildet, die während der vierwöchigen Implementierungsphase beratend tätig waren. Mittels retrograder Dokumentenanalyse wurde das Dokumentationsverhalten aller mit diesem System arbeitenden Mitarbeiter (Ärzte, Pflegende und Physiotherapeuten) gemessen und somit die Praktikabilität dieses Systems und die Akzeptanz der Mitarbeiter analysiert. Die Auswertung zeigte, dass vor allem bei den Intensivpflegenden ein positives Lernverhalten bei der Pflegeprozessdarstellung innerhalb des dreiwöchigen Analysezeitraumes festzustellen war. Das Dokumentationssystem stellt die meisten Pflegeprobleme auf der interdisziplinären IPS dar, so dass eine handschriftliche Ergänzung im Pflegebericht gegen Ende der Implementierungsphase immer weniger notwendig wurde. Erstmals ist auch die „Intensivmedizinische Komplexbehandlung“ in Form einer codierten Darstellung des Behandlungsaufwandes auf der Intensivpflegestation dokumentiert worden. In einer abschließenden Mitarbeiterbefragung zur Zufriedenheit mit dem neuen Patientendokumentationssystem zeigte sich trotz des positiven Lernverhaltens noch eine Unsicherheit im Umgang mit dem Pflegeprozess. Für die endgültige Verwendung sind daher noch ein paar Modifikationen notwendig. Gleichwohl haben die Ergebnisse der Analyse gezeigt, dass das in dieser Diplomarbeit entwickelte Patientendokumentationssystem praxistauglich ist und von den Mitarbeitern der IPS akzeptiert wird. Es ist dazu geeignet, die Kausalität des komplexen Behandlungsaufwandes sowohl der Medizin, als auch der Pflege darzustellen. Die pflegerischen und die ärztlichen Mitarbeiter sind motiviert, das System weiter zu entwickeln.
.3. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
In den letzten Jahrzehnten wurde die Versorgung von Menschen im Krankenhaus in Bezug auf Methoden zur Diagnostik, Therapie und Pflege vielfältiger und komplexer. Durch fortschreitende Technologisierung, zunehmende Multimorbidität und kürzere Verweildauer der Patienten sowie höhere gesetzliche Auflagen bezüglich der Dokumentation fallen im stationären Bereich mehr Daten an als bisher (Lagemann 1996). Diese überwiegend medizinischen Daten sind im Wesentlichen für den ärztlichen Dienst von Bedeutung (z.B. Dokumentation der Vitalparameter und der Medikation) und werden oftmals von Pflegekräften erfasst und dokumentiert. Hinzu kommt, dass die Dokumentation von pflegerischen Leistungen immer mehr an Bedeutung gewinnt. War noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die Arbeit von Schwestern und Pflegern am Krankenbett gekennzeichnet vom Mythos des 'selbstlosen Dienens', so verschiebt sich heute die Gewichtung der einzelnen Funktionen weg von der eigentlichen Pflege hin zu Tätigkeiten administrativer und kommunikativer Art. Neben einer Umstrukturierung der pflegerischen Tätigkeiten muss daher auch die pflegerische Dokumentation ökonomisiert werden.
In zahlreichen Publikationen auf dem Gebiet der Pflege, so beispielsweise in der Denkschrift „Pflege neu denken“ (Robert-Bosch-Stiftung 2000), wird eine wissenschaftlich fundierte Pflegepraxis gefordert. Die Anwendung der richtigen Fachsprache in der Pflege wird als Voraussetzung für die Patientensicherheit bzw. für die forensische Absicherung der Pflegenden, als Qualitätskriterium für die Kostenträger und auch im Rahmen von Benchmarking auf nationalem und internationalem Niveau gesehen (Müller Staub 2004; Herberger und Hindermann 2004). Damit wird der große Handlungsbedarf unterstrichen, der in dieser Hinsicht besteht und in unterschiedlichster Form wahrzunehmen ist. Franke (2002b) konnte Mängel bezüglich dieser Anforderungen an ein Patientendokumentationssystem auf einer Intensivpflegestation (IPS) aufzeigen.
1.1 Gegenstand und Motivation
Der Autor arbeitet auf einer Intensivpflegestation im St. Vincenz-Krankenhaus Datteln, einem Krankenhaus der Regelversorgung. Hierbei handelt es sich um ein Krankenhaus in kirchlicher Trägerschaft. In einer Vordiplomarbeit (Franke 2002b) hat er das Dokumentationsverhalten der pflegerischen Mitarbeiter bezüglich der Orientierung am Pflegeprozess untersucht. Dabei konnte er feststellen, dass das derzeit verwendete konventionelle Pflegedokumentationssystem Schwachstellen zeigt; z.B. wird der Behandlungsprozess sowohl bei der Pflege-, als auch bei der ärztlichen Dokumentation nicht dargestellt. Es wird keine einheitliche Terminologie verwendet, da die Pflegedokumentation größtenteils frei zu formulieren ist. Ebenso wurde in einer Voruntersuchung von Franke (2002a) einheitlich der Wunsch von allen pflegerischen Mitarbeitern dieser IPS geäußert, ein neues Patientendokumentationssystem zu entwickeln. Zurzeit befindet sich das Krankenhaus in der Zertifizierungsphase nach KTQ®. Dort ist unter anderem die Dokumentation ein Qualitätskriterium. Diese Bündelung von intrinsischen und extrinsischen Motivationswünschen an das bestehende Patientendokumentationssystem ließen eine hohe Erfolgsaussicht bei der Entwicklung eines neuen Patientendokumentationssystems erhoffen und veranlasste den Autor, dieses zu entwickeln.
1.2 Zielstellung
Conrad (2004) betont, dass eine wissenschaftlich fundierte Pflegepraxis in Deutschland heute nicht mehr als Option zur Wahl stehen kann, sondern als obligate Bedingung zu etablieren ist. Der Autor (Franke) hat bei der Entwicklung des Patientendokumentationssystems folgende Zielkriterien aufgenommen:
- Beachtung rechtlicher Rahmenbedingungen
- Einführung einer einheitlichen Terminologie
- Darstellung von für die Intensivstation relevanten NANDA-Pflegediagnosen (North American Nursing Diagnosis Association), den entsprechenden Interventionen und Ergebnissen (Johnson et al. 2001)
- Beschreibung des Pflege- und Behandlungsprozesses
- Integration von Scores
- Integration der Dokumentation pflegerischer Nebendiagnosen im OPS
- Nutzung und Integration der vorhandenen Standards des Krankenhauses
- Berücksichtigung der Archivierungsbedingungen
- Erleichterung der Dokumentationspraxis
- Beachtung von Wünschen der Mitarbeiter
Ziel dieser Arbeit ist es, ein in der Praxis anwendbares Patientendokumentationssystem zu entwickeln, das all diese Anforderungen erfüllt.
1.3 Fragestellung
Aus den formulierten Zielstellungen lässt sich folgende Forschungsfrage formulieren:
„Ist ein wissenschaftlich fundiertes Patientendokumentationssystem auf einer Intensivpflegestation anwendbar und wird es in der Praxis vom multiprofessionellen Team akzeptiert und genutzt?“
1.4 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 wird der theoretische Rahmen, der einem Patientendokumentationssystem im Krankenhaus zugrunde liegt, erarbeitet. Hierbei werden gesetzliche und pflegewissenschaftliche Anforderungen an ein Patientendokumentationssystem dargestellt und der Pflegeprozess, sowie Klassifikationssysteme erläutert.
In Kapitel 3 wird die Dokumentationspraxis konventioneller und rechnergestützter Pflegedokumentationssysteme dargestellt und der Stand der Dokumentationspraxis der IPS Datteln, für die das neue Patientendokumentationssystem entwickelt werden soll. Kapitel 4 erläutert die Konkretisierung der Zielstellung und Kapitel 5 Material und Methoden der Untersuchung. Kapitel 6 beschreibt die Implementierungsphase des neuen Patientendokumentationssystems. Die Evaluation der Implementierung wird in Kapitel 7 behandelt. In Kapitel 8 werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und im darauf folgenden Kapitel 9 diskutiert. Kapitel 10 zieht ein Fazit der Untersuchung. Kapitel 11 schließt die Diplomarbeit mit einem Ausblick ab.
1.5 Stand der Literatur
Die Literaturrecherche erfolgte in MEDLINE und CINAHL über Schlagwörter „chart Intensive care/ nursing process/ nurse intensive care quality documentation/ nursing process documentation/ Intensiv care documentation“. Hierbei wurden die Suchstrategien modifiziert, wenn bekannte Schlüsselarbeiten in der Suche nicht erfasst worden waren. Die Suche stützte sich dabei auf einen Zeitraum von 1997 bis 2004. Um die Treffergenauigkeit relevanter Artikel zu erhöhen, wurden die Suchbegriffe mit dem Operator „and“ kombiniert. Nach Begutachtung der Abstracts wurden 62 Artikel als themenbezogen befunden. Alle Literaturquellen wurden über die ULB Sachsen-Anhalt, ULB Dortmund, oder über Subito als Fernleihkopie bezogen. Somit konnte ein Bestand von 56 Artikeln aufgebaut werden. Bei Querverweisen der Autoren zu anderen Studien erfolgte die Sichtung und Prüfung dieser Quellen hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit, auch wenn die Literatur älter als der Recherchezeitraum war. Ergänzt wurde die Datenbankrecherche durch eine Handsuche und per Internetrecherche. Insgesamt konnten 146 Literaturquellen zur Recherche genutzt werden.
2 Theoretischer Rahmen
2.1 Einbettung der Pflegedokumentation in ein Pflegemodell
Der Zweck eines Pflegemodells ist es, die Realität darzustellen. Es kann nicht alle Aspekte jeder realen Situation beschreiben, aber es bietet den Pflegenden nützliche Rahmenbedingungen, um über alltägliche Pflegeaktivitäten nachzudenken. Weil das Modell lediglich eine Abbildung der Realität ist, kann es durch das Bilden von Fragen zur Entwicklung einer Theorie führen. Die Theorie kann bestätigen, dass das Modell ein akkurates Spiegelbild der Realität ist, oder die Pflegenden dazu führen, das Modell zu ändern, wenn sich zeigt, dass es die Wirklichkeit unrichtig abbildet.
Die Anwendung oder Übernahme eines Pflegemodells auf Intensivstationen kann helfen, einen Intensivpflegenden dorthin zu entwickeln, dass er sich über die rein pflegenden Handlungen hinaus auch der moralischen und professionellen Dimension in der Praxis der Intensivpflege bewusst wird. Pflegemodelle sind nicht die einzige Quelle dieser Erkenntnisse, aber sie dienen als Mittel für alle Pflegenden, die sich erkundigen wie die Pflegepraxis reflektiert und verbessert werden kann. Durch die Anwendung eines Pflegemodells kann der Intensivpflegende zu erklären beginnen, was Intensivpflege innerhalb der komplexen High-Tech-Bereiche, die Intensivstationen genannt werden, ist. Der Intensivpflegende muss versuchen, die Modelle als Werkzeuge für eine autonome Praxis zu benutzen, um die Grenzen der professionellen Intensivpflege zu definieren.
Die Entwicklung eines Pflegemodells erleichtert es den Pflegenden im pflegerischen und im medizinischen Sinn zu denken. Das Intensivpflegepersonal muss Prioritäten setzen, um im Umfeld der körperlichen/ physiologischen Probleme und instabilen physiologischen Systeme adäquat reagieren zu können. Laut Millar und Burnard (2002) hat gerade dieses Setzten von Prioritäten den Intensivstationen viel Kritik eingebracht, indem behauptet wird, die Intensivpflegenden arbeiten immer noch nach einem rein medizinischen Modell. Orem (1971) vertritt z.B. die Auffassung, dass Pflegende je nach Defizit auf drei unterschiedliche Arten Gesundheitsversorgung bereitstellen: vollkompensierend, teilkompensierend und unterstützend-schulend. Auf der Intensivstation liegen aber häufig Patienten, die während der gesamten Zeit vollkompensierende Pflegeleistungen erfordern und es liegt in der Natur der Intensivversorgung, dass für diese Patienten erst nach der Verlegung auf eine andere Station die übrigen Arten der Pflege angewandt werden können.
Die Entwicklung einer Intensivphilosophie hilft bei der Bestimmung der Werte des Personals und vermag die Entscheidung zu beeinflussen, ein Pflegemodell zu übernehmen. Patienten und ihre Familien stammen aus vielen verschiedenen Kulturen und sozialen Umfeldern und werden gegenüber den Pflegenden auf der Intensivstation sehr unterschiedliche Wertvorstellungen aufrechterhalten. Die Pflegenden müssen, wenn möglich, den Patienten und seine Familie in ihr Denken einbeziehen. Die Pflegephilosophie soll deshalb nicht statisch bleiben, sondern flexibel und lebendig. „Die Erfahrungen der meisten Intensivpflegenden zeigen, dass sich systemtheoretische Modelle in der Regel als die nützlichsten erwiesen haben […]“ (Millar und Burnard 2002: 70). Die Vereinigung der naturwissenschaftlichen und der geisteswissenschaftlichen Rahmenbedingungen, die Zusammenführung medizinischer High-Tech-Überwachung und pflegerischer Interventionen, die Integration pflegerischer, medizinischer Aspekte und die der Patienten und seiner Angehörigen, führen zur Entwicklung eines eklektischen Modells, welches brauchbare Ansätze aus allen Modellen herausnimmt und in einem individuellen Pflegemodell zusammenführt. Die Pflege geht davon aus, dass der Patient alles wünscht, was möglich ist. Um dies zu gewährleisten betrachtet die Pflege nicht nur den Patienten, sondern auch sein soziales und kulturelles Umfeld. Neumann (1998) konstruiert ein komplexes Systemmodell, das die Interaktion zwischen den Grundstrukturen des Individuums, den internen und externen Stressoren, der Reaktion, Intervention und Wiederherstellung (Adaption) sowie die Bedeutung von Interventionen als primäre, sekundäre und tertiäre Prävention herstellt. Die Aufgabe der Pflege besteht nach Neumann darin, Stressoren für den Patienten zu vermeiden oder zu verhindern. Dazu zeigt sie auf, dass der Mensch innere (geistige) flexible Verteidigungslinien hat, um mit diesen Stressoren umgehen zu können. Dies sind z.B. Copingstrategien oder Lebensstile, die den Umgang mit Stressoren erleichtern. Diese flexiblen Verteidigungslinien beruhen auf dynamischen Verhaltensmustern, die durch pflegerische Intervention in Zusammenarbeit mit dem Patienten zu Handlungsalternativen führen können. Hier bieten die in das systemische Paradigma einbezogene physiologischen, psychologischen, soziokulturellen, entwicklungspotentiellen und spirituellen Einflussfaktoren ein reichhaltiges Spektrum an Möglichkeiten zur Intervention und damit zur Stärkung der Verteidigungslinien. Aus diesem Grund wird das Modell nach Neumann (1998) vom Autor bevorzugt. Das Modell kann auf einen einzelnen Menschen und dessen Familie im Bereich der Intensivversorgung angewendet werden. Weiterhin können die physiologischen Aspekte der Intensivversorgung so tiefgehend betrachtet werden, wie es für die Stabilisierung des individuellen Systems des Patienten notwendig ist.
Für das einzelne Krankenhaus stellt sich immer die Frage, ob Instrumente selbst entwickelt werden sollen, oder ob bereits vorhandene Instrumente übernommen werden können (König 2002a). Das St. Vincenz-Krankenhaus hat sich dem caritativen Gedanken verpflichtet. Die Patienten und ihre Angehörigen sind ernst zu nehmende Partner, denen mit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und zuvorkommend begegnet wird. Die Würde und das Recht auf Selbstbestimmung des Menschen werden respektiert.
2.2 Anforderungen an eine Pflegedokumentation
Die Krankenhausbehandlung setzt sich aus einer Vielfalt von Einzelaspekten zusammen, die wichtig für die Verwaltung, die Interaktion und Koordination rund um Diagnostik und Therapie, sowie für die pflegerische Versorgung des Patienten sind. Der erfolgreiche Krankenhausaufenthalt ist daher unabdingbar verknüpft mit dem Erheben, Fixieren und Kommunizieren patientenbezogener Informationen.
Die Pflegedokumentation ist eine schriftliche patientenbezogene Dokumentation des Krankenpflegeprozesses und dient somit auch dem Nachweis des Umfangs und der Effektivität pflegerischer Interventionen. Sie ist Teil der Patientenakte und wird vom Pflegepersonal als Dokument des Pflegeverlaufes und der erbrachten pflegerischen Leistung geführt. Die Pflegedokumentation umfasst in der Regel die Pflegeanamnese, den Pflegeplan und den Pflegebericht.
2.2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die Forderung nach qualitätssichernden Maßnahmen in der Krankenpflege beruht nicht alleine auf der Motivation der Pflegenden selbst. Die Leistungserfassung der Pflege wird durch gesetzliche Rahmenbedingungen geregelt und in Zukunft immer wichtiger, da eine Kostenübernahme nur für überprüfbare Leistungen erfolgt und somit eine assessmentgestützte Planung und Leistungserfassung notwendig ist. Zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen gehören:
- Rechtsprechung als Rechtgestaltung: Wander (1988) weist auf die Pflicht zur Dokumentation hin. Er belegt diese Pflicht durch Urteile des Oberlandesgerichts Celle vom 27.6.1983 und des Bundesgerichtshofs vom 18.3.1986, in denen sowohl auf die Dokumentationspflicht der Ärzte, als auch auf die Dokumentation von pflegerischen Maßnahmen hingewiesen wird. Diese umfasst sowohl die Grund- wie auch die Behandlungspflege. Da eine fehlende Pflegedokumentation in Streitfällen zu einer richterlichen Entscheidung zugunsten des Patienten führen könnte, hat die Pflegedokumentation auch prozessualen Charakter.
- Qualitätssicherung: Über § 80 SGB XI und § 112 SGB XI (durch das PQsG seit 1.1.2002) kommt das umfassende Qualitätsmanagementsystem zum Tragen, in dem Dokumentation als Bestandteil der Qualitätssicherung ein wichtiges Element darstellt. Hier heißt es: „ [ … ] Die zugelassenen Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, sich an Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu beteiligen [ … ] “ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1999).
- Wirtschaftlichkeitsgebot: Trotz der Fürsorglichkeit bei der pflegerischen Betreuung der Patienten auf einer Intensivstation ist der ökonomische Gedanke nicht zu vernachlässigen. Das in § 12 Abs. 1 SGB V festgelegte Wirtschaftlichkeitsgebot lässt die Bedeutung der Patientendokumentation als Leistungsnachweis wachsen.
(1) „Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig, oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen.“
- Darstellung des Pflegeprozesses: In § 1 Abs. 1 Abschnitt A1 KrPflAPrV heißt es (Auszug):
(2) „Die Ausbildung […] soll insbesondere dazu befähigen
1. die folgenden Aufgaben eigenständig auszuführen:
a) Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation der Pflege,
b) Evaluation der Pflege, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege,
c) Beratung, Anleitung und Unterstützung von Patienten […] und ihrer Bezugspersonen in der individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit. […]
3. interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten und dabei multidisziplinäre und berufsübergreifende Lösungen von Gesundheitsproblemen zu entwickeln.“
Die Darstellung des Pflegeprozesses wird hier eindeutig gefordert.
Dokumentierte Informationen sind für alle für die Behandlung Verantwortlichen zugänglich und handlungsweisend. Nur eine auf Vollständigkeit und Kontinuität bedachte Dokumentationspraxis kann diesen Ansprüchen gerecht werden (Höhmann et al. 1997; Pröbstl et al. 1997; Sperl 1996).
Die Führung der pflegerischen Dokumentation obliegt den Pflegekräften, die Verantwortung für die vollständige Dokumentation trägt die jeweilige Stationsleitung, da sie als Führungskraft im unteren Management der Pflege die Qualität der in ihrem Bereich erbrachten pflegerischen Leistungen verantwortet (Reinhart 1998).
2.2.2 Spezielle Anforderungen an die Pflegedokumentation auf einer Intensivpflegestation
Auf einer Intensivstation muss der Sicherheit des Patienten die zentrale Aufmerksamkeit gelten. Risikomanagement ist die Gesamtheit aller organisatorischen Maßnahmen und Regelungen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken. Dieses Risikomanagement bedeutet, Gefahren und Fehler zu erkennen, um Zwischenfälle mit Patientenschädigung erst gar nicht entstehen zu lassen. Hierzu gehört auch das Dokumentationswesen. Die Voraussetzung, um ein Risikomanagement erfolgreich umsetzen zu können, ist ein funktionierender Pflegeprozess (Steinbrucker und Jacobs 2004).
2.2.2.1 Interdisziplinäre Anforderungen
Über die juristischen Rahmenbedingungen hinaus liegt der zentrale Stellenwert der Patientendokumentation im Behandlungsalltag in ihrer Funktion als Organisationsinstrument (Klapper et al. 2001; Brüggemann et al. 2002). Wichtige Patienteninformationen werden täglich von verschiedenen Berufsgruppen produziert und in den weiteren Arbeitsprozess einbezogen. Den vielen an der Krankenhausbehandlung Beteiligten, insbesondere Ärzten und Pflegenden, dient die Patientendokumentation als zentrales Kommunikations- und Informationsmedium. Hierdurch wird ebenso eine qualitativ hochwertige, als auch eine kontinuierliche Versorgung ermöglicht.
Die Pflegedokumentation ist neben der ärztlichen Dokumentation ein wesentlicher Bestandteil der klinischen Dokumentation.
Im Wesentlichen besteht die Patientendokumentation aus zwei Teilen:
- dem Formularteil
- dem Berichtsteil
Der Formularteil dient der Zusammenstellung vorgedruckter Tabellen der Pflegehandlungen und Medikamentenanordnungen. Dieser Teil ist häufig stark standardisiert. Der Pflegebericht dient der zusätzlichen Dokumentation in Worten, für die der Formularteil keine Eintragungen vorsieht, wie z.B. Beobachtungen und außergewöhnliche Ereignisse.
Reinhart (1998) und Feuerstein (2000) haben folgende Systematik des Patientendokumentationsmanagements für Intensivstationen dargestellt:
- Verlaufskurve (Vitalparameter, Beatmungsparameter, Laborwerte, Urinaus-scheidung, Patientenstatus etc.)
- Therapiekurve (Medikamente, Infusionstherapie, Perfusortherapie, Konsiliarbefunde, Flüssigkeitsbilanzierung)
- Pflegekurve (Pflegeplanung, Dokumentation pflegerischer Maßnahmen, Dokumentation von Drainagen, Atemwegsmanagement etc.)
Bei der Dokumentation sollte deutlich werden, WER: WAS WO WIE WANN und WARUM etwas getan hat. Kann eine dieser Fragen nicht beantwortet werden, so ist der Pflegebericht unvollständig (Abt-Zegelin 2003).
Die Intensivpflegestation, für die der Autor das Patientendokumentationssystem entwickelt, ist eine interdisziplinäre Intensivstation. Es werden sowohl medizinische, als auch allgemein- und unfallchirurgische, urologische und gynäkologische Patienten versorgt. Unabhängig von den unterschiedlichen Fachrichtungen sind für die Dokumentation des Behandlungsverlaufes in jedem Fall folgende Parameter in der Patientendokumentation zu erfassen:
- Aufnahmegrund
- Vitalparameter
- medizinische Verlaufsparameter
- medikamentöse Therapieanordnung
- medikamentöse Therapiedurchführung
- invasive Zu- und Abgänge beim Patienten
- Pflegeplanung
2.2.3 Pflegedokumentation als Teil der Leistungserfassung
Der Pflegeprozessansatz hat in der Dokumentation den Anspruch der professionellen Darstellung und internen Qualitätssicherung. Die Dokumentation soll umfassende Informationskontinuität und die Möglichkeit der Pflegeevaluation ebenso ermöglichen, wie auch als Grundlage für einen interdisziplinären Austausch am Patienten dienen (Abt-Zegelin et al., 2004). Abt-Zegelin et al. sagen aber auch, dass die Pflegedokumentation in erster Linie eine intraprofessionelle Notwendigkeit und nicht eine Leistungsbeschreibung für die Kostenträger, ein Qualitätsnachweis für externe Prüfer, oder ein Text für die Juristen ist.
Güttler und Lehmann (2003) haben in ihrer Studie versucht, eine Struktur zur Erfassung und Dokumentation von Pflegeprozessen im Sinne einer Typologie sowie einer Standardisierung zum Austausch von Patientendaten zu entwickeln und verbindlich festzulegen. Dieses Projekt nannten sie „APLE“ (Assessment, Planung, Leistungserfassung, Evaluation). Sie postulierten, dass die Typologie nicht zu komplex sein darf, um praxistauglich zu bleiben. Sie sollte aber die Pflegeinhalte vollständig abbilden. Die Pflegephänomene wurden sowohl den Haupt- als auch den Nebendiagnosen der DRGs zugeordnet, um so eine transparentere Abbildung der Pflegeleistungen zu ermöglichen.
Die Ärzte sind verantwortlich für die digitale Codierung der für den Krankenhausaufenthalt relevanten Diagnosen (lt. ICD-10-GM) und der relevanten (gesamten) geleisteten Tätigkeiten, auch Prozeduren genannt (lt. OPS-301), während des Krankenhausaufenthaltes. Es dürfen nach den Deutschen Kodierrichtlinien nur Diagnosen oder Prozeduren kodiert werden, die diagnostisch, -therapeutisch und/ oder pflegerisch relevant sind. Um die Diagnosen und Tätigkeiten vollständig abzubilden beinhaltet die Codierung der ärztlichen Leistungen im Computersystem auch die Codierung der „pflegerischen Nebendiagnosen“. Die Intensivpflegenden codieren die pflegerischen Leistungen (lt.OPS-301) und die „pflegerischen Nebendiagnosen“ (lt.ICD-10-GM) ebenfalls am Computer und arbeiten somit dem Arzt „in die Hand“. Diese pflegerischen Nebendiagnosen müssen sich auch in der täglichen Pflegedokumentation widerspiegeln. Der MdK behält sich die Überprüfung der Übereinstimmung der handschriftlichen Dokumentation und der digitalen Codierung vor.
2.2.3.1 Einbindung von Scores in das Dokumentationssystem
Zu den bisher üblichen Dokumentationsanteilen findet die Dokumentation von Score-Systemen im Bereich der Intensivmedizin immer mehr Anwendung. Ab 2005 wird das DRG-System (Diagnosis Related Groups) in Bezug auf die Intensivdokumentation erweitert (DIMDI, 2004; DKG, 2004). Aktuell wird die Anwendung des TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System) und des so genannten „total-SAPS II“ (Simplified Acute Physiology Score) im Hinblick auf eine Nutzung zur ökonomischen Abgrenzung von DRG-Fallgruppen im Bereich der Intensivmedizin diskutiert. Beide Systeme werden auch von der deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) als Bestandteil im Kerndatensatz zur Qualitätssicherung empfohlen. In einer Stellungnahme zu diesem Thema in der DRG-Zeitung vom 25.8.04 erscheint die Anwendung beider Scores zur Evaluation von DRG-Fallgruppen im intensivmedizinischen Bereich als machbar und sinnvoll (Sommerhäuser 2004). Ab 2006 wird die Codierung der „Intensivmedizinischen Komplexbehandlung“ als Abrechnungsgrundlage verlangt, die oben genannte Scores zusammenfasst.
Nicht nur die „Intensivmedizinische Komplexbehandlung“, sondern auch pflegerische Scores werden in zunehmendem Maße in der Dokumentation verlangt, da sie über eine einheitliche Taxonomie den Status des Patienten und die Kausalität der pflegerischen Interventionen darstellen können. Hierzu stehen Scores, wie z.B. die Norton-, oder Braden-Skala zur Beurteilung des Risikos zur Dekubitusbildung, zur Verfügung. Zur Beurteilung der Agitiertheit des Patienten in Bezug auf die Sedierungstiefe stehen Scores, wie die Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), die Motor Activity Assessment Scale (MAAS), der RAMSAY Score, oder die Riker Sedation-Agitation-Scale (SAS) zur Verfügung. Von den Scores ist nur der Riker-SAS validiert. Ebenso stehen unterschiedliche Scores zur Beurteilung des Schmerzes zur Verfügung, auf deren Grundlage eine angemessene Therapie und Pflege in der Patientendokumentation kausal verständlich wird.
2.2.4 Pflegedokumentation als Teil der Qualitätssicherung
Die Qualität von Pflegedokumentationen wird als Teilqualität der gesamten Pflegequalität angesehen. Eine gute Pflegequalität ist die Summe vieler einzelner Qualitäten (Pflegemodell, Pflegstandards etc.). Das heißt, dass eine qualitativ gute Pflegedokumentation nicht ein Garant für eine gute Pflege ist, jedoch gute Pflege eine gute Dokumentation mit beinhaltet (Mahler et al. 2001).
Abt-Zegelin (2003) fordert eine „intelligente Dokumentation“, die einen größeren Umfang der Dokumentation einschränkt.
„Für die DRG-Zeiten bedeutet dies, die Pflegeanamnese zu qualifizieren, Pflegebedürftigkeit zu operationalisieren, stärker zu standardisieren und Leistungserfassungssysteme zu entwickeln, die den Pflegeaufwand abbilden können“ (Abt-Zegelin 2003: 221).
Darüber hinaus werden durch die exakt erhobenen Daten Qualitätssicherungsmaßnahmen unterstützt, die eine wissenschaftliche Auswertbarkeit von Daten gewährleisten und Kostentransparenz sowie effiziente Personal- und Materialkalkulation ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der Evaluation der Patientendokumentation im Zuge des Qualitätsmanagements ebenfalls eine zentrale Rolle zukommt. So fügt sie sich als wichtiger Faktor in das Hauptkriterium „Prozesse“ des EFQM-Modells und ist expliziter Bestandteil nationaler und internationaler Zertifizierungs- und Akkreditierungsverfahren in Krankenhäusern (ANAES 1999; KTQÒ 2000; Simon 2000). Das St. Vincenz-Krankenhaus befindet sich momentan in der Zertifizierungsphase nach KTQÒ. Die Entwicklung eines Patientendokumentationssystems, das den gestellten Qualitätsanforderungen entspricht, hat somit Anteil am Zertifizierungsprozess des Krankenhauses.
2.3 Der Pflegeprozess
Der Pflegeprozess in seiner heutigen Form beruht auf einem langen Entwicklungsprozess, der in den USA seinen Ursprung fand. 1955 wurde er von Lydia Hall anlässlich einer Vorlesung vorgestellt. In den darauf folgenden Jahren wurde der Pflegeprozess weiterentwickelt und bestand Mitte der siebziger Jahre aus folgenden Phasen: Informationssammlung, Diagnose, Planung, Durchführung und Evaluation (Arets et al. 1996). Anfang der achtziger Jahre machten die beiden Schweizer Krankenschwestern Fiechter und Meier den Pflegeprozess in ihrem Buch „Pflegeplanung“ (1981) im deutschsprachigen Raum bekannt. In der deutschsprachigen Literatur wird häufig der Begriff „Krankenpflegeprozess“ synonym mit „Pflegeprozess“ benutzt, bedingt durch die Übersetzung aus dem Amerikanischen („nursing process“). Er dient der systematischen Beschreibung der Pflege als berufliche Tätigkeit und hat sich im deutschsprachigen Raum unter dem Begriff „Pflegeprozess“ etabliert. Daher wird in dieser Arbeit weiterhin der Begriff „Pflegeprozess“ verwendet.
Der Pflegeprozess beschreibt ein methodisches Vorgehen zur Planung und Steuerung der pflegerischen Maßnahmen.
„Er besteht aus einer Reihe von logischen, voneinander abhängigen Überlegungs-, Entscheidungs- und Handlungsschritten, die auf eine Problemlösung, also auf ein Ziel hin, ausgerichtet sind und im Sinne eines Regelkreises einen Rückkopplungseffekt (Feedback) in Form einer Beurteilung und Neuanpassung enthalten“ (Fiechter und Meier 1998: 42).
Nachdem die Forderung nach Anwendung des Pflegeprozesses 1974 in das WHO-Programm aufgenommen wurde, priesen Berufsverbände, Fachzeitschriften, Weiterbildungsinstitute und Hersteller von Dokumentationssystemen die Prozessmethode als Chance und Notwendigkeit für die Professionalisierung der Pflege. Fiechter und Meier (1998) stellten eher den Aspekt der Problemlösung in den Vordergrund. Fachkompetentes Handeln, so Lay und Brandenburg (2001), scheinen ohne Pflegeplanung nicht mehr denkbar zu sein. „ Geplante Pflege [ ist ] unabdingbarer Bestandteil fachkompetenten beruflichen Handelns“ (Schewior-Popp 1998: 168). „Dennoch ist es hierzulande immer noch nicht gelungen, die Pflegeplanung [ … ] zu etablieren“ (Moers, 1998: 4). Erfolgreiche Pflegeplanung ist nach Aussage von Thiel (2001) nur möglich, soweit es die Qualifikation der Pflegekräfte und die Rahmenbedingungen zulassen. Hier zählt auch die Qualität der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (Müller Staub 2004; Brandenburg 1998). Müller Staub (2004) spricht in diesem Zusammenhang davon, dass praktisch die Pflegedokumentation zur Patientendokumentation geworden ist. Die Pflege übernehme mehr Verantwortung im interdisziplinären Behandlungsteam.
Die Auffassungen von der Bedeutung des Pflegeprozesses gehen weit auseinander. Während die Vertreter eines interaktionstheoretischen Pflegeverständnisses unter dem Pflegeprozess den Verlauf und die Gestaltung der Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient verstehen (Beziehungsprozess) (Stratmeyer 1997), sehen ihn andere als technische Arbeitsmethode zur systematischen Lösung von Patientenproblemen (Problemlösungsprozess) (Arets et al. 1996; Mayer 2000). Höhmann et al. (1996) verstehen den Pflegeprozess nicht als Pflegetheorie, sondern eher als Handlungsmodell, das dem Ablauf von zielgerichtetem Handeln in der Pflege entspricht. Vorgaben über die konkreten Inhalte der Pflege sind nicht vorgegeben.
Auch die Terminologie in Bezug auf die einzelnen Phasen des Pflegeprozesses ist nicht einheitlich (4-, 5- und 6-schrittige Modelle) (s. Abbildung 1: Gegenüberstellung Pflegeprozess (Quelle: Michalke 2001). Es lassen sich aber überall vier Hauptkomponenten finden, die mit Erfassen, Planen, Durchführen und Evaluieren bezeichnet werden (Wicha 2001). Diese vier Komponenten finden sich auch in der Pflegeprozessdefinition der WHO (Assessment, Planning, Intervention, Evaluation).
Schritte/ Phasen des Pflegeprozesses:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Gegenüberstellung Pflegeprozess (Quelle: Michalke 2001)
Da in Deutschland die Interpretation der jeweiligen Inhalte des Pflegeprozesses unterschiedlich ausfällt, ergaben sich in der Folge erhebliche Variationen in der praktischen Umsetzung.
Will der Pflegeprozess wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden und darüber hinaus auch praktikabel sein, müssen folgende Grundlagen erfüllt sein:
1. Es müssen wissenschaftlich akzeptierte Modelle/ Theorien zugrunde gelegt werden.
2. Es muss ein Begriffssystem verwendet werden, welches auch außerhalb spezifischer Fachterminologie den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt.
3. Der so formulierte Prozess muss gesellschaftlichen Ansprüchen genüge tun, d.h. er muss in seinen Möglichkeiten an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie z.B. juristischen Regelungen orientiert sein.
Der Pflegeprozess umfasst eine Reihe von aufeinander aufbauenden Schritten, die zwar einzelne Aktivitäten darstellen, aber miteinander verknüpft sind und einen kontinuierlichen Zyklus von Gedanken und Interventionen darstellen (s. Abbildung 2: Der Pflegeprozess als Regelkreis (Quelle: Loskamp 2003)). Dieser sechsschrittige Regelkreis bietet als Grundlage für das pflegerische Handeln eine gute Struktur.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Der Pflegeprozess als Regelkreis (Quelle: Loskamp 2003)
Die dokumentierten Informationen aus dem Pflegeprozess müssen selbstverständlich in den Entscheidungsprozess für den weiteren Behandlungsverlauf mit einbezogen werden, um so eine Kontinuität der Behandlung zu gewährleisten.
Die Vorteile, die der Pflegeprozess als geplante Pflege für den Patienten hat, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
- sein individuelles Erleben und seine Bedürfnisse werden besonders gewichtet,
- die geplante Pflege beinhaltet eine gezielte Suche nach der besten Lösung für pflegerische Probleme,
- die Pflegeplanung unterstützt die Kontinuität der Teamarbeit, was für einen Menschen, der täglich von unterschiedlichen Personen intensiv betreut wird, von großer Bedeutung ist,
- Pflegeplanung und –dokumentation gewährleisten für den Patienten Sicherheit und Qualität.
Die Therapiemaßnahmen und der dazugehörige Heilungsverlauf von z.B. Wunden werden somit im Zusammenhang überblickbar.
In der Pflege wird das Assessment für die erste sowie die fortdauernde gesundheitliche Beurteilung einer Einzelperson genutzt. Ein systematisches Assessment beruht auf einem systematischen Plan zur Sammlung und Strukturierung von Informationen. Es hat zum Ziel, die Gesundheitsbeurteilung und Pflegediagnostik zu erleichtern.
Informationssammlung kann erfolgen:
- direkt vom Patienten,
- durch eigene Beobachtung,
- durch Aussagen von Angehörigen,
- aus Krankenunterlagen,
- durch Gespräche im Pflegeteam.
Ziele der Informationssammlung sind:
- Kennen lernen des Patienten,
- Abschätzen des Pflegebedarfs,
- Aufbau einer Beziehung,
- Erfassen spezieller Probleme, Pflegebedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten des Patienten,
- Aufnehmen von a) objektiven Daten (messbare Parameter wie Größe, Gewicht, etc.); b) subjektive Daten (Empfindungen, Gefühle).
Das Assessment leitet unmittelbar zu den Diagnosen über. Die Informationen oder Daten vom oder über den Patienten bestehen aus objektiven und subjektiven Informationen. Subjektive Daten sind diejenigen, die vom Patienten oder seinen Bezugspersonen in eigenen Worten angegeben werden. Objektive Daten sind quantitative Daten, die von außen beobachtet, beschrieben, gemessen oder von anderen Personen bestätigt werden können. Dazu gehören auch Resultate medizinischer Befunde oder körperlicher Untersuchungen. Man muss aber immer berücksichtigen, dass die Problemidentifikation auch ein „Element der Ungewissheit“ beinhaltet (Gordon und Bartholomeyczik 2001: 19).
Müller Staub (2004) fordert, dass die Erhebung pflegerischer Daten möglichst durch keinerlei Störungen, wenig Lärm und eine entsprechende Umgebung mit komfortabler Sitzgelegenheit unterstützt werden sollte. Dies mag durch die Notwendigkeit der alarmgebenden Monitorsysteme auf einer Intensivstation aber nur äußerst selten möglich sein. Um eine unnötige Doppelbefragung der Patienten zu vermeiden, fordert Schiereck (2000) die Übernahme z.B. der Stammdaten des Patienten aus der Aufnahmeverwaltung zu übernehmen, wie dies in Form von Etiketten der Fall sein könnte.
Die Analyse der gesammelten Daten führt zur Identifikation von Problemen oder Bereichen, in denen ein Bedarf besteht.
Es werden drei Problemtypen unterschieden:
1.) aktuelle Probleme (mess- oder beobachtbar)
2.) potentielle Probleme (sie können durch prophylaktisches Handeln verhindert werden)
3.) verdeckte Probleme (ergeben sich aus Verhalten von Patienten und/ oder Angehörigen)
Diese Probleme oder der Bedarf werden mit Pflegediagnosen beschrieben (s. 2.4.4 Pflegediagnosen). Nach der Problemidentifikation schließen sich die Problemlösungsmaßnahmen an, zu denen die Pflegezielbestimmung, die Pflegeplanung, Interventionen und die Ergebnisbewertung gehören.
Zu jedem formulierten Pflegeproblem gehört ein Pflegeziel. Doenges et al. (2002) fordern, dass die Zielformulierungen auch für den Patienten verständlich sein sollen.
Ein Pflegeziel beschreibt:
- welchen Erfolg die Pflege in einem festgelegten Zeitraum haben soll,
- welche Fortschritte und Eigenständigkeiten des Patienten erreicht werden sollen. Hierbei unterscheidet man Nah- und Fernziele.
Ein Pflegeziel:
- muss realistisch, erreichbar und überprüfbar sein,
- soll eindeutig und so knapp wie möglich formuliert werden,
- soll keine Pflegemaßnahmen beschreiben,
- soll möglichst einen qualitativen oder quantitativen Hinweis enthalten.
Im Anschluss folgt die Planung der Maßnahmen.
- In der Planung werden die Maßnahmen und die Art des Vorgehens festgelegt. Sie orientieren sich an den individuellen Ressourcen und Problemen des Patienten.
- Die Planung der Maßnahmen stellt die eigentliche Pflegeverordnung dar und ist von allen Pflegenden einzuhalten und auf die Wirksamkeit zu überprüfen.
- Aus der dokumentierten Planung muss klar hervorgehen, was, wann, wie, wie häufig und womit gemacht werden soll.
Die Planung dient als Vorbereitung für die Interventionen, die sich hieran anschließen. Interventionen sind Handlungsschritte, um erwünschte Pflegeergebnisse zu erreichen. Wegen der Forderung, sie an andere Pflegende weitergeben zu können, müssen sie genau formuliert werden. Die Interventionen können unabhängiger oder interdisziplinärer Natur sein. Sie müssen die Entwicklung des Patienten hin zu Gesundheit, Unabhängigkeit und physiologischer Stabilität fördern.
- Die geplanten Maßnahmen gelten als verbindlich für alle Pflegenden.
- Begründete Abweichungen müssen schriftlich fixiert werden.
- Bei der Durchführung ist stets der gesamte Pflegeprozess zu beachten.
- Die geplanten Interventionen werden vorgenommen und in Form eines Pflegeberichts mit Datum, Uhrzeit sowie Unterschrift, bzw. Handzeichen der Pflegekraft dokumentiert.
Der Pflegebericht gibt Auskunft über:
- die Wirkung der Pflegemaßnahmen,
- die Veränderungen im Krankheitsbild,
- besondere Beobachtungen hinsichtlich der physischen und psychischen Verfassung des Patienten.
Die Bezugsschwester muss regelmäßig die Fortschritte des Patienten und die Wirksamkeit des Plans in der Evaluationsphase prüfen. Durch diese Beobachtung kann eingeschätzt werden, ob der Plan beibehalten oder modifiziert werden muss.
Die Evaluation der Pflege
- dient der Erfolgskontrolle,
- dient der Qualitätssicherung,
- ist Grundlage für die Modifikation der Interventionen.
Wurde das Pflegeziel erreicht, ist die Intervention abgeschlossen und dieses wird dokumentiert. Wenn Pflegeziele nicht erreicht wurden, ist die Ursache dafür zu suchen und eine Neuanpassung im Pflegeplan vorzunehmen.
Mögliche Ursachen für Zielverfehlungen sind:
- lückenhafte Informationssammlung,
- falsche Einschätzung der Ausgangssituation,
- unrealistisch gesetzte Pflegeziele.
- nicht erkannte Pflegeprobleme,
- falsch eingeschätzte Ressourcen,
- unangemessene oder ungeeignete Pflegeinterventionen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte 1984 im Programm Gesundheit für Alle bis zum Jahr 2000 im Ziel 31, dass „bis zum Jahr 1990 alle Mitgliedsstaaten effektive Mechanismen zur Qualitätssicherung der Krankenversorgung in ihren Gesundheitssystemen etabliert haben sollen“ (WHO 2004). Das Ziel ist es, durch eine regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Versorgung bessere Behandlungsergebnisse für alle Patienten zu erzielen. In der Intensivversorgung, wie in anderen Spezialbereichen, findet im Rahmen von Entscheidungsprozessen in der Praxis bereits unbewusst eine Evaluierung statt, wenn in rascher Folge Interventionen vorgenommen werden, um das gewünschte Ziel, nämlich das Wohlbefinden und die Stabilität des Patienten, zu erreichen.
Folgende Fragen sollte sich der Behandelnde zur Evaluation stellen (nach Hunt und Marks-Maran 1986, in: Millar und Burnard 2002):
- Ist die anfängliche Einschätzung immer noch gültig?
- Spiegeln die vermerkten Probleme/ Bedürfnisse immer noch die Situation des Patienten wider?
- Sind die angestrebten Ziele immer noch gültig und sind sie realistisch?
- Sind die pflegerischen Maßnahmen wirksam und sind sie weiterhin angemessen?
- Ist der gestattete Zeitraum vor der Evaluierung des Ergebnisses realistisch gesetzt?
Die Evaluation sollte jede Pflegeperson für sich vornehmen. Es kann und sollte aber auch die Schichtübergabe genutzt werden, um die Ziele für den Patienten zu besprechen und eventuell zu modifizieren.
Hallensleben (2004) hat als Überprüfung der direkten Pflege am Pflegeprozess die Pflegevisite diskutiert. Diese Pflegevisite sollte durch die Pflegedienstleitung gemeinsam mit dem Patienten und der Bezugspflegekraft in einem Konferenzcharakter durchgeführt werden. Hierfür ist eine transparente Patientendokumentation Grundlage. Heering (2004) setzt den Begriff Pflegevisite mit den Begriffen „Dienstübergabe“, „Rapport am Bett“, „Pflegegespräch“, „Übergabe“ gleich. Es wird der Patient als gleichberechtigter Partner bei dem Gespräch gesehen.
Lübke (1997) und Morawe-Becker (2004) stellen fest, dass bei der Verwendung des Pflegeprozesses die benötigte Zeit für die Übergabe verkürzt wird. Der Pflegeprozess wird in den meisten Spitälern der Schweiz umgesetzt (Müller Staub 2004). Reinhard (1998) ergänzt, dass ohne eine systematische Form der schriftlichen Dokumentation die Umsetzung des Pflegeprozessmodells faktisch nicht möglich ist.
2.3.1 Merkmale des Pflegeprozesses auf Intensivstationen
Besonderheiten des Pflegeprozesses auf Intensivstationen liegen vor allem im Gesundheitszustand der zu Pflegenden und ihren daraus resultierenden eingeschränkten Möglichkeiten der Kommunikation begründet, sowie der engen Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegenden und der hohen Verantwortung, die die Pflegenden im Umgang mit den Patienten haben. Auf Intensivstationen wird Professionalität weniger über einzelne Interventionen als über patientenorientiertes Arbeiten erlangt. Die Pflegeperson übernimmt die Verantwortung für getroffene Entscheidungen und die daraus resultierenden Handlungen innerhalb ihres Kompetenzbereichs. Um diese Patientenorientierung zu erreichen, ist es erforderlich, eine Rückmeldung vom Patienten zu bekommen. Viele Entscheidungen im Bereich von Pflege, Diagnosen und Therapie auf Intensivstationen werden allerdings in Situationen getroffen, in denen sich Patienten bereits in einem komatösen Zustand befinden oder unter massiven Pharmazeutikagaben stehen, so dass Dialoge unmöglich sind. An diesem Punkt setzt ein großer Unterschied im Vergleich zu anderen Pflegeeinrichtungen an. Das Erfassen, Analysieren und Ordnen der Bedürfnisse und Probleme ist in den seltensten Fällen gemeinsam mit dem Patienten möglich. Informationssammlung erfolgt meist über Bezugspersonen (Angehörige). Manchmal ist selbst die Befragung von Bezugspersonen nicht möglich, sodass der Pflegende lediglich eine Statuserhebung machen kann, um eine aktuelle organische Gefährdung zu erkennen. Pflegeziele gehen nicht objektiv aus Berechnungen und Analysen hervor, sondern sie sind Verhandlungsergebnisse zwischen zwei Personen. Pflegeziele sind auch nur dann erreichbar, wenn Patienten sich mit ihnen identifizieren (Stratmeyer 1997). Bei in der Kommunikation eingeschränkten Patienten ist dies ebenso wenig möglich, wie bei solchen, die nicht compliant sind (z.B. bei alkoholisierte Patienten). Hier muss die Pflege die Pflegeziele selber festlegen.
2.3.2 Kritik am Pflegeprozess
Trotz der offensichtlichen Vorteile des Pflegeprozesses gibt es von Seiten der Pflegenden teils immer noch Bedenken. Die Rubriken der Pflegedokumentation (die nach dem Pflegeprozess aufgebaut sind) mit Pflegeproblem und Ressourcen, Pflegezielen und Pflegemaßnahmen bleiben häufig leer, da die in der Praxis tätigen Pflegenden oft der Ansicht sind, dass zuviel Schreibarbeit auf sie zukomme, die komplette Dokumentation ohnehin nicht gelesen würde, die Pflegesituation sich zu schnell ändere und sie dadurch mit der Dokumentation nicht nachkämen. Andere Gründe für das Leerbleiben dieser Rubriken sind umständliche Formulierungen. Oftmals werden Pflegepläne lediglich aus Gründen der Kostenerstattung oder zur Befriedigung der Stationsleitung angefertigt (Stratmeyer 1997; Doenges et al. 2002). Unter solchen Umständen findet dann auch keine Evaluation der gegebenen Pflege statt und somit erfüllt der Pflegeprozess auch seine Aufgabe als Instrument der Qualitätssicherung nicht (Stratmeyer 1997).
Fischbach (2001) kritisiert das Arbeiten anhand von vorgefertigten Rastern, das die intuitive berufliche Erfahrung verleugnet. Der Pflegeberuf sei deshalb nur noch eingeschränkt autonom, die Forderung nach ganzheitlicher Pflege mit der Verwendung des Pflegeprozesses nicht vereinbar. Der Mensch werde zu einem Problemkomplex minimiert. „Diese ausgesprochene statische Auffassung vom Menschen verstellt den Blick für die Prozesshaftigkeit des Seins“ (Fischbach 2001: 175). Er konstatiert, dass für die Weiterentwicklung der Professionalisierung der Pflegeberufe der Pflegeprozess nicht länger notwendig sei.
Der Pflegeprozess wurde mehrfach als zu technisch und theoretisch nicht fundiert kritisiert. Dabei wurde argumentiert, dass die uniforme Sprache das Risiko der Fragmentation und Reduktion beinhaltet. Das wiederum vermittelt in seiner Anwendungspraxis den Eindruck, als ließe sich der pflegebedürftige Mensch in eine Vielzahl einzelner Probleme und Ressourcen zerlegen. Häufig entstehen kleine Probleme in der laufenden Begegnung mit dem Patienten, z.B. Schmerzen bei der i.m.-Injektion, Schamgefühl beim Einlauf, Erbrechen nach der Mahlzeit. Es wird der Eindruck vermittelt, als sollten jedes Mal diese im Zusammenhang mit bestimmten Interventionen auftretenden Probleme in den Gesamtprozess von Problem-, Ziel und Interventionsformulierungen mit aufgenommen werden. Pflegeplanung würde die ständige Dokumentationsanpassung bedeuten, die im Pflegealltag nicht zu bewältigen ist. Nach Aussage von Stratmeyer (1997) ist deshalb die Pflegeplanung derart komplex, dass sie als tägliche Arbeitsgrundlage nicht geeignet ist. Zieger (2002) bemerkt, dass vieles von dem, was Pflegeprozess genannt wird, in der Vergangenheit schon berücksichtigt wurde. Nur war es häufig aufgrund der fehlenden Dokumentation nicht nachvollziehbar.
Trotz aller Kritik wird die Patientenbetreuung durch die Verbesserung des Informationsstandes der an der Behandlung und Betreuung beteiligten Mitarbeiter, optimiert. Dies gewährleistet die Dokumentation des Pflegeprozesses.
2.4 Klassifikationssysteme der Pflege
Als Grundlage zur Erstellung einer Pflegediagnose dient als erster Schritt im Pflegeprozess die Einschätzung des Patienten bei der die Pflegeanamnese die wichtigste Rolle spielt.
Umgangssprachlich wird ein Klassifikationssystem häufig mit Bezeichnungen wie Struktur oder Ordnungsschema gleichgesetzt. Im wissenschaftlichen Sinn zeichnen sich Klassifikationen jedoch durch eine Reihe von festgelegten Regeln aus.
Ganz allgemein kann Klassifikation als der Versuch verstanden werden, eine systematische Ordnung von Gegenständen, Begriffen oder Erscheinungen (Phänomenen) vorzunehmen, die eine feststehende Benennung durch sprachliche Mittel erhalten. Die betreffenden Gegenstände, Begriffe oder Erscheinungen müssen in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung stehen und können dann in Gruppen und Untergruppen aufgeteilt werden, welche jeweils durch bestimmte Merkmale charakterisiert sind. Miteinander in Verbindung stehende Begriffe sind z.B. dort zu finden, wo eine Fachdisziplin, wie in diesem Fall die Pflege, ihren Gegenstandsbereich beschreibt. Die hierarchische Ordnung der in Verbindung stehenden Begriffe besteht aus Konzepten mit breiter Reichweite und hohem Abstraktionsgrad, die – aus der Botanik stammend – als Klasse oder Gattung bezeichnet werden und Konzepten mit eingeschränkter Reichweite und niedrigem Abstraktionsgrad, die als Art bezeichnet werden. Ein ursprünglicher Zusammenhang zwischen Konzepten besteht dann, wenn die untergeordneten Konzepte alle Charakteristika der übergeordneten und zusätzlich mindestens ein Unterscheidungsmerkmal enthalten. Der Umfang jeder Klassifikation, also auch die Anzahl der hierarchischen Stufen, hängt von der Menge der Merkmale ab (König 2002b).
Pflegeklassifikationen werden in dem Projektbericht von Weidner und Isfort als „[…] logisch zusammenhängende Begriffssysteme, die zu einer ganzheitlichen Sprachbildung in der Pflege verwendet werden können“, bezeichnet (Weidner und Isfort 2001: 127). Die Anwendung von Pflegeklassifikationen findet derzeit für pflegediagnostische Prozesse (NANDA, ICNP), Pflegeinterventionen (NIC, LEP ICNP) und Pflegeergebnisse (NOC, ICNP) statt. Pflegeklassifikationen setzten also in ihrer Systematik an verschiedenen Punkten prozesshafter Pflege an und können somit vollständig oder ergänzend genutzt werden (Etzel 2000; Wicha 2001).
Einerseits werden Pflegeklassifikationen dargestellt:
- als Grundlage für die Entwicklung der Profession,
- zur Entwicklung einer einheitlichen Fachsprache,
- als Grundlage für eine exakte und vergleichbare Dokumentation,
- als Instrument zur Sichtbarmachung von Pflegeleistungen,
- zur Sicherstellung einer zielgerichteten und geplanten Pflege,
- als Instrument der Qualitätssicherung
(Georg 1997; Friesacher 1999; König 2000a; Goosen 2001).
Andererseits werden Pflegeklassifikationen im Allgemeinen kritisiert:
- wegen ihrer zu geringen Flexibilität im Umgang mit der Individualität der Patienten,
- angesichts der Anpassung der Pflege an Normvorstellungen gesundheitlicher Zustandsbewertung,
- weil die komplexe und umfassende Realität der Pflegepraxis zu wenig dargestellt und zum Teil ein verkürzter Handlungsbegriff angewandt wird und
- wegen ihrer geringen Praxistauglichkeit (z.B. ICNP) auf Grund ihrer hohen Komplexität (Friesacher 1998; Friesacher 1999).
2.4.1 NANDA
Anfang der 70er Jahre schloss sich eine Gruppe von Experten zusammen und ermittelte die häufigsten Pflegeprobleme der Praxis. Hieraus entstand die NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), deren erste Konferenz 1973 zum Zweck des Erfahrungsaustausches stattfand. Seitdem werden in regelmäßigen Abständen NANDA-Konferenzen abgehalten, deren Berichte dann in Buchform herausgegeben werden. Hieraus entstand ein Klassifikationssystem, welches multiaxial ist und sieben Achsen aufweist. Das NANDA-Klassifikationssystem beinhaltet außerdem 13 Domänen, 46 Klassen und 154 Pflegediagnosen. Diese Klassifikationen der Pflegediagnosen bilden in einheitlicher, taxonomisch geordneter Sprache die Gesundheitsprobleme ab, auf die Pflegende durch Pflegeinterventionen Lösungen bieten.
Im Zusammenhang mit der NANDA-Klassifikation wurden die NIC (Nursing Interventions Classification) und NOC (Nursing Outcomes Classification) entwickelt. Zusammen bilden die drei Klassifikationen ein so genanntes Triptychon (Bulechek et al. 1990). Die NIC umfasst sechs Bereiche, 26 Klassen und 486 Interventionen.
Die NANDA-Klassifikation wurde im amerikanischen Pflegekontext entwickelt. Es wurde öfters kritisiert, dass die amerikanisch geprägte NANDA-Klassifikation „kulturell nicht kompatibel“ mit Europa sei. Begriffe, welche aus dem Fokus der Pflege formuliert wurden, erscheinen hierzulande oft fremd. Unterschiede bestehen sicherlich bezüglich der Anerkennung und Rolle der Pflege als Profession. Die Klassifikationen der Diagnosen, Interventionen und Ergebnisse hingegen haben zum Ziel, den Wissenskörper und den Verantwortungsbereich der Pflege zusammenzufassen.
Im Netzwerk Pflegediagnostik, welches in der Schweiz über 1000 Mitglieder zählt, wird sich rege über aktuelle Projekte und Entwicklungen ausgetauscht. Dabei zeigt sich, dass Pflegediagnostik in manchen Spitälern/ Institutionen ein wichtiges Thema ist. Die Umfrage am Netzwerk und in Universitätsspitälern ergab, dass die NANDA die meist angewandte Pflegediagnostikklassifikation darstellt. Eine Befragung in vier Universitätsspitälern zeigte, dass Pflegediagnostik ganz oder teilweise eingeführt wurde. Die Befragten hoben die Wichtigkeit der Umsetzung des Pflegeprozesses als Basis vor der Einführung der Pflegediagnostik hervor (Müller Staub 2004). Müller Staub (2004) hat verschiedene Pflegeklassifikationssysteme (ICF, ICNP, NANDA, ZEFP) anhand wissenschaftlicher Kriterien miteinander verglichen und herausgefunden, dass die NANDA-Klassifikation die höchste Anzahl der zu erfüllenden Kriterien aufweist und deshalb empfohlen wird. Die NANDA-Klassifikation befindet sich in einem immer fortwährenden Forschungsprozess, und wird ständig aktualisiert und international weiterentwickelt.
2.4.2 ACENDIO
Die ACENDIO wurde bei der zweiten europäischen Konferenz für Pflegediagnosen in Brüssel 1995 gegründet. Da ein kritikloses Übernehmen der NANDA-Klassifikation für den europäischen Bereich nicht sinnvoll ist, hat sich die ACENDIO zum Ziel gesetzt, ein europäisches Klassifikationssystem zu entwickeln.
2.4.3 ICNP
Veränderungen in der Gestaltung, Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens erhöhen den Bedarf nach einer gemeinsamen, einheitlichen Fachsprache.
Die ICNP ist eine auf internationaler Ebene entwickelte Klassifikation von Pflegephänomenen, Pflegeinterventionen und Pflegeergebnissen. Mit dieser Struktur lehnt sie sich an das von McCloskey und Bulechek entwickelte und breit akzeptierte Triptychon an (McCloskey und Bulechek 2002). Die internationale Klassifikation der Pflegepraxis (ICNP) wurde 1989 vom International Council of Nurses (ICN) mit dem Ziel initiiert, die Pflegepraxis zu umschreiben und eine gemeinsame Sprache für Kommunikation zwischen Pflegenden zu bieten. Das Dänische Institut für Gesundheits- und Pflegeforschung nahm diese Anregung auf. Um die elektronische Dokumentation, Analyse und Präsentation der ICNP zu ermöglichen, wurde das Projekt TELENURSE (Hinz et al. 1999), finanziert von der EU, ins Leben gerufen. Es wird vom Dänischen Institut für Krankenpflege und Gesundheitsforschung in einer gemeinsamen Arbeit von Pflegewissenschaft, Praxis und Informatik geleitet und die Alpha-Version der ICNP wurde in elf europäische Sprachen übersetzt (1996). Die ersten Erfahrungen mit der ICNP wurden auf der TELENURSE-Konferenz in Athen im Oktober 1996 ausgetauscht.
1989 wurde auf der Tagung des „Weltbundes für Krankenschwestern und Krankenpfleger“ in Seoul beschlossen, das Klassifikationssystem der Medizin (ICD) mit dem Klassifikationssystem der Pflege zu ergänzen, doch die Aufnahme der NANDA-Pflegediagnosen in die ICD-10 wurde von der WHO abgelehnt. Nun wird intensiv an der ICNP weiter gearbeitet. Die Pflegenden sehen zwar die Notwendigkeit des Systems, beklagen jedoch die umständliche Handhabung, welche als zu ungenau und zu umfassend dargestellt wird (Trambale-Faltus 2004).
Als Rahmenklassifikation soll die ICNP die Zuordnung bestehender Vokabularien und Klassifikationen und den Vergleich von Pflegedaten ermöglichen. Entsprechende Verweisstrukturen (Mappings) sollen die internationale Vergleichbarkeit pflegerischer Dokumente sichern. Die jetzt vorliegende Beta-Version umfasst insgesamt 2563 Begriffe für Pflegephänomene und Pflegehandlungen (Hinz et al. 1999; Etzel 2000). Dabei kann die ICNP als Referenzklassifikation dienen, damit Pflegende ihre regionalen oder einrichtungsspezifischen Begriffe weiter verwenden können.
2.4.4 Pflegediagnosen
Das Ziel der Pflegediagnosen besteht darin, Patienten individuell und richtig einzuschätzen, um ihnen die bestmögliche Pflege zu bieten. Pflegediagnostik ermöglicht ein ganzheitliches, vernetztes Verständnis der Patientensituation. Hierzu wird eine einheitliche Taxonomie verwendet.
Doenges et al. 2002 bemerken, dass die Sprache der Pflegediagnosen unter anderem den Praktikern zur Dokumentation, Überprüfung und Weiterentwicklung des Pflegeprozesses dient. Die NANDA hat folgende Arbeitsdefinition akzeptiert:
„Eine Pflegediagnose ist eine klinische Beurteilung über die Reaktion eines Individuums, einer Familie oder einer Gemeinschaft auf aktuelle oder potentielle Gesundheitsprobleme/ Lebensprozesse. Pflegediagnosen bilden die Grundlage zur Auswahl von Pflegeinterventionen zur Erreichung von Ergebnissen, für die Pflegende verantwortlich sind“ (Doenges et al. 2002: 21).
Anderegg-Tschudin (1999) beschreibt die Veränderungen, welche durch die Einführung von Pflegediagnostik im Pflegemanagement hervorgerufen wurden. Sie geht davon aus, dass Pflegediagnostik ein Kernprozess im komplexen System Krankenhaus ist und einen unmittelbaren Beitrag auf die Dienstleistungserstellung hat und somit die Pflege fundamental verändert. Pflege kann somit benannt werden und ist durchschaubar.
Die Pflegediagnosen geben den Anlass für pflegerische Maßnahmen und zeigen den Fokus auf die Wahl von Pflegeinterventionen. Qualitativ gute Pflege hängt von den Informationen ab, zu denen der Pflegende Zugang hat.
„Pflegende sind Schlüsselpersonen im Sammeln von Informationen, im Beobachten der Patientinnen und im Generieren von Informationen. Die professionelle Entwicklung der Pflege führt zur Akzeptanz der Pflegediagnostik als wichtige Komponente und Schnittstelle im Pflegeprozess“ (Müller Staub 2004: 298).
Der Pflegende benötigt für die Diagnose Kenntnisse und Fähigkeiten, analytische Denkfähigkeit, eine gezielte Wahrnehmung und Erfahrung (Müller Staub 2004; Lassen, in: Mayer 2000). Die daraus resultierenden Interventionen führen zu einem Ziel, für das der Pflegende verantwortlich ist und auch jederzeit zur Verantwortung gezogen werden kann. Bei der Entwicklung der Pflegediagnosen wurde induktiv vorgegangen. Aus der Praxis wurden gut begründete und belegte Vorschläge zu Pflegediagnosen gesammelt, überarbeitet, modifiziert, neue hinzu- und alte herausgenommen. Gordon (2001) stellt fest, dass Pflegediagnosen eine Verbindung zwischen medizinischen Diagnosen und pflegerischen Pflegehandlungen beschreiben. Der Pflegeprozess ist ein Vorgang zur Identifizierung und Lösung von Problemen. Manche Kennzeichen sind diagnostische Kennzeichen (Hauptkennzeichen), d.h. ein entscheidendes definierendes Merkmal oder ein klinischer Indikator für einen funktionell gestörten (dysfunktionalen) oder potenziell gestörten Gesundheitszustand.
Pflegediagnosetitel werden zur Beschreibung des aktuellen oder potentiellen Pflegeproblems verwendet. Diese Pflegediagnosetitel sollen präzise und knapp formuliert werden und als Grundlage der Übergaben und Behandlung durch andere Berufsgruppen dienen (Gordon 2001).
Äthiologische oder verbindende Faktoren dokumentieren die möglichen Ursachen des Problems und bestimmen die Wahl der Intervention. Die Pflegediagnose kann, laut Aussage von Gordon und Bartholomeyczik (2001) entweder von der Pflegekraft, dem Patienten, oder beiden gemeinsam erfolgen. Für die Pflegesituation auf einer Intensivstation mag diese Aussage nicht in jedem Fall zutreffen, da die Kooperationsmöglichkeit des Patienten häufig nicht gegeben ist. Hier obliegt es der Pflegefachkraft, die Diagnose und Interventionswahl zum Wohle des Patienten zu wählen.
Pflegediagnosen, welche zu Beginn der pflegerischen Beziehung gestellt werden, sind immer als vorläufige „Arbeitsdiagnosen“ zu verstehen, welche im Laufe der Zeit validiert und spezifiziert werden müssen. König (2002a) stellt heraus, dass für das Erfassen der Bedeutung der Pflegediagnose für den Patienten, Pflegende weiterhin nach den Empfindungen, Einstellungen und Gefühlen fragen und diese miteinander in Beziehung setzen müssen.
Eine Umformulierung medizinischer Probleme zur Dokumentation der entsprechenden Pflege ist nicht notwendig (Gordon 2001; Gordon und Bartholomeyczik 2001), da sie eher zu Kommunikations- und Übermittlungsfehlern führen. Die Trennung zwischen ärztlichen und pflegerischen Diagnosen ist in der Praxis künstlich. Wird ein Patient als Person betrachtet, so ergänzen sich beide Berufsgruppen, um sich Hand in Hand bei der Überwindung dieser Probleme zu unterstützen. Aufgrund der hohen fachlichen Kompetenz der Pflegefachkräfte ist gerade auf einer Intensivstation von einem Behandlungsteam die Rede.
Die Ergebnisse einer Studie von Johnson und Hales zeigen, dass Pflegediagnostik dazu beiträgt die Patienten bedürfnisgerechter zu pflegen (Johnson und Hales 1989). Ebenso zeigt ein weiteres Forschungsresultat dieser Studie, dass Pflegediagnosen, die auf der NANDA-Klassifikation basieren, die berufsständischen Standards erfüllen und individuelle Pflege ermöglichen.
In Österreich wird Pflegediagnostik landesweit umgesetzt. Grundlage für die Einführung ist das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, welches am 1.1.1997 in Kraft getreten ist.
2.4.4.1 Kritik an der Pflegediagnostik
Im schnell sich wandelnden Alltag einer Intensivstation, wo sich der Gesundheitszustand und damit die Pflegeprobleme häufig innerhalb kürzester Zeit stark verändern, kann von einer Intensivpflegefachkraft nicht verlangt werden, kontinuierlich die aktuellen Pflegediagnosen durch Nutzung von Entscheidungsfindungssystemen dokumentarisch zu erfassen und in einen Pflegeplan umzuwandeln. Notfälle, wie z.B. ein Herzstillstand, erlauben es nicht, erst ein aufwendiges Pflegeassessment durchzuführen. Hier wird eine sofortige Intervention verlangt, die im Erfahrungsspektrum der Pflegekraft begründet liegt. Aufgrund körperlicher Instabilität der Patienten liegt die Aufteilung der pflegerischen Aktivitäten auf Intensivstationen nach Aussage von Gordon und Bartholomeyczik (2001) bei ca. 10 % für pflegerische und bei ca. 90 % für medizinische Aktivitäten. Ebenso können Pflegediagnosen nicht die gesamte Pflegepraxis beschreiben, sondern nur die aktuellen Pflegeprobleme.
Unzufriedenheit äußert sich in der Kritik, dass die persönliche Geschichte eines Menschen nicht mehr zähle, das standardisierte Denken, so wird geäußert, entpersonalisiere die Pflege (van der Bruggen 2002). Patienten sollen durch Pflegediagnosen nicht „schematisiert“ werden. Wenn die Titel der Pflegediagnosen vorschnell und fachlich unbegründet zugeordnet werden, besteht die Gefahr der Etikettierung (Kean 1999; Kesselring 1999).
3 Dokumentationspraxis
Die Dokumentationspraxis hat in der Vergangenheit auf Papier basierend stattgefunden. Aufgrund des Wandels der Technologie im Krankenhauswesen ist ebenso ein Wandel in der Dokumentationspraxis in Richtung Computer basierte Dokumentation festzustellen.
3.1 Konventionelle Pflegedokumentationen
In einer Studie von Martin et al. (1999) wurde die Dokumentationspraxis der Pflegenden auf einer Intensivstation und die Übereinstimmung der dokumentierten mit den tatsächlichen Gegebenheiten der Patientensituationen überprüft. Es zeigte sich, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumentationsarten auf derselben Station vorhanden war. Pflegende gaben an, dass sie den Patienten durch die enge Zusammenarbeit gut kennen würden. Diese Tatsache gaben sie als Grund an, nicht so häufig dokumentieren zu müssen. Die mündliche Übergabe ist die häufigste Übergabemethode. Auch Schindele (1998) stellt fest, dass die gängige Form der Informationsweitergabe zwischen Pflegenden die mündliche Übergabe ist. Bei ihr besteht die Gefahr, dass pflegerelevante Aspekte vergessen werden und somit die Qualität der pflegerischen Betreuung nicht gegeben ist. Martin et al. (1999) berichten, dass die Vitalzeichendokumentation durchgehend und vollständig durchgeführt wurde, was auch Franke (2002b) in seiner Untersuchung zeigen konnte. Einige Pflegende nutzten zusätzlich ein Kommunikationsbuch. Diese Vielzahl und Unvollständigkeit der Dokumentation bietet ein großes Potential, Fakten zu vergessen, die die übernehmende Pflegekraft für die Kontinuität und Sicherheit der Patientenbetreuung benötigt. Die durchschnittliche Dokumentationszeit pro Schicht wurde mit 56 Minuten, oder 12 % der Arbeitszeit ermittelt. Pflegende gaben als Grund für die mangelnde Dokumentation meistens Zeitmangel an. Pflegeergebnisse wurden ebenfalls nachlässig dokumentiert. Dokumentation ist der häufigste Grund für Überstunden auf der Intensivstation. Nach einer internen Erhebung auf der Intensivstation der Chirurgischen Universitätsklinik Regensburg mit zehn Intensivpflege-Planbetten entfallen vier bis fünf ärztliche Arbeitsstunden und sogar acht bis zehn pflegerische Arbeitsstunden pro Tag auf Dokumentationsaufgaben (Mann et al. 1996).
Gottschalk (in Mayer 2000) hat mit seiner Forschungsarbeit untersucht, welche Anforderungen Pflegende an einen Pflegebericht stellen, welche Informationen zu finden sind und ob der Verlauf der Patientenbetreuung in diesem ersichtlich ist. Es wurden problemzentrierte Interviews mit den Pflegenden geführt und diese analysiert. Dabei zeigte sich, dass nicht alle aufgestellten Kriterien immer erfüllt sein müssen, damit der Verlauf bei einem Patienten zu erkennen ist. Die Pflegenden gaben eine Reihe von Anforderungen an die Pflegedokumentation an. Den Verlauf der Pflege beschrieben sie nur aufgrund von Wirkungen und Auswirkungen der Pflegeinterventionen. In einigen Kategorien scheint das Dokumentieren für die Pflegenden eher als Absicherung gegenüber anderen Pflegenden, sowie dem ärztlichen Bereich zu sein. Die Gefahr besteht, dass die Dokumentation nur als Tätigkeitsnachweis gebraucht wird.
Benner (1994) konnte zeigen, dass Pflegende in der Lage sind, das Besondere der jeweiligen Patientensituation zu sehen und dem einzelnen Patienten gerecht zu werden. In diesem Sinne muss den Pflegekräften zugetraut werden, dieses Besondere in schriftlich angemessener Form darstellen zu können (Schiereck 2000). Die Informationssammlung sollte nicht auf das Aufnahmegespräch begrenzt, sondern bei Bedarf ergänzt werden. Allerdings meint Schiereck, dass Pflegeziele die während des Krankenhausaufenthaltes nicht erreicht werden können, erst gar nicht in der Zielformulierung der Pflegeplanung auftauchen sollten und deshalb auch nicht dokumentationswürdig seien (Stratmeyer 1997; Schiereck 2000).
Bartholomeyczik und Morgenstern (2004) haben im Rahmen einer umfassenden Qualitätssicherung in der Mehrzahl von Altenpflegeheimen in Frankfurt am Main eine standardisierte Untersuchung von Pflegedokumenten durchgeführt und mit Hilfe zweier übergreifender Fragestellungen, die sich auf Dimensionen der Vollständigkeit und der Prozessbezogenheit der Dokumentation bezogen, untersucht. Es konnte dargestellt werden, dass in der pflegerischen Dokumentation die Ressourcen der Patienten unzureichend dokumentiert und psychosoziale Probleme ignoriert wurden. Jedes fünfte Dokument enthielt keinerlei Angaben zu Pflegezielen. Ebenso fehlten zum überwiegenden Teil Grundlagen der Evaluation der Pflege. Am häufigsten wurden durchgeführte Interventionen dokumentiert. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Ehnfors und Smedby (1993) in ihrer Untersuchung in Schweden. Die Forscher stellten fest, dass eine mangelnde Anwendung der Pflegedokumentation das Risiko von Mängeln bei der Kontinuität und Sicherheit für den Patienten bedeutet. Viele Studien fokussierten auf die Pflegedokumentation und bestätigten deren Zunahme und erhöhte Genauigkeit. Es zeigte sich, dass pathophysiologische und häufig vorkommende Pflegediagnosen gezielter erfasst werden, als diejenigen, die präventive Interventionen erfordern oder solche im physiologischen Bereich (Brown et al. 1987; Hanson et al. 1990). Ehrenberg befragte 544 Pflegende zur Dokumentation des Pflegeprozesses. Die Ergebnisse zeigten, dass 83 % die Pflegegeschichte und 84 % den Pflegestatus der Patienten erhoben. Am wenigsten häufig wurden Pflegediagnosen und Pflegeziele (40 %, bzw. 43 %) gestellt (Ehrenberg et al. 1996).
Timonen und Sihvonen (2000) haben in einer Studie in Finnland untersucht, in wieweit die Einbeziehung der Patienten in die Pflegevisite eine Verbesserung des Genesungszustandes beeinflusst. Dabei wurde festgestellt, dass die Patienten häufig zu müde waren, um effektiv an ihrer eigenen Pflegeplanung mitzuarbeiten. Patienten forderten von den behandelnden Pflegenden und Ärzten eine patientenverständliche Sprache im Umgang mit ihnen anzuwenden. Häufig bestand die Kommunikation nur von Seiten der Pflegenden; die Patienten waren meist zu passiv.
Lassen (in: Mayer 2000) hat die Umsetzung der Pflegediagnostik im pflegerischen Alltag untersucht. Die mittels fokussierter Interviews ermittelten Ergebnisse zeigen, dass die befragten Pflegenden Pflegediagnostik als wichtigen Bestandteil der heutigen Pflege empfinden. Sie befanden sich allerdings in dem Widerspruch aus „machen wollen“ und „nicht können“. Das „nicht können“ lag für sie vor allen Dingen in der hohen Arbeitsbelastung und darin, nicht ausreichend Zeit für Gespräche, Reflexion und Dokumentation zu haben. Pflegende gaben an, Angst zu haben, die falsche Diagnose zu stellen und so die falschen Interventionen durchzuführen. Mayer (2000) stellt fest, dass die Pflegeanamnese unvollständig geschieht und der psychosoziale Bereich häufig vernachlässigt wird, da Pflegende hier keine Interventionen angeben können.
Dokumentationsschwierigkeiten können unterschiedliche Ursachen haben. Dies untersuchten Höhmann et al.. Sie fanden folgende Gründe für eine mangelnde Dokumentation:
1. defizitäre pflegetheoretische Kenntnisse
2. defizitäre Schulung zum Pflegeprozess
3. defizitäres Verständnis vom Pflegeprozess
4. mangelnde Systematik der Systeme
5. mangelnde Einsicht
6. Formulierungsschwierigkeiten
7. erhöhter Zeitaufwand
8. Doppeldokumentation
9. unvollständige Eintragungen
10. abrechnungsrelevant statt patientenbezogen (Höhmann et al. 1996)
Die Nutzung der NANDA-Pflegediagnosen in der Patientendokumentation haben unterschiedliche Studien als vorteilhaft herausstellen können (Pyykkö et al. 2000; Johnson et al. 2001; König 2002a).
3.2 Rechnergestützte Pflegedokumentation
Die Anforderungen an eine effiziente und theoretisch fundierte Pflege sowie die Qualitätsentwicklung haben rapide zugenommen und Pflegende wenden vermehrt computerisierte Dokumentationssysteme an. Pflegestandards, individuelle Pflegeplanung und Pflegeinterventionen schließen sich gegenseitig nicht aus und sind integrale Bestandteile von Qualitätssicherung. Der zunehmende Einzug von rechnergestützten Dokumentationssystemen in der Krankenpflege führt unweigerlich zu dem Vergleich von rechnergestützten und konventionellen Pflegedokumentationssystemen. Dabei treten neben Fragen der Akzeptanz von Computern auch Fragen bezüglich der Qualität von computerunterstützten Pflegedokumentationen auf. Um die Qualität von Pflegedokumentationen zu bestimmen, ist es sinnvoll, sich die vorliegenden Forschungsergebnisse zu diesem Thema zu betrachten.
Narita et al. (1997) untersuchten die Voraussetzungen, die an ein Computersystem gestellt werden müssen, um die Pflegedokumentation durchführen zu können. Es stellte sich heraus, dass selbst Computer mittlerer Leistungsfähigkeit und einfacher Software hierzu geeignet sind.
Getty et al. (1999) untersuchten das Verhalten von Pflegenden bei der rechnergestützten Pflegeplanung und deren Dokumentation. Es wurde eine Gruppe Pflegender mit zweijähriger Computererfahrung mit Pflegenden, die wenig oder keine Computererfahrung besaßen, verglichen. Es zeigte sich, dass Pflegende mit vorheriger Computererfahrung sicherer im Umgang mit der digitalen Pflegeplanung waren. Eine begleitende technische Unterstützung zeigte sich ebenfalls als sehr vorteilhaft. Gordon (2001) stellt fest, dass zurzeit ein Umbruch von der Krankengeschichte auf Papier hin zu computergestützten Informationen stattfindet.
Nach einer Untersuchung österreichischer Autoren gehen schätzungsweise bis zu 30% aller generierten bzw. erfassten Daten im Rahmen einer herkömmlichen (handschriftlichen) Pflegedokumentation verloren. Die Autoren zweifeln aufgrund dieser Tatsachen die forensische Verwertbarkeit herkömmlicher Patientendokumentationsmethoden stark an (Groom und Harris 1990; Kalli et al. 1992). Darüber hinaus stellen heute gängige Dokumentationsmethoden (mehrseitige Patientenkurven) durch ihren Umfang bzw. umständliche Handhabung häufig eine Fehlerquelle dar, von denen einige mittels Computer gestützter Dokumentationen vermieden werden könnten (Feuerstein 2000). Die NANDA-Pflegediagnosen unterstützen die Schritte des Pflegeprozesses. Johnson et al. (2001) wiesen aber darauf hin, dass ein effektives Nutzen der umfangreichen NANDA-Pflegediagnosen nur mit einem rechnergestützten Dokumentationssystem zu gewährleisten ist. Dem Anspruch, die von Pflegenden geleistete Arbeit auf effiziente Weise erfass- und als Kostenfaktor ausweisbar zu machen, wird damit entsprochen.
3.3 Stand der Praxis
Das Bild einer Intensivstation wird vor allem durch den notwendigen Gebrauch medizinischer Apparate geprägt. Durch den Zustand der vitalen Gefährdung der Patienten steht die Technik im Vordergrund. Individuelle Bedürfnisse der Patienten erscheinen als primär unwichtig (Marintschev 2004). Oberstes Ziel sind stabile Vitalfunktionen.
Intensivpflegende sind laut Gordon und Bartholomeyczik (2001) ein integraler Bestandteil der Technologie einer Intensivstation. Technologie umfasst nicht nur den Einsatz von Apparaten zur Unterstützung der Patienten, sondern schließt auch die Menschen, die mit diesen Maschinen interagieren, ein. Es werden Geräte, wie EKG-Monitoring, Infusomaten und Perfusoren, Pulsoxymeter, Beatmungsmaschinen, Hämodialysegeräte u.a. am Patienten zu seiner Überwachung und Unterstützung eingesetzt. Ebenso muss die Körpertemperatur überwacht werden. Jedes Gerät hat seine spezifischen Einstellungsmöglichkeiten und Überwachungsparameter. Die Überwachung all dieser Geräte gehört mit zum Aufgabenfeld einer Intensivpflegekraft. Die Dokumentation aller erfassten klinischen Parameter eines instabilen Intensivpatienten an einem Behandlungstag generiert mehr als 2000 Messwerte und zusätzlich bis zu 1000 daraus abzuleitender Daten (Price 1987). Es wurde festgestellt, dass eine umfassende Dokumentation sämtlicher relevanter Parameter für das ärztliche und pflegerische Personal auf Intensivstationen einen erheblichen Arbeitsaufwand darstellt. Einhergehend mit dieser Vielzahl erfasster, beziehungsweise generierter Daten hat auch die Komplexität klinisch-therapeutischer Entscheidungsfindungsprozesse zugenommen. Trends, die eine Reaktion des Patienten auf therapeutische Veränderungen widerspiegeln, müssen in einer aussagekräftigen bzw. nachvollziehbaren Art und Weise dargestellt werden, wie dies mit herkömmlichen manuellen Dokumentationsmethoden heute kaum mehr zu erreichen ist.
Millar und Burnard (2002) stellten fest, dass der Intensivpflegende von seiner direkten Pflege am Patienten abgelenkt wird, wenn es dem Patienten schlechter geht und er sich vermehrt um die Überwachungs- und Therapiemaßnahmen kümmern muss. Dies steht aber in keinem Gegensatz zueinander, da zu der direkten Pflege auf einer Intensivstation Überwachung und Therapie untrennbar zusammengehören. „Eine effektive Intensivpflegende sollte sowohl die physischen und psychischen Bedürfnisse des Patienten erfüllen können, als auch kompetent im Umgang mit der Technik sein“ (Shurdam 1986, in: Millar und Burnard 2002: 144).
Das Management auf einer Intensivstation besteht aus einer Reihe von aufeinander bezogenen Schritten, z.B. Planen, Organisieren, Führen, Kontrollieren. Die Intensivstation wird als ein Bereich beschrieben, „[…] in dem Patienten wegen akutem oder drohendem Organversagen aufgenommen werden, die möglicherweise der Unterstützung durch Apparate (einschließlich der künstlichen Beatmung) und/ oder der intensiven Überwachung bedürfen“ (Association of Anaesthetists 1989: 3).
3.4 Stand der Dokumentationspraxis der IPS Datteln
Franke (2002b) konnte mit Hilfe einer Dokumentenanalyse des Patientendokumentationssystems im St. Vincenz-Krankenhaus Datteln zeigen, dass eine Dokumentation am Pflegeprozess nicht stattgefunden hat. Es wurden z.B. Pflegeziele und Ressourcen der Patienten zu über 98 % gar nicht dokumentiert. Vitalparameter wurden vollständiger dokumentiert als der aktuelle Pflegestatus. Die mündliche Weitergabe von pflegerischen Informationen beim Schichtwechsel, die bislang auf der IPS in Datteln sehr umfangreich gehandhabt wird, soll nun durch Anwendung des Pflegeprozesses standardisiert werden. Hör- und Abschreibfehler werden somit vermieden und der Zugriff auf Informationen vereinfacht. So können auch Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende und Aushilfskräfte jederzeit einen aktuellen Überblick über den Behandlungs- und Pflegezustand ihrer Patienten gewinnen.
In einer Befragung aller Pflegenden betonten diese die Wichtigkeit einer sorgfältigen Dokumentation. Ebenso bemängelten sie das aktuelle Dokumentationssytem und befürworteten eine Modifikation desselben.
Zusammenfassend besteht die Intensivdokumentation zurzeit aus folgenden Teilen:
- Tageskurve
- Chargendokumentationsbogen
- ärztlicher Anamnesebogen
- Beatmungsdokumentation (falls der Patient beatmet ist)
- EKG-Sammelmappe
- Labormappe
- Konsiliarmappe und Hygienebefunde
- Abrechnungsbogen (OPS)
Da die IPS des Krankenhauses in Datteln nicht genügend PC-Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann, bleibt der einzige PC der Codierung und Patientenverwaltung vorbehalten. Für die Führung einer elektronischen Patientenakte für alle Patienten wären mehrerer PC-Arbeitsplätze und die entsprechende Software notwendig. Bis zur Einführung einer rechnergestützten Dokumentation auf der Intensivpflegestation muss somit ein neues Patientendokumentationssystem weiterhin auf Papier basiert entwickelt werden.
2 4 Konkretisierung der Zielstellung
Bei der Entwicklung eines neuen Patientendokumentationssystems für den Gebrauch im Praxisalltag muss es gelingen, die Erkenntnisse der Wissenschaft und der Praxis für den klinischen Arbeitsalltag zu integrieren. Aus diesem Grund sollten neben den Ergebnissen einer wissenschaftlichen Literaturrecherche auch die Erfahrungen der Experten, d.h. der Ärzte, der Intensivpflegenden und des Autors, in die Entwicklung des neuen Patientendokumentationssystems einfließen.
Eine Herausforderung bei der Entwicklung eines Patientendokumentationssystems für die interdisziplinär ausgerichtete Intensivpflegestation des St. Vincenz-Krankenhauses Datteln sind sicherlich die unterschiedlichen Krankheitsbilder, mit denen es das ärztliche und pflegerische Personal auf der Station zu tun hat. Die Intensivstation wird von den Fachrichtungen Innere Medizin (Kardiologie, Pulmonologie, Gastroenterologie), Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Abteilung und Gynäkologie belegt. Es wäre für den pflegerischen Alltag sicherlich nicht hilfreich, wenn für jede Fachrichtung unterschiedliche Patientendokumentationssysteme entwickelt würden, da die Intensivpflegenden, im Gegensatz zu den Fachärzten, Patienten aller Fachabteilungen betreuen. Ziel war es deshalb, ein die Fachabteilungen übergreifendes Patientendokumentationssystem zu entwickeln.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dirk Franke (Autor:in), 2004, Entwicklung und Implementierung eines Patientendokumentationssystems auf einer Intensivpflegestation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49505
Kostenlos Autor werden









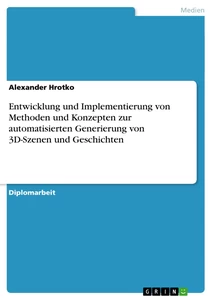






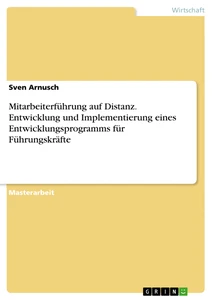
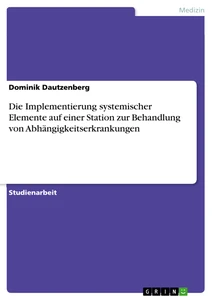




Kommentare