Leseprobe
Inhalt
1.) Einleitung
2.) Der Suchtbegriff
2.1) Sucht oder Abhängigkeit?
2.2) Einteilung der Süchte
2.3) Charakteristik einer Sucht
2.4) Faktoren und Motive einer Sucht
3.) Internetsucht
3.1) Daten zur Internet- und Computernutzung
3.2) Internetsucht – Fakt oder Fiktion? Ein Forschungsüberblick
3.2.1) Internetsucht ist möglich
3.2.2) Internetsucht gibt es nicht
3.3) Erscheinungsbild der Internetsucht
3.3.1) Anzeichen für die Internetsucht
3.3.2) Warum macht das Internet süchtig?
3.3.3) Welche Bereiche des Internet sind besonders betroffen?
3.3.4) Auswirkungen der Internetsucht
3.3.4.1) Soziale Auswirkungen
3.3.4.2) Gesundheitliche Auswirkungen
3.3.4.3) Berufliche und schulische Auswirkungen
3.3.5) Wann ist man internetsüchtig?
3.4) Internetsucht bei Kindern und Jugendlichen
3.4.1) Betroffene Bereiche
3.4.1.1) Computer- und Onlinespiele
3.4.1.2) Kontakte knüpfen
3.4.2) Interventionsmöglichkeiten für Eltern betroffener Kinder
4.) Empirische Studie zum Problembewusstsein Jugendlicher bezüglich ihres Internet- und Onlinespiele-Konsums
4.1) Fragestellung
4.2) Charakterisierung des Interviews
4.3) Überlegungen beim Erstellen der Interviewfragen
4.4) Interviewfragen
4.5) Vorgehensweise bei der Erhebung
4.5.1) Zugang zum Untersuchungsfeld
4.5.2) Durchführung der Interviews und Aufzeichnung
4.5.2.1) Angaben zur person
4.5.2.2) Einleitung
4.5.2.3) Leitfaden
4.6) Überlegungen zur Interpretation der Interviews
4.6.1) Transkription
4.6.2) Redigierte Aussagen
4.6.2.1) Selektieren der bedeutungstragenden Aussagen
4.6.2.2) Auslassen von Redundanzen und Füllseln
4.6.2.3) Transformieren in unabhängige Aussagen des Interviewpartners
4.6.2.4) Paraphrasieren
4.6.3) Auswertung der Interviews
4.7) Interpretation der Interviews
4.7.1) Redigierte Aussagen der interviewten Jugendlichen
4.7.1.1) Redigierte Aussagen Felix
4.7.1.2) Redigierte Aussagen Marcel
4.7.1.3) Redigierte Aussagen Gerrit
4.7.1.4) Redigierte Aussagen Anne
4.7.1.5) Redigierte Aussagen Marc
4.7.1.6) Redigierte Aussagen Timm
4.7.1.7) Redigierte Aussagen Sebastian
4.7.1.8) Redigierte Aussagen Harry
4.7.2) Auswertung der Aussagen der interviewten Jugendlichen
4.7.2.1) Welches Vorwissen haben die Jugendlichen zum Thema Sucht und nehmen sie diese als eine reale Problematik wahr?
4.7.2.2) Was sind die Hauptaktivitäten der Befragten am Computer und im Internet?
4.7.2.3) Welche Bedeutung haben digitale Unterhaltungsmedien im Leben der Jugendlichen?
4.7.2.4) Welchen Einfluss haben die Eltern auf den Computer- und Internetkonsum der Jugendlichen?
4.7.2.5) Sehen die Jugendlichen ein Problem in ihrem Computer- und Internetkonsum?
4.7.2.6) Deuten Computer- und Internetgebrauch der Befragten auf eine Suchtgefährdung hin?
4.8) Zusammenfassung der Ergebnisse
5.) Resümee
6.) Ausblick
7.) Literaturverzeichnis
8.) Anhang
8.1) Transkript Felix
8.2) Transkript Marcel
8.3) Transkript Gerrit
8.4) Transkript Anne
8.5) Transkript Marc
8.6) Transkript Timm
8.7) Transkript Sebastian
8.8) Transkript Harry
8.9) Auszug aus dem SciFi-Forum [http://www.scifi-forum.de/showthread.php?t=2732] vom 19.04.2001
1.) Einleitung
Computer und Internet gewinnen in der heutigen Gesellschaft rapide an Einfluss und Bedeutung. Medienwissenschaftler und Pädagogen, aber auch Eltern und Vorgesetzte betrachten diese Medien aber immer häufiger als zweischneidiges Schwert. Vor einigen Jahren als Informations-, Bildungs- und Kommunikationsmedium gelobt, beklagen sie nun die negativen Begleiterscheinungen. So wird der Internetnutzer ständig reizüberflutet und verliert bisweilen die Übersicht. Auch wird das Internet oft ungeniert als Mittel zur Agitation eingesetzt oder bietet Raum für Menschen mit gewissen Vorlieben, die in der Gesellschaft nicht oder kaum akzeptiert werden würden. Weiterhin taucht in diesem Zusammenhang immer wieder der Vorwurf auf, das Internet verursache Abhängigkeiten oder mache gar süchtig. Besonders anfällig dafür seien Kinder und Jugendliche, die etliche Stunden am Tag surfen, chatten oder spielen.
Mit meiner Studienarbeit versuche ich, dem „Suchtfaktor Internet“ ein Stück weit auf den Grund zu gehen. Sollten diese Vorwürfe nämlich zutreffen, hätte dies weit reichende Konsequenzen für den Schulalltag. Denn nachlassende Konzentrations- und Leistungsfähigkeit gehen oft mit einem suchtartigen Verhalten einher. Weiterhin sähen sich in diesem Fall auch Lehrer und Lehrerinnen mit einer neuartigen Problematik konfrontiert, was von ihnen verlangen würde, sich darüber in dem Maße zu informieren, dass sie im Stande sind, eine Diagnose zu stellen und Präventions- oder Interventionsmaßnahmen anzubieten.
Problematisch war für mich das Fehlen einer zufrieden stellenden und allgemeingültigen Definition der Computer- und Internetsucht in der Literatur. Dieses Phänomen – sofern es existiert – ist noch zu jung, um wissenschaftlich schon in aller Konsequenz untersucht zu sein. Nachdem ich einen grundlegenden Überblick zum Suchtbegriff geschaffen habe, habe ich daher zunächst vorhandene Suchtdefinitionen auf ihre Vereinbarkeit mit Begleiterscheinungen von exzessivem Internetkonsum hin überprüft. Die daraus gewonnenen Ergebnisse verwende ich im Anschluss in einer ergebnisoffenen Studie. Ich habe einen Fragenkatalog zu den Themenkomplexen Sucht und Internet ausgearbeitet. Dieser diente in Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Grundlage, um deren Internetgebrauchsgewohnheiten kennen zu lernen und heraus zu finden, ob sie bezüglich einer Suchtgefährdung Probleme bei ihrem Internetkonsum feststellen. Diese Aussagen haben zwar keinen repräsentativen Charakter, stellen aber insofern eine Vertiefung des Themas dar, als dass auch die nicht-wissenschaftlichen Meinungen dargestellt werden können. Dabei wird eine Diskrepanz der Anschauungen hinsichtlich des Gefahrenpotenzials des Internet deutlich werden.
Abschließend werde ich die Ergebnisse der Befragung mit dem theoretischen Teil der Arbeit vergleichen und kritisch reflektieren. Dies ist Grundlage für die in einem Ausblick fest gehaltenen Äußerungen zur Notwendigkeit einer weiteren intensiven Forschung in diesem Bereich.
2.) Der Suchtbegriff
Der Begriff Sucht taucht im täglichen Leben sehr oft auf. Primär werden damit vermutlich Süchte assoziiert, deren weit reichende Folgen nahezu jedem bekannt sind, wie beispielsweise die Drogensucht oder die Alkoholsucht. Weiterhin existiert das Wort Sucht auch in Zusammenhang mit von der Norm abweichenden Verhaltensweisen, wie Arbeitssucht, Spielsucht oder auch die Internetsucht, auf die ich im weiteren Verlauf der Arbeit noch detailliert eingehen werde.
Nicht vergessen sollte man die unter Menschen eher alltägliche Eifersucht, Habsucht oder Geltungssucht. Solange diese nicht in einer extremen Form auftreten, werden sie jedoch eher selten als krankhaft und von der Norm abweichend eingestuft.
Diese täglichen Berührungspunkte führen wohl oft auch dazu, dass Verhaltensweisen, die nach Meinung der bereffenden Person übermäßig praktiziert werden, schnell spaßeshalber als „Sucht“ eingestuft werden, beispielsweise wenn ein Familienmitglied zu lange vor dem Fernseher sitzt.
Wann es sich nun genau um eine Sucht im medizinischen Sinn handelt, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die einzelnen Süchte haben und welche Auswirkungen diese haben können, soll im Folgenden geklärt werden.
Im ersten Schritt muss dazu der Unterschied zwischen dem Wort Sucht und dem ebenfalls häufigen Begriff der Abhängigkeit erörtert werden. Das bildet die Basis, um die verschiedenen Süchte weiter zu differenzieren und Motive oder Faktoren einer Sucht zu benennen.
2.1) Sucht oder Abhängigkeit?
Die Begriffe Sucht und Abhängigkeit werden häufig synonym verwendet. Im Rahmen meiner Recherche stellte sich allerdings heraus, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, ob es sich nun wirklich um dasselbe handelt oder nicht.
So lässt sich in der Pschyrembel nachlesen, dass Sucht lediglich ein umgangssprachlicher Ausdruck für Abhängigkeit ist (vgl. Pschyrembel 1998, S. 1503). Dagegen vertritt Werner Stangl auf seiner Website die Meinung, dass der Mensch von Geburt an von vielen Dingen wie Nahrung, Luft und dergleichen abhängig ist. Darum müsse Abhängigkeit nicht von vorneherein etwas Negatives sein, wobei die Sucht schon eher im Extremen angesiedelt sei. Nach Stangl ist nicht jeder Abhängige gleichzeitig auch süchtig (vgl. Stangl).
Eher in der Mitte bewegt sich Seifried Seyer, indem er den beiden Begriffen unterschiedliche Schwerpunkte zuordnet. So rückt für ihn beim Begriff Sucht eher die Krankheit in den Vordergrund, während die Abhängigkeit eine Relationsbeziehung zwischen dem Körper und seinen Bedürfnissen betont. Abhängigkeit bedürfe allerdings einer Spezifikation wie „psychisch“ oder „physisch“ (vgl. Seyer 2004, S.1).
Nach Karla Etschenberg wurde der klassische Suchtbegriff, der sich bis dahin ausschließlich auf die stoffgebundene Drogensucht bezog, 1964 auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zu Gunsten des Begriffs Abhängigkeit aufgegeben. Wie schon erwähnt, wird Abhängigkeit immer spezifiziert, je nachdem ob sie eher im körperlichen oder im seelischen Bereich existent ist. Der Begriff Sucht dagegen würde weiterhin für stoffungebundene Süchte, die man auch als Verhaltenssüchte bezeichnet, verwendet werden. Etschenberg ist jedoch der Auffassung, dass der Begriff Sucht im Bereich einer stoffgebundenen psychischen Abhängigkeit treffender wäre, um die Vielschichtigkeit der Problematik zu fassen, da das Wort Abhängigkeit eher den pharmakologisch-medizinischen Aspekt des Problems betont (vgl. Etschenberg 2003, S. 4).
In Bezug auf das Problem des exzessiven Internetkonsums werde ich vor allem den Begriff Sucht benutzen, da er auch mir aussagekräftiger hinsichtlich eines nicht oder nur schwer zu kontrollierenden Verhaltens erscheint. Unabhängig davon benutzt aber auch die Fachliteratur häufiger diesen Begriff für Verhaltenssüchte, weswegen ich davon nicht abweichen möchte.
2.2) Einteilung der Süchte
Lange Zeit und auch heute noch wird der Begriff Sucht vor allem mit „physischer, substanzgebundener Sucht“ gleichgesetzt. Diese Einteilung nennt man darum den „klassischen Suchtbegriff“. Heute wird es allerdings üblicher, den Begriff auch auf nicht-substanzgebundene Süchte wie Internetsucht, Spielsucht oder Arbeitssucht zu beziehen, da diese auch einen immer größere Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Dann spricht man von einem „erweiterten Suchtbegriff“. Und schließlich bindet der „umfassende Suchtbegriff“ auch psychische und soziale Abhängigkeiten ein (vgl. Seyer 2004, S.1).
Noch in den achtziger Jahren erhielt ein Autor anlässlich seiner Recherche von der Barmer Ersatzkasse die schriftliche Mitteilung, „eine Sucht, ‚die für sich keine Organschäden verursacht’, ist ‚nicht als behandlungsbedürftige Krankheit anzusehen’“. (Gaßmann 1988, S.6)
Glücklicherweise konnte dieser Begriff offensichtlich in den letzten Jahren erweitert werden, denn hilfsbedürftig sind nicht nur die Süchtigen mit klassischen Krankheitssymptomen. Auch eine psychische Abhängigkeit kann schwerwiegende Folgen für den Betroffenen haben. Generell kann man also von zwei Arten einer Abhängigkeit sprechen: der körperlichen oder physischen und der seelischen oder psychischen Abhängigkeit.
Merkmale einer körperlichen Abhängigkeit sind vor allem die „Entwicklung einer Toleranz bezüglich der konsumierten Substanz, das Auftreten eines substanzspezifischen Entzugssyndroms bei Aussetzen der Substanzzufuhr beziehungsweise die Einnahme der Substanz, um Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden.“ (Robert 2001, S. 60)
Auch die psychische Abhängigkeit ist gekennzeichnet von einer verminderten Kontrollfähigkeit über Beginn, Ende und Menge des Substanzgebrauchs. Versuche den Gebrauch zu verringern schlagen meistens fehl, da das Verlangen zu stark ist. Die Betroffenen wollen mit dem Konsum ebenfalls positive Empfindungen schaffen oder negative vermeiden. Für eine psychische Abhängigkeit ist weiterhin kennzeichnend, dass Alltagsaktivitäten eingeschränkt beziehungsweise an die Sucht angepasst werden. Das führt oft dazu, dass berufliche und soziale Interessen in den Hintergrund treten und schlussendlich vernachlässigt werden (vgl. ebd.).
Noch vor einigen Jahrzehnten wurde der Suchtbegriff nahezu ausschließlich auf Stoffe bezogen. Erst in den achtziger Jahren wurde allmählich klar, dass diese Definition viel weiter gefasst werden muss, da auch andere Dinge einen Menschen süchtig machen können (vgl. Gaßmann 1988, S.5f). So unterscheidet man heutzutage auch zwischen stoffgebundenen und stoffungebundenen Süchten. Demgemäß werden beispielsweise die Drogen-, Alkohol-, Nikotin- oder auch die Medikamentensucht den stoffgebundenen Süchten untergeordnet, da ein bestimmter Stoff konsumiert werden muss, um die gewünschte Wirkung zu erlangen. Für die Betroffenen haben diese Süchte meistens sowohl körperliche als auch psychische Folgeprobleme.
Die stoffungebundenen oder auch nicht-stoffgebundenen Süchte wirken sich vielmehr auf das Privatleben oder die Finanzen aus. Dabei handelt es sich um Verhaltensweisen, mit denen der Betroffene eine bestimmte Wirkung erreichen möchte. Diese Verhaltensweisen treten in sehr extremer Form auf, was den Süchtigen von einem anderen Menschen abgrenzt. Dies zeigen die Beispiele Internetsucht, Arbeitssucht oder Kaufsucht. Diese Aktivitäten gehören normalerweise zum Leben der meisten Menschendie aber nur selten exzessiv davon Gebrauch machen (vgl. Tretter/Müller 2001, S. 26f).
Problematisch an den nicht-stoffgebundenen Süchten ist vor allem die leichte Zugänglichkeit. Während Substanzen, bei denen die Gefahr einer Abhängigkeit besteht, großteils einer staatlichen Illegalisierung oder Einschränkung unterliegen, ist dies bei nicht-stoffbezogenen Suchtformen kaum der Fall. Verhaltensweisen oder Tätigkeiten, die zum normalen Leben eines jeden Menschen gehören, gesetzlich zu verbieten oder einzuschränken, erscheint sehr zweifelhaft (vgl. Gaßman 1988, S. 18).
Schuller gibt jedoch zu bedenken, dass man zwar alle Süchte nach den vorgestellten Kriterien unterscheidet und kategorisiert, sie aber doch weder in ihren Ursachen noch in ihren Folgen richtig unterscheidbar seien (Schuller 1996, S. 7). Und tatsächlich hat jede Sucht verschiedene Auswirkungen auf den Betroffenen. Dies liegt unter anderem daran, dass auch das Umfeld eine Rolle spielt. Somit kann man schon eine Sucht für sich nicht allgemeingültig definieren, da ihr Verlauf von Person zu Person verschieden ist. Trotz allem muss man sich diesem Phänomen aber nähern können. Aus diesem Grund versucht man, Charakteristisches jeder Sucht zu finden.
2.3) Charakteristik einer Sucht
Generell kann man sagen, dass jede Sucht ein unabweisbares Verlangen nach einer bestimmten Substanz oder einem Verhalten ist. Der Süchtige bezweckt damit, von einem unerwünschten Erlebnis- oder Bewusstseinszustand in einen gewünschten zu fliehen (vgl. Robert 2001, S. 60). Weiterhin kann das Suchtmittel auch benutzt werden, um einen unangenehmen Zustand zu lindern. Diesen subjektiv angenehmen Erlebniszustand bezeichnet man als Rausch oder als Intoxikation (vgl. Tretter/Müller 2001, S. 18). Der Süchtige kann sich diesem Verhalten nur schwer entziehen, da der Verstand dem Verlangen untergeordnet ist (vgl. Gaßmann 1988, S. 14f).
Dass sich stoffgebundene Süchte und Verhaltenssüchte in ihrem Grundgerüst teilweise sehr ähnlich sein können, zeigt die folgende Gegenüberstellung aus dem DSM-III-R. Hier werden diagnostische Kriterien des pathologischen Spielens als einer Verhaltenssucht und der Drogensucht verglichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Ruppert 2003, S. 49; zitiert nach DSM-III-R)[1]
Wie deutlich wird, bestehen einige Gemeinsamkeiten zwischen stoffgebundenen Abhängigkeiten und Verhaltenssüchten. Letztendlich ist die auslösende Substanz oder Verhaltensweise natürlich etwas grundlegend anderes, ebenso wie jede Sucht für sich individuell verläuft – auch wenn es sich beispielsweise um dieselbe Sucht handelt. Man kann jedoch bestehende Ähnlichkeiten als Merkmale einer Suchtkrankheit als solches zusammenfassen. Das erleichtert auch Laien die Möglichkeit einer verstärkten Beobachtung oder sogar einer vorläufigen Diagnose.
Laut Helmut Kuntz durchläuft eine Sucht mindestens vier Stadien. Der erstmalige Gebrauch bildet den Einstieg in die Sucht, welche durch darauf folgenden mehrfachen Konsum vertieft wird (vgl. Kuntz 2000, S. 172). Die betreffende Person hat immer weniger Einfluss auf ihr Suchtverhalten, was schließlich in einem Kontrollverlust endet. Auftretende Entzugssymptome zwingen sie zu einer Dosissteigerung und einem Wiederholungszwang, denn das Suchtverhalten will ständig wieder befriedigt werden (vgl. Robert 2001, S.60). Nun kann man schon von einem regelmäßigen Gebrauch und einer damit verbundenen Gewöhnung sprechen. Schlussendlich kann der Betroffene seinen Konsum nicht mehr selbständig kontrollieren (vgl. Kunz 2000, S. 172). Weiterhin ist ein Süchtiger auch nicht mehr in der Lage, abstinent zu sein. Das Suchtverhalten wird immer mehr zum Mittelpunkt seines Lebens (vgl. Robert 2001, S.60f).
Als Begleiterscheinungen oder Symptome einer Sucht kann man nach Robert also folgende festhalten (vgl. ebd.):
- Missbrauch
- Toleranz
- Entzugssyndrom
- Wiederholungszwang
- Kontrollverlust
- Vernachlässigung von sozialen und beruflichen Interessen
Wie schon dargestellt ist eine Sucht nicht immer von einer bestimmten Substanz definiert. Tretter und Müller gehen sogar so weit zu sagen, dass jedes menschliche Verhalten süchtig entgleisen kann, solange es eine Art Rauschzustand hervorrufen kann. Der Rausch führt dazu, dieses Verhalten zu wiederholen, was im Grunde schon die Basis einer Sucht darstellt. Betrachtet man alleine unser Alltagsverhalten, können hier schon einige Formen von Sucht festgestellt werden, man denke nur an die Kaufsucht, die Geltungssucht oder die Habsucht. Jedoch haben nicht alle abweichenden Verhaltensformen auch anerkannten Krankheitscharakter, was Diagnose und Behandlung nicht unbedingt einfacher machen (vgl. Tretter/Müller 2001, S. 22f).
Die vorherrschende Meinung der Forschung geht davon aus, dass jeder Mensch gleichermaßen anfällig für süchtiges Verhalten ist. Es gibt also keine Suchtpersönlichkeit. Letztendlich lässt sich jede Sucht nur durch ihre individuelle Entstehungsgeschichte erklären, die viele Faktoren beinhalten kann (vgl. Kuntz 2000, S. 17). Aufgrund dieser multifaktoriellen Entstehungsgeschichte, kann man nicht von einem einzigen Mechanismus sprechen, nach dem sich jede Sucht entwickelt. Auch die Ausprägung des süchtigen Verhaltens ist von Fall zu Fall verschieden.
In einigen Fällen ist es sicher sehr schwierig, süchtiges Verhalten festzustellen und einzuordnen. Hinzu kommt, dass einige süchtige Verhaltensweisen von den Betroffenen selbst und vom näheren Umfeld nicht unbedingt als problematisch angesehen werden. So können beispielsweise Konsum von Tabak oder Süßigkeiten den betreffenden Personen eher noch helfen, den Stress des Alltags zu bewältigen.
Treffen die oben genannten Kriterien einer Sucht jedoch zumindest teilweise auf das Verhalten einer Person zu, so sollte man das zumindest als Warnsignal sehen und weiter beobachten und nachforschen um möglicherweise rechtzeitig intervenieren zu können.
2.4) Faktoren und Motive einer Sucht
Die Entwicklung einer Sucht ist multikausal, und die Ursachen sind nicht immer eindeutig zu bestimmen. Es gibt viele Theorieansätze, die das Suchtverhalten erklären möchten; diese hier in Gänze darzustellen würde aber vermutlich den Rahmen der Arbeit sprengen.
„In der Fülle der Theorien finden wir kulturelle, soziologische, sozialpolitische, sozialpsychologische, lernpsychologische, triebpsychologische, ich-psychologische, selbstpsychologische, objektbeziehungspsychologische oder systemische Ansätze zum Verständnis des schillernden Phänomens ‚Sucht’. Kein Erklärungsansatz kann Allgemeingültigkeit beanspruchen, kaum einer ist völlig zu verwerfen.“ (Kuntz 2000, S. 17)
Unabhängig von einer Theorie möchte ich aber zumindest einige Faktoren erwähnen, die mit einer Sucht in Zusammenhang stehen und die vor allem auch in Bezug auf die Internetsucht eine große Rolle spielen können. Diese Faktoren sind eng mit einer Funktion verbunden, die durch den Konsum für die Betroffenen erfüllt wird. Der Grundstein für einen falschen Umgang mit Konsummitteln wird oft schon in der Kindheit gelegt. Dies geschieht unbewusst durch falsche Erziehungsmethoden der Eltern. Durch Überbehüten, zu strenge, lieblose oder kontrastierende Erziehung oder Überforderung kann die Suchtneigung ungünstig beeinflusst werden. So kann beispielsweise ein „Kind, das sich an ständigen Konsum und an prompte Befriedigung seiner Wünsche gewöhnt hat, […] später nur schwer Verzicht üben.“ (Priebe u.a. 1994, S. 23)
Ein weiterer Punkt, der ebenfalls schon im Elternhaus beginnen kann aber nicht zwangsläufig muss, ist die in unserer Gesellschaft immer häufiger werdende Einsamkeit und damit verbundene Langeweile (vgl. Kuntz 2000, S. 180). Erwachsene suchen den Ausgleich für ein vermeintlich unerfülltes Leben oft in einer von einer Sucht geprägten Verhaltensweise. Diese lenkt von der Leere des Alltags ab und setzt neue Ziele, die in den meisten Fällen allerdings eine Illusion bleiben. Erschreckenderweise ist auch das Leben heutiger Kinder und Jugendlicher oft geprägt von Langeweile. Viele Eltern haben nicht immer Zeit, ihre Kinder kreativ zu beschäftigen, da sie beispielsweise durch die Berufstätigkeit eingeschränkt sind. So sind die Kinder gezwungen, nach Alternativen zu suchen. Diese Suche kann beispielsweise in übermäßigem Fernseh- oder Computerkonsum enden. Es ist aber auch möglich, dass sich Cliquen zusammenschließen, die auf der Suche nach immer neuen ‚Kicks’ mit Drogen experimentieren.
Vor allem der Kontakt mit Gleichaltrigen weckt oft jene Neugier, die für Suchtmittel empfänglich macht. Die Jugendlichen möchten ausprobieren, was andere am betreffenden Verhalten als ‚toll’ empfinden und warum Eltern möglicherweise davor warnen oder es verbieten.
Weiterhin versuchen gerade Jugendliche und junge Erwachsene, mit Suchtmitteln ihren Problemen aus dem Weg zu gehen, sie zu vergessen oder zumindest zu überlagern (vgl. Priebe u.a. 1994, S. 24f).
Eine weitere nicht zu unterschätzende Funktion von Suchtmitteln oder suchtartigen Verhaltensweisen ist die Ablenkung vom Selbst. Laut Schuller unterliegt der Mensch einem ständigen Zwang zur Selbstinszenierung, da er sich zu allen erdenklichen Anlässen so günstig wie möglich darstellen möchte. Diese Selbstinszenierung sei jedoch immer mit Selbstbeobachtung und Selbstkritik verbunden, was dazu führen könne, dass man diesem Zwang gerne entfliehen möchte. Ein einfach erscheinender Weg, die Augen vor der Realität zu verschließen, liege in einer suchtartigen Verhaltensweise (vgl. Schuller 1996, S. 15).
Nun ist jedoch noch fraglich, ob der Weg in die Sucht von einer gewissen Eigeninitiative gekennzeichnet ist, ob man also von Motiven für eine Sucht sprechen kann.
Helmut Kuntz beispielsweise sieht die Suchtmittelabhängigkeit als eine „selbst-gewählte bzw. aktiv-mitverantwortete Krankheit“ an. (Kuntz 2000, S. 176)
„Sucht ist kein Schicksal, sondern eine Wahl, für die der Wählende mitverantwortlich ist.“ (ebd. S. 17)
Diese sehr drastisch erscheinenden Aussagen sind sicher nicht falsch. Niemand wird gezwungen, sich dem einen oder anderen Laster hinzugeben. Daher kann man sicher davon sprechen, dass die Krankheit aktiv mit verursacht wird. Meiner Meinung nach trifft allerdings die Bezeichnung ‚Wahl’ nicht auf die Problematik einer Sucht zu. Sicher wird der erste Schritt von den Betroffenen selbst unternommen. Ich bezweifle jedoch, dass dem Einzelnen immer klar ist, welche Folgen der einmalige Konsum eines Suchtmittels haben kann. Der Genuss eines Gläschen Alkohols oder einer Zigarette, das ständige Spielen des aktuellsten Computerspiels erscheint vielen zuerst nicht problematisch. Der Weg in eine suchtartige Verhaltensweise verläuft oft unbewusst und stufenlos, so dass man sich plötzlich einem Problem gegenüber sieht, auf das man zu Beginn nicht vorbereitet war. Dieses unbewusste Entgleiten in eine Sucht kann man bei einer Abhängigkeit von illegalen Drogen jedoch nicht als Entschuldigung gelten lassen, da man sich hierbei sehr wohl bewusst sein muss, welche Konsequenzen der Konsum haben kann.
Doch auch in diesem Fall ist die Sucht sicher nicht die ‚Wahl’ des Betroffenen. Für ihn steht die subjektiv positive Wirkung des Suchtmittels im Vordergrund. Eine Sucht und die Konsequenzen werden in diesem Moment allerdings sicher nicht bedacht und somit auch nicht ‚gewählt’.
3.) Internetsucht
Die Internetsucht ist ein Phänomen, das erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist. Sie ist unter Wissenschaftlern allerdings sehr umstritten. Man ist sich nicht einig, ob es sich um eine stoffungebundene Sucht handelt, oder ob sie nur eine extreme Verhaltensweise darstellt.
Im Folgenden möchte ich zuerst einen Überblick über die Verbreitung und Nutzung von Computern und dem Internet geben, um deutlich zu machen, mit welchem Ausmaß sich diese Technologie auf das Leben von Erwachsenen und Kindern auswirkt. Es wird sich herausstellen, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen der Einfluss des Internets immer stärker wird. Dieser Einfluss ist jedoch nicht immer positiv und kann dazu führen, dass wichtige Aktivitäten im Jugendalter vernachlässigt werden. Es ist vor allem Aufgabe der Eltern, den Umgang der Kinder mit diesem Medium kritisch zu beurteilen und notfalls zu intervenieren. Oft hat es aber den Anschein, als wären sich die Eltern der Risiken von Internet und Computerspielen nicht vollständig bewusst. Darum werde ich mich im Anschluss konkret mit der Internetsucht beschäftigen und in Frage stellen, ob diese existiert oder nicht. Zu diesem Zweck werde ich verschiedene Aspekte der Forschung darstellen. Weiterhin möchte ich auf die Onlinespiele eingehen, da diese gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt sind und vermutlich einen großen Teil ihrer Zeit beanspruchen, die sie im Internet verbringen.
3.1) Daten zur Internet- und Computernutzung
Das Internet hat in den letzten Jahren stark an Einfluss gewonnen. Mittlerweile sind mehrere hundert Millionen Menschen auf der Welt online. Genauer gesagt, handelte es sich um circa 670 Millionen Menschen im Jahre 2003, was ungefähr 12% der Weltbevölkerung entspricht. Beachtet man, dass die Zahl der Internetneuzugänge in den USA bereits im Jahr 2000 pro Tag um 10.000 anstieg, kann man von einer erneuten Steigerung bis heute ausgehen (vgl. Greenfield 2000, S. 17; Gross 2003, S. 241).
Allein der Anstieg der Verbreitung des Internets in Deutschland ist enorm. 1997 verfügten nur 6,5% der Deutschen Erwachsenen über einen Internetzugang, das sind 4,1 Millionen Menschen. In nur fünf Jahren hat sich der Anteil nahezu versiebenfacht. Im Jahr 2002 surften schon 44,1% oder 28,3 Millionen Menschen über 14 Jahre im World Wide Web. Im Jahr 2003 wurde dann schließlich die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung erreicht: 53,5% oder 34,4 Millionen Menschen sind online (vgl. Gerhard u.a. 2003, S. 339; Eimeren 2003, S. 67).
Besonders bei den Jugendlichen hat die Internetverbreitung stark zugenommen. So verfügten laut der ARD/ZDF-Online-Studie 1997 nur 6,3% der 14- bis 19-Jährigen über einen Internetanschluss. 2002 sind es schon 76,9% und 2003 sogar 92,1% der Stichprobe (vgl. Eimeren 2003, S.67). Damit sind die Jugendlichen heute die Altersgruppe mit der höchsten „Internetpenetration“ (vgl. Gerhard u.a. 2003, S. 339).
Parallel dazu steigt natürlich auch die Ausstattung der Haushalte an Computern stark an. So waren 1999 in 47% der Haushalte, die an der Studie „KIM 2002“ teilnahmen, ein Computer zu finden. Im Jahr 2002 sind es schon 67% (vgl. Feierabend/Klingler 2003, S. 278). Bei der Nachfolgestudie „KIM 2003“ haben sogar schon 74% der Haushalte einen Computer, wobei dieser bei 15% im Besitz eines 6 bis 13jährigen Kindes ist (vgl. MPFS 2003, S. 14ff).
Betrachtet man die Attraktivität des Computers, so fällt auf, dass das Interesse wohl stark altersabhängig ist. So geben 12- bis 13-Jährige den Computer doppelt so häufig als liebste Freizeitbeschäftigung an, wie 6-7jährige (vgl. Feierabend/Klingler 2003, S. 281). Insgesamt zählen 28% der befragten Kinder zu intensiven Nutzern, was bedeutet, dass sie jeden oder zumindest fast jeden Tag Umgang mit dem Computer haben. Der Großteil der Kinder, nämlich 57%, benutzt ihn jedoch ein- bis mehrmals die Woche (vgl. ebd. S. 283).
Ein Unterschied zwischen den Geschlechtern fällt auf in Bezug auf die Medienbindung. 18% der Jungen würde es sehr schwer fallen, auf den Computer zu verzichten. Bei den Mädchen würde es nur 8% stören. Auch hier steigt die Wichtigkeit des Computers wieder mit dem Alter an. Bei den 6-bis 7-Jährigen stuften nur 4% den Computer als unverzichtbar ein, während es bei den 12- bis 13-Jährigen gut 24% sind (vgl. MPFS 2003, S. 17).
Die liebste Aktivität der Kinder und Jugendlichen am Computer sind die Spiele. 70% der befragten Kinder und Jugendlichen spielen mindestens einmal die Woche. Auch bei Treffen mit Freunden gehört das gemeinsame Computerspielen für 53% dazu. 30% der Befragten sind regelmäßig im Internet. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Jahr 2002 verdoppelt (vgl. ebd. S. 29).
Sehr interessant im Zusammenhang mit den Themen Internetsucht oder erhöhter Spielkonsum ist die Aussage von 45% der befragten Kinder, dass ihre Eltern sich dafür interessieren, was sie am Computer machen (vgl. ebd. S. 30). Der Umkehrschluss lässt die Aussage zu, dass 55% der Eltern eher nicht wissen, mit was genau sich ihre Kinder am Computer oder im Internet beschäftigen.
Zwar wird die Computernutzung der meisten Kinder durch die Eltern eingeschränkt. Dies kann zum einen durch Sicherheitssoftware für das Internet oder durch eine klare Vorgabe, was gespielt werden darf und was nicht, geschehen. Doch 29% der Kinder geben an, von den Eltern überhaupt nicht kontrolliert zu werden und machen zu können, was sie wollen (vgl. ebd. S. 32).
Die Studie besagt ebenfalls, dass Kinder und Jugendliche den PC meist zu Hause nutzen (vgl. ebd. S. 28). So kann man davon ausgehen, dass die Eltern zumindest beobachten könnten, was ihre Kinder am Computer spielen oder welche Websites sie besuchen. Die Tatsache, dass sich mehr als die Hälfte der befragten Eltern nicht darum kümmert, lässt darauf schließen, dass sie sich der Risiken des Internets und der Spiele nicht richtig bewusst sein können. Sicherlich kann man nicht sagen, dass sich jedes Kind, das im Internet surft oder Computerspiele spielt, gleich einem erhöhten Risiko aussetzt. Es ist jedoch wichtig, die Kinder zu einem bewussten und aufgeklärten Umgang mit dem Computer zu erziehen. Und das erfordert das Engagement der Eltern.
Obgleich die Existenz einer Internetsucht, wie schon eingangs erwähnt, noch nicht ausreichend belegt ist, so bestehen vor allem für Kinder die Gefahren eines übermäßigen Konsums. Er wird vor allem „ dann problematisch, wenn Jugendliche das Internet in einem so hohen Ausmaß nutzen, dass andere identitätsstiftende Aktivitäten darunter leiden.“ (Petzold 2002, S. 302)
Um ein besseres Verständnis für die Problematik der Internetsucht zu entwickeln, möchte ich diese im Folgenden genauer erörtern.
3.2) Internetsucht – Fakt oder Fiktion? Ein Forschungsüberblick
Die Internetsucht wird seit einigen Jahren unter den verschiedensten Bezeichnungen diskutiert. Begriffe wie Net Addiction, Internet Addiction,
Online Addiction, Internet Addition Disorder, Pathological Internet Use und Cyberdisorder sind Beispiele, die das neue Phänomen zu beschreiben versuchen.
Ursprünglich wurde der Begriff „Internetsucht“ 1995 von Ivan Goldberg, einem Psychiater aus New York, zufällig und eher scherzhaft eingeführt. Nachdem sich daraufhin allerdings viele vermeintlich Betroffene meldeten, entwickelte sich die Angelegenheit dann aber zum Selbstläufer (vgl. Petzold 2002; Gross 2002). Seitdem 1995 die “New York Times“ in einem Artikel über die Gefahren der Netznutzung berichtete, wird die Existenz der Internetsucht in Fachkreisen kontrovers diskutiert. Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen versucht Aufschluss über dieses Thema zu geben. Hierbei gilt es herauszufinden, ob es die Internetsucht überhaupt gibt und wovon die Betroffenen im Speziellen abhängig sind. Während einige Autoren die Existenz der Internetsucht anzweifeln und eine Thematisierung intensiver Netzaktivitäten für überflüssig halten, versuchen andere Autoren, diese Form eines suchtartigen Verhaltens näher zu erforschen.
3.2.1) Internetsucht ist möglich
Betrachtet man die Forschungsergebnisse, die für die Existenz einer Internetsucht sprechen, muss man sicherlich mit der amerikanischen Psychologin Kimberly Young beginnen, da sie eine der ersten Forscherinnen zu diesem Thema war. Bereits 1996 bezeichnete sie die Internetsucht als ein ernstzunehmendes und weit verbreitetes Phänomen und führte eine Studie durch, um herauszufinden, ob die Internetnutzung süchtig machen kann (vgl. Young 1996). Für ihre Studie benutzte sie Kriterien aus dem DSM-IV zur Erkennung von pathologischem Spielen und wandelte diese so ab, dass daraus die Definition einer Internetsucht entstehen konnte. An ihrer ersten im Internet durchgeführten Studie nahmen 496 Personen teil, von denen sie 396 nach Auswertung eines Fragebogens als abhängig bezeichnete. Diese Zahl ist natürlich sehr hoch, was wohl vor allem daran liegt, dass die Studie keine Repräsentativität beanspruchen kann. Höchstwahrscheinlich haben sich genau die User freiwillig dem Test unterzogen, die ohnehin lange Zeit im Internet verbringen und sich eines Problems schon bewusst sind (vgl. Robert 2001, S. 61).
Dr. Hans Zimmerl von der Universität in Wien verfasste 1998 die erste deutschsprachige Studie zum Thema Internetsucht. Sie ist allerdings primär auf die so genannten Chatrooms ausgelegt, da er hier die meisten suchtgefährdeten Internetuser vermutete. Auf seiner Homepage stellt er fest, dass viele andere Untersuchungen dieser Thematik zwar vorrangig das komplette Internet diskutieren, man bei genauerem Hinsehen allerdings bemerkt, dass die eigentlichen Probleme hauptsächlich im Bereich der Chatrooms lokalisiert werden.
An Zimmerls Studie, die ebenfalls online durchgeführt wurde, nahmen 473 Personen teil, die alle mehr oder weniger häufig in Chatrooms anzutreffen sind. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass 12,7% der Probanden ein suchtartiges Verhalten aufweisen, welches Zimmerl als „pathologischen Internetgebrauch“ bezeichnet. 30,8% dieser Subgruppe gaben sogar an, beim Chatten eine Art rauschähnlichen Zustand zu erleben. Eine weitere wichtige Erkenntnis dieser Studie ist, dass die Bereitschaft der Probanden zur Selbstreflexion offenbar sehr hoch ist, da sich 40,9% der als süchtig eingestuften Subgruppe selbst als süchtig bezeichnen würde.
Zimmerl betonte in seinem Schlusswort jedoch, dass seine Studie kein Beweis für das Vorhandensein der Internetsucht als Krankheit ist. Er möchte sie jedoch als Anregung sehen, in diesem Bereich weiter zu forschen (vgl. Zimmerl 1998).
Die erste Studie in Deutschland haben André Hahn und Matthias Jerusalem durchgeführt. Auch hierbei handelt es sich um einen Online-Survey, auf den die Teilnehmer jedoch zusätzlich durch Radio- und TV-Interviews aufmerksam gemacht wurden. Schlussendlich bestand die Stichprobe aus 7091 Teilnehmern. Hahn und Jerusalem erachten 3,2% der Befragten als internetsüchtig. Ihr durchschnittlicher Aufenthalt im Internet pro Woche beträgt 34,6 Stunden. Weitere 6,6% der Teilnehmer wurden als Risikogruppe klassifiziert, da sie auf eine wöchentlich durchschnittliche Online-Zeit von 28,6 Stunden kommen. Die eher unauffälligen Internetuser dieser Studie nutzen das Internet im Vergleich nur 7,6 Stunden pro Woche.
Weiterhin ist auffallend, dass die Rate der Internetabhängigen von 10,3% in der Gruppe der unter 15jährigen auf 2,2% in der Gruppe der 21- bis 29- Jährigen fällt. Man vermutet folglich, dass es sich um eine Jugendproblematik handeln könnte (vgl. Hahn/Jerusalem 2001, S. 284f).
3.2.2) Internetsucht gibt es nicht
Ein Kritiker der Internetsucht ist beispielsweise der amerikanische Psychologe John Grohol. Er glaubt nicht an die Existenz einer solchen Störung und hält es für unseriös, allein auf der Basis von Erfahrungsberichten und Umfragedaten eine neue Krankheit zu postulieren. Diese Umfrageberichte können seiner Meinung nach keine kausalen Zusammenhänge zwischen einer bestimmten Verhaltensweise und deren Ursache beschreiben. Sie könnten zwar Erkenntnisse darüber liefern, was die Betroffenen über sich und ihr Verhalten denken und fühlen, durch diese Umfragen könnte man aber keine Schlussfolgerungen ziehen, inwiefern eine bestimmte Technologie wie das Internet als Ursache auf dieses Verhalten einwirkt (vgl. Grohol 1999)
John Grohol und andere Kritiker bestreiten zwar nicht, dass es Menschen gibt, die sich durch exzessiven Internetgebrauch Schaden zufügen, betonen aber, dass die Extremnutzung nur einen kleinen Teil der User betrifft. Außerdem sehen sie nicht das Internet als Verursacher der durch die Netznutzung aufgetretenen Schäden. Vielmehr führen sie den übermäßigen Konsum des Mediums auf bereits bestehende soziale und psychische Konflikte der Betroffenen zurück. Demnach wird intensive Netznutzung eher als ein Versuch verstanden, sich sozialen Konflikten und depressiven Verstimmungen der Alltagswelt zu entziehen (vgl. ebd.).
Da Grohol den teilweise exzessiven Gebrauch einiger User nicht leugnet, stellt er eine alternative Theorie auf. Seiner Meinung nach vollzieht sich die Nutzung des Internets eher in Phasen, wobei vor allem neue User dazu neigen, übermäßig viel Zeit online zu verbringen. Er stellt drei Stufen dar: Die erste Stufe bezeichnet er als „Enchantment“, also der Reiz des Neuen, der schnell zur Besessenheit („Obsession“) führen kann. Die zweite Stufe nennt Grohol „Disillusionment“, womit er die Zeit bezeichnet, in der man eher genug hat von der anfänglich attraktiven Tätigkeit. In der dritten Stufe findet der User schließlich seine „Balance“ und geht zu einem normalen Gebrauch des Mediums über. Grohol zufolge erreichen alle User irgendwann die dritte Phase, bei manchen dauert es nur länger. Er räumt jedoch ein, dass manche Personen es nicht aus eigener Kraft schaffen, die dritte Phase zu erreichen und somit auf professionelle Hilfe angewiesen sind (vgl. ebd.).
Vergleicht man die Ausführungen Grohols mit denen der Befürworter einer Existenz der Internetsucht, so fallen doch Parallelen auf. Beide Seiten gehen davon aus, dass es übermäßigen Internetkonsum gibt. Grohol macht jedoch eine plausible Feststellung, die sich an alle richtet, die sich mit diesem Thema befassen, unabhängig davon, auf welcher Seite sie nun stehen. Er ist der Auffassung, Forscher sollten ihre Zeit nicht damit verschwenden, zu beweisen, dass eine Sucht besteht. Sie würden ihre Zeit viel sinnvoller einsetzen, indem sie den Menschen helfen, die das Internet exzessiv nutzen, um vor ihren realen Problemen zu flüchten. (Grohol 1997)
Somit wird sich der nächste Abschnitt damit befassen, wie sich übermäßiger Internetgebrauch darstellt und welche Einflüsse er auf das Leben des Betroffenen haben kann, unabhängig davon, ob man dieses Erscheinungsbild als Sucht betiteln möchte, oder nicht.
3.3) Erscheinungsbild der Internetsucht
Wie im bereits beschrieben, bestehen kontroverse Meinungen über die Existenz einer Internetsucht. In einem Punkt sind sich die Wissenschaftler jedoch einig: Übermäßiger Konsum von Internet oder Computerspielen stellt definitiv in einigen Fällen ein Problem dar. Teilweise verschwindet diese Problematik von selbst, in anderen Fällen können die Personen allerdings nur schwer zu einem Normalmaß zurückfinden. Sie benötigen dafür professionelle Hilfe.
Ich möchte im Folgenden beschreiben, wie sich die Internetsucht generell bemerkbar macht und wie Betroffene diese als solche erkennen können. Dazu ist es wichtig, zu wissen, welche Bereiche des Internets ein besonders süchtig machendes Potenzial haben und welche Anzeichen sowohl selbst Betroffene als auch Angehörige beunruhigen sollten. In diesem Zusammenhang ist es weiterhin wichtig, zu klären, was man überhaupt als „normal“ bezeichnen kann. Mit voreiligen Verallgemeinerungen sollte man in dieser Hinsicht nämlich sehr vorsichtig sein.
Ich werde weiterhin den Begriff der „Internetsucht“ verwenden, unabhängig von den zuvor vorgestellten Meinungen. Dieser Begriff tritt in der Literatur am häufigsten auf und scheint mir das Problem am treffendsten zu fassen. Sicherlich muss man aber innerhalb dieses Begriffes in den einzelnen Fällen Abstufungen vornehmen und kann nicht in jedem Fall von einer Sucht oder einer Abhängigkeit sprechen. Doch wie Grohol im vorigen Kapitel deutlich machte, sollte es nicht Aufgabe der Forschung sein, über die Definition einer Sucht zu diskutieren, sondern den Betroffenen die Problematik ihrer Verhaltensweise zu verdeutlichen und ihnen gegebenenfalls zu helfen.
3.3.1) Anzeichen für die Internetsucht
Wie wohl mittlerweile schon deutlich wurde, handelt es sich bei der Internetsucht um ein Krankheitsbild mit vielfältigen Symptomen und oft weit reichenden Konsequenzen. Wie bei jeder anderen Sucht auch ist die Ausprägung von Person zu Person verschieden. Um den Betroffenen allerdings die Möglichkeit einer Selbsteinschätzung zu geben, gibt es einige Fragebögen, die eine persönliche Einstufung erleichtern sollen. So soll beispielsweise der online abrufbare Fragebogen von Kimberly Young helfen, Warnsignale zu erkennen, die auf eine Internetsucht hindeuten. Sie stellt folgende acht Fragen:
- Fühlen Sie sich vom Internet eingenommen? Denken Sie an vorangegangene Online-Aktivitäten oder antizipieren Sie kommende?
- Fühlen Sie eine Notwendigkeit, das Internet zeitlich immer mehr nutzen zu müssen, um ein gewisses Maß an Zufriedenheit zu erreichen?
- Haben Sie wiederholt erfolglos versucht, die Internetnutzung zu kontrollieren, zu reduzieren oder zu stoppen?
- Fühlen Sie sich unruhig, launisch, depressiv oder irritiert, wenn Sie versuchen, die Internetnutzung zu reduzieren?
- Sind Sie länger online als eigentlich beabsichtigt?
- Haben Sie signifikante Beziehungen, Ihren Beruf, Ihre Karriere wegen des Internets gefährdet oder gar riskiert?
- Haben Sie Familienangehörige, Therapeuten oder andere angelogen, um Ihren exzessiven Gebrauch des Internets zu verbergen?
- Nutzen Sie das Internet als eine Möglichkeit, um vor Problemen, Missstimmungen (z.B. Gefühle der Hilflosigkeit, Depression, Schuld, Angst) zu fliehen?
(Übersetzung von Robert 2001, S. 61, zitiert nach Young: http://www.netaddiction.com/whatis.htm)
Bei fünf bejahten Fragen empfiehlt Young, einen genaueren Test durchzuführen, der den Grad der Abhängigkeit bestimmen soll. Auch dieser ist auf ihrer Homepage zu finden (vgl. http://www.netaddiction.com/resources/internet_addiction_ test.htm).
Ob ein solcher Test überhaupt notwendig ist, bleibt allerdings fraglich. Höchstwahrscheinlich benötigen Betroffene nicht erst einen solchen Test, um festzustellen, dass ihr Internetgebrauch exzessiv ist. Trotzdem wird in vielen Büchern und Ratgebern dieser oder ein ähnlicher Test abgedruckt. Die meisten Betroffenen können sicher sehr gut einschätzen, dass sie zu viel Zeit im Internet oder mit Spielen verbringen, haben aber nicht unbedingt ein Problembewusstsein für ihr Verhalten. Mit Fragen, die beispielsweise auf Vernachlässigung des Privatlebens zielen, könnte man jedoch unter Umständen ein solches Problembewusstsein herstellen. Dies sind Bestandteile einer Sucht, die Betroffene vor sich selbst des Öfteren leugnen. Erst wenn ihnen die Tragweite ihres Verhaltens deutlich gemacht wird, entschließen sie sich womöglich, dieses zu überdenken und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Da schon der Begriff Internetsucht unterschiedlich beurteilt wird, gibt es auch keinen eindeutigen Konsens über die Merkmale, die eine Verhaltensstörung in diesem Bereich ausmachen. In nahezu allen Arbeiten zur Internetsucht lassen sich jedoch fünf abstrakte Kriterien finden, die auf eine Internetsucht hindeuten. Hahn und Jerusalem zu Folge ist eine Internetsucht vorhanden, wenn
- der Verhaltensraum stark eingeengt wird, da der größte Teil der zur Verfügung stehenden Zeit zur Internetnutzung verwendet wird,
- die Person die Kontrolle über ihre Internetnutzung weitestgehend verliert und nicht in der Lage ist, die Zeit am Computer zu reduzieren oder sogar zu unterbrechen, obwohl durchaus ein Bewusstsein für dadurch verursachte persönliche oder soziale Probleme vorhanden ist,
- über einen längeren Zeitraum eine Toleranzentwicklung festzustellen ist, was bedeutet, dass die Person eine immer größere „Verhaltensdosis“ benötigt, um die angestrebte positive Stimmungslage zu erreichen,
- Entzugserscheinungen in Folge einer längeren Unterbrechung der Internetnutzung auftreten, die sich durch Unruhe, Nervosität, Gereiztheit, Unzufriedenheit, Aggressivität und psychisches Verlangen bemerkbar machen,
- Auf Grund von Internetaktivitäten negative soziale Konsequenzen in den Bereichen Arbeit und Leistung oder bei sozialen Beziehungen auftreten.
(vgl. Hahn/Jerusalem 2001, S. 280f)
3.3.2) Warum macht das Internet süchtig?
Die Frage, warum das Internet süchtig oder abhängig macht, ist schwer zu beantworten, da es reihenweise Faktoren gibt, die das Medium für den einzelnen attraktiv erscheinen lassen können. Eine derartige Technologie bietet zahlreiche Möglichkeiten und positive Aspekte für den Nutzer. Man sollte dabei allerdings nicht vergessen, dass diese Vorteile durch übermäßigen Gebrauch auch ins Gegenteil umschlagen können. Vorab möchte ich allerdings feststellen, dass man in diesem Bereich keine allgemeingültigen Angaben machen kann, da es von Person zu Person durch die enorme Bandbreite des Internets große Unterschiede geben kann. Ich möchte aber die wichtigsten Faktoren der Attraktivität des Internets darstellen, da diese zu einem suchtartigen Verhalten führen können.
Ein für viele Internetuser sehr wichtiger Punkt ist das Knüpfen von Kontakten. Auf die unterschiedlichsten Weisen hat man Gelegenheit, andere Menschen kennen zu lernen und mit ihnen sogar Freundschaften zu schließen. Nicht nur in Chatrooms, auch in diversen Onlinespielen, Foren und vielem anderen trifft man online auf andere Menschen. Das ist nicht nur für diejenigen attraktiv, die im realen Leben eher kontaktscheu sind. Sicherlich haben sie im Internet aber eine vereinfachte Ausgangsposition. Doch auch Menschen, die im normalen Leben über einen durchschnittlich großen Freundeskreis verfügen, sind zusätzlichen Online-Freundschaften oft nicht abgeneigt. Mit ihnen kann man unter Umständen ganz anders umgehen, als mit realen Freunden. Die Hemmschwelle, Online-Bekannten von Dingen zu erzählen, die man von Angesicht zu Angesicht vielleicht lieber für sich behalten würde, ist häufig sehr niedrig. Es gibt also eine gewisse Anonymität (vgl. Tretter/Müller 2001, S.29), vor allem beim chatten, da jeder User selbst dafür verantwortlich ist, welche Dinge er von sich preisgibt und welche nicht.
Greenfield (2000, S. 50) verweist auf Schätzungen, nach denen etwa 35 bis 50 Prozent der Internetnutzer schon einmal falsche Angaben zu ihrer Person gemacht haben. Diese Angaben bezögen sich vor allem auf Familienstand, finanzielle Lage oder auf persönliche Merkmale wie zum Beispiel das Gewicht. Es gibt sogar Personen, die schon einmal in die Rolle des anderen Geschlechts geschlüpft sind, sei es aus purer Neugier oder zur Verwirklichung ihrer sexuellen Phantasien. Dieses Verhalten wird in der Wissenschaft als „gender switching“ bezeichnet. Nach Kimberly Young sind es vor allem einsame und unsichere Menschen, die sich die Freiheiten des Internets zu Nutze machen und ihre „dunkelsten Geheimnisse und tiefsten Wünsche“ verwirklichen (vgl. Young: http://www.netaddiction.com/addictive.htm, übersetzt von M. Wörsching).
Unterstützt durch die Anonymität des Internets kommt es oftmals zu einer „beschleunigten Intimität“ (Greenfield 2000, S.52), bei der sich das Gefühl von Vertrautheit wesentlich schneller aufbaut, als dies im normalen Leben möglich wäre. Oft wird der Gesprächspartner dabei hochgradig idealisiert, ohne dass es im nächsten Moment zu einer Enttäuschung kommt, wie das in der Realität eventuell der Fall sein könnte (vgl. Gross 2003, S. 243). Unter diesem Gesichtspunkt können Online-Beziehungen eine besondere Bedeutung bekommen.
Bei intensiven Online-Kontakten besteht vor allem die Gefahr, sich zu sehr auf dieses Medium zu fixieren und reale Bindungen dadurch zu vernachlässigen.
Häufig sind labile Menschen sehr viel schneller von einer derartigen Sucht oder Abhängigkeit betroffen als Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl.
„ Je stabiler die soziale, berufliche und gesellschaftliche Einbindung eines Menschen ist, desto geringer ist die Gefahr, einer Sucht zu verfallen.“ (Farke 2003, S. 27)
Das schließt allerdings nicht aus, dass auch Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, von einer derartigen Sucht erfasst werden (vgl. ebd.). Man muss sich zum Beispiel nur vorstellen, dass eine Person aus lauter Langeweile in einen Chat hereinschaut und dabei einen sehr sympathischen Gesprächspartner kennen lernt. Möglicherweise wird sie nur wegen diesem Menschen in Zukunft mehr und mehr Zeit online verbringen und dadurch noch mehr Kontakte knüpfen. Ohne es zu merken hat man sich so schon stückweise ein suchtartiges Verhaltensmuster angeeignet.
Die Zeit, die man für die Internetnutzung aufbringt, muss man verständlicherweise an anderen Stellen abzweigen. Man ist ständig dabei, seine Onlinekontakte zu pflegen und vergisst dabei, dass es auch reale Menschen gibt, mit denen man sich hin und wieder treffen sollte. Es kommt oft zu einer sozialen Isolation. Mit dieser verbunden sind oft Depressionen und Konflikte innerhalb der Familie oder mit dem Partner. Weiterhin können auch berufliche Probleme auftauchen, da man oft nicht mehr ganz bei der Sache ist oder sogar noch bei der Arbeit die Chance nutzt, sich ins Internet einzuloggen (vgl. Greenfield 2000, S. 25).
Auch Gabriele Farke (2003, S.12) sieht einen Auslöser der Internetsucht in der Suche nach Kontakten. Sie definiert die Sucht als eine „gewisse Disziplinlosigkeit und der Schrei nach Liebe“ und zieht somit eine Parallele zu anderen Suchtformen, in denen dieses Motiv des Öfteren zu erkennen ist.
Eine für Partnerschaften völlig neue Gefahr stellen überdies Cyberaffären mit Internetbekanntschaften dar. Diese entstehen meist eher ungewollt, stellen für die reale Beziehung aber eine große Belastung dar (vgl. Greenfield 2000, S. 25).
Greenfield hat die Problematik sehr treffend formuliert:
„ Während uns das Internet einerseits mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden kann, besteht gleichzeitig die Möglichkeit, daß es uns von den Menschen in der nächsten Umgebung abschneidet. Hier liegt das Paradox des Internet: Man ist gezwungen, sich zu isolieren, um seine Kontakte zu erweitern.“ (ebd., S. 29)
Sicherlich muss man jedoch differenzieren zwischen dem Einstieg in die Internetsucht und der Zeit des exzessiven Konsums. Die Motive für einen Einstieg und für ein Beibehalten des suchtartigen Verhaltensmusters müssen nicht immer die gleichen sein.
Die ersten Kontakte mit dem Internet entstehen oft aus Interesse für das relativ neue Medium. Man ist bestrebt, sein Wissen in diesem Bereich zu erweitern, da dies unter anderem häufig schon eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Bestehen in der Berufswelt ist. Eher zufällig lernt man die verschiedenen Bereiche des Internets kennen und nutzen. Gerade zu Beginn werden User durch die Faszination des Neuen übermäßig lang an ihren Computer gebunden, was aber nicht unbedingt gleich ein Problem darstellen muss. Hierbei möchte ich auf Kapitel 3.2.2 verweisen, in dem Grohols Theorie zu diesem anfänglich starken Konsum vorgestellt wurde.
Der Weg in einen andauernden übermäßigen Konsum wird unter anderem auch dadurch geebnet, dass das Internet endlose Möglichkeiten bietet. Greenfield (2000, S. 55) erläutert, dass man im Netz niemals fertig sei mit einer Sache, wie dies beispielsweise bei der Lektüre eines Buches der Fall wäre. Durch Links oder Hypertexte erschließen sich ständig neue Möglichkeiten, das Gespräch in einem Chat ist niemals völlig abgeschlossen, und auch in einem Online-Spiel mit ständig wechselnden Gegnern muss es nicht unbedingt ein festgeschriebenes Ende geben. Es bleibt offensichtlich immer der Eindruck von etwas Unerledigtem, was man gerne zu Ende bringen möchte. Dies kann beispielsweise ein Motiv sein, den Internetgebrauch ständig fortzusetzen und somit eine Toleranz, also eine Gewöhnung an das Verhalten, zu entwickeln.
Zwei weitere Punkte, die die Faszination Internet begünstigen, sind die Verfügbarkeit und die Intensität des Mediums. Das Internet ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche verfügbar. Zu jeder Tages- oder Nachtzeit kann man Informationen suchen, Gesprächspartner finden oder sich die Zeit vertreiben. Diese Möglichkeiten können äußerst anregend wirken und beim User ein Macht- oder Erfolgsgefühl hervorrufen. Diese Erfahrungen der Interaktion sind für den Nutzer oftmals sehr intensiv. Kein anderes Medium kann vergleichbare Erlebnisse bieten (vgl. ebd. S. 46ff).
Dass die Attraktivität des Internets bei einigen Usern letztendlich zu einem suchtartigen Verhaltensmuster führen kann, wird unter anderem zusätzlich begünstigt durch die Zeitlosigkeit des Internets. Kaum ein Internetnutzer bestreitet, dass eine verzerrte Zeitwahrnehmung besteht. Greenfield berichtet, dass viele User die Zeit vergessen und oftmals für mehrere Stunden nicht an ihre Umgebung oder an bestehende Aufgaben denken:
„ Das Phänomen der Zeitlosigkeit ist in der Psychologie unter dem Begriff Dissoziation bekannt. Es ist ein normaler psychischer Vorgang, der im allgemeinen erlebt wird, wenn wir uns auf ein stimulierendes, schmerzliches und/oder potentiell suchterzeugendes Verhalten einlassen. “ (ebd. S. 48)
3.3.3) Welche Bereiche des Internet sind besonders betroffen?
Das Internet ist ein enormes Medium mit vielen Bereichen und Funktionen, die oft derart verschieden sind, dass Personen häufig nur von Teilbereichen fasziniert sind, ohne einen anderen Teil auch nur zu kennen. Darum kann man nicht prinzipiell davon sprechen, dass das Internet süchtig machen kann. Es muss immer differenziert werden, um welchen Bereich es sich genau handelt. Nur so kann dem Betroffenen angemessen geholfen werden.
Kimberly Young und ihre Kollegen (2000) teilen die Internetsucht in folgende Kategorien ein:
- Cybersexual Addiction: Im Vordergrund steht hier der Konsum von Erotik und Sex im Internet. Über bestimmte Websites schauen sich die Betroffenen Bilder oder Videos an oder leben in Erotik-Chats ihre Phantasien aus. Begünstigt durch die Anonymität des Internet werden auch Seiten mit illegalem Inhalt wie Kinderpornographie oder Gewaltszenen frequentiert, deren Kontrolle durch die unbegrenzten Einspeisungen ins Web nahezu unmöglich ist.
- Cyber-relationship Addiction: Hier geht es in erster Linie um den Aufbau von Beziehungen im Netz. Kontakte knüpft man in Chats, Foren, in Kontaktanzeigen, per E-Mail oder über interaktive Spiele. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dabei auch Romanzen entstehen. Doch auch rein freundschaftliche Beziehungen im Internet bergen die Gefahr, dass diese nach und nach wichtiger werden als Beziehungen im realen Leben.
- Net Compulsions: Der Aufenthalt des Users im Internet ist bestimmt von Auktionen und exzessivem Shopping oder Spielen mit Geldeinsatz. Im Vordergrund stehen Geldtransaktionen über das Internet, die durch einen Einkauf oder Gewinne beziehungsweise Verluste zu Stande kommen. Auch der Handel mit Wertpapieren ist möglich.
- Information Overload: Der User versinkt im Informationsmeer des Internet. Den Hauptteil seiner Zeit verbringt er damit, zu surfen oder Programme und Musik zu downloaden. Diese Informationen werden dann auf der Festplatte gesammelt.
- Computer Addiction: Damit wird exzessives Spielen oder Programmieren beschrieben. Young bezieht sich zwar nur auf Spiele, die offline gespielt werden. Die Möglichkeit, normale Computerspiele mittlerweile auch online gegen reale Partner spielen zu können, bietet jedoch für viele Betroffene einen besonderen Reiz, da sich das Spiel quasi nie erschöpft. Inzwischen sind auch schon Spiele im Handel erhältlich, die ausschließlich online gespielt werden können.
3.3.4) Auswirkungen der Internetsucht
Die Auswirkungen der Internetsucht sind wie sie selbst auch weit reichend und individuell unterschiedlich. Sie können sich in allen möglichen Bereichen des täglichen Lebens bemerkbar machen. Ein erhöhter Internetkonsum hat sowohl soziale als auch gesundheitliche Auswirkungen, ebenso muss man aber die schulischen und beruflichen Folgen beachten.
3.3.4.1) Soziale Auswirkungen
Die sozialen Auswirkungen der Internetsucht werden von den Betroffenen im ersten Moment vermutlich nicht unbedingt als problematisch erachtet, da die negativen Folgen von positiven Empfindungen innerhalb des Internets überlagert werden.
Das gravierendste Problem des übermäßigen Internetkonsums besteht in einer Art sozialen Isolation. Die Betroffenen kapseln sich von Familie und Umfeld ab. Dies geschieht meist völlig unbewusst und unabsichtlich. Doch die Pflege der Bekanntschaften im Internet erfordert ein sehr hohes Maß an Zeit, die selbstverständlich an anderen Stellen fehlt. Somit kann es leicht zu familiären Problemen oder Krisen in der Ehe kommen, da sich die engsten Verwandten vernachlässigt fühlen (vgl. Greenfield 2000, S. 25). Auch von der Vernachlässigung der eigenen Kinder konnte man in diverser Literatur erfahren, was deutlich macht, wie sehr sich die Prioritäten im Leben des Betroffenen verschieben (vgl. Farke 2003, S. 23). Weiterhin sagt Gabriele Farke, die es als ehemals Süchtige berichten kann, dass Internetsüchtige nicht einmal mehr in Urlaub fahren wollen, aus Angst, etwas verpassen zu können (vgl. ebd.).
Diese Vernachlässigung des realen Lebens führt auf längere Sicht zur Vereinsamung (vgl. Greenfield 2000). Familien zerbrechen, Freunde werden nicht mehr kontaktiert, und das komplette Leben ist nur noch auf das Internet fixiert. Früher oder später wird es jedem Betroffenen auffallen, dass im Notfall niemand mehr da ist, der einem im realen Leben weiterhelfen kann. Fraglich bleibt nur, ob die Sucht bis dahin schon so weit fortgeschritten ist, dass das für den Einzelnen gar nicht mehr von Interesse ist.
[...]
[1] Leider gibt es trotz langjähriger Bemühungen noch keinen einheitlichen Kriterienkatalog für die Internetsucht, was für den weiteren Verlauf der Arbeit sehr interessant wäre. Aus diesem Grund ist es wichtig zu erwähnen, dass sich einige Autoren am Kriterienkatalog der Spielsucht orientiert haben, und diesen in Bezug auf die Internetsucht adaptierten (vgl. Gross 2003, S. 246f).
- Arbeit zitieren
- Maike Wörsching (Autor:in), 2006, Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49119
Kostenlos Autor werden

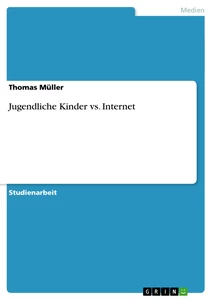









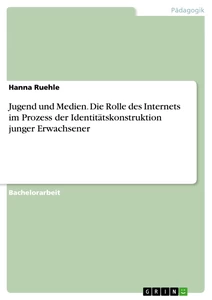



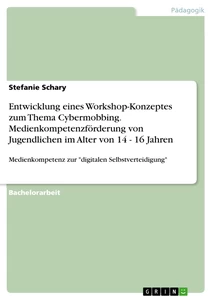

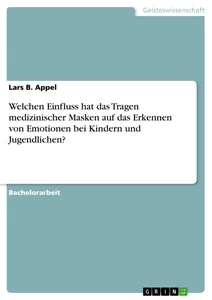



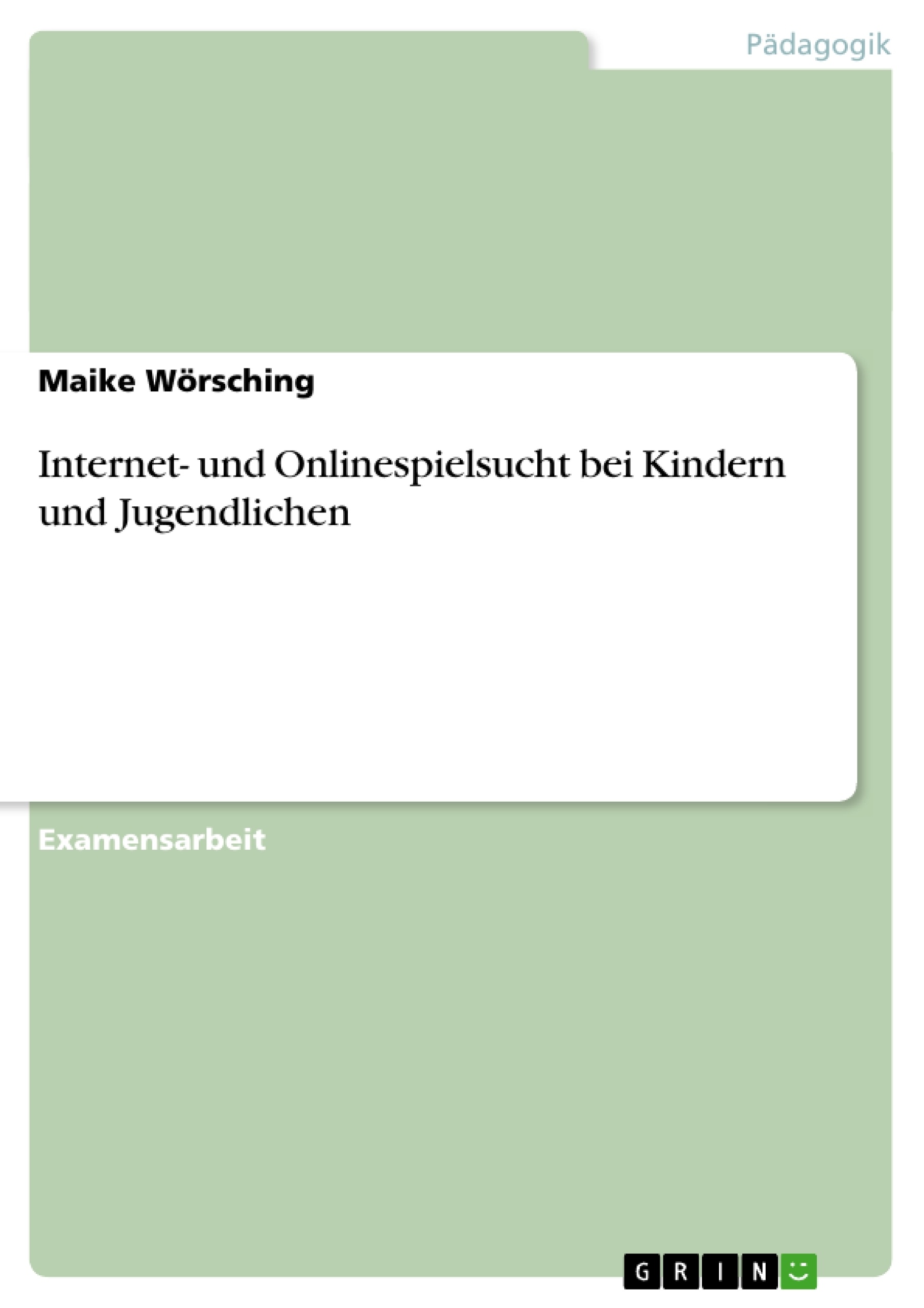

Kommentare