Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
KAPITEL 1: GEGENSTAND, ZIEL UND METHODIK DER ARBEIT
1.1. REFORMBAUSTELLE GESUNDHEITSWESEN
1.2. METHODIK DER ARBEIT
KAPITEL 2: WAHLEN UND GEWALTENTEILUNG IN DER BRD
2.1. WAHLEN
2.1.1. Wahlgrundsätze
2.1.2. Repräsentationssystem
2.1.3. Einflussfaktoren auf die Wähler
2.2. GEWALTENTEILUNG
2.2.1. Gesetzgebungsverlauf
2.2.2. Zustimmungsgesetze und Kompetenzen der Länder bei der gesetzlichen Krankenversicherung
KAPITEL 3: ERKLÄRUNGSANSÄTZE DER ÖKONOMISCHEN THEORIE DER POLITIK
3.1. GEMEINSAME ANNAHMEN UND AXIOME
3.1.1. Der methodologische Individualismus
3.1.2. Das Rationalitätsprinzip
3.1.3. Die gegebenen Präferenzen
3.1.4. Das Wettbewerbsprinzip im politischen Bereich
3.2. DIE ÖKONOMISCHE THEORIE DER DEMOKRATIE
3.2.1. Die Grundstruktur
3.2.2. Die Rolle der Ungewissheit
3.2.3. Die Bedeutung von Informationskosten
3.3. DIE LOGIK KOLLEKTIVEN HANDELNS
3.3.1. Gruppenprozesse
3.3.2. Der Einfluss von Interessenverbänden auf die Politik
3.4. DIE POLITISCHE ÖKONOMIE DER VERFASSUNG
3.4.1. Das Modell nach Buchanan und Tullock
3.4.2. Log-Rolling
3.4.3. Vetospieler
3.5. DIE ÖKONOMISCHE THEORIE DER PFADABHÄNGIGKEIT
3.5.1. Ergänzung der bisherigen Theorien
3.5.2. Der Kern der Theorie
KAPITEL 4: DER EINFLUSS POLITISCHER RATIONALITÄT AUF REFORMEN DER GKV
4.1. REFORMNOTWENDIGKEIT IN DER GKV
4.2. REFORMVERSUCHE UNTER ADENAUER UND ERHARD
4.2.1. Wichtige Reforminhalte und Positionen der gesellschaftlichen Gruppen
4.2.2. Wahlökonomische Bewertung
4.3. DAS KRANKENVERSICHERUNGS-KOSTENDÄMPFUNGSGESETZ (KVKG)
4.3.1. Wichtige Reforminhalte und Positionen der gesellschaftlichen Gruppen
4.3.3. Wahlökonomische Bewertung
4.4. DAS GESUNDHEITSREFORMGESETZ (GRG)
4.4.1. Die Entwicklungen vom KVKG bis zum GRG
4.4.2. Wichtige Reforminhalte und Positionen der gesellschaftlichen Gruppen
4.4.3. Wahlökonomische Bewertung
4.5. DAS GESUNDHEITSSTRUKTURGESETZ (GSG)
4.5.1. Wichtige Reforminhalte und Positionen der gesellschaftlichen Gruppen
4.5.2. Wahlökonomische Bewertung
4.6. KOSTENDÄMPFUNGSGESETZE UND DAS GESUNDHEITS-SYSTEM-MODERNISIERUNGSGESETZ (GMG)
4.6.1. Die Entwicklungen bis zum Gesundheitssystem-Modernisierungsgesetz 2004
4.6.2. Wichtige Reforminhalte und Positionen der gesellschaftlichen Gruppen
4.6.3. Wahlökonomische Bewertung
KAPITEL 5: LÖSUNGSANSÄTZE FÜR NACHHALTIGERE REFORMEN
5.1. ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE REFORMGESETZGEBUNG
5.1.1. Zeitliche Einschränkungen durch Wahlen
5.1.2. Der Bundesrat als politisiertes Blockadeorgan
5.1.3. Der Rentneranteil in der Bevölkerung als Ursache und Lösung von Blockaden
5.1.4. Leichter umsetzbare Reformen durch das Verständnis der Wähler
5.1.5. Schutz vor Belastungen durch homogene Akteursstrukturen
5.2. LÖSUNGSANSÄTZE UND AUSWIRKUNGEN
5.2.1. Verringerung der Dependenz von Wahlterminen
5.2.2. Aufbrechung der Vetomacht des Bundesrats
5.2.3. Reduktion der Bevorzugung von Rentnern
5.2.4. Steigerung der Informiertheit der Wähler
5.2.5. Zersplitterung der Akteure
5.2.6. Auswirkungen
5.3. REALISIERUNG UND BEWERTUNG DER LÖSUNGSANSÄTZE
5.3.1. Realisierungschancen
5.3.2. Bewertung der Lösungsansätze
KAPITEL 6: ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG
6.1. DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
6.2. AUSBLICK
ANHANG
LITERATURVERZEICHNIS
ERKLÄRUNG
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Einflussfaktoren bei der Wahlentscheidung
Abbildung 2: Gesetzgebungsverfahren
Abbildung 3: Medianwähler
Abbildung 4: Einfluss von Interessengruppen
Abbildung 5: Optimale Entscheidungsregel
Abbildung 6: Pfadabhängigkeit
Abbildung 7: Einzelregel und Regelsystem
Abbildung 8: Das gesundheitsökonomische Fundamentalproblem
Abbildung 9: Multidimensionale Bewertung der Lösungsansätze
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Inhalte und Positionen bei den Reformversuchen bei Blank
Tabelle 2: Inhalte und Positionen beim KVKG
Tabelle 3: Inhalte und Positionen beim GRG
Tabelle 4: Inhalte und Positionen beim GSG
Tabelle 5: Inhalte und Positionen beim GMG
Tabelle 6: Die essentiellen Ergebnisse der Untersuchung
Im Anhang:
Tabelle A 1: Gesetzgebungsverlauf der Reformversuche bei Blank
Tabelle A 2: Gesetzgebungsverlauf des Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetzes
Tabelle A 3: Gesetzgebungsverlauf des Gesundheitsreformgesetzes
Tabelle A 4: Gesetzgebungsverlauf des Gesundheits-Strukturgesetzes
Tabelle A 5: Gesetzgebungsverlauf des Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz
Tabelle A 6: Bruttoinlandsprodukt, Volkseinkommen
Tabelle A 7: Beitragssatzentwicklung
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
KAPITEL 1: GEGENSTAND, ZIEL UND METHODIK DER ARBEIT
1.1. REFORMBAUSTELLE GESUNDHEITSWESEN
Alle Jahre wieder ist der Gesundheitssektor eine Reformbaustelle. Gesundheitsexperten aus Politik und Gesellschaft überbieten sich mit ihren Reformvorschlägen zur Sanierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Um die Beiträge und die Lohnzusatzkosten zu stabilisieren müssen die Löcher gestopft werden, die die Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben verursacht. Die Reformen zur Füllung jener Löcher scheinen keinen größeren Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Schon nach kurzer Zeit entstehen neue Löcher und verursachen Beitragssatzanstiege, die die Fahrt der Wirtschaft beeinträchtigen. Eine Art Reformzyklus entsteht, der eine gewisse Regelmäßigkeit aufweist. Da überwiegend die Politik die Gesetzgebung bestimmt, wäre es nicht verwunderlich, wenn zwischen Wahlterminen und Reformzyklus ein Zusammenhang bestehen würde. Die Abhängigkeit der Politiker von den Stimmen der Wähler formt deren Verhalten. Doch es kann nicht alleine der Wille des Wählers sein, der nachhaltige Reformen nahezu unmöglich macht. Andere europäische Länder konnten selbst einschneidende Maßnahmen durchsetzen, die zu Lasten einer Mehrzahl von Wählern gingen. Zu denken wäre hier besonders an die Reformpolitik von Maggie Thatcher in Großbritannien.
Die Konstruktion des politischen Systems ist demnach für die Reformfähigkeit eines Landes nicht zu unterschätzen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist mittlerweile 56 Jahre alt und hat sich im Laufe der Zeit zu einer „Konsens-Falle“[1] entwickelt. Der Gesetzgebungsprozess kann mit der Entwicklungsgeschwindigkeit der globalisierten Welt nicht mehr mithalten. Statt der Entwicklung einen Schritt zuvor zu sein, versucht die Politik in kleinen Schritten hinterher zu laufen. Auf Dauer verliert unser Land den Anschluss und fällt in die Zweitklassigkeit zurück.
Um den Anschluss an die Weltspitze nicht zu verlieren und wieder aufzuholen, müssen sich die Rahmenbedingungen in Deutschland einschlägig ändern. Eine Analyse der größeren Gesundheitsreformen seit 1955 kann stellvertretend für andere Politikbereiche als empirischer Test helfen, die wesentlichen Hindernisse auf dem Weg zu nachhaltigeren Reformen aufzuspüren. Anhand dieser können dann Lösungsansätze entwickelt werden, die die Reformfähigkeit des Landes erhöhen können.
Das Ziel dieser Arbeit ist, die entscheidenden Einflussfaktoren, die den Gesundheitsreformen vorausgingen, zu finden und Lösungsansätze zur Verringerung von Hindernissen zu entwickeln. Überwiegend sollen dabei die Strategien der Politiker und das politische System im Mittelpunkt stehen und nicht die Effektivität und Effizienz der einzelnen Reformbausteine. Die Untersuchung orientiert sich dabei an folgenden Fragestellungen:
1) Wie wird der Wille des Wählers in Stimmen für den Politiker transformiert?
2) Welche rechtlichen Bestimmungen schränken den Handlungsspielraum der Politiker im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung ein?
3) Wie lässt sich das Verhalten des Politikers und des Wählers erklären und welche Faktoren dominieren den Entscheidungsprozess?
4) Warum sind Gesundheitsreformen ständig auf der Agenda?
5) Welche Positionen und Strategien begleiten die einzelnen Parteien und Interessengruppen bei den Reformen?
6) Wie hemmen diese und die Ausgestaltung des politischen Systems die Reformgesetzgebung?
7) Welche Lösungen bieten sich an, um die Gesundheitsreformen nachhaltiger zu gestalten?
1.2. METHODIK DER ARBEIT
Am Anfang der Untersuchung werden zunächst das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland dargestellt und die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert, die dem Handeln der Politiker in der Gesundheitspolitik Grenzen setzen. Insbesondere wird der Gesetzgebungs-prozess vorgestellt und dabei die Rolle des Bundesrats als zweite Kammer der Legislative erläutert. Es werden die Gesetzgebungskompetenzen in der Gesundheitspolitik konkretisiert und der Brisanz von Zustimmungsgesetzen nachgegangen.
Im weiteren Verlauf werden Theorien zur Erklärung des politischen Handelns erläutert. Zunächst wird auf die gemeinsamen Annahmen und Axiome eingegangen, um dann die Kosten-Nutzen-Abwägungen in der Politik darzulegen. Die Grundlagen für das Handeln in Kollektiven werden gelegt und die Abhängigkeit der Parteien von Interessenverbänden näher betrachtet. Die Auswirkungen von der unterschiedlichen Ausgestaltung des Abstimmungs-mechanismus werden in einer Theorie der Verfassung gegenübergestellt und dabei zusätzlich die Rolle von Vetospielern beleuchtet. Ergänzt werden die Theorien durch die Theorie der Pfadabhängigkeit, die sich vor allem für die Analyse von geschichtlichen Abläufen anbietet.
Nach der Schilderung der Theorie steht im vierten Kapitel die Empirie im Vordergrund. Die größeren Gesundheitsreformen und Gesundheitsreformversuche in Deutschland seit 1955 werden analysiert. Dabei sollen vor allem die Positionen der unterschiedlichen Parteien und gesellschaftlichen Akteure verglichen werden und jeweils hinsichtlich der politischen Strategie wahlökonomisch bewertet werden.
Im Rahmen des fünften Kapitels werden die grundlegenden Einflussfaktoren auf die Reformen zusammengefasst, vor allem diejenigen, die die Intensität und Nachhaltigkeit der Reformen verringerten und somit zu einer Erhöhung der Frequenz der Gesundheitsreformen aufgrund weiterhin steigender Beitragssätze führten. Es werden Lösungen vorgeschlagen, die abschließend nach ihrer Wirkung und ihren Realisierungschancen erörtert werden.
Schließlich sollen die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst werden und ein Ausblick auf die nächsten Gesundheitsreformen gegeben werden.
Die Vorgehensweise orientiert sich am Erkenntnisobjekt Gesundheitsreform, das im Mittelpunkt der Untersuchung steht. Anhand der größeren Gesundheitsreformen in Deutschland sollen als Erkenntnisziel die Wechselwirkungen zwischen Zeitpunkt und Intensität der Reformen und rationalen Verhalten der Politiker erforscht werden. In einem ersten Schritt ist es nötig den Gestaltungsspielraum, der durch das demokratische System vorgegeben wird, einzugrenzen. Stehen die Grenzlinien fest, kann sich im zweiten Schritt den Verhaltensprämissen der Politiker gewidmet werden. Nachdem die Theorie näher spezifiziert wurde, wird sie auf ihren Wahrheitsgehalt im Rahmen von empirischen Daten zu den Gesundheitsreformen überprüft. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und einer Bewertung dahingehend unterzogen, ob sie sich vorteilhaft oder nachteilig auf den Reformprozess auswirkten. Danach werden Wege und Mittel erörtert, die die Hindernisse im Reformprozess beseitigen können. Der Ansatzpunkt für Veränderungen ist dabei die institutionelle Ausgestaltung des politischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland.
KAPITEL 2: WAHLEN UND GEWALTENTEILUNG IN DER BRD
In einer Demokratie geht alle Herrschaft vom Volke aus. Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln prägte 1863 das Demokratieverständnis, indem er Demokratie definierte als „government of the people, by the people, for the people”[2]. Damit die Menschen eines Landes ihre Macht ausüben können und gleichzeitig mit dieser Aufgabe nicht überfordert sind, werden in demokratischen Staaten Institutionen wie Parlamente und Regierungen mit der Herrschaft beauftragt. Um Missbrauch zu verhindern, ist die Herrschaft begrenzt und sie muss mit anderen Gewalten geteilt werden. Im ersten Fall entscheiden die Wähler über die Regierenden in regelmäßigen Wahlen und im zweiten Fall wird die Macht der Exekutive fortwährend durch Legislative und Judikative begrenzt und kontrolliert.
2.1. WAHLEN
Eine neue Regierung sollte dem Willen der Mehrheit der Wähler entsprechen. Der Wille des Wählers wird dabei von verschiedenen Faktoren beeinflusst, die individuell gewichtet werden und schließlich in eine Stimme für eine Partei oder einen Kandidaten münden. Gewisse Regeln sind nötig, um sicherzustellen, dass die gewählten Repräsentanten tatsächlich den Volkswillen verkörpern und für die Herrschaft legitimiert sind.
2.1.1. Wahlgrundsätze
In der Bundesrepublik werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach Art. 38 Grundgesetz (GG) „in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl“[3] alle vier Jahre[4] neu gewählt. Allgemeinheit der Wahl bedeutet, dass das Wahlrecht allen Staatsbürgern zusteht unabhängig ihres Status in der Gesellschaft[5]. Gewisse Einschränkungen beispielsweise hinsichtlich des Wahlalters ab 18 Jahren sind dennoch statthaft[6]. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit stellt sicher, dass mit der Wählerstimme ein Vertreter direkt gewählt wird und keine weiteren Instanzen wie etwa Wahlmänner zwischen Wähler und Bewerber vorhanden sind. Daran anknüpfend darf eine Bewerberliste im Nachhinein nicht mehr geändert werden[7]. Hinsichtlich der Freiheit der Wahl wird von einigen Autoren angeführt, dass diese „kein klassischer Wahlrechtsgrundsatz“[8] sei. Freie Wahlen seien unter den anderen Grundsätzen subsumierbar. Gleichwohl versteht man darunter das Verbot von Zwang- und Druckausübung von außen. Allerdings darf „frei“ nicht als Gegenteil von Wahlpflicht gesehen werden[9]. Eine Wahlpflicht wie in Österreich würde in Deutschland nicht gegen die Verfassung verstoßen, solange die Entschließungsfreiheit des Wählers gewähr-leistet bleibt. Gleiche Wahlen beziehen sich auf das Stimmengewicht. Gemäss „one man, one vote“ soll jede Stimme gleich gezählt und gleich erfolgreich sein[10]. Ein Drei-Klassen-Wahlrecht zu Zeiten Preußens, in der das jeweilige Steueraufkommen über den Stimmenwert entschied, wäre demnach unzulässig. Mit dem letzten Wahlgrundsatz „geheim“ soll garantiert werden, dass Sanktionen nach einer Stimmabgabe ausbleiben. Die getroffene Wahlent-scheidung soll anderen Menschen zumindest im Wahllokal verborgen bleiben. Die erläuterten Wahlrechtsgrundsätze finden sich auch bei Landtagswahlen[11] wieder.
2.1.2. Repräsentationssystem
Während die Wahlrechtsgrundsätze Verfassungsrang haben, ist das Repräsentationsprinzip in einfachen Gesetzen geregelt[12]. Eine Änderung des Repräsentationsprinzips wird demzufolge erleichtert. In Deutschland findet man ausschließlich die Verhältniswahl mit einigen Modifi-kationen[13] in den jeweiligen Bundesländern vor. Hauptkennzeichen der Verhältniswahl ist, dass die Anzahl der Sitze der einzelnen Parteien proportional zu den abgegeben Wählerstim-men ist. Hingegen kann bei einem Mehrheitswahlsystem die zweitstärkste Partei nach Stimmen die meisten Sitze im Parlament erreichen[14]. Bei den Bundestagswahlen besitzen die Wähler jeweils zwei Stimmen, wobei mit der ersten eine Person und mit der zweiten eine Partei gewählt wird. Insofern spricht man exakter von einer personalisierten Verhältniswahl. Die reine Verhältniswahl wird jedoch durch die Mehrheitswahl durchbrochen, da die relative Mehrheit über den Gewinn eines von 299 Direktmandaten entscheidet. Das Bundes-verfassungsgericht klassifiziert somit das deutsche Wahlsystem als „ein System der Verhältniswahl mit vorgeschalteter Mehrheitswahl.“[15]. Diese Durchbrechung kann als Versuch gelten, die Vorteile der beiden Systeme zu nutzen und die Nachteile zu vermeiden.
Eine besondere Bedeutung kommt der Rolle der 5%-Sperrklausel zu. Eine Zersplitterung des Parlaments soll verhindert werden. Die Sperrklausel sorgt dafür, dass nur Parteien ins Parlament einziehen dürfen, wenn deren Zweitstimmenanteil über fünf Prozent beträgt oder die Partei drei Direktmandate für sich gewinnen konnte. Die Funktionalität des politischen Systems genießt Vorrang vor der gerechten Repräsentation. Für kleine Parteien ist die Sperrklausel ein oft nicht zu überwindendes Hindernis, besonders bei den Landtagswahlen. Bei den Bundestagswahlen hat aber gerade die FDP von der künstlichen Hürde profitiert, da viele Fremdwähler sie unterstützten um eine entsprechende Koalitionsregierung zu erhalten[16].
Für kleine Parteien ist das Auszählungsverfahren bedeutender als für große Parteien. Da das Verfahren nach d’Hondt kleinere Parteien benachteiligt, wurde es 1985 bei den Bundestagswahlen durch das System nach Hare/Niemeyer ersetzt[17]. Bei beiden Verfahren bestimmt in erster Linie die Zweitstimme die Sitze einer Partei im Parlament. Nur wenn eine Partei mehr Direktmandate in einem Bundesland erhält, als Mandate, die ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, kann sie die zusätzlichen Überhangmandate behalten[18].
2.1.3. Einflussfaktoren auf die Wähler
Geht man davon aus, dass Wähler nicht erst in der Wahlkabine ihre Entscheidung für einen Kandidaten oder eine Partei treffen, so müssen schon vorher gewisse Faktoren wirken, die zumindest die Entscheidung des Wählers in eine bestimmte Richtung leiten. Diese kann auch in einer Nichtwahl enden. Es existieren kurz- und langfristige Einflussfaktoren[19].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Einflussfaktoren bei der Wahlentscheidung
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Korte (2000), S. 91.
Bei den Langzeitfaktoren kann man zwischen den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, der Eingliederung in die Sozialstruktur und der politisch ideologischen Grundorientierung differenzieren. Unter Ersteren kann man allgemein die Zufriedenheit der Wähler mit ihrem Umfeld einordnen. Als Hauptpunkte können hier die Arbeitslosigkeit und die Inflation angeführt werden, deren Auswirkungen auf Wahltermine in mehreren Studien bereits untersucht wurde[20]. Bei der Eingliederung in die Sozialstruktur nehmen die persönlichen Werte und Normen einen entscheidenden Stellenwert ein. Es bilden sich Konfliktlinien sog. „cleavages“ aus, die dem Wähler die Orientierung im Parteienspektrum erleichtern[21]. So stehen Sozialdemokraten eher auf Arbeitnehmerseite, wogegen die Liberalen mehr den Arbeitgebern und Freiberuflern nahe stehen. Systematisch sind Liberale dann für einen zurückhaltenden Staat und Sozialdemokraten für größeren staatlichen Einfluss. Diese Gruppenzugehörigkeit, die Stellung im gesellschaftlichen Netzwerk, hängt eng mit dem dritten Punkt der politisch ideologischen Grundorientierung zusammen. Der Wähler identifiziert sich mit der Partei, die am ehesten mit seinen Wertvorstellungen konform geht.
In den letzten Jahren haben sich Parteibindungen abgeschwächt[22]. Die kurzfristigen Faktoren dominieren die Wählerentscheidung. Diese kann man in situative und konjunkturelle Faktoren unterteilen. Situative Faktoren sind „die konkreten Wettbewerbsbedingungen, Parteien- und Parteiensystemkonstellationen“[23]. Diese Definition beschränkt sich auf den Bereich der Anbieter; bei Wahlen sind dies die Parteien und Kandidaten. In diesem Sinne kann die Menge, die Vielfalt und Qualität der Kandidaten und Parteien bei Wahlen unterschiedlich sein. Weiter können mögliche Koalitionsaussagen das Angebot strukturieren und dem Wähler die Entscheidung erleichtern. Über die Qualität können keine allgemeinen Aussagen getroffen werden, da jeder Wähler individuell entsprechend seiner Präferenzen urteilt. Situative Faktoren meinen also primär die Anzahl und die Beziehungsstruktur bzw. das Netzwerk der Parteien und Kandidaten. Bei den konjunkturellen Faktoren ist vor allem bedeutsam, welche Themen die Bevölkerung gegenwärtig am meisten bewegen. Der Wahlkampf wird von diesen Themen determiniert. Vor den Bundestagswahlen 2002 waren z.B. die Flutkatastrophe in Ostdeutschland und die Angst vor einem Irakkrieg die Themen, die in der öffentlichen Diskussion überwogen[24].
Der größere Einfluss der Kurzzeitfaktoren spiegelt sich darin wider, dass der Wähler eine Diskontierung[25] vornimmt. So verlieren zurückliegende Ereignisse an Bedeutung und geraten in Vergessenheit. Für eine Regierung ist es sinnvoll, belastende Maßnahmen am Anfang der Legislaturperiode durchzuführen und Wahlgeschenke kurz vor Ende der Legislaturperiode zu verteilen. In einem föderativen Staat ist dieses Vorgehen weniger erfolgreich, weil Zwischenwahlen, insbesondere Landtagswahlen, den Wählern die Möglichkeit geben über die Bundesregierung abzustimmen. Weil die Länder in der Gesetzgebung mitbestimmen kann es sich die Regierung nicht leisten Landtagswahlen zu ignorieren.
Schließlich ist festzuhalten, dass mehrere Faktoren bei der Wahlentscheidung zusammenwirken. Es bestehen „komplexe Wechselwirkungen, deren Richtung und Gewicht genau zu bestimmen, der Wahlforschung schwer fällt.“[26]. Auch stimmen die Wähler nicht zwingend rational ab, sondern lassen sich ebenso von ihren Gefühlen leiten. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll aber ausgeschlossen werden, dass der Wähler affektiv abstimmt.
2.2. GEWALTENTEILUNG
Bei der Gewaltenteilung muss man zwischen vertikaler und horizontaler trennen. Während unter horizontaler Gewaltenteilung die Aufteilung in Exekutive, Legislative und Judikative gemeint ist, betont die vertikale Gewaltenteilung den föderativen Charakter der Bundesrepublik, wonach Bundesländer und Kommunen eigene Rechte besitzen. Da die Kommunen bei der Gesetzgebung eine untergeordnete Rolle einnehmen und Kommunal-wahlen wegen ihres engen regionalen Bezugs nicht als Stimmungsparameter für die Bundesregierung gelten, werden schwerpunktmäßig die Befugnisse der Länder bei der Gesetzgebung im Rahmen des Bundesrats untersucht. Auch die Europäische Union hat in der GKV in ihrer Ausgestaltung als Sozialversicherung noch keinen nennenswerten Einfluss.
2.2.1. Gesetzgebungsverlauf
Abbildung 2: Gesetzgebungsverfahren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesrat (2005).
Wie man der Abbildung entnehmen kann, können sowohl Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung eine Gesetzesvorlage einbringen. Sobald die Stellungnahmen nach Art. 76 Abs. 2 und 3 GG abgegeben wurden, trifft der Bundestag in drei Lesungen[27] einen Gesetzesbeschluss. Nach der ersten Lesung wird der Gesetzentwurf an einen oder mehrere Ausschüsse überwiesen, in denen auch Bundesbeamte, Landesbeamte, externe Gutachter und betroffene Verbände zu Wort kommen. Gegebenenfalls wird der Gesetzentwurf geändert oder auch ohne eine Änderung wieder in den Bundestag in zweiter Lesung eingebracht. Nach der zweiten Lesung kann der Gesetzentwurf wiederum in Ausschüsse überwiesen werden, bis schließlich in der 3. Lesung der Bundestag den Gesetzentwurf verabschiedet. Je nach Inhalt des Gesetzes handelt es sich um ein Zustimmungs- oder Einspruchsgesetz und dementsprechend divergiert der weitere Ablauf. Wenn der Bundesrat mit dem Gesetzes-beschluss einverstanden ist, wird das Gesetz von der Bundesregierung gegengezeichnet und kann nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten in Kraft treten. Ist der Bundesrat aber nicht einverstanden, führt der Weg über den Vermittlungsausschuss, wo ein Kompromiss zwischen den Interessen getroffen werden soll. Letztlich kann der Bundesrat dem Gesetz zustimmen oder es ablehnen. Bei Zustimmungsgesetzen wird das Gesetz endgültig abgelehnt oder bei Einspruchsgesetzen wird das Inkrafttreten durch ein suspensives Veto verzögert, da eine absolute Mehrheit des Bundestages das Gesetz dennoch in Kraft treten lassen kann. Bei einem Einspruch des Bundesrats mit Zwei-Drittel-Mehrheit allerdings müsste der Bundestag ebenfalls mit zwei Dritteln die zweite Kammer überstimmen, was bisher noch nicht vorgefallen ist.
2.2.2. Zustimmungsgesetze und Kompetenzen der Länder bei der gesetzlichen Krankenversicherung
Wenn die Opposition im Bundestag in der Länderkammer die Mehrheit hat, zum Beispiel von 1972 bis 1982, ergreift sie im Bundesrat die parteipolitische Chance der Mitregentschaft und tritt als Vetospieler auf[28]. Da man wegen der Verhältniswahl oft Koalitionsregierungen im Bund vorfindet, verhalten sich Länderkoalitionen mit einem Koalitionspartner der Bundesregierung bei strittigen Entscheidungen im Bundesrat neutral[29], was im Endeffekt eine Ablehnung bedeutet. Besonders bei Zustimmungsgesetzen ist die Zusammensetzung der zweiten Kammer in der Bundesrepublik und das damit verbundene Abstimmungsverhalten das Zünglein an der Waage für deren Inkrafttreten[30].
Für die GKV bzw. generell für den Bereich der Sozialversicherung teilen sich der Bund und die Länder die konkurrierende Gesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1 Nummer 12 GG. Weiterhin liegt die konkurrierende Gesetzgebung auf dem Gebiet der Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen, der Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten und des Verkehrs mit Arznei- und Heilmitteln in Art. 74 Abs. 1 Nummer 19 vor, sowie in Nummer 19a auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und deren Vergütung. Konkretisierend muss man zu diesen Kompetenztiteln folgendes anführen[31]: Bei der Sozialversicherung hat der Gesetzgeber einen „weiten Gestaltungsspielraum“[32], solange das Versicherungselement in Kombination mit der Versicherungspflicht und das Prinzip der Selbstverwaltung gewahrt bleiben[33]. Zum Gebiet der Sozialversicherung wird auch das Kassenarztrecht dazugezählt. Bei dem Kompetenztitel nach Nummer 19 sind die Regelungen für das Facharztwesen nicht erhalten, da sie in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder liegen[34]. Ferner darf der Bund primär nur die Zulassung zu den Heilberufen regeln und nicht die Ausbildungsinhalte und er darf Vorsorgeuntersuchungen bei lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs anordnen, nicht aber beispielsweise bei Zahnerkrankungen. Der Beruf des Apothekers fällt aus Nummer 19 heraus und ist unter Gewerbe nach Nummer 11 Art. 74 GG zu ordnen, was an der Qualität der Kompetenz nichts ändert. Hinsichtlich der wirtschaft-lichen Sicherung der Krankenhäuser sind neben öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern, auch private und freigemeinnützige Krankenhäuser zu verstehen[35]. Mit der Sicherstellung der Versorgung durch Krankenhäuser ist die Finanzierung durch Pflegesätze verbunden.
Damit der Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung tätig werden kann, muss eine bundesgesetzliche Regelung nach Art. 72 Abs. 2 GG erforderlich sein. Ansonsten haben alleine die Länder die Gesetzgebungsbefugnis. Die Notwendigkeit einer bundesgesetzlichen Regelung ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 24.10.2002[36] an enge Voraussetzungen geknüpft. So müssen sich die Lebensverhältnisse in den Ländern in „erheblicher … beeinträchtigender Weise auseinander entwickelt haben“, eine „Rechtszer-splitterung mit problematischen Folgen“ stattgefunden haben oder fehlende Bundes-regelungen „erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft“[37] darstellen. Letzteres spricht für einheitliche Regelungen der Sozialversicherung durch den Bundesgesetzgeber.
Selbst wenn der Bund die Gesetzgebungsbefugnis für die oben genannten Gebiete besitzt, müssen die Länder nicht außen vor blieben. Eine Zustimmungspflicht der Länder besteht vor allem dann, wenn Gesetze, die Verfassung ändern, das Finanzaufkommen der Länder tangieren und in die Verwaltungsautonomie der Länder eingreifen[38]. Bedürfen lediglich einzelne Teile eines Gesetzes der Zustimmung, so ist das komplette Gesetz nach dem Prinzip der „Einheitsthese“[39] zustimmungsbedürftig. Demgegenüber ist die Aufhebung eines Zustimmungsgesetzes nicht zustimmungsbedürftig und eine Änderung nur dann, wenn Reichweite und Bedeutung der zustimmungsbedürftigen Normen wesentlich neu gefasst werden[40]. Dem verfassungsändernden Gesetz kommt in der GKV wenig Bedeutung zu; öfters betreffen Gesetze das Finanzaufkommen der Länder. Nach Art. 104 Abs. 3 müssen die Länder einem Gesetz zustimmen, sobald sie ein Viertel der Ausgaben und mehr zu tragen haben. Da bei vielen Gesetzen die finanziellen Auswirkungen im Voraus schwer abzu-schätzen sind, bestehen bereits diesbezüglich Kontroversen zwischen Bund und Ländern. Der Bund hat einen Anreiz die Ausgaben klein zu rechnen, um die Zustimmungspflicht umgehen zu können. Als Hauptgrund für die Zustimmungspflicht der Länder[41] muss deren Verwaltungsautonomie nach Art. 30 GG i.V.m. Art. 83 GG gesehen werden. Bundesgesetze, staatliche Aufgaben und Befugnisse werden in der Regel von den Ländern ausgeführt. Wenn die Länder die Bundesgesetze in eigener Angelegenheit nach Art. 84 Abs. 1 GG oder im Auftrag des Bundes nach Art. 85 Abs. 1 GG vollziehen, liegt es in ihrer Kompetenz die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren, das „ob“ und „wie“ zu regeln, es sei denn Bundesgesetze verlangen etwas anderes. Die Einrichtung der Behörde ist dabei weit auszulegen und umfasst auch deren Aufgabengebiet. Zudem müssen beim Verwaltungs-verfahren die Eingriffe bzw. das Zusammenwirken zwischen Bund und Land über den Grundsatz der Bundestreue hinausgehen, um eine Zustimmungspflicht des Bundesrats zu begründen. Primär wird die Zustimmungspflicht also durch formelle Normen ausgelöst. Es ist dennoch unbedenklich, einem zustimmungspflichtigen Gesetz aufgrund von materiellen Normen nicht zuzustimmen, gleichermaßen ist eine Aufspaltung eines Gesetzes in einen zustimmungspflichtigen und nicht zustimmungspflichtigen Teil erlaubt.
Im Bereich der GKV haben Zustimmungsgesetze bei der Kassenorganisation eine herausragende Bedeutung, weil die Kassen regional gegliedert sind und als soziale Versicherungsträger in der Regel landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts darstellen[42]. Greift der Bund in die Kassenorganisation ein, insbesondere in das Verwaltungs-verfahren, muss es sich um qualitative Änderungen handeln, um eine Zustimmungspflicht des Bundesrats zu bedingen. Rein quantitative Änderungen wie die Erweiterung der Mitgliederzahl finden im Rahmen des bisherigen Aufgabenkreises statt und sind durch Art. 83 GG gedeckt[43]. Analog gilt dies für Eingriffe in die Verwaltung der Kassenärztlichen Vereinigungen im Land.
Besonders schwierig stellen sich darüber hinaus Gesetzesregelungen für die Krankenhäuser dar, da dieser Bereich in die Kompetenz der Länder fällt[44]. Die Organisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Hilfe für psychisch Kranke, das Rettungswesen und die Regelungen im Bereich der Ausbildung für Gesundheitsberufe gehören ebenfalls in Länderkompetenz[45], weil sie die Rechtsbereiche der Länder, öffentliche Sicherheit und Ordnung und Bildung, berühren. Will der Bund Teile dieser Bereiche in Gesetzen regeln, bedarf er der Zustimmung des Bundesrats.
Die Zustimmungspflicht erstreckt sich auch auf Rechtsverordnungen und Verwaltungs-vorschriften, die ihre Grundlage in einem zustimmungspflichtigen Gesetz haben. Würde dies nicht der Fall sein, wäre es leicht die Zustimmungspflicht zu umgehen. Bei Rechtsverord-nungen gab es bisher nur wenige Ablehnungen durch den Bundesrat[46], was darin zu begründen ist, dass Änderungswünsche des Bundesrats in der Regel vor Verabschiedung der Rechtsverordnung berücksichtigt werden. Möge diese Praxis „höchst effektiv“[47] sein, so zeichnet sie sich durch eine mangelnde Transparenz aus, weil die Einflussnahme der Länder in der Öffentlichkeit nicht sichtbar ist. In der GKV sind die Rechtsverordnungen hinsichtlich der Zustimmungspflicht vor allem im Krankenhausbereich relevant, wo der Haushalt oder die Leistungen der Krankenhäuser beeinflusst werden[48].
Lediglich in wenigen Bereichen kann der Bund ohne Rücksicht auf den Bundesrat Normen festlegen bzw. ändern. Dazu zählen vor allem das Arzneimittelrecht[49] und quantitative Anpassungen von Rechtsverordnungen und Gesetzen. Unter quantitative Änderungen können u.a. Zuzahlungen zu Arzneimitteln, Änderungen bei Zuschüssen (Zahnersatz, Brillen, Kuren), Krankengeldkürzungen und Mitgliederkreiserweiterungen fallen[50].
Insgesamt ist festzustellen, dass die Länder weitgehende Mitgestaltungs- und Blockademöglichkeiten in der Gesetzgebung zur GKV besitzen. Umfassende Strukturreformen lassen sich nur in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat durchführen. Eine Systematik bei der Zustimmungspflicht des Bundesrats kann zwar grob skizziert werden, doch ein „logisches, konsequentes Verfassungskonzept“[51] ist nicht zu erkennen. Vielmehr erfordert es jeweils einer Prüfung im Einzelfall, ob eine Zustimmungspflicht gegeben ist[52]. Letztlich sollte man auch die Selbstverwaltungsgremien in der GKV nicht unterschätzen, die im Rahmen der Gesetzgebung von Bund und Ländern eigene Regelungen treffen und speziell über Vergütungshöhen entscheiden können.
KAPITEL 3: ERKLÄRUNGSANSÄTZE DER ÖKONOMISCHEN THEORIE DER POLITIK
Um zu verstehen, welche Überlegungen und Kalküle der Politiker den Gesetzesinitiativen vorausgehen und welche den Wählern vor ihrer Stimmabgabe, sollen im Folgenden einige Theorien zeigen. Neben der wohl bekanntesten Theorie von Anthony Downs „Ökonomische Theorie der Demokratie“, werden die Theorien „Die Logik des kollektiven Handelns“ „Die Politische Ökonomie der Verfassung“ sowie die Theorie der Pfadabhängigkeit behandelt. Verzichtet wird auf Theorien über die Bürokratie, da die Bürokratie in einem dezentralisierten Mehrparteiensystem wie Deutschland von geringerer Bedeutung ist[53].
3.1. GEMEINSAME ANNAHMEN UND AXIOME
Mit Ausnahme der Theorie der Pfadabhängigkeit haben die nachfolgenden ökonomischen Theorien der Politik gemeinsame Axiome und Annahmen[54].
3.1.1. Der methodologische Individualismus
Im Zentrum des methodologischen Individualismus steht das Individuum. Allen sozialen Phänomenen gehen Denkprozesse und Handlungen von Einzelpersonen voraus, die jeweils unterschiedliche Präferenzen besitzen. Demnach werden Gruppen wie z.B. Parteien, die aus mehreren Individuen bestehen wie ein einzelnes Individuum behandelt. Diese Vereinfachung stellt aber zugleich die größte Gefahr dar, da Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe unberücksichtigt bleiben. Es wird insofern von einer homogenen Gruppe ausgegangen, was zweifelsohne in den wenigsten Fällen vorzufinden ist.
3.1.2. Das Rationalitätsprinzip
Ein rational denkender Mensch trifft Entscheidungen, indem er eine Kosten-Nutzen-Abwägung vornimmt. Er versucht seine Ziele nach seiner Präferenzordnung mit den geringsten Mitteleinsatz zu verwirklichen (Minimalprinzip) oder mit gegebenen Mitteln den größtmöglichen Nutzen zu erreichen (Maximalprinzip). Sparsamkeit ist oberstes Gebot und zeichnet den Menschen als „homo oeconomicus“ aus, der eigennützig für seine Ziele eintritt. Für die Entscheidungen zählt allein das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen, wobei Nutzenmaximierung und Kostenminimierung im Vordergrund stehen. Demzufolge handelt ein Mensch irrational, wenn er sich vor Bundestagswahlen über die verschiedenen Wahlprogramme informiert, weil die Kosten der Informationsbeschaffung den Ertrag aus der Stimme bei weitem übersteigen[55].
3.1.3. Die gegebenen Präferenzen
Für die ökonomischen Theorien sind die Präferenzen der Individuen als exogene Variable vorgegeben. Dabei wird unterstellt, dass die Präferenzen vollständig und transitiv sind. Problematisch wird eine Aggregation von individuellen Präferenzen wie Kenneth Arrow 1951 nachgewiesen hat.
3.1.4. Das Wettbewerbsprinzip im politischen Bereich
Die Politik wird bei den ökonomischen Theorien der Politik als Markt aufgefasst, wo mehrere Parteien und Politiker im Wettbewerb um die Wähler stehen. Die Politiker bieten Programme und Lösungen an und die Wähler bzw. Bürger fragen diese nach. In der Tauschbeziehung drücken die Wähler ihre Zufriedenheit mit der Regierung durch ihr Wahlverhalten aus und bezahlen mit ihrer Stimme den Preis[56]. Die Unterschiede zwischen politischen Markt und ökonomischen Markt bestehen in der Wettbewerbsorganisation und in der Art der getauschten Güter.
3.2. DIE ÖKONOMISCHE THEORIE DER DEMOKRATIE
Das Buch von Anthony Downs „Economic Theory of Democracy“ erhellt „das vermutlich wichtigste Motiv des Regierungsverhaltens“[57]: den Machterhalt durch Stimmenmaximierung. Es untersucht den Zusammenhang zwischen den Wünschen der Wähler und der tatsächlichen Regierungspolitik. Zunächst soll die Grundstruktur des Modells skizziert werden, dann die Rolle der Ungewissheit und letztlich die der Informationskosten.
3.2.1. Die Grundstruktur
Downs geht von einer zentralistischen Zwei-Parteien-Demokratie aus, in der das Mehrheitswahlrecht gilt und politische Optionen nur eindimensional sind. Wähler und Politiker streben nach individueller Nutzenmaximierung. Der Politiker möchte sein Einkommen, sein Prestige und seine Macht ausbauen, wofür er die Hilfe des Wählers benötigt[58][59]. Der Wähler entscheidet nach seinen Präferenzen und stimmt für den Politiker, für die Partei, die mit ihren Programmen seinen Vorstellungen am nächsten kommen. Dabei vergleicht er die Leistung der Regierungsparteien mit der der Oppositionsparteien und kalkuliert, welche den größten Nutzen gebracht haben, gebracht hätten bzw. bringen werden. Für den Wähler sind vorrangig die endende und die kommende Legislaturperiode bedeutsam. In einem föderalen Staat kann er zusätzlich die Leistungen der jeweiligen Parteien in den Ländern in seine Betrachtungen einfließen lassen. Der angesprochene Vergleich, das sogenannte Parteidifferential, gibt schließlich den Ausschlag für die Stimmabgabe. Demgemäss müssen Politiker, die die Regierung stellen wollen, den Wünschen der Mehrheit der Wähler entgegen kommen, um die Mehrheit der Stimmen zu gewinnen. Analog gilt dies für die Nominierungswahlzüge der Parteien. Wie folgende Grafik erkennen lässt, sind die Präferenzen der Mehrheit der Delegierten bei Nominierungen keineswegs immer mit denen der Mehrheit der Wähler bei Bundes- oder Landtagswahlen konform. Der Politiker muss daher zum Zeitpunkt der Nominierung (N) eher parteiideologische Standpunkte vertreten und sich mit näherrückendem Wahltermin zur Mehrheit der Wählerpräferenzen bewegen. Dieses Phänomen wird in der Literatur mit Medianwählertheorem bezeichnet.
Abbildung 3: Medianwähler
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene erweiterte Darstellung nach Herder-Dorneich/Groser (1977), S. 210.
3.2.2. Die Rolle der Ungewissheit
Um die Wünsche der potentiellen Wähler erfüllen zu können, müssen die Politiker deren Präferenzen kennen. Dies ist aber in den wenigsten Fällen gegeben. Aus diesem Grund stellt die Demoskopie eine sprudelnde Informationsquelle dar. Doch befragen Demoskopen nur ein kleinen Teil der Wähler; die Prognose hinsichtlich der Stimmenanteile ist nie exakt. Da jeder Bürger eine eigene Nutzenfunktion hat[60], reichen die Ressourcen der Parteien nicht aus, um alle in ihren Entscheidungsprozess einzubeziehen. Erst nach der Wahl kommen die wahren Präferenzen der Wähler und deren Verteilung ans Tageslicht[61]. Hier kommt auch das Unwissen über die Wählerbeweglichkeit zum Tragen, denn in Bereichen mit hoher Ausprägung ist der Wettbewerb umso größer und die Politik umso zielwirksamer[62]. Auch können Parteien die Folgen ihrer Entscheidungen nicht in Gänze bestimmen. Sie wissen nicht wie nichtpolitische Akteure noch von anderen Einflussgrößen in ihren Handlungen geleitet werden. Zusätzlich besteht gerade in pluralistischen Demokratien Unklarheit darüber, ob der Wähler die Verantwortlichen einer politischen Maßnahme identifizieren kann. Besonders bei Kompromissen zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien ist es kaum durchschaubar, wer der Urheber einzelner Regelungen ist. Der Wähler wird fatalerweise die falsche Partei bestrafen bzw. belohnen[63]. Folglich wird jeder Politiker versuchen Erfolge als die Seinen zu verbuchen und Misserfolge den Gegnern zu attribuieren. Die Reaktion der politischen Gegner darauf ist ebenfalls ungewiss, genau wie deren Strategien und Handlungen. Noch weiß die Regierung nicht, welche Reichweite und welche Überzeugungskraft Oppositionspolitiker mit ihren Argumenten innerhalb der Wählerschaft haben. Ähnliches gilt für Wähler, die zu anderen in einem besonderen Vertrauensverhältnis stehen[64] oder die in weiten Teilen der Bevölkerung bekannt und beliebt sind. Diese sind überzeugender als unbekannte Wähler.
Selbstverständlich unterliegen die Wähler einer ähnlichen Ungewissheit[65]. So wissen sie nicht, ob die Politiker ihre Präferenzen kennen und diese entsprechend deuten können. Weiter ist es unklar, in welchem Ausmaß die Interessen des einzelnen Wählers durch die Politik bei Entscheidungen Berücksichtigung finden. Bei getroffenen oder geplanten Entscheidungen kann es ihnen verborgen bleiben, inwieweit ihr Nutzeneinkommen beeinträchtigt wird. Sie kennen mögliche Alternativen nicht, die stattdessen hätten getroffen werden können. Außerdem können sie, wie oben bereits angedeutet, die Ursache und die Urheber einer Maßnahme, die ihr Nutzeneinkommen positiv oder negativ tangieren nicht zweifelsfrei bestimmen. Sie wissen oft nicht, ob die Politik selbst oder externe Akteure verantwortlich sind. Bis zum Ende des Wahltags bleibt es unklar, wie andere Wähler abgestimmt haben und abstimmen werden. Die Kenntnis darüber wäre jedoch für viele Wähler hilfreich, da sie dann abschätzen könnten, welchen Wert ihre Stimme haben wird. Eine „sinnlose“ Stimme könnte vermieden werden[66]. Auch weil der Wähler das Wahlergebnis vor seiner Stimmabgabe nicht kennt, „untermauert er in Wirklichkeit eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung von Kompromissen.“[67]. Selbst wenn er das Ergebnis vorher kennen würde, ist es für ihn ungewiss, ob die Regierungspartei ihre Versprechen, ihr Wahlprogramm eins zu eins umsetzt und wie ein Koalitionspartner oder der Bundesrat ein Abweichen bestimmt.
Es ist festzustellen, dass Ungewissheit bei den Wählern und den Politikern das Erreichen eines Pareto-Optimums unmöglich macht[68]. Andererseits bleibt ein „Chaos“ durch das Arrow-Paradox aus, das besagt, dass bei Kenntnis aller einzelnen Präferenzen die Aggregation zu einer sozialen Wohlfahrtsfunktion nicht widerspruchsfrei wäre.
3.2.3. Die Bedeutung von Informationskosten
Da die Ungewissheit ein Problem darstellt, besteht für Wähler und Politiker ein Anreiz diese durch Informationen zu reduzieren. Die Stärke des Anreizes ist unterschiedlich ausgeprägt und beim Wähler geringer als beim Politiker. Das hängt mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis zusammen und mit der Tatsache, dass Informationen nicht kostenlos zu bekommen sind. Ein Wähler verbraucht auf jedem Fall Zeit um sich über Vorschläge von Politikern zu informieren und nicht zuletzt auch um zum Wahllokal zu gehen. Diese Kosten überwiegen den Nutzen seiner Abstimmung. Bei größeren Wahlen hat eine Stimme nur geringen Einfluss auf den Ausgang der Wahl. Demnach ist es nach Downs für Wähler individuell irrational sich gut zu informieren[69]. Da die Ressourcen des Wählers und die Aufnahmekapazität für Informationen knapp sind, muss er sich auf die Informationen beschränken, die für sein Nutzeneinkommen am bedeutendsten sind. Oder er muss seine Kosten der Informationsbeschaffung auf andere übertragen, die die Informationen für ihn sammeln, analysieren und auswerten[70]. Dies können in erster Linie Medien, wie z.B. Tageszeitungen oder Fernsehnachrichten sein, aber auch Experten eines Fachgebiets, die oft als Lobbyisten[71] versuchen die Regierungspolitik zu lenken. Parteiideologien können die Informationskosten ebenfalls senken[72], da sie die Grundausrichtung der Partei für den Wähler signalisieren und er daraus die Positionen in den jeweiligen Sachgebieten ableiten kann. Allerdings bleibt letztlich die Wertung der ausgewerteten Informationen immer noch Sache des einzelnen Wählers[73]. Während auf der einen Seite die Informationskosten für den Wähler eine Rolle spielen, ist auf der anderen Seite der Stimmenwert nicht zu vernachlässigen, da es im Endeffekt auf das Verhältnis von beiden ankommt. Den Stimmenwert kann der Wähler nur schwer selbst ändern, weil er stark vom Verhalten der anderen Wähler abhängig ist. So steigt der Stimmenwert bei geringer Wahlbeteiligung und knappen Wahlausgang und sinkt bei hoher Wahlbeteiligung und eindeutigem Wahlausgang.
[...]
[1] Darnstädt/ Kloth (2003), S. 34.
[2] Guggenberger (1995), S. 36f.
[3] Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG.
[4] Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GG.
[5] Vgl. Jesse (1988), S. 24f und Nohlen (2004), S. 37-39.
[6] Vgl. Degenhart (2002), S. 11.
[7] Vgl. Jesse (1988), S. 24f.
[8] Jesse (1988), S. 24.
[9] Vgl. Jesse (1988), S. 24f.
[10] Vgl. Nohlen (2004), S. 38-39.
[11] Vgl. Art. 14 BayVerf.
[12] Vgl. BWG und BWO.
[13] Wahlrecht.de (2005a).
[14] Vgl. Korte (2000), S. 24f.
[15] Vgl. Bundesverfassungsgerichtsentscheidung am 10.04.1997.
[16] Vgl. Nohlen (2004), S. 317.
[17] Vgl. Korte (2000), S. 43.
[18] Vgl. Korte (2000), S. 57: Der Gipfel bei der Anzahl der Überhangmandate wurde 1994 mit 16 Mandaten
erreicht, wobei 12 auf die CDU entfielen.
[19] Vgl. Schultze (2002), S. 559-561.
[20] Vgl. Norpoth/Goergen (1990), S. 345-375.
[21] Vgl. Korte (2000), S. 90.
[22] Vgl. Dalton/Rohrschneider (1990), S. 297-324.
[23] Schultze (2002), S. 560.
[24] Vgl. Jung/Roth (2002), S. 12.
[25] Vgl. Schneider (1982), S. 69.
[26] Schultze (2002), S. 560.
[27] Vgl. §§79,81,84 GO-BT.
[28] Vgl. Schmidt (2001), S. 28f.
[29] Da im Bundesrat eine positive Abstimmung stattfindet in dem Sinne „wer stimmt dem Gesetz zu?“, zählt die absolute Mehrheit der Ja-Stimmen. Eine Enthaltung entspricht quasi einer Nein-Stimme.
[30] Vgl. Limberger (1982), S. 154: Limberger konstatiert, dass gerade neutrale Bundesländer „häufig entscheidend gewesen sein können.“.
[31] Vgl. Maunz (1984).
[32] Vgl. Maunz (1984), S. 85.
[33] Vgl. Maunz (1984), S. 82-85: Würde die Versicherungspflicht entfallen, wäre die Kompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 abzuleiten.
[34] Vgl. Kamarsin , S. 325 .
[35] Universitätsklinika gehören zu den Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern in Art. 91a Satz 1 Nummer 1 GG.
[36] Vgl. Bundesverfassungsgericht - Pressestelle – (2002).
[37] Bundesverfassungsgericht - Pressestelle – (2002).
[38] Vgl. Pfitzer (1991), S. 62.
[39] Vgl. Limberger (1982), S. 34.
[40] Vgl. Limberger (1982), S. 43-45.
[41] Die folgende Darstellung lehnt sich an Lerche (1985) an.
[42] Art. 87 Abs. 2 Satz 2 GG.
[43] Vgl. Weber (1995) , S. 247.
[44] Bandelow (1998), S. 115.
[45] Vgl. Bandelow (1998), S. 115 und Jarass/Pieroth (2000), S. 765.
[46] Vgl.Limberger (1982), Tabelle S. 138.
[47] Limberger (1982), S. 97.
[48] §16 KHG.
[49] Vgl. Bandelow (1998), S. 115.
[50] Vgl. Bundestags-Drucksache 13/4615.
[51] Limberger (1982), S. 30.
[52] Bei Zweifeln zwischen Bund und Ländern kann das Bundesverfassungsgericht nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG angerufen werden.
[53] Bernholz (1974), S. 194.
[54] Die folgende Darstellung lehnt sich an Groser (1980), S. 6-11 an.
[55] Vgl. Wildenmann/Downs (1968), S. 261.
[56] Vgl. Catlin (1927), zitiert nach Herder-Dorneich/Groser (1977), S.50: „Wählerstimmen sind das „Geld der Politik”.”
[57] Frey (1970), S. 11.
[58] Die folgende Darstellung lehnt sich an Wildenmann/Downs (1968), S. 3-50 an.
[59] Vgl. Kirsch (2004), S. 257: „Ein Politiker, der nicht primär auf die Machterringung und den Machterhalt fixiert ist, landet über kurz oder lang im politischen Nichts.“.
[60] Vgl. Wildenmann/Downs (1968), S. 184.
[61] Vgl. Kirsch (2004), S. 319.
[62] Vgl. Zohlndörfer (1980), S. 82-102.
[63] Wenn ein Kompromiss zw. Opposition und Regierung zustande gekommen ist, wird regelmäßig die Regierung dafür verantwortlich gemacht, die ja für die Umsetzung des Gesetzes Rechnung trägt (z.B. bei Hartz-IV).
[64] Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung können zweifelsohne die Ärzte durch ihre Schweigepflicht als Vertraute des Patienten gesehen werden.
[65] Vgl. Wildenmann/Downs (1968), S. 77f.
[66] Hat die favorisierte Partei eines Wählers keine Aussicht auf Erfolg, so kann es sinnvoller sein die zweitbeste Alternative zu wählen, die aussichtsreicher ist.
[67] Wildenmann/Downs (1968), S. 144.
[68] Vgl. Wildenmann/Downs (1968), S. 175.
[69] Vgl. Wildenmann/Downs (1968), S. 292 und Kirsch (2004), S.136.
[70] Vgl. Wildenmann/Downs (1968), S. 204f.
[71] Vgl. Kirsch (2004), S. 136f.
[72] Vgl. Groser (1980), S.12f
[73] Vgl. Wildenmann/Downs (1968), S. 232.
- Arbeit zitieren
- Diplom Staatswissenschaftler (Univ.) Michael Grüner (Autor:in), 2005, Ansätze zu einer Theorie der Reformen in einem demokratischen Staat - dargestellt am Beispiel der Gesundheitsreformen seit 1955 in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47168
Kostenlos Autor werden




















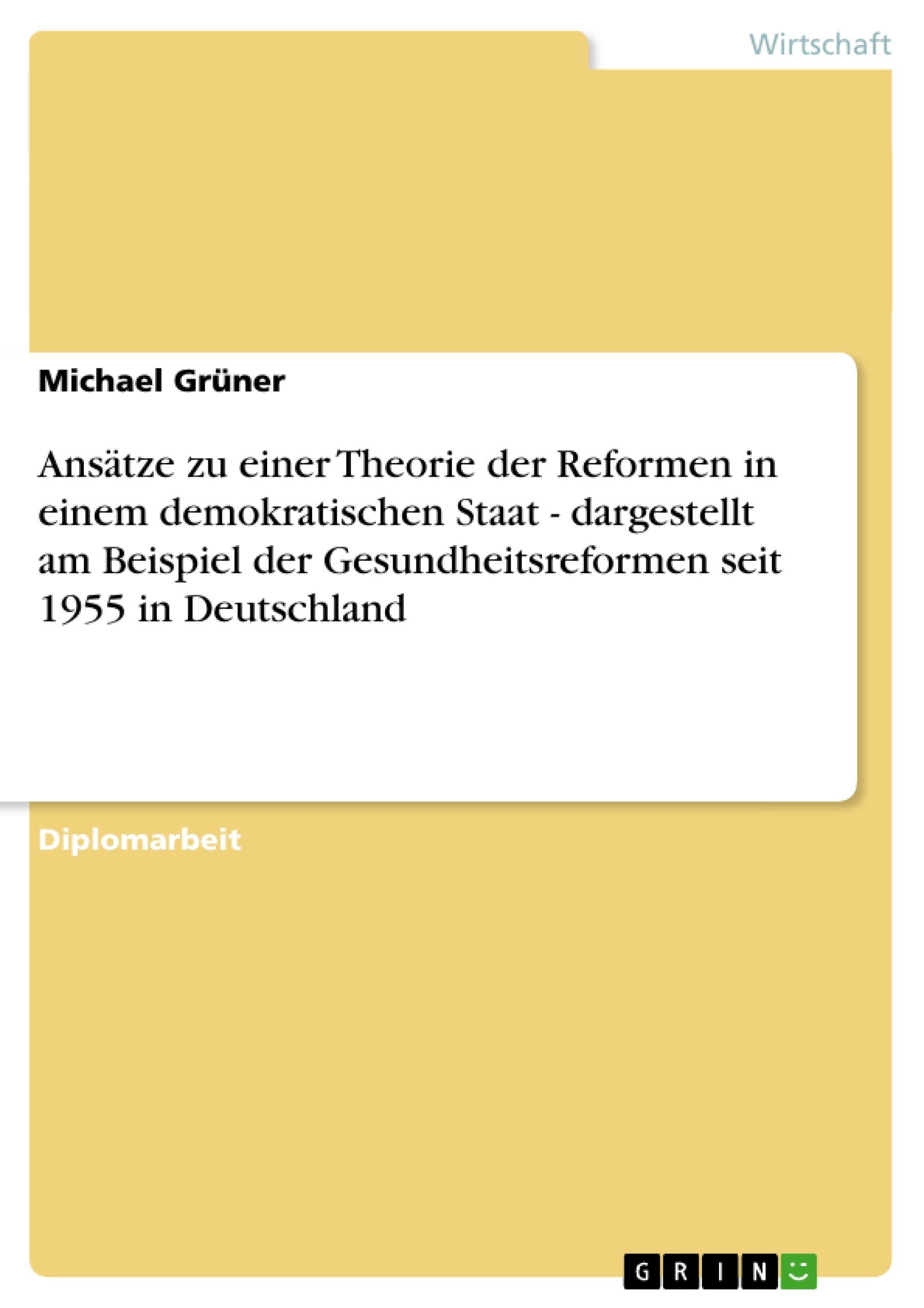

Kommentare