Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
1. Fallbeispiel Sachsen
II Hauptteil
2. Grundbegriffe und Grundannahmen der ökonomischen Theorie der Politik
3. Die politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien
3.1. Minimal winning und minimum size coalitions
3.1.1. Fallbeispiel Sachsen
3.1.2. Bewertung
3.2. Minimal range und minimal connected winning coalitions
3.2.1. Fallbeispiel Sachsen
3.2.2. Bewertung
3.3. Weiterentwickelte Ansätze
III Fazit
IV Literaturverzeichnis
I Einleitung
„Es ist keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftehe. Aber auch in Vernunftehen kann die Liebe noch später kommen.“[1]
Am 19. September 2004 fand im Freistaat Sachsen die Wahl zum Vierten Sächsischen Landtag statt. Bisher konnte die sächsische CDU mit einer relativ komfortablen Mehrheit alleine regieren. Erstmalig seit 1990 verlor die Union nun ihre absolute Mehrheit im Landtag, womit der Zwang zur Koalition entsteht. Die Koalitionsverhandlungen wurden bereits aufgenommen. Deren Abschluss kann in dieser Arbeit jedoch nicht mehr berücksichtigt werden.
In der vorliegenden Arbeit soll mit Hilfe von politisch- ökonomischen Zugängen zum Prozess des Regierens erklärt werden, mit welcher Partei die sächsische Union voraussichtlich koalieren wird. Die konkrete Fragestellung lautet somit: Welche Regierungskonstellation kann mit Hilfe der politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien nach der Wahl zum Sächsischen Landtag Mitte September 2004 prognostiziert werden? Koalitionsbildungsprozesse stellen natürlich einen wichtigen Teilaspekt im Prozess des Regierens dar, ja viel mehr ermöglichen diese erst den Prozess des Regierens. Die auf das Fallbeispiel Sachsen bezogene Fragestellung ist insofern von Bedeutung, als mit deren Beantwortung die Erklärungskraft von Koalitionstheorien beurteilt werden soll und aufgezeigt werden kann, welcher Teil der sozialen Wirklichkeit damit plausibel erklärt werden kann. Andererseits kann gleichzeitig dargestellt werden, wo diese Theorien ihre blinden Flecken haben bzw. die soziale Wirklichkeit nur sehr unvollkommen abbilden.
Die Koalitionstheorien basieren größtenteils auf politisch- ökonomischen und spieltheoretischen Ansätzen. Unter politisch- ökonomischen Analyseansätzen werden in der Literatur verschiedene sprachliche Spielarten dargeboten, so z.B. Neue Politische Ökonomie, Moderne Politische Ökonomie oder das angelsächsische Pendant Public Choice. Die treffendere Bezeichnung, die auch in dieser Arbeit schon wegen ihrem besseren Verständnis bevorzugt wird, ist jedoch Ökonomische Theorie der Politik.
Die Literaturgrundlage für diese Forschungsrichtung ist immens groß. Einen hervorragenden Überblick über diesen Ansatz bietet Franz Lehner, der mit vielen Beispielen das Verständnis erleichtert.[2] Im Bezug der ökonomischen Theorie auf die Demokratie kann die Studie von Anthony Downs als eine Art „Klassiker“ herangezogen werden.[3] Downs bezieht sich hierbei teilweise auf die schon früher von Schumpeter entwickelte Kapitalismustheorie.[4] Zum Verständnis des Koalitionsbildungsprozesses und der Logik des Parteihandelns in Koalitionen sei an dieser Stelle besonders auf Budge/ Keman verwiesen.[5] Einen umfassenden Überblick über Regierungskonstellationen in 13 westeuropäischen Staaten ermöglicht die Studie von Müller und Strom.[6] Die Autoren gehen besonders auf die Rahmenbedingungen von Koalitionen, den Koalitionsbildungsprozess, die Praxis des Koalitionsregierens und die Beendigung von Kabinetten ein. Für die Bundesrepublik Deutschland ist die Veröffentlichung von Kropp und Sturm sehr hilfreich.[7] Die grundlegende Literatur der politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien ist im Hauptteil dieser Arbeit unter dem jeweiligen Analyseansatz zu finden und wird daher an dieser Stelle nicht gesondert aufgeführt.
Im nun folgenden Hauptteil werden zunächst die Grundlagen des politisch- ökonomischen Analyseansatzes erläutert, da die Koalitionstheorien größtenteils auf diesen aufbauen. Danach werden die Koalitionstheorien allgemein vorgestellt und sogleich auf das Fallbeispiel Sachsen, dass im folgenden Kapitel erläutert wird, bezogen. Die Ansätze werden nach ihrem Bezug auf das Fallbeispiel einer Bewertung unterzogen, damit im abschließenden Fazit die eingangs gestellte Fragestellung beantwortet werden kann.
1. Fallbeispiel Sachsen
Die Wahl zum Vierten Sächsischen Landtag vom 19. September 2004 erzeugte ein Novum in der noch jungen Geschichte des Landtags seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990. Erstmalig verlor die sächsische Union ihre absolute Mehrheit im Parlament und muss sich nun auf die Suche nach einem Koalitionspartner begeben.
Die CDU konnte nur 41,1 % der Zweitstimmen erringen und verlor damit im Vergleich zur Landtagswahl im Jahre 1999 fast 16 Prozentpunkte. Auch gelang es der Union nicht, wie noch zuvor in den Landtagswahlen 1990, 1994 und 1999, alle Direktmandate für sich zu gewinnen.[8] Die Wahlkreise Chemnitz 4 (Wahlkreis 15), Hoyerswerda (Wahlkreis 55), Leipzig 3 (Wahlkreis 27) und Leipzig 5 (Wahlkreis 29) wurden jeweils durch PDS- Kandidaten gewonnen, Leipzig 4 (Wahlkreis 28) wurde durch die SPD gewonnen.[9]
Dennoch bleibt die CDU stärkste Kraft in Sachsen, gefolgt von der PDS, die mit 23,6 % ihr bisher bestes Wahlergebnis erzielen konnte und sich im Vergleich zu 1999 um 1,4 Prozentpunkte verbesserte. Die SPD bleibt drittstärkste Kraft im Land, setzte aber den Abwärtstrend seit 1990 fort und erreichte lediglich 9,8 % der abgegebenen Zweitstimmen.
Ein weiteres Novum ist die Erweiterung der Zahl der im sächsischen Landtag vertretenen Parteien. Die hohen Stimmenverluste der CDU bescherten den kleineren Parteien, vor allem der NPD, enorme Stimmenzuwächse. So verlor die CDU 36.000 Stimmen an die PDS, 28.000 Stimmen an die SPD, 12.000 an die Grünen und jeweils 40.000 Stimmen an FDP und NPD.[10]
Die NPD erreichte erschreckende 9,2 % und ist nun ebenso im Landtag vertreten wie die FDP, die 5,9 % der Wählerstimmen für sich verbuchen konnte sowie die Grünen, die relativ knapp mit 5,1 % die Fünf- Prozent- Hürde überspringen konnten. Alle übrigen Parteien erreichten zusammen 5,3 %. Folglich sind im neuen sächsischen Landtag sechs Parteien repräsentiert – eine Verdopplung im Vergleich zum Vorherigen.
Tabelle 1: Wahlergebnisse und Mandatsverteilung nach der Wahl zum Vierten Sächsischen
Landtag vom 19. September 2004[11]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Vierte Sächsische Landtag wird um vier zusätzliche Mandate erweitert, so dass nun insgesamt 124 Sitze auf die Parteien verteilt werden. Grund hierfür waren zwei Überhangmandate der CDU. Diese wurden um zwei Ausgleichsmandate erweitert, die jeweils auf PDS und SPD entfielen. Die absolute Mehrheit im neuen Landtag liegt somit bei 63 Sitzen.
Da die CDU als stärkste Kraft eine Koalition mit einer anderen Partei eingehen wird, ergeben sich insgesamt vier mögliche Koalitionszusammensetzungen, die über eine absolute Mehrheit im Landtag verfügen würden.
Tabelle 2: Mögliche Koalitionszusammensetzungen mit absoluter Mehrheit nach der Wahl
zum Vierten Sächsischen Landtag vom 19. September 2004
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine Koalition zwischen der CDU und der FDP würde die für eine absolute Mehrheit erforderlichen Sitze knapp um einen Sitz verfehlen.
II Hauptteil
2. Grundbegriffe und Grundannahmen der ökonomischen Theorie der Politik
Die ökonomische Theorie der Politik beschäftigt sich mit einem breit angelegten Spektrum politischer Strukturen und Prozesse, das von Wahlen und der Logik der Parteienkonkurrenz über Organisations- bzw. Bürokratietheorien bis hin zu Verfahren der Mehrheitsbildung und der hier im Blickpunkt stehenden Koalitionstheorien reicht.
Obwohl also sehr unterschiedliche Bereiche sozialer Wirklichkeit erklärt werden sollen, beruhen alle Modelle auf einer ihnen gemeinsamen allgemeinen Grundannahme bzw. Theorie, nämlich der Theorie der rationalen Wahl.[12]
Das Rationalitätsprinzip behauptet, dass Individuen durch ihr Verhalten versuchen, ihren Nutzen zu maximieren. Es wird unterstellt, dass Verhalten immer an bestimmten Zwecken orientiert ist.
Diese in den Wirtschaftswissenschaften entwickelte Theorie beruht auf der Idee des sozialen Tausches. Demnach können soziale Beziehungen als ein Austausch von materiellen und immateriellen Gütern und Dienstleistungen verstanden werden. Der soziale Tausch bildet aus der Sichtweise der ökonomischen Theorie die Grundlage einer jeden Gesellschaft. Aus der Theorie wird nun abgeleitet, dass die Strukturen und Prozesse in einer Gesellschaft prinzipiell als Folge des sozialen Tausches erklärt werden können. Die Tauschprozesse schlagen sich also in gesellschaftlichen Strukturen nieder. Die dadurch entstandenen bzw. veränderten Strukturen wirken dabei auf die sie verursachenden Tauschprozesse zurück und verändern diese. Durch den veränderten sozialen Tausch entstehen wiederum veränderte gesellschaftliche Strukturen.
Somit verbindet die Idee des sozialen Tausches einerseits Strukturen und Prozesse mit individuellem Verhalten, andererseits aber auch individuelles Verhalten mit Strukturen und Prozessen. Die axiomatische Basis dieser Theorie ist somit auf das einzelne Individuum bezogen, weshalb dieser Denkansatz auch als methodologischer Individualismus bezeichnet wird. Es handelt sich hier um ein Erkenntnisprinzip, demzufolge Strukturen und Prozesse einer Gesellschaft mit Hilfe von Gesetzen über individuelles Verhalten erklärt werden können, also Aussagen über gesellschaftliche Strukturen und Prozesse direkt ableitbar sind aus Aussagen über individuelles Verhalten. Obwohl die Axiome auf das einzelne Individuum bezogen sind, darf diesem Ansatz nicht unterstellt werden, dass hier versucht wird, soziale Strukturen bzw. Prozesse auf individuelle Bedürfnisse und Neigungen zurückzuführen. Dies ist keineswegs beabsichtigt. Viel mehr liegt die Intention in der Formulierung allgemeiner Verhaltensprinzipien, also beispielsweise Aussagen über Organisationen, Institutionen oder die gesamte Gesellschaft, die wiederum abgeleitet werden aus Hypothesen über individuelles Verhalten.
Der methodologische Individualismus betrachtet gesellschaftliches Zusammenleben somit aus Sicht des einzelnen Menschen, nicht aber aus der Sicht der Gesellschaft als Ganzem. Prozesse innerhalb einer Gesellschaft entstehen, da Menschen denken, fühlen, reden und vor allem handeln. Diese Handlungen sollen aber nicht aus Sicht der Gesellschaft verstanden werden. Häufig wird diesem Ansatz daher unterstellt, dass er außer acht lässt, dass der einzelne Mensch auch gesellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt ist. Der methodologische Individualismus ist aber sehr wohl vereinbar mit der Beeinflussbarkeit und Formbarkeit des Menschen durch soziale Einflüsse, nur dass aus dieser Sichtweise der Mensch nicht durch die Gesellschaft geformt wird, sondern in der Gesellschaft. Der einzelne Mensch begegnet ja nicht der gesamten Gesellschaft, sondern einzelnen Gesellschaftsmitgliedern.[13]
Somit steht der methodologische Individualismus im Kontrast zum methodologischen Holismus bzw. Organizismus. Diesem Ansatz zufolge weisen soziale Strukturen und auch gesellschaftliche Organisationen eine bestimmte Eigendynamik auf, die nicht vollkommen das Ergebnis individueller Handlungen sein können. Soziale Strukturen und Prozesse sind diesem Ansatz zufolge also prinzipiell nicht erklärbar mit einer Theorie, deren axiomatische Basis Aussagen über individuelles Verhalten sind, sondern lediglich mit einem theoretischen Ansatz, deren Axiome Aussagen über soziale Strukturen und Organisationen selbst sind.[14]
Um die Grundannahmen der ökonomischen Theorie vollständig zu behandeln, bedarf die eingangs erwähnte Idee des sozialen Tausches noch einer eingehenderen Beschäftigung. Grundlage der Idee des sozialen Tausches ist eine Gesellschaft, in der ein Minimum an gesellschaftlicher Arbeitsteilung und Verschiedenheit von Individuen anzutreffen ist, denn würden alle Gesellschaftsmitglieder dasselbe produzieren und konsumieren, dann gäbe es für sie keinen Anreiz, Tauschbeziehungen untereinander einzugehen. Der Logik des sozialen Tausches liegt somit immer die Annahme zugrunde, dass die einzelnen Gesellschaftsmitglieder nicht alles konsumieren, was sie produzieren und anders herum nicht alles produzieren, was sie konsumieren. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich die nächste Grundannahme der ökonomischen Theorie, nämlich der Tatbestand der Güterknappheit. Wären die Güter einer Gesellschaft, egal ob materiell oder immateriell, nicht knapp, dann könnte jedes Gesellschaftsmitglied die benötigten Güter beschaffen, ohne dafür in Tauschbeziehungen zu anderen Individuen treten zu müssen.
Durch die Arbeitsteilung und die Verschiedenheit der Menschen in Bezug auf die Produktion und Konsumtion von knappen Gütern entsteht in einer Gesellschaft eine soziale Differenzierung sowie Ungleichheit, Macht und Konflikte, besonders Konflikte im Hinblick auf die Verteilung von knappen Gütern. Soziale Differenzierung, Ungleichheit, Macht und Konflikte sind somit einerseits das Ergebnis von Arbeitsteilung, Knappheit und sozialem Tausch, andererseits bilden sie zugleich die spezifischen Rahmenbedingungen, in denen Tauschprozesse vollzogen werden und führen zu unterschiedlichen Ausprägungen der Tauschbeziehungen, haben also Einfluss auf die Organisation der Tauschvorgänge selbst. Zum besseren Verständnis ist dieser Sachverhalt in der folgenden Darstellung abgebildet.
Darstellung 1: Bedingungen und Faktoren des sozialen Tausches[15]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Idee des sozialen Tausches und der Denkansatz des methodologischen Individualismus sind die Grundannahmen der ökonomischen Theorie, erklären allerdings nur unvollkommen ihren Charakter. Die ökonomische Theorie wird erst dann zur wirklichen ökonomischen Theorie, wenn man die eben gemachten Ausführungen mit dem utilitaristischen Prinzip verbindet.
Entsprechend diesem Grundsatz wird ein Individuum in einer bestimmten Situation immer diejenige Verhaltensalternative wählen, von der es den größten Nutzen erwartet oder, bei nicht unterscheidbarem Nutzen, diejenige, die mit den geringsten Kosten verbunden ist. Die ökonomische Theorie wird somit zu einer Theorie der rationalen Wahl. Das Rationalitätsprinzip unterstellt dem Individuum folglich zielorientiertes Handeln. Ein rational handelndes Individuum versucht also, seine Ziele weitestgehend zu erreichen und damit seinen Nutzen zu maximieren. Das Erreichen bestimmter Ziele ist für das Individuum allerdings mit Kosten verbunden. Zielorientiertes Verhalten setzt in der Regel einen bestimmten Aufwand an Zeit, Geld oder anderen Ressourcen voraus. Die für die Zielerreichung eingesetzten Ressourcen sind häufig ebenfalls wertvolle bzw. knappe Güter. Stehen zwei Wege der Zielerreichung zur Verfügung, dann wählt das Individuum auf Grund einer rationalen Entscheidung denjenigen, der mit einem geringeren Aufwand an Ressourcen zu beschreiten ist. Eine besondere Art von Kosten entsteht dadurch, dass die für die Erreichung eines bestimmten Zieles eingesetzten Ressourcen nicht mehr einsetzbar sind für die Erreichung anderer Ziele. Durch diese Tatsache entgeht dem Individuum natürlich ein durch andere Ziele definierter Nutzen. Diesen Verlust von anderweitig erzielbarem Nutzen bezeichnet man als Opportunitätskosten. Somit wählt das Individuum immer die Verhaltensalternative, die ihm den größten Netto- Nutzen, also den größtmöglichen Netto- Gewinn verspricht.
Eine wichtige Rolle in der ökonomischen Theorie spielen auch die Informationskosten. Individuen benötigen zur Entscheidungsfindung natürlich Informationen über die möglichen Verhaltensalternativen. Die zur Beschaffung und Verarbeitung eingesetzten Ressourcen werden als die Informationskosten einer Wahl bezeichnet. Dabei tritt häufig das Problem auf, dass Akteure nur unzureichende Informationen über ihre Verhaltensalternativen und vor allem deren Konsequenzen haben. Dieser Umstand wird als Ungewissheit bezeichnet, den man durch die Intensivierung der Informationsbeschaffung minimieren kann. Da Akteure häufig nur über unzureichende Informationen über verschiedene Verhaltensalternativen verfügen, handeln sie häufig nicht vollkommen, sondern lediglich begrenzt rational. Wenn andererseits die Informationskosten eines Akteurs größer sind als der von der Informationsbeschaffung erwartete Nutzen, ist es natürlich rational, auf die weitere Beschaffung von Informationen zu verzichten und bewusst eine Ungewissheit über die Konsequenzen des Handelns in Kauf zu nehmen.
In ökonomischen Beziehungen lassen sich Kosten und Nutzen relativ leicht in Geldeinheiten ausdrücken. In sozialen Beziehungen ist dies allerdings häufig nicht der Fall. So lässt sich der mit der Übernahme eines politischen Amtes, beispielsweise eines Ministerpostens, ergebende Nutzen eben nicht nur in Geldeinheiten definieren. Der damit verbundene Zuwachs an Prestige und Macht würde z.B. vollkommen außen vor gelassen werden. Sobald die unterschiedlichen Arten von Kosten und Nutzen einer Entscheidungssituation jedoch nicht mehr monetär definierbar sind, entsteht für das Individuum prinzipiell das Problem der Abwägbarkeit zwischen verschiedenen Handlungsalternativen. Das Rationalitätsprinzip würde hiermit bedeutungslos werden. Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, bedient sich die ökonomische Theorie dem Begriff der Präferenz. Eine Präferenz kann als eine Vergleichsrelation aufgefasst werden, nach der ein Individuum unterschiedliche Zielzustände und den damit verbundenen Nutzen (also die Menge von knappen Gütern) im Bezug auf ihre subjektive Wünschbarkeit ordnet. Eine Präferenzordnung kann prinzipiell nur aus einem Vergleich hervorgehen, d.h. das Individuum vergleicht Zielzustand A mit Zielzustand B und legt fest, welchen Zustand es präferieren würde. Kann es sich zwischen den Zielszuständen A und B nicht entscheiden, dann ist es hinsichtlich dieser indifferent.
Die ökonomische Theorie unterstellt Individuen, dass sie in der Lage sind, ihre Präferenzen so zu ordnen, dass sie individuelle Entscheidungen eindeutig bestimmen können. Die individuellen Präferenzen müssen dabei die Prinzipien der Konnektivität, Transitivität und Kontinuität erfüllen.
Das Prinzip der Konnektivität verlangt, dass ein Individuum in der Lage ist, all seine Zielzustände einander zuzuordnen. Dies bedeutet, dass zwischen den Zielzuständen A und B entweder eine Präferenz- oder eine Indifferenzrelation bestehen muss. Gemäß dem Prinzip der Transitivität muss die Präferenzordnung eines Individuums eindeutig und in sich widerspruchsfrei geordnet sein. Wird der Zielzustand A dem Zielzustand B vorgezogen und des weiteren der Zustand B vor C präferiert, so muss auch A vor C bevorzugt werden. Die Präferenzordnung eines Individuums muss zudem durch Kontinuität charakterisiert sein. Wenn ein Individuum den Zustand A vor B präferiert und es existiert ein weiterer Zielzustand C, der A ähnlich ist, dann muss das Individuum auch C vor A präferieren.
Diese drei Bedingungen sind nicht direkt aus dem Rationalitätsprinzip ableitbar, sondern fungieren als zusätzliche Axiome. Das Rationalitätsprinzip wird dahingehend erweitert, dass ein Individuum in einer bestimmten Situation immer diejenige Verhaltensalternative auswählen wird, die am stärksten mit seinen Präferenzen übereinstimmt, also diejenige, die in seiner Präferenzordnung an erster Stelle steht.
Diese abstrakte Theorie wird im Rahmen eines komparatistischen Ansatzes verwendet, d.h. die Präferenz- sowie Nutzen- und Kostenfunktionen und die sich ergebenden Wahlmöglichkeiten der Akteure werden im Rahmen eines Modells beschrieben. Dabei soll die Logik der analysierten Situation herausgearbeitet und unter Verwendung des dargestellten Rationalitätsprinzips dann das erwartete Verhalten der Akteure bestimmt werden. Da die Analyse der Situation und nicht eine Verhaltensvorhersage einzelner Individuen beabsichtigt ist, sei an dieser Stelle noch einmal darauf verwiesen, dass lediglich die axiomatische Basis individualistisch ist, das Erkenntnisziel sich aber auf die Erklärung sozialer Strukturen und Prozesse bezieht.
Die Annahme der ökonomischen Theorie, dass rationalem Handeln primär eigennützige Absichten zugrunde liegen, kann nun auch auf die Motivationen des Parteihandelns übertragen werden. Es wird angenommen, dass Akteure, also Parteimitglieder „nur handeln, um das Einkommen, das Prestige und die Macht zu erlangen, die mit öffentlichen Ämtern verbunden sind.“[16] Die ökonomische Theorie der Politik geht also davon aus, dass Parteimitglieder ein öffentliches Amt nicht anstreben, weil es ihnen ermöglicht, bestimmte politische Konzepte zu verwirklichen, sondern politische Konzepte oder Ideologien werden einzig und allein als Mittel zur Verfolgung ihrer privaten Ziele, also zur Maximierung ihres Eigennutzes, verfolgt. Die Grundannahme der ökonomischen Theorie der Demokratie von Anthony Downs in Bezug auf die Motivation des Parteihandelns besteht also im folgenden: „Die Parteien treten mit politischen Konzepten hervor, um Wahlen zu gewinnen; sie gewinnen nicht die Wahlen, um mit politischen Konzepten hervortreten zu können.“[17] Downs´ Ansatz unterstellt also, dass die Verhaltensmaxime von Akteuren prinzipiell nicht an einem Gemeinwohl oder übergeordneten staatlichen Interesse orientiert ist. Akteurshandeln, das durch das Eigennutz- Axiom charakterisiert ist, orientiert sich beispielsweise an der Stimmenmaximierung bei Wahlen. Stimmen können wiederum nur maximiert werden, indem die gesellschaftliche Wohlfahrt gesteigert wird, um dem Wähler, der eben auch auf Eigennutz (Nutzen aus der Regierungstätigkeit beispielsweise der SPD) bedacht ist, bei der nächsten Wahl einen Anreiz zu liefern, erneut für die SPD zu stimmen. Gesellschaftliche Wohlfahrtssteigerung, dies erkannte schon Joseph Schumpeter, ist praktisch als ein Nebenprodukt zu betrachten: „In ähnlicher Weise ist der soziale Sinn oder die soziale Funktion der parlamentarischen Tätigkeit ohne Zweifel die, Gesetze und teilweise auch Verwaltungsmaßnahmen hervorzubringen. Aber um zu verstehen, wie die demokratische Politik diesem sozialen Ziele dient, müssen wir vom Konkurrenzkampf um Macht und Amt ausgehen und uns klar werden, dass die soziale Funktion, so wie die Dinge nun einmal liegen, nur nebenher erfüllt wird – im gleichen Sinne wie die Produktion eine Nebenerscheinung beim Erzielen von Profiten ist.“[18]
[...]
[1] Aussage von Sachsens Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU) nach dem ersten Tag der Koalitionsver-
handlungen mit der SPD am 28. 9. 2004, zu finden unter: http://www.mdr.de/wahl/landtagswahl-
sachsen/aktuell/1610818.html
[2] Lehner, Franz, 1981: Einführung in die Neue Politische Ökonomie, Königstein/ Ts.
[3] Downs, Anthony, 1968: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen.
[4] Schumpeter, Joseph A., 1950: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern.
[5] Budge, Ian/ Keman, Hans, 1990: Parties and Democracy. Coalition Government and Government
Functioning in Twenty States, Oxford.
[6] Müller, Wolfgang C./ Strom, Kaare, 1997: Koalitionsregierungen in Westeuropa. Bildung, Arbeitsweise
und Beendigung, Wien.
[7] Kropp, Sabine/ Sturm, Roland, 1998: Koalitionen und Koalitionsvereinbarungen. Theorie, Analyse und
Dokumentation, Opladen. Für deutsche Länderregierungen vgl.: Kropp, Sabine, 2001: Regieren in
Koalitionen. Handlungsmuster und Entscheidungsbildung in deutschen Länderregierungen, Wiesbaden.
[8] Vgl. für die Landtagswahl 1999: Jesse, Eckhard, 2000: Die Landtagswahl in Sachsen vom 19. September
1999: Triumphale Bestätigung der CDU, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 1/2000, S. 69-85.
[9] Quelle: http://www.mdr.de/wahl/landtagswahl-sachsen/
[10] Quelle: http://www.mdr.de/wahl/landtagswahl-sachsen/aktuell/1597647.html
[11] Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, zu finden unter: http://www.statistik.sachsen.de/
pls/wpr_neu/pkg_w04_nav.prc_index?p_anw_kz=LW04
[12] Für die folgenden Ausführungen vgl. Lehner, Franz, 1981: Einführung in die Neue Politische Ökonomie,
Königstein/ Ts., S. 9-21.
[13] Vgl. Kirsch, Guy, 1993: Neue Politische Ökonomie, Düsseldorf, S. 17f.
[14] Siehe weiterführend für die Auseinandersetzung um den methodologischen Individualismus bzw.
Holismus z.B. Bohnen, Alfred, 1975: Individualismus und Gesellschaftstheorie, Tübingen.
[15] Abbildung nach: Lehner, Franz, 1981: Einführung in die Neue Politische Ökonomie, Königstein/ Ts.,
S. 12.
[16] Downs, Anthony, 1968: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen, S. 27.
[17] Downs, Anthony, 1968: a.a.O., S. 28.
[18] Schumpeter, Joseph A., 1950: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern, S. 448.
- Arbeit zitieren
- Stephan Fischer (Autor:in), 2004, Politisch- ökonomische Zugänge zum Prozess des Regierens. Die politikwissenschaftlichen Koalitionstheorien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46573
Kostenlos Autor werden




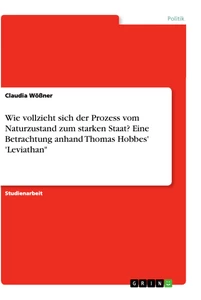

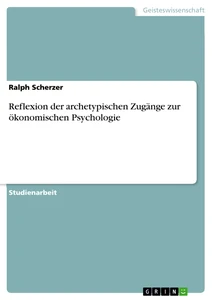











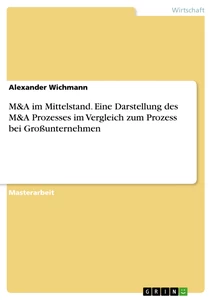

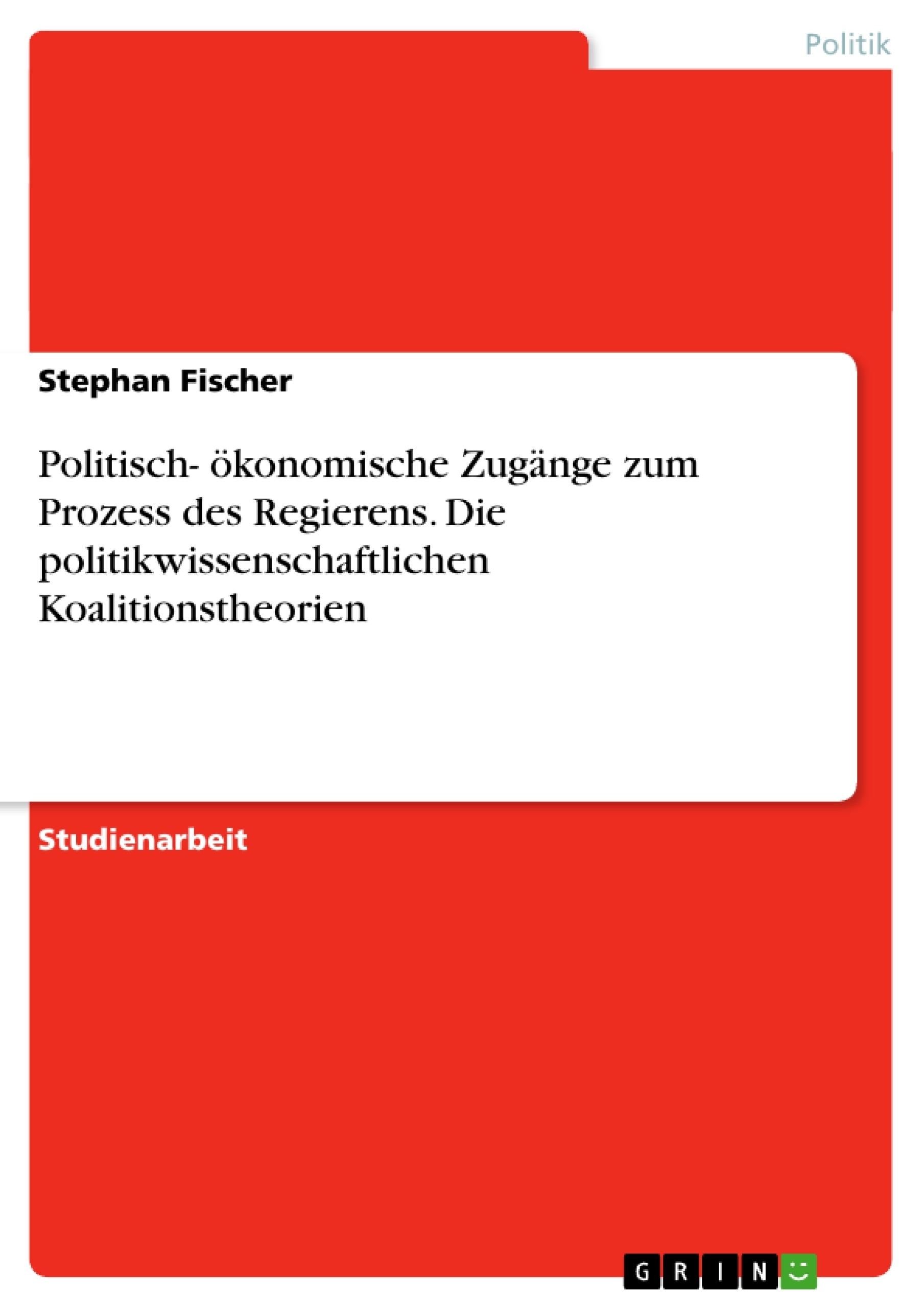

Kommentare