Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Entstehung der Arbeit
1.2 Zielsetzung und Fragestellung
1.3 Bedeutung der Untersuchung
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Definitionen
2.1 Begriffsabgrenzung: China
2.2 Der Expatriate
2.3 Kultur
2.4 Interkulturelle Kompetenz
3 Kulturstandards
3.1 Deutsche Kulturstandards
3.1.1 Sachorientierung
3.1.2 Regelorientierung
3.1.3 Zeitplanung
3.1.4 Trennung von Arbeits- und Privatbereich
3.1.5 Direktheit und Wahrhaftigkeit
3.1.6 Individualismus
3.2 Chinesische Kulturstandards
3.2.1 Soziale Harmonie
3.2.2 Hierarchie
3.2.3 Guanxi und Renqing
3.2.4 Das Danwei-System
3.2.5 Gesicht
3.2.6 Etikette
3.2.7 Regelrelativismus
3.3 Fazit
4 Akkulturation
4.1 Begriffsdefinition Akkulturation
4.2 Die Akkulturationsgruppen
4.3 Der Akkulturationsprozess
4.3.1 Die U-Kurven-Hypothese nach Lysgaard
4.3.2 Die Kulturschocktheorie von Oberg
4.3.3 Der Akkulturationsprozess nach Hofstede und Schugk
4.3.4 Der Akkulturationsprozess und Adaption nach Berry
4.3.5 Vergleich der Modelle
4.4 Akkulturationsstress
4.5 Akkulturationsvariablen
4.5.1 Interne Faktoren
4.5.2 Externe Faktoren
4.6 Die Akkulturation von Expatriates
4.7 Der Akkulturationserfolg
5 Befragung deutscher Expatriates in China
5.1 Methodische Vorüberlegungen
5.2 Die Art der Datenerhebung
5.3 Die Befragten
5.4 Aufbau und Inhalt des Fragebogens
5.4.1 Aufenthalt in China
5.4.2 Interkulturelle Vorerfahrungen
5.4.3 Sprachkenntnisse
5.4.4 Berufliche Situation in China
5.4.5 Umzug nach China
5.4.6 Kontakte und Freizeit
5.4.7 Vorstellungen China – Deutschland
5.4.8 Integration
5.4.9 Allgemeines
5.4.10 Zusammenfassung
5.5 Das Datenmaterial
5.6 Ergebnisse der Fragebogen-Studie
5.6.1 Die Stichprobe
5.6.2 Selbsteinschätzung der Integration
5.6.3 Soziodemografische Merkmale
5.6.4 Leben in China
5.6.5 Sprache
5.6.6 Interkulturelle Vorerfahrungen
5.6.7 Familie
5.6.8 Motive
5.6.1 Soziale Netzwerke
5.6.2 Aufenthaltsdauer
5.6.3 Bezug zu Deutschland
5.6.4 Berufliche Situation und Arbeitsumfeld
5.6.5 Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt
5.6.6 Als Expatriate in China
5.6.7 Bilder von Deutschland und China
5.6.8 Zufriedenheit in China
5.6.9 Überprüfung der Akkulturationswege nach Berry
5.7 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
5.8 Bezug zu den Forschungsfragen
6 Kritik und Ausblick auf weitere Forschungen
7 Fazit
Quellenangaben
Anhang Fehler! Textmarke nicht definiert
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Akkulturationsgruppen (angelehnt an Wolfradt, 1992, S. 34; Berry et al., 1988, S. 71)
Abb. 2: U-Kurve nach Lysgaard (angelehnt an Kühlmann, 1995, S. 11)
Abb. 3: Kurve der kulturellen Anpassung (nach Hofstede, 2006, S. 445)
Abb. 4: Die vier Akkulturationswege nach Berry (vgl. Berry & Kim, 1988, S. 211)
Abb. 5: Veränderung von Verhalten und Kultur durch den Akkulturations-stress (Berry & Kim 1988, S. 213; Wolfradt, 1992, S. 38)
Abb. 6: Vorgehensweise (eigene Darstellung)
Abb. 7: Selbsteinschätzung der Integration von Expatriates (nach Häufig-keit, n=64)
Abb. 8: Alter und Integration der Expatriates (in Prozent)
Abb. 9: Größe der Stadt und Integration der Expatriates (in Prozent)
Abb. 10: Nachbarschaft und Integration der Expatriates (in Prozent)
Abb. 11: Sprachkenntnisse der Expatriates (nach Häufigkeit, n=64)
Abb. 12: Sprachkenntnisse und Integration der Expatriates (nach Häufig-keit, n=64)
Abb. 13: Erlernen der chinesischen Sprache (in Prozent)
Abb. 14: Auslandserfahrung und Integration der Expatriates (in Prozent)
Abb. 15: Familienstand und Integration der Expatriates (in Prozent).
Abb. 16: Motive für den Umzug nach China (in Prozent)
Abb. 17: Einschätzung der Beziehungen zu Chinesen (in Prozent)
Abb. 18: Freundeskreis und Integrationsstand der Expatriates (nach Häufigkeit, n=64)
Abb. 19: Aufenthaltsdauer und Sprachkenntnisse (in Prozent)
Abb. 20: Aufenthaltsdauer und Freundeskreis (in Prozent)
Abb. 21: Aufenthaltsdauer und Integration der Expatriates (in Prozent)
Abb. 22: Verbundenheit zu Deutschland (in Prozent)
Abb. 23: Zufriedenheit mit Beruflicher Situation (nach Häufigkeit, n=64)
Abb. 24: Vorbereitung der Expatriates auf den Auslandsaufenthalt (in Prozent)
Abb. 25: Anpassungsstile nach Berry (nach Häufigkeit, n= 64)
Abb. 26: Vorbereitungsmaßnahmen zur Verbesserung der Integration von Expatriates (eigene Darstellung)
1 Einführung
Es ist keine neue Erscheinung, dass Menschen ihre Heimat verlassen, um in der Fremde zu leben und dort ihrem Beruf nachzugehen. Schon im Altertum gab es einige wenige Berufsreisende wie beispielsweise Botschafter, Soldaten, Händler und Missionare (vgl. Thomas, 2003c, S. 7; Fischlmayr, 2004, S. 7). Doch erst im Laufe des letzten Jahrhunderts, als zunehmende Globalisierung und die damit verbundene Markterschließung die Unternehmen vor neue Herausforderungen stellten, rückten internationale Aktivitäten sowie interkulturelle Zusammenarbeit und Expansion in den Fokus der Firmenstrategien. Unternehmen erhalten durch das Annähern der Länder die Möglichkeit, andere Märkte zu erschließen. Längst haben nicht mehr nur die Global Player Standorte auf der ganzen Welt. Immer mehr Firmen versuchen sich auf den internationalen Märkten zu behaupten. Besonders reizvoll ist in diesem Zusammenhang für viele das Reich der Mitte. Chinas Wirtschaft boomt, der Wohlstand der Gesellschaft steigt, die Bevölkerungszahl ist groß und damit auch die Nachfrage nach Industrie- und Konsumgütern. Und davon will man profitieren. Die Unternehmen eröffnen Niederlassungen im Ausland mit der Zielstellung, sich auf dem neuen Markt bestmöglich zu positionieren. Dabei setzen sie meist auf eigenes, heimisches Know-how und senden Mitarbeiter ins neue Zielgebiet, damit diese die Geschäfte dort gewinnbringend vorantreiben. Doch oft scheitern diese Pläne an der praktischen Umsetzung. Viele Auslandseinsätze werden entweder vorzeitig abgebrochen oder das mit der Entsendung verbundene geschäftliche Ziel der Mitarbeiter wird nicht erreicht (vgl. Stahl, 1995, S. 31). Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Zum einen die beruflichen Herausforderungen, zum anderen die Schwierigkeiten des Alltags in der fremden Kultur eines asiatischen Landes. Beides zehrt an den Kräften und Nerven der entsandten Mitarbeiter. Diese müssen der Veränderung ihrer Lebensbedingungen hinsichtlich Sprache, Religion, politischem System, Gesellschaft, Geschichte, Moral, Sitten und Gebräuchen gewachsen sein, um damit umgehen zu können (vgl. Glaser, 1999, S. 2).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, wie deutsche Expatriates2 mit dieser Ausnahmesituation in China zurechtkommen und untersucht ihre Integration in die chinesische Gesellschaft sowie ihre Anpassung an eine fremde Umgebung und Kultur.
1.1 Entstehung der Arbeit
Die Idee zur Untersuchung dieses Themas kam während meines Auslandsaufenthaltes in China. Von August 2006 bis März 2007 war ich Praktikantin bei einem in Schanghai ansässigen deutsch-chinesischen Joint-Venture. Bei dieser Arbeit habe ich viele Chinesen und Menschen verschiedenster Nationalitäten kennengelernt. Bald fiel mir auf, dass einige Deutsche vor Ort die Chinesen und deren Kultur meiden und sich in China ein Stück Heimat aufbauen. Sie versuchen ihre deutsche Lebensweise und den gewohnten Lebensstandard im Ausland so gut wie möglich weiterzuleben. Dabei ignorieren sie ihr chinesisches Umfeld und leben in ihrer eigenen, kleinen, selbst geschaffenen Welt. Diese möchte ich mit dem Begriff Heimatblase beschreiben. Die Heimatblase umfasst die westliche Lebensweise dieser Expatriates, an der sie trotz veränderter Rahmenbedingungen und kulturellem Umfeld festhalten. Diese Pflege und Aufrechterhaltung alles Westlichen geht einher mit der Ablehnung chinesischer Lebensart. Das zeigt sich daran, dass sie oftmals kein chinesisches Essen probieren, keine einheimischen Bekannten haben und sich weigern, die fremde Sprache zu lernen. Manche Expatriates scheinen eine Integration bewusst zu vermeiden, weil sie sich nicht mit chinesischen Werten und der Kultur identifizieren können und diese teilweise auch überheblich aburteilen. Kurz: Sie versuchen bestmöglich auszublenden, dass sie sich in China befinden.
Die oben beschriebenen Erfahrungen, die auf meinen individuellen Eindrücken beruhen, sind rein subjektiv. Sie haben mich aber dennoch oft beschäftigt, da ich dieses Phänomen der Heimatblase auch bei einigen meiner Bekannten festgestellt habe. Andererseits habe ich auch Menschen kennengelernt, die sich meiner Meinung nach als Fremde gar nicht besser hätten integrieren können. Die Mehrzahl jedoch zog sich in ein kleines Stück selbst geschaffene Heimat zurück. Mit dieser Arbeit will ich nun versuchen, meine subjektiven Eindrücke empirisch zu untersuchen und diese Vermutung wissenschaftlich zu validieren oder zu widerlegen.
1.2 Zielsetzung und Fragestellung
Diese Masterarbeit soll aufzeigen, wie sich deutsche Expatriates in die chine-sische Gesellschaft integrieren. Grundlagen aus den theoretischen For-schungen und eine darauf basierende Datenerhebung unter deutschen Expatriates in China mithilfe eines Onlinefragebogens sollen Erkenntnisse zur Beantwortung folgender Fragen liefern:
1. Wie gut integrieren sich deutsche Expatriates, die in China leben, in ihr chinesisches Umfeld?
Zur Beantwortung dieser Frage ist es wichtig, im Laufe der Arbeit die folgenden Aspekte zu behandeln und abzuklären:
1. a) Welche Faktoren beeinflussen die Anpassung an eine fremde Kultur?
1. b) Was sind die Merkmale und Eigenheiten von Expatriates im Al-gemeinen und von deutschen Expatriates in China im Speziellen?
1. c) Welche inneren und äußeren Bedingungen führen zu einer besseren Integration von Expatriates?
Abschließend stellt sich die Frage:
2. Wie kann man mithilfe dieser Erkenntnisse die Anpassung der übrigen Expatriates vorantreiben oder erleichtern?
1.3 Bedeutung der Untersuchung
Mit fortschreitender Globalisierung müssen Mitarbeiter in Unternehmen immer flexibler werden. Manche Arbeitgeber entsenden ihre Mitarbeiter ins Reich der Mitte, um eine gute Marktstellung zu erreichen. Expatriates können jedoch nur gute Arbeitsergebnisse liefern, wenn sie sich im fremden Land wohlfühlen und gut in ihr Umfeld integriert sind.
Auf diesem Gebiet ist mittlerweile ein breites Spektrum an Fachliteratur verfügbar. Häufig werden die Entsendungsziele der Mitarbeiter und Unternehmen, die Vorbereitung der Mitarbeiter auf den Auslandseinsatz, die Betreuung vor Ort und die Probleme bei der Rückkehr des Mitarbeiters in die Heimat thematisiert (vgl. Kühlmann, 1995, S. VI). Das Themengebiet wird oft unter betriebswirtschaftlichen Aspekten betrachtet. Ein anderer großer Bereich der Forschung befasst sich allgemein mit Kulturunterschieden3 und Anpassungsprozessen4. In der vorliegenden Arbeit steht jedoch der Expatriate als Individuum während seines Auslandsaufenthaltes im Mittelpunkt der Untersuchung. Somit dient diese als Schnittstelle folgender Themenbereiche: Mitarbeiterentsendung ins Ausland, Anpassung des Einzelnen sowie Leben in einer fremden Kultur.
Eine Besonderheit dieser Ausführung ist ferner, dass durch den Länderfokus auf Deutschland und China sowie die spezielle Zielgruppe der Expatriates die Resultate greifbar gemacht werden. Vor allem frühere Studien konzentrieren sich beispielsweise auf Studenten im Ausland5. Diese Untersuchung kann wichtige Informationen sowohl für Firmen liefern, welche Mitarbeiter ins Ausland entsenden, aber auch für Expatriates, die derzeit in China leben oder sich auf einen Auslandseinsatz vorbereiten.
1.4 Aufbau der Arbeit
Im Anschluss an die Einleitung werden in Kapitel 2 (Definitionen) zunächst grundlegende Begriffe wie Expatriate, Kultur und interkulturelle Kompetenz definiert.
Darauf folgt eine Beschreibung der chinesischen sowie der deutschen Kultur anhand von Kulturstandards in Kapitel 3 (Kulturstandards). Dies verdeutlicht die Kulturunterschiede zwischen Deutschland und China und zeigt die Herausforderung auf, mit denen deutsche Expatriates in China konfrontiert werden.
In Kapitel 4 (Akkulturation) werden verschiedene Anpassungsmodelle vorgestellt und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Anpassung genannt. In diesem Zusammenhang findet auch der Begriff Kulturschock Berück-sichtigung. Bei all diesen Ausführungen steht stets die Gruppe der Expatriates im Vordergrund.
Der empirische Teil in Kapitel 5 (Befragung deutscher Expatriates in China) schildert zunächst die Entstehung des Fragebogens und stellt anschließend die Ergebnisse der Befragung deutscher Expatriates in China dar. Dabei wird untersucht, wie die Gruppe der Befragten beschaffen ist, ob sich deutsche Expatriates an ihr chinesisches Umfeld anpassen und in welchem Maße die in der Theorie genannten Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Integration haben. Es folgt eine Analyse der Daten und die Beantwortung der Forschungs-fragen anhand der durch die Befragung gewonnenen Erkenntnisse.
Nach der Analyse und Interpretation der Daten folgen in Kapitel 6 (Kritik und Ausblick auf weitere Forschungen) eine kritische Auseinandersetzung mit der vorliegenden Ausführung und Vorschläge für aufbauende Forschungs-möglichkeiten.
Kapitel 7 (Fazit) liefert eine abschließende Betrachtung der Arbeit bezüglich des Untersuchungsgegenstands.
Für die Bearbeitung der Forschungsfragen spielen verschiedene theoretische Modelle und Konzepte eine große Rolle. Im Folgenden werden daher die als zentral erachteten Grundlagen vorgestellt. Dieser theoretische Rahmen bildet die Grundlage für das spätere empirische Vorgehen mittels elektronischem Fragebogen.
2 Definitionen
Es folgt zuerst eine Abgrenzung des Begriffs China, wie er im Kontext dieser Ausarbeitung verwendet wird. Im Anschluss werden die Begriffe Expatriate, Kultur und interkulturelle Kompetenz definiert, da sie wesentlich für das Verständnis dieser Arbeit sind.
2.1 Begriffsabgrenzung: China
In dieser Arbeit werden deutsche Expatriates in China betrachtet. Da die Rahmenbedingungen in den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao sowie in der Provinz Taiwan andere sind, liegt der Fokus dieser Untersuchung auf dem chinesischen Festland.6
2.2 Der Expatriate
Ein Expatriate7 ist ein Geschäfts- oder Fachmann, der vom Stammhaus an eine Auslandsniederlassung des Unternehmens entsandt wird und dort für längere Zeit als ausländischer Mitarbeiter arbeitet (vgl. Wang, 2004, S. V; Fischlmayr, 2004, S. 7). Im Kontext dieser Arbeit wird der Begriff verwendet für alle in China lebenden Nicht-Chinesen, die von ihrer Firma für eine bestimmte Zeit dorthin entsandt wurden. Dieser Zeitrahmen kann wenige Monate aber auch mehrere Jahre umfassen. Entsprechend dieser Definition zählen nicht zu den Expatriates: Menschen, die zwar nicht in China leben, aber häufig auch längere Zeit dort arbeiten. Diese sind zwar permanent mit dem Land und der Kultur konfrontiert, doch durch den Wohnsitz im Heimatland wird eine gewisse Distanz geschaffen. Ebenso zählen Arbeiter, die durch lokale Verträge in China angestellt sind und Menschen, die in China leben ohne zu arbeiten8, nicht zur Gruppe der Expatriates.
2.3 Kultur
Für die Thematik dieser Arbeit spielt die Kultur eine wichtige Rolle. Es gibt unzählige Auffassungen und Erklärungsversuche, jedoch keine allgemeingültige Definition von Kultur. So ist es in diesem Rahmen nicht möglich, ein re-präsentatives Bild aller Ansätze zu geben. Im Folgenden sollen daher nur einige aufgeführt werden, um das Kulturverständnis im Kontext der vorliegenden Ausarbeitung zu verdeutlichen. Als Basis eignet sich folgende Definition:
„Kultur offenbart sich als ein spezifisches System von Werten, Normen, Regeln und Einstellungen, das nachhaltig das Verhalten der Mitglieder einer Gruppe, Organisation, Gesellschaft oder Nation beeinflusst“ (Thomas, 2005, S. 13).
Die Mitglieder einer Gesellschaft wenden täglich dieses Orientierungssystem unbewusst an, um ihr eigenes Verhalten zu lenken und das Verhalten anderer zu interpretieren (vgl. Gudykunst & Hammer 1987, S. 106; Hoebel, 1971, S. 208). Es setzt sich aus Symbolen wie Sprache, Mimik oder Gestik zusammen (vgl. Thomas, 2003a, S. 22). Die Symbole haben spezielle Bedeutungen und vermitteln in einer Gemeinschaft geteilte Ideen und formen somit eine Kultur (vgl. Baldwin, Longhurst, McCracken, Ogborn & Smith, 1999, S. 4). Doch dieses Orientierungssystem gibt nicht nur Anreize und Möglichkeiten zum Handeln und Problemlösen vor, sondern beschränkt die Mitglieder der jeweiligen Kultur auch durch Vorschriften und Grenzsetzung (vgl. Thomas, 2003a, S. 22; Malinowski, 1975, S. 75).
Kultur ist nicht genetisch im Menschen verankert. Sie wurde durch Sozialisation im Laufe des Lebens erlernt (vgl. Heringer, 2004, S. 106). Somit ist Kultur kein starres System, sondern ist vielen internen sowie externen Einflüssen ausgesetzt und folglich dynamisch und wandelbar (vgl. Schroll-Machl, 2007, S. 27). Diese Veränderungsprozesse sind ein wesentliches Charakteristikum von Kultur (vgl. Murdock, 1971, S. 319).
„Kultur ist nicht als historische, einmal erbrachte Leistung oder als museales Endprodukt einer Epoche zu begreifen, sondern muss als ein dynamisches, funktions- und vor allem adaptionsfähiges System verstanden werden“ (Loenhoff, 1992, S. 139).
Maletzke (1996, S. 16) weist auch darauf hin, dass die Konzepte, Einstellungen und Werte, die eine Kultur ausmachen, nicht nur im Verhalten der Menschen sichtbar werden, sondern auch in deren geistigen und materiellen Werken. Dies erklärt den alltäglichen Gebrauch des Wortes Kultur, der diese oft im Zusammenhang mit wertvollen Kulturprodukten wie beispielsweise Literatur, Musik, Malerei und Schauspiel beschreibt (vgl. Baldwin et al., 1999, S. 4).
2.4 Interkulturelle Kompetenz
Deutsche Arbeitnehmer, die beschließen nach China zu gehen, hatten im Vorfeld nicht zwangsläufig viel Kontakt mit Chinesen und deren Kultur. Sie sind daher oft unvorbereitet und wissen nur spärlich über die im Gastland üblichen Kommunikations- und Interaktionskonventionen Bescheid. Daraus resultieren kulturelle Problemsituationen. Eine Lösung dieser Probleme bedingt die Einsicht, dass es nötig ist, die fremde Kultur und die in ihr herrschenden Regeln, Normen und Verhaltensweisen zu erlernen (vgl. Yamanaka, 2001, S. 34). Das Ziel der interkulturellen Lernprozesse ist die Aneignung von interkultureller Kompetenz (vgl. Grosch & Leenen, 1998, S. 39).
„Unter interkultureller Kompetenz wird ein ‚set‘ von Fähigkeiten verstanden, die es einer Person ermöglichen, in einer kulturellen Überschneidungssituation unabhängig, kultursensibel und wirkungsvoll zu handeln“ (Grosch & Leenen, 1998, S. 39).
In zahlreichen Studien befassen sich Forscher seit Jahrzehnten mit der Frage, welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Voraussetzungen eine Person haben muss, damit sie als interkulturell kompetent bezeichnet werden kann (vgl. Glaser, 1999, S. 33). Oft wurden in der Wissenschaft Listen erstellt, die alle angeblich nötigen Eigenschaften aufführen. Alle zusammen sollen das Konstrukt interkulturelle Kompetenz ergeben. Die Darstellung solcher Aufzählungen entspricht nicht dem Rahmen dieser Arbeit und macht unter Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes wenig Sinn. Denn diese Listen9 sind oft unübersichtlich, widersprechen sich gegenseitig und sind zu speziell formuliert, um Allgemeingültigkeit zu besitzen. Im Folgenden werden daher einige Herangehensweisen exemplarisch dargestellt, um den Begriff der interkulturellen Kompetenz für den Kontext dieser Ausführung zu definieren.
Barmeyer (1999, S. 382) unterteilt interkulturelle Kompetenz in zwei große Bereiche: kognitives Wissen sowie affektive Einstellung bzw. kulturelle Sensibilität. Kulturelles, kognitives Wissen kann man sich durch das Studium von Kulturen aneignen, wie beispielsweise Kulturstandards10. Das Erlernen von kulturellen Eigenheiten ermöglicht es, die eigene sowie die fremde Kultur besser einordnen und verstehen zu können. Die oben erwähnte affektive Einstellung hingegen setzt sich zusammen aus sozialer Kompetenz (z.B. Aufgeschlossenheit, Flexibilität, Toleranz, etc.) und kommunikativer Kompetenz (z.B. Kommu-nikationsbereitschaft, Fremdsprachenkenntnis, etc.). Nur wer alle drei Bereiche abdeckt, erfüllt sämtliche Voraussetzungen und weist somit interkulturelle Kompetenz auf. Dieser Ansatz zur Definition von interkultureller Kompetenz zeigt, dass Wissen über eine Kultur alleine ebenso wenig ausreicht wie die Fähigkeit zum sozialen oder kommunikativen Umgang mit Menschen. (vgl. Barmeyer, 1999, S. 383)
Bolten (2001, S. 87) hingegen entwickelt eine Kompetenzliste speziell für Expatriates. Er geht davon aus, dass es keine spezielle interkulturelle Kompetenz gibt, sondern definiert diese als die „Fähigkeit, individuelle, soziale, fachliche und strategische Teilkompetenzen in ihrer bestmöglichen Verknüpfung auf interkulturelle Handlungskontexte beziehen zu können“. Es folgt eine Auflistung der verschiedenen Kompetenzbereiche, die in richtiger Anwendung und Ausrichtung interkulturelle Handlungsfähigkeit ermöglichen (vgl. Bolten, 2001, S. 84ff.):
- Fachkompetenz (z.B. Berufserfahrung, Fachkenntnisse im Aufgabenbe-reich),
- Soziale Kompetenz (z.B. Teamfähigkeit, Empathie, Toleranz, Assimi-lationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit)
- Strategische Kompetenz (z.B. Wissensmanagement, Organisationsfähigkeit),
- Individuelle Kompetenz (z.B. Lernbereitschaft, Selbstkritik, Eigenmotivation, Rollendistanz, Selbstorganisation, optimistische Grundhaltung, Polyzentrismus).
Interkulturelle Kompetenz ist daher in jedem Fall eine Mischung aus verschiedenen Kompetenzbereichen mit interkultureller Ausrichtung sowie Wissen über Kulturen im Allgemeinen und die betreffende Kultur im Speziellen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass interkulturelle Kompetenz keine isolierte Fähigkeit darstellt, die jeder neu erlernen muss. Denn in ihren Grundzügen stimmt sie mit denen der sozialen Kompetenzen überein (vgl. Hatzer & Layes, 2003, S. 147).
Schwierigkeiten ergeben sich für den Expatriate bei der Anwendung der eigenen interkulturellen Kompetenz im Alltag. Diese darf nämlich laut Thomas und Schenk (2005, S. 16) nicht missverstanden werden als die unreflektierte, starre Nachahmung kulturtypischer Verhaltensweisen. Die deutschen Expatriates sollen folglich nicht zu Chinesen werden, sondern sich vielmehr so eingliedern, dass ein Zusammenleben und ein Dialog mit den Einheimischen möglich sind. Diese interkulturelle Handlungskompetenz definiert Thomas (2003b, S. 143) als die „Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei sich selbst und bei fremden Personen zu erfassen, zu würdigen und produktiv zu nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung, von Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten und einer Entwicklung hin zu synergieträchtigen Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und handlungswirksamer Orientierungsmuster in Bezug auf Weltinterpretation und Weltgestaltung“. Diese Definition vereint personelle Faktoren, interkulturelle Erfahrungen sowie interkulturelles Lernen (vgl. Breuninger & Brönneke, 2006, S. 16).
Doch wie eignet man sich interkulturelle Kompetenz an? Es wurde bereits angesprochen, dass diese sich in verschiedenen Bereichen mit der sozialen Kompetenz überschneidet. Niemand muss deshalb interkulturelle Kompetenz von Grund auf neu erwerben. Sie soll jedoch entwickelt und gefördert werden.
„Interkulturelle Handlungskompetenz ‚entwickelt sich in und aus dem Verlauf eines hochgradig lernsensitiven interkulturellen Begegnungs- und Erfahrungsprozesses. Lernen, das Erkennen und Ergreifen von Lernchancen und Lernerfahrungen und der gezielte Einsatz von Reflexion und Kommunikation über das, was an situations- und zielangemessenem Verhalten zu planen, durchzuführen und als Ergebnis zu registrieren und zu bewerten ist, sind dabei zentrale Anforderungen‘“ (Thomas, 2003b; zitiert nach Hatzer & Layes, 2003, S. 145).
3 Kulturstandards
Andere Länder, andere Sitten. Diese gängige Floskel drückt aus, dass sich einzelne Kulturen bezüglich der vorherrschenden Handlungsnormen unterscheiden. Als Expatriate sollte man über die kulturellen Besonderheiten im Gastland informiert sein. Dies geht natürlich nicht ohne ein Bewusstsein für die eigene kulturelle Herkunft. Im folgenden Kapitel werden daher die chinesische und die deutsche Kultur mit ihren jeweiligen Charakteristika gegenübergestellt. Dies zeigt, vor welch großen kulturellen Herausforderungen deutsche Expatriates stehen, die sich für einen Aufenthalt in China entschieden haben.
Wie bereits in Kapitel 2.3 (Kultur) erwähnt, wird Kultur in dieser Arbeit als ein spezifisches Orientierungssystem aufgefasst. In diesem System gibt es handlungsleitende Elemente, die das Zusammenleben in einer Kultur vereinfachen (vgl. Schroll-Machl, 2007, S. 28). Diese kulturellen Elemente nennt Thomas (1999, S. 110) Kulturstandards und definiert sie folgendermaßen:
„Unter Kulturstandards werden alle Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns verstanden, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als normal, selbstverständlich, typisch und verbindlich angesehen werden. Eigenes und fremdes Verhalten wird auf der Grundlage dieser Kulturstandards wahrgenommen, erwartet, beurteilt und reguliert“.
Bei Kulturstandards handelt es sich nicht um starre Regeln, sondern vielmehr um Leitlinien zum gesellschaftlichen und sozialen Handeln, die vom Individuum im Laufe seines Lebens in einer Kultur erlernt werden. Ebenso wie sich die betreffende Kultur verändert, so wandelt sich das in ihr geltende Orientierungssystem und somit die jeweils geltenden Kulturstandards. Erst wenn zwei unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, wird ersichtlich, wie stark die einzelnen Individuen und ihr Verhalten von den erlernten Kulturstandards geprägt sind. (vgl. Thomas & Schenk, 2005, S. 14f.)
Ein deutscher Expatriate in China versucht, die neuen, fremden Geschehnisse, das Verhalten der Menschen und seine neue Umgebung mithilfe des Orientierungssystems zu bewerten und zu erklären, das er in Deutschland erlernt hat. Die Kulturstandards dienen dabei als „Orientierung in der Entscheidung, welches Verhalten als normal, typisch, noch akzeptabel anzusehen […] und welches Verhalten abzulehnen ist“ (Schroll-Machl, 2007, S. 29). Kulturstandards beschreiben also zentrale Charakteristika eines Orientierungssystems, mit dessen Hilfe sich die jeweiligen Kulturen vergleichen lassen (vgl. Thomas, 1999, S. 109). Jedoch treten bei Interaktionssituationen die Kulturstandards selten isoliert auf, sondern bedingen und stützen sich gegenseitig in einem fließenden System (vgl. Thomas & Schenk, 1996, S. 68).
Eine wichtige Eigenschaft von Kulturstandards ist ferner ihre Perspektivenabhängigkeit (vgl. Thomas & Schenk, 1996, S. 60). Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man eine Kultur betrachtet, findet man unterschiedliche kulturtypische Merkmale. Japaner beispielsweise definieren Kulturstandards für China anders als Amerikaner. (vgl. Woesler, 2004, S. 20) Im Folgenden werden die für Deutschland wichtigen Kulturstandards aus chinesischer Sicht und die aus deutscher Sicht geltenden chinesischen Kulturstandards näher erläutert.
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass durch die Reduzierung der beiden Kulturen auf Kulturstandards keineswegs eine Verallgemeinerung und Stereotypisierung entstehen soll. Man sollte sich deshalb immer vor Augen führen, dass einzelne Länder nicht aus personifizierten Standardträgern bestehen, sondern aus Individuen mit einer großen Bandbreite an Charakteren (Schugk, 2004, S. 307). Die nachfolgenden Kulturstandards beschreiben lediglich die in einer Gesellschaft vorwiegenden Tendenzen.
3.1 Deutsche Kulturstandards
Ziel dieses Abschnittes ist es, einige zentrale, deutsche Kulturstandards darzustellen, die nach Schroll-Machl (2007, S. 35) besonders im Vergleich von Deutschland und China ins Gewicht fallen.
3.1.1 Sachorientierung
Bei der Begegnung von Menschen spielen die Sachebene und die interpersonelle Beziehungsebene eine Rolle. Haben diese Ebenen in zwei Kulturen einen unterschiedlichen Stellenwert, so kommt es bei der Interaktion von Mitgliedern dieser Kulturen zu erheblichen Schwierigkeiten. Deutsche sind, vor allem in beruflicher Hinsicht, hauptsächlich sachorientiert. Sie schätzen sachliches Verhalten, wodurch die soziale Ebene in den Hintergrund gedrängt wird. Die Vernachlässigung der Beziehungsebene zeigt sich beispielsweise an der spärlichen Verwendung von als lästig empfundenem Smalltalk. (vgl. Schroll-Machl, 2007, S. 48ff.)
3.1.2 Regelorientierung
In Deutschland findet sich ein fast lückenloses Gesetzeswerk und Ent-scheidungs- bzw. Handlungsabläufe sind formalisiert. Dies zeugt von einem Bedürfnis nach Ordnung, Kontrolle und Planbarkeit. Denn Regeln und Strukturen gelten als hilfreich zur Befriedigung der eben genannten Bedürfnisse (vgl. Thomas & Schenk, 1996, S. 95). Die Deutschen sind an Regeln und Strukturen gewöhnt, denn sie finden sich in allen Bereichen des täglichen Lebens wieder. Die Einhaltung der Regeln wird als selbstverständlich erachtet und bei Zuwiderhandeln sanktioniert (vgl. Schroll-Machl, 2007, S. 71).
3.1.3 Zeitplanung
Ebenso, wie durch Regeln das alltägliche Leben geordnet ist, wird der zeitliche Alltag in Deutschland durch Zeitpläne strukturiert. Es gibt viele Termine und Fristen, die eingehalten werden müssen und für fast jedes Vorhaben, sei es beruflich oder privat, wird ein Zeitplan erstellt und befolgt (vgl. Schroll-Machl, 2007, S. 122ff.).
3.1.4 Trennung von Arbeits- und Privatbereich
Deutsche trennen ihre unterschiedlichen Lebensbereiche strikt voneinander ab. So verhält man sich während der Arbeit stets sachlich, der Beruf steht im Vordergrund. Nach Feierabend und in der Freizeit ist der Deutsche eher be-ziehungsorientiert. Familie, Freunde und private Interessen stehen hier an erster Stelle. Beide Bereiche existieren meist ohne Schnittpunkte neben-einander. Private Themen werden am Arbeitsplatz selten angesprochen. (vgl. Schroll-Machl, 2007, S. 143ff.)
3.1.5 Direktheit und Wahrhaftigkeit
Die Sachorientierung der Deutschen spiegelt sich auch in der Kommunikations-weise wider. Es wird direkt und mit inhaltlichem Fokus kommuniziert (vgl. Schroll-Machl, 2007, S. 174f.). „Das halten wir menschlich für ehrlich, aufrichtig, authentisch und glaubwürdig, beruflich für professionell, da zielführend und zeitsparend, und es erspart Missverständnisse“ (Schroll-Machl, 2007, S. 174).
3.1.6 Individualismus
Deutsche schätzen ihre Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in allen Lebensbereichen. Daher steht nur die unmittelbare Familie im Vordergrund, ein Zusammenleben als Großfamilie existiert kaum noch. Durch den hohen Wert des Individuums ergibt sich auch die Achtung von Privatsphäre (vgl. Thomas & Schenk, 1996, S. 95). So bleiben Türen beispielsweise meist geschlossen. Wer dennoch eintreten will, der klopft an (vgl. Hall & Hall, 1990, S. 40f.).
3.2 Chinesische Kulturstandards
Nachdem die Spezifika für die deutsche Kultur dargelegt wurden, werden im Anschluss die wesentlichen chinesischen Standards aus deutscher Sicht in Anlehnung an Liang und Kammhuber (2003), Thomas und Schenk (1996) und Thomas (2005) genannt.
3.2.1 Soziale Harmonie
Die soziale Harmonie ist eine traditionelle Wertvorstellung, die überaus wichtig für das zwischenmenschliche Zusammenleben ist (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 173). „Der Begriff […] rührt aus dem Verständnis, dass die soziale Ordnung in gleicher Weise harmonisch wirken müsse wie die Natur“ (Thomas, 2005, S. 102). Diese soziale Harmonie entsteht durch willkürliche Verhaltensregeln (vgl. Thomas, 2005, S. 102). Soziale Harmonie bedeutet jedoch nicht die Gleichheit der Menschen. Vielmehr kann Harmonie nur dann entstehen, wenn die Menschen ihren Platz im Beziehungsgefüge einnehmen und sich gemäß dieser Stellung verhalten (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 173). „Wichtig zur Wahrung ist daher […] ein hierarchisch und interpersonal differenziertes Verhalten, das je nach Alter, sozialem Status, Wissensstand und Gruppenzugehörigkeit festgelegt wird“ (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 173). Wesentlich zur Herstellung einer Harmonie ist die Vermeidung von Konflikten. Diese gefährden eine harmonische Beziehung, weshalb ihnen meist aus dem Weg gegangen wird. Dies bedeutet, dass Meinungsdifferenzen sowie direkte Konfron-tationen vermieden oder ignoriert werden (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 173).
3.2.2 Hierarchie
Wie eben im Bezug auf soziale Harmonie erwähnt, hat jeder seinen bestimmten Platz in der chinesischen Gesellschaft. „Die streng festgelegte Hierarchie […] bedeutet keine Unterscheidung der Menschen nach ihrem Wert, sondern ist eine rein formale Zuweisung des angemessenen Platzes im Ganzen“ (Thomas, 2005, S. 52). Beispiel für die Verankerung der Hierarchie in der chinesischen Gesellschaft ist die Tatsache, dass zu Beginn eines Gespräches immer indirekt nach dem gesellschaftlichen Stand des Gegenübers gefragt wird. Danach richten sich dann Kommunikation und Umgang zwischen den interagierenden Personen. Vor diesem Hintergrund hat beispielsweise auch die Visitenkarte in China einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Visitenkarten spiegeln einen Teil der Identität wider und geben dem Gesprächspartner Aufschluss über den eigenen Status, ohne dass man sich selbst rühmen muss. Das Besitzen von Statussymbolen wird nicht missachtet oder hinterfragt, sondern steht nach der allgemeinen Auffassung jeder hierarchisch hoch stehenden Person zu. (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 175)
3.2.3 Guanxi und Renqing
In China ist die Gruppenorientierung von zentraler Bedeutung. Das zeigt sich in der intensiven Pflege von interpersonalen Beziehungen (guanxi). Ein gut funktionierendes Beziehungsnetz macht produktives Handeln in China erst möglich (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 175). So bilden Chinesen unterschiedliche Beziehungsgefüge, die verschiedene Wichtigkeiten haben. Ein primäres Beziehungsnetz ist beispielsweise die Familie. Doch auch gemeinsame Erlebnisse, wie der Besuch derselben Schule oder die Herkunft aus derselben Stadt sind Kriterien zur Entstehung eines Netzes und verpflichten somit zur Loyalität (vgl. Thomas & Schenk, 2005, S. 116). Für den Umgang mit Menschen ist es wichtig, ob diese sich innerhalb oder außerhalb eines Beziehungsnetzwerkes befinden. Gegenüber Mitgliedern herrschen Loyalität und Unterstützung, eigene Interessen werden untergeordnet (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 175). Für den Umgang mit Außenstehenden jedoch fehlen Regulationsmechanismen (vgl. Thomas & Schenk, 1996, S. 74). Um Außenseiter zu Innenseitern zu machen und sie somit für ein Beziehungsnetz zu gewinnen wird renqing (Mitmenschlichkeit) eingesetzt. Darunter versteht man beispielsweise Geschenke oder Hilfeleistungen. (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 175f.)
3.2.4 Das Danwei-System
Ähnlich wie die guanxi verdeutlicht das Danwei-System die Tendenz der Gruppenorientierung in der chinesischen Kultur. Das Danwei-System prägte lange die Gesellschaftsordnung. Aus den ursprünglichen Familienclans bildeten sich im Laufe der Zeit die Danweis, die als Arbeits- und Lebensgemeinschaften fungierten. (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 176). „In ihr liefen alle Fäden zusammen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch“ (Liang & Kammhuber, 2003, S. 176). Sie regelte „Wohnungsvergabe, Beförderung, Altersversorgung, Krankenversicherung, Kindergartenplätze oder die Erlaubnis, Kinder zu bekommen sowie sonstige persönliche Belange“ (Liang & Kammhuber, 2003, S. 176f.). Somit stellte die Danwei zwar ein Sicherungssystem dar, diente jedoch durch die Verbindung zur Partei auch zur politischen und sozialen Kontrolle (vgl. Thomas & Schenk, 2005, S. 33ff.).
3.2.5 Gesicht
Gesicht haben, Gesicht verlieren, Gesicht wahren, Gesicht nehmen oder auch Gesicht geben. Es gibt viele Ausprägungen des Prinzips Gesicht. Dabei handelt es sich um ein sehr ausdifferenziertes moralisches Verhalten in der chinesischen Gesellschaft. Es ist Voraussetzung, dass jeder ein soziales Gesicht hat, das je nach Ansehen, Leistung, Erfolg, Status und Reichtum der Person verschieden stark ausgeprägt ist. (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 178) „Allerdings ist eine Vermehrung des sozialen Gesichts weniger von Eigenaktivitäten abhängig […] sondern vielmehr von den gesichtsgebenden Aktivitäten anderer“ (Liang & Kammhuber, 2003, S. 178). Eine solche Aktivität wäre beispielsweise die Aussprache von Komplimenten. Wer anderen kein Gesicht geben kann, riskiert damit einen Verlust des eigenen Gesichts. Deshalb wird meist versucht, das Gesicht des anderen zumindest zu wahren. Denn in China ist das Gesicht ein soziales Mittel zum Aufbau interpersonaler Beziehungen. Gesichtsgebende Aktivitäten ziehen meist eine Gegenleistung des anderen nach sich. (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 178f.) Sämtliche Aktionen, die auf das Gesicht bezogen vorgenommen werden, haben Einfluss auf der interpersonalen Ebene. „‚Gesicht wahrende‘ und ‚Gesicht gebende‘ Handlungen sind unabdingbare Voraussetzungen dafür, dass ein interpersonales Beziehungsverhältnis und Klima geschaffen wird, aus dem heraus sich so etwas wie Macht, Autorität und Respekt entwickeln kann“ (Thomas, 1999, S. 119).
3.2.6 Etikette
In der chinesischen Gesellschaft kommt der Gruppe ein hoher Stellenwert zu. Es ist gesellschaftlich nicht angesehen, sich selbst in den Mittelpunkt und in gutes Licht zu stellen. Durch diese Zurückhaltung sollen Konflikte vermieden und die soziale Harmonie gewahrt werden. (vgl. Liang & Kammhuber, 2003, S. 180). Der von Bescheidenheit und Respekt geprägte Umgang miteinander dient dem Aufbau von Beziehungen. „Während in der deutschen Tradition Höflichkeit oftmals verbunden ist mit Distanzwahrung, bedeutet in China Höflichkeit die Herstellung von Vertrautheit und eines herzlichen Verhältnisses“ (Liang & Kammhuber, 2003, S. 180).
3.2.7 Regelrelativismus
Im Gegensatz zu Deutschland besitzen Regeln in China keinen absoluten Charakter. Sie werden situationsabhängig interpretiert. Ein stark ausgear-beitetes Regelwerk wird als erschwerend und konfliktfördernd angesehen. Deutsche gelten bei Chinesen deshalb oft als starrsinnig und unflexibel, während letztere aus deutscher Perspektive als unzuverlässig und chaotisch angesehen werden. (vgl. Liang und Kammhuber, 2003, S. 181)
3.3 Fazit
Diese Auflistung der charakteristischen Kulturstandards macht die Unterschiede zwischen der chinesischen und der deutschen Kultur deutlich. Während in China sehr viel Wert auf soziale Beziehungen sowie deren Pflege gelegt wird, herrscht in Deutschland eher Individualismus. Vor allem im beruflichen Bereich sind Deutsche eher sachorientiert und private Angelegenheiten werden dabei ausgeklammert. In China hingegen spielen die soziale Stellung, die soziale Beziehung sowie das Gesicht in das Berufsleben hinein. Eine starke Trennung zwischen Arbeits- und Privatbereich, wie in Deutschland, ist in China unüblich. Ferner unterscheiden sich die Kulturen hinsichtlich der Handhabung von Regeln und der strukturellen Ordnung. Während in Deutschland alle Lebensbereiche von Regeln und Strukturen beherrscht werden, stehen in China die interpersonalen Beziehungen im Vordergrund und Regeln werden gegebenenfalls gebeugt.
Die Distanz zwischen den beiden Kulturen ist folglich sehr groß. Dies verdeutlicht, wie schwierig es für einen deutschen Expatriate sein muss, sich in China zurechtzufinden und mit Chinesen zu interagieren, sei es beruflich oder privat. Ein Beispiel dafür findet sich bereits in früher Zeit, als eine Auslandsentsendung noch nicht so üblich war wie heute. In einem Buch von Arthur H. Smith aus dem Jahr 1900 verweist der Autor auf die enormen Schwierigkeiten und Besonderheiten, die den westlichen Entsandten in China erwarten. Zitiert wird Sir Robert Hart, Generaldirektor des chinesischen Seezolldienstes, der länger als vierzig Jahre in China gelebt hat.
„China ist wirklich ein schwer zu verstehendes Land. Vor ein paar Jahren glaubte ich endlich so weit gekommen zu sein, etwas von seinen Angelegenheiten zu wissen, und ich suchte, meine Ansichten darüber zu Papier zu bringen. Heute komme ich mir wieder wie ein vollkommener Neuling vor. Wenn ich jetzt aufgefordert würde, drei oder vier Seiten über China zu schreiben, würde ich nicht recht wissen, wie ich dies anfangen sollte. Nur eins habe ich gelernt. In meinem Vaterlande heisst es gewöhnlich: Lass dich nicht biegen, und wenn es dabei auch zum Bruche kommt. In China dagegen gerade umgekehrt: Lass dich biegen, aber lass es nicht zum Bruche kommen“ (Smith, 1900, S. III).
Diese Beschreibung illustriert sehr treffend die Einstellung der Chinesen zu sozialen Beziehungen. Eigene Einstellungen und Werte sind nur so lange aufrecht zu erhalten, wie die Beziehungen zu anderen Menschen nicht gefährdet sind (vgl. Thomas, 2003c, S. 10).
Der starke Unterschied der beiden Kulturen wird im weiteren Verlauf der Arbeit im Zusammenhang mit Kulturschock11 und dem Akkulturationsprozess12 noch eine Rolle spielen. Denn nur soviel sei vorweggenommen: Je entfernter die Gastkultur des Expatriate zu seiner Heimatkultur ist, desto schwieriger wird es für ihn, sich in seiner neuen Situation und Umgebung zurechtzufinden. Wie schwer die Umgewöhnung für den Expatriate wird, hängt auch von seinem Wissen über die beiden involvierten Kulturen und deren Kulturstandards ab.
„Wenn die einander begegnenden Partner über die Art der Handlungswirksamkeit zentraler Kulturstandards in der anderen Kultur informiert und sich ihrer eigenen Kulturstandards bewusst sind, dann steigen die Chancen zur Reduktion kulturbedingter Missverständnisse, (…), dann steigt die Fähigkeit zum interkulturellen Verstehen, und es wächst die interkulturelle Handlungskompetenz“ (Thomas, 1999, S. 120).
4 Akkulturation
Das folgende Kapitel widmet sich dem Themenbereich Akkulturation. In diesem Zusammenhang werden zuerst der Begriff sowie allgemeine Rahmenbe-dingungen und Eigenschaften des Akkulturationsprozesses erläutert. An-schließend werden einige Anpassungsmodelle vorgestellt und letztlich der Akkulturationsstress sowie verschiedene Variablen des Anpassungsprozesses thematisiert.
4.1 Begriffsdefinition Akkulturation
Berufsbedingte Aufenthalte im Ausland sind immer mit Anpassungsschwierigkeiten verbunden, egal, aus welcher Kultur der Expatriate stammt, in welches Land er entsandt wird oder wie seine Persönlichkeit beschaffen ist. Diese kulturelle Anpassung wird auch als Akkulturation, Enkulturation oder Assimilation bezeichnet (vgl. Maletzke, 1996, S. 160). Thomas (1989, S. 174) versteht unter Akkulturation „das allmähliche Hineinwachsen und Anpassen in eine fremde Kultur“. Wolfradt (1992, S. 29) hebt hervor, dass das ak-kulturierende Individuum bereits eine „Sozialisation in seiner Heimatkultur durchlaufen hat (Enkulturation)“. Die in der Kindheit erlernten Denk- und Verhaltensweisen sowie Regeln und Symbole, die den Alltag und das Zusammenleben im Herkunftsland regeln, greifen in der neuen Heimat nicht mehr. Somit ist der Fremde gezwungen, sich der Gastkultur anzupassen, indem er neue Verhaltensweisen erlernt. Akkulturation geht folglich immer mit interkulturellen Lernprozessen einher (vgl. Layes, 2003, S. 127).
Berry, Kim und Boski (1988, S. 64) nennen fünf Bereiche, in denen durch Akkulturation einer Person Veränderungen auftreten: physische Veränderungen (z.B. neue Wohnung, neues Umfeld, mehr Population, höhere Luftverschmutzung), biologische Veränderungen (z.B. andere Nahrungsmittel, neue Krankheiten), kulturelle Veränderungen (z.B. politische, ökonomische, tech-nische, sprachliche, religiöse sowie soziale Institutionen ändern sich), soziale Veränderungen (z.B. neue soziale Kontakte) und nicht zuletzt psychische Veränderungen (z.B. Veränderung der psychischen Stabilität).
4.2 Die Akkulturationsgruppen
Akkulturation teilt sich in zwei Ebenen, in denen der Prozess durchlaufen wird: die Gruppenebene und die individuelle Ebene. In der Gruppenebene verändert sich die Kultur einer gesamten Gruppe. Auf der individuellen Ebene hingegen geht es um eine Veränderung der Personenmerkmale (z.B. Verhalten, Identität, Werte und Einstellungen) eines Individuums, das in Kontakt mit einer fremden Kultur tritt (vgl. Schönpflug, 2003, S. 329). Diese Art der Anpassung, die auch in dieser Arbeit im Vordergrund steht, bezeichnet man als psychologische Ak-kulturation (vgl. Berry, 1990, S. 133f.). Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, da eine Person aufgrund seiner Autonomie im Vergleich zu seiner ethnischen Bezugsgruppe einzelne Veränderungen in einem anderen Ausmaß oder eventuell gar nicht vollzieht (vgl. Wolfradt, 1992, S. 32).
Auf der individuellen Ebene definieren Berry et al. (1988, S. 71) fünf Personengruppen, die eine Akkulturation durchlaufen: Einwanderer, Flüchtlinge, ethnische Gruppen, Besucher und autochtone Einwohner des Landes. Diese Unterscheidung folgt den Kriterien Freiwilligkeit, Mobilität und Dauer des Kontaktes zum Gastland (vgl. Berry et al., 1988, S. 33f.). Folgende Grafik verdeutlicht diese Einteilung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Akkulturationsgruppen (angelehnt an Wolfradt, 1992, S. 34; Berry et al., 1988, S. 71).
Diese Kategorienbildung ist sinnvoll, da die verschiedenen Gruppen unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt sind und somit auch verschiedene Akkulturationsprozesse durchlaufen (vgl. Berry, 1990, S. 242). Anhand der Grafik ist leicht festzustellen, dass Expatriates der Besuchergruppe zuzuordnen sind, da sie sich freiwillig in der Gastkultur aufhalten (vgl. Layes, 2003, S. 127). Besucher leben zeitlich begrenzt in der Gastkultur. Daher wirkt der Akkulturationsdruck auf sie weniger stark (vgl. Wolfradt, 1992, S. 34). Durch den freiwilligen Umzug ins Gastland war ihre Einstellung grundsätzlich positiver als beispielsweise bei Flüchtlingen (vgl. Berry, 1990, S. 243).
4.3 Der Akkulturationsprozess
Zur Akkulturation gibt es zahlreiche Studien und Phasenmodelle, welche die kulturelle Anpassung einer Person darzustellen versuchen (vgl. Schugk, 2004, S. 237). Bei allen Modellen ist es jedoch wichtig zu beachten, dass diese nur eine grobe Tendenz beschreiben. Die Akkulturation ist ein Prozess, der weder linear noch passiv verläuft und daher keine Allgemeingültigkeit besitzt. Aufgrund der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes gibt es keine Gesetzmäßigkeiten. (vgl. Glaser, 1999, S. 51) Wie die Akkulturation letztendlich genau abläuft, ist zum einen abhängig vom Betroffenen selbst, zum anderen von externen, situativen Faktoren.13 Auch Thomas (1989, S. 175) äußert sich dazu:
„Theorien des interkulturellen Personenaustausches oder eine Theorie der Akkulturation, die zuverlässige Vorhersagen erlaubt, bei welchen Personen unter welchen Bedingungen welche psychischen und sozialen Prozesse den Akkulturationsvorgang fördern respektive erschweren, und welche nachhaltigen Folgen für die Persönlichkeit zu erwarten sind, wurden bisher nicht entwickelt“.
Trotzdem haben Untersuchungen bestätigt, dass der Anpassungsprozess generell erstaunlich gleichartig verläuft, unabhängig davon, in welcher Kultur er geschieht (vgl. Maletzke, 1996, S. 161).
4.3.1 Die U-Kurven-Hypothese nach Lysgaard
Lysgaard veröffentlichte im Jahr 1955 seine U-Kurven-Hypothese. Er fand in einer Studie zum Anpassungserfolg heraus, dass die von ihm untersuchten 200 norwegischen Fulbright-Stipendiaten, die entweder bis zu sechs Monaten oder mehr als 18 Monate im Ausland waren, sich als gut angepasst bezeichneten, die Gruppe dazwischen (sechs bis 18 Monate) beschrieb sich hingegen als weniger angepasst. (vgl. Lysgaard, 1955, S. 45, 49) Dieses Phänomen stellte er unabhängig von anderen Variablen, wie Alter, Studienprogramm, etc. bei allen Studenten fest. Lysgaard leitete daraus ab, dass ein Anpassungsprozess in verschiedenen Stufen dem Verlauf einer U-Kurve folgt. Einer anfänglich guten Anpassung mit gehobener Stimmung folgt eine Anpassungskrise, in der das Individuum unzufrieden mit der Situation und daher niedergeschlagen ist. Anschließend kommt erneut eine Phase guter Anpassung verbunden mit Optimismus und Zufriedenheit. (vgl. Lysgaard, 1955, S. 49; Glaser, 1999, S. 51f.) Folgende Grafik veranschaulicht diesen U-Verlauf der Akkulturation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: U-Kurve nach Lysgaard (angelehnt an Kühlmann, 1995, S. 11).
Jedoch wird auch Kritik am U-Kurven-Modell geübt, da die Ergebnisse in zahlreichen Studien zwar belegt, in anderen aber auch oft widerlegt wurden. Das Modell ist stark idealisiert, denn in der Realität kann dieser verallgemeinerte Akkulturationsverlauf in der beschriebenen standardisierten Form nicht bei jedem Individuum beobachtet werden. Es kommt vor, dass nicht alle Phasen auftreten und die zeitliche Abfolge stark variiert. Dieses Modell eignet sich daher weniger für eine zuverlässige Aussage über die Akkulturation von Expatriates (vgl. Kim, 1989, S. 278; Kühlmann, 1995, S. 10f.), gibt jedoch ein grobes Orientierungsmuster vor.
4.3.2 Die Kulturschocktheorie von Oberg
Bei der Interaktion von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft, wie es bei Auslandsaufenthalten von Expatriates der Fall ist, wird oft von Problemen und Erfahrungen berichtet, die einem Schock gleichen. Somit ist nachvollziehbar, warum das im Folgenden beschriebene Phänomen als Kulturschock bezeichnet wird. Viele Menschen verwenden heutzutage dieses Wort, ohne genau zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Der Begriff Kulturschock, zum ersten Mal 1960 von Kalvero Oberg in Zusammenhang mit einem Modell des Anpassungsprozesses verwendet (vgl. Taft, 1977, S. 139), hat sich vor allem im Zuge der Globalisierung und des Massentourismus zu einem Modewort entwickelt.
Im Folgenden wird nun zuerst das Phasenmodell von Oberg (1960) näher erläutert. Es folgen eine Definition des Begriffs Kulturschock sowie die Thema-tisierung einiger Anzeichen und Folgen dieses Phänomens. Abschließend werden die Besonderheiten des Kulturschocks bei Expatriates beschrieben.
Das Phasenmodell
Oberg (1960) beschreibt den Auslandsaufenthalt eines in einem fremden Land lebenden Individuums anhand von vier Phasen (vgl. Glaser, 1999, S. 52): Honeymoon, Crisis, Recovery und Adjustment.
Während der ersten, der sogenannten Honeymoon-Phase, tritt die Person in ersten Kontakt mit der neuen Kultur und den Einwohnern des Gastlandes. Diese Phase kann, je nach Rahmenbedingungen des Aufenthaltes, von einigen Tagen über Wochen bis hin zu sechs Monaten dauern. In dieser Zeit überwiegt meist die Begeisterung für das neue Land und dessen Einwohner. (vgl. Oberg, 1960, S. 178) Man ist begierig auf Erlebnisse und fasziniert von der neuen Umwelt. Vieles erscheint spannend, ungewohnt und reizvoll. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen und der Fremde durchlebt die erste Zeit in neuer Umgebung voller Optimismus. (vgl. Schugk, 2004, S. 237) „During the first few weeks most individuals are fascinated by the new. They stay in hotels and associate with nationals who speak their language and are polite and gracious to foreigners“ (Oberg, 1960, S. 178). Diese Phase machen auch Touristen durch, die sich im Urlaub in einer fremden Kultur befinden. Expatriates bleiben jedoch für längere Zeit in dieser Umgebung und müssen daher auch das alltägliche Leben bewältigen.
Die zweite Phase, die Crisis-Phase, beginnt, wenn die anfängliche Ausnahmesituation dem Alltag und der Routine im neuen Land gewichen ist. Die Auswirkungen und Geschehnisse dieser Phase decken sich mit dem, was man im Wesentlichen unter dem Begriff Kulturschock versteht und werden an späterer Stelle noch weiter ausgeführt. Durch Anpassungsschwierigkeiten entwickelt sich eine aggressive und feindliche Haltung gegenüber dem Gastland. Daraufhin sucht das Individuum vermehrt Kontakt mit eigenen Landsleuten und beginnt, das Gastland sowie dessen Kultur und Einwohner zu kritisieren. Nicht selten entstehen in dieser Phase auch Vorurteile und Stereotypen14. (vgl. Oberg, 160, S. 178; Kim, 1989, S. 278)
In der darauffolgenden Recovery-Phase wird der Besucher selbstsicherer und passt sich schrittweise an die fremde Kultur an. Dies resultiert aus dem besseren Zurechtfinden im Alltag durch gesteigerte Sprachkenntnisse, die wachsende Anzahl sozialer Kontakte und die teilweise Übernahme von Werten der Gastkultur. (vgl. Hofstede, 2006, S. 445) Natürlich ist der Fremde nicht frei von Problemen, aber er lernt mit ihnen umzugehen und findet sich mit seiner Situation ab (vgl. Kim, 1989, S. 278).
Die letzte Phase ist schließlich die Adjustment-Phase. Der ehemals Fremde ist nun vollkommen eingegliedert und akzeptiert die kulturelle Andersartigkeit der Umgebung. Die Ängste sind verschwunden, es bleiben wenige Belastungen, die sich dank sozialer Interaktionen weiter verringern. Diese Phase übersteigt die reine Akzeptanz der Kultur und Gewohnheiten der Gastkultur bis hin zu deren Wertschätzung. (vgl. Oberg, 1960, S. 179; Kühlmann, 1995, S. 6)
Definition von Kulturschock
Menschen erlernen bereits in frühester Kindheit die Werte und Normen der Kultur, in der sie aufwachsen. Eltern, Freunde und das Umfeld prägen uns und tragen somit zu einer Sozialisation bei. Diese Verhaltensweisen werden so sehr verinnerlicht, dass sie unbewusst angewandt werden.15 (vgl. Hofstede, 2006, S. 444) Kommt eine Person in eine neue Kultur, ist sie dort plötzlich mit einer scheinbar anderen Welt und zahlreichen neuen Eindrücken konfrontiert. Nichts ist mehr, wie von zu Hause gewohnt. Die erlernten, kulturell bedingten Muster, Denk- und Handlungsweisen greifen in dieser neuen Situation nicht mehr. Der Betroffene verliert sein Orientierungssystem und beginnt, alles in Frage zu stellen was um ihn herum geschieht. (vgl. Bracht, 1994, S. 89) Der Kulturfremde deutet nun sein neues Umfeld mit den ihm bekannten kulturellen Normen und Werten. Er wird jedoch feststellen, dass er mit seinem Verhalten keinen Erfolg hat, denn sein Orientierungssystem bietet in der fremden Umgebung und im Kontakt mit Angehörigen der anderen Kultur keinen Handlungsleitfaden (vgl. Hofstede, 2001, S. 424). Dies ist der Auslöser für das Entstehen eines Kulturschocks. Oberg (1960) gab die erste Definition von Kulturschock:
„Culture shock is precipitated by the anxiety that results from losing all our familiar signs and symbols of social intercourse. These signs or cues include the thousand and one ways in which we orient ourselves to the situations of daily life“ (Oberg, 1960, S. 177).
Auch Bracht (1994, S. 91) sieht den Verlust des Orientierungssystems als Auslöser des Kulturschocks. Sie definiert diesen als „die Summe von Reaktionen eines Fremden, der die Sicherheit des ihm Vertrauten verloren hat“. Vor allem im Fall von Expatriates ist dieser Verlust des gewohnten Umfeldes schwerwiegend. Sie werden nicht nur mit anderen Denk- und Handlungsmustern konfrontiert, sondern die Umstellung betrifft auch die Bereiche Wohnung, Essen, Klima, hygienische Zustände, Kollegen, Arbeitsplatz, etc. (vgl. Brislin, 1981, S. 155).
Jeder Anpassungsprozess geht mit bestimmten Problemen einher. Jedoch ist die Intensität, mit welcher der Kulturschock erlebt wird, von Person zu Person verschieden und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Dies können beispielsweise interkulturelle Vorerfahrungen, Herausforderungen im Beruf und Alltag der neuen Gastkultur und individuelle Kompetenzen, die das schnelle Eingewöhnen möglich machen, sein (vgl. Schugk, 2004, S. 240). Taft (1977, S. 139) nennt als Faktoren ferner noch die Persönlichkeit, die kulturelle Entfernung des Gastlandes zum Heimatland und den persönlichen Einsatz des Betroffenen. Um den Zustand des Kulturschocks zu überwinden, bleibt dem Kulturfremden keine andere Chance, als sich das neue Orientierungssystem bestmöglich anzueignen (vgl. Bracht, 1994, S.90).
Im Laufe der Forschung zum Thema Kulturschock wurde das Konzept um den Reentry Schock erweitert. Dieser bezeichnet die emotionalen und physischen Probleme, mit denen jemand konfrontiert wird, sobald er in die Heimatkultur zurückkehrt (vgl. Kim, 1989, S. 277). Da dieser Zeitraum für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit nicht relevant ist, werden der Kulturschock bei der Rückkehr in die Heimat und die damit verbundene Reintegration nicht weiter ausgeführt.16
Anzeichen eines Kulturschocks
Wenn man über Anzeichen eines Kulturschocks spricht, ist es wichtig zu betonen, dass nicht sämtliche in gleichem Ausmaß bei allen Expatriates auftreten (vgl. Brislin, 1981, S. 156). Oberg nennt folgende Zeichen von Kulturschock (die nachfolgende Auflistung ist angelehnt an Furnham, 1987, S. 45; Taft, 1977, S. 140ff.):
- Anstrengung als eine Folge der Versuche und Bestrebungen, die nötig sind, um eine Anpassung zu erreichen;
- Verlustgefühle durch den Wechsel der vertrauten Umgebung und damit einhergehendem Mangel bzw. Verlust an Freunden, Status sowie Besitztümern;
- Zurückweisung des Neuankömmlings durch die Mitglieder der Gastkultur oder gegenteiliger Verlauf. Die Entwicklung einer negativen Einstellung der Expatriates gegenüber der Gastkultur führt teilweise dazu, dass sie sich weigern, die Landessprache zu erlernen. Als Folge suchen sie vermehrt Kontakt zu Angehörigen des eigenen Kulturkreises; (vgl. Brislin, 1981, S. 156f.)
- Verwirrungen bezüglich der eigenen Rolle, der Rollenerwartungen, von Werten, Gefühlen und Identität;
- Befremdung, Beklemmung, sogar Abscheu und Empörung nach dem Bewusstwerden der Kulturunterschiede;
- Gefühl der Unfähigkeit als Resultat, nicht mit der neuen Umgebung umgehen zu können.
All diese Auswirkungen einer interkulturellen Konfrontation äußern sich im Verhalten und Wohlbefinden des Kulturfremden. Brislin (1981, S. 155f.) nennt diesbezüglich Erschöpfung, Unwohlsein und Frustration als Resultat der Tatsache, dass alte Wertmuster nicht greifen. Ferner weist er darauf hin, dass sich Kulturschock auch in der Besorgnis über die Sauberkeit des Trinkwassers und der räumlichen Umgebung äußert. Bei Craig (1979, S. 160) finden sich folgende Symptome: exzessives Händewaschen, Müdigkeit, übermäßiges Trinken und geistesabwesendes in die Leere starren.
Der Kulturschock wird somit als „Stressfaktor oder psychische Belastung wahrgenommen“ (Fischlmayr, 2004, S. 77), was die Anpassung des Expatriate an die Gastkultur negativ beeinflusst.
Folgen des Kulturschocks
Kulturschock wird zwar meist als negative Erfahrung beschrieben, kann aber durchaus auch positive Folgen haben, wie Bracht (1994) und Furnham (1987) feststellen. „Very few writers have stressed the positive or beneficial side of culture shock either for those individuals who revel in exciting and different environments or for those initial discomfort leads to personal growth“ (Furnham, 1987, S. 47). Dieses personelle Wachstum kann sich in neuen Lernprozessen und in einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst zeigen. Man kann durch die Situation als Nichtmitglied der kulturellen Einheit des Gastgeberlandes neue Erkenntnisse gewinnen und Entdeckungen machen (vgl. Bracht, 1994, S. 94).
Eine wichtige Folge des Kulturschocks und zugleich eine bedeutende Voraussetzung zur Erlangung von interkultureller Kompetenz und zur Akkulturation in einer neuen Gesellschaft ist die Selbstreflexion.
„Culture hides much more than it reveals, and strangely enough what it hides, it hides most effectively from its own participants. Years of study have convinced me that the real job is not to understand foreign culture but to understand our own. […] The best reason for exposing oneself to foreign ways is to generate a sense of vitality and awareness – an interest in life, which can come only when one lives through the shock of contrast and difference“ (Hall, 1973, S. 30).
Dennoch geben viele Expatriates dem Kulturschock und seinen Symptomen nach und verlassen das Gastland. Dem Standhalten des Kulturschocks kann jedoch auch Positives abgewonnen werden. Nachdem man ihn überstanden hat, ist man definitiv interkulturell erfahrener und geht gestärkt aus der Krise hervor (vgl. Maletzke, 1996, S. 166).
Der Kulturschock von Expatriates
Touristen und Expatriates erleben gleichermaßen einen Kulturschock. Der Tourist ist schnell wieder zu Hause und was im Urlaub ein Schock war, heitert später als Urlaubsanekdote das nächste Familientreffen auf. Bei Expatriates gestaltet sich die Situation hingegen anders. „Menschen, die mehrere Jahre lang im Ausland lebten, erzählten, dass die Phase des kulturellen Schocks ein Jahr und länger andauerte, bevor sie sich kulturell angepasst haben“ (Hofstede, 2006, S. 446). Die Einordnung des Kulturschocks in den Akkulturationsprozess wurde bereits zu Beginn dieses Kapitels thematisiert.
Nicht übersehen werden darf, dass auch die mit ausreisende Familie vom Kulturschock betroffen sein kann, zumal Ehepartner in der neuen Heimat oft keinen Job und somit keine Aufgabe haben (vgl. Hofstede, 2006, S. 446). Der Expatriate ist jedoch durch seine Erfahrungen im beruflichen Alltag abgelenkt und hat durch die Arbeit meist mehr Kontakt zur westlichen Kultur (vgl. Craig, 1979, S. 163). Dies führt unter Umständen zu einem angespannten Verhältnis in der Familie und kann zusätzliche Belastungen für den Expatriate bewirken.
4.3.3 Der Akkulturationsprozess nach Hofstede und Schugk
Das nachfolgend behandelte Modell zeigt Ähnlichkeit mit dem Kulturschockmodell von Oberg. Auch hier wird der Prozess der Akkulturation in vier verschiedene Phasen unterteilt (vgl. Hofstede, 2006, S. 444f; Schugk, 2004, S. 237ff.).
1. Euphoriephase
2. Phase des Kulturschocks
3. Phase der Akkulturation
4. Phase der Stabilisierung
Die folgende Abbildung (siehe nächste Seite) gibt einen Überblick über die einzelnen Akkulturationsphasen dieses Modells und den Gefühlsausprägungen des Individuums.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Kurve der kulturellen Anpassung (nach Hofstede, 2006, S. 445).
Positive und negative Gefühle des Individuums sind auf der vertikalen Achse, der zeitliche Verlauf und die einzelnen Phasen hingegen sind auf der horizontalen Achse dargestellt. Die ersten drei Phasen in diesem Modell gleichen in ihren Eigenheiten und Symptomen denen des Oberg-Modells und werden daher an dieser Stelle nicht weiter erläutert.17 Interessant bei dem Modell von Hofstede (2006) und Schugk (2004) ist jedoch die Darstellung der letzten Phase, der Stabilisierung. Diese Phase spiegelt den bestmöglichen, individuellen Anpassungsgrad wider. Der Expatriate hat ein emotionales Gleichgewicht erreicht, das ihm ermöglicht, Vergleiche zwischen Gastland und Heimat realistisch einzuschätzen (vgl. Schugk, 2004, S. 241). Hofstede (2006, S. 445) spricht in diesem Zusammenhang von der mentalen Stabilität.
Im Unterschied zum Modell von Oberg (1960) kann der Akkulturationsgrad, also die Stabilität, drei unterschiedliche Ebenen erreichen. „Sie kann, verglichen mit Zuhause, mit negativen Gefühlen verbunden sein (4a), z.B. wenn sich der Besucher weiterhin wie ein Fremder fühlt […]. Dieser Zustand kann genauso stabil sein wie vorher (4b), d.h. man könnte von einer bikulturellen Anpassung des Besuchers sprechen, oder er kann sogar stabiler ausfallen als vorher (4c). In diesem Fall ist der Besucher ‚zum Einheimischen geworden‘“ (Hofstede, 2006, S. 445). Die Konstellation 4c tritt am seltensten auf, ist aber nicht völlig ausgeschlossen (vgl. Schugk, 2004, S. 241).
[...]
2 Ein Expatriate ist ein ins Ausland entsandter Mitarbeiter. Für mehr Informationen siehe Kapitel 2.2 (Der Expatriate).
3 Mit Kulturunterschieden befassen sich beispielsweise Hofstede (2001) sowie Thomas (1999). Das theoretische Modell von Thomas wird in Kapitel 3 (Kulturstandards) am Beispiel Deutsch-land und China näher beschrieben.
4 Einen kurzen Überblick dieser Forschungen liefert Kapitel 4 (Akkulturation).
5 Siehe beispielsweise die Untersuchung von Lysgaard (1955).
6 Nähere Informationen zur Einteilung Chinas und zu den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao sowie zur Provinz Taiwan finden sich beim China Internet Information Center (2004).
7 Eine oft verwendete Kurzform ist Expat oder aufgrund der englischen Aussprache auch X-pat.
8 Dies sind z.B. Pensionäre oder mit ausgereiste Partner von Expatriates.
9 Für weitere Informationen zu den Listen: Glaser (1999, S. 33-40) bietet einen Überblick über die einzelnen Forschungen.
10 Siehe Kapitel 3 (Kulturstandards).
11 Siehe Kapitel 4.3.2 (Die Kulturschocktheorie von Oberg).
12 Siehe Kapitel 4.3 (Der Akkulturationsprozess).
13 Siehe Kapitel 4.5 (Akkulturationsvariablen).
14 Im Rahmen dieser Arbeit werden Stereotypen definiert als stark vereinfachte, klischeehafte und generalisierende Bilder von Kulturen und kultureller Gruppen (vgl. Schugk, 2004, S. 62).
15 Zum Thema kulturelle Prägung siehe auch Kapitel 2.3 (Kultur).
16 Für weiterführende Informationen zum Thema Reentry Schock siehe Maletzke (1996) und Schugk (2004).
17 Siehe Kapitel 4.3.2 (Die Kulturschocktheorie von Oberg).
- Arbeit zitieren
- Alexandra den Ouden (Autor:in), 2007, Integration versus Abgrenzung. Realität und Potenziale der Entsendung von Expatriates im Kontext deutscher Firmen nach China, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465381
Kostenlos Autor werden















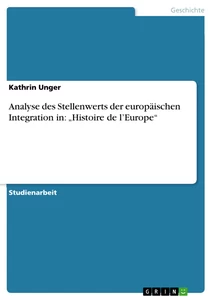






Kommentare