Leseprobe
Inhalt
Danksagung
Abstract
1 Einleitung.
2 Identität.
2.1 Identitätsbildung.
2.2 Identität Soziales Milieu.
2.3 Identität Online.
3 Sozialerziehung.
3.1 Definition des Begriffs Sozialerziehung.
3.2 Sozial- und Selbstkompetenz.
3.3 Schule.
3.4 Ambivalenz zwischen Individuum und Gemeinschaft
4 Bildung.
4.1 Bildung und Habitus.
4.2 Außerschulische Jugendbildung.
5 Jugend und Medien.
5.1 Digital natives.
5.2 Peergruppen.
5.3 Soziale Netzwerke.
5.4 Medienhandeln – Ausgleich oder Reproduktion sozialer Differenzen..
6 Soziokultureller Ansatz - Jugend und Medien.
6.1 Sozialraum Netz – Zwischen Kommunikation und Kooperation.
6.2 Ressourcen und Partizipation.
6.3 Faktoren medialer Kompetenzbildung.
6.4 Visuelle und Audiovisuelle Medien..
7 Methodik unter Einsatz audiovisueller Medien.
7.1 Produktion.
7.2 Rezeption.
7.3 Exposition.
7.4 Vernetzung.
8 Fazit und Ausblick.
Literatur- und Quellenverzeichnis.
Abbildungsverzeichnis.
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei Christine Jesuiter bedanken, die mir mit konstruktiver Kritik und Reflexion während der gesamten Studienzeit zur Seite gestanden hat. Meinem Mann, mit dem ich aktuell in der Gründung einer Stiftung zur Arbeit mit audiovisuellen Medien mit Kindern und Jugendlichen stehe und der mir den notwendigen Raum und Motivation für die Erstellung der Master Thesis gegeben hat.
Weiterhin gilt mein Dank Prof. Dr. Stephan Wagner, den ich innerhalb des Studiums als Mentor erleben und mit seiner unangefochtenen Ambition und Motivation für die Studierenden auf dem komplexen Feld der sozialen Arbeit schätzen lernen durfte.
Ein letzter herzlicher Dank gilt Viola Strittmatter und allen Dozentinnen und Dozenten der Paritätischen Akademie in Berlin für ihre fachliche und verlässliche Unterstützung während des Studiums.
Abstract
Die globale Moderne hat einen enormen sozialen und technologischen Wandel durchlaufen. In der vorliegenden Master Thesis werden die biographischen und sozialen Einflüssen in der Phase der Jugend von Mädchen, Jungen und Queers vor dem Hintergrund sich rasant entwickelnder medial gesellschaftlicher Veränderungen in den Blick genommen. Die zunehmend komplexeren Kommunikationstechnologien verändern für Jugendliche auch den Bezug und die Zugänge zur Welt. Der zunehmende Strukturwandel, der sich mittlerweile auf alle Lebensbereiche erstreckt, erfordert neues Wissen und Kompetenzen. Auf formale und non-formale Erziehungs- und Bildungsinstitutionen kommen damit neue Anforderungen zu, um aktuelle Bedarfe in digital vernetzten Welten für Mädchen, Jungen und Queers zu erkennen und Angebote angepasst flexibel ausgestalten zu können. Traditionelle Lebenskonzepte von Familie, Schule und Arbeit verändern sich unter dem Einfluss polymorpher Lebensstile und -kulturen. Für junge Heranwachsende birgt dies neue Chancen in der individuellen und sozialen Persönlichkeitsentwicklung, doch auch Gefahren im Hinblick auf ungleiche Sozialisationsbedingungen. Kinder und Jugendliche mit belasteten sozialen Hintergründen sind aufgrund fehlender sozioökonomischer Ressourcen und medialer Zugänge vor doppelter Ausgrenzung bedroht. Ausgehend von den Einflüssen auf die Identitätsbildung, muss seitens der Pädagog*Innen ein Verständnis für die Bedeutung der komplexen medialen Netzwerke in der heutigen Lebenswelt von Jugendlichen entwickelt werden. Vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit bedarf es dabei einer differenzierten Betrachtung im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Medien. Wie können Hilfen in der Arbeit mit Mädchen, Jungen und Queers ausgestaltet werden, um unabhängig ihrer sozialen Herkunft, digital-mediale Kompetenzen vermitteln zu können und damit gleichermaßen die Teilhabe an der globalen Moderne zu ermöglichen? Es werden die Aspekte der Identitätsbildung und des sozialen Lernens in der Jugendphase in den Blick genommen und Herausforderungen insbesondere für die Arbeit in der außerschulischen, soziokulturellen Jugendbildung aufgezeigt. Textbasierte und audiovisuelle Informationen verschmelzen in digitalen Medien. Dies kann als unterstützende Methode in soziokulturellen Angeboten mit Mädchen, Jungen und Queers genutzt werden
1 Einleitung
Die neuen Medien und die global vernetzte Kommunikation in sozialen Netzwerken sind zu einem kulturellen Phänomen in den letzten Jahren avanciert. Was heißt das Aufwachsen heute in Zeiten der Allgegenwart von Medien und sich rasant entwickelnder, globalisierter Kommunikationstechnologien für Mädchen, Jungen und Queers? Die zunehmende Vielfalt von neuen Medien fließt in alle Bereiche des persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Lebens und bringt neue individuelle Verwirklichungschancen für junge Heranwachsende. Das Spannungsfeld zwischen den Risiken und Chancen der Mediennutzung wird in aktuellen Forschungen vielfach untersucht. Einigkeit dürfte jedoch darüber bestehen, dass das Internet sich zu einem neuen Lern- und Bildungsort entwickelt, der Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten um Dimensionen für Jugendliche vergrößert hat. Keine Zeit im Leben ist derart mit dem Prozess der Selbstfindung gekennzeichnet wie die Jugendphase. Junge Heranwachsende gehen neue Wege, kreieren sich eigene Räume in denen verschiedene Haltungen und Ambitionen ausprobiert werden. In meiner langjährigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen konnte ich beobachten, wie entscheidend das soziale Umfeld auf die persönliche Identitätsbildung einwirkt. Dies hat sich neben der Familie und Schule auf das digitale Netzwerk ausgeweitet. Es wurde deutlich wie unterschiedlich Kinder und Jugendliche in sozialen Netzwerken agieren. Gleichzeitig blieb ihnen jedoch eines gemeinsam: ihre unangefochtene Ambition zur Nutzung audiovisueller Medien ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, Ethnie und Geschlecht. Das führte mich zu dem Thema der vorliegenden Arbeit. Diese Master Thesis beschäftigt sich mit der Frage, wie Jugendliche sich auch unter schwierigen Sozialisationsbedingungen, soziale, kreative und mediale Kompetenzen aneignen können, um die neuen Medien konstruktiv in ihre Lebenswelt zu integrieren und für sich Lebensperspektiven entwickeln zu können. Dabei werden folgende Unterfragen in den Blick genommen:
Können die Chancen der Mediennutzung im Lebensalltag von Mädchen, Jungen und Queers ungleiche Sozialisationsbedingungen ausgleichen oder besteht die Gefahr der Reproduktion sozialer Gräben?
Welche Chancen erschließen sich mit der Mediennutzung und wie können Hilfen ausgestaltet und methodisch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden?
Zusätzlich zu der Recherche für die vorliegende Arbeit, die auf einem reinen Literaturstudium basiert, bringe ich Erfahrungen sowohl aus der pädagogischen Praxis, als auch der Arbeit mit audiovisuellen Medien mit Mädchen, Jungen und Queers ein. Dabei werde ich im ersten Teil der Arbeit Erkenntnisse und Faktoren der Identitätsbildung und der Sozialerziehung zusammentragen. Anschließend wird die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf die Mediennutzung beleuchtet, um ein Verständnis für die neuen Herausforderungen insbesondere in der außerschulischen, soziokulturellen Arbeit zu entwickeln. Abschließend stelle ich den Entwurf einer möglichen Methodik mit audiovisuellen Medien in der Arbeit mit Mädchen, Jungen und Queers vor, die eine Notwendigkeit aufgrund vorangegangener Erkenntnisse aufzeigt.
Die Ergebnisse dieser Arbeit geben keine abschließenden Antworten, möchten jedoch zur Reflektion und den Einsatz neuer Methoden in der Arbeit mit Mädchen, Jungen und Queers anregen.
Aus Gründen der gendergerechten Sprache, werden in dieser Arbeit das weibliche, männliche und intersexuelle Geschlecht benannt. Zur besseren Lesbarkeit konnte jedoch nicht vollkommen auf geschlechtsneutrale Bezeichnungen verzichtet werden. Bei Verwendung von Personenbezeichnungen, die keine eindeutige Geschlechtszuordnung zulassen, gelten diese gleichermaßen für jedes Geschlecht.
2 Identität
„Identität ist der Schnittpunkt zwischen dem, was eine Person sein will und dem, was die Welt ihr zu sein gestattet.“ (Erik H. Erikson, Psychologe, 1902-1994)
2.1 Identitätsbildung
Um zu verstehen, welche entscheidenden Einflüsse auf die Identitätsbildung wirken, muss zuvor auf die Frage der Identität eingegangen werden. In Philosophie, Psychologie sowie Sozialwissenschaft scheiden sich nach wie vor die Geister an der Begriffserklärung. Es scheint jedoch Konsens über das Verständnis von Identität, als die einzigartige Persönlichkeitsstruktur unter Einbeziehung des Namens, Geschlechts, Berufes und des Selbstverständnisses für das was wir sein wollen und was wir sind, zu bestehen. Identitätsbildung umfasst, dass sich ein Mensch seiner Umwelt, seines Charakters und seiner Position bewusst wird und unterliegt einem lebenslang andauernden Prozess. Wir können uns bewusst für oder gegen eine Entwicklung entscheiden und darauf Einfluss nehmen. Zur Verdeutlichung: Eine junge Frau wächst in ärmlichen und bildungsfernen Verhältnissen auf. Im späteren Verlauf verlässt sie den Heimatort und beginnt ihren Schulabschluss nachzuholen, zu studieren und zu unterrichten. Ihre Identität setzt sich aus allen Fragmenten ihrer Entwicklung zusammen. Im Vergleich dazu ein junger Mann, der anerkannt und beruflich erfolgreich ist, erleidet einen Schlaganfall welcher ihn von seinem gewohnten Leben und Umfeld abschneidet. Er kann sich nicht mehr über Sprache, Mimik und Gestik artikulieren und in Kommunikation treten. In Bezug auf seine Identität, erinnert sich jeder an den damals aktiven und erfolgreichen jungen Mann und nicht den hilfebedürftigen Menschen zu dem er geworden ist. Sein aktueller Zustand reflektiert nicht seine Identität.Sollte er jedoch länger im invaliden Zustand verbleiben, wird sich dies auf sein Fremdbild und im längeren Verlauf auch auf sein Selbstbild auswirken.Es wird deutlich, wie das Zusammenwirken von inneren Prozessen und äußeren Einflüssen entscheidend die Identitätsbildung bedingt. „Identität als einen kontinuierlichen Prozess der Persönlichkeitsbildung“ (Nierobisch, 2016, S. 19). Individuen bilden ihre Persönlichkeit durch die Wahl von Beruf, Freizeitorganisationen, Kleidung und Medien und sind gleichzeitig geprägt durch die eigene, individuelle Sozialisation. Der Sozialpsychologe Heiner Keupp bezeichnet die Identität als einen „Akt sozialer Konstruktion“ (Keupp, 2000). Das Individuum und die soziale Gemeinschaft wirken unmittelbar aufeinander innerhalb der konstanten Auseinandersetzung zu den Fragen ´Wer bin ich, was kann ich und wo gehöre ich hin?´. Der Grad der Zugehörigkeit und Anerkennung des Individuums innerhalb der Gruppe sind entscheidend für die Entwicklung der Persönlichkeit. In der Persönlichkeitsbildung spielt die Phase der Adoleszenz eine entscheidende Rolle, die durch Bildung, Geschlecht, Familie und soziales Milieu weitreichend beeinflusst wird.
2.1.1 Adoleszenz
Die Phase der Adoleszenz ist geprägt von körperlichen, intellektuellen und psycho-sozialen Veränderungen. Der Eintritt in die Geschlechtsreife zieht auch eine sichtbare Veränderung des Körpers nach sich. Mädchen, Jungen und Queers stellen in dieser Phase des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen sich selbst und ihr Umfeld konstant in Frage. Die kritische Auseinandersetzung mit sich selbst, der eigenen Geschlechterrolle, der Erwachsenenwelt, der eigenen Rolle in Peergruppen führt immer wieder zu der Frage ´Wer bin ich?´. Mädchen, Jungen und Queers bewegen sich im konstanten Spannungsfeld zwischen Rollenfindung, dem Entwickeln einer Ich-Identität und Zugehörigkeit. Unter strukturellem Aspekt wurde diese Phase in der Vergangenheit als beendet erklärt, wenn die jungen Frauen, Männer und Queers über Berufsfindung und Gründung einer Familie in die Gesellschaft integriert sind (Vgl. Döbert / Winkler 1975, S. 42). Nicht allein angesichts moderner, sich verändernder Lebensformen kann von einer Veränderung und Verlängerung der Jugendphase ausgegangen werden. Auch vor dem Hintergrund gesellschaftlich-problematischer Strukturen, Jugendarbeitslosigkeit und zivilgesellschaftlichem Wandel stellt sich die Frage, wie die Jugendgeneration der vorangegangen These nach den Status eines Erwachsenen überhaupt erreichen kann (Vgl. Ecarius 2012, S. 28 – 32). Mädchen, Jungen und Queers sind weiterhin ökonomisch, sozial-emotional und biologisch an ihre Eltern oder Bezugspersonen gebunden, gleichzeitig werden ihnen jedoch auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden und zunehmend mehr Verantwortung abverlangt. Mit Einzug der globalen Moderne findet eine zunehmende Angleichung der Generationen statt (Vgl. ebd., S.31). Ausbildungszeiten verlängern sich, Studierende starten ihren Berufseintritt heute nicht selten erst ab dem 30. Lebensjahr und die Ehe hat ihre Monopolstellung als gemeingültige Lebensform für Erwachsene verloren (Vgl. Tillmann, 2010, S. 241). Den Status eines Erwachsenen erreichen gegenwärtig die meisten Menschen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr (Vgl. ebd.), wobei der Zeitpunkt von der jeweiligen Sozialisation des Mädchen, Jungen und Queers abhängt. Eine Identitätsfindung wird zunehmend komplexer und langwieriger, da sich Lebensräume erweitern und Rollenbilder multipel ausgelebt werden können. Mädchen, Jungen und Queers suchen den Zuspruch und die Anerkennung der Gleichaltrigen. Während sich ihr Wirkungsbereich in der Vergangenheit auf Räume wie die Schule, die Familie und Freizeittreffs beschränkte, finden sich Mädchen, Jungen und Queers heute zusätzlich in virtuellen öffentlichen Räumen wieder. Diese digitale Vernetzung wird von vielen Erwachsenen in der gleichen Weise kritisch beobachtet, wie früher der Aufenthalt der Jugendlichen im öffentlichen Leben an frequentierten Plätzen wie Parks oder Einkaufszentren (Vgl. Boyd 2014, S. 17). Besonders in der Phase der Adoleszenz streben die Jugendlichen nach persönlicher Autonomie. Sie lieben ihre Eltern und lehnen sie zugleich ab. Sie wollen nicht nur Tochter oder Sohn sein, sondern ihre eigene Identität finden. Es ist eine ambivalente Position zwischen Abhängig- und Unabhängigkeit, Kindheit und Erwachsenwerden, Freiheit und Verantwortung. Der Wunsch nach Autonomie wird über unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten wie Kleidungsstile, Frisuren, Peergruppen und die Teilnahme an sozialen Netzwerken ausgelebt. Dies ist notwendig für die eigene Identität, die in dieser Zeit neben der Familie zunehmend von Gleichaltrigen geprägt wird. In dieser Zeit der Loslösung von der familiären Zentrierung haben Freundschaften eine wichtige Bedeutung. Mädchen, Jungen und Queers wollen ihre Freunde und ihr soziales Umfeld selber gestalten, frei von elterlicher Kontrolle. Dies ist ihnen, zur Sorge vieler Erwachsener zunehmend auch in medialer Form möglich. An der Bedeutung der Freundschaft hat sich jedoch nichts verändert. Sie entsteht über Wertschätzung, Verständnis, ein Gefühl der Nähe, Bindung und Akzeptanz. Ob dies in realer, physischer Form oder auf medialer Ebene stattfindet, der Wunsch nach Freundschaften ist gleich geblieben und notwendig bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen. In der Phase der Adoleszenz stehen Mädchen, Jungen und Queers vor vielen Herausforderungen die auf unterschiedlichen Ebenen wie emotionaler Unabhängigkeit gegenüber den Eltern, Sexualität und die Wahl einer Geschlechterrolle, die berufliche Perspektive, Konflikte mit sich bringen können. Wie diese gelöst werden ist abhängig von der Kultur und Lebenswelt jeder einzelnen Person.
2.1.2 Biographie und Bildung
Der Psychoanalytiker Erik Homburger Erikson ist in seinem Ansatz zur Identitätsentwicklung davon ausgegangen, dass sich der Prozess der Identitätsbildung in bestimmten, aufeinander aufbauenden psychosozialen Phasen von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter vollzieht (Vgl. Erikson, 1966). Die frühkindlichen Erfahrungen, geprägt durch die Identifikation mit dem Lebensumfeld und den Erwachsenen, sind dabei identitätsbedeutsam (Vgl. Tillmann, 2011). Die individuelle Lebensgeschichte wirkt also unmittelbar auf die Bildung einer eigenen Persönlichkeit. Dies bedeutet, dass Mädchen, Jungen und Queers über keine bestimmte Identität verfügen. Diese wird aufgrund ihrer Biographie erst hervorgebracht und bleibt durchgängig über die Zeit beeinflussbar. Anknüpfend an die sich aufbauende Biographie sind auch Lern- und Bildungsprozesse abhängig von der Erfahrungsaufschichtung und dem Selbst- und Weltverständnis. Die Familie als Erfahrungs- und Lernort nimmt dabei entscheidend Einfluss. Ökonomische, kulturelle und soziale Hintergründe der Eltern prägen das Selbstbild und eine perspektivische Lebensführung der Kinder und Jugendlichen. Ob es dabei zu einer Anpassung, Unterordnung oder einer Gegenposition kommt, ist wiederum abhängig von dem individuellen, biographischen Prozess. Ressourcen, die Mütter, Väter und Bezugspersonen den Jugendlichen zur Verfügung stellen können oder nicht können, sind immer auch bestimmt von dem, was sie sich selbst an sozialen, ökonomischen und kulturellen Ressourcen angeeignet haben (Vgl. Ecarius, 2012, S. 35). Diese notwendigen Ressourcen bestimmen den eigenen Individuierungsprozess von Mädchen, Jungen und Queers in der Jugendphase, der vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheiten keineswegs einheitlich ist. Kinder und Jugendliche leben zwar seit dem letzten Jahrhundert zunehmend länger mit der Familie zusammen (Vgl. ebd., S. 33) und sind somit auch länger mit ihr eng emotional verbunden. Ergebnisse der Shell Jugendstudie (Shell, 2010) zeigen jedoch auch starke milieuspezifische Unterschiede auf. Demnach wenden sich 72% der Mädchen, Jungen und Queers im Alter von 12 - 25 Jahren aus der Oberschicht mit ihren Bedürfnissen und Problemen an ihre Eltern, während dies Jugendliche aus der Unterschicht nur in 40% der Fälle tun. Darin wird eine Übereinkunft beziehungsweise eine Diskrepanz des sozialen Verständnisses von Mädchen, Jungen und Queers gegenüber ihren Eltern deutlich. Darauf soll im Kapital 2.2 / Identität Soziales Milieu näher eingegangen werden. Biographische Prozesse wirken demnach kohärent mit Lern- und Bildungsprozessen innerhalb der Identitätsentwicklung. Kira Nierobisch benennt dies als die biographische Figur des Werdens und der konstanten biographischen Veränderung, „..die sich im Prozesscharakter von Lernen und Bildung, von Identität und Alterität..“(Nierobisch 2016, S. 131) zeigt. Besonderes Augenmerk sollte in biographischen Verläufen jedoch Krisen zukommen, die in der Regel auch Krisen im Bildungsprozess nach sich ziehen können. Für den Aufbau einer autonomen und stabilen Identität gehört die Herausbildung von Mechanismen mit denen ein positives Selbstbild trotz biographischer Krisen wie Misserfolge, negative soziale Rückmeldungen oder Verluste, erhalten bleiben kann. Wie aber entsteht im biographischen Prozess eine Konstruktion von ´Selbst´ und ´Welt´ ohne den Einfluss von Geschlechterverhältnissen. Können diese reproduziert, variiert und transformiert werden (Vgl. ebd, S. 134)?
2.1.3 Geschlecht
Das Geschlecht unterliegt nicht nur einer biologischen sondern auch einer sozialen und gesellschaftlichen Konstruktion (Vgl. Keuneke, 2000) und nimmt neben der Biographie und Herkunft maßgeblich Einfluss auf die Identitätsentwicklung. In den Begrifflichkeiten von „Sex“ als die biologische Dimension und „Gender“ als die soziale Dimension des Geschlechts, wird eine Unterscheidung deutlich. Beide Dimensionen wirken aber unmittelbar aufeinander (Vgl. TU Wien). Die Zugehörigkeit und auch Ablehnung zum biologischen oder sozialen Geschlecht wirkt sich gleichermaßen auf die sexuelle Orientierung aus. Insbesondere in der Phase der Adoleszenz findet eine bewusste oder unbewusste aber unvermeidbare Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht statt. Entscheide ich mich weiblich, männlich, zweigeschlechtlich oder auch ungeschlechtlich zu sein? Dieser Prozess wird nicht nur durch die eigene Selbstwahrnehmung, sondern insbesondere auch durch das soziale Umfeld beeinflusst. Neben der noch immer vorherrschenden binären Geschlechterordnung, also der eindeutigen Geschlechtsidentität zu Frau oder Mann, findet zunehmend auch die Queer-Identität1 Raum in sozialwissenschaftlichen und kulturellen Diskursen. Gesellschaftlich jedoch ist das binäre Geschlechtermodell nach wie vor als soziale Norm tief in den Köpfen der Menschen verankert. Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer werden durch unterschiedliche sexuell relevante Reize und Lernerfahrungen automatisch in zwei Geschlechter sozialisiert (Vgl. Meier, 2015, S. 138). Sie erlernen die Geschlechterrollen durch Mutter, Vater und anderen Bezugspersonen in Form subtiler Mechanismen wie Aufmerksamkeit, Anerkennung, Belohnung und Bestrafung. Diese konditionierten Reaktionsmuster können weitgehend das Geschlecht eines Kindes determinieren (Vgl. ebd.). Neben den primären Einflüssen durch Mutter und Vater, bestimmen auch Geschwister, Peergruppen, Sexualpartner*Innen, Pädagog*Innen und besonders auch die Medien die Entwicklung einer Geschlechtsidentität. Damit wird noch einmal deutlich, wie das Individuum innerhalb seiner Identitätsbildung auch bezogen auf seine Geschlechterrolle an die gesellschaftliche Ordnung gebunden ist. Susanne Keuneke spricht in ihrer Forschung zur frühen Geschlechtersozialisation von dem Geschlecht als „soziale Konstruktion“, in der auf einem fast schleichenden Weg durch die Vergabe von geschlechtsspezifischem Material wie Spielzeug, Kinderbüchern, gesellschaftliche Aufgabenteilung, Kleidung und Mode auf das Individuum eingewirkt wird (Vgl. Keuneke, 2000).
Im Hinblick auf die besondere Dynamik in der Phase der Adoleszenz steht in diesem Übergangsprozess die Bedeutung des Geschlechts stärker im Vordergrund als in anderen biographischen Entwicklungen (Vgl. King, 2000, S. 40). Emotionen werden in dieser Zeit stärker zum Ausdruck gebracht und insbesondere bei abweichendem Verhalten vorschnell in ´jungen- und mädchentypisches´ Verhalten kategorisiert. Stereotypisches Verhalten führt in der Regel auch zu stereotypischen Reaktionen. Aggressives Verhalten wird beispielsweise eher den Jungen zugeschrieben und unter der Geschlechterordnung ´Männlichkeit´ in größerem Maße geduldet als bei Mädchen, die bei gleichem Verhalten sich einer härteren Konsequenz unterziehen müssen. Vor dem Hintergrund des Wandels der Geschlechterverhältnisse in den letzten Jahrzehnten reichen diese Kategorisierungen in der Arbeit mit Mädchen, Jungen und Queers jedoch nicht mehr aus.
2.2 Identität Soziales Milieu
Verschiedene soziologische Zeitdiagnosen sprechen von einer weitreichenden Dekonventionalisierung von Biographien, Identitäten und Lebensformen (Vgl. Schallberger 2003, S.9). Lebenswege gestalten sich heute neben der konventionellen Form von Beruf und Familie zunehmend individueller. Abhängig vom sozialen Milieu, also dem sozialem Lebensumfeld des jungen Menschen, können sich berufliche und soziale Perspektiven entwickeln ebenso wie Limitierungen und Krisen. Die eigene soziale Realität ebnet den persönlichen Lebensweg. Nehmen wir zwei Fallbeispiele:
Marie, 17 Jahre, kommt aus einer stark bildungsorientierten Herkunftsfamilie. Sie besucht ein Gymnasium und hat einen überdurchschnittlichen Notendurchschnitt. Ihre Mutter und ihr Vater unterstützen Marie in vollem Umfang in ihrer Bildungslaufbahn. Auch der Freundkreis von Marie besteht zur Freude der Eltern fast ausschließlich aus Gleichgesinnten fokussiert auf eine berufliche Perspektive und mit leistungsorientiertem Charakter. Der Weg einer universalen Laufbahn für Marie wurde durch ihre Herkunftsfamilie und ihrem sozialen Umfeld geebnet.
Dem gegenüber steht Leon, 16 Jahre. Ein Junge, der aus zerrütteten Familienverhältnissen kommt und seit einem Jahr in der Kinder- und Jugendhilfe stationär untergebracht ist, hat trotz problematischer familiärer Strukturen einen durchschnittlich guten schulischen Leistungsstand. Die Schule bedeutet für ihn, die einzige Konstante in seinem Leben. Er möchte seinen Mittleren Schulabschluss absolvieren und kann sich einen Weitergang zum Abitur vorstellen. Vater und Mutter, beide ohne Schulabschluss und abhängig von der sozialen Unterstützung durch den Staat, belächeln Leon und glauben nicht an seinen Erfolg. Auch sein Freundeskreis, bestehend aus Jungen und Mädchen innerhalb der Jugendhilfe mit einem überproportionierten Anteil an Schulverweigerer*Innen, kann ihn in seinem Vorhaben nicht ernst nehmen. Hinzukommend läuft er Gefahr, durch die anderen Jugendlichen als ´Streber´ ausgegrenzt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leon einen höheren Bildungsgrad erreicht, wird durch seine soziale Realität massiv eingegrenzt. Deutlich wird der Einfluss des sozialen Umfeldes, das nicht allein durch den Bildungsgrad der Herkunftsfamilie sondern auch durch die Ambitionen der Peergruppen bestimmt wird. Schauen wir uns noch ein drittes Fallbeispiel an: Maximilian, 17 Jahre, besucht ebenso wie Marie ein Gymnasium mit stark leistungsorientiertem Charakter. Seine Eltern bestärken ihn darin, einen hohen Bildungsabschluss zu erreichen. Maximilian teilt die Ansicht seiner Eltern jedoch nicht. Sein Freundeskreis besteht aus gleichaltrigen Jungen, die seine Leidenschaft für Computerspiele teilen. Die meiste Zeit verbringt er vor dem Computer und in Chat-Rooms. Dies stellt für ihn einen Ausweg, eine Gegenwelt zur schulischen Leistungserbringung dar. An diesem Beispiel wird deutlich, dass das soziale Umfeld nicht zwangsläufig an die Herkunftsfamilie gebunden sein muss und im Fall von Maximilian, aber auch Leon, zu einer Gefährdung des Bildungsweges führen kann. Nun dürfen Peergruppen und Familie nicht isoliert betrachtet werden. Wie im Vorfeld in der biographischen Identitätsbildung bereits kurz beschrieben, nimmt der Grad der emotionalen Bindung von Mädchen, Jungen und Queers zu ihren Eltern und Bezugspersonen maßgeblich Einfluss auf die Bewältigung von kritischen Lebenslagen. Am Beispiel von Marie kann von einem fast homogenen sozialem Umfeld gesprochen werden, da Eltern, Schule und auch ihre Peergruppen ein einheitliches Ziel verfolgen. Im Fall von Leon hingegen zeigen sich biographische Krisen, die er für sich allein bewältigen muss. Auch er bewegt sich in einem homogenen Umfeld, welches aber nicht konform mit seiner Identität ist. Seine Mutter, sein Vater und sein soziales Umfeld, zwingen ihn in eine soziale Realität, die für ihn perspektivisch identitätsbedeutsam sein wird. In Maximilians Fall haben wir ein heterogenes Umfeld, in welchem er die Möglichkeit bekommt sich zwischen dem Leistungsbestreben seiner Eltern und seiner Peergruppe zu entscheiden. Die Beispiele von Marie, Leon und Maximilian verdeutlichen wie das soziale Milieu eine Ressource, aber auch eine biographischen Gefährdung darstellen kann. Neben den Instanzen Schule, Familie und Milieu nehmen heute auch digitale Medien entscheidend Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung.
2.3 Identität Online
Medien sind heute – nicht nur aus dem jugendlichen – Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie eröffnen neue soziokulturelle Räume und Begegnungsstätten, die alternative Lebensformen und Lebensstile zum ´realen´2 sozialen Milieu ermöglichen. Wie bereits im Vorfeld beschrieben, ist in der Jugendphase der Wunsch nach Autonomie und Loslösung aus dem Einflussbereich der Eltern am stärksten. Dies ist Mädchen, Jungen und Queers insbesondere in medialer Form möglich. Verschiedenste digitale Plattformen bieten ein virtuelles Zielpublikum, mit dem sich die Jugendlichen identifizieren. Soziale Medien bieten vielfältige Kontexte. Das Mädchen, Jungen und Queers in unterschiedlichen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram mit scheinbar fiktiven Identitäten zugegen sind, führt schnell zum Trugschluss einer multiplen Identität im psychologischen Sinne. Der Anschein von unterschiedlichen Identitäten, resultiert aus dem wahrgenommenen unterschiedlichen Nutzerverhalten, bedingt durch den Kontext der jeweiligen Plattform. Allerdings, so beschreibt Danah Boyd in ihrer Langzeitstudie zum Verhalten von Jugendlichen in sozialen Netzwerken, müssen Menschen, anders als in der physischen Umgebung, wo die körperliche und soziale Existenz als selbstverständlich gegeben ist, „im Internet ganz bewusst ihre digitale Existenz erschaffen“ (Boyd, 2014, S. 44). Die Möglichkeiten, die eigene Identität in medialer Form auszuprobieren und auszuleben erscheint schier unbegrenzt und ist doch auch an die eigene Sozialisation gebunden.
Ob ein Mädchen sich beispielsweise eine bunte Mischung aus Online-Identitäten zulegt oder in allen medialen Plattformen denselben und realen Nutzernamen trägt, beide Wege sind gleichermaßen an ihren sozialen Kontext gebunden. „Wenn Jugendliche zwischen verschiedenen sozialen Umgebungen pendeln und mit verschiedenen Freundesgruppen, Interessengruppen und Schulkameraden kommunizieren, bewegen sie sich zwischen verschiedenen Kontexten, die sie gemeinsam erschaffen und sozial konstruiert haben. Ihr Gefühl für (den) Kontext wird von der Umgebung, dem Zeitpunkt und dem jeweiligen Publikum geprägt, aber nicht klar definiert.“ (Boyd, 2014, S. 48) Die 16-jährige Mara3, mit der ich über drei Jahre intensivpädagogisch gearbeitet habe, berichtete, dass all ihre Kontakte in den jeweiligen sozialen Netzwerken genau wissen, was sie mit den Angaben zu ihrer Person und ihren Publikationen ausdrücken möchte, selbst wenn diese nicht der Wahrheit entsprechen. Die Dinge, die sie im Netz mit ihren Freunden teilt, sind nicht aus einer Willkür geboren und auch nicht vorgegeben. Sie unterliegen dem sozialen Kontext, sind zum Schutz der Privatsphäre und ihrer Sicherheit verschlüsselt und grenzen bewusst die Erwachsenenwelt aus. Gleichermaßen bleibt auch die virtuelle Plattform ein Ort der Begegnung und des Austausches unter Gleichgesinnten. Die Vorstellung, in den Medien einen anonymen Raum gefunden zu haben, ist schlichtweg banalisiert und muss hinterfragt werden. Wenn Jugendliche sich in sozialen Medien aufhalten, bewegen sie sich in öffentlichen Umgebungen und in privaten Freundschaften gleichzeitig. Jede Online-Identität ist jederzeit auffindbar. Selbst gefälschte Inhalte und Angaben zu einer Person können Aufschluss auf die reale Person und Sozialisation geben. Erstaunlicherweise haben sich Jugendliche eine eigene Sprache zugelegt, eine Codierung wie ich sie vorher erwähnt habe, deren Inhalte nur von denen verstanden werden, an die die Nachrichten gerichtet sind. Dies dient zum Schutz vor dem Einblick der Familie, Lehrer*Innen und anderer Autoritätspersonen. Wie vielfältig die Jugendlichen dabei agieren erscheint fast phänomenal. Dazu im späteren Kapitel 5 zu Jugend und Medien eingehender.
3 Sozialerziehung
„Alle Tugenden sind individuell, alle Laster sozial.“ (Franz Kafka, Schriftsteller, 1883 – 1924, Aufzeichnung aus dem Jahre 1920, Er)
3.1 Definition des Begriffs Sozialerziehung
Um ein Verständnis für die Dimension von Sozialerziehung zu bekommen und daraus ableitende Arbeitsaufträge zu definieren, muss vorerst der Begriff der Sozialerziehung betrachtet werden. Aus der Komplexität des Begriffs ´Sozialerziehung´ definiert Hans Hielscher: „Sozialerziehung zielt auf den Erwerb von Fähigkeiten, die den Kindern – und später den Erwachsenen – erlauben, in der sozialen Umwelt kompetent zu leben und sie kritisch mitzugestalten.“ (Hielscher, 1975 zit. nach Knoll-Jokisch, 1981, S. 92) Daraus wird ein sehr weitläufiges und individuell interpretierbares Konzept deutlich. Konsens besteht in dem pädagogischen Auftrag der Vermittlung von sozialen Kompetenzen für Kinder und Jugendliche. „Zu den Zielen der Sozialerziehung gehören beispielsweise Perspektivübernahmen, Empathie, Kommunikation, Konfliktlösung und Verantwortungsübernahme. Sie werden größtenteils normativ festgelegt und sind damit im gewissen Sinne einem kulturabhängigen Aushandlungsprozess unterworfen.“ (Nifbe, 2012) Der Begriff Sozialerziehung, begründet aus der Gesamtschul- und Kinderladenbewegung in den 60er und 70er Jahren, untersteht oft der Kritik der Erwartung an eine allgemeingültige Anpassungsleistung (Vgl. ebd.), die dem individuellen Charakter eines Kindes mit seinen persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen nur schwer gerecht werden kann. Individualität hat sich kollektiven Normen unterzuordnen. Dem folgte der Begriff des sozialen Lernens, der neben der Sozial- auch die Selbstkompetenz von Mädchen, Jungen und Queers in den Fokus nimmt. Er ist die modernere Ausdrucksform des, neben dem familiären, institutionellen Bildungs- und Erziehungskonzeptes. Familie, Kindergärten und Schulen aber auch außerschulischen Institutionen der Jugendbildung kommt dabei elementare Bedeutung zu. Soziales Lernen findet in sozialen Räumen statt. Dort wo Menschen miteinander kommunizieren, interagieren und Wissen austauschen. Demnach ist auch das Internet eine soziale Umgebung und innerhalb eines Lernkontextes, ein Ort sozialen Lernens.
3.2 Sozial- und Selbstkompetenz
Die Erlangung von Kompetenzen ist vergleichbar mit der des Wissens: Wissen, das sich das Individuum durch aktive Prozesse der Wahrnehmung, Interpretation und Verarbeitung aneignet, lässt sich durch günstige Bedingungen verstärken. Zentral ist dabei das Individuum mit seinen inneren und äußeren Ressourcen (Vgl. Lehmann/ Nieke). Das entwickeln einer Selbstkompetenz umfasst dabei das Vertrauen in das eigene Handeln, die Wahrnehmung und auch die Akzeptanz eigener Gefühle, insbesondere auch negativer. Kann ich negative Gefühle bei mir nicht akzeptieren, so werde ich diese auch nicht bei meinem Gegenüber zulassen können. Selbstkompetenz ist dabei and die Entwicklung einer Ich-Identität gebunden, die wie zuvor beschrieben durch das Geschlecht, das soziale und biographische Umfeld beeinflusst wird. Das Selbstwertgefühl, die Selbstbehauptung, der Ausdruck von Gefühlen, die Neugier an sich und dem Umfeld sind dabei entscheidende Komponenten. Die Entwicklung einer Selbstkompetenz steht unmittelbar in Verbindung zur sozialen Kompetenz. Beide Kompetenzen entwickeln sich in konstanter Interaktion zueinander. Die soziale Kompetenz umfasst alle Komponenten der persönlichen Fähigkeiten um von der individuellen in eine gemeinschaftsorientierte Handlung zu gehen. Kommunikations-, Kooperations-, aber auch Konfliktfähigkeit sind erforderlich, um sich kritisch mit sich und seiner Lebenswelt auseinanderzusetzen. „Jeder ist als individuelles Wesen, zugleich auch Glied der menschlichen Gesellschaft, d.h.: der Mensch ist gleichzeitig autonom und interdependent.“ (Knoll-Jokisch, 1981, S. 92) Sozial- und Selbstkompetenz sind Ziele des sozialen Lernens, die sich im ständigen Entwicklungsprozess bewegen und sich deshalb nicht über ein endgültiges Ergebnis definieren lassen.
3.3 Schule
Der Schule „als die größte, differenzierteste und einflussreichste Einrichtung im Bildungsbereich“ (Tillmann, 2010, S. 134) steht eine maßgebliche Rolle in der Sozialerziehung zu. Zwischen dem 06. und dem 16. Lebensjahr ist sie eine verbindliche Institution, die aufgrund der Gesetzeslage von jedem Kind beziehungsweise jedem Jugendlichen in Anspruch genommen werden muss. Mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland besuchen täglich die Schule (Vgl. ebd.). Ihr kommt damit in besonderem Maße ein Bildungs- und (Sozial-)Erziehungsauftrag zu. Unser Schulsystem entstand in einer Zeit, in der Schulklassen aufgrund abgegrenzter gesellschaftlicher Schichten und geschlechtergetrennten Klassen homogen waren. Die Homogenität erschloss sich aus einer bewussten gesellschaftlichen Klassentrennung. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen, der Entwicklung zu einer multikulturellen und globalen Gemeinschaft, wird zunehmend von einer Heterogenität an Schulen gesprochen. Doch statt diese Heterogenität als Chance für die Entwicklung neuer Lernmethoden zu nutzen, wird sie oft im Zusammenhang mit Problemen, kulturellen Konflikten und sozialer Ungleichheit diskutiert. Tillmann führt diese Problematik auf die „scharfen Selektionsprozesse“ (Tillmann, 2006, S. 25). und dem jahrhundertelangen Wunsch der Pädagog*Innen nach „einer homogenen Lerngruppe“ (ebd.) zurück. Die Differenzen von intellektuellen, sozialen und kulturellen Hintergründen von Mädchen, Jungen und Queers an Schulen, erfordern einen differenzierten Blick der Lehrenden. Die schulische Leistungs- und Disziplinorientierung wird den jungen Heranwachsenden mit ihren individuellen Lebensentwürfen nicht mehr gerecht. Bildendes und soziales Lernen ist nur dann ein konstruktiver Prozess, wenn er auf Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden beruht. Methoden, welche die individuellen Fähigkeiten und Motivationen der Schüler*Innen berücksichtigen, sollten die Basis für einen erfolgversprechenden Lernprozess bilden. Die zunehmende Heterogenität in der Schule erfordert daher auch einen individuelleren Bezug. Lernerfahrungen und Lernvoraussetzungen differenzieren sich aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Biographie und Haltung von Mädchen, Jungen und Queers. Statt dem inklusiven Charakter gerecht zu werden, wird jedoch nach wie vor mit Ausgrenzungen durch Sitzenbleiben, Überweisung an Sonderschulen, differenzierten Schulformen und Zurückstellungen vom Unterricht gearbeitet (Vgl. Tillmann, 2006, S. 26). Der Wunsch nach Homogenität in den Schulklassen ist in den organisatorischen Strukturen fest eingebunden. Doch was bedeutet diese frühe Erfahrung der Selektierung für das soziale Lernen der Schüler*Innen? Wer soziale Vorteile besitzt, sei es kultureller oder intellektueller Herkunft, wird gefördert. Wer jedoch aus einem sozialschwachen Milieu stammt, wird herabgestuft, für diese Schüler*Innen wird Bildung und die Förderung des sozialen Lernens stark limitiert. Wie entwickelt sich Sozial- und Selbstkompetenz, wenn Schüler*Innen frühzeitig Defizite wie ´lernschwach´ und ´verhaltensauffällig´ attestiert werden? Die kategorische Sozialisation beginnt bereits im frühen Kindesalter und verläuft in der Regel fast zielgerade bis in das Erwachsenenalter. Die soziale Zusammensetzung von Klassen, seien es Hauptschul-, Realschul- oder Gymnasialklassen sind stark an das soziale Milieu gebunden. Der Sohn aus einer Akademikerfamilie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Gymnasialklasse wiederzufinden sein, während die Tochter aus einer bildungsfernen Familie wahrscheinlich den Weg über die Hauptschule hinaus nie beschreiten wird. Die Diskrepanzen sozialer Herkunft reflektieren sich natürlich in der schulischen Laufbahn, jedoch fast schon in einer stereotypischen und systemübergreifenden Weise, die dem Anspruch des sozialen Lernens nur sehr begrenzt gerecht werden kann. Permanente Erfahrungen von Versagen, Nichtkönnen und Ausschluss wirken sich gleichermaßen wie Bestätigung und Anerkennung auf das soziale Lernen aus. Anhand der Daten aus der Schulleistungsstudie PISA 2000 werden bedenkliche Fakten deutlich: „Fast 40% der deutschen Schüler/innen machen zwischen der ersten und der 10. Klasse mindestens einmal die Erfahrung, von ihrer Lerngruppe aufgrund angeblich mangelnder Fähigkeiten ausgeschlossen zu werden. [...] An Hauptschulen sind es fast 2/3 der Heranwachsenden, aber auch an Realschulen immer noch 43% die mindestens einmal solch ein Schulversagen zu verkraften hatten. Nur an Gymnasien findet sich mit 16% ein anderes Bild“ (Tillmann, 2006, S.32). Demnach ist das soziale Lernen immer auch an Leistung gebunden und die Gefahr von Misserfolgen und Krisen für leistungsschwächere Schüler*Innen größer. Soziale Ungleichheiten entscheiden über den schulischen Erfolg oder Misserfolg von Mädchen, Jungen und Queers. Die Sozialerziehung könnte demzufolge in Unter-, Mittel- und Oberschicht klassifiziert werden und mündet statt in der Chance von interkulturellem Lernen und Heterogenität, in einer vorstrukturierten und vermeindlichen Homogenität. Ambitionen und Motivationen entwickeln sich in der Regel innerhalb einer sozialen Verbundenheit mit Gleichgesinnten, aus einem Gruppengefühl und Zugehörigkeit. Es mag daher nicht verwundern, dass die Motivation zum Lernen aufgrund der defizitbasierten Klassifizierung bei Schüler*Innen in Haupt- und Sonderschulen um ein Deutliches geringer ist als auf Real- und Gymnasialschulen. Ein Kind, dem einmal eine Lernschwäche diagnostiziert wurde, lässt sich nur schwer auf neue intellektuelle Herausforderungen ein. Sozial- und Selbstkompetenz entwickeln sich, wie zuvor beschrieben, in konstanter Interaktion zueinander. Schulen und Klassen, die jedoch fast homogen erscheinend in ´leistungsstark´ und ´leistungsschwach´ unterteilt sind, beeinflussen und limitieren damit nicht nur den Bildungsauftrag, sondern vielmehr auch den Anspruch des sozialen Lernens und damit die Perspektiventwicklung von Mädchen, Jungen und Queers.
[...]
1 Queer ist aus einer politischen Bewegung Ende der 80-ger Jahren zu einem Synonym für alle Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen geworden, die nicht der Heteronormativität entsprechen.
2 Das reale soziale Milieu kann auf physischer aber eben auch auf digitaler Ebene stattfinden. In diesem Fall beziehe ich mich auf das physisch-reale Umfeld.
3 Alle hier aufgeführten Namen sind geändert und rein fiktiv.
- Arbeit zitieren
- Diana Miller (Autor:in), 2019, Social Media und die Identitätsbildung bei Jugendlichen. Chancen und Herausforderungen in der soziokulturellen Arbeit mit Mädchen, Jungen und Queers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461749
Kostenlos Autor werden





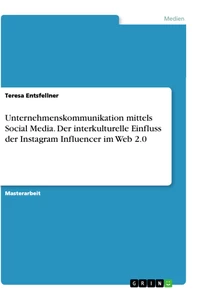














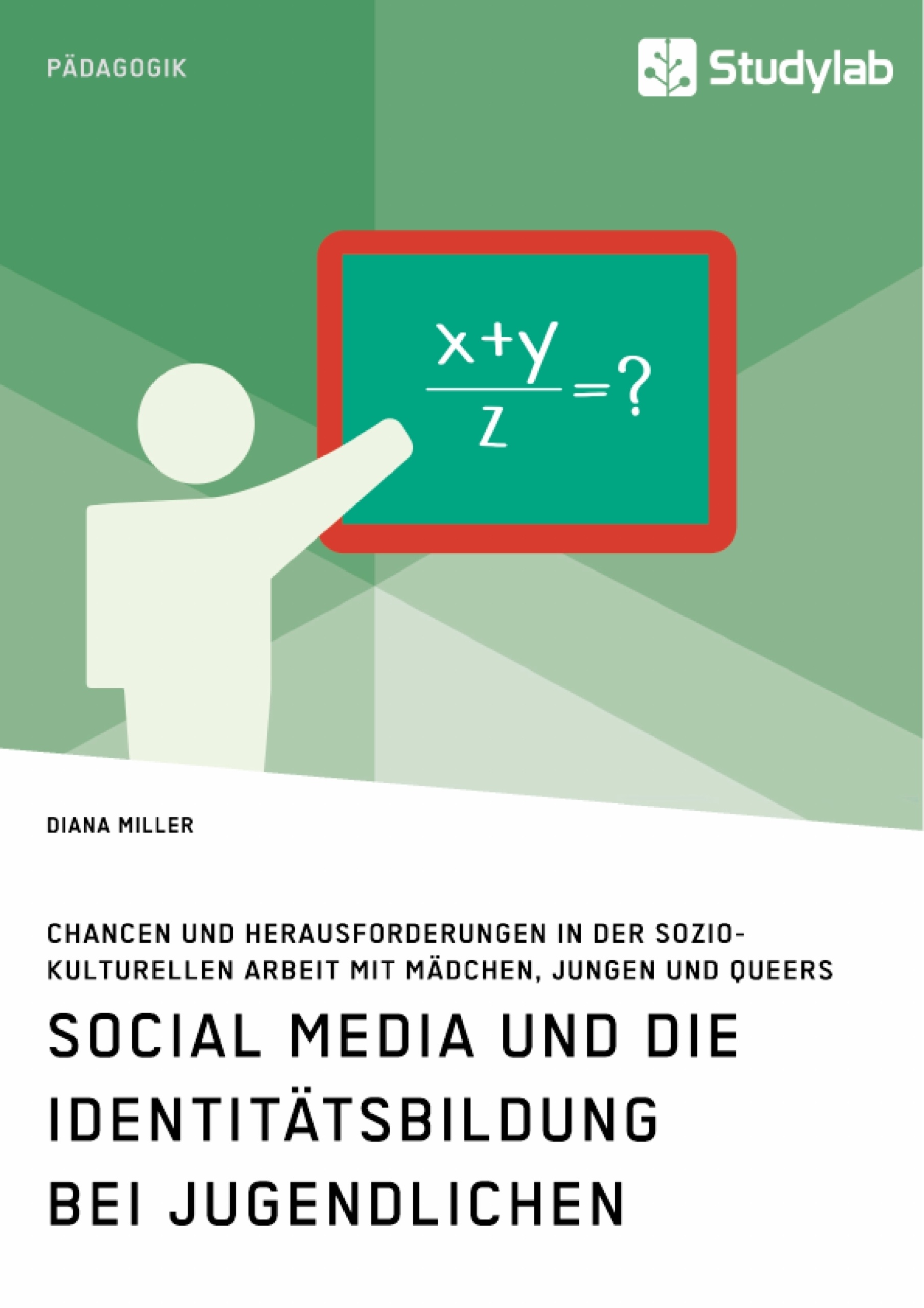

Kommentare