Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Schweizer Eigenart: verfassungsmäßige Besonderheiten und deren Folgen
3. Parlamentswahlen und Gesamterneuerung des Bundesrates 2003
3.1 Die Ergebnisse der Nationalratswahlen vom 19. Oktober 2003
3.2 Die Neukonstituierung des Bundesrates nach einer neuen Zauberformel
4. Uno anno post: Eine Zwischenbilanz zu Blochers Arbeit im Bundesrat
4.1 Blocher - nur einer unter sieben Exekutivräten?
4.2 Blocher - der „halboppositionelle Regierungsrat“
4.3 Der Bundesrat am Ende? - Zur Befangenheit des Regierungsorgans
5. Das Konkordanzsystem: Ein Auslaufmodell?
6. Schlussbetrachtung
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die deutsche Öffentlichkeit erlebt den politischen Alltag in der Bundesrepublik nicht selten als eine Agglomeration unpopulärer Entscheidungen und haarspalterischer Partei- fehden. Scheinbar regelmäßig opfern die konkurrierenden Parteien in ihren Positionsbe- zügen das für das Gemeinwohl langfristig Sinnvolle dem kurzfristig Nützlichen: näm- lich dem raschen Wahlerfolg. Schuldig für diese Misere werden zunehmend die Legiti- mations- und Steuerungsdefizite unseres repräsentativen Systems gesprochen. Forde- rungen nach einem Ausbau plebiszitärer Elemente werden laut.1 Dabei mag der eine o- der andere neidvoll auf unseren südlichen Nachbarn blicken: Die Schweiz ist traditionell eine halbdirekte Konkordanzdemokratie. Die direktdemokratischen Elemente2 sind dort ebenso fester Bestandteil des politischen Lebens wie die Proporzpolitik.
Meist entbehrt solch ein ekstatischer Blick auf das eidgenössische Konsensprinzip einer weitergehenden Analyse der Bedingtheiten des politischen Systems der Schweiz. Schließlich lässt sich das von uns nicht selten als exotisch verklärte schweizerische „Aushandlungsverfahren“ auf politisch-institutionelle wie auch kulturell-historische Spezifika zurückführen, wie sie in Deutschland jeher nicht gegeben und auch nicht rea- lisierbar sind. Um dieser Eindimensionalität vorzubeugen sowie als elementares Funda- ment für die folgenden Untersuchungen sollen im zweiten Kapitel zunächst die schwei- zerischen Besonderheiten im Überblick und ohne Anspruch auf Vollständigkeit illust- riert werden.
Die unter Kapitel 2 benannten „Eigenarten“ des eidgenössischen Konkordanzsystems haben mehrheitlich seit vielen Jahrzehnten Bestand. Doch das scheinbar harmonisch- kooperative Politikidyll der Schweiz steckt in einer tiefen Krise. Noch nie ist das politi- sche System so großen Belastungen und gewichtigen Veränderungen ausgesetzt worden wie gegenwärtig: die Zauberformel wurde 2003 aufgrund sich verändernder Wähler- stimmenanteile der nationalen Parteien modifiziert, die traditionellen Wählerbindungen nehmen stetig ab, die modernen Massenmedien bieten den Politikern neue Möglichkei- ten zur Profilierung, die schweizerischen Nachbarstaaten befinden sich in einem tief- greifenden Europäisierungsprozess, et cetera. Angesichts dieser einschneidenden Ver- änderungen der systembedingenden Faktoren stellt sich zunehmend die Frage, ob und wie lange die Schweizer Techniken des „gütlichen Einvernehmens“ (amicabilis compo- sitio) noch zeitgemäß und realisierbar sind. Diese Frage soll das zentrale Motiv des vor- liegenden Aufsatzes sein. Hierzu gilt es, die relevanten Tendenzen differenziert zu un- tersuchen. Ausgangspunkt dieser Analyse sei ein Blick auf die letzten Nationalratswah- len 2003 und die im selbigen Jahr erfolgende Neukonstituierung des Bundesrates unter Variation der altbekannten „Zauberformel“ (Kapitel 3). Über die veränderte Regie- rungszusammensetzung hinaus resultierten aus dieser politischen Zäsur vermeintlich weitreichende Folgen für die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die Arbeitsweise des Exekutivorgans. Denn mit der Wahl des ebenso charismatischen wie umstrittenen SVP- Übervaters Christoph Blocher zum Neubundesrat wird das Konkordanzprinzip im All- gemeinen und das Kollegialitätsprinzip im Besonderen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Kapitel 4 bilanziert das Wirken und Schaffen Blochers im ersten Jahr als Regie- rungsrat: Wo konnte er inhaltliche Schwerpunkte setzen (4.1), inwiefern hat er sich den kollegialen Gepflogenheiten der Regierung bei- und untergeordnet (4.2)? Unter 4.3 soll die markant hohe Zahl der im Jahr 2004 vom Volk verworfenen behördlichen Abstim- mungsvorlagen thematisiert werden. Davon erhofft sich der Autor verallgemeinerbare Erkenntnisse über das Integrations- und Kompensationsvermögen des Schweizer Kon- kordanzsystems, insbesondere des kollegialen Bundesrates. Sollte sich nämlich abzeich- nen, dass die Institutionen des Status quo mittel- und langfristig nicht zur Bewältigung der aktuellen Krisenerscheinungen fähig sind, dürfen tiefgreifende systemimmanente, aber auch systemverändernde Reformmaßnahmen nicht tabuisiert werden (Kapitel 5). Abschließend sind prognostisch die Realisierungschancen relevanter Reformansätze zu erörtert.
2. Die Schweizer Eigenart: verfassungsmäßige Besonderheiten und deren Folgen
Als sich in den siebziger Jahren auf dem Feld der Politikwissenschaft endgültig die Auf- fassung durchsetzte, dass die Konkordanzdemokratie einen eigenständigen Demokratie- typus klassifiziert (siehe hierzu Lehmbruch 1967, Lijphart 1977 und andere), hatten die meisten Proporzsysteme - die vornehmlich in Kleinstaaten anzutreffen waren - bereits ein jähes Ende gefunden.3 Allein die Schweiz blieb bis dato als einzige reine Verhand- lungsdemokratie über. Die Stabilität der helvetischen Politik gründet sich auf verschie- dene politisch-institutionelle wie auch kulturell-historische Aspekte, die teilweise den wegweisenden Definitionskriterien einer „consociational democracy“ nach Lijphart ge- nügen (1977: 25-47: „grand coalition“, „mutual veto“, „proportionality“, „segmental au- tonomy and federalism“), aber auch teilweise über diese hinausgehend die „Schweizer Eigenart“ charakterisieren.
Eine erste wichtige Bedingung für den Schweizer Korporatismus ist der ausgeprägte Föderalismus. Braun (2003: 58-84) stellt im Vergleich mit Deutschland die wesentli- chen Merkmale des schweizerischen Föderalismus heraus. Erstens bewahrten sich die Kantone ihre Identität und weitgehende Autonomie durch die Vermeidung jeglicher bundesstaatlicher Penetration („dezentraler Föderalismus“). Die „typisch schweizerische Lösung bestand nicht darin, den Staatsapparat auszubauen, sondern die Aufgaben zu de- legieren“ (Armingeon 2001: 405). Während sich die Deutschen als zusammengehörige „Kulturnation“ begriffen und beispielsweise die Rechtsvereinheitlichung als Symbol na- tionaler Einheit feierten, sahen sich die Schweizer aufgrund ihrer Heterogenität nie als Einheit, sondern gingen die eidgenössische Bindung (siehe Art. 1-3 BV) allein aus Gründen sicherheitspolitischer Notwendigkeit ein. Im Gegensatz zu den mehrheitlich ar- tifiziellen deutschen Bundesländern bieten die historisch erwachsenen Schweizer Kan- tone ein hohes Identifikationspotential. Der schwache Zentralstaat bedingt eine stark sektional und kantonal gegliederte Struktur auch der auf nationaler Ebene agierenden Parteien. Zweitens sind die Stände im Gegensatz zu den deutschen Ländern kein Veto- Instrumentarium in der Politikformulierung. Denn nicht beim Gesetzesentscheid des Bundesparlaments, sondern erst im Vollzugsstadium des entsprechenden Bundesgeset- zes auf kantonaler Ebene können sie ihre Positionen gewinnbringend in die Waagschale werfen (Implementation).4 Ebenso entscheidend ist die Tatsache, dass die Ständerats- mitglieder direkt gewählt und mit freiem Mandat ausgestattet werden und somit nicht gegenüber der jeweiligen Kantonalregierung weisungsgebunden sind. Die fehlende Ve- tomacht der Kantonsregierungen sowie die weitgehende ständische Autonomie in der Implementation bedingt drittens die Überwindung des - typisch deutschen - föderalisti- schen „Strukturkonservativismus“ (Braun 2003: 72): Unvorhersehbare, vom territorialen
Auch in den Niederlanden löste sich die „Versäulung“ zunehmend auf und ließ 1967 eine Wende zur Konkurrenzdemokratie erfolgen (Lijphart 1975: 196-219).
Interessengleichgewicht abweichende (Konsens-)Lösungen erscheinen möglich. Lehm- bruch (1967: 28, 45; 1992: 207) bemerkt zudem, dass die politische Kultur in der Schweiz weniger sachrational ausgerichtet ist als in Deutschland oder Frankreich und dadurch themenfremde Maßnahmen als Junktim gekoppelt werden können. Viertens und letztens stehen die einzelnen Schweizer Kantone vor allem aufgrund ihrer Steuergesetz- gebungskompetenz im Wettbewerb zueinander. Der Länderfinanzausgleich strebt hier - im Gegensatz zu Deutschland - nicht die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingun- gen in allen Teilstaaten an, sondern dient lediglich der Sicherung kantonaler Eigenstän- digkeit.
Wesentliches Merkmal der „Schweizer Eigenart“ ist die kulturelle Vielfalt des relativ kleinen Landes, die sich allein schon in der Existenz von vier offiziellen Landesspra- chen zu erkennen gibt. Neben der Sprachkultur5 existieren weitere Spannungsfelder (Konfession, Zentrum-Peripherie, Ökonomie,…), deren Grenz- und Konfliktlinien sich aber im Gegensatz zu anderen pluralistischen Gesellschaften wie Belgien oder Kanada zumeist nicht überlagern, weshalb auch keine zentrifugalen Kräfte wirken, die zu Polari- sierungen oder gar Abspaltungen führen könnten (Braun 2003: 64). Der starke Schwei- zer Sektionalismus hat zur Folge, dass es keine organisierten Interessen mit nur annä- hernder Mehrheitsfähigkeit gibt (Lehmbruch 1967: 37). Dies macht eine Interessenalli- anz erforderlich, die Lutz und Vatter (2000: 70) als den „Schlüssel zum friedlichen Zu- sammenleben“ beschreiben und mit den folgenden zentralen Prinzipien besetzen: pro- portionale Vertretung, politische Integration sowie breit abgestützter Kompromiss.
Zur proportionalen Vertretung der kulturellen und Interessengruppen dient das Schwei- zer Proporzprinzip, nach dem bei der Vergabe öffentlicher Ämter die einzelnen Grup- pierungen oder Parteien anteilig entsprechend ihrer Bedeutung berücksichtigt werden (Lehmbruch 1992: 207). Darüber hinaus erfolgt die Zusammensetzung der Schweizer Bundesregierung seit 1953 nach einem festen Verteilungsschlüssel, der sogenannten „Zauberformel“, die 2003 geringfügig modifiziert wurde. Sie gründet sich auf einen breiten Konsens, der ihren Fortbestand sichert. Denn verfassungsrechtlich verankert ist die Zauberformel nicht. Die Berufung der Kantonsregierungen erfolgt dagegen übli- cherweise durch das Majorzwahlverfahren. Dieses Wahlverfahren hat auch dann Gültig- keit, wenn die jeweilige Kantonsverfassung keine explizite Regelung trifft. Soll das Pro- porzwahlverfahren Anwendung finden, ist dies ausdrücklich in der Ständeverfassung zu regeln - so geschehen in den beiden Kantonen Zug (§ 78, seit 1894) und Tessin (Art .66, seit 1997). Im ebenfalls traditionellen Proporzsystem der Bundesrepublik Österreich findet sich das Proporzwahlverfahren in den Verfassungen aller Gliedstaaten, ausgenommen der Landesverfassung Vorarlbergs, wieder. Eine Sonderregelung enthält die Wiener Landesverfassung.6 Zurückzuführen ist das Proporzverfahren auf die aristokratischen Stadtregierungen, in denen zumeist alle bedeutenden Geschlechter in die Entscheidungsfindung eingebunden worden sind (Lehmbruch 1967: 17).
Historisch bedingt verfügt die Schweiz über stark ausgeprägte direktdemokratische E- lemente.7 Dieser Umstand mag sich auf die von Rousseau im „Contrat Social“ geäußerte Idee einer identitären Demokratie zurückführen lassen. Dementsprechend entstanden die Parteien im 19. Jahrhundert auch nicht aufgrund der Initiative eines elitären Zirkels, sondern als Folge der pragmatischen Überlegung, durch gemeinsames und koordiniertes Auftreten das direktdemokratische Potential einer Interessengruppe optimal nutzbar ma- chen zu können (Gruner 1977: 25 f). Vor allem für kleinere Parteien bieten die weitrei- chenden Volksrechte ein Reservoir zur politischen Integration, können aber auch von einer minoritären Opposition als Veto-Instrument genutzt werden (Möckli 1994: 239): Beispielsweise bedarf es bei - in der Schweiz nicht seltenen - Volksabstimmungen über die (Teil-)Revision der Bundesverfassung8 (obligatorisches Referendum) nicht nur der absoluten Mehrheit des Volkes, sondern auch derjenigen der Stände (Vatter 1997: 747 f). Da die Bevölkerungszahlen zwischen den Ständen teilweise stark variieren, vermag eine ausgewählte Ständeminderheit den Mehrheitswillen des Volkes zu unterminieren. Aufgrund der intensiven Nutzung des breiten Arsenals direktdemokratischer Instrumen- te, des daraus resultierenden Veto- und Blockadepotentials und der damit einhergehen- den Unvorhersehbarkeit der Folgen politischen Handelns erwuchsen „institutionalisierte Konkordanzzwänge“9, die die „Referendumsdemokratie“ im Laufe der Zeit zur
„Verhandlungs- und Konkordanzdemokratie“ transformiert haben (Lutz/Vatter 2000: 70). Anders als in Belgien, Österreich und den Niederlanden basiert das Schweizer Ver- handlungsprinzip also nicht nur auf einem freiwilligen Agreement politischer Eliten, sondern ist der fortlaufenden Integration referendumsfähiger Oppositionskräfte geschul- det. So haben beispielsweise schweizerische Interessenverbände die im europäischen Raum einmalige Möglichkeit, mittels Volksabstimmung (Verfassungsinitiative) auf den Inhalt der Verfassung direkten Einfluss zu nehmen (Armingeon 2001: 411). Um dem vorzubeugen werden ihre Positionen bereits im Vernehmlassungsverfahren, einer Art Vorverfahren der Gesetzgebung, korporativ berücksichtigt. Deshalb findet sich der eid- genössische Korporatismus auch in nicht originär politischen Gesellschaftsbereichen wie Wirtschaft und Religion wieder (ausführlicher bei Lehmbruch 1967: 54-57). Durch dieses starke Potential außerparlamentarischer Opposition reduziert sich der Einfluss po- litischer Parteien: Sie verlieren ihr „Transmissionsmonopol“ (Steppacher 2003: 69). Aus diesen institutionellen Bedingungen resultieren gleichermaßen die dauerhafte Stabilität des Schweizer Konkordanzsystems einerseits und die offensichtliche Unrealisierbarkeit eines Konkurrenzmodells andererseits (vergleiche Kapitel 5).
Die Beteiligung von Minderheiten an exekutiven Entscheidungsprozessen beruht auf Kompromisstechniken, die der „amicabilis compositio“ der schweizerischen und deut- schen Religionsfriedensschlüsse des 17. und 18. Jahrhunderts ähneln (Lehmbruch 1992: 207). Ironisierend bemerkt Gruner (1977: 18), dass „selbst die Revolution in der Schweiz konstitutionelle Formen“ angenommen habe. Das Proporzprinzip im schweize- rischen Bundesrat zielt auf die Beteiligung aller wichtigen Minderheitengruppen an der Regierung, um die potentiell destabilisierende Fragmentierung der politischen Kultur zu überbrücken. Neben dem Partei- sind auch der Sprach- und Regionalproporz zu berück- sichtigen. Steppacher (2003: 71) sieht deshalb den „wunderbaren Zauber“ der „Zauber- formel“ darin begründet, dass es immer sieben ausreichend qualifizierte Politiker gibt, die den erforderlichen Kriterien für die Zusammensetzung der Regierung genügen.
Anders als in Österreich zu Zeiten der Großen Koalition (von ÖVP und SPÖ) ist die schweizerische Konkordanzdemokratie den „Weg der formalen Ausschaltung des Mehrheitsprinzips“ in der Regierung nicht gegangen (Lehmbruch 1992: 207), da hier nicht zwei, sondern vier Regierungsparteien existieren (SVP, FDP, CVP, SP).10 Der ständige Wechsel von Mehrheiten hat den systemstabilisierenden Nebeneffekt, dass es keine permanenten Minderheiten gibt, sondern sich die erforderlichen Mehrheiten zu- meist ad hoc in Verhandlungen ausbilden.11 Entsprechend dem Kollegialprinzip haben alle Bundesräte die von der Ratsmehrheit erarbeiteten Standpunkte gegenüber der Öffentlichkeit zu verantworten (Art. 177 Abs. 1 BV). Formalisierte Koalitionsvereinbarungen zwischen den Parteien nach dem Muster von Konkurrenzdemokratien wie Deutschland existieren in der Schweiz nicht, woraus eine gewisse Doppelidentität der Bundesratsparteien resultiert: Sie verstehen sich teilweise als Regierungs- und teilweise als Oppositionskraft (Lutz/Vatter 2000: 71).
Ein kurzes Fazit zum eidgenössischen Konkordanzsystem könnte wie folgt lauten: Die Praxis des „gütlichen Einvernehmens“ hat in der Schweiz tiefe traditionelle Wurzeln und ist zudem auf breiter Ebene (soll heißen: in vielen Gesellschaftsbereichen) verankert. In der Neuen Züricher Zeitung (10./11.04.2004, S. 7) heißt es: „Konkordanz ist keine ‚Institution’, sie ist ein Prozess“, der sich ohne kooperationswillige Partner von ganz alleine entzaubert. Diese Aussage mag prinzipiell stimmen, doch lässt sie für den Schweizer Sonderfall folgenden pragmatischen Aspekt außer Acht: Durch die direktdemokratischen Elemente des eidgenössischen Regierungssystems, die in solch einer Fülle in keiner anderen (ehemaligen) Konkordanzdemokratie anzutreffen sind, wird der Korporatismus quasi-institutionell bedingt (siehe Anmerkung 9).
3. Parlamentswahlen und Gesamterneuerung des Bundesrates 2003
3.1. Die Ergebnisse der Nationalratswahlen vom 19. Oktober 2003
Die am 19. Oktober 2003 erfolgten Nationalratswahlen brachten für die Bundesratspar- teien folgende Ergebnisse: SVP 26,7 %, SP 23,3 %, FDP 17,3 %, CVP 14,4 %.12 Mit Ausnahme der GPS (von 5 % auf 7,4 %) haben die Nichtregierungsparteien kollektiv an Boden verloren. Die Extrem- und Protestwähler konnten zu großen Teilen von SVP re- spektive SP geworben werden, so dass die Regierungsparteien gemeinsam einen beacht- lichen Wählerstimmenanteil von 81,7 % auf sich vereinen können. Dies kann entweder von einem hohen Vertrauen in die Regierungsparteien zeugen oder auch nur Ausdruck von Alternativlosigkeit aufgrund der relativ starren und traditionell gefestigten Zauber- formel sein.
[...]
1 Dies gilt nicht erst seit der europaweit intensiv geführten Debatte über eine nationale Volksabstimmung zur EU-Verfassung, wie sie im Jahr 2005 beispielsweise in Spanien (20.02.) erfolgt ist sowie in Frankreich (voraussichtlich im Mai) und anderen Staaten, nicht aber in Deutschland, noch aussteht.
2 Zwar offeriert auch das Grundgesetz entsprechende Möglichkeiten der Volksbeteiligung (Volksbegeh- ren, -entscheid, -befragung), doch unterscheiden sich diese maßgeblich von dem in der Schweizer Ver- fassung festgeschriebenen direktdemokratischen Elementen: Das deutsche Recht auf Volksabstimmung bedingt eine vorangehende Initiative der Parlamentsmehrheit („Tyrannei der Mehrheit“) und ist zudem nur für die Neugliederung der Länder (Art. 29 GG) obligatorisch, während beispielsweise beim schweizerischen fakultativen Referendum eine Minderheit „von unten“ die Initiative ergreifen und die Gesetzesvorlage zum Scheitern bringen kann (zur grundlegenden Typologisierung direkter Demokratien siehe Smith 1976, ebenso Jung 1996: 634).
3 In Österreich endete 1966 die Große Koalition (Pelinka 2003: 543), der Libanon versank im Bürger- krieg und in Belgien erhielt der Sprach- und Kulturkonflikt zwischen den niederländischsprachigen Flämen und den frankophonen Wallonen in den 60er Jahren eine neue Qualität (Germann 1994: 81 f).
4 Obgleich die Kompetenzzuteilung zwischen den vertikalen Ebenen wie in Deutschland nicht immer eindeutig geregelt ist. Die NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwi- schen Bund und Kantonen), die voraussichtlich 2008 in Kraft tritt, soll die Zuständigkeiten von Bund und Kantonen klarer verteilen.
5 Zum „Röstigraben“ siehe Büchi (2001).
6 Die Informationen zur verfassungsmäßigen Verankerung der kantonalen Regierungsbildung entstammen Mailkontakten mit den betreffenden österreichischen und schweizerischen Stellen (Bundesamt für Justiz, Bern; Bundesministerium des Innern, Wien).
7 Die direktdemokratischen Traditionen haben dem Aufkommen eines Berufsbeamtentums lange Zeit entgegengewirkt (Lehmbruch 1967: 42).
8 Nicht mehr ganz aktuell aber dennoch eindrucksvoll sind die Zahlen, die Germann (1994: 121 f) präsen- tiert: demnach sei seit Inkraftsetzung der Verfassung 1874 bis etwa 1985 durchschnittlich alle elf Mo- nate eine Partialrevision der Bundesverfassung erfolgt. Dies ist maßgeblich auf die „Überfrachtung“ der Verfassung mit „gewöhnlichen“ Gesetzen zurückzuführen, die beispielsweise in Deutschland aufgrund ihres spezifischen Inhalts keine Chance auf Verfassungsstatus hätten.
9 M.E. nicht ganz korrekt spricht Germann (1994: passim) von „institutionellen Konkordanzzwängen“. Denn die reinen Institutionen als solche - zum Beispiel der Bundesrat - bedingen aus verfassungsrecht- licher Perspektive noch keine Konkordanzprinzipien, sondern haben vielmehr aufgrund der direktde- mokratischen Rahmenbedingen ihren Proporz- und Korporationscharakter erfahren (vergleiche hierzu die verfassungsrechtlichen Konkordanzbestimmungen auf kantonaler Ebene, siehe oben). Diese Rah- menbedingungen waren derart nachhaltig und alternativlos, dass sie die Konkordanzprinzipien praktisch institutionalisierten, man also von „institutionalisierten Konkordanzzwängen“ sprechen müsste.
10 Gemäß den Nationalratswahlergebnissen 2003 vereinigen die vier Regierungsparteien 81,7 % der Wählerstimmen auf sich.
11 Der Nachteil dieses Exekutivverfahrens ist der langwierige Verhandlungsprozess, der durch den födera- len Charakter der Schweiz noch zusätzlich verzögert wird. Als Ergebnis steht nicht selten ein Minimal- konsens.
12 Dazu im Vergleich die Wählerstimmenanteile bei der Nationalratswahl 1999: SVP 22,5 %, SP 22,5 %, FDP 19,9 %, CVP 15,9 %; Zahlen laut Bundesamt für Statistik, <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/ de/index/themen/politik/wahlen/blank/kennzahlen0/national_rat/parteienstaerke.html> (Stand: 19.02. 2005).
- Arbeit zitieren
- Matthias Hansen (Autor:in), 2005, Quo vadis, Helvetia? Die Schweiz am Scheideweg zwischen Konkordanz und Konkurrenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45876
Kostenlos Autor werden






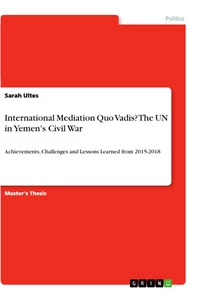






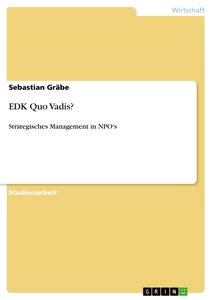
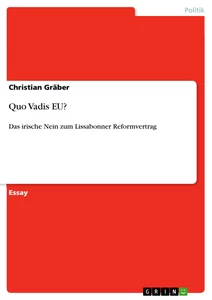







Kommentare